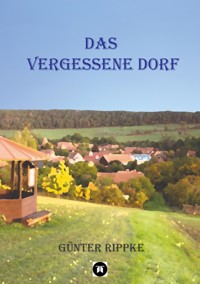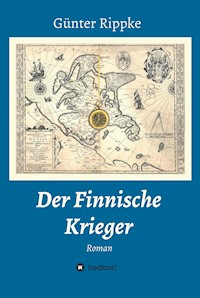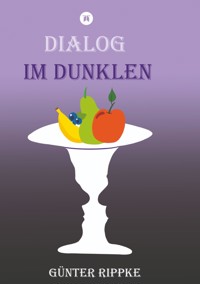
15,99 €
Mehr erfahren.
Ein bislang wenig erfolgreicher an den Rollstuhl gebundener junger Mann, der seine Befähigung für die Arbeit mit Jugendlichen verbessern möchte, sieht den hierfür richtigen Weg in der Erweiterung seiner psychologischen Kenntnisse. Von dem nur theoretischen Lehrstoff ist er jedoch bald enttäuscht. Die Psychothereapie dagegen scheint ein praktisches Konzept zu bieten. In der Hoffnung so vielleicht auch von seinem körperlichen Leiden befreit zu werden, begibt er sich in Therapie. Dabei gerät er in zahlreiche unerwartete Situatione und Schwiegkeiten, die ihn an die Grenze seiner Möglichkeiten führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
www.tredition.de
Günter Rippke
Dialog im Dunklen
Psychologischer Roman
www.tredition.de
© 2023 Günter Rippke
Umschlag und Layout: G. & A. Rippke
Cover-Zeichnung: Astrid Rippke
Softcover
978-3-384-07092-0
E-Book
978-3-384-07093-7
Druck und Distribution im Auftrag: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1: Die Stadt
Kapitel 2: Das Große Haus
Kapitel 3: Das Kleine Haus
Kapitel 4: Angelika
Kapitel 5: Das Therapieseminar
Kapitel 6: Wechselspiele
Kapitel 7: Das Zimmer
Kapitel 8: Der Kamin
Kapitel 9: Der Morgen
Kapitel 10: Der Plan
Dialog im Dunklen
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1: Die Stadt
Kapitel 10: Der Plan
Dialog im Dunklen
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
KAPITEL 1: DIE STADT
Hannes Rebhan war 36, als er sich entschloss, seine Arbeit als erfolglos aufzugeben und neu zu studieren. Er hatte einige Jahre jüngere und ältere Schüler in verschiedenen Fächern unterrichtet, ganz wie es kam, obwohl er keine abgeschlossene Ausbildung vorweisen konnte. Das Leben – oder richtiger doch: ein pädagogisches Fehlverhalten – hatte ihn dann aber in eine Position gebracht, dass er sich in ein Heim für verhaltensauffällige Jugendliche versetzt sah. Er akzeptierte die neue Lage als Aufgabe, seine pädagogischen Befähigungen zu vervollkommnen; er fühlte sich aber auch erleichtert, dass eine doppelt unangenehme Situation auf diese Weise hinter ihm versank, denn zur gleichen Zeit war auch seine Ehe in die Brüche gegangen.
Die neue Stelle hatte er nicht sogleich antreten können. Eine unerklärliche Lähmung der Beine machte ihm zu schaffen und erforderte ärztliche Maßnahmen, die allerdings zu keiner Lösung führten; man stufte ihn schließlich als dauerhaft schwerbeschädigt ein. Die Heimleitung schien aber auch für eine halbe Lehrkraft im Rollstuhl dankbar, zumal durch den neuen Mitarbeiter der elementarste Unterricht gesichert werden konnte, denn der war aus Mangel an geeignetem Personal bisher teilweise ausgefallen.
Die ganze Heimsituation zeigte noch Merkmale eines Neubeginns; die Einrichtung habe sich erst nach der Wende hier angesiedelt, erfuhr er; das Vorgängerheim sei geschlossen worden, weil nach den Ereignissen von 1990 auch die Unterbringung und Betreuung von so genannten Problemjugendlichen neu zu überdenken und zu verändern war.
Verbindliche Vorgaben für die Beschulung in einer pädagogischen Sondereinrichtung lagen nicht vor, doch galt es beim Jugendamt und auch für die Eltern als ein gutes Zeichen, wenn die Jugendlichen während des Heimaufenthalts mit dem offiziellen Schulstoff in Kontakt blieben – wenn dieser auch den spezifischen Bedingungen entsprechend angepasst werden musste.
Nachdem Rebhan die Anfangsschwierigkeiten in der neuen Situation überwunden hatte und die tägliche Arbeit in Routine übergegangen war, fiel ihm auf, dass man auf diesem Gebiet ohne einen entsprechenden theoretischen Hintergrund werkelte. Wie aber sollte man ohne wirkliche Kenntnisse über Verhaltensauffälligkeiten die Ergebnisse erreichen, wie sie von einem Heimaufenthalt erwartet wurden? Zwar ging so hin, was man mit den üblichen pädagogischen Maßnahmen erreichte, mehr erwartete kaum jemand, aber ohne Modellvorstellungen, fand er, sei das alles weder zu verstehen noch zu verbessern; er müsse sich dazu neu qualifizieren.
Während seiner Kurzausbildung hatte er kein Wort von Verhaltensschwierigkeiten gehört; in der klassischen Pädagogik schien das Problem unbekannt zu sein. Aber die Psychologie werde dazu doch etwas sagen können, meinte er. Der Heimleiter betrachtete sein Ansinnen aber als Luxusunternehmen; wer brauchte noch eine private Weiterbildung in Sachen Psychologie, wenn er bereits im Berufsleben stand? Erst nach längerem Bohren genehmigte Borchert ihm einen freien Tag zum Studium als Gasthörer – wenn darunter der Unterricht nicht leide. Er möge das im Lehrerkollegium klären. Möglicherweise war dabei auch Rebhans Gehbehinderung, die ihn an einen Rollstuhl band, zu Buche geschlagen. Denn welches Unternehmen hätte diesbezüglich gerne mit dem Gleichstellungsanspruch gestritten? Die Angelegenheit kam aber auch dem Kollegium etwas verworren vor. Was wolle Hannes damit eigentlich erreichen? Er argumentierte, dass man erkunden müsse, durch welche neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse ihre Arbeit mit den Jugendlichen gestützt werde oder auch zu verbessern sei, und da diesbezüglich in der herkömmlichen Pädagogik offensichtlich nichts bekannt sei, habe er vor, sich in der Psychologie danach umzusehen, zumal das in der Stadt kostenlos und bequem möglich wäre, die Uni könne man sogar mit der Straßenbahn erreichen. Sein Unterricht ließe sich leicht auch auf vier Tage legen. Er bitte nur um eine geringe Änderung des Stundenplans. Kopfschüttelnd ließen sie ihn ziehen.
Rebhan kannte die Stadt nur flüchtig. Viel mehr als den Markt hatte er bisher kaum gesehen; seine Behinderung erlaubte ihm keine weiten Ausflüge, zumal das Areal nicht zu weiten Erkundungen einlud; Jena war wenig behindertengerecht angelegt. Er erinnerte sich eigentlich nur an ein monumentales, von grüner Patina überzogenes Standbild eines Ritters mit Schwert. Im Kollegenkreis erklärte man ihm, dass es sich um die Erinnerung an den Gründer der Universität handle, den ehemaligen Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen, dessen Denkmal man „den Hanfried“ nenne. An diese Auskunft hatte sich ein regelrechter Exkurs in Stadtgeschichte angeschlossen. Fiona, eine ältere Kollegin, die in der Heimschule Geschichte und Erdkunde gab, setzte sich dabei an die Spitze. Jena sei natürlich lange vor Johann Friedrich gegründet worden, führte sie aus, aber erst mit der Universität – der ersten offiziell reformatorischen Hochschule in Deutschland – habe die Stadt an Bedeutung gewonnen.
„Warum wird der neue Charakter so betont?“ fragte er. Fiona wollte zu einer ausführlichen Geschichtsstunde ansetzen, doch das Klingelzeichen zum Unterrichtsbeginn verhinderte den Versuch. Auf dem gemeinsamen Heimweg nahm sie den Faden wieder auf. Sie schob dabei Hannes im Rollstuhl vor sich her – was keineswegs ungewöhnlich war, denn beide wohnten im gleichen Haus. Sie redete wie vor ihrer Klasse: „Der Aufstieg Jenas ist in den Ereignissen nach der Reformation zu suchen. Nicht nur die kirchlichen, auch die weltlichen Machtverhältnisse kamen ins Wanken. Die Bauern erhoben sich schon 1525 gegen ihre Unterdrücker, unterlagen insgesamt aber der Übermacht der Fürsten. Kaum zehn Jahre später gründeten die Sieger selbst ein Bündnis gegen eine Übermacht, die des Kaisers Karl V. Beides hängt ursprünglich mit den Gedanken Luthers zusammen, die mittelalterliche Kirchenordnung zu reformieren. Die praktische Umsetzung zeigte aber deutlich den engen Zusammenhang mit den weltlichen Interessen der damaligen Zeit. Bereits die Bauern hatten Luthers These von der ‚Freiheit eines Christenmenschen‘ auf ihre materielle Lage bezogen, aber auch große Teile der damaligen Bevölkerung stimmte der neuen Lehre zu. Sogar zahlreiche Fürsten traten dem reformierten Glauben bei. In den meisten europäischen Ländern waren damit zwei Richtungen des damaligen Kirchenglaubens entstanden.“
„Noch kann ich folgen“, warf Hannes ein. Fiona ließ sich nicht verwirren. „Im Großmaßstab zeigte sich aber, dass die Glaubensfrage nur die Hülle der Machtinteressen darstellte; der Kaiser war weiterhin auf die Unterstützung der katholischen Kirche angewiesen und verteidigte die hergebrachten Positionen, die Reformierten vereinigten sich dagegen zu einem Bündnis, das ihre Interessen schützen sollte. Sehr bald zeigte sich, dass der sogenannte ‚Schmalkaldische Bund‘ – dem die meisten reformierten Fürsten und viele Städte beigetreten waren – durchaus militärische Absichten verfolgte. Die Widersprüche entluden sich 1546/47 im Schmalkaldischen Krieg, den die konservativen Kräfte allerdings für sich entscheiden konnten.“
„Fiona, es genügt. Wir sind angekommen. Vielen Dank für die Hilfe und Nachhilfe. Die Informationen waren sehr interessant, aber über Jena habe ich nichts gehört.“
„Das war die Vorgeschichte. Ohne Vorgeschichte ist das Nachfolgende nicht zu verstehen, man kann es nicht in den Fluss der Ereignisse einordnen.“ Sie schob den Rollstuhl in sein Zimmer und war Hannes beim Aufstehen etwas behilflich. „Heute Abend dann den Rest“, sagte sie und verließ den Raum. Sie wohnte eine Etage höher.
Gegen Abend erschien sie wieder und begann, ohne weitere Begründung ihren Vortrag fortzusetzen. „Geschichte ist ein interessantes Fach – vielleicht das interessanteste von allen; der Stoff endet nie, und je weiter wir uns von der Zeit des täglichen Geschehens entfernen, desto deutlicher treten Spuren gesetzmäßiger Vorgänge hervor …“
„Ja, ja, Fiona, gewiss“, warf Hannes ein, „aber wollen wir nicht erst eine Tasse Kaffee zu uns nehmen, bevor wir wieder in die Vergangenheit eintauchen?“ Sie sah ihn an, als könne er nicht recht bei Trost sein, sie bei den wichtigsten Erkenntnissen der Welt zu unterbrechen. Nach einigen Atemzügen wandte sie sich wortlos der Kaffeebereitung zu. Hannes war betroffen von der Auswirkung seiner Bemerkung. „Entschuldige – ich bin so ein grober Klotz! Ich habe überhaupt keine Ahnung von Geschichte; auf diese Bedeutung des Faches hat man uns nie hingewiesen. Sicher, man hätte sich selbst um ein Verständnis bemühen sollen, aber wenn man jede Sache erst von dieser Seite betrachten sollte, wäre alle Hoffnung …“
„Die Plätzchen von gestern sind schon alle?“, fragte sie.
„Ja, vielleicht – ich weiß nicht. Dann nehmen wir den Kaffee eben ohne.“ Fiona antwortete nicht, sondern verließ ohne Erklärung das Zimmer. Als sie wieder erschien, stellte sie wortlos eine ungeöffnete Rolle Kekse auf den Tisch. Dann schenkte sie den duftenden Kaffee ein und nahm am Tisch Platz. „Jena hatte mit den Ereignissen damals tatsächlich noch nichts zu tun“, sagte sie nach dem ersten Schluck. „Das änderte sich aber gerade: Der Sächsische Kurfürst Johann Friedrich, dem üblichen Brauch nach mit dem Beinamen ‚der Großmütige‘ belegt, der maßgebliche Führer der Reformierten, geriet in Gefangenschaft Karls des Fünften. Er kam erst nach sechs Jahren wieder frei. Ihm war nicht nur die Kurfürstenwürde abgesprochen worden, sondern auch große Teile seines Territoriums mitsamt der wichtigen Stadt Wittenberg, dem Ausgangspunkt der Reformation. Nach seiner Befreiung begann Johann Friedrich sofort mit der Neuorganisation seiner verbliebenen Besitzungen. Da mit Wittenberg auch die dortige Universität verloren war, verfügte er schon 1554 die Gründung einer neuen Universität – in Jena.“ Fiona legte eine kleine Pause ein.
„Hier hast du nun endlich dein Jena, gleich mit dem notwendigen Verständnis für die vielen zufälligen Ereignisse, die bis zum Erscheinen einer Gegenwart führen können“, sagte sie. „Jedenfalls hoffe ich das.“
„Diese Hoffnung hat sich ganz und gar erfüllt“, bestätigte Hannes eifrig, „und mehr als das; die Geschichte macht mich neugierig – warum ausgerechnet Jena?“
„Hier gab es einigermaßen günstige Voraussetzungen. Seit der Reformation stand das dortige Dominikanerkloster leer. Als 1527 in Wittenberg die Pest ausbrach, dienten die Jenaer Gebäude bereits als behelfsmäßiges Ausweichquartier für Wittenberger Studenten; ein gewisser Anfang war also schon da. An einen geregelten Studienbetrieb war allerdings nur mit Erteilung kaiserlicher Privilegien zu denken. Diese trafen erst 1557 unter dem Nachfolger Karls des Fünften ein.“ Und da er sie nur stumm und staunend ansah, ergänzte sie: „Ist einfache Stadt- und Zeitgeschichte!“
„Vielleicht hätte ich mich besser für dieses Fach statt für Psychologie entscheiden sollen“, scherzte Hannes „ich fürchte allerdings, dass meine Wissenslücken in Geschichte zu groß sind, um einen Anschluss zu finden.“
„Ein gewisses Grundinteresse ist natürlich die erste Voraussetzung. Mir würden zum Beispiel im Fach Chemie selbst Nachhilfestunden nichts nützen. So hat jeder andere Möglichkeiten, sein Leben erfolgreich zu gestalten.“
„So wird es wohl sein, Fiona, und so kann ich auch leicht wieder zu mir und meinen Interessen zurückfinden. Ich danke dir für diese Führung durch Zeiten und Ereignisse, von denen ich nicht die geringste Ahnung hatte.“
„Wir können immer nur kleine Ausschnitte betrachten, es ist wie Lesen eines riesigen Textes mit einer Lupe; manchmal erfasst man nur einen Namen oder eine Jahreszahl. Die Bedeutung, der Zusammenhang ergibt sich nur aus den vorangegangenen und den nachfolgenden Wörtern.“
„Ein gutes Bild“, lobte Hannes. Ich wäre nun doch daran interessiert, was du mit deiner Lupe beim Weiterlesen in der Stadt-und Universitätsgeschichte erkennen kannst.“ Fiona zeigte eine Andeutung von Heiterkeit – was selten geschah.
„Ich kann dir die Lupe holen“, schlug sie vor.
„Das würde nichts nützen; mir fehlte ja der Text dazu“, scherzte Hannes weiter. Fiona stand auf, um Kaffee nachzuschenken. So konnte sie auch ein leichtes Lächeln unterdrücken, das schon um ihren Mund spielen wollte.
„Es ist ganz einfach“, sagte sie und nahm wieder Platz. „Manchmal ergibt sich der weitere Verlauf ganz logisch und vorhersehbar – doch nicht so, dass historische Ereignisse mit der Regelhaftigkeit naturwissenschaftlicher Abläufe vergleichbar wären, dass Ergebnisse der gesellschaftlichen Entwicklung durch logische Schlussfolgerungen vorhersagbar sind.“
„Na ja …“ Hannes wusste nicht, was er zu dieser Wendung des Gesprächs sagen sollte. „Was hat das mit der Entwicklung der Uni Jena zu tun?“, fragte er.
„In erster Linie hat es etwas mit dir zu tun; du scheinst nicht sehen zu können, was die Gründung der ersten reformatorischen Hochschule bedeutete: Nach eintausend Jahren Anspruch auf Unfehlbarkeit der Päpstlichen Kirchenmeinung, der sich alles unterzuordnen hatte – selbst Kaiser und Könige – schien eine Zeitenwende Gestalt angenommen zu haben. Das Ende des geistigen Mittelalters hatte begonnen. “ Hannes sah seine Mitbewohnerin aus der oberen Etage erstaunt an.
„Als so bedeutend habe ich die Sache tatsächlich nicht gleich gesehen“, gab er zu. „Hat man das zu jener Zeit auch so erlebt?“
„Das entzieht sich natürlich meiner Kenntnis; Geschichtsbetrachtungen betreffen im Allgemeinen ja die Vergangenheit. Die ländliche Bevölkerung nahm davon sicher kaum Notiz, doch die führenden Geister jener Zeit könnten das Ereignis so in etwa gesehen haben. Das sind allerdings Spekulationen. Als Tatsache ist hingegen überliefert, dass die Zahl der Studenten, die nach Jena strebten, bald die Zahl der Einwohner erreichte und auch überschritt. Universität und Stadt nahmen seitdem die gleiche Entwicklung. Aber das kannst du nun ja selbst kennenlernen und erleben.“ Fiona stand auf und verließ, wie üblich, ohne weitere Formalitäten Rebhans Wohnung.
KAPITEL 2: DAS GROßE HAUS
Er hatte Glück, die ersten Schritte in der Universität bereiteten ihm keine Probleme. Rebhan erklärte im Sekretariat sein Vorhaben, worauf ihm die junge Sachbearbeiterin einen Antrag auf Gasthörerschaft reichte. Sie zeigte sich interessiert an seinem Vorhaben, gab ihm sogar Hinweise zum Studienbeginn, und die Empfehlung, zuerst „Allgemeine Psychologie“ zu hören; so hätte sie es auch gehalten. Und auf seine Frage, ob sie denn hier Psychologie studiert habe, sagte sie: „Ich bin noch nicht ganz fertig. Aber ich studiere ebenfalls extern. Ich will doch nicht ein Leben lang Sekretärin bleiben.“
„Das ist ja ein Zufall. Wie verläuft denn so ein externes Studieren?“
„Wie man Zeit hat. Man ist ja an die Berufstätigkeit gebunden.“
„Natürlich. Ich meine: Mit Anwesenheitskontrolle und so?“
„Ach was.“
„Und Prüfungen?“
„Wenn man als Student eingeschrieben ist.“
„Das bin ich ja nicht.“
„Nein. Dazu wäre dieses Formular einzureichen …“ Sie bückte sich nach dem Blatt.
„Bemühen Sie sich bitte nicht“, sagte er, „ich bin froh, dass mir keine Prüfungen drohen.“
Sie lachte. „Ja, es sind einige, ich habe auch noch nicht alle. Aber ein Studienbuch sollten Sie führen. Es dient dem Nachweis der Teilnahme an den Seminaren. Und hier ist auch Ihr Studentenausweis.“ Sie reichte ihm das Kärtchen. „Bitte Ihr Passfoto einkleben und zur Bestätigung hier abgeben.“
„Vielen Dank“, sagte er. „Was für eine Freude, Sie kennengelernt zu haben. Darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee einladen?“
„Vielleicht bei anderer Gelegenheit. Ich kann meinen Platz jetzt nicht verlassen.“
„Ich würde Sie gern wiedersehen.“
„Jederzeit in meinem Büro.“ Sie lächelte.
Die ersten Vorlesungen fand er sehr interessant. Der Professor las allerdings nichts vor, sondern sprach frei.
„Psychologie ist eine empirische Wissenschaft“, sagte er. Die wissenschaftliche Psychologie untersuche das Erleben und Verhalten des Menschen nach wissenschaftlichen Kriterien. Sie unterscheide sich dadurch ganz entschieden von anderen Versuchen, das Wesen des Menschen zu erfassen. Mit Deutungen, die auf Glauben, Überlieferungen oder Alltagserfahrungen zurückgingen, habe die heutige Psychologie nichts zu tun – obwohl diese Bezeichnung leider auch für manchen Hokuspokus noch in Gebrauch sei. Eine „Seelenerkundung“ werde in der wissenschaftlichen Psychologie nicht betrieben, man stehe im Gegenteil ständig vor der Aufgabe, eine objektive Sichtweise auf subjektive Vorgänge zu finden, was eine grundsätzlich rationale Herangehensweise erfordere. Gleichzeitig sei jedoch auch die Empirie zu beachten, denn Erleben und Verhalten gebe es als individuelles Bewusstsein seit es Menschen gibt. In der wissenschaftlichen Betrachtung seien vielfache Verknüpfungen mit anderen Fächern festzustellen und zu beachten, die teils zu den Voraussetzungen, teils zu den Rückwirkungen individuellen Handelns gerechnet werden müssten. Eine solche Psychologie könne kein abgeschlossenes Gebäude darstellen, sondern sehe sich wie jede andere Wissenschaft auf Hypothesen, Theorien und Modelle angewiesen, die sich mit dem Wissenszuwachs und mit den gesellschaftlichen Verhältnissen auch ändern würden.
Rebhan hatte versucht, möglichst viel davon zu erfassen und in sein Heft zu schreiben, sah sich von der Fülle an Informationen jedoch bald überfordert. Zuhören und gleichzeitig mitschreiben ging nicht – er war zu ungeübt. In den Notizen erschienen daher überwiegend nur Stichworte. Der Vortragende war dann wohl zu den Notwendigkeiten übergegangen, den fast unüberschaubaren Stoffumfang in zugänglichere Gebiete zu unterteilen. Rebhan hatte notiert „Grundlagen d. gesamten Psychol: Naturwissenschaften, Anthropologie, Hirnforschg., Sozialwiss. usw. Für d. Allgemeine Psychol: Entwicklungs-, Persönlichkeits- Sozial-, Pädagog-, Therapeut. Psychol. …Schwerpunkte der Persönlichkeitspsych: Wahrnehmg., Gedächtn., Handeln, Bewerten, Emotionen, sozialpychol. Aspekte.“. In dieser Reihenfolge konnte er seine Weiterbildung unmöglich gestalten. Er hatte dann beschlossen, ohne Notizen weiter zu hören und später zu entscheiden, wie er sich in aber der Frage verhalten wollte. Übungshalber begann er aber, möglichst viele der neuen Eindrücke skizzenhaft zu notieren; das war einfacher, als gleichzeitig dem Faden der Vorlesung zu folgen.
Zu den Aufzeichnungen gehörten auch Notizen über attraktive Frauen, die ihm damals häufiger aufgefallen zu sein schienen. „In der ‚Forelle‘ bedient jetzt eine attraktive Kellnerin. Unglaublich, was sie für lange Beine hat. Man sitzt sehr tief dort, mit Blick fast auf Saumhöhe“, stand in dem Heft. Dann, als er einmal in einer freien Stunde das alte Uni-Gebäude erkundete und gerade im Vorraum zum Direktorat ein Cranach-Bild aus der Ahnengalerie der Rektoren betrachtete, sei eine Frauenschönheit von unerhörter Ausstrahlung wie eine Erscheinung durch den Raum gegangen. Als sie zurückkehrte, hatte er sie gefragt, ob er sich hier ein wenig aufhalten dürfe, ihn interessierten die Bilder. „Bitte“, meinte sie, „aber dieser Raum ist in Kürze für eine internationale Delegation vorgesehen.“
„Oh, bis dahin bin ich längst wieder verschwunden.“
Sie war dann wie ein Traumbild durch die Glastür des Direktorats geströmt. „Solche Frauen gibt es wirklich?“ hatte er in sein Heft geschrieben. Er saß dann längere Zeit in seinem Rollstuhl vor dem Porträt Johan Stigels – „erster Rektor der Hohen Schule zu Jena 1559, Prof. d. Rhetorik und Dichtkunst, Schüler Melanchthons zu Wittenberg“, wie ein Messingschildchen unterhalb des Rahmens wissen ließ. Ein lebensnahes Porträt, fand er, trotz der altertümlichen Handhaltung und seltsamen Spinnenfingrigkeit. Besonders die Augen waren eindrucksvoll gemalt, ein schön beobachtetes Braungrün der Iris, ein unaufdringlicher Glanz. Aber von des alten Cranach Hand konnte das Bild insgesamt kaum sein, die Dreiviertelansicht des Kopfes war nicht ganz bewältigt worden, oben noch am besten; eine schöne Stirn, sehr leichtes, schon etwas schütteres, braunes Haar, ganz herrlich, aber die rechte Gesichtshälfte war etwas verzogen; da stimmte die Augenlinie nicht ganz und auch der Mund rundete sich nicht genügend nach hinten weg. Eine Werkstattarbeit eher, schien ihm, bei der die Hand des Meisters nur hier und da korrigierend eingegriffen haben mochte.
Die Vorzeigedame erschien wieder. Er blickte ihr mit offenem Interesse entgegen. Aber erst auf dem Rückweg erwiderte sie seinen Blick. Er sah ihr nach, bis sie sich wieder in der Glastür auflöste; es war wie Musik. In der Hoffnung, dass sie nochmals käme, studierte er weitere dort versammelte Kunstwerke. Eine Arbeit von Rodin fiel ihm auf, eine grün glasierte Keramik mit viel Phantasie um ein Gesicht herum, einschließlich etlicher Schlangen, man wurde nicht klug daraus. Eine Tafel belehrte ihn, dass dies ein Geschenk Rodins anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Jena sei. Der Text war in Französisch gehalten, das er nicht verstand, aber „immortelle Friedrich Schiller“, das verstand er.
Ein großes Gemälde zeigte Schiller selbst auf dem Weg zu seiner Antrittsvorlesung im Griesbachschen Haus. Eine eher mäßig gute Arbeit, fand er. Aber der Giebel, die breite Front des Hauses hinter der Torfassade in voller Sonne, das sah gekonnt aus. Doch warum hatte der Maler der Hauptperson nur soviel Grün ins Gesicht gestrichen? Neben dem Bild hing ein Text.
„Schiller an G. Körner, Jena, 28.5. 1789. Vorgestern als den 26sten habe ich endlich das Abentheuer auf dem Katheder rühmlich und tapfer bestanden … Die Johannisstraße, eine der längsten in Jena, von Studenten ganz besät. Weil sie liefen was sie konnten, um in Griesbachs Auditorium einen guten Platz zu bekommen, so kam die Straße in Alarme und alles an den Fenstern in Bewegung … Ich zog also durch eine Allee von Zuschauern und Zuhörern ein und sah mich von einem Amphitheater von Menschen umgeben … Meine Vorlesung machte Eindruck, den ganzen Abend hörte man in der Stadt davon reden und mir widerfuhr eine Aufmerksamkeit von den Studenten, die bey einem neuen Professor das erste Beispiel war. Ich bekam eine Nachtmusik und Vivat ward 3mal gerufen“.
Er hatte den Brief kaum zu Ende gelesen, als eine männliche Stimme hinter ihm sagte:
„Kollege, erwarten Sie jemanden?“
„Nein, ich habe mich nur in Betrachtung der Bilder hier ein wenig aufgehalten.“
„Entschuldigen Sie, aber das ist an dieser Stelle nicht üblich.“
„Tut mir leid, ich wollte gerade auch gehen.“
„Wir erwarten eine Delegation, wissen Sie.“
„Ja, ja, entschuldigen Sie.“
Wenn das man nicht der Rektor selber war, dachte er, von der Sekretärin geschickt, um zu erfahren, was das für ein Vogel sei, da im Vorraum. Nach dieser Störung habe er keine Neigung zu weiteren Entdeckungen in dem alten Bau verspürt, war zu lesen. Er sei bei dem Nieselregen draußen unschlüssig gewesen, was er machen sollte. Der Tag schien verloren. Es kam häufiger vor, dass Vorlesungen und Seminare ausfielen oder verlegt wurden. Darüber informierte ihn natürlich niemand. Er konnte sich dann zum Turm begeben, in der Mensa einen Kaffee nehmen und zum Lesesaal hochfahren, so war manchmal noch etwas zu retten. Über Verlegungen oder Ausfälle oder lange Wartezeiten fand er beim Blättern im Heft häufiger Bemerkungen. „Wieder der erste“, las er, „noch kein Betrieb in den Korridoren, der Hörsaal dunkel.“ Einmal: „Der Vorraum voller Mäntel und Mützen, die Vorlesung hat schon begonnen, muss bis zur Pause warten“. Er erinnerte sich, dass es schwierig geworden war, mit seiner Behinderung die Lehrveranstaltungen immer zur festgesetzten Zeit zu erreichen. Manchmal war er auch zu früh; dann hatte er Zeit, die langen, stillen und schlecht erleuchteten Flure des Unihauptgebäudes zu durchrollen. Von den Wänden blickten mittelalterlich gekleidete Autoritäten aus dunklen Gemälden ernst auf ihn herab – die lange Reihe der Rektoren seit Gründung der Einrichtung. Über dem Eingang zur Aula prangte das Marx-Zitat „Die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern“. Möglicherweise hatte Marx hier die Anerkennung seiner Dissertationsschrift entgegengenommen, doch gab es darüber keine Hinweise. Die Aula selbst schien eine Art Heiligtum zu sein, das stets verschlossen war. Neben dem Eingang wachte eine Stele mit Fichtes steinerner Büste, dazu ein Text. „Schon als Fichte noch in Jena lehrte, stand Schelling im Wintersemester 1798 zum ersten Male auf dem Katheder und hielt seine Antrittsvorlesung. Fichte glaubte zwar, er habe in Schelling einen zuverlässigen Anhänger zurückgelassen. Die Zukunft sollte jedoch schnell das Gegenteil beweisen“. Auch diesen Text hatte er in sein Heft geschrieben. Manchmal verstrich die Wartezeit mit dem Lesen der Kritzeleien auf den alten Tischen und Bänken der Seminarräume. Es kam ständig Neues hinzu – Zeichnungen von hochbusigen Vamps und Strichmännchen, einzelne Wörter und manchmal sogar ganze Texte. An einem Platz wurde gleich mehrfach „Hilfe!“ gerufen, einige Sitze weiter hatte jemand in schöner Vollendung das Wort „Scheiße“ geschrieben. Er hatte sich ebenfalls notiert: „Hier starb Leibnitz, hier starb Newton, und ich fühle mich auch schon ganz elend“. Ein alter Witz, fand er. Dann musste er aber doch lachen: „Ich beobachte Sie schon eine ganze Weile!“, stand da. Weiter vorn nahmen die Schmierereien ab. Er erinnerte sich auch an eine andere Szene: Er wurde nicht eingelassen, weil er seinen Gasthörerausweis vergessen hatte. Man konnte jedoch telefonieren.
„Einen Moment bitte“, sagte die Frauenstimme, „welches Studienjahr?“
Es dauerte. Unentwegt strömten Leute durch die Halle zu den Aufzügen. Jeder zeigte seinen Ausweis vor, und der Mann an der Tür nickte. Ab und zu entstand ein kleiner Stau. Es kam ihm vor, als ob alles ohne jedes Geräusch ablief. In der Leitung knackte es.
„Die Veranstaltung findet am Mittwoch im Hörsaal 12 statt.“
„Am Mittwoch?“, fragte er ungläubig. „Heute fällt sie wohl aus?
„Ja. Mittwoch von 8 Uhr bis 11 Uhr.“ Mittwoch ging nicht, er hatte seinen Studientag am Montag. Er konnte höchstens noch am Samstag fahren, wenn da eine Veranstaltung lag. Samstags hatte er keinen Unterricht zu halten.
Die anfangs interessante Geschichte war rasch komplizierter geworden. Manchmal hatte er das Gefühl, überhaupt nicht mehr durchzublicken. Er musste sich eingestehen, dass sich diese Art der Ausbildung unglaublich in die Länge ziehen würde. Außer Allgemeiner Psychologie hatte er am Montag nur noch Statistik belegen können. Doch Notizen aus dieser Veranstaltungsreihe erschienen ihm vollends nebelhaft. Statistik galt als Angstfach, hörte er. Hier hatte er sich eindeutig am falschen Ort befunden. Aus Frust darüber war er zum Glossieren der Unterrichtssituation übergegangen. Er las: „Der Dozent ist ein überaus korrekter älterer Herr mit dunkler Fliege zum grauen Anzug. Er kann fehlerlos und ohne jeden Versprecher eine Stunde lang über irgendein ‚Chi-Quadrat‘ referieren, während er wie ein General vor der Truppe auf und ab schreitet und die Absätze effektvoll in den quietschenden Belag stößt. Niemand wagt, vom Heft auch nur aufzublicken. ‚Dadurch, dass ich quadriere, spielt die Richtung der Abweichung keine Rolle. Wir stellen uns die Frage: Wie wirkt sich die Verdoppelung des Stichprobenumfangs aus?‘ Er redet auch beim Schreiben an der Tafel konzentriert weiter. ‚Was passiert mit Chi-Quadrat…, die Formel wird immer länger…, und bei k-facher Vergrößerung wächst das ‚n‘ eben um das k-fache. Es wächst so lange, bis ich alle Elemente erfasst habe. Dann ist jeder Unterschied ein echter Unterschied, und sei er auch noch so klein, ich kann jede Nullhypothese zurückweisen. Denn wenn Sie alle Probanden befragt haben, brauchen Sie keine Signifikanzuntersuchung mehr. Denken Sie daran‘.“
Er wusste jetzt nicht, warum er das Heft wieder zur Hand genommen hatte. Aber es war ja ohnehin verrückt, so eine Weiterbildung anzufangen, schon wegen der organisatorischen Schwierigkeiten. Nur an einem Tag in der Woche zur Uni – um wie viel länger als normal würde sich so eine Ausbildung dann hinziehen? Er rechnete gar nicht erst nach, ein Abschluss war ja auch nicht sein Ziel. Er blätterte weiter. Es kam nichts mehr. Das Mitschreiben war seine Sache nicht, er hatte sich dann ganz aufs Zuhören verlassen. Wahrscheinlich fanden in der Woche zwei Vorlesungen zur Allgemeinen Psychologie statt, von denen er eine immer versäumen musste.
„Ein zweiter Weg, die allen Menschen eigenen Funktionen zu erforschen, liegt in der Betrachtung seiner Entwicklung als biologisches Gattungswesen“, stand da, und noch das Wort „Darwin“. Und eingerahmt: „Anthropologie“. Diese Art Psychologie entsprach nicht gerade seinen Erwartungen. Er hatte begonnen, das Geschehen zu beobachten, statt auf das Dargebotene zu hören, aber dazu war er eigentlich nicht angetreten, es lief alles auf reine Zeitvergeudung hinaus. Zwei- oder dreimal fuhr er noch hin, dann fragte er sich, ob so ein Unternehmen überhaupt funktionieren könne. Er brauchte eine Denkpause.
Das hätte er wohl etwas früher in Betracht ziehen sollen, erkannte er – aber wie würde man anders zu einer solchen Erkenntnis gelangen als durch Erfahrung? Er war unzufrieden mit sich selbst.
Über sein Scheitern sprach er nicht. Mit wem auch? Er merkte erst jetzt, dass er überhaupt keinen Freund oder Vertrauten besaß; plötzlich war es ganz unwichtig, nicht nur keine Feinde zu haben, wie er bisher erstrebt hatte. Nicht-Feinde waren keineswegs automatisch auch Freunde. Eigentlich interessierte sich niemand für ihn, Fiona vielleicht ausgenommen, doch auch sie sah in ihm wohl eher einen behinderten Kollegen, dessen Betreuung ihrem ältlichen Dasein einen zusätzlichen Sinn bot.
Nach einiger Zeit stellte er fest, dass untätig und missmutig dazusitzen noch dümmer war als alles andere. Er nahm seinen Gasthörerausweis und fuhr wieder zur Uni.
Der Vortragende war jetzt ein jüngerer Mitarbeiter, der forsch und konzentriert sprach, ohne auf sein Manuskript zu blicken. Im Raum saßen weniger Studenten als zuvor, und sie schienen weniger aufmerksam zu sein, einige schwatzten sogar halblaut miteinander, Studentinnen in der Überzahl. Bei den Lehrveranstaltungen stellte sich immer bald so etwas wie eine Sitzordnung ein. Er hatte früher schon bemerkt, dass seitlich vor ihm oft ein Mädchen von auffallender, fast indischer Schönheit saß. Er konnte nicht verhindern, dass sein Blick häufiger dorthin wanderte. Sie schrieb kaum etwas mit, redete aber halblaut mit ihren Nachbarinnen oder kommentierte mit einer treffenden Bemerkung die Passagen vom Katheder. In der Pause setzte sie sich einfach auf die Bankreihe und schwang ihre langen Jeans-Beine darüber. Sie wirkte dann größer als es zunächst den Anschein hatte, dabei sehr schlank und fest gebaut. Sie schien der Mittelpunkt der Seminargruppe zu sein. Laura hier und Laura da, hieß es immer nur. Einmal hatte sie sich beobachtet gefühlt und kurz nach hinten geblickt. Er hatte zu einem Lächeln angesetzt, aber es kam zu spät. Natürlich hatte sie bemerkt, dass er von ihr beeindruckt war; während der Veranstaltungen versicherte sie sich manchmal mit einem kurzen Seitenblick seiner Aufmerksamkeit, und einmal, im Lesesaal, war sie dicht an seinem Platz vorübergegangen und hatte ihn herausfordernd angeblickt. Zurückhaltung war sie offenbar nicht gewohnt. Das sei gewiss der Typ von Frauen, einen Mann verrückt zu machen und ihn dann mit exzentrischen Ansprüchen zu terrorisieren, meinte er. Aber natürlich hatte er keine Ahnung. Von den Studenten bemühte sich offensichtlich keiner um sie, was er sehr erstaunlich fand. Waren die Kerle blind? Er hätte sie wohl gern fotografiert, zögerte aber, sie anzusprechen. Ihre offenkundige Erwartung, dass jedermann sie zu bewundern hätte, störte ihn etwas. Immerhin nahm er nun häufiger die Kamera mit. Zu Laura gab es keine Notizen in dem Heft. Aber er erinnerte sich an ihre Stimme, die angenehm dunkel und ein wenig belegt klang, und an den goldenen Bronzeton ihrer Haut, und an ihren Mund, über den man hätte Gedichte schreiben können. Er sah sie nur sehr unregelmäßig, und dann gar nicht mehr, da er mit dem Ausbildungstempo der regulären Studiengruppen nicht mithalten konnte.
Am Ende einer Vorlesung entdeckte er die Sekretärin im Gewusel der Mensa. Er rollte er auf sie zu. „Hallo, ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Und erfreut natürlich. Darf ich jetzt vielleicht meine Einladung zu einer Tasse Kaffee erneuern?“
„Darauf habe ich direkt gehofft“, gab sie kess zurück.
„Ich meine, Sie hätten angedeutet, dass diese Vorlesungsreihe bereits hinter Ihnen läge?“
„Das stimmt. Ich wollte sehen, ob Sie meiner Empfehlung gefolgt sind.“
„Wie sollte ich nicht!“
„Unsinn. Für mich ist es empfehlenswert, sich ab und zu mal sehen zu lassen. Ich hatte gehofft, der Chef würde lesen, aber das scheint vorbei zu sein.“
„Ja, auch heute war es jemand anderes.“
„Doktor Schwarz, die neue Hoffnung, auch hervorragend. Er nimmt jetzt in Vertretung ebenfalls die Hauptprüfung ab. Ich bin bald dran mit dem Examen, wissen Sie, und der Professor ist ja schon seit längerem etwas hinfällig.“
„Verstehe.“
Sie nahmen Platz. Beim Kaffee berichtete sie, dass sie inzwischen geheiratet habe, aber ihre Pläne und die ihres Mannes, der sich um ein Kunststudium bemühte, hätten sich bisher nicht verwirklichen lassen. Es sei wahnsinnig schwierig, ohne Zusatzausbildung zum Therapeuten eine Anstellung im Gesundheitswesen zu finden, meinte sie.
„Wäre Pädagogik dann nicht besser?“
„Ja, vielleicht.“ Aber das seien nicht so ihre Pläne. Sie habe die Tätigkeit als Sekretärin für Studienangelegenheiten im Haus nicht für ewig angenommen, sie brauche bald eine neue Arbeitsstelle. Er fragte: „Sie studieren doch ebenfalls neben Ihrer Berufsarbeit; endet das eigentlich mit einem ordnungsgemäßen Abschluss?“