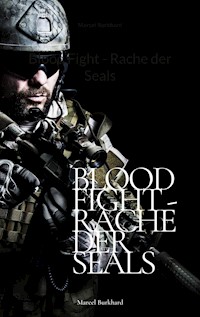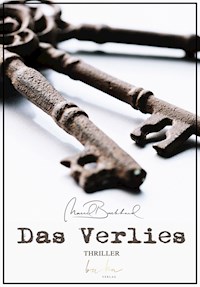
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gavin MacArthur und Susette Dubois
- Sprache: Deutsch
Superintendent Gavin MacArthur wurde vom Polizeichef Rutherford nach Vatersay versetzt. Schon wenige Tage nach dessen Eintreffen findet er eine Leiche und muss sich fortan mit einem Mordfall beschäftigen. Die Ermittlungen gehen zu einem Fall zurück, welcher vor dreißig Jahren nicht gelöst werden konnte. Die ganze Geschichte ist nachzulesen im Buch – das Ritual – und ist erhältlich auf www.bu-ka.ch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum neobooks
Marcel Burkhard
bu-ka Verlag
Marcel Burkhard
Das Verlies
Der erste Fall von Chief-Inspector Gavin MacArthur führt ihn auf die Insel Vatersay, welche am südlichsten Punkt der Äußeren Hebriden liegt.
bu-ka Verlag
Superintendent Gavin MacArthur wurde vom Polizeichef Rutherford nach Vatersay versetzt. Schon wenige Tage nach dessen Eintreffen findet er eine Leiche und muss sich fortan mit einem Mordfall beschäftigen. Die Ermittlungen gehen zu einem Fall zurück, welcher vor dreißig Jahren nicht gelöst werden konnte. Die ganze Geschichte ist nachzulesen im Buch – das Ritual – und ist erhältlich auf www.bu-ka.ch.
bu-ka Verlag Taschenbuch
© by Marcel Burkhard 2023
© by bu-ka Verlag 2021
Höhenweg 37, CH-3661 Uetendorf
Telefon +41 79 608 02 96
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagfoto: Sahra Wyss
Umschlaggestaltung: Marcel Burkhard
Druck und Bindung: drucks.ch Röthlisberger GmbH, Schweiz
ISBN: 978-3-9525669-0-9
Auflage: 1. Auflage
Auch als E-Book erhältlich
Einige Schauplätze dieses Krimis wie Städte, Gebäude und Straßen, existieren wirklich. Auch wenn dieser Thriller in einer realen Kulisse erzählt wird, sind sowohl die darin agierenden Personen wie auch die Handlung frei erfunden. Sollte es trotzdem Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen oder Organisationen geben, ist dies nicht von mir beabsichtigt und rein zufälliger Natur.
»Bevor du bei dir selbst Depressionen oder ein geringes Selbstwertgefühl diagnostizierst, stelle erst mal sicher, dass du nicht komplett von Arschlöchern umgeben bist.«
Sigmund Freud (1856 - 1939)
Einleitung
Vatersay, ein friedlicher, malerischer und romantischer Ort im Süden der Äußeren Hebriden Schottlands, war der südlichste bewohnte Ort dieser Inselgruppe. Felsige Landschaften und Machair-Land säumten das paradiesische und verträumte Dörfchen Vatersay, das ganz im Süden der gleichnamigen Insel lag. Zu erreichen war die südlichste Inselgruppe mit der Fluggesellschaft Loganair, die zweimal täglich zwischen Barra Island und dem Flughafen Glasgow verkehrte, oder aber mit einer Fähre, die in unregelmäßigen Abständen den Hafen, oder viel mehr den modernen Holzsteg ansteuert, um die Bewohner mit Lebensmittel zu versorgen.
Die wenigen Leute, die noch in der Abgelegenheit lebten, durften auf eine kleine Kneipe zählen, die einige Zimmer für meist ungebetene Gäste anbot. Ein Lebensmittelgeschäft sowie eine Kirche konnten die Einheimischen ebenfalls ihr Eigen nennen. Kinder gab es, wenn überhaupt, nur wenige und wenn, mussten diese eine hügelige, kurvenreiche Strecke in Kauf nehmen, um die Schule in Eoligarry, ganz im Norden der Insel Barra gelegen, zu besuchen. Deshalb wurden diese meistens in einem der zahlreichen Zimmer unterhalb der Kirche unterrichtet. Hinzu kam, dass die Causeway-Brücke, die den südlichen mit dem nördlichen Teil von Barra verband, meistens wegen Reparaturarbeiten gesperrt war.
Hier kannte jeder jeden und Fremde fielen sofort auf. Ein solcher lebte nun schon seit einigen Jahren auf der Insel. Man sollte denken, dass ein neuer Bewohner nach dieser Zeit kein Fremder mehr sein würde. In diesem Fall weit gefehlt. Es gab nur sehr wenige Inselbewohner, die den Fremden oder besser gesagt die Fremden, denn es handelte sich um ein Paar, jemals zu Gesicht bekamen oder dies zumindest behaupteten. Natürlich wurden Geschichten erzählt - in der Kneipe, auf dem Dorfplatz oder in der Kirche - aber niemand wusste so genau, ob diese auch richtig waren, selbst die Erzähler glaubten nicht so recht, was sie erzählten.
Das unbekannte Pärchen lebte fernab der Zivilisation im Südosten der Insel auf einem etwas erhöhten Plateau. Nur ein Weg führte zur villa bianca, wie sie von den Inselbewohnern genannt wurde, und zwar den Felsen entlang bis zu einer Wegkreuzung, danach über ein Feld bis zu einer kleinen Felsformation. Nach Angaben eines älteren Herrn, ein Stammgast in der Dorfkneipe mit stets etwas zu viel Alkohol intus, soll es sich beim Besitzer der Villa um einen etwa sechzigjährigen, männlichen Arzt handeln und bei der Frau um eine knapp dreißigjährige Brünette, eine Schönheit von Frau. Durch seinen erhöhten Alkoholkonsum schenkten ihm die Bewohnerinnen und Bewohner von Vatersay jedoch nicht allzu viel Aufmerksamkeit und so erstickte die Geschichte im Keim, wie so viele andere auch. Jack, wie der stets betrunkene Stammgast hieß, war ein Übel in der Gesellschaft. Er hatte weder Familie noch Freunde, was er sehr oft im Alkohol ertränkte und danach noch öfters erzählte.
Berühmtheit erlangte Vatersay vor genau dreißig Jahren, als ein Vater seine Frau und seine beiden Söhne auf bestialische Art ermordet hatte. Danach hatte er die drei Leichen über die Klippen geworfen und war hinterhergesprungen. Erst einige Tage später hatte man die toten Körper der Mutter und eines Kindes gefunden. Die beiden anderen waren nie wiederaufgetaucht und wurden wohl von Fischen dankend angenommen, zumindest stand es so im damaligen Polizeibericht. Das Familiendrama hatte sich am selben Ort ereignet, wo der Fremde später seine Villa gebaut hat. Zuvor war an selber Stätte eine kleine, verlotterte Zweizimmerhütte gestanden, die sich kurz vor dem Einsturz befunden hatte. Schon lange war gemunkelt worden, dass der arbeitslose und meistens betrunkene Familienvater seine Frau und die Kinder schlagen würde, dennoch hatte niemand etwas dagegen unternommen. Im Gegenteil: Man war froh gewesen, wenn man nichts mit der Familie zu tun haben musste. Als sich seine Frau von ihm hatte trennen wollen - man munkelte, sie habe ein Verhältnis mit dem Dorfpfarrer gehabt - hatte er sie mit mehreren Messerstichen umgebracht. Danach war er ins Kinderzimmer gegangen und hatte den kleinen Clyde erstochen. Diese Tatsachen gingen aus einem Bericht der Polizei hervor. Man vermutete, dass auch der eineiige Zwilling von Clyde, Tevin, auf dieselbe Art und Weise ums Leben gekommen war. Da man aber seine Leiche nie gefunden hat, konnten nur Vermutungen angestellt werden.
Während der polizeilichen Ermittlungen war Vatersay von Journalistinnen und Journalisten belagert worden, welche in den Morden die Story ihres Lebens vermutet hatten. Leider weit gefehlt, denn der Fall konnte nie ganz aufgelöst werden. Nach etwa einem Monat hatten sich die zahlreichen Fernsehstationen und Reporter von der Insel zurückgezogen und waren ihrem normalen journalistischen Leben nachgegangen. In der Folge wurde Vatersay wieder zu dem friedlichen, malerischen und romantischen Ort, den er vor dem Familiendrama gewesen war. Das paradiesische Dörfchen wurde wieder Ziel von Touristinnen und Touristen, die die traumhaften Strände genießen wollten. Damals hatte niemand ahnen können, dass es dreißig Jahre später am selben Ort wieder zu einer Tragödie kommen würde.
1
Vatersay
Aberdeen, die drittgrößte Stadt Schottlands, lag im Nordosten des Landes. Einer der über 200.000 Einwohner war Inspector Gavin MacArthur. Ein junger, aufstrebender Polizist, der die Regeln nicht immer genau nahm und sich oft drüber hinwegsetzte. In der Vergangenheit hatte er deswegen schon des Öfteren beim Chief Inspector Angus MacGibbon vorsprechen müssen. Heute jedoch war ein ganz anderer Tag. Laut seinem Vorgesetzten, eben diesem Angus MacGibbon, stand eine Beförderung im Raum. Er weilte schon seit zwei Tagen in Kincardine, Ort des Hauptquartiers der schottischen Polizeibehörde, und konnte es kaum erwarten, sich künftig Chief Inspector nennen zu dürfen. Es war sein erster Besuch im Scotland Police HQ und er war begeistert. Die Behörde residierte im Tulliallan Castle, ein Schloss, inmitten einer Parklandschaft. Gleich daneben befand sich das Tulliallan Police College. Gavin nutzte die freie Zeit, um im anliegenden Waldstück etwas Naturluft einzuatmen. Kurz vor vierzehn Uhr saß er schließlich vor dem Büro des Chief Constables, dem Polizeipräsidenten, Finley Rutherford. »Sie können jetzt eintreten, Inspector MacArthur, der Polizeichef erwartet Sie«, sagte die nette Dame hinter dem Schreibtisch.
Der Inspector stand auf, klopfte an die Tür und öffnete sie. »Kommen Sie rein und nehmen Sie Platz, Inspector. Wir haben einiges zu bereden!« MacArthur war sich nicht mehr so sicher, ob es sich hier wirklich um eine Beförderung handeln würde, denn Rutherford sprach in einem ernsten Ton mit ihm. Er setzte sich auf den einzigen Stuhl, der nicht mit irgendwelchen Akten beladen gewesen ist und wartete, bis der Chief das Wort ergriff. »Mister MacArthur. Chief Inspector MacGibbon hat mich wissen lassen, dass Sie es mit den Regeln nicht so genau nehmen. Sie würden sie immer wieder missachten.« Der Chief wartete einen kleinen Augenblick in der Hoffnung, der Inspector würde etwas dazu sagen, doch er wartete vergebens. »Wollen Sie sich zu diesen Vorwürfen nicht äußern?«
»Es tut mir leid, Chief Constable, ich dachte, es ginge um eine Beförderung! Ich fühle mich betrogen!«
»Ach was! Warten Sie das Gespräch doch ab, Inspector. Zu Ihrer Beförderung kommen wir später. Also, was wollen Sie mir zu diesen Anschuldigungen sagen?«
»Sir, das sind keine Anschuldigungen. Ich bin der Inspector mit den meisten Verhaftungen im letzten Jahr. Ich habe eine hundertprozentige Erfolgsrate! Durch mich sind Diebe, Vergewaltiger und Mörder hinter Gitter gebracht worden. Da muss man manchmal etwas unkonventionell arbeiten«, fluchte der Inspector grimmig. MacArthur war sich aber sogleich bewusst, dass er etwas forsch geantwortet hatte und entschuldigte sich unverzüglich. »Bitte verzeihen Sie meine etwas zu gehässige Antwort. Aber ich kann nicht verstehen, warum ich deshalb hierher beordert worden bin.«
»Nun, auch als Inspector hat man die Pflicht, die Regeln zu befolgen, genauso wie die Bürgerinnen und Bürger in Ihrem Bezirk, wie übrigens überall auf dieser Welt. Unkonventionelle Arbeit, wie Sie es nennen, hat dabei keinen Platz. Ich bin bestens informiert über Ihre erfolgreichen Verhaftungen. Was Sie jedoch nicht erwähnt haben, ist die Tatsache, dass vier der im letzten Jahr verhafteten Personen die Polizei auf Schadensersatz verklagt haben, weil Sie angeblich zu brutal mit den Gefangenen umgegangen sind. Ich zitiere:
›Inspector MacArthur hat bei der Verhaftung einer älteren Dame, die ihr Parkticket nicht bezahlen wollte, den linken Arm so stark nach hinten gedrückt, dass dabei die Schulter auskugelte und die Person hospitalisiert werden musste. Bei einem anderen Fall rannte ein Mann durch die Straße, weil er noch den Bus erwischen wollte. Inspector MacArthur hielt ihn fälschlicherweise für den Flüchtigen, hinter dem er gerade hergerannt war, und schoss ihm in den Oberschenkel.‹
Es gibt noch weitere Beispiele, Inspector, soll ich weiterlesen?«
»Nein, nicht nötig. Zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, dass der flüchtige Mann ebenfalls in denselben …«
Rutherford fuhr dazwischen. »Inspector! Es geht nicht um diese beiden Fälle! Es geht um Ihre Vorgehensweise! Sie müssen lernen, die rote Linie nicht zu überschreiten. Denn es ist nicht nur wichtig, die Täter zu verhaften, sondern auch, dass diese hinter Gitter bleiben und nicht wegen irgendeinem Fehler wieder freikommen, wie es im letzten Jahr zweimal der Fall gewesen ist. Das sind Verbrecher, die nun wieder frei herumlaufen. Bei einem Taschendieb ist das ein kleineres Übel, aber es waren zwei Typen, die ihre Frauen verprügelt hatten. Solches Gesindel muss hinter Schloss und Riegel sitzen. Nun gut…«, sagte Rutherford. »Ich habe mich mit Ihrem Vorgesetzten unterhalten und wir sind uns einig geworden. Inspector, nichtsdestotrotz sind Sie ein hervorragender Polizist mit sehr hoher Erfolgsquote. Wenn ich ehrlich bin, hat wohl kein anderer in Schottland auch nur annähernd so viele Fälle aufgeklärt wie Sie.« Gavin wusste gerade nicht, was mit ihm geschah. Erhielt er einen Tadel mit einem Akteneintrag oder wurde er gerade gelobt und mit etwas Glück befördert? Seine Hoffnungen stiegen wieder. »Inspector MacArthur. Trotz Ihrer oft unkonventionellen Vorgehensweise befördere ich Sie zum Chief Inspector. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung.«
»Oh, vielen Dank, Chief Constable. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet. Ich habe gedacht, ich würde einen Tadel in meine Akte kriegen.«
»Ach, wo denken Sie hin, Inspector. Das würde Ihre ganze Karriere beeinträchtigen. Nein, keine Angst. Sie sind jung und hungrig. Sie können es weit bringen, vielleicht eines Tages sogar auf diesen Stuhl, wo ich drauf sitze!«
»Sir, mit Verlaub. Aber da gibt es keinen Besseren als Sie.«
»Das freut mich zu hören. Nun, Sie verstehen sicher, dass es nicht von Vorteil ist, zwei Chief Inspectors auf derselben Wache zu haben. Da Ihr Vorgesetzter, Angus MacGibbon, mehr Dienstjahre auf dem Buckel hat, wird er weiterhin die Fäden auf der 48sten ziehen.«
»Ich werde versetzt?«
»Ja, aber Sie werden Ihre eigene Wache erhalten, Inspector MacArthur.« – »Entschuldigen Sie bitte, Chief Inspector«, sagte der Polizeipräsident. Gavin strotzte vor Stolz, zumindest für ein paar Sekunden. »Sie werden in einer Woche nach Vatersay ziehen und dort für Gerechtigkeit sorgen.«
»Wohin soll ich ziehen?«, fragte der Inspector etwas verwirrt.
»Nach Vatersay. Das liegt im Süden der Äußeren Hebriden.«
»Ist das ein Witz, Sir? Haben Sie irgendwo Kameras versteckt? Leben dort überhaupt Menschen?«
»Nein, Chief Inspector, das ist kein Witz! Sie werden nach Vatersay versetzt für drei Jahre. Danach ist Chief Inspector MacGibbon in Pension und Sie können zurück nach Aberdeen.«
»Sir, ich hätte dann doch lieber einen Tadel in meiner Akte, als dass ich mich versetzen lasse. Die Beförderung können Sie auch wieder zurücknehmen!«
Der Polizeipräsident schaute verärgert zum neu ernannten Chief Inspector, obwohl es ihn innerlich beinahe kugelte vor Lachen: »Sie können Ihre Karriere bei der Polizei auch sofort beenden. Aber dann werden Sie in ganz Schottland keinen anderen Job mehr finden als denjenigen, die Straßen zu reinigen und mit etwas Glück noch die Toiletten auf den Raststätten zu schruppen. Also fahren Sie heim, packen Sie Ihre Sachen und ziehen Sie nach Vatersay. Sie werden dort bereits erwartet!«
* * *
Rowan Tulloch und seine Lebensgefährtin, Kendra Gow, wohnten zusammen in einer Villa nur unwesentlich vom Dörfchen Vatersay entfernt. Das Gebäude war beinahe quadratisch mit einem kleinen Anbau auf der Ostseite. Die Eingangstür, zur Hälfte aus Glas gefertigt, führte direkt in die offene Küche, die mit dem Wohn- und Esszimmer verbunden war. Die Südfassade bestand zum größten Teil aus Glas, damit sie das wunderschöne Panorama genießen konnten. Im östlichen Teil des Hauses waren die Zimmer sowie zwei Badezimmer, wobei das kleinere der beiden für die Gäste gedacht war. Direkt neben dem Badezimmer führte eine Treppe in den Untergrund der Villa. Sämtliche Wände waren im selben Weiß gehalten wie die Außenfassade. Einzig in der Küche war mit Holz gearbeitet und die Wände getäfelt worden. Neben der Küche war eine Tür angebracht, die nach draußen führte, wo sich eine Treppe zum Bootsanlegeplatz befand. Garten oder dergleichen gab es keinen, nicht einmal Blumen vor den Fenstern. Die Umgebung wurde so schlicht wie möglich gehalten.
Bis vor wenigen Jahren hatte Tulloch für kurze Zeit an derselben Stelle in einem kleinen, verlotterten und zuvor verlassenen Häuschen gelebt. Er war darin alleine aufgewachsen oder zumindest, beinahe. Im Keller hauste ein ›Murtair‹, wie er seinen Mitbewohner nannte. Die meiste Zeit hatte er damit verbracht, die Gewölbe im Untergeschoß zu erweitern und zu stabilisieren. Nun verfügte er über ein mittelalterlich eingerichtetes, dennoch modernes Verlies sowie einige Kellerräume. Die Wände waren aus Naturfelsen und Steinen errichtet worden und waren schalldicht. Im hinteren Bereich stand ein Stuhl, der durch einen Scheinwerfer beleuchtet wurde. Sein ›Murtair‹ hing jedoch mit den Armen an einer Kette, die Knie in sich gebeugt. Der Stuhl diente nur als Relikt und zur Folter. Bis dahin hatte er diesen noch nie in Gebrauch genommen. Der Rest des Raumes war stockfinster, so dass man nicht einmal seine Hand vor Augen erkennen konnte. Von den Wänden tropfte Wasser und es roch nach Dreck, Urin, Blut und Schweiß.
Nachdem Tulloch bei einem Einkaufsbummel auf dem Festland Kendra kennen gelernt hatte, eine Ärztin der Gerichtsmedizin, war sie zu ihm nach Vatersay gezogen. Damals wusste sie noch nicht, auf was sie sich da eingelassen hatte. Es gefiel ihr so gut auf der Insel, dass sie die verlotterte Hütte hatte abreißen lassen, um an gleicher Stätte eine Villa zu bauen. Mit Blick nach Süden konnte Kendra vom Sofa aus die vier unbewohnten Inseln Sandray, Pabbay, Mingulay und Barra Head sehen. Das Geld, um das moderne Gebäude zu bauen, hatte sie von ihrem Vater geerbt, der nach einem Herzanfall verstorben war. Er war einer der besten Hirnchirurgen Schottlands gewesen und hatte dort eine große Lücke hinterlassen. Auf Wunsch ihres etwas älteren Partners hatte sie die Villa auf dem bestehenden Fundament bauen müssen; warum, hatte er ihr jedoch nicht sagen wollen. So genau hatte sie es auch nicht wissen wollen und hinterfragte die Bitte deshalb auch nie. Hinter dem Haus, direkt von der Küche aus zu erreichen, führte eine lange Treppe zum Strand, der mit einem Bootsanlegeplatz versehen war. Von dort aus startete Tulloch jeweils zweimal die Woche mit einer 1500 PS starken Privatjacht zum Festland, um sich mit Lebensmittel einzudecken. Es war ein Geschenk von Kendra, damit sie zwischendurch aufs offene Meer hinausfahren konnten. Sie hatten nur selten Gäste und so waren die acht Kojen und die unzähligen Extras kaum in Gebrauch. Die meiste Zeit brauchte Rowan die Jacht nur, um seine Partnerin vom Festland auf die Insel und wieder zurück zu bringen.
Der 37-Jährige war einmal mehr auf dem Weg ins Verlies im Keller, um seinen Mitbewohner zu besuchen. Es war an der Zeit, den alten Fressnapf wieder mit etwas Essbarem zu befüllen. Er zog das Geschirr an der Kette zurück, schüttelte das Fleisch einer Büchse Hundefutter hinein und schob es mit einem Stock wieder an den gewohnten Platz. Es war nicht etwa gefährlich, den Napf von Hand hinzulegen. Aber in der Nähe des lebenden Etwas stank es nach Urin und Fäkalien. Danach sprach er aus der Ferne mit der Person, die sich am anderen Ende des Kellers, oder vielmehr des Verlieses, befand, halb an der Wand hängend und halb am Boden liegend. »Hör auf zu jammern! Ich hab den Napf ja bereits gefüllt.« - »Na, wie gefällt dir das? Das kommt davon, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Du fragst dich sicher, warum ich dich nicht umbringe? Nein, der Tod wäre zu schön für dich. Aber ich will ja kein Unmensch sein. Ich besorge dir einen Freund, mit dem du dich etwas unterhalten kannst, nachdem ich dir den letzten genommen habe. Kannst du überhaupt noch sprechen? Ich hoffe nicht, du widerliches Arschloch.«
Antwort erhielt er keine, denn sein Gegenüber hatte seit vielen Jahren kein Wort mehr gesprochen. Tulloch wendete sich ab und setzte sich etwas abseits auf einen Stuhl. Er genoss es, dem Gefangenen beim Essen zuzusehen, der wie ein wildes Tier den Kopf in den Napf drückte und das Fleisch verzehrte. Dabei hatte er erst die Kette etwas lockern müssen, ansonsten hätte es der Gefangene nicht geschafft, sein Haupt so tief in den Napf zu quetschen. Es kam nicht oft vor, dass er mit dem Gefangenen sprach, aber wenn, dann hatte er keine schönen Worte für ihn übrig. Die ganze Prozedur dauerte etwa eine Stunde, danach verließ er den Keller wieder und ließ seinen ›Mitbewohner‹ in absoluter Finsternis zurück.
»Rowan, was genau machst du eigentlich immer da unten? Du hast mich beim Bau der Villa gebeten, den Keller stehenzulassen. Ich habe nicht näher nachgefragt, aber jetzt würde mich schon langsam interessieren, was du da unten immer so treibst.«
Tulloch setzte sich zu ihr aufs Sofa, legte seine Füße über ihre Oberschenkel, schaute ihr in die Augen und sagte: »Ich habe da unten ein Monster, das ich täglich füttern muss. Es ist gefräßig und braucht etwas Zuneigung. Wenn ich mich nicht darum kümmere, kommt es hoch und frisst dich!« Dabei kitzelte er sie am Bauch und machte ›Mampf-Mampf‹-Geräusche. Kendra musste unweigerlich lachen. »Willst du es sehen?«, fragte er schließlich mit einem verschmitzten Lächeln.
»Nein, im Ernst, Rowan! Was machst du da unten immer?«
»Du brauchst dich nicht zu fürchten. Der Keller wird zu einem Sicherheitsraum umfunktioniert. Man weiß ja nie, was passieren kann und dann will ich dich in Sicherheit wissen. Du liegst mir am Herzen und für dein Wohl mache ich alles. Aber bitte frag mich nicht, ob du ihn sehen kannst, das soll eine Überraschung werden. Ich verspreche dir, dass du ihn einmal sehen wirst!«
»Danke, jetzt bin ich beruhigt. Du hast mir gerade etwas Angst eingejagt mit dem Monster.«
»Bist du nun zufrieden?«, fragte Tulloch etwas boshaft.
»Ja«, sagte die Ärztin und schmiegte sich an ihn heran.
»Gut! Dann frag mich nie wieder, was ich da unten mache! Verstanden?«
»Ja«, antwortete sie etwas eingeschnappt.
Kendra Gow ist eine bildhübsche, vierunddreißigjährige, zierliche Frau. Viele ihrer Freundinnen konnten nicht verstehen, was sie an diesem Tulloch fand. Sie konnte ihnen aber nichts entgegenhalten, denn sie wusste es auch nicht so genau. Sie fühlte sich einfach zu ihm hingezogen. Seit sie in Vatersay wohnte, verringerte sie ihr Arbeitspensum um vierzig Prozent. Sie arbeitete während drei Tagen in Glasgow und wohnte in dieser Zeit in einer kleinen Mietwohnung und verbrachte die restliche Zeit auf Vatersay.
Jeden Montag in der Früh brachte Tulloch seine Partnerin mit seiner Fairline Motorjacht aufs Festland und tätigte dabei seine Einkäufe. Rowan konnte so, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, Futter für seinen Mitbewohner im Keller kaufen. Nun war es wieder soweit. Das Wetter zeigte sich, wie meistens um diese Jahreszeit, von seiner regnerischen und windigen Seite. Sie mussten früh raus, damit Kendra ihre Arbeit zur rechten Zeit beginnen konnte. So war es erst vier Uhr morgens, als Tulloch am Steg anlegte, der vor einigen Wochen eigens für ihn neu gestaltet worden war. Kendra verabschiedete sich von ihm und fuhr anschließend mit ihrem auf dem Parkplatz direkt vor dem Einkaufsladen geparkten SUV die zweihundert Kilometer nach Glasgow. Da die Geschäfte noch nicht geöffneten hatten, versuchte Tulloch in der Zwischenzeit auf der Jacht etwas Schlaf zu finden, was sich bei diesem Seegang als gar nicht so leicht entpuppte.
Es war neun Uhr, als Tulloch das Geschäft betrat, das er jede Woche aufsuchte. »Guten Morgen, Mister Tulloch. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Es ist mir, als wären Sie erst gestern hier gewesen«, sagte die nette, etwas ins Alter gekommene Verkäuferin. Er ignoriere die Worte und schlenderte durch die verschiedenen Regale. »Wie geht es Ihrem Hund, Mister Tulloch?«
»Hund?«
»Ja, Ihrem Hund. Sie kaufen doch jede Woche Hundefutter. Ich wollte nur sagen, dass wir Ihre bevorzugte Sorte gerade im Angebot haben. Ich habe mir erlaubt, die übliche Menge für Sie zu reservieren, wenn das für Sie in Ordnung ist.«
»Ach so, mein Hund! Ich habe etwas ganz anderes verstanden. Ja, ihm geht es gut. Gefräßig, wie immer.« Tulloch verbrachte eine ganze Stunde im Geschäft, ehe er sich zur Kasse begab und die eingeladenen Artikel aufs Laufband legte. Es war der einzige Kontakt, den er außerhalb seiner Villa pflegte, wenn auch nur für die eine Stunde. Nachdem er die Ware im Boot verstaut hatte, tuckerte er gemächlich zum Anlegeplatz direkt unterhalb der Villa zurück. Was Kendra nicht wusste, war der Umstand, dass es einen weiteren Eingang zum Keller gab, etwas versteckt in einer Einbuchtung im Felsen. Diesen benutzte Tulloch nun, um das Hundefutter in den, nur von seinem Keller aus erreichbaren, Vorratsraum zu verstauen. Danach begab er sich ins Wohnzimmer, wo er nach einigen Minuten auf dem Sofa einschlief.
* * *
Die Fähre, die MacArthur nach Vatersay brachte, legte nur etwa zweihundert Meter östlich des kleinen Dorfes an einem primitiv erbauten, beinahe schon vermoderten Holzsteg an. Der Fährmann versorgte die Einwohner mit Nahrungsmittel, brachte ihnen die aktuellste Post und in seltenen Fällen Touristen. Dieses Mal, jedoch, hatte er einen Chief Inspector mit an Bord. Eigentlich brauchte das Dorf keinen Gesetzeshüter, denn seit dem schrecklichen Familiendrama vor dreißig Jahren hatte es keinen Grund gegeben, einen solchen in der Ortschaft zu haben. Probleme wurden untereinander gelöst und dies immer, oder zumindest meistens, friedlich.
Wie ihm der Polizeipräsident noch vor wenigen Tagen mitgeteilt hatte, würde er von einer am Steg stehenden Person erwartet werden. Zu seiner Enttäuschung stellte sich aber heraus, dass es sich dabei nicht um einen Polizisten handelte, sondern vielmehr um einen Mann, der jeweils die Lebensmittel in Empfang nahm. »Guten Tag, Sir. Mein Name ist Gavin MacArthur. Ich bin Chief Inspector der schottischen Polizei. Ich dachte, ich würde von einem Polizisten in Empfang genommen.«.
»Von einem Polizisten? Hier auf Vatersay?«, fragte der Händler amüsiert.
»Ja, zumindest wurde mir das so mitgeteilt. Wer schaut denn hier für Ordnung?«
»Na ich!«
»Sie sind Polizist?«
»Nein, wie kommen Sie denn auf diesen Schwachsinn!«
»Weil Sie sagten, Sie schauen für Ordnung.«
»Hier schaut jeder Bürger für Ordnung. Wir brauchen keine Gesetzeshüter!«
MacArthur wusste nicht, wie ihm geschah. »Es gibt keinen Polizisten auf Vatersay?«
»Nein, Sir. Den letzten dieser Sorte haben wir damals beim Familiendrama gesehen. Das dürfte so ungefähr die dreißig Jahre her sein. Aber ich habe keine Zeit, Ihnen mehr zu erzählen, ich muss mich um mein Geschäft und die Lebensmittel kümmern.«
»Wo geht es denn hier zur Polizeistation?«, wollte MacArthur wissen.
»Polizeistation? Haben wir nicht. Schauen Sie in der Kneipe vorbei, die haben vielleicht ein Zimmer für Sie.« Danach wendete sich der Lebensmittelhändler wieder dem Fährmann zu, der gerade unermüdlich dabei war, die Ware auf die Ladefläche eines Pickups zu laden.
MacArthur lief auf der steinigen Straße in Richtung Zentrum, bepackt mit zwei Rücksäcken und ebenso vielen Koffern. Endlich im Hotel angekommen, musste er erst einmal nach dem Personal suchen. »Hallo? Ist da jemand?«
Von irgendwoher hörte er eine leise Stimme rufen: »Bin gleich bei Ihnen.« Es sollte noch etwa fünf Minuten dauern, bis eine junge, zierliche Brünette erschien. »Guten Tag Fremder, wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ich suche ein Zimmer. Der Typ am Steg hat mir gesagt, ich solle mich hier melden.«
»Sie meinen sicher Jamie Donn. Er kümmert sich um die Lebensmittel in unserem Dorf. Und für ein Zimmer sind Sie hier genau richtig. Wie lange möchten Sie denn bleiben? Wir bieten unsere Zimmer für bis zu vier Tage an. Länger hat es noch kein Tourist in dieser Einöde ausgehalten.«
»Drei Jahre«, gab MacArthur eingeschnappt zur Antwort.
»Sie sind ein Spaßvogel, Sir. Das kann ich brauchen. Nur selten verschlägt es Besucher zu uns und schon gar keine, die Humor haben. Also, wie lange möchten Sie bleiben? Zwei Tage? Ich könnte Ihnen einen Spezialpreis für vier Tage anbieten, dabei nur drei verrechnen, aber das bleibt unter uns.«
»Ich meine es ernst, Miss. Ich bleibe drei Jahre hier. Mein Name ist Gavin MacArthur. Ich bin Chief Inspector bei der schottischen Polizei und wurde hierher versetzt. Wurden Sie nicht informiert?«
»Nein, Mister MacArthur, ich wurde nicht darüber benachrichtigt. Aber was will ein Polizist auf Vatersay? Hier ist seit dreißig Jahren nichts mehr passiert!«
»Schon gut! Lassen wir das. Bitte geben Sie mir einfach ein Zimmer. Die Rechnung können Sie direkt ins Hauptquartier senden.«
MacArthur konnte sich sein Zimmer aussuchen, da keine belegt waren. Er entschied sich für das Zimmer mit der Nummer 313. Nicht, dass es ihm wichtig gewesen wäre, welche Nummer sein Verschlag aufwies, aber da das Hotel über keinen Lift verfügte, wollte er nahe der Treppe sein. Das Zimmer lag im ersten Stock, mit Blick auf den Dorfplatz. Er legte seine Rucksäcke und Koffer nur aufs Bett und begab sich sogleich wieder nach unten in die Kneipe. »Gibt es noch etwas zu essen?«, fragte er dieselbe Dame, die ihm schon den Zimmerschlüssel übergeben hatte.
»Selbstverständlich. Übrigens, mein Name ist Fenella, aber alle nennen mich nur Fenny.«
»Freut mich, Fenny. Mein Name kennen Sie ja bereits. Ich bin der Chief Inspector, aber alle nennen mich nur Chief. Also, ich hätte gerne das Menu eins, wobei mir gerade erst auffällt, dass auch nur ein Menu aufgelistet ist.«
»Ein Menu reicht völlig aus, Chief! Dafür ist es besonders köstlich.« Fenny wendete sich ab. Während sie in die Küche ging, brummte sie etwas, was MacArthur aber nicht verstehen konnte. War er vor einigen Tagen noch mächtig sauer über die ganze Sachlage, war er nun nur noch angepisst und angesäuert. Aber er verfügte über keine alternativen Optionen; er musste die drei Jahre irgendwie hinter sich bringen.
Es dauerte etwa zwanzig Minuten, bis das Essen aufgetischt wurde. Der Chief merkte auf Anhieb, dass er Fenella gegenüber wohl etwas zu unfreundlich gewesen war, denn diese stellte ihm den Teller etwas unsanft auf den Tisch. »Tut mir leid, Fenny, wenn ich etwas unhöflich gewesen bin. Ich hatte einfach einige schlechte Tage und muss erst lernen, mit der neuen Situation zurechtzukommen. Nennen Sie mich bitte Gavin, schließlich werde ich die nächsten drei Jahre Ihr Gast sein.«
»Kein Thema! Ich habe des Öfteren mit solchen Typen wie Sie zu tun. Schließlich wohne ich hier in einer Gemeinschaft mit hauptsächlich Männern und jeder möchte der Chef sein. Vielleicht ganz gut, wenn ein Chief Inspector zum Rechten schaut.«
»Ach Fenny. Der Lebensmittelverkäufer hat etwas über einen Mordfall vor dreißig Jahren erwähnt. Wissen Sie etwas darüber?«
»Das war vor meiner Geburt. Aber es wurde viel erzählt hier in der Kneipe. Es soll sich um eine Familie mit zwei Kindern gehandelt haben. Damals ist da oben noch eine alte Hütte gestanden. Die villa bianca ist erst vor ein paar Jahren gebaut worden. Der Vater hat damals als Farmer gearbeitet. Das ganze Land südlich von hier gehörte ihm. Als er dieses, und damit seinen Job, verloren hat, suchte er Trost im Alkohol. Seine Frau wollte ihn jedoch nicht verlassen, soll aber eine Affäre mit dem Dorfpfarrer gehabt haben. Was jedoch nie bestätigt worden ist. Eines Abends, als der Vater nach Hause gekommen ist, hat er einen Schatten zur Hintertür hinausgehen sehen. Er rannte hinterher, hat jedoch niemanden erkennen können. Vielleicht war es nur eine durch seinen Alkoholkonsum verursachte Illusion. Daraufhin hat er aus Eifersucht seine Frau und die beiden siebenjährigen Kinder ermordet, um sie anschließend die Klippen runterzuwerfen. Anschließend beging er Selbstmord, indem er ebenfalls von den Klippen runtergesprungen ist. Einige Tage später hat man die Frau und eines der beiden Kinder tot am Strand gefunden. Wie hieß die Familie noch…« Fenny hatte einen nachdenklichen Gesichtsausdruck aufgesetzt. »…tut mir leid, ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Diese Geschichte wurde natürlich in verschiedenen Variationen erzählt: Gemäß einer Version sind alle zuerst vergiftet worden, in einer anderen ist die ganze Familie erschossen worden. Fakt ist aber, dass die ganze Familie beim Drama ums Leben gekommen ist.«
»Villa bianca?«
»Ja, so nennen wir das Gebäude. Wenn die Wintersonne hoch am Himmel steht, leuchtet die Villa in einem grellen Weiß, weswegen die Bewohner der Villa diesen Namen gegeben haben.«
»Das ist eine üble Geschichte mit der Familie. Wer hat danach im Haus gewohnt und wer hat die villa bianca gebaut?«, wollte MacArthur von Fenny wissen.
»Das alte Haus ist leer gestanden, soviel ich weiß. Es wurde herumerzählt, dass die verlotterte Hütte bald in sich zusammenfallen würde. Aber das ist nie geschehen. Also ich habe nie jemanden gesehen, der in dem alten Ding gewohnt hätte. Dürfte wohl auch zu gefährlich gewesen sein. Wer jetzt da wohnt und wer das Prachtsteil gebaut hat, weiß man auch nicht. Jack, einer unserer Stammgäste, hat vor einiger Zeit erzählt, es sei eine etwa dreißigjährige Brünette mit ihrem Liebhaber, einem über sechzigjährigen Arzt. Ich glaube das aber nicht.«
»Warum nicht?«