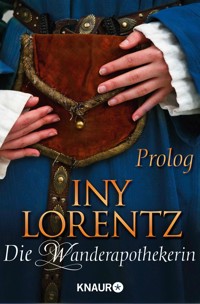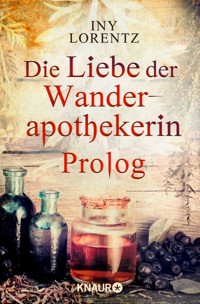9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wanderhuren-Reihe
- Sprache: Deutsch
Marie lebt ein glückliches Leben mit Mann und Kind. Doch ihre Feinde haben die ehemalige Wanderhure nicht vergessen … Band 3 der erfolgeichen historischen Roman-Serie des Bestseller-Autorenduos Iny Lorentz Als Maries Todfeindin Hulda erfährt, dass ihre Rivalin wieder schwanger ist, schmiedet sie einen perfiden Plan: Marie soll entführt und für tot erklärt werden. Zunächst scheint der Plan zu gelingen: Marie landet in den Händen eines Handelsherrn, der sie als Sklavin verkaufen lässt. Zusammen mit dem Sohn, den sie inzwischen geboren hat, gerät sie in den Besitz von Anna, Gemahlin des Neffen des Großfürsten von Moskau. Es gelingt ihr, Annas Vertrauen zu gewinnen, doch dann schwebt diese selbst in höchster Gefahr und muss fliehen. Als es Marie endlich gelingt, unter Einsatz ihres Lebens den Weg in die Heimat zu finden, muss sie feststellen, dass ihr geliebter Michel nicht mehr frei ist … Die fesselnde historische Saga erzählt die Geschichte der Hübschlerin Marie, die sich durch die Wirren des Mittelalters kämpft und dabei auf beeindruckende Weise Stärke und Unnachgiebigkeit demonstriert. Hochspannend, dramatisch und opulent lässt uns die Bestseller-Autorin tief ins deutsche Mittelalter eintauchen. Alle Bände der historischen Saga um die Wanderhure Marie und deren Reihenfolge: - Band 1: Die Wanderhure - Band 2: Die Kastellanin - Band 3: Das Vermächtnis der Wanderhure - Band 4: Die Tochter der Wanderhure - Band 5: Töchter der Sünde - Band 6: Die List der Wanderhure - Band 7: Die Wanderhure und die Nonne - Band 8: Die Wanderhure und der orientalische Arzt - Band 9: Die junge Wanderhure (Prequel zu Band 1) - Band 10: Die Wanderhure. Intrigen in Rom
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1009
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Iny Lorentz
Das Vermächtnis der Wanderhure
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Widmung
Landkarte
Erster Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Zweiter Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Dritter Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Vierter Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Fünfter Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Sechster Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Siebter Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Achter Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
Historischer Hintergrund
Für Lianne,Ingeborg,Tatjana und Isabel
Erster Teil
Die Entführung
I.
Schreie von Kriegern und Pferden hallten misstönend in Maries Ohren, und über dem Schlachtenlärm lag der Klang hussitischer Feldschlangen, die Tod und Verderben in die dicht gedrängten Reihen der deutschen Ritter spien. Sie sah böhmisches Fußvolk in blauen Kitteln mit kleinen, federgeschmückten Hüten wie die Woge einer Sturmflut auf das eisenstarrende kaiserliche Heer zurollen. Zwar schützten sich die Angreifer nur durch Lederpanzer und kleine Rundschilde, doch sie schienen zahllos zu sein, und über ihren Köpfen blitzten Hakenspieße und die Stacheln der Morgensterne.
Nun vernahm sie Michels Stimme, der seine Leute zum Standhalten aufforderte. Dennoch löste sich an anderen Stellen die Formation der Deutschen auf, und ihre Schlachtreihe bröckelte wie ein hart gewordener Laib Brot, den man mit den Händen zerreibt, um ihn an die Schweine zu verfüttern. In diesem Moment begriff Marie, dass Kaiser Sigismund die Seinen in eine vernichtende Niederlage geführt hatte. Sie stöhnte auf und zog Trudi enger an sich.
Da stürmte einer der fliehenden Ritter direkt auf sie zu. Sein Visier stand offen, und sie erkannte Falko von Hettenheim. Er blieb vor ihr stehen und wies mit dem Daumen auf Michel, der von einer dichten Traube böhmischer Rebellen umzingelt war. »Diesmal opfert sich dein Mann für den Kaiser. Gleich wird er krepieren, und nichts kann dich mehr vor meiner Rache schützen!«
Marie versteifte sich und tastete nach dem Dolch, den sie in einer Falte ihres Kleides verborgen hielt, mochte die Waffe auch im Vergleich zu dem Schwert des Ritters eine Nadel sein. Falko von Hettenheim hob die Klinge zum Schlag, hielt aber mitten in der Bewegung inne und lachte auf.
»Ein schneller Tod wäre eine zu leichte Strafe für dich, Hure. Du sollst leben und dabei tausend Tode sterben!« Er griff mit der gepanzerten Rechten nach Trudi, riss das Kind an sich und wandte sich hohnlachend ab.
Mit einem verzweifelten Schrei wollte Marie ihm folgen, um ihre Tochter zu retten. Im gleichen Augenblick packte jemand sie an der Schulter und schüttelte sie kräftig.
»Wacht auf, Herrin!«
Marie schreckte hoch und öffnete die Augen. Da gab es keinen Falko von Hettenheim mehr, auch keine Böhmen und keine deutschen Ritter, sondern nur ein friedliches grünes Ufer und einen träge fließenden Strom. Sie selbst befand sich auf einem schlanken, von zwei hurtigen Braunen getreidelten Flussschiff und sah Anni und Michi vor sich stehen, die sie sichtlich besorgt musterten.
»Was ist mit Euch, Frau Marie? Seid Ihr krank?«, fragte der Junge.
»Nein, mir geht es gut. Ich bin wohl kurz eingeschlafen und habe schlecht geträumt.« Marie erhob sich, brauchte aber die helfende Hand ihrer Leibmagd, um sicher auf den Beinen zu stehen.
»Schlechte Träume nicht gut.« Inzwischen vermochte Anni sich zwar fließend auszudrücken, aber wenn sie sich aufregte, fiel sie in ihr früheres Stammeln zurück.
Marie lächelte ihr beruhigend zu und trat an den Rand der Barke. Während sie den grünen Auwald betrachtete, der an dieser Stelle bis in den Strom hineinwuchs und die Pferde zwang, durch das Wasser zu laufen, glitten ihre Gedanken wieder zu dem Traum zurück. Sie hatte ihn so intensiv erlebt, dass sie den Geruch des verschossenen Pulvers noch in ihrer Nase zu spüren glaubte. Darüber wunderte sie sich, denn Michel und sie waren den böhmischen Verwicklungen fast unversehrt entkommen, und es bestand auch keine Gefahr, wieder hineingezogen zu werden. Den Verräter Falko von Hettenheim hatte die Strafe des Himmels ereilt, und ihr Ehemann weilte auf Kibitzstein, dem Lehen, das Kaiser Sigismund ihm verliehen hatte. Sie aber hatte sich aufgemacht, ihre Freundin Hiltrud auf deren Freibauernhof in der Nähe von Rheinsobern zu besuchen.
Gerne hätte sie den Besuch bis ins Frühjahr aufgeschoben, um auf dem Rückweg nicht in kaltes, stürmisches Herbstwetter zu geraten. Doch dann hatte sie zu ihrer und Michels übergroßen Freude festgestellt, dass sie schwanger war. Sie wollte Michels Patensohn Michi jedoch persönlich nach Hause bringen, denn Hiltrud hatte ihren Ältesten seit mehr als zwei Jahren nicht gesehen, und ohne den Jungen hätten Michel und sie in Böhmen ein grausames Ende gefunden. Marie war Hiltrud überaus dankbar, dass die Freundin ihr bei jener Flucht aus der Pfalz ihren Sohn mitgegeben hatte, obwohl diese nicht von ihrem Plan überzeugt gewesen war.
Nun würde Hiltrud zugeben müssen, dass Marie damals Recht gehabt hatte. Das war auch anderen klar geworden, zuvorderst Pfalzgraf Ludwig, der sie nach dem angeblichen Tod ihres Mannes neu hatte vermählen wollen. Doch als Falko von Hettenheim behauptet hatte, Michel sei von Hussiten umgebracht worden, war sie überzeugt gewesen, dass er log. Sie wusste, dass der Ritter ihrem Mann den Aufstieg neidete, und hatte deswegen sofort vermutet, er habe Michel verletzt in den böhmischen Wäldern zurückgelassen, damit dieser einen qualvollen Tod in hussitischer Gefangenschaft erleide. Dieser Ahnung war sie nach Osten gefolgt, und sie hatte tatsächlich Recht behalten. Michel hatte dank der Hilfe friedlicher Tschechen überlebt, und gemeinsam war es ihnen schließlich sogar gelungen, dem Kaiser eine Botschaft von treu gebliebenen böhmischen Adeligen zu überbringen.
»Du bist heute aber sehr in Gedanken.« Anni blickte Marie verwundert an, denn ihre Herrin und Freundin war normalerweise gelassen und aufmerksam. Ihr Sinnieren musste wohl mit ihrer Schwangerschaft zusammenhängen. Sie wusste, dass Frau Marie und ihr Mann sich diesmal einen Sohn erhofften, dem Michel das Lehen würde vererben können. Mit Trudi gab es schon eine Tochter, aber die würde später einen Ritter heiraten und Herrin auf dessen Burg werden. Der Kaiser hatte zwar erlaubt, dass sie das Lehen erben konnte, doch selbst dann würde es keine weiteren Adler auf Kibitzstein geben, sondern den Sippennamen eines anderen Geschlechts.
»Da hat eben ein Langohr das andere Esel genannt«, spöttelte Marie über Anni, die jetzt ebenfalls gedankenverloren vor sich hin starrte, und bat sie, ihr ein wenig mit Wasser vermischten Wein zu bringen. Während ihre Magd den Becher suchte, der von der als Tisch dienenden Frachtkiste gefallen und über das Deck gerollt war, versuchte Marie, die düstere Vorahnung abzuschütteln. Die Tatsache, dass sie ausgerechnet von dem ehrlosen Mörder und Verräter Falko von Hettenheim geträumt hatte, erschien ihr als schlechtes Omen.
Um die Bilder des Traums wegzuschieben, richtete sie ihre Gedanken auf die Ankunft in Rheinsobern. Sie fieberte dem Wiedersehen mit ihrer alten Freundin entgegen, von der sie von ihrem siebzehnten Lebensjahr an bis zu dem böhmischen Abenteuer nie lange getrennt gewesen war. Damals, vor mehr als anderthalb Jahrzehnten, hatte Hiltrud ihr das Leben gerettet, und sie waren gemeinsam als Ausgestoßene, als wandernde Huren, von Markt zu Markt gezogen und hatten ihre Körper so oft wie möglich verkaufen müssen, um überleben zu können. Als sich ihr Geschick nach fünf Jahren gewendet hatte, war aus Hiltrud eine geachtete Freibäuerin und aus ihr die Ehefrau eines Burghauptmanns geworden, den der Kaiser nach einer verlustreichen Schlacht zum freien Reichsritter ernannt hatte. In Augenblicken wie diesem erschien Marie ihr und Michels Aufstieg zu steil, und ihr schwindelte allein bei dem Gedanken an ihren neuen Stand und die Pflichten und Rechte, die dieser mit sich brachte.
Mit einem Mal fragte sie sich, was ihr Vater wohl zu alledem gesagt hätte. Als sie siebzehn gewesen war, hatte er es als das größte Glück angesehen, sie mit dem illegitimen, vermögenslosen Sohn eines Reichsgrafen verheiraten zu können. Doch der war ein ebenso gewissenloser Schurke gewesen wie Falko von Hettenheim und hatte mit seinen Intrigen dafür gesorgt, dass sie nicht in ein geschmücktes Brautbett gelegt, sondern der Hurerei beschuldigt und verhaftet worden war. Schwer verletzt wurde sie aus der Stadt vertrieben, während ihr Verlobter ihren Vater um sein Vermögen brachte. Sie hatte überlebt, weil sie fest davon überzeugt gewesen war, sich irgendwann an ihrem Verderber rächen zu können. Das war ihr auch gelungen, indem sie sich den wütenden Protest der zum Konzil nach Konstanz gereisten Huren über die Zustände in der Stadt zunutze gemacht und Kaiser Sigismund selbst dazu gezwungen hatte, sie zu rehabilitieren. Da jedoch niemand wusste, was man mit einer wieder zur Jungfrau erklärten Hure anfangen sollte, hatte man sie kurzerhand mit ihrem Jugendfreund Michel verheiratet, und gegen ihre Erwartungen war sie mit ihm sehr, sehr glücklich geworden.
»Ich weiß nicht, wer das größere Langohr von uns beiden ist, Marie. Du denkst zu viel nach. Das ist nicht gut für das Kleine, das du in dir trägst.« Nach ihren gemeinsamen Erlebnissen in Böhmen als Sklavinnen der Hussiten konnte Anni sich nicht daran gewöhnen, ihre Freundin mit jener Ehrerbietung anzureden, die einer Burgherrin und Gemahlin eines Ritters zukam, und Marie verlangte es auch nicht von ihr.
Nun lachte sie leise auf. »Du tust ja gerade so, als hättest du bereits ein Dutzend Kinder geboren!«
Anni war knapp fünfzehn und immer noch ein recht schmales Ding. Dennoch hatte sie schon Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gesammelt, wenn auch recht unfreiwillige.
»Das habe ich nicht, aber ich weiß, dass es nicht gut für dich ist, so lange zu grübeln. Wir hätten Trudi mitnehmen sollen. Sie hätte dir deine Grillen längst schon ausgetrieben.«
Für einen Augenblick fühlte Marie, wie ihr die Tränen in die Augen schossen. Sie vermisste ihre kleine Tochter, mit der sie durch halb Böhmen gezogen war, doch da Michel so lange auf sein Kind hatte verzichten müssen, war Trudi bei ihm geblieben. Mit einem leicht gequälten Gesichtsausdruck sah sie Anni an. »Mach dir nicht so viele Sorgen um mich. Die meisten schwangeren Frauen haben ihre Launen. In spätestens einer Stunde lache ich wieder mit dir um die Wette.«
»Das will ich hoffen!« So ganz nahm die junge Tschechin ihrer Herrin den bevorstehenden Stimmungswechsel nicht ab, denn Marie wirkte so bedrückt, als wäre ihr etwas Böses begegnet. Dabei hatte sie gehofft, ihre Freundin würde sich beim Anblick der Gefilde freuen, in denen sie lange gelebt hatte. Doch je näher sie Rheinsobern kamen, umso schwermütiger wurde Marie.
Als Anni mit dem leeren Becher ihrer Herrin nach hinten ging, um ihn neu zu füllen, sagte sie zu Michi: »Ich hoffe, deiner Mutter gelingt es, Frau Marie aufzuheitern. So gefällt sie mir gar nicht.«
Michi nickte, ohne richtig hinzuhören. Der Stimmbruch lag hinter ihm, und er spürte plötzlich Sehnsüchte, die ihm vor einem Jahr noch völlig fremd gewesen waren. In seinen Träumen stellte er sich vor, wie er Anni das züchtige graue Gewand einer Leibmagd auszog und mit der Nackten Dinge trieb, die er nicht einmal in der Beichte zu erwähnen wagte.
»Mama wusste mit Frau Maries Launen immer umzugehen. Und denke ja nicht, dass sie früher keine gehabt hätte. Die Herrin kann sturer sein als ein Ochse, und wenn sie ein Ziel ins Auge gefasst hat, gibt sie nicht eher auf, bis sie es erreicht hat. An deiner Stelle würde ich mir keine Gedanken machen.«
»Ich mache mir Sorgen!«, betonte Anni und schnaubte enttäuscht, weil Michi sie nicht ernst nahm.
Als sie weitergehen wollte, streckte er die Hand aus und berührte sie am Hintern. Im gleichen Augenblick schnellte das Mädchen herum und versetzte ihm eine Ohrfeige, die noch am gegenüberliegenden Ufer zu hören gewesen sein musste. Michi verlor das Gleichgewicht, setzte sich auf den Hosenboden und starrte verdattert zu Anni hoch, die mit zornblitzenden Augen über ihm stand.
»Mach das nicht noch einmal!«, warnte sie ihn.
»Jetzt tu nicht so, als wärst du eine unbefleckte Jungfrau. Ich weiß, dass du bereits unter Männern gelegen bist.« Michi traten vor Beschämung und Wut die Tränen in die Augen. Einen Herzschlag später mischten sich die des Schmerzes hinzu, denn das Mädchen hatte erneut zugeschlagen, und diese Ohrfeige hinterließ Spuren auf seiner Wange.
»Ich habe mich nicht freiwillig unter diese Kerle gelegt, und einen wie dich werde ich gewiss nicht an mich heranlassen. Wenn du es noch einmal versuchst, sage ich es Frau Marie.«
Jetzt zog Michi den Kopf zwischen die Schultern, denn in diesen Dingen verstand Marie keinen Spaß. Da sie selbst das Opfer einer Vergewaltigung geworden war, hasste sie Männer über alles, die Frauen zwangen, ihnen gefällig zu sein. Dabei hatte er Anni keine Gewalt antun, sondern sie nur necken wollen. Wobei er natürlich ein wenig darauf gehofft hatte, sie würde irgendwann einmal in der Nacht zu ihm kommen, damit er sich bei ihr als Mann beweisen konnte.
»Musst du deshalb so toll zuschlagen? Ich wollte doch gar nichts von dir.« Er stand auf, wandte dem Mädchen den Rücken zu und gesellte sich zu den Schiffern. Drei der Männer kümmerten sich um die Zugleine und unterstützten die Fahrt, indem sie den Rumpf mit langen Stangen von Untiefen fernhielten, während der vierte am Ruder stand und das Boot so am Treidelpfad entlangsteuerte, dass die Pferde es gut in Fahrt halten konnten. Die vier hatten den kleinen Zwischenfall mit angehört und rieten Michi nun lachend, sich nichts daraus zu machen.
Einer klopfte ihm zum Trost auf die Schulter. »Weißt du, mein Junge, in der Nacht sind alle Katzen grau. Da ist es egal, ob das Weib, auf dem du liegst, jung oder alt ist. Hauptsache, du kannst dein bestes Stück in einem warmen Frauenspalt versenken. Im nächsten Ort wohnt eine saubere Hure, die einem so patenten Burschen wie dir sicher gerne zeigen wird, wie er seinen Schwengel rühren muss. Was meinst du, sollen wir dich zu ihr bringen?«
»Nein, danke!« Michi schüttelte unter dem Lachen der Schifferknechte den Kopf. Er wäre ja gerne mit den Männern gegangen, doch der Ort lag schon zu nahe bei Rheinsobern, und er fürchtete, dieser Ausflug würde daheim bekannt werden. Sein Vater würde vielleicht darüber hinwegsehen, doch der Mutter dürfte er danach eine Weile nicht unter die Augen treten. Zu der Angst, seine Familie dummem Gerede auszusetzen, kam noch die Scheu, sich bei der Hure zu blamieren.
Die Einzige, die nichts von Annis Schlagfertigkeit und den Kommentaren der Schiffer wahrgenommen hatte, war Marie, die sich wieder in ihren Erinnerungen verlor. Sie musste an Falko von Hettenheim denken, und es war ihr, als ginge auch von dem Toten noch eine Bedrohung für sie aus.
II.
In ihrer Zeit als Ehefrau des Burghauptmanns hatte Marie die Ritterburgen der Umgebung besucht und kannte jeden Fußbreit Boden einen Tagesritt weit um Rheinsobern herum. Und doch war ihr jetzt, als reise sie durch ein fremdes, ja sogar fremdartiges Land. Sie legte die Hand auf die leichte Wölbung ihres Leibes und horchte in sich hinein, um das neue Leben zu erfassen, das in ihr heranwuchs. War es wirklich die Schwangerschaft, die sie so seltsam reagieren ließ? Bei Trudi hatte sie nichts dergleichen empfunden, obwohl sie damals mehr Probleme hatte schultern müssen, als ein Mensch alleine tragen kann. Zu jener Zeit war ihr Mann für tot erklärt worden, und der neue Burghauptmann von Rheinsobern hatte sie um ihr Vermögen bringen wollen. Jetzt aber herrschte um sie herum nur eitel Sonnenschein. Vielleicht, dachte sie, lösten ihr Widerwille gegen die Sobernburg und die Erinnerung an all das, was dort passiert war, diese unguten Gefühle aus.
»Ich hätte klüger sein und mit der Reise warten sollen, bis mein Kind geboren ist. Michi hätte auch allein nach Rheinsobern fahren können«, sagte sie zu niemand Bestimmtem, auch wenn Anni eifrig nickte.
Aber sie wusste, dass sie nicht anders hatte handeln können. Sie würde diese Reise durchstehen und versuchen müssen, den warmen Spätsommertag, der sich langsam dem Ende zuneigte, mit schöneren Gedanken zu beschließen.
Plötzlich zupfte jemand sie am Ärmel. Sie blickte auf und sah Michi aufgeregt nach vorne zeigen. »Seht dort, Frau Marie! Ich kann in der Ferne bereits die Rheinsoberner Kirchtürme erkennen. Dort drüben unter dem Bergfried der Sobernburg!«
Marie stand auf und entdeckte nun ebenfalls die Stadt. Wenn es noch zwei Stunden hell blieb, würden sie den Hafen und mit dem letzten Tageslicht auch Hiltruds Bauernhof erreichen. Sie nickte Michi aufatmend zu und wandte sich dann an den Besitzer der Barke. »He, Schiffer, können die Gäule etwas schneller laufen? Ich will Rheinsobern heute noch erreichen!«
Der untersetzte Mann in der derben Tracht der Rheinfahrer verzog das Gesicht und spie über die Bordwand ins Wasser. Er hatte im nächsten Ort anhalten und übernachten wollen, doch für ein gutes Trinkgeld würde er bis Rheinsobern weiterfahren.
»Ich werde schauen, was sich machen lässt, Herrin. Der Treidelknecht wird jedoch ganz schön fluchen, wenn er seinen Gäulen die Peitsche geben muss.« Bevor Marie antworten konnte, winkte er dem Treidelknecht zu.
»He, Steffen, die Herrin wünscht Rheinsobern heute noch zu erreichen!«
»Die Dame kann leicht befehlen, aber ich habe danach zwei abgetriebene Gäule, mit denen ich morgen nichts anfangen kann.«
Es war ein Spiel, das die Schiffer und Treidelknechte immer wieder aufführten, aber das konnte Marie nicht wissen. »Es soll ja nicht umsonst sein! Sag mir, was dir morgen an Verdienst entgeht, und ich werde es dir ersetzen.«
»Hörst du? Die Herrin gibt ein großzügiges Trinkgeld.« Der Schiffer streifte Marie mit einem abschätzigen Blick, denn schon oft hatten eilige Reisende hohen Lohn versprochen und sich am Ziel geweigert, das versprochene Aufgeld zu zahlen.
Marie begriff, dass sie die Männer bei Laune halten musste, und warf ihnen Geldstücke zu. Dabei fiel kein einziger Pfennig ins Wasser, obwohl der Treidelknecht ein ganzes Stück vor der Barke auf einem der Pferde ritt. Er fing die für ihn bestimmte Münze auf, biss prüfend in deren Rand und grinste.
»Los, ihr Zossen! Die Herrin will heute in der Rheinsoberner Vogtsburg schlafen!«
Die beiden Tiere legten sich stärker ins Geschirr, und das Schiff wurde merklich schneller. Da sich außer dem Schiffer und seinen Knechten nur Marie, Anni, Michi und zwei Bewaffnete an Bord befanden, die Michel Marie zum Schutz mitgegeben hatte, lag die Barke hoch im Wasser, und die Pferde holten rasch einen tief im Wasser liegenden Prahm ein, dessen Gäule sich sichtlich schwerer taten. Die Leute des anderen Bootes dachten nicht daran, den schnelleren Kahn vorbeizulassen, doch das großzügige Trinkgeld und die Aussicht auf mehr stachelten Maries Schiffer an. Er steuerte das Boot weiter auf den Rhein hinaus, um Abstand von dem Prahm zu gewinnen, und dann hoben seine Knechte die Zugseile mit ihren Stangen hoch, während der Treidelknecht die Stelle nutzte, an der keine Weiden und Erlen am Ufer standen, um an den Pferden des anderen Treidelzugs vorbeizutraben.
Der Steuerer des überholten Frachtschiffs schimpfte wie ein Rohrspatz, denn er hatte eine tiefe Verbeugung machen müssen, um nicht von dem über sein Boot schwingenden Treidelseil von Bord gerissen zu werden. »Dafür setzt es heute Abend Prügel!«, drohte er Maries Schiffer.
Dieser winkte mit einem unflätigen Fluch ab, doch Marie warf den Männern auf dem überholten Schiff mehrere kleine Münzen zu. »Trinkt lieber einen Becher Wein auf meine Gesundheit!« Dann ließen sie den schweren Prahm hinter sich zurück.
Der Schiffer der Barke wandte sich nun sichtlich zufrieden an Marie. »Jetzt werden wir Rheinsobern rechtzeitig erreichen. Sollen wir dort auf Euch warten?«
Marie wollte nicht allzu lange bei Hiltrud bleiben, sagte sich aber, dass es dem Schiffer und seinen Leuten wohl kaum gefallen würde, zwei bis drei Wochen nutzlos in Rheinsobern herumzulungern. »Es steht dir frei, neue Passagiere oder Fracht aufzunehmen. Doch solltest du innerhalb einer Monatsfrist wieder nach Rheinsobern kommen, lass es mich wissen. Zu dieser Zeit will ich rheinabwärts reisen.«
»Wohl, wohl!« Der Schiffer überlegte, wie er es einrichten könnte, rechtzeitig zur Stelle zu sein. Die Dame hatte sich als ebenso freundlich wie großzügig erwiesen, und es war ihm lieber, solche Passagiere zu befördern, als sich mit schweren Kisten und Fässern abzuplagen.
Sie passierten den letzten Ort vor ihrem Ziel, dann grüßten die Rheinsoberner Türme von dem Höhenzug jenseits des Hochufers zu ihnen herüber. Während Marie die Stadt, in der sie fast zehn Jahre ihres Lebens verbracht hatte, mit gemischten Gefühlen betrachtete, konnte Michi es kaum erwarten, an Land zu kommen. Er brannte darauf, seine Eltern und Geschwister wiederzusehen und ihnen die feinen Kleider vorzuführen, die er jetzt tragen durfte. Seine hellgrünen Strumpfhosen schmiegten sich eng an die Beine, und sein rotes Wams war aus gutem Stoff genäht und mit hübschen Stickereien versehen. Sein ganzer Stolz waren jedoch die weichen, spitz zulaufenden Schuhe und das rote, mit einer echten Reiherfeder geschmückte Barett, welches auch das Haupt eines Edelmanns hätte zieren können.
Anni hatte ihn wegen dieser farbigen Pracht bereits geneckt, denn neben ihm wirkte sie in ihrem strengen Gewand wie ein grauer Schatten. Anders als andere Adelsdamen hätte Marie ihr durchaus erlaubt, eine gefälligere Farbe zu tragen, doch das Mädchen zog die unauffällige Kleidung einer höheren Dienstmagd jedem Schmuck und Putz vor. Das mochte ein Nachhall des Grauens sein, das Anni durchlitten hatte, denn sie war die einzige Überlebende eines Hussitenüberfalls auf ihr Heimatdorf gewesen und hatte es nur Maries fürsorglicher Pflege zu verdanken, dass sie überhaupt noch am Leben war.
Marie hatte sich für die Reise so bequem wie möglich gekleidet und trug nun einen weiten blauen Rock, ein weinrotes Mieder und gegen die Kühle der Nacht eine Wolljacke, die ihr ihre tschechische Wirtschafterin Zdenka gestrickt hatte. Als Kopfbedeckung diente ihr ein Strohhut, wie ihn die Frauen in ihrer neuen Heimat bei der Arbeit in den Weinbergen trugen und der sie besser vor der Sonne schützte als jene Haube mit Schleierbesatz, die ihrem Stand als Ehefrau eines freien Reichsritters angemessen gewesen wäre.
Kurz bevor es dämmerte, erreichten sie den kleinen Hafen von Rheinsobern. Der Treidelknecht führte seine Pferde so, dass das Schiff vom eigenen Schwung getrieben erst vor der hölzernen Pier langsamer wurde, und wand die nun durchhängende Leine um einen dicken Pfahl. Während die Schifferknechte das Boot vertäuten, schwang er sich von seinem Reittier und verbeugte sich vor Marie. »Meine Braunen haben gut gezogen! Findet Ihr das nicht auch, Herrin?«
Marie verstand dies genau so, wie es gemeint war, nämlich als Aufforderung, ihre Geldkatze zu öffnen. Das tat sie auch und zählte dem Mann mehrere Münzen in die Hand. »Kauf deinen Pferden eine gute Portion Hafer dafür. Sie haben es verdient.«
Der Treidelknecht beäugte das Geld und fand, dass allein die kleineren Münzen für Hafer wie auch für ein gutes Essen und Becher süffigen Weines ausreichten. Das große Geldstück wollte er zu seinen Ersparnissen legen. Noch ein paar solch großzügige Trinkgelder und er konnte sich ein eigenes Treidelpferd kaufen. Dann würde er nicht mehr gegen geringen Lohn die Arbeit für andere tun müssen.
Er verbeugte sich noch tiefer vor der Edeldame. »Ihr seid sehr großzügig, Herrin! Meine Pferdchen werden sich freuen.«
Marie nickte ihm lächelnd zu und stieg an Land. Michi überließ es Anni, sich um das Gepäck zu kümmern, und folgte auf dem Fuße. »Was meinst du, Frau Marie, wollen wir gleich zu meinen Eltern gehen oder hier in der Herberge übernachten?«
Marie streifte die Herberge am Hafen mit einem skeptischen Blick. »Da drinnen möchte ich lieber nicht schlafen, außerdem kann ich es kaum mehr erwarten, deine Eltern wiederzusehen.«
Es waren nicht nur die lärmenden Stimmen der Schiffsknechte, die sie abschreckten. Die Rheinaue war sumpfig, und in ihr wimmelte es nur so von Blut saugenden Fliegen und Mücken. Zudem sah man dem Gebäude schon von außen an, dass es nicht den Ansprüchen gehobener Reisender genügte. Marie wusste von früher, dass Leute von Adel und reiche Kaufleute die halbe Stunde Fußmarsch in Kauf nahmen, um in den behaglichen Gasthäusern von Rheinsobern zu übernachten. Deshalb warteten meist ein paar Sänftenträger in der Kneipe auf Kunden. Auch diesmal eilten Männer herbei und priesen ihre Dienste an.
Nach einem Blick auf die Sonne, die schon halb hinter den Hügeln jenseits des Stroms verschwunden war, schickte Marie die Träger weg. »Wir können den Ziegenhof noch vor Einbruch der Dunkelheit erreichen. Anni, du kommst mit uns. Gereon, Dieter, ihr nehmt euch des Gepäcks an.«
Sie drehte den beiden Waffenknechten den Rücken zu und eilte los, ohne ihnen Gelegenheit zu geben, sich über diesen in ihren Augen unwürdigen Auftrag zu beschweren. Michi lief schon voraus, während Anni eine der Kisten öffnete und die Gegenstände herausnahm, die sie als unbedingt notwendig erachtete.
Dieter, ein großer, vierschrötiger Mann mit kantigem Kinn, der, wie Anni wusste, zu den eher gutmütigen und auch recht leichtgläubigen Leuten gehörte, winkte zwei Herbergsknechte zu sich. »He, ihr Burschen, bringt diese Kisten in den Gasthof und sorgt dafür, dass morgen früh ein Fuhrwerk für uns bereitsteht.«
Die Wirtsknechte sahen das Wappen mit dem auf einem Stein stehenden Kiebitz, welches die beiden Reisigen auf der Brust trugen, und wieselten eifrig herbei. Von solchen Reisenden war zwar kein gutes Trinkgeld zu erwarten, doch wenn man ihnen nicht gehorchte, erntete man meist ein paar derbe Ohrfeigen.
III.
Maries Schritte wurden immer schneller, so dass sie Michi überholte und er sich nun beeilen musste, an ihrer Seite zu bleiben. Sie folgte zunächst ein Stück dem Weg nach Rheinsobern, bog dann nach rechts auf einen schmalen Pfad ein, der zwischen abgeernteten Getreidefeldern hindurchführte, und erreichte nach weniger als einer halben Stunde einige Bauernhöfe, die nahe genug beieinander lagen, um als Dorf gelten zu können. Der größte und schönste Hof gehörte Hiltrud. Noch während Marie sich fragte, was ihre Freundin zu ihrem überraschenden Auftauchen sagen würde, trat diese mit einem Holzeimer voller Essensabfälle aus dem Haus und wandte sich dem Schweinekoben zu. Als sie Marie und Michi bemerkte, blieb sie so ruckartig stehen, als wäre sie gegen eine Wand gelaufen. Der Eimer entglitt ihrer Hand und ergoss seinen Inhalt auf den sauber gefegten Hofplatz. Sie schien die Bescherung nicht zu bemerken, denn sie öffnete und schloss ein paarmal den Mund, stieß dann einen gellenden Schrei aus und rannte den Ankömmlingen entgegen.
»Marie! Bist du es wirklich? Du lebst ja!« Hiltrud umfasste ihre Freundin und herzte sie, ohne den Tränen Einhalt gebieten zu können, die wie kleine Bäche über ihre Wangen liefen.
Maries Augen wurden ebenfalls feucht. »Es ist so schön, dich wiederzusehen.«
Hiltrud wurde von einem heftigen Schluchzen geschüttelt. »Du hast nie Nachricht geschickt, und ich war fest überzeugt, du seiest tot. Mein Gott, wie oft habe ich um dich geweint – und um Michi!«
Ihr Blick wanderte zu ihrem Sohn, der als Knabe fortgegangen war und nun als Jüngling mit dem ersten Anflug eines Bartes auf der Oberlippe zurückkehrte. Sie löste einen Arm von ihrer Freundin und umschlang den Jungen. Dabei zitterten ihre Lippen so, dass sie kein Wort herausbrachte.
Von dem Lärm angelockt, trat Hiltruds Ehemann Thomas aus dem Stall, starrte seine Frau und die beiden Personen an, die diese umschlungen hielt, und schlug das Kreuz. »Bei der Muttergottes! Kann ich meinen Augen trauen?«
Er eilte auf die Gruppe zu, streckte die Hand aus und berührte Marie an der Schulter, als müsse er sich überzeugen, dass ihn kein Trugbild narrte. Dann sah er Michi an und brach nun ebenfalls in Schluchzen aus.
Michi schob den Arm seiner Mutter sanft weg und ließ sich von seinem Vater an die Brust ziehen. »Nicht weinen, Papa«, flüsterte er, konnte aber selbst die Tränen nicht zurückhalten.
Unterdessen quollen Hiltruds und Thomas’ übrige Kinder aus der Tür des Wohnhauses und umringten die Besucher. »Tante Marie! Es ist Tante Marie!«, schrie Mariele, die Älteste, immer wieder.
Ihre Schwester Mechthild interessierte sich mehr für den schmucken Jungen, der ihr fremd und doch so bekannt vorkam. Schließlich stemmte sie die Arme in die Hüften und schüttelte ungläubig den Kopf. »Das ist tatsächlich Michi! Bei der Heiligen Jungfrau, bist du aber groß und stark geworden!«
»… und was für ein prächtiges Gewand er trägt!« In Marieles Stimme schwang eine gehörige Portion Neid, denn sie besaß nur zwei einfache, mit einem Band an der Taille geraffte Kleider aus derbem Stoff wie andere Bauernmädchen auch und schwelgte oft in der Erinnerung an jene Tage, die sie mit ihrer Patin Marie am Hof des Pfalzgrafen in Heidelberg verbracht hatte. Damals war sie ähnlich herausgeputzt gewesen wie nun ihr Bruder. Sie streifte Marie mit einem hoffnungsvollen Blick und sagte sich, dass die Tante gewiss nicht ohne reiche Geschenke gekommen war.
Marie umarmte Hiltruds übrige Kinder und wunderte sich, wie sie in den letzten Jahren gewachsen waren. Mariele war nun fast elf Jahre alt und versprach eine Schönheit mit weißblonden Haaren zu werden. Die hohe Gestalt der Mutter hatte sie jedoch nicht geerbt, ganz im Gegensatz zu Mechthild, die bereits jetzt einen halben Kopf größer war als ihre ältere Schwester. Auch deren Haar war hellblond, aber ihre Gesichtszüge wirkten etwas schlichter als Marieles. Dietmar und Giso, die beiden jüngsten Söhne, waren noch zu kindhaft, als dass man hätte abschätzen können, wie sie sich einmal entwickeln würden. Da Michi nicht vorhatte, den Dienst bei seinem Patenonkel zu verlassen, würde einer von ihnen später einmal den Hof übernehmen.
Hiltrud wischte sich die nassen Augen mit dem Ärmel trocken und deutete auf die Tür. »Kommt herein! Ihr habt doch gewiss noch nicht zu Abend gegessen.«
Marie spürte, wie ihr Hunger bei diesen Worten erwachte, und nickte. »Dazu haben wir uns keine Zeit genommen, denn wir wollten so schnell wie möglich bei euch sein. Darf ich dir meine Zofe Anni vorstellen? Sie hat ein schlimmes Schicksal hinter sich und ihre Geschichte wird dich gewiss interessieren.«
Anni blickte zu der Bäuerin auf, die ihr wie eine Riesin aus einem Märchen erschien, erwiderte scheu deren Lächeln und sah ihr ehrfürchtig nach, als diese an ihr vorbei auf das Haus zuging. Während Mariele sich bei ihrer Patin unterhakte und sich an sie schmiegte, blieb Mechthild vor Anni stehen und streckte die Hand nach deren Bündel aus. »Komm, gib es mir. Ich bringe es in die Schlafkammer, die für Frau Marie bereitsteht. Du wirst dich gewiss zur Tante setzen wollen.«
Anni musterte die Zehnjährige und fand, dass sie ihr vertrauen konnte. Sie reichte ihr das Bündel, ließ sie aber nicht aus den Augen, bis sie wusste, in welcher Kammer Mechthild die Sachen ablegte. Dann folgte sie dem Mädchen in die Küche, in der Marie und Michi es sich bereits gemütlich gemacht hatten.
Trotz ihrer Freude, ihre Freundin und ihren Sohn wiederzusehen, vergaß Hiltrud ihre Pflichten als Gastgeberin nicht und tischte eine Brotzeit auf, die für einen halben Heerzug ausgereicht hätte. Marie biss fröhlich in das schmackhafte graue Brot, das mit einer dicken Schicht Butter und Schinken belegt war, und wartete auf die Fragen, die unweigerlich kommen mussten. Als die Tischplatte so dicht mit Tellern, Tiegeln und Schüsseln bedeckt war, dass die Tonbecher kaum noch Platz fanden, setzte Hiltrud sich neben ihre Freundin und legte die Hand auf ihren Arm. »Was ist mit Trudi?«
»Die ist zu Hause bei Michel.« Marie lachte hell auf, als sie das fassungslose Gesicht ihrer Freundin sah.
»Du hast ihn tatsächlich gefunden? Wie habe ich daran nur zweifeln können!«
Hiltrud schnaufte und schüttelte ein über das andere Mal den Kopf. Manchmal sah es so aus, als läge der Fluch einer bösen Fee auf ihrer Freundin. Dann aber schien es, als sei Marie mit einer Glückshaut geboren worden, die ihr selbst das schlimmste Unglück zum Guten ausschlagen ließ.
»Ich glaube, du hast mir wirklich einiges zu erzählen. Aber jetzt iss erst einmal. Du siehst verhungert aus.«
Marie protestierte vehement. »Ich und verhungert? Da hört sich doch alles auf. Allerdings, wenn ich mich mit dir vergleiche …«
Ihr Spott konnte die Freundin jedoch nicht treffen. »Immerhin habe ich die vierzig schon eine Weile hinter mir gelassen, auch wenn ich nicht genau weiß, wann das war. Es gibt nun mal kein Kirchenbuch, in dem meine Geburt vermerkt worden ist.«
Dabei musterte Hiltrud Marie und breitete verwundert die Hände aus. Ihre Freundin schien um keine Stunde älter zu sein als an jenem Tag, an dem sie Rheinsobern verlassen hatte, um Michel zu suchen. Eigentlich wirkte sie sogar jünger und viel munterer. Aber das war wohl nicht verwunderlich, denn damals hatten sie die schlimme Zeit mit den Banzenburgern, von denen sie während ihrer Schwangerschaft wie eine Gefangene gehalten worden war, die Geburt und die ständige Angst um Michel niedergedrückt und gezeichnet. Jetzt aber erschien Marie so zeitlos schön, dass Hiltrud näher rückte, um das Gesicht ihrer Freundin im Schein des Herdfeuers und einiger Talglichter genauer zu betrachten. Da waren tatsächlich ein paar feine Fältchen um die Augen und zwei kaum wahrnehmbare Kerben an den Mundwinkeln, doch nichts deutete darauf hin, dass ihre Freundin bald das sechsunddreißigste Jahr vollenden würde.
»Kannst du dich noch an Kunigunde von Wanzenburg erinnern?«, setzte sie das Gespräch fort.
»Du meinst Banzenburg«, korrigierte Marie sie.
»Ich meine, was ich sage! Da hatte der Pfalzgraf uns eine arg verlauste Gesellschaft nach Rheinsobern geschickt. Es wird dich sicher freuen zu hören, dass dieses Miststück über ihre eigenen Schliche und Intrigen zu Fall gekommen ist. Vor einem Jahr hat Herr Ludwig ihren Mann seines Amtes enthoben und an die böhmische Grenze geschickt, und ich hoffe, sie werden dort den aufständischen Hussiten zum Opfer fallen – oder sind es schon.« Hiltrud war sonst nicht so gehässig, doch die Banzenburger hatten, wie sie Marie wortreich erzählte, während ihrer Zeit auf der Vogtsburg die Bauern der Rheinsoberner Vogtei gegen jedes geschriebene Recht ausgepresst. Auch Hiltrud und ihr Mann hatten zwei Kühe als Sondersteuer abgeben müssen und dies trug die Bäuerin Michels Nachfolger und dessen Frau immer noch nach.
»Das kann uns unter dem nächsten Vogt nicht mehr passieren. Thomas und ich haben uns nämlich mit Wilmars Hilfe ein Haus in der Stadt und das Bürgerrecht gekauft. Unser Hof zählt jetzt zum Stadtfrieden und ist durch städtisches Recht vor dem Zugriff der Edelleute geschützt.«
Hiltruds Worte erinnerten Marie an ihre Verwandten in Rheinsobern, die sie auch würde aufsuchen müssen. In all der Zeit hatte sie kaum einmal an Hedwig und Wilmar gedacht, und nun leistete sie den beiden in Gedanken Abbitte. Dann erfüllte sie Hiltruds Wunsch, ihr von all den Abenteuern zu erzählen, die sie seit ihrer Abreise erlebt hatte. Einige besonders unangenehme Dinge verschwieg sie, um das Gemüt ihrer Freundin nicht zu stark zu belasten.
»Von Frau Kunigunde und dem Schicksal ihrer Sippe habe ich schon auf dem Weg von Falkenhain nach Nürnberg gehört«, setzte sie mit einem zufriedenen Lachen hinzu. »Unterwegs sind wir auf Konrad von Weilburg und seine Frau getroffen, die vom Pfalzgrafen ebenfalls an die Grenze der Oberen Pfalz zu Böhmen geschickt worden waren. Sie haben sich gut eingelebt und hoffen, dort ein Lehen zu erhalten. Die Banzenburger haben es jedoch schlechter getroffen, und Frau Kunigunde und ihre zahlreiche Nachkommenschaft sollen den gefüllten Fleischtöpfen von Rheinsobern arg nachtrauern.«
Hiltrud nickte sinnend. »Das kann ich mir gut vorstellen, denn hier haben sie es sich gut gehen lassen. Wären sie nicht so gierig gewesen, würden sie noch heute in der Vogtsburg hausen und Rheinwein trinken können.« Sie hielt kurz inne, strich sich eine Strähne ihres weißblonden Haares aus der Stirn, die aus ihrer Haube geschlüpft war, und warf Marie einen auffordernden Blick zu. »Du wirst der Gemahlin des neuen Burghauptmanns einen Besuch abstatten müssen. Wir haben zwar wenig mit diesen Leuten zu tun, aber sie würden es uns gewiss verübeln, wenn wir eine Dame von Stand beherbergen, die nicht die Höflichkeit besitzt, sie zu begrüßen.«
Marie verzog ihr Gesicht wie ein schmollendes Kind. »Muss das sein? Ich hatte mir geschworen, die Vogtsburg nie mehr zu betreten.«
Im Grunde ihres Herzen wusste sie jedoch, dass Hiltrud Recht hatte, und es hätte nicht eines strafenden Blickes bedurft, sie anderen Sinnes werden zu lassen. »Also gut! Ich werde mich morgen auf den Weg zur Sobernburg machen. Danach kann ich ja Hedwig und Wilmar aufsuchen.«
»Das will ich doch hoffen! Die beiden würden kein Wort mehr mit mir sprechen, wenn sie erführen, dass du zu mir gekommen bist, ohne sie gleich am nächsten Tag zu besuchen. Sie mögen dich sehr, das weißt du ja, und ich hatte in den letzten Jahren einiges zu tun, Hedwigs Grillen zu fangen.«
»Du musstest Grillen fangen?« Marie starrte ihre Freundin verständnislos an und erhielt dafür einen kleinen Nasenstüber.
»Nicht die auf dem Feld, deren Konzert du jetzt durch das Fenster hören kannst, sondern jene in Hedwigs Kopf. Sie hat sich mehr Sorgen um dich, Trudi und Michi gemacht, als für sie gut war, und ist ihres Lebens nicht mehr froh geworden.«
»Es wird ihr besser gehen, wenn ich gesund und munter vor ihr stehe. Aber jetzt gib mir noch eines von deinen köstlichen Broten und einen Becher vermischten Weines. Ich will es genießen, endlich wieder bei dir zu sein.« Marie lehnte sich lächelnd zurück und zwinkerte ihrer Freundin zu. Trotz der Zeit, die seit ihrer Abreise nach Böhmen vergangen war, fühlte sie sich auf dem Ziegenhof so wohl wie am ersten Tag. Die Ängste, die sie während ihrer Fahrt hierher bis in ihre Träume verfolgt hatten, schienen ihr jetzt so fern, dass sie sich kaum daran erinnern konnte.
IV.
Die Vogtsburg von Rheinsobern war ein alter Bau mit hohen Mauern, engen Innenhöfen und einem schon von außen nicht besonders wohnlich wirkenden Hauptgebäude. Generationen von Burghauptleuten und Vögten hatten mit ihren Familien hier gelebt und sich entweder mit den Verhältnissen abgefunden oder versucht, die Gebäude mit eher geringen Mitteln ihren Bedürfnissen anzupassen. Erfolg aber war keinem beschieden worden. Auch Isberga von Ellershausen, die Gemahlin des neuen pfalzgräflichen Vogts, hatte diesen Kampf aufgenommen und ihn zumindest in ihrer Kemenate gewonnen. Auf den weichen Polstern, die in den geflochtenen Sesseln lagen, ließ es sich vortrefflich sitzen und schwatzen. Frau Isberga liebte Gespräche und hatte ihre Leibmägde und ihre Wirtschafterin zu guten Zuhörerinnen erzogen.
An diesem Tag war sie es jedoch, die zuhören musste. Alles, was sie einflechten konnte, war ab und an ein »Das ist ja entsetzlich!«, »Was für ein Unglück!« und »Du Ärmste!«. Sie bedauerte das schwere Schicksal der Dame, die ihr gegenübersaß, kam aber nicht umhin, sich zu fragen, warum Hulda von Hettenheim ihre feiste, schwerfällig wirkende Gestalt durch ein so unkleidsames Gewand unterstreichen musste. Braun und Ocker waren nun einmal keine Farben für eine Frau mit fleckigem Teint und mausfarbenem Haar. Aber sie kannte ihre Freundin schon lange und wusste, dass diese jeden noch so gut gemeinten Ratschlag als Kritik auffasste. Daher hielt sie sich gegen ihre sonstige Gewohnheit zurück, obwohl ihr scharfe Worte auf der Zunge lagen. Seit Falko von Hettenheims Ableben schien Hulda sich noch weniger zu pflegen als früher und ganz in ihrer mit Hass vermischten Trauer aufzugehen.
Nun berichtete sie in vielen Wiederholungen und mit bissigen Worten durchmengt, wie der Kaiser ihren Ehemann Falko zuerst gedrängt hatte, in seine Dienste zu treten, und ihn dann hatte fallen lassen wie eine heiße Kastanie.
»Wenn es einen gerechten Gott im Himmel gibt, wird dieser Verrat Sigismund zum Schlechten ausschlagen!« Hulda reckte die Fäuste zur Decke und machte ein Gesicht, als wolle sie den Herrn des Römischen Reiches Deutscher Nation persönlich erwürgen.
Isberga von Ellershausen erlaubte normalerweise weder sich noch anderen Menschen, Kritik an einem Gesalbten zu üben, der Gott so nahe war, dass nur noch der Papst zwischen ihnen stand. Bei Hulda ließ sie jedoch Nachsicht walten, denn zum einen war diese die Tochter Rumold von Lauensteins, eines hoch angesehenen Höflings des Pfalzgrafen, der bei seinem Herrn leicht ein böses Wort über jemanden fallen lassen konnte, und zum anderen sah man ihr deutlich an, dass sie gesegneten Leibes war. Ihren Worten zufolge würde sie in weniger als drei Monaten den Erben von Hettenheim gebären. Also wollte Isberga sie nicht mit scharfen Worten in Wallung treiben und vielleicht schuld daran sein, wenn Hulda mit einer Frühgeburt oder gar einem totgeborenen Kind niederkam.
Daher fasste sie die Hände ihrer Freundin und sah sie lächelnd an. »Errege dich doch nicht so, meine Liebe. Schenke deine ganze Kraft dem Kind, das unter deinem Herzen wächst. Du willst doch einen gesunden Sohn gebären, der einmal die Herrschaft seines Vaters übernehmen kann!«
Über das teigige Gesicht Hulda von Hettenheims huschte ein selbstsicheres Lächeln. »Es wird ganz gewiss ein Sohn werden! Das haben mir der ehrwürdige Eremit Heimeran und eine weise Frau prophezeit.«
Isberga musste ein Kichern unterdrücken. Ihre Freundin hatte bereits sechs Töchter, und kaum jemand am Hof des Pfalzgrafen wettete auf einen Erben Falko von Hettenheims. Doch Hulda schien sich ihrer Sache sicher zu sein, denn sie schwärmte nun davon, dass die Geburt ihres Sohnes den von ihr gehassten Vetter ihres Mannes, Heinrich von Hettenheim, weiterhin an den Stand eines armen, von einem geizigen Abt abhängigen Ritters fesseln würde.
»Dieser Kerl macht sich doch tatsächlich Hoffnungen, mich und meine armen Töchter von Hettenheim vertreiben und mit seiner Brut dort einziehen zu können. Eher würde ich meine Seele verkaufen, als dies zuzulassen!«
Die Burgherrin zuckte zusammen und bekreuzigte sich. »Versündige dich nicht vor Gott, Hulda! Sonst könnte der Himmel dich mit einer weiterer Tochter strafen – oder, schlimmer noch, mit einem schwächlichen Sohn, der die erste Woche nicht überlebt.«
Hulda von Hettenheim winkte mit einem bösen Auflachen ab. »Ich werde gewiss kein schwächliches Kind gebären. Alle meine Töchter waren bei ihrer Geburt ungewöhnlich kräftig. Also wird auch mein Sohn ein starkes, munteres Kind sein.«
»Beten wir zu Gott, dass er dich erhört!« Frau Isberga hätte ihrer Freundin aufzählen können, dass sie mindestens schon drei Kinder kurz nach der Geburt verloren hatte, aber sie wurde das Thema allmählich leid. Früher hatte Hulda den neuesten Klatsch vom Hof des Pfalzgrafen zu berichten gewusst, doch jetzt drehte sich ihr ganzes Denken um ihren ungeborenen Sohn und die Rache, die dieser an den Feinden seines Vaters nehmen würde. Auch aus diesem Grund hoffte die Burgherrin, ihre Freundin würde sich nicht zu lange bei ihr aufhalten, denn sonst konnte es womöglich zu spät für eine Weiterreise werden, und sie wollte Hulda nicht bis zu deren Niederkunft und darüber hinaus noch bis ins warme Frühjahr am Hals haben.
Das Eintreten ihrer Wirtschafterin gab ihr die Möglichkeit, Huldas Monolog zu unterbrechen. »Was ist, Tine?«
»Es ist Besuch für Euch gekommen, Herrin.«
»Ich erwarte eigentlich niemanden. Wer ist es denn?«
»Die Gemahlin des ehemaligen Burghauptmanns und Vogts von Rheinsobern«, lautete die ebenso unerwartete wie unangenehme Antwort.
»Kunigunde von Banzenburg? Die hat mir gerade noch gefehlt.« Frau Isberga schüttelte sich bei dem Gedanken, ihre Vorgängerin auf der Sobernburg könne vor ihrer Tür stehen. Diese Frau würde sie auf keinen Fall empfangen.
Tine schüttelte jedoch den Kopf. »Es ist nicht die Banzenburgerin, sondern Frau Marie Adlerin, die zusammen mit ihrem Gemahl, dem jetzigen Reichsritter Michel Adler auf Kibitzstein, zehn Jahre lang die Vogtei geführt hat.«
Isberga konnte ihre Überraschung nicht verbergen. »Marie Adlerin? Die Dame wollte ich schon lange kennen lernen! Bring sie herein, rasch!«
Frau Hulda stieß einen Schrei aus, als wolle ihr jemand einen Dolch ins Herz stoßen. »Nein! Nein! Dieser Hexe will ich nicht begegnen. Die ist schuld am Tod meines Gemahls!«
Bisher hatte sie mit niemandem reden können, der bei jenem Zweikampf zugegen gewesen war, bei dem ihr Mann den Tod gefunden hatte. Nur ihr Vater hatte ihr geschrieben, dass Ritter Falko von Michel Adlers Klinge gefällt worden war. Sie war davon überzeugt, dass dessen Weib mit Gift oder geheimen Kräften nachgeholfen hatte. Wie sonst hätte der Sohn eines gemeinen Konstanzer Gassenschenks einen Recken wie Falko von Hettenheim besiegen können?
Hulda wollte ihre Freundin schon bitten, Marie nicht zu empfangen, aber dann überwog ihre Neugier. Sie wollte die Frau wiedersehen, die an ihrem Unglück schuld war, allerdings nicht von Angesicht zu Angesicht. Mit einem tiefen Seufzer stand sie auf. »Meine liebe Isberga, erlaube mir, mich zu entfernen. Mir ist nicht danach, fremde Leute zu sehen.«
Die Burgherrin musste an sich halten, um nicht erleichtert das Kreuz zu schlagen. Solange Hulda mit sauertöpfischem Gesicht dabeisaß, würde keine angeregte Unterhaltung mit ihrem neuen Gast aufkommen. Dabei war sie gespannt darauf, was Marie Adlerin zu berichten wusste. Vielleicht konnte sie der Frau sogar ein paar pikante Anekdoten aus jener Zeit entlocken, in der diese als schmutzige Wanderhure durch die Lande gezogen war. Isberga erinnerte sich mit einem gewissen Schuldgefühl, aber auch mit einer durchaus angenehmen Erinnerung an die Nacht, in der ihr Mann stark angetrunken zu ihr ins Ehebett gekommen war und sie gebeten hatte, sich ihm wie eine Stute zu präsentieren. Sie hatte natürlich gehorcht, war aber am nächsten Morgen zu ihrem Burgkaplan gegangen und hatte den Vorfall gebeichtet. Die Sühnegebete, die ihr und ihrem Gemahl auferlegt worden waren, hatte sie jedoch alleine gesprochen, denn ihr Gatte hätte sie geschlagen, wenn sie ihn dazu aufgefordert hätte. Der Vorfall war ihr deutlich in Erinnerung geblieben, und selbst jetzt fühlte sie bei dem Gedanken an jene Nacht ein wohliges Ziehen zwischen den Schenkeln.
Hulda packte Isberga bei der Schulter, als wolle sie sie schütteln, denn ihre Gastgeberin war ihr eine Antwort schuldig geblieben.
Isberga lächelte verlegen. »Ich verstehe dich gut, meine Liebe. Geh in dein Zimmer und lege dich ein wenig hin.« Sie wartete, bis Hulda durch die Tür trat, die in einen Nebenraum führte, strich dann erwartungsvoll ihr Kleid glatt und winkte der Dienerin, den neuen Gast hereinzuführen.
Hulda war gleich hinter der Tür stehen geblieben und blickte nun durch einen kaum fingerbreiten Spalt in Isbergas Kemenate. Als Marie eintrat, biss sie die Zähne zusammen, um den Fluch zurückzuhalten, der sich in ihrer Kehle ballte. Michel Adlers Weib war womöglich noch schöner geworden, und jede ihrer Gesten und jedes Wort drückten Selbstsicherheit und Zufriedenheit aus. Am meisten ärgerte Hulda sich jedoch, wie freundlich Isberga von Ellershausen die ehemalige Hure empfing. Die Frau, die sie für eine Freundin gehalten hatte, begrüßte Marie Adlerin so ehrerbietig, als sei diese schon als Tochter eines Reichsritters zur Welt gekommen. Dabei war das Weib genauso wie ihr Mann Abschaum aus der Gosse.
Hulda von Hettenheim spürte, wie der Hass in ihr hochschäumte und gleich einer roten Woge über ihr zusammenschlug. Hätte sie einen Dolch oder ein größeres Messer als das aus ihrem Essbesteck zur Hand gehabt, welches in einer Ziertasche an ihrem Gürtel hing, wäre sie hinausgestürmt und hätte diese Hure umgebracht. Bei dem Gedanken schüttelte sie verbissen den Kopf, denn es schien ihr doch nicht der richtige Weg zu sein, diese Hexe auf der Stelle zu töten. Viel befriedigender wäre es, der Hure das Gesicht zu zerschneiden, bis es einer Teufelsfratze glich, und dann bei den Brüsten weiterzumachen. Tief in ihre hasserfüllten Vorstellungen verstrickt, achtete sie zunächst nicht auf das Gespräch und schreckte hoch, als Isberga nach Maries Tochter fragte.
»Wie ich hörte, seid Ihr noch hier auf der Sobernburg Mutter geworden. Euer Kind ist hoffentlich wohlauf?«
Marie nickte lächelnd, obwohl sie Trudi nicht in der Vogtsburg, sondern auf Hiltruds Ziegenhof zur Welt gebracht hatte. »Meinem Schatz geht es ausgezeichnet. Ich habe ihn bei meinem Mann zurückgelassen, der wegen der böhmischen Unruhen lange auf Trudi verzichten musste.«
»Euer Gemahl soll in Böhmen sehr tapfer gekämpft und dem Kaiser selbst das Leben gerettet haben. Ist es wahr, dass er für diese Tat zum freien Reichsritter erhoben wurde?« Isbergas Frage war eigentlich überflüssig, denn sie hatte etliche Gerüchte vernommen, die sich um den ehemaligen Schankwirtssohn drehten, aber der Neid, den sie jedes Mal empfand, wenn die Rede auf den Kibitzsteiner kam, legte ihr diese Worte auf die Lippen. Während ihr Ehemann auf die höchst wankelmütige Gunst seines Lehnsherrn angewiesen war, lebte Michel Adler nun als reichsunmittelbarer Ritter unbekümmert auf seiner Burg, ohne die Forderung eines Höheren fürchten zu müssen, denn er war allein dem Kaiser verpflichtet. Eine Freundin Isbergas hatte das große Glück gehabt, den Herrn einer reichsunmittelbaren Herrschaft heiraten zu dürfen, und schwärmte in ihren Briefen davon, welch glückliches Leben sie nun führe.
Marie bemerkte, dass ihre Gastgeberin eigenen Gedanken nachhing, und wartete mit der Antwort, bis Isberga ihr wieder Aufmerksamkeit schenkte. »Das ist richtig. Mein Michel hat Herrn Sigismund das Leben gerettet und ihm zudem hohe Herren aus Böhmen zugeführt, die bereit sind, ihr Knie wieder vor dem Kaiser zu beugen, der ja auch die böhmische Königskrone trägt.«
Während Marie ihrer Gastgeberin einen kurzen Bericht über die Geschehnisse gab, presste Hulda von Hettenheim im Raum nebenan die Kiefer zusammen, um nicht vor Wut aufzuschreien.
Ihr Mann Falko hatte oft davon gesprochen, wie unfähig, alt und senil der Kaiser geworden sei. Dabei hatte er ihn als einen überängstlichen Greis bezeichnet, der einen lumpigen Wirtssohn zum Reichsritter erhoben hatte, nur weil dieser einem vorwitzigen Böhmen, der Sigismund zu nahe gekommen war, den Kopf abgeschlagen hatte. Er selbst aber war nur mit einem Bettel abgespeist worden, obwohl er in Dutzenden von Kämpfen und Scharmützeln sein Blut für Kaiser und Reich vergossen hatte. Auch sie verfluchte Sigismund innerlich, denn wenn der Kaiser ihren Gemahl zum freien Reichsritter erhoben hätte, müsste sie sich jetzt nicht vor Angst verzehren, ihr nächstes Kind könne ebenfalls eine Tochter werden. Ein Reichslehen hätte auch ihre Älteste erben können, aber die Hausgesetze der zur Pfalz zählenden Herrschaft Hettenheim sprachen diese allein einem männlichen Erben zu.
»Dieser von Gott verfluchte Ritter Heinrich wird niemals in meiner Burg Einzug halten!« Der Klang ihrer eigenen Stimme brachte Hulda zu Bewusstsein, dass sie diesen Gedanken laut ausgesprochen hatte. Sie zuckte zusammen und spähte durch den Türspalt, um zu sehen, ob Isberga und Marie sie gehört hatten. Doch ihre Freundin lachte gerade über eine Bemerkung Maries und hatte den hasserfüllten Ausruf übertönt. Hulda wollte gerade erleichtert aufatmen, da hörte sie Marie sagen: »So Gott will, wird meine Trudi in weniger als fünf Monaten ein Geschwisterchen haben.«
Zunächst traf diese Bemerkung Hulda wie ein Schlag. Marie war schwanger, und mit der Bosheit des Satans würde dieses Weib einen Sohn zur Welt bringen, während sie wieder eine Tochter gebären würde. Zwar wüsste sich Hulda in diesem Fall zu helfen, denn sie hatte schon erste Vorkehrungen getroffen, doch mit einem Mal fürchtete sie, ihr Plan könne bereits an der Tatsache scheitern, dass ihr Mann ihres Wissens auf den Hettenheimer Besitzungen keinen einzigen männlichen Bastard gezeugt hatte. Plötzlich war sie sich sicher, dass dieses Weib sie und wahrscheinlich auch ihren verstorbenen Gatten verhext hatte. Schnell machte sie das Zeichen gegen den bösen Blick und zog sich leise aus der Kammer zurück. In einem dunklen Winkel des Korridors blieb sie stehen und presste ihre erhitzten Wangen gegen die kühle Mauer.
Nach einer schier endlos langen Zeit öffnete sich die Tür von Isbergas Kemenate und Marie verließ mit höflichen Abschiedsworten den Raum. Dann ging sie mit so schnellen Schritten den Korridor entlang, dass die Magd mit der Lampe kaum mit ihr Schritt halten konnte. Hulda wartete, bis sie nicht mehr gesehen werden konnte, und folgte ihrer Feindin.
V.
Marie war froh, als sie den Pflichtbesuch bei der Ehefrau des neuen Burghauptmanns hinter sich gebracht hatte. Isberga von Ellershausen war die schwatzhafteste Frau, die ihr je begegnet war, und eine der neugierigsten dazu, hatte sie doch nach Bettgeheimnissen gefragt, die nach Maries Ansicht niemanden etwas angingen. Auch schien die Burgherrin einen Hang zu haben, alles zu dramatisieren und zu übertreiben, denn sie hatte Eberhard, dem Vater des jetzigen Herzogs von Württemberg, ein Glied von der Größe eines Hengstes angedichtet und von ihr wissen wollen, ob Pfalzgraf Ludwig tatsächlich ein Muttermal an einer sehr delikaten Stelle hatte. Marie hatte die Frau nicht vor den Kopf stoßen wollen und so ausweichend wie möglich geantwortet.
Noch während Marie das recht einseitige Gespräch mit der Burgherrin im Kopf herumging, trat sie in die Eingangshalle, in der Gereon und ein Knecht von Hiltruds Hof auf sie warteten. Als sie die Dienerin mit ein paar Worten des Danks entließ, wäre sie beinahe über eine ältere Magd gestolpert, die im Dämmerlicht auf dem Fußboden kniete und die Platten schrubbte. Die alte Vettel hob sich in ihrem schmutzigen, zerrissenen Kleid kaum von den Steinen um sie herum ab und wirkte so schmierig, als schliefe sie in dem Dreck, den sie zusammenfegen musste. Als Marie leicht angeekelt um das Wesen herumging, richtete es sich mit einem wimmernden Laut auf und hielt sie am Saum ihres Überwurfs fest.
»Frau Marie? Oh, bei allen Heiligen, Ihr seid es wirklich!«
Jetzt erkannte Marie die Alte. Es war niemand anders als Marga, ihre einstige Beschließerin auf der Sobernburg. Die einst so hochnäsige Frau war im Ranggefüge der Dienstboten offensichtlich sehr tief gefallen, denn sonst würde sie nicht eine der niedrigsten Arbeiten verrichten müssen. Marie empfand eine leichte Befriedigung, erinnerte sie sich doch noch an all die Gemeinheiten, die ihr von dieser Person zugefügt worden waren. Bei der Nachricht von Michels angeblichem Tod hatte dieses Weib sie schamlos hintergangen, sich auf die Seite Kunigunde von Banzenburgs geschlagen und dieser geholfen, sie zu demütigen und zu quälen. Daher gönnte sie Marga keine Antwort, sondern riss ihr den Saum des Umhangs aus den Händen und wollte weitergehen.
Noch ehe sie zwei Schritte getan hatte, sprang Marga auf und klammerte sich nun an ihren Arm. »Frau Marie, habt Erbarmen mit mir und nehmt mich mit Euch! Seht Ihr nicht, wie schlecht man mich hier behandelt? Die neue Burgherrin ist hochnäsig und ungerecht und ihre Wirtschafterin ein entsetzliches Ekel, das sich immer neue Bosheiten für mich ausdenkt. Ihr seid doch jetzt die wohlbestallte Witwe eines Reichsritters und habt sicher schon einem neuen Gemahl die Hand zum Bunde gereicht. Da braucht Ihr doch eine treue Beschließerin auf Eurer Burg. Ich werde Euch noch ergebener dienen als damals, das schwöre ich!«
Marie glaubte ihren Ohren nicht zu trauen. Die Frau, die sie jetzt anflehte, hatte ihr früher deutlich gezeigt, wie sehr sie sie wegen ihrer Herkunft verachtete. Das Weib war auch schuld daran gewesen, dass die Banzenburgerin sie während ihrer fortschreitenden Schwangerschaft mitten im Winter in ein Turmgemach einquartiert hatte, durch das der Wind den Schnee trieb. Ohne Hiltrud und ihre ehemalige Leibmagd Ischi hätte sie Trudis Geburt nicht überlebt, sondern wäre samt ihrer Tochter dort oben umgekommen. Diesen Verrat würde sie ihrer ehemaligen Bediensteten niemals verzeihen.
Brüsk entzog sie Marga den Arm und trat einen Schritt zurück. »Du hättest mit Kunigunde von Banzenburg gehen sollen. Mich bittest du vergebens um Hilfe!«
Sie schüttelte sich innerlich vor Ekel, den dieses Weib in ihr auslöste, und wandte sich mit einem Ruck ab. In dem Moment erklang hinter ihr ein giftiges »Du elende Hure!«. Offensichtlich hatte die Frau sich um keinen Deut geändert. Marie nahm an, dass Marga Kunigunde von Banzenburg beim Erscheinen des neuen Burghauptmanns ebenso rasch fallen gelassen hatte wie sie, um sich bei der nächsten Burgherrin einzuschmeicheln. Doch im Unterschied zu den Banzenburgern war Isberga von Ellershausen mit größerem Gefolge erschienen und nicht willens gewesen, auf ihre eigene Wirtschafterin zu verzichten.
Marie genoss das Gefühl, vom Schicksal selbst gerächt worden zu sein, und wünschte Marga noch viele schmutzige Fußböden, die diese auf Knien würde schrubben müssen. Während sie mit ihren beiden Begleitern die Sobernburg schadenfroh und in besserer Laune verließ, schälte Hulda von Hettenheim sich aus dem Schatten des Korridors und blieb vor Marga stehen. »Kennst du Frau Marie schon länger?«
Marga nickte eifrig und musterte Frau Hulda dabei mit banger Erwartung. Die Stimme der Edeldame hatte nicht so geklungen, als wären sie und Marie Adlerin gute Freundinnen. »Ja, Herrin, ich kenne sie gut, denn ich war zehn Jahre ihre Beschließerin hier in Sobernheim.«
Hulda hatte das kurze Gespräch zwischen Marie und Marga hinter der Tür des Rittersaals belauscht und die Magd bereits in ihre Pläne eingebaut. Jetzt musste sie das Weib nur noch zum Sprechen bringen. »Ich habe zufällig mitgehört, dass du deine jetzige Herrin verlassen willst und einen neuen Dienst suchst. Vielleicht nehme ich dich mit mir. Auf einer meiner Burgen fehlt eine zuverlässige Wirtschafterin.«
Margas Augen leuchteten begehrlich auf, und sie küsste Hulda die Hände. »Ich werde Euch mit meiner ganzen Kraft dienen, Herrin.«
»Das will ich hoffen!« Hulda lächelte in sich hinein, denn sie benötigte bei ihrem Vorhaben eine ihr ergebene und vor allem schweigsame Helferin, die keine Gewissensbisse kannte. Sie legte ihre Hand auf Margas Schulter und krallte ihre Finger so fest in den rauen Stoff, dass die Magd aufstöhnte. »Höre mir gut zu! Ich bin auf dem Weg zur Otternburg, um dort mein Kind auf die Welt zu bringen. Es muss unbedingt ein Sohn sein, verstehst du mich?«
Marga sah sich um, ob sie jemand belauschen konnte, und nickte dann beeindruckt. »Ich verstehe! Falls Euer Kind wieder ein Mädchen wird, wollt Ihr Eurem Gemahl einen männlichen Säugling unterschieben.«
»Mein Gemahl ist tot, gestorben durch die Schuld der Hexe, die dich eben beleidigt hat! Dafür werde ich mich an diesem Weib rächen! Wenn du mir dabei hilfst, soll es dein Schade nicht sein.«
Hulda nahm erfreut wahr, dass Margas Züge sich zu einer hasserfüllten Maske verzogen. »Ihr könnt Euch auf mich verlassen, Herrin!«
»Dann lass diesen Fußboden, wie er ist, und komm mit mir. Ich werde später mit Isberga sprechen und ihr sagen, dass ich dich in meine Dienste nehmen will. Vorher aber musst du mir alles erzählen, was du über Marie Adlerin weißt.« Frau Hulda zog Marga mit einer Kraft hinter sich her, die man ihrem schlaff wirkenden Körper nicht zugetraut hätte.
VI.
Als Hedwig Marie in der Tür stehen sah, stieß sie einen gellenden Schrei aus und stürzte ihr dann schluchzend in die Arme. Sie presste ihre Base so fest an sich, dass diese kaum noch Luft bekam, und schob sie in das Licht, welches durch ein mit handtellergroßen, gelblichen Glasscheiben verschlossenes Fenster fiel. Dort tastete sie ihr Gesicht mit den Fingerspitzen ab, als müsse sie sich versichern, einen Menschen aus Fleisch und Blut vor sich zu haben, und rief dann durchdringend nach ihrem Mann.
Der Böttchermeister Wilmar Häftli schoss aus seiner Werkstatt heraus und rannte die Treppe hoch, indem er drei Stufen auf einmal nahm. »Hedwig, was ist? Brennt es?« Er sah dabei so besorgt aus, als fürchte er, das Obergeschoss stände in Flammen.
»Hier sieh doch, Wilmar, wer zu uns gekommen ist!« Hedwig trat einen Schritt beiseite und zeigte auf Marie.
Wilmar starrte seine adelige Verwandte mit weit aufgerissenen Augen an und sah für einen Augenblick so aus wie ein kleiner Junge, dem eben der sehnlichste Wunsch in Erfüllung gegangen war. »Beim Jesuskind und der Jungfrau Maria! Ihr seid am Leben! Gott weiß, welche Sorgen wir uns um Euch gemacht haben.«
»Das war aber nicht nötig. Du weißt doch: Unkraut vergeht nicht«, spöttelte Marie. Sie streckte Wilmar die Hand entgegen und ließ sich von ihm und Hedwig in die gute Stube des Hauses geleiten. Das Paar bot seinem unverhofften Gast den besten Platz an, und während Hedwig in die Küche eilte, um zusammen mit ihrer Magd einen Imbiss für den Gast herzurichten, stieg Wilmar in den Keller, zapfte einen Krug Wein aus einem besonderen Fass und kehrte so schnell zurück, als hätte er Schwingen an den Schuhen.
»Hier, Frau Reichsritterin, kostet diesen Tropfen! Er stammt von Eurem besten Weingarten«, erklärte er, während er den silbernen Ehrenbecher füllte, der ihm als Zunftmeister der Rheinsoberner Böttcher zustand und den er als einzigen für geeignet hielt, ihn seiner hochrangigen Verwandten anzubieten.
»Ich danke dir, Wilmar.« Marie hätte den Wein lieber mit Wasser vermischt getrunken, doch sie verstand Wilmars Stolz und sagte sich, dass dieser eine Becher gewiss nicht schaden würde. Der Wein schmeckte tatsächlich ausgezeichnet, und sie beschloss, etliche Fässer davon nach Kibitzstein zu senden. Michel würde sich gewiss darüber freuen.
Unterdessen trugen Hedwig und die Magd eine Platte herein, die vor Leckerbissen überquoll.
»Wenn du nichts dagegen hast, so hole ich Ischi. Sie ist ebenso wie ich aus Sorge um dich fast vergangen.«