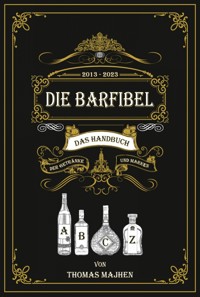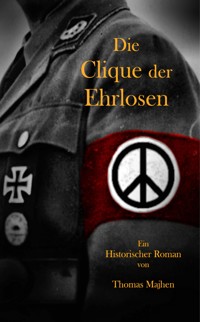Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Teil 2: Ein historischer Polit-Roman, basierend auf wahren Begebenheiten. Die Fortsetzung der Trilogie über einen alternativen Verlauf der deutschen Geschichte. Deutschland im Herbst 1938: Adolf Hitler ist tot – oder doch nicht? Nach der erfolgreichen Erstürmung der Alten Reichskanzlei fehlt vom »Führer« jede Spur. Während Hauptmann Friedrich Heinz weiterhin beteuert, den Leichnam des Diktators mit eigenen Augen gesehen zu haben, wird aus Königsberg über Rundfunk das Gegenteil verbreitet. Verzweifelt sind die Putschisten um Ludwig Beck darum bemüht, ihre Macht zu festigen und ein neues Deutschland aufzubauen. Sie wollen den Rechtsstaat wiederherstellen und gleichzeitig die Einheit des Landes unter einer neuen, demokratischen Regierung wahren. Doch nicht alle sind mit dem Gang der Ereignisse einverstanden. Im ostpreußischen Königsberg etablieren Hermann Göring und Heinrich Himmler unterdessen eine Gegenregierung. Mit ihrer Behauptung, Hitler lebe, sähen sie Zweifel in der Bevölkerung und spalten das Land. Viele halten dem Diktator die Treue und stellen sich gegen Berlin. Schon bald stehen sich an der Grenze zur Tschechoslowakei die Armeen der beiden Lager feindlich gegenüber. Auch in Augsburg kehren die Nationalsozialisten nach wenigen Tagen ins Rathaus zurück. Als sich die Lage im Osten zuspitzt, wird die gesamte Augsburger Jugend mobilisiert und für die Zwecke der Nazis missbraucht. Vergeblich darum bemüht, der Hitlerjugend zu entgehen, entscheidet sich Christoph Goeben zu einem verzweifelten Schritt. Auch er sieht sich einer Zerreißprobe gegenüber: Wie lassen sich Hitlerjugend, Freundschaft, Liebe und das Bedürfnis nach Freiheit in Einklang bringen? Realistisch, detailreich, dramatisch, erschütternd – ein wenig bekannter Aspekt der deutschen Geschichte verarbeitet in einer fesselnden Erzählung. Jetzt die Leseprobe herunterladen und kostenlos reinlesen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 883
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Rückblick
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Nachwort
Das Vermächtnis
des Lumpen
Ein
Historischer Roman
von
Thomas Majhen
Copyright © 2023 Thomas Majhen
Brunnenstraße 42, 10115 Berlin
1. Auflage: 05/2023
Umschlaggestaltung/Artwork: © Thomas Majhen
Lektorat/Korrektorat: Tom Klein
Druck und Bindung: Amazon.com, Inc.
Alle Rechte vorbehalten
»In einer Stunde, da ein Volkskörper sichtlich zusammenbricht und allem Augenscheine nach der schwersten Bedrückung ausgeliefert wird, dank des Handelns einiger Lumpen, bedeuten Gehorsam und Pflichterfüllung diesen gegenüber doktrinären Formalismus, ja reinen Wahnwitz, wenn andererseits durch Verweigerung von Gehorsam und ›Pflichterfüllung‹ die Errettung eines Volkes vor seinem Untergang ermöglicht würde.«
Adolf Hitler, Mein Kampf
Rückblick
Wir schreiben das Jahr 1944, wenige Wochen nach dem gescheiterten Stauffenberg-Attentat: In seiner Gestapo-Zelle im Keller des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin denkt der ehemalige Abwehroffizier Hans Oster an die Ereignisse des Jahres 1938 zurück. Lange vor dem Bombenanschlag in der »Wolfsschanze« hatte es bereits Überlegungen zu einem Staatsstreich gegeben, er, Hans Oster, hatte für einen kurzen Augenblick die Fäden hierzu in den Händen gehalten. Während er Befragungen und Folter durch die Gestapo über sich ergehen lassen muss, sieht er sich immer wieder der Frage gegenüber, ob und wann er etwas hätte unternehmen können. Erst auf dem Weg zu seiner Hinrichtung, buchstäblich in der letzten Minute seines Lebens, offenbart sich vor seinem geistigen Auge die Stunde, in der die Geschichte eines ganzen Kontinents, vielleicht der ganzen Welt, einen anderen Verlauf hätte nehmen können.
Durch eine mutmaßliche Intrige der SS gegen die Spitze der obersten Heeresführung sah sich Hans Oster noch vor Ausbruch des Krieges dazu veranlasst, Stellung gegen den nationalsozialistischen Staat zu beziehen. Aus seiner anfänglich begrenzten Bemühung, Oberbefehlshaber Werner von Fritsch im Amt zu halten, wurde bald ein entschlossener Widerstand gegen das System als solches. Im Verlauf des Frühlings und Sommers 1938 gelang es Oster, weitere Gleichgesinnte um sich zu scharen, die mit den Verhältnissen im Deutschen Reich unzufrieden waren. Doch vor allem anderen einte eines die ansonsten sehr heterogene Gruppe der Verschwörer: die Angst vor einem neuen großen europäischen Krieg.
Nachdem unmissverständlich klar geworden war, dass Adolf Hitler nicht einmal im Traum daran dachte, die personellen Veränderungen an der Heeresspitze rückgängig zu machen, begannen sich auch dessen außenpolitische Ziele immer deutlicher abzuzeichnen. Wer sehenden Auges durch den Tag schritt, dem konnte nicht verborgen bleiben, dass der von vielen befürchtete Krieg genau das war, was der Diktator wollte. Nach mehreren geheimen Treffen gelangte die Widerstandsgruppe um Hans Oster und Erwin von Witzleben schnell zu der Erkenntnis, dass es nur eine Möglichkeit gab, die Katastrophe abzuwenden. Die Regierung musste gestürzt, der Führer beseitigt werden.
Fortan arbeitete alles auf dieses eine Ziel hin. Der vordergründigen Einigkeit zum Trotz herrschten unterschiedliche Auffassungen darüber, was die genaue Umsetzung dieses Plans anbelangte. Sollte lediglich der SS-Apparat, dieser Staat im Staate, ausgeschaltet und der Diktator von dessen vermeintlichen Einfluss befreit werden? Konnte es gelingen, den Führer zur Räson zu bringen oder musste auch er weichen?
Während man sich nach schwierigen Gesprächen darauf einigte, Hitler in Gewahrsam zu nehmen und vor ein Gericht zu stellen, schmiedete Hans Oster zusammen mit seinem Freund Friedrich Wilhelm Heinz eigene Pläne, die eine Ermordung des Führers vorsahen. Denn, so die Überlegung, nur ein toter Diktator war ein Garant für dauerhaften Frieden und die Wiederherstellung der Rechtssicherheit im Reich.
Nach einer Rede Hitlers im Berliner Sportpalast Ende September 1938, in der dieser der benachbarten Tschechoslowakei unmissverständlich mit Krieg drohte, gab Oster schließlich eigenmächtig und ohne Rücksprache mit den anderen Verschwörern das Signal zum Losschlagen. Daraufhin versammelte Friedrich Heinz den bereitstehenden Stoßtrupp und stürmte die Alte Reichskanzlei. Gegen den Widerstand der SS-Wachmannschaft gelang es Heinz und seinen Männern, in die Führerwohnung vorzudringen – wo sie einen verstörten Joseph Goebbels und einen toten Adolf Hitler vorfanden. Man beschloss, die Leiche des Diktators zurückzulassen und lediglich den Propagandaminister mitzunehmen. Der Rückzug aus der Reichskanzlei gestaltete sich als halsbrecherisch und verlustreich, dennoch gelang es Heinz, sich und den Großteil seiner Männer in Sicherheit zu bringen.
Unterdessen sah sich General Erwin von Witzleben durch Osters Eigenmächtigkeit dazu genötigt, die Besetzung Berlins wie geplant in die Tat umzusetzen. Zwar gelang das Vorhaben, doch kam es zu unvermeidlichen Verzögerungen und Pannen. So verschwand etwa zwischenzeitlich Hitlers Leichnam aus der Reichskanzlei, ohne Hinweise auf dessen Verbleib zu hinterlassen. Als dann auch noch Heinrich Himmler die Flucht gelang, dieser die Versuchsfunkstelle Eberswalde besetzte und über den Rundfunk die Behauptung verbreitete, der Diktator sei am Leben, gerieten viele der hohen Wehrmachtsoffiziere ins Wanken. Ein Riss, der nicht nur das Offizierskorps, sondern das ganze Land zu spalten drohte, zeichnete sich ab. Ein Riss, der zu einem ausgewachsenen Bürgerkrieg führen könnte.
***
Zur selben Zeit verlebten die Freunde Christoph, Jan, Peter und Michel in Augsburg das bevorstehende Ende ihrer Schulzeit. Auch sie bekamen verstärkt den Einfluss des NS-Staates zu spüren: Klassen wurden nach Geschlechtern getrennt, jüdische Mitschüler vom Unterricht ausgeschlossen. Ersteres war vor allem für Christoph schlimm, denn seit einiger Zeit war er heillos in seine ehemalige Klassenkameradin Teresa verliebt.
Als er schon glaubte, sie zukünftig nur noch in der großen Pause auf dem Schulhof heimlich beobachten zu können, traf er sie zufällig auf dem Weg zur Schule. In den folgenden Wochen und Monaten kamen sich Christoph und Teresa näher, während gleichzeitig das Verhältnis der Freunde untereinander zunehmend von Anspannung geprägt wurde.
Besonders Jan zeigte sich von der Vorliebe seines besten Freundes für das tschechische Mädchen alles andere als begeistert. Er ist vorbehaltlos auf Linie der Partei, hält abweichende Meinungen und Ansichten für Verrat am Vaterland. Die Lage schien sich etwas zu beruhigen, als sich Christoph durch seinen Klassenlehrer dazu genötigt sah, in die Hitlerjugend einzutreten. Durch Bekanntwerden der Ereignisse in Berlin, den nur halb geglückten Staatsstreich und den Aufruf Himmlers zum Widerstand gegen die Putschisten, traten die Unterschiede zwischen den Freunden jedoch ungehemmt hervor und führten sogar zum Bruch zwischen den besten Freunden Christoph und Jan.
Am Ende wurde Christoph von Jan dazu aufgefordert, sich ihm anzuschließen und gegen die Berliner Putschregierung zu kämpfen. Letzterer war entsetzt von dieser Vorstellung und lehnte ab. Als sich Freunde am späten Abend in einer dunklen Augsburger Gasse trennten, blieb ungewiss, ob und unter welchen Umständen sie sich jemals wieder begegnen würden.
Kapitel 1
29. September 1938
Er hatte noch nicht einmal einen Fuß aus der U-Bahn gesetzt, da bemerkte er auch schon die bewaffneten Sicherungsposten.
Zwei Wehrmachtssoldaten standen auf dem Bahnsteig und beäugten misstrauisch die ein- und aussteigenden Fahrgäste. Der eine hielt seinen Karabiner 98k bedrohlich in der Armbeuge, jederzeit darauf gefasst, ihn in Anschlag zu bringen und möglichen Bedrohungen mit aller Härte zu begegnen. Der andere, einen guten Kopf größer als sein Kamerad, hatte seinen Karabiner geschultert und ließ seinen Blick gelangweilt durch den Bahnhof schweifen.
Auch die beiden Ausgänge wurden von Posten bewacht. Besonders auffällig daran war, dass man dem einen davon sichtlich mehr Beachtung schenkte als dem anderen. Selbst ein nicht ortskundiger Besucher hätte daher sofort gewusst, welchen der Ausgänge er zu nehmen hatte: nämlich denjenigen, dem nur noch ein Schlagbaum gefehlt hätte, um dem Grenzübergang zu einem benachbarten Staat zu gleichen.
Als Hans Oster aus dem Wagen trat, zog er sofort die Aufmerksamkeit der Soldaten auf dem Bahnsteig auf sich. In den Augen des kleineren bemerkte er ein Funkeln, das für einen kurzen Moment wie ein Alarmsignal aufblitzte. Er wurde routiniert in Augenschein genommen und in kaum einer Sekunde fachmännisch von oben bis unten gemustert. Dann schien er die Inspektion erfolgreich bestanden zu haben, denn der Soldat straffte sich unmerklich und grüßte ihn mit einem knappen Nicken. Oster erwiderte das Nicken und musste schmunzeln, als er im Vorübergehen das gelangweilte Gesicht des Größeren streifte; es gab sicher Interessanteres, als im Zwielicht der U-Bahnstation auf Streife zu gehen.
Zielstrebig begab sich Oster zum unterirdischen »Grenzübergang«. Dort hatte man es nicht versäumt, eine massive Absperrung aus Sandsäcken zu errichten, damit niemand ungehindert den Platz darüber betreten konnte. Er wurde von einem Leutnant angehalten, der ihn steif grüßte und freundlich aber bestimmt seine Papiere verlangte. Oster händigte sie bereitwillig aus und wurde ohne Komplikationen vorbeigelassen. Er passierte die Absperrung und mehrere angespannt wirkende Soldaten, dann erklomm er die Treppe und gelangte ans Tageslicht.
Der sonst so lebhafte Wilhelmplatz war nicht wiederzuerkennen. Wo sich üblicherweise zahllose Menschen tummelten und wie Ameisen kreuz und quer über den Platz wuselten, herrschte beinahe so etwas wie Friedhofsatmosphäre. Eine geradezu bedrückende Ruhe machte sich breit, die üblichen Geräusche der Großstadt drangen wie durch ein Stück Watte gefiltert aus einiger Entfernung an Osters Ohr. Hatte im Bahnhof noch ein mehr oder minder abwechslungsreiches Angebot an ziviler Kleidung geherrscht, dominierte hier unangefochten das Feldgrau der Armee.
Posten, Absperrungen und Patrouillen – es gab sogar eine hinter Sandsäcken aufgebaute Maschinengewehrstellung – gaben dem Areal den Anschein eines Kasernenhofs und sorgten dafür, dass sich kein Unbefugter dem Regierungsviertel auch nur bis auf einhundert Meter nähern konnte. Die Krönung der Abschreckung jedoch bestand in der Gestalt von zwei Panzern des Typs I, die mit laufenden Motoren brummend die Straße blockierten. Kaum größer als ein gewöhnlicher Pkw, wirkten die gepanzerten Gefährte mit ihren drehbaren Maschinengewehrtürmen und ihrem Kettenfahrwerk dennoch respekteinflößend. Nur ein vollkommen Wahnsinniger würde den Versuch wagen, sich mit Gewalt einen Weg durch die Sicherungsposten zu bahnen.
Einer der Panzerkommandanten lehnte sich, die eine Hand selbstbewusst in die Seite gestemmt, in seiner schwarzen Uniform lässig aus der Turmluke. Interessiert beobachtete er Oster, der sich gemessenen Schrittes an den Panzern vorbei über den Platz bewegte.
»Da sind sie also, Witzlebens Panzer.«, dachte Oster anerkennend. »Ganz wie versprochen.«
Bei dem Gedanken an den ehemaligen Wehrkreiskommandeur von Berlin – jetzt Oberbefehlshaber der gesamten Wehrmacht – bekam seine gute Laune einen Dämpfer. Es war mehr als eine gewisse Bewunderung, die er für den General empfand. Witzleben stand zu seinem Wort, unumstößlich und felsenfest. Mehr noch war aus dem Mitverschwörer im Trubel der zurückliegenden Monate ein Freund geworden. Dazu hatten nicht zuletzt die heimlichen Gespräche und staatsfeindlichen Planungen hinter verschlossenen Türen beigetragen, die sie für den Großteil des Jahres beschäftigt hatten und zu gleichgesinnten Komplizen werden ließen. Zu Verschwörern, die sich gegenseitig mit dem Leben vertrauten. Allerdings häuften sich die Anzeichen, dass Oster mit seiner kürzlichen Eigenmächtigkeit diese Freundschaft ernsthaft aufs Spiel gesetzt hatte.
Er schüttelte den Gedanken ab und ging weiter. Nachdem er das Ausmaß der militärischen Zernierung des Areals erfasst hatte, konnte er nicht anders, als seine Aufmerksamkeit auf die Alte Reichskanzlei zu richten.
Das linke Eisentor, das den Ehrenhof zur Wilhelmstraße hin abschirmte, hatte einiges abbekommen. Nicht wenige der Gitterstäbe waren in grotesken Formen verbogen, als habe ein Hüne mit riesenhaften Kräften versucht, sich gewaltsam Zugang zu verschaffen. Da der Schließmechanismus hoffnungslos zerstört war, hatte man sich beholfen, indem man das Tor mit einer schweren Eisenkette am übrigen Zaun befestigte. Weit dramatischer war aber der Anblick des dahinterliegenden Eingangs. Die schwere, übermannsgroße Doppeltür war unübersehbar schwer beschädigt worden. Eine Seite der Tür fehlte gänzlich und war durch einige provisorisch zusammengezimmerte Holzbretter ersetzt worden. Die andere Seite war zwar noch vorhanden, in der unteren Hälfte aber dort, wo Hauptmann Heinz und sein Stoßtrupp ein wagenradgroßes Loch hineingesprengt hatten, mit mehreren Latten notdürftig ausgebessert worden. Durch die Wucht der Explosion war Rund um die Tür stellenweise der Putz wie die Seife durch einen Rasierhobel abgeschabt worden, mancherorts waren tiefe Furchen im darunterliegenden Mauerwerk zu erkennen. Schwarze Ruß- und Brandspuren breiteten sich sternförmig von der Türschwelle aus und wiesen deutlich sichtbar darauf hin, wo sich das Zentrum der Detonation befunden haben musste. Von der ursprünglich über der Tür angebrachten Markise waren lediglich noch die Wandhalterungen übriggeblieben. Die zuvor links und rechts befindlichen Laternen hatte man gänzlich entfernt. Vor allem die Fassade links des Eingangs war wie ein Streuselkuchen über und über von Einschusslöchern übersät. Fast alle Fenster des Erdgeschosses waren zu Bruch gegangen und mit Brettern vernagelt.
Das derart verunstaltete, über einhundert Jahre alte Palais war allerdings nicht das Ziel von Hans Oster. Stattdessen steuerte er auf den modernen Verbindungsbau direkt daneben zu.
Am offiziellen Eingang zur Reichskanzlei, den Heinz‘ Trupp wenige Tage zuvor so geflissentlich gemieden hatte, wurde Oster aufgehalten und musste erneut seine Papiere vorzeigen. Der Posten musterte ihn eingehend und ließ ihn trotz seiner korrekten Ausweise nicht sofort in das Gebäude. Er wurde aufgefordert, an Ort und Stelle zu warten, während der Soldat mit Osters Unterlagen im inneren des Wachlokals verschwand.
»Vorsicht ist wohl besser als Nachsicht, nehme ich an.«, dachte Oster und musste sich eingestehen, dass die enorme Militärpräsenz einschüchternd wirkte – und das, obwohl er selbst Uniform trug und natürlich nichts zu befürchten hatte.
Nach etwa zwei Minuten kehrte der Wachposten zurück, händigte Oster die Papiere aus und ließ ihn ein.
Über einen Fahrstuhl, den man nicht versäumt hatte in den modernen Verbindungsbau zu installieren, gelangte der Abwehrmann in den zweiten Stock. Dort wurde er von einem Adjutanten in Empfang genommen. Dieser geleitete ihn in einen Warteraum, der viel zu groß war und beinahe dem Wartesaal in einem Bahnhof glich, wären da nicht die wenigen Sitzgelegenheiten gewesen, die man sparsam entlang der Wände drapiert hatte. Fast die gesamte Fläche des Raumes wurde von einem kostbaren Teppich eingenommen, und während neben einem Sofa und einigen Sesseln fast kein Mobiliar an das Wartezimmer verschwendet worden war, hätte man hier ausgezeichnete Tanzveranstaltungen ausrichten können.
Der Adjutant bat Oster, Platz zu nehmen und verschwand in einem der angrenzenden Räume. Oster musste nicht lange warten, denn schon nach kurzer Zeit kehrte der Adjutant zurück und forderte den Besucher auf, einzutreten.
Als der Abwehrmann in das Zimmer trat, benötigte er einen Augenblick, die Ausmaße des Raumes zu erfassen. Dieser war mindestens doppelt so groß, wenn nicht noch größer als der angrenzende Warteraum. Von der Decke hing ein massiver, in modernem Stil gefertigter Kronleuchter und vereinnahmte gut die Hälfte der Raumhöhe. Dennoch wäre Oster selbst auf Zehen nicht in der Lage gewesen, den Leuchter auch nur mit den Fingerspitzen zu erreichen. Linker Hand war in der Mitte des Zimmers eine Sitzgruppe arrangiert. Dahinter ließ ein Fenster so groß wie ein Scheunentor Tageslicht hinein. Obwohl sich vis-a-vis ein Fenster gleicher Größe befand, schien es, als könne sich das einströmende Licht nicht gegen die düstere Atmosphäre dieses Ortes behaupten. An der gegenüberliegenden holzvertäfelten Wand hing über einer breiten Kommode ein Ölgemälde. Etwas versetzt davor, unweit des rechten Scheunentor-Fensters, befand sich ein flacher, fast bescheiden wirkender Schreibtisch, an dem sich zwei Personen, die in dem großen Raum wie Puppen in einem Puppenhaus wirkten, gegenübersaßen. Obwohl Hans Oster wusste, wer die eine der beiden Personen sein musste, tat er sich schwer, aus dieser Entfernung die andere sofort zu erkennen.
»Oster, bitte, treten Sie näher!«, sagte der Mann, der mit dem Gesicht zu ihm saß, wie aus weiter Ferne. Die Gestalt erhob sich und schickte sich an, ihm auf halber Strecke entgegenzukommen.
Etwas unsicher blieb der Abwehrmann mit zwei Schritten Abstand stehen. Tatsächlich hatte er es völlig versäumt sich Gedanken darüber zu machen, wie er sein Gegenüber zu grüßen hatte. Sollte er salutieren, ihm die Hand schütteln oder gar den Arm zum Deutschen Gruß heben? Letzteres schien im gänzlich unpassend, abgesehen davon, dass es ihn einiges an Überwindung abverlangt hätte. Also entschied er sich spontan für einen Kompromiss, streckte den Rücken durch und knallte die Hacken zusammen.
Der andere erfasste die Situation und wirkte beinahe peinlich berührt. Er tat einen Schritt auf Oster zu und streckte ihm die Hand entgegen.
Erleichtert entspannte sich Oster und gewann umgehend seine Selbstsicherheit zurück.
»Wie darf ich Sie von nun an anreden, mit ›Eure Exzellenz‹, ›Herr General‹ oder doch besser ›Herr Reichsverweser‹?«, fragte er mit einem spitzbübischen Lächeln.
»Die Exzellenz können Sie sich getrost sparen.«, wischte der andere mit einer Handbewegung weg. Seine braunen Augen, die einen Hauch Unbehagen ausdrückten, verrieten, dass er sich selbst noch nicht völlig mit der neuen Situation und seiner eigenen Rolle darin angefreundet hatte. »Daneben überlasse ich alles Weitere Ihnen.«
Oberstleutnant Hans Oster riskierte einen Seitenblick auf die zweite Person, die noch immer im Besuchersessel am Schreibtisch saß und ihn beobachtete. Sein Blick verfinsterte sich, als er erkannte, wer der Mann war.
»Was zum Teufel …« schoss es ihm durch den Kopf, bevor er in seinen Gedanken unterbrochen wurde.
»Sie wissen, dass ich mir dieses Amt weder gewünscht habe noch die Verantwortung auf die leichte Schulter nehme, die damit verbunden ist. Sicherlich können Sie sich ausmalen, wie schwer das Erbe ist, das ich zu verwalten habe. Dennoch betrachte ich es als Pflicht und Ehre, dem Reich mit all meiner Kraft zu dienen und das in Sturm geratene Schiff wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.«
Ein zartes Lächeln, das der schmale, bogenförmig herabgezogene Mund nicht gewohnt zu sein schien, blitzte kurz und schüchtern auf.
»Am liebsten wäre es mir, wenn Sie mich weiterhin mit Herr General anreden würden. Mein Amtstitel ist etwas, womit sich die Juristen befassen sollen.«
Da stand er nun also vor ihm, der neue Diktator des Deutschen Reiches. Zwar würde die offizielle Bezeichnung »Reichsverweser« oder »Generalstatthalter« lauten, man war sich in dieser Hinsicht noch nicht einig. Doch letztendlich war das nur eine wohlklingende Umschreibung für einen Diktator mit nahezu unumschränkten Vollmachten.
Oster sah vor sich einen schmalschultrigen Philosophen in Generalsuniform, einen Militärtheoretiker durch und durch, einen Menschen, der sein Leben dem Wohle des Vaterlandes gewidmet hatte. Jemanden, auf den nicht nur die gesamte deutsche Bevölkerung mit Spannung und ängstlicher Erwartung blickte, sondern die halbe Welt. Er musste zugeben, dass er nicht gerne mit Ludwig Beck tauschen mochte.
Beck schwieg einen Moment und musterte Oster. Dann drehte er sich leicht nach links und wies mit der Hand auf die dritte Person im Raum.
»Sie haben bereits Bekanntschaft gemacht mit dem Berliner Polizeipräsidenten.«, sagte er und ließ es mehr wie eine Feststellung klingen als wie eine Frage. Dabei neigte er den Kopf leicht nach unten und hob gleichzeitig die Augenbrauen an, als wolle er dem Oberstleutnant damit etwas zu verstehen geben.
Auf dieses Stichwort hin erhob sich Wolf-Heinrich von Helldorff und trat an Oster heran. Er ließ keinerlei Anstalten erkennen, diesem die Hand zu reichen.
»Wir sind uns bereits bei der einen oder anderen Gelegenheit begegnet.«
Seine Stimme klang freundlich und durchaus nicht unangenehm. Selbst ein gewisses Maß an Charme konnte man dem Polizeipräsidenten, der ein überzeugendes Lächeln in seinem weichen, vermutlich vom übermäßigen Alkoholgenuss etwas schwammigen Gesicht zur Schau stellte, nicht absprechen.
Doch Oster wusste es besser. Er ließ sich nicht davon täuschen, dass Helldorff seine Uniform von sämtlichen NS-Devotionalien, darunter das goldene Parteiabzeichen, befreit hatte. Helldorff hasste nicht nur die Juden, woran sich innerhalb weniger Tage kaum etwas geändert haben dürfte, er war außerdem über Jahre hinweg Nutznießer der NSDAP und seiner vorzüglichen Kontakte zu hohen Parteifunktionären gewesen. Bis zuletzt war es zudem als fraglich erschienen, ob die Berliner Polizei den Anordnungen ihres unbeliebten obersten Dienstherrn überhaupt Folge leisten und den Putsch unterstützten würde.
»Allerdings, das sind wir.«, hörte sich Oster überraschend freundlich sagen und überlegte dabei, weshalb Beck ihn und Helldorff zur selben Zeit hierhergebeten haben mochte.
»Bitte, lassen Sie uns dort drüben Platz nehmen.«, meinte Beck und wies zu der Sitzgruppe zu seiner Rechten.
»Ich bin erstaunt, dass Sie sich in Hitlers Arbeitszimmer eingerichtet haben.«, bemerkte Oster, nachdem er sich dem General gegenübergesetzt und die Beine übereinandergeschlagen hatte und darum bemüht war, seinen Widerwillen, mit Helldorff am selben Tisch zu sitzen, zu überspielen. »Der Ort scheint mir doch etwas … vorbelastet zu sein.«
Beide Arme auf den Lehnen des Sessels ruhen lassend, sog Beck hörbar Luft ein, bevor er antwortete.
»Ihr Einwand ist nicht unberechtigt. Dabei dürfen Sie aber nicht vergessen, dass nicht Hitler diesen Ort erschaffen hat. Er mag diesen Raum hier und einige andere nach seinem Geschmack umgestaltet haben. Das Gebäude gab es jedoch schon bevor er seine unsägliche Rolle für unser Land zu spielen begonnen hat – von der Alten Reichskanzlei ganz zu schweigen. Ich hätte es vorgezogen, dort meinen Amtssitz einzurichten, um der Tradition der Reichskanzler, die das Reich in über sechzig Jahren hervorgebracht hat, zu folgen. Schon allein wegen der damit verbundenen Symbolkraft. Nach den kürzlichen … Ereignissen sind vor einem Umzug allerdings einige … Renovierungsarbeiten erforderlich. Darüber hinaus bin ich mir noch nicht ganz im Klaren darüber, was mit Hitlers Privaträumen geschehen soll. Ich kann mir nur schwer vorstellen, im selben Raum wie er zu schlafen. Stattdessen habe ich auch weiterhin vor, in Lichterfelde wohnen zu bleiben.«
»Wissen Sie schon, was mit dem Neubau der Reichskanzlei geschehen soll?«, wollte Helldorff unschuldig wissen.
Sicherlich wäre er selbst gerne dort eingezogen, überlegte Oster. Als Diktator wäre der Mann sicherlich kaum eine bessere Wahl als Hitler, wenn auch vermutlich weit weniger Durchsetzungsstark. Zudem wäre Helldorff wohl überwiegend damit beschäftigt, sich seiner Spielsucht hinzugeben und die Finanzen des Staates anderweitig zu verprassen.
»Auch das ist keine ganz leichte Entscheidung.«, antwortete Beck. »Das Gebäude ist so gut wie fertig, bis auf Weiteres habe ich aber die Arbeiten einstellen lassen. Im Augenblick gibt es zudem dringlichere Fragen zu klären.«
»Natürlich.«, sagte der Polizeipräsident in einem für Osters Geschmack zu schmeichelhaften Ton.
»Um derartige Fragen soll es im Moment nicht gehen.«, verkündetet Beck ernst.
Sein Gesicht verdüsterte sich, die Anspannung in seinem Oberkörper nahm sichtbar zu.
»Wir sehen uns weit größeren Schwierigkeiten gegenüber. Zwar haben wir die Versuchsfunkstelle Eberwalde mittlerweile besetzt, dennoch hatte Himmler eine gute Stunde Zeit, seine Meldung mehrfach zu wiederholen und auszustrahlen. Das ganze Land hat sie gehört. Jeder weiß von seiner Behauptung, Hitler sei noch am Leben.«
»Hauptmann Heinz hat geschworen, er habe Hitlers Leiche mit eigenen Augen gesehen.«, warf Oster ein. »So nah wie er ist ihm sonst niemand gekommen. Ich versichere Ihnen, dass wir dem Hauptmann unbedingt vertrauen können.«
»Ich glaube Ihnen und Hauptmann Heinz.«, bestätigte General Beck. »Was Sie, ich und einige andere in dieser Hinsicht glauben, spielt jedoch leider keine Rolle. Wir müssen es zweifelsfrei beweisen können. Solange das Gerücht besteht, wird es die Einheit des Reiches beträchtlich schwächen.«
»Aber wie?«, wollte Helldorff wissen. »Der Leichnam des Führers ist verschwunden.«
»So, er ist also immer noch dein Führer?«, dachte Oster mit misstrauisch gespitzten Ohren. »Jedenfalls solange er noch am Leben sein könnte. Das Wiesel sichert sich nach allen Seiten hin ab.«
Aufmerksam registrierte er, wie die ostentativ zur Schau getragene, gelassene Fassade des Polizeipräsidenten einen Riss bekam. Dessen scheinheiliges Lächeln verschwand, sein schwammiges Gesicht zog sich wie in einem Krampf zusammen.
»Es ist mir unbegreiflich, wie der Hauptmann es versäumen konnte, sich zu versichern.«, kritisierte Helldorff. »Ein oder zwei Schüsse hätten genügt, und wir wären jetzt nicht in dieser bedauerlichen Situation.«
Wie ein dunkler Schleier huschte ein Ausdruck entsetzlicher Angst über Helldorffs Züge, bevor er die Kontrolle über sich wiedererlangte.
»Das löste immer noch nicht das Problem mit dem verschwundenen Körper.«, gab Beck zu bedenken.
»Dann hätte er ihn eben mitnehmen müssen!«, beschwerte sich Helldorff etwas zu laut.
Beck erweckte den Eindruck, als wolle er den Polizeipräsidenten angesichts seines Ausbruches zurechtweisen. Dann entschied er sich jedoch anders und fuhr mit ruhiger Stimme fort:
»An den Umständen können wir jetzt nichts mehr ändern. Uns bleibt nur mit den Karten zu spielen, die wir in den Händen halten.«
»Woran haben Sie gedacht?«, wollte Oster wissen.
»Soweit wir das beurteilen können, gibt es nur eine Person, die in Hitlers letzten Minuten bei ihm war. Glücklicherweise befindet sich genau diese Person in unserem Gewahrsam.«
»Goebbels.«, führte Oberstleutnant Oster den Gedanken zu Ende.
»Ganz recht.«
»Haben Sie uns deshalb hierhergebeten?«
»So ist es.«
Ratlos sah Oster Beck an, riskierte dann einen Blick auf Helldorff, der ebenso verwirrt schien wie er. Dass man ihn zusammen mit Helldorff hierhergebeten hatte, ergab noch immer nicht den geringsten Sinn.
»Ich wüsste nicht, was wir … ich …«
»Wer sonst?«, fragte Beck und zuckte mit den schmalen Schultern. »Die Gestapo ist noch immer die Gestapo. Es ist unmöglich zu sagen, wem wir dort vertrauen können. Bis der gesamte Apparat umstrukturiert, das Personal überprüft wurde und die faulen Eier aussortiert sind, vergehen wenigstens Wochen, wenn nicht Monate. Wir können nicht riskieren, dass man ihm zur Flucht verhilft oder ihn auf andere Weise unserem Zugriff entzieht.«
»Sie denken, man könnte Goebbels ermorden?«
»Um zu verhindern, dass er etwas Bedeutendes ausplaudert? Natürlich. Im Augenblick steht er unter strenger Bewachung. Sein Gesundheitszustand ist nicht sehr stabil, dennoch bin ich entschlossen, ihn einer Befragung zu unterziehen.“
»Ich verstehe. Trotzdem muss ich fragen: Warum Helldorff und ich?«
Beck sah Oster und dem Polizeipräsidenten abwechselnd fest in die Augen.
»Weil ich zu Ihnen absolutes Vertrauen habe. Und weil Helldorff mit dem ehemaligen Propagandaminister für einige Zeit eng befreundet war.«
Daher wehte also der Wind, ging Oster ein Licht auf. Der Nazi Helldorff sollte seine gute Beziehung zum Nazi Goebbels spielen lassen und diesem die wichtige Information entlocken, was sich während der ersten Minuten der Erstürmung der Alten Reichskanzlei in Hitlers Wohnung zugetragen hatte. Hans Oster bezweifelte ernsthaft, dass er der Richtige für diese Aufgabe war. Weder kannte er Joseph Goebbels persönlich noch war er sonderlich geübt in der Befragung von Gefangenen.
Er wandte den Kopf und musste feststellen, dass der Polizeipräsident von der Aussicht, seinem ehemaligen Busenfreund gegenüberzutreten, ebenfalls alles andere als begeistert zu sein schien.
***
Das Staatskrankenhaus der Berliner Polizei in der Scharnhorststraße, unweit des Lehrter Bahnhofs im Bezirk Mitte gelegen, existierte schon seit 1841. Unter dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. als Lazarett für die Berliner Garnison gegründet, diente es seit den Weimarer Jahren der Behandlung von Polizeibeamten. Erst 1931 war der Gebäudekomplex umgebaut und erweitert worden, um auch verletzte oder erkrankte Polizeigefangene behandeln zu können.
Nachdem die Verschwörer die Reichshauptstadt Berlin fest unter ihre Kontrolle gebracht hatten, hatte man den schwer verletzten ehemaligen Propagandaminister Joseph Goebbels aus dem provisorischen Versteck in der Kleingartenkolonie Bornholmer Straße hierhin überführt. Die Entscheidung, das Leben des abgesetzten Ministers nach Möglichkeit zu retten, war nicht von Hauptmann Friedrich Heinz getroffen worden. Wenn es nach diesem gegangen wäre, hätte man den Verwundeten einfach in der Gartenlaube seinem Schicksal überlassen. In dieser Angelegenheit war er aber von General Witzleben überstimmt worden, der eine solche Vorgehensweise nicht nur in moralischer Hinsicht für unverantwortlich hielt, sondern den wichtigen Komplizen des NS-Regimes und Lenker des Propagandaapparats nach erfolgter Genesung einem ordentlichen Gerichtsverfahren zuführen wollte.
So wurden denn Oberstleutnant Hans Oster und Polizeipräsident Wolf-Heinrich von Helldorff beim Betreten des Krankenhauses zunächst vom zuständigen Arzt zur Seite genommen und ernsthaft ermahnt.
Der Mediziner war alles andere als begeistert von der Ankündigung, der durch einen Schuss in den linken Fuß ernsthaft verletzte Häftling solle einem polizeilichen Verhör unterzogen werden. Die Wunde habe sich durch die verzögerte Behandlung entzündet, die vorläufige Schonung des Häftlings sei eine Frage von Leben und Tod. Er sehe sich daher veranlasst, gegen den Grund von Osters und Helldorffs Besuch mit aller Deutlichkeit zu protestieren.
Man sei keineswegs in der Absicht gekommen, den Verletzten zu quälen und länger als unbedingt nötig zu befragen, versuchte Oster zu beschwichtigen. In der gegenwärtigen Situation sei es jedoch ebenfalls eine Frage von Leben oder Tod – und zwar nicht nur für einen Menschen, sondern für viele tausend! –, so bald wie möglich an gewisse Informationen von größter Bedeutung zu gelangen. Die Zeit dränge und es sei unmöglich, eine Genesung oder auch nur eine Verbesserung des Gesundheitszustandes des Inhaftierten abzuwarten.
Bevor der Arzt hierauf etwas erwidern konnte, schaltete sich mit deutlich weniger Zurückhaltung Helldorff ein.
Er fragte den Arzt, ob dieser denn nicht wisse, wer er sei. Um dessen Gedächtnis aufzufrischen wolle er einmal darauf hinweisen, dass er der Polizeipräsident sei und ihm daher diese Einrichtung als Krankenhaus der Berliner Polizei unterstehe. Der Sache nach könne er hier schalten und walten wie es ihm beliebe, und so denke er überhaupt nicht daran, sich von einem dahergelaufenen Doktor Befehle erteilen zu lassen.
Oster war entsetzt von dieser Taktlosigkeit. Einmal mehr sah er sich darin bestätigt, dass Kreaturen wie dieser Helldorff noch nicht einmal mit dem Gedanken zu spielen schienen, die Zeiten könnten sich von nun an geändert haben. Bevor er vermittelnd eingreifen konnte, ergriff der Arzt das Wort.
Er wisse sehr wohl, wen er da vor sich habe, verkündete er mit einem verächtlichen Schnauben. Der Polizeipräsident solle es dennoch nicht missverstehen, wenn sich der Doktor dazu genötigt sehe, dem Vorhaben zähneknirschend stattzugeben. Man habe bereits von weit höherer Stelle aus interveniert und so bleibe ihm nichts anderes übrig, als die Herren vorzulassen. Bevor er den Weg für die beiden Männer freimachte, versäumte er es nicht, noch einmal zu betonen, dass sich der Patient keinesfalls aufregen dürfe und die Befragung fünfzehn Minuten nicht überschreiten solle. Sodann machte er einen Schritt zur Seite und beobachtete grimmig, wie Oster und Helldorff in das Krankenzimmer traten.
Der langgezogene, rechteckige Raum verfügte über acht Betten, die sich jeweils zu vieren entlang der Wände gegenüberstanden. Die wenigen Fenster waren vergittert, um etwaigen Fluchtversuchen der straffällig gewordenen Patienten vorzubeugen. Neben dem Eingang saß auf einem Stuhl ein in Zivil gekleideter Polizist, der überrascht aufsah, als das ungleiche Paar eintrat. Eine bleiche Person, die im hintersten Bett lag, war der einzige Häftling, den es zu bewachen galt.
Mit zwei knappen Sätzen schickte Helldorff den Polizisten nach draußen. Bevor dieser das Zimmer verließ, nahm er eine militärische Haltung an und zuckte verdächtig mit der rechten Schulter. Es gelang ihm in letzter Sekunde, die Situation zu retten, indem er die Hand zum Gruß an die Braue hob. Dann verschwand er und sie waren allein.
Langsam und vorsichtig, so als seien sie darum bemüht, möglichst wenig Geräusche zu verursachen, um die Ruhe des Kranken nicht zu stören, bewegten sich Oster und Helldorff auf das einzige belegte Bett zu. Die Stiefel quietschten leise auf dem Linoleumfußboden, es roch nach Medizin und Siechtum.
Als Oster am Bett des Häftlings ankam, bemerkte er, dass Helldorff ein Stück weit zurückgeblieben war. Der Geruch nach Medikamenten, Desinfektionsmittel und etwas, das an sauren Käse erinnerte, war hier besonders stark. Betroffen sah er auf den Mann vor sich hinunter.
Joseph Goebbels lag lang und flach auf der Pritsche, fast schien er zur Hälfte in die weiche Matratze eingesunken zu sein. Die Arme hatte er links und rechts seines kleinen, beinahe zart wirkenden Körpers auf die Decke gelegt, die ihm bis über die Brust reichte. Sein Kopf ruhte vollkommen gerade auf dem Kissen, sodass die gesamte Haltung des Kranken den Eindruck eines Toten erweckte, den man würdevoll zur letzten Ruhe gebettet hatte. Sein dickes, fast krauses Haar wirkte wie eine Perücke, die man dem fahlen Leichnam übergestülpt hatte. Lediglich die Augen, die neben einer ramponiert aussehenden Nase in den tiefen Höhlen eines aschfahlen Knochenschädels nach links rollten und den Besucher schwach anblickten, gaben einen Hinweis darauf, dass das Leben noch nicht vollends aus der Gestalt gewichen war. Der schiefe, wie verzerrt wirkende Mund, der für Goebbels auch zu dessen besten Zeiten charakteristisch war, ließ nicht erkennen, ob er wusste, wer dort vor ihm stand.
Oster war unbehaglich zumute. Er hatte nicht die geringste Ahnung, was er sagen, wie er anfangen sollte. Wenn er sich zunächst einmal vorstellte, so hoffte er, würde ihm schon noch das Passende einfallen.
»Mein Name ist Oberstleutnant Hans Oster, ich bin Leiter der Zentralabteilung der Abwehr. Ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal begegnet sind.«
Die Augen des Patienten bewegten sich sachte von Osters Augen zu dessen Mund. Während letzterer sprach, schien Goebbels das Gesagte zusätzlich von dessen Lippen ablesen. Ansonsten war keinerlei körperliche Reaktion auf die Worte des Oberstleutnants zu erkennen.
»Soweit ich informiert bin, kennen Sie den Berliner Polizeipräsidenten.«, sagte Oster und wies mit einer Handbewegung auf Helldorff, der reglos außerhalb seines Gesichtskreises verharrte.
Wieder wechselte Goebbels‘ Blick schwach zwischen Mund und Augen seines Besuchers hin und her. Dann schien er etwas zu fixieren, das sich irgendwo hinter Osters linker Schulter befand. Daraufhin atmete Goebbels ein paar Mal schnell und flach ein und aus, seine Lippen verkrampften sich und ließen den Mund noch schiefer erscheinen. Mit einem vorwurfsvollen Ausdruck schenkte er seine Aufmerksamkeit wieder Oster, wohl in der Erwartung weiterer Erklärungen.
In diesem Moment hatte Oster gehofft, dass ihm Helldorff zu Hilfe eilen und die Führung des Gesprächs übernehmen würde. Schließlich kannten sich die beiden seit längerer Zeit persönlich, waren offenbar sogar befreundet gewesen. Sicher wäre es dem Polizeipräsidenten leichter gefallen, dem prominenten Patienten etwas von Bedeutung zu entlocken. Helldorff jedoch tat nichts dergleichen, hielt sich bewusst abseits und gab nicht den leisesten Laut von sich. Allmählich hegte Oster ernsthafte Zweifel daran, ob Joseph Goebbels auch nur ein einziges Wort sagen würde.
»Wir hatten gehofft, Sie könnten uns Auskunft geben.«, schwenkte der Oberstleutnant langsam auf das Thema ein, das der Grund ihres Kommens war. »Auskunft darüber, was in den Minuten vor dem Eindringen des Stoßtrupps in die Reichskanzlei in der Wohnung des … Führers … vorgefallen ist.«
Es war ihm nicht leichtgefallen, das Wort »Führer« auszusprechen. Aus taktischen Erwägungen hatte er es jedoch für klüger gehalten, gegenüber Goebbels nicht einfach von »Hitler« zu sprechen, da dieser das leicht als Respektlosigkeit hätte auffassen können.
Der Mund des Patienten begann leicht zu zittern, blieb aber weiterhin krampfhaft verschlossen. Dabei wandte er den Blick von Oster ab und fixierte einen unsichtbaren Punkt an der Zimmerdecke.
Der Abwehrmann wusste nicht weiter. Was konnte er sagen oder tun, um den ehemaligen Propagandaminister zum Sprechen zu bringen? Wie konnte er ihm die Information entlocken, die Beck so sehnlichst wünschte? Langsam bezweifelte er, dass es eine gute Idee gewesen war, ihn hierher zu schicken.
»Warum?«, drang es ohne Vorwarnung heiser und leise, wie ein Flüstern, von der Pritsche. Leicht hätte man dem Eindruck verfallen können, ein Windhauch habe die Stimme von der Straße hereingeweht, obwohl doch alle Fenster fest verschlossen waren.
Oster versuchte sich zusammenzunehmen, um die Bresche, die sich soeben aufgetan hatte, nicht ungenutzt zu lassen. Um Zeit zu gewinnen, fragte er:
»Entschuldigung, wie bitte?«
»Warum wollen Sie das wissen?«, antwortete das Flüstern. »Was kümmert es Sie wie …«, brach es mitten im Satz ab. Der Mund schloss sich und nahm wieder seine verzerrte Haltung ein. Die dunklen Lider senkten sich fast vollständig über die Augen, die sich mit Wasser zu füllen begannen.
»Nun, sehen Sie …«, setzte Oster an und wähnte sich schon am Ziel. Dann fiel ihm aus heiterem Himmel Helldorff ins Wort.
»Du musst uns sagen, ob Hitler wirklich tot ist!«, preschte der Polizeipräsident vor und tat dies auch buchstäblich, indem er an Oster vorbei ans Krankenbett sprang und den Oberstleutnant dabei anrempelte. »Hat er in letzter Minute Gift geschluckt?«
Bei diesen Worten kehrte das Leben in den leichenhaften Patienten zurück. Blitzartig schlug er die Augen auf, auch sein Mund öffnete sich einen Spalt weit. Während er den Polizeipräsidenten anstarrte, konnte man Überraschung in seinen Zügen lesen, die allmählich etwas anderem wich, das schwer zu entziffern war. Vielleicht war es Erkenntnis, vielleicht Befriedigung, sehr wahrscheinlich beides in dieser Reihenfolge. Hätte er die Kraft besessen, wäre der Patient nun vermutlich in ein hysterisches Lachen verfallen. Heraus kam ein Röcheln und Keuchen, das einem einen eiskalten Schauer über den Rücken jagte.
»Wir könnten etwas arrangieren.«, lockte Helldorff in der Hoffnung, Goebbels nun endlich zum Reden zu bringen. »Magda und die Kinder könnten dich besuchen. Aber nur, wenn du uns sagst, was …«
»Magda.«, sagte die Stimme, die an Kraft gewonnen zu haben schien. Dabei war es keine liebevolle Sehnsucht, die in Goebbels‹ Stimme mitschwang. Es klang vielmehr wie Verachtung für einen ehemaligen Gefolgsmann, der in Ungnade gefallen war. »Du kannst mir nichts geben.«
Damit kehrte der gestürzte Propagandaminister in seine ursprüngliche Ausgangsposition zurück, hielt die Augen halb geschlossen und presste die Lippen fest aufeinander. Reglos blieb er so liegen. Offenbar hatte er entschieden, dass die Unterhaltung damit beendet war.
In diesem Augenblick trat der Arzt in das Zimmer. Anscheinend waren ihre fünfzehn Minuten um, was ohnehin kaum eine Rolle spielte. Denn Oster glaubte nicht, dass sich hier noch etwas erreichen ließe.
»Ich muss Sie nun mit aller Vehemenz bitten, zu gehen.«, sagte der Arzt und klang, als meine er es auch so.
Nicht einmal der Polizeipräsident erhob gegen die Aufforderung irgendwelche Einwände. Sogar er musste schließlich einsehen, dass sein plumpes Vorgehen die Lippen des ehemaligen Propagandaministers in der vorliegenden Angelegenheit vermutlich für immer versiegelt hatte.
Wortlos schob er sich zwischen dem Arzt und Oster hindurch und stürmte schnellen Schrittes aus dem Zimmer.
Kapitel 2
»Ahab war sich auch einer anderen Sache bewusst: In Augenblicken überschäumender Emotionen wischt der Mensch selbst die einfachsten Bedenken beiseite; doch solche Augenblicke währen nicht lange. Die grundlegende Eigenschaft des von Gott erschaffenen Menschen ist Mittelmäßigkeit, dachte Ahab. Vorausgesetzt der Weiße Wal entflammte vollständig die Herzen seiner wilden Besatzung und transformierte ihre Wildheit gar in eine Form der Ritterlichkeit, der zu Liebe sie die Jagd nach Moby Dick fortsetzten, so mussten doch auch ihre gewöhnlichen, alltäglichen Bedürfnisse genährt werden. Denn selbst die erhabenen Kreuzritter alter Zeiten waren nicht fähig, sich über zweitausend Meilen hinweg zum Heiligen Grab zu begeben, ohne sich dabei die Zeit mit Einbrüchen, Diebstählen und ähnlichen frommen Nebeneinkünften zu vertreiben. Hätten sie sich stur auf ihr finales und romantischen Ziel versteift – nicht wenige hätten sich schon bald angewidert davon abgewandt. Ich werde ihnen nicht die Aussicht auf volle Taschen nehmen, dachte Ahab.«
Frustriert klappte Christoph das Buch zu und legte es zur Seite. Er hatte nicht die geringste Ahnung, was er in den vergangenen Minuten gelesen hatte. Zielsicher waren seine Augen über die Zeilen gehuscht, hatten Buchstaben erfasst, Wörter daraus gebildet, zu Sätzen geformt. Diese Stimme im Kopf, die immerzu da ist, die Gedanken und Gefühle für niemanden sonst hörbar in Worte fasst und wortlos ausspricht, hatte ihm die Passage aus dem Buch zuverlässig wie ein routinierter Erzähler von Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen. Dennoch war nichts davon in den Bereich seines Gehirns vorgedrungen, den die Fantasie ihre Heimat nennt. Die Sätze hatten keine Bilder hervorgerufen, er hatte nicht Kapitän Ahab vor sich gesehen, der auf dem Achterdeck stehend die Besatzung der »Pequod« mustert und dabei den Plan schmiedet, mit dessen Hilfe sich die Männer in ihr Verderben führen ließen. Sie waren einfach durch Christoph hindurch gegangen, und dass, obwohl er das Buch schon mehrfach gelesen hatte. Es war ihm gar nicht anders möglich, als sich über seine mangelnde Konzentrationsfähigkeit zu ärgern. Er war abgelenkt und nicht bei der Sache.
Seit drei Tagen saß er nun schon Zuhause herum und war vorwiegend damit beschäftigt, die Zeit totzuschlagen. Nun, wenn er ehrlich war, nicht ausschließlich damit. Vielleicht nicht einmal vorwiegend. Es gab vieles, das in Christophs Kopf umhergeisterte und jeden Versuch, sich abzulenken, aussichtslos erscheinen lassen musste.
Immer wieder kehrten seine Gedanken an den Abend zurück, als er Jan zum letzten Mal gesehen hatte. Wieder und wieder durchlebte er die Auseinandersetzung im Schatten der Gasse, sah Jan in dieser aufgewühlten, unterschwellig aggressiven Stimmung vor sich, grübelte über dessen merkwürdiges Verhalten nach. Er war entsetzt über den Auftritt seines Freundes, der kaum wiederzuerkennen gewesen war. Was war nur in ihn gefahren? Und was war es denn eigentlich, was er von ihm verlangte?
Sooft er auch darüber nachsann, er begriff es einfach nicht. Es war offensichtlich gewesen, dass Jan unbedingt kämpfen, dass er die Absetzung des Führers nicht einfach hinnehmen und etwas unternehmen wollte. Kämpfen – aber gegen wen? Man konnte ja schlecht nach Berlin marschieren und den Führer auf eigene Faust befreien.
Das alles ergab überhaupt keinen Sinn, sosehr man sich auch den Kopf darüber zerbrach. Das Einzige, das Christoph wusste, war, dass sich zwischen ihm und Jan ein Riss aufgetan hatte, der sich womöglich nicht mehr schließen lassen würde. Immerhin, versuchte er sich zu trösten, bestand die Hoffnung, dass Jan wieder zur Besinnung käme. Vielleicht hatte der sich mittlerweile wieder beruhigt und bereute seinen nächtlichen Auftritt. Andererseits, wie Christoph zugeben musste, war es schon das ganze Jahr hindurch immer wieder zu kleineren und größeren Auseinandersetzung und Streitereien zwischen ihnen gekommen. Jan war ihm äußerst reizbar erschienen, manchmal schien seine Beziehung zu Teresa der Grund dafür zu sein, manchmal etwas anderes, das Christoph nicht zu durchschauen vermochte. So oder so war er noch nicht bereit, seinen Freund aufzugeben. Wenn ihm doch nur etwas einfallen würde, wenn er nur wüsste, was er tun konnte.
Auch Teresa tauchte immer wieder in seinem verwirrten und nach Lösungen suchenden Geist auf. Christoph versuchte sich mit der Erinnerung an den Tag auf dem Augsburger Plärrer aufzurichten, dachte an ihre erste Verabredung am Neptunbrunnen zurück, aß in seiner Fantasie noch einmal ein Eis mit ihr, fuhr mit ihr das Kettenkarussell, ließ sich von ihr an der Hand nehmen und die Böschung bis zum Ufer der Wertach hinabziehen ...
Es half nicht lange. Diese kostbaren Erinnerungen, die er wie einen geheimen Schatz hegte und pflegte, wurden überschattet von Sehnsucht und der Sorge darüber, was aus Teresa geworden sein mochte. Zu Hause hatte er sie nicht angetroffen, ihr Vater hatte ihn an der Tür abgewiegelt und völlig im Unklaren darüber gelassen, ob es Teresa gut ging. Und nun war er hier in der Wohnung seiner Eltern gefangen und rang in jeder Minute mit dieser quälenden Ungewissheit.
Obwohl er nie geglaubt hätte, dass seine Eltern einmal einer Meinung mit seinem Freund Peter sein würden, hatten sie Christoph eine Art vorsorglichen Hausarrest erteilt. Sein Vater hatte sich die Sache überlegt und war nach kurzer Frist zu der Erkenntnis gelangt, es sei besser, wenn sein Sohn für einige Tage die Schule schwänzte. Die Mutter, noch immer wie paralysiert von den Zeitungsmeldungen, war nicht schwer zu überzeugen gewesen. Außerdem wäre es lediglich für einige Tage, bis weitere Nachrichten über die Ereignisse in Berlin an die Öffentlichkeit dringen würden und sich die Lage beruhigt hätte.
Nach Christophs Einschätzung war die Lage ruhig. Wenn er aus dem Fenster sah, schien nichts auf das Gegenteil hinzudeuten. Die Geschäfte hatten geöffnet wie jeden Tag, der Besitzer des kleinen Lebensmittelladens schräg gegenüber kurbelte morgens pünktlich wie stets die Markise herunter, die Anwohner gingen ihren Pflichten nach, alles war wie immer. In den Zeitungen tauchten keine beunruhigenden Nachrichten auf, auch die Meldungen im Radio erschienen harmlos und gewöhnlich. Verkündet wurden im Wesentlichen personelle Veränderungen, die die neue Militärregierung vorgenommen hatte, auch verschiedene, vorübergehende Anordnungen wurden verlautbart.
Ein gewisser Ludwig Beck, von dem Christoph bis vor kurzem noch nie etwas gehört hatte, hatte den Führer Adolf Hitler ersetzt und stand nun als neues Staatsoberhaupt an der Spitze des Landes. Einmal, es war am ersten Tag von Christophs »Schutzhaft« gewesen, hatte er den Mann im Radio sprechen hören. Im Verlauf der kurzen Rede war ihm sofort der enorme Unterschied zu Hitler aufgefallen, der weniger im Inhalt des Gesagten bestand, sondern vielmehr im Temperament des Sprechers: Ludwig Beck hatte mit ruhiger, etwas belegt klingender Stimme, in nüchtern-sachlichem Ton und etwas langweilig, wie Christoph fand, vorgetragen. Wo der Führer Adolf Hitler vor Emotionen nur so überzusprudeln pflegte, mal leiser, mal lauter, immer wieder auch in überkochender Wut sprach, da wirkte der neue Führer Ludwig Beck geradezu einschläfernd. Mehr wie ein eingestaubter Professor als wie ein Führer und Staatslenker. Folgerichtig hatte sich Christoph auch nicht gemerkt, worum es bei der Radioansprache eigentlich gegangen war.
Nein, er war sich sicher, die Lage war ruhig und würde es auch bleiben. Sein Vater, der vor wenigen Tagen einem Handgemenge in der Fabrik mit einem blauen Auge entkommen war, sagte schließlich selbst, dass es seither keine weiteren Vorfälle gegeben hatte. Zwar sei eine gewisse Anspannung unter der Belegschaft zu spüren, doch herrsche im Allgemeinen Ruhe und Ordnung. Das Leben ging weiter, wie immer, als sei nichts gewesen. Nüchtern betrachtet gab es also keinen Grund, Christoph hier weiterhin einzusperren. Wie das der anderen sollte auch sein Leben weitergehen wie bisher – ganz besonders, da es sich in den vergangenen Monaten doch so vielversprechend entwickelt hatte.
Er hörte, wie jemand von außen einen Schlüssel in das Türschloss steckte und aufsperrte. Ein Rascheln war zu hören, die Tür fiel zurück ins Schloss. Sekunden später erschien Christophs Mutter mit einem Flechtkorb voller Lebensmittel in der Küche. Es war 10:33 Uhr.
Mit unbewegter Miene sah die Mutter Christoph für eine Sekunde lang an, gerade so, als handele es sich bei ihrem jüngsten Sohn um einen unerwünschten Besucher, von dem man zwischenzeitlich vergessen hatte, dass er da war. Wortlos stellte sie den Korb unweit der Spüle ab, begann die Lebensmittel der Reihe nach zu entnehmen und in die ihnen zugewiesenen Schränke einzuräumen. Gelegentlich atmete sie hörbar aus wie jemand, der mit einer unsichtbaren Last oder mit Schmerzen zu kämpfen hat.
Auch Christoph sagte noch immer kein Wort. Er beobachtete seine Mutter dabei, wie sie einen Bund Möhren in das Waschbecken legte – tatsächlich ließ sie die Möhren fallen wie etwas, das man schnell loswerden wollte – und konnte den Anblick kaum ertragen.
Zwar wirkte sie nicht mehr ungemacht, ja fast verwahrlost wie noch vor einigen Tagen. Ihr Haar war ordentlich gebürstet, ihre Kleidung tadellos. Dennoch schien sie unter einer unbekannten Krankheit zu leiden, war bleich mit dunklen Ringen unter den Augen, in denen sich rote Äderchen wie Ströme aus Lava verzweigten. Sie sprach kaum mehr mit jemanden, erfüllte schweigend ihre häuslichen Pflichten und schien sich mehr und mehr in sich selbst zurückzuziehen. Für Christoph war es, als sei seine Mutter an einen finsteren Ort entschwunden, dem sie nicht entrinnen, von wo sie niemand retten konnte.
Mit einer seltsamen Mischung aus Mitleid, Hilflosigkeit und Widerwillen wandte er sich ab. Natürlich liebte er seine Mutter und nur zu gerne hätte er ihr in irgendeiner Weise geholfen. Dass sie sich aber auch nach Tagen noch immer derart niedergeschlagen zeigte, dass sie die Vorgänge in Berlin auf so übertriebene Weise mitnahmen, das konnte er nicht begreifen. Es fehlte nicht viel und man hätte auf den Gedanken verfallen können, sie liebe den Führer und trauere dem Verlust ihres Geliebten nach.
Christoph nahm sein Buch vom Küchentisch und verschwand lautlos in sein Zimmer.
***
Am Abend kehrte Christophs Vater von der Arbeit zurück. Für Christoph, der den ganzen Tag überwiegend brütend in seinem Zimmer verbracht hatte, war dies der einzige Grund, seinen Rückzugsort zu verlassen.
Im Gegensatz zu seiner Mutter zeigte sich sein Vater in Bezug auf seinen Gemütszustand nahezu unverändert. Er war noch immer der ruhige, überlegte, schier unerschütterliche Fels in der Brandung, auf dessen Urteil man sich verlassen konnte. Außerdem hatte Christoph einen Plan geschmiedet: Er wollte ihn davon überzeugen, dass es nun an der Zeit sei, die »Schutzhaft« zu beenden.
Als er mit Mutter und Vater am Küchentisch saß und gierig die Suppe in sich hineinlöffelte, bemerkte Christoph erst wie hungrig er war. Damit beschäftigt, die gelblich-grüne Flüssigkeit mit den Fettaugen, den in Scheiben geschnittenen Möhren und den zuvor zerteilten Grießnockerln auf dem Löffel balancierend in seinen Mund zu befördern, geriet Christoph gar nicht erst in die Verlegenheit, seine Mutter anzusehen oder etwas sagen zu müssen. Stattdessen lauschte er dem Vater, der dies und das, alltägliche Belanglosigkeiten, von der Arbeit berichtete.
Zwischen dem Schlürfen und dem, was sein Vater sagte, bemerkte Christoph sehr wohl, dass die Reaktionen seiner Mutter nicht so ausfielen, wie man es erwarten würde. Sie gab keinen Kommentar von sich, räusperte sich nicht einmal, widmete sich stur wie er selbst der Suppe und ließ mit keiner Geste, keinem Ton erkennen, ob sie überhaupt zuhörte. Das machte Christoph wütend.
Nachdem er aufgegessen hatte, stand er einfach auf und schickte sich an, die Küche zu verlassen. Unter normalen Umständen hätte ein solches Verhalten eine Zurechtweisung nach sich gezogen, vor allem die Mutter hätte ihm anständig die Ohren gewaschen. Absichtlich beging Christoph diese Unhöflichkeit, ließ demonstrativ einen Mangel an Anstand und Respekt erkennen. Denn einerseits hoffte er damit irgendeine Reaktion auszulösen, andererseits wusste er, dass er derzeit kaum etwas zu befürchten hatte. Befriedigt stellte er fest, wie seine Eltern innehielten und ihn überrascht ansahen. Wie selbstverständlich schlüpfte er ohne ein Wort hinaus und begab sich in die Wohnstube.
Auf einem bequemen Polsterstuhl unweit des Ofens in der Ecke setzte sich Christoph hin und wartete. Dieser Platz war gemäß dem familiären Gewohnheitsrecht seiner Mutter vorbehalten, die schon bei mäßig kalten Temperaturen zu freieren begann und sich daher bevorzugt in der Nähe der häuslichen Wärmequellen aufhielt. Hier saß sie oft und las ein Magazin oder besserte mit Nadel und Faden die Kleidung der Familienmitglieder aus. Erwartungsfroh sah Christoph dem Moment entgegen, wenn seine neuerliche Provokation erkannt würde.
Die Eltern ließen sich Zeit. Lange erschien keiner der beiden, nicht einmal ein Laut drang bis zu Christoph vor, als sei er der einzige Bewohner der Behausung. Seine Streitlust wurde durch das Warten deutlich abgemildert, was seine Laune nur noch weiter verschlechterte.
Plötzlich erschien ihm der Stuhl sehr unbequem. Unruhig rutschte er hin und her und versuchte eine behagliche und zugleich selbstbewusste Position einzunehmen. Es gelang ihm mit nur mäßigem Erfolg.
Endlich, Stunden später, so jedenfalls erschien es Christoph, tauchte sein Vater in der Stube auf. Der warf ihm einen Blick zu, der zu erkennen gab, dass er sehr wohl erkannte: etwas befand sich nicht am gewohnten Ort. Mit einem tiefen Seufzer ließ sich der Vater in den einzigen Sessel fallen, dem bequemsten Sitzmöbel, das von je her dem Hausherrn vorbehalten war. Mit routinierter Ruhe stopfte er sich eine Pfeife und begann zu rauchen, während er in der Zeitung blätterte.
Beunruhigt davon, wie unbeeindruckt sich der Vater angesichts des neuerlichen Affronts des Sohnes zeigte, begann Christoph innerlich zu wanken. Zähneknirschend sah er ein, dass er seinen ursprünglichen Plan, den Vater durch sein Verhalten aus der Reserve zu locken, aufgeben musste. Stattdessen blieb ihm nun nichts anderes übrig, als seinen Wunsch, den Hausarrest endlich aufzuheben, anderweitig zur Sprache zu bringen.
»Draußen ist wohl nicht besonders viel los.«, begann er mit vor der Brust verschränkten Armen in gespielt beiläufigem Ton.
Der Vater, das Gesicht hinter der aufgeschlagenen Zeitung versteckt, gab keinen Laut von sich. Ein gelegentliches Rascheln des Papiers war das einzige Geräusch, das aus seiner Richtung zu vernehmen war. Wie die Rauchzeichen von auf Beutezug befindlichen Apachen traten dann und wann einzelne Rauchschwaden hinter der Zeitung hervor und lösten sich zügig im Zimmer auf.
»Im Betrieb ist wohl auch alles ruhig.«
Ein schlichtes »Mmhh« verschaffte nun immerhin die Gewissheit, dass der Vater nicht unerwartet taub geworden war. Zu weiteren Ausführungen ließ er sich allerdings nicht verleiten.
Christophs wachsende Frustration wurde von der Türklingel unterbrochen. Aus dem Flur konnte er hören, wie Tür geöffnet wurde und mehrere Personen miteinander sprachen. Seiner Einschätzung nach war wenigstens eine Männerstimme darunter. Was dort gesagt wurde, konnte er nicht verstehen.
Augenblicke später trat die Mutter in die Stube, gefolgt von einem älteren Mann und einer älteren Frau. Es waren die Krausens aus der Nachbarwohnung, ein greises Ehepaar, dass dort schon wohnte so lange Christoph denken konnte.
»Herr Krause hat gehört, dass es eine Übertragung im Radio geben soll.«, erklärte die Mutter in geschäftsmäßigem Ton. Es war offenbar, dass sie von dem unangemeldeten Besuch nicht sonderlich begeistert war.
»Ich habe am offenen Fenster in der Küche geraucht,«, erläuterte Herr Krause mit heiserer Stimme, »woanders darf ich nämlich nicht.«
Er warf seiner Frau einen scheuen Blick zu wie ein Hündchen, dass sich nicht sicher war, ob es von seinem Herrchen einen Hieb mit der Leine oder eine Belohnung zu erwarten habe. Dann sah er mit einer Mischung aus Neid und Sehnsucht zu Christophs Vater, der noch immer Pfeife rauchend in seinem Sessel saß, bevor er fortfuhr.
»Dort kann man den Empfänger der Modrichs von unten hören. So gut aber leider auch nicht – Sie wissen, das Gehör ist nicht mehr das Beste. Vielleicht könnten wir uns die Sendung gemeinsam anhören?«
»Bitte, kommen Sie nur herein.«, sagte der Vater, legte die Zeitung weg, stand auf und begab sich zu dem Volksempfänger, der auf einem kleinen Tischchen stand. »Nehmen Sie Platz. Das haben wir gleich …«
»… mit sofortiger Wirkung in Kraft.«, drang es blechern aus dem schwarz lackierten Gerät, während sich Herr und Frau Krause auf das Sofa setzten.
»Ach bitte, machen Sie doch etwas lauter!«, bat Frau Krause.
»Weiterhin werden die NSDAP und alle ihr unterstehenden, angegliederten oder nahestehenden Organisationen und Gruppierungen für aufgelöst erklärt. Hierzu zählen vor allen Dingen die Sturmabteilung und die Schutzstaffel, die Nachwuchsorganisation der Hitlerjugend samt ihrem weiblichen Zweig Bund deutscher Mädel, der Reichsarbeitsdienst, die NS-Frauenschaft, der Nationalsozialistische Lehrerbund …«
Abgesehen von der von einem konstanten Rauschen untermalten Stimme des Radiosprechers war es vollkommen still im Zimmer. Niemand wagte auch nur einen Finger zu rühren aus Angst, etwas von dem Gesagten zu verpassen. Herr und Frau Krause lauschten angestrengt und hätten wohl nichts gegen eine weitere Anpassung der Lautstärke einzuwenden gehabt, sagten aber nichts.
Die Aufzählung der von nun an verbotenen NS-Organisationen dauerte noch eine Weile fort. Dann hieß es:
»Mitgliedschaften in den zuvor genannten Organisationen werden für ungültig erklärt. Zusammenkünfte, Verabredungen, Korrespondenzen und ähnliches, das zum Zwecke der Aufrechterhaltung, des Ausbaus oder der Neuordnung dieser Strukturen unternommen wird, werden unter Strafe gestellt. Weiterhin wird erklärt, dass die Parteifahne der NSDAP – schwarzes Hakenkreuz auf weißem Spiegel auf rotem Grundtuch – nicht länger als Nationalflagge des Deutschen Reiches anzusehen ist. Sie wird ersetzt durch die Flagge mit drei waagerechten, gleich breiten Streifen in den Farben Schwarz-Weiß-Rot.
Um eine ordnungsgemäße Durchführung der genannten Maßnahmen zu gewährleisten, wird vorübergehend eine landesweite Ausgangssperre verordnet. Beginnend kommenden Samstag, dem 1. Oktober 1938, haben sich Bürger, die über keine entsprechende Ausnahmegenehmigung verfügen, zwischen 21 Uhr und 5 Uhr in ihren Wohnungen aufzuhalten. Wer während dieser Sperrzeit auf den Straßen, auf öffentlichen Plätzen oder in öffentlichen Parks angetroffen wird, hat mit polizeilicher Verfolgung zu rechnen. Private Versammlungen von Personen, die die Zahl von fünf überschreiten, sofern sie nicht mehrheitlich aus Familienmitgliedern bestehen, sind mit Beginn der Ausgangssperre ebenfalls untersagt.
Die entsprechenden Verordnungen werden der Bevölkerung in kürze zusätzlich zu dieser Mitteilung in Schriftform in aller Ausführlichkeit bekannt gegeben. Alle Bürger des Reiches werden auch weiterhin dazu aufgefordert, den Anordnungen Folge zu leisten und Ruhe zu bewahren.«
Fanfarenklänge markierten feierlich das Ende der Durchsage. Danach drang nur noch ein leises Knistern aus dem Apparat.
»Das war zu erwarten.«, bemerkte Herr Krause nüchtern. »Mich wundert’s, dass das überhaupt solange gedauert hat.«
»Wir sollten unsere Mitgliedsbeiträge zurückverlangen.«, meinte Frau Krause ärgerlich. »Die bilden sich wohl ein, unsereins hätte Geld wie Heu.«
»Ist das Ihre einzige Sorge?«, fuhr Christophs Mutter die Nachbarin an. »Was ist mit der Zukunft unseres Landes? Was mit der Zukunft unserer Kinder? Bedeutet das alles denn gar nichts?!«
Entsetzt über diesen Ausbruch sah der Vater seine Frau an. Noch bevor er beruhigend einschreiten und etwas sagen konnte, machte die Mutter mit Tränen in den Augen kehrt und verschwand in der Wohnung.
Betroffen starrte Herr Krause zu Boden.
»Ich habe ja nur gesagt, dass wir nichts zu verschenken haben.«, sagte Frau Krause und machte dabei ein trotziges Gesicht. »Nicht mehr und nicht weniger.«
»Wir sollten besser gehen.«, stellte Herr Krause fest, wohl auch deshalb, um weiteren Ausführungen seiner Frau zuvorzukommen. »Haben Sie Dank für Ihre Freundlichkeit.« Damit stand er auf und verließ mit seiner Frau im Schlepptau die Wohnstube.
»Was hältst du davon?«, wollte Christoph wissen, als sein Vater, der die Krausens zur Tür geleitet hatte, zurückkehrte.
Er selbst wusste überhaupt nicht, was er von der Radiodurchsage halten sollte. Einerseits hielt er es für einleuchtend, dass die NSDAP nun offiziell als verboten galt, andererseits empfand er die Vorstellung seltsam und es mutete ihm unwirklich an. Uniformen, Symbole, Bezeichnungen, Zeichen – Alltäglichkeiten, die Christoph seit seinem dreizehnten Lebensjahr ganz selbstverständlich vorgekommen waren, sollten nun von einem Tag auf den anderen aus der Öffentlichkeit verschwinden. Erst allmählich schien sich das Ausmaß der anstehenden Veränderungen zu offenbaren.
»Die neue Regierung ist in erster Linie um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung besorgt. Das ist verständlich.«, antwortete der Vater und begann seine Pfeife zu stopfen. »Nicht alle werden froh über die Auflösung der Partei sein …«, brach er mitten im Satz ab, als ihm einfiel, dass seine eigene Frau ebenfalls zu dieser Gruppe zählte. »Manche werden Zeit brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich an so ziemlich alles. Außerdem kommt es nur selten so schlimm, wie man befürchtet. In ein oder zwei Monaten wird es uns so vorkommen, als wäre nichts Besonderes vorgefallen.«
Die Ausführungen seines Vaters schürten Christophs Zuversicht. Bald würde sich alles wieder normalisieren und praktisch weitergehen wie bisher, nur eben ohne Hakenkreuzfahnen, ohne Hitlergruß – und ohne Hitlerjugend.
»Dann hast du nichts dagegen, wenn ich …«, Christoph suchte nach den richtigen Worten, »… mal an die frische Luft gehe?«
Der Vater sah seinen Sohn skeptisch an. »Ich denke es ist noch etwas zu früh dafür.«
»Aber was soll schon passieren?«, protestierte Christoph und klang dabei wie ein quengelndes Kind. »Du hast selbst gesagt, es herrscht Ruhe in der Stadt. Ich will ja nicht den ganzen Tag draußen verbringen, nur eine Stunde oder zwei. Ich vermisse meine Freunde.«
Der Vater zog ein paar Mal an seiner Pfeife, blickte seinen Sohn durchdringend an und dachte nach. Nach einer Weile nahm er die Pfeife aus dem Mund, seufzte und sagte:
»Ich weiß, dir fällt die Decke auf den Kopf. Gedulde dich noch etwas. Bald ist Wochenende, ab Samstag gilt die Ausgangssperre. Wenn nach Ablauf einer Woche alles friedlich bleibt, reden wir weiter.«
»Mmpf«, machte Christoph, mit dieser Antwort alles andere als zufrieden. Sein weiterer Protest beschränkte sich darauf, dass er erneut die Arme vor der Brust verschränkte und grimmig auf den Volksempfänger starrte. Nur zu gut wusste er, jede weitere Diskussion wäre zwecklos. Sein Vater würde sich durch nichts von seinem Entschluss abbringen lassen.
Da verschaffte sich ein anderer Gedanke Raum in seinem Kopf. Er schlich sich ein, verstohlen und heimlich, in ein Gewand aus Unschuld gehüllt: Es musste ja überhaupt niemand erfahren, wenn er für kurze Zeit das Haus verließ.
Allmählich nahm ein Plan Gestalt an. Christophs Vater war wochentags bis in die frühen Abendstunden arbeiten, die Mutter hatte vormittags das eine oder andere zu erledigen, während des Rests des Tages gingen sie sich aus dem Weg. Es gab nur ein Problem, denn er musste die Wohnungstür benutzen, für einen heimlichen Ausstieg aus dem Fenster wohnten sie zu hoch über der Straße. Hinausgelangen konnte er ohne weiteres, sobald die Mutter das Haus einmal verlassen hatte – wie jedoch wieder unbemerkt die Wohnung betreten? Man konnte unmöglich vorhersagen, wie lange die Mutter weg wäre, manchmal war sie eine Stunde und länger fort, manchmal nur kurz.
Angestrengt überlegte Christoph, wie er sie für einige Stunden aus dem Haus locken konnte.
Kapitel 3
2. Oktober 1938
Einen Tag nach Inkrafttreten der nächtlichen Ausgangssperre, es war ein Sonntag, hätte ein unbeteiligter Beobachter noch immer dem Eindruck verfallen können, im Deutschen Reich verlaufe alles in den gewohnt geordneten Bahnen. Die Mehrzahl der Menschen war bislang ihrer täglichen Arbeit nachgegangen, die Fabriken hatten alle erdenklichen Waren produziert, die Landwirte ihre Felder bestellt und ihr Vieh versorgt, der Beamtenapparat und die Behörden weitgehend frei von Störungen funktioniert. Selbst die Ausgangssperre wurde weitestgehend eingehalten, nur selten kam es zu Zwischenfällen, bei denen die Polizei eingreifen musste. Scheinbar wurde Heinrich Himmlers vor Tagen erfolgter Aufruf zum Widerstand gegen die Putschisten kollektiv ignoriert. Alles erweckte den Eindruck, als verliefe der Übergang von der nationalsozialistischen Diktatur zu einer provisorischen neuen Regierung und die allmähliche Rückkehr zu einem Rechtsstaat erstaunlich reibungslos. Der alte Ausspruch, der Deutsche tauge nicht zum Revolutionär, schien einmal mehr seinen Wahrheitsgehalt unter Beweis zu stellen.
Doch dieser Schein begann langsam und heimlich, in kleinen und kleinsten Details zu bröckeln. Wer Augen und Ohren offenhielt und aufmerksam durch die Städte und Dörfer schritt, dem konnte nicht entgehen, wie es unter der trügerisch ruhigen Oberfläche der Gesellschaft brodelte.
Auch wenn sich die breite Mehrheit mit Erleichterung darüber äußerte, dass durch die Veränderten Machtverhältnisse in Berlin ein Krieg gegen die Tschechoslowakei und ihre Verbündeten in vermutlich letzter Sekunde verhindert worden war, wurde doch immer wieder Unmut laut über die radikale Vorgehensweise der Militärs. Wie man es auch drehen und wenden wolle, ein Putsch sei Verrat und Verrat etwas zutiefst Verabscheuungswürdiges. Man sei hier schließlich nicht in Südamerika, wo gewaltsame Regierungswechsel durch machthungrige Offiziere an der Tagesordnung wären. So manch einer hegte den heimlichen Verdacht, die putschenden Generäle wollten gar nicht einen Krieg verhindern, sondern dies lediglich als Vorwand nutzen, um sich selbst die Macht zu sichern.