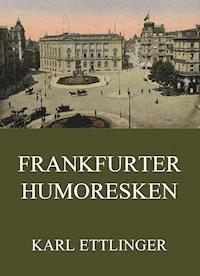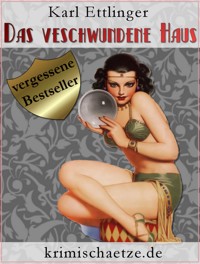
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: krimischaetze.de
- Kategorie: Krimi
- Serie: krimischaetze.de
- Sprache: Deutsch
Erstmals seit den 1920er Jahren neu aufgelegt: In »Das verschwundene Haus – oder: Der Maharadscha von Breckendorf« erzählt der deutsch-jüdische Journalist und Schriftsteller Karl Ettlinger mit Humor und satirischem Scharfsinn eine provinzielle Kriminalgeschichte mit internationalem Flair. Eduard Bohnkraut – ein gutmütiger Polterer mit Bärenstimme und Inhaber eine Schnapskneipe in Philadelphia – kehrt nach zwanzig Jahren in den USA in seine alte Heimat zurück: Dank der guten Luft ist das verschlafene Breckendorf im Harz inzwischen zu einer Großstadt mit Kurbetrieb avanciert – mit edlen Hotels, eigenem Theater und Gästen aus aller Welt. Bohnkraut möchte in das Haus seines verstorbenen Vaters einziehen, doch anstelle der »Villa Sonnenstrahl« erwartet ihn eine leere Baugrube. Und der Rechtsanwalt »Meier III«, der Bohnkraut brieflich über das Erbe informiert hat, ist in der Stadt noch nie gesehen worden. Als bei einer Theaterpremiere mit Stromausfall neben vielen anderen auch der berühmteste aller Kurgäste – der Maharadscha von Bengusi – beklaut wird, deutet sich ein Zusammenhang mit Bohnkrauts verschwundenem Haus an: Die »Villa Sonnenstrahl«-Bande versetzt die Stadt in Ausnahmezustand. Amerika-Rückkehrer Bohnkraut hält die lokale Polizei für unfähig und ermittelt auf eigene Faust. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel voller Überraschungen … In Zukunft werden bei www.krimischaetze.de regelmäßig weitere Titel erscheinen - überarbeitet, in neuer Rechtschreibung und mit erklärenden Fußnoten versehen. krimischaetze.de Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Karl Ettlinger
Das verschwundene Haus
Oder: Der Maharadscha von Breckendorf
Karl Ettlinger
Das verschwundene Haus
Oder: Der Maharadscha von Breckendorf
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Georg Müller, München, 1922 2. Auflage, ISBN 978-3-954185-33-7
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Über krimischaetze.de
Über den Autor
Über dieses Buch
Handelnde Personen
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
krimischaetze.de
Der Drachenteich
Fräulein Bandit
Die blaue Spur – Maurice Wallion ermittelt
Das verschwundene Haus
Der Tod im Kasino
Der Mann vom Meer
Auf der Flucht
Die weiße Nelke
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Über krimischaetze.de
Kriminalromane sind heutzutage erfolgreich wie nie. Krimi-Klassiker? Da denken die meisten sofort an Agatha Christie (1890-1976) oder Edgar Wallace (1875-1932). Tatsächlich gehörten die britischen Autoren zu den ersten, die in den »wilden« 1920er Jahren ins Deutsche übersetzt wurden. Krimi-Fans kennen oft auch den Schweizer Friedrich Glauser (1896-1938), den Namensgeber des Glauser-Preises -- eine der wichtigsten Auszeichnungen für deutschsprachige Krimi-Autoren. Wie vielfältig die Krimi-Szene in der Weimarer Republik war, ist in der breiten Öffentlichkeit jedoch vollkommen in Vergessenheit geraten. Für krimischaetze.de haben sich Jürgen Schulze, Verleger des Null Papier-Verlages, und Sebastian Brück, Autor und Journalist, zusammengetan, um alte Krimi-Bestseller neu zu entdecken und als E-Book verfügbar zu machen -- überarbeitet, in neuer Rechtschreibung und mit erklärenden Fußnoten versehen.
Das krimischaetze.de-Programm startet zunächst mit sechs Titeln -- sowohl Übersetzungen aus dem Englischen (S.S. Van Dine) und Schwedischen (Julius Regis), als auch deutschsprachige Originale: In je zwei Fällen ermitteln Philo Vance, der »amerikanische Sherlock Holmes«, und Maurice Wallion, der »Detektivreporter« und »Urvater« von Stieg Larssons »Millenium«-Protagonist Mikael Blomqvist. Ebenfalls vertreten sind die vergessenen Werke zweier jüdischer Autoren: Die in Budapest, Paris und San Sebastián spielende Krimikomödie »Fräulein Bandit« des Österreichers Joseph Delmont sowie der humorvolle Kriminalroman »Das verschwundene Haus -- oder: Der Maharadscha von Breckendorf« des Frankfurters Karl Ettlinger.
In Zukunft werden bei www.krimischaetze.de regelmäßig weitere Titel erscheinen.
Über den Autor
Karl Ettlinger, geboren 1881 in Frankfurt am Main, stammt aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Im Alter von 23 Jahren veröffentlichte er erstmals Texte in der Münchener Wochenzeitschrift »Die Jugend«, bei der er kurz darauf vom Redaktionssekretär zum Redakteur aufsteigt. Von patriotischer Begeisterung getrieben zieht er in den Ersten Weltkrieg, wo er 1916 schwer verwundet wird. In dieser Zeit entstehen »Karlchens Kriegsberichte« -- satirische Anekdoten, die eine Auflage von rund 150.000 Exemplaren erreichen. Das Pseudonym »Karlchen« behält Ettlinger auch nach dem Krieg bei: Er geht mit kabarettistischen »Karlchenabenden« auf Tour durch deutsche Großstädte und Badeorte.
Außerdem schreibt er mehrere Gedichtbände sowie Novellen und humoristische Romane.
Nach der Machtübernahme durch die Nazis erhält er ab 1933 erste Arbeitsverbote -- bis ihm kurz vor seinem Tod das Schreiben komplett verboten wird. Zwischenzeitlich am Tegernsee ansässig, beschließt Ettlinger zu seinem Bruder in die USA auszureisen. Vorher -- im Mai 1939 -- wird er in Berlin an der Galle operiert und verstirbt dabei an Herzversagen.
An seinem Grab auf dem Jüdischen Friedhof in Frankfurt erinnert eine Gedenkplatte an Karl Ettlinger. Anfang der 1990er Jahre wurden einige seiner in Frankfurter Mundart geschriebenen Gedichte bei einem Verlag neu herausgegeben. Als Autor ist er außerhalb seiner Heimatstadt in Vergessenheit geraten.
Über dieses Buch
Erstmals seit den 1920er Jahren neu aufgelegt: In »Das verschwundene Haus --oder: Der Maharadscha von Breckendorf« erzählt der deutsch-jüdische Journalist und Schriftsteller Karl Ettlinger mit Humor und satirischem Scharfsinn eine provinzielle Kriminalgeschichte mit internationalem Flair.
Eduard Bohnkraut -- ein gutmütiger Polterer mit Bärenstimme und Inhaber eine Schnapskneipe in Philadelphia -- kehrt nach zwanzig Jahren in den USA in seine alte Heimat zurück: Dank der guten Luft ist das verschlafene Breckendorf im Harz inzwischen zu einer Großstadt mit Kurbetrieb avanciert -- mit edlen Hotels, eigenem Theater und Gästen aus aller Welt. Bohnkraut möchte in das Haus seines verstorbenen Vaters einziehen, doch anstelle der »Villa Sonnenstrahl« erwartet ihn eine leere Baugrube. Und der Rechtsanwalt »Meier III«, der Bohnkraut brieflich über das Erbe informiert hat, ist in der Stadt noch nie gesehen worden. Als bei einer Theaterpremiere mit Stromausfall neben vielen anderen auch der berühmteste aller Kurgäste -- der Maharadscha von Bengusi -- beklaut wird, deutet sich ein Zusammenhang mit Bohnkrauts verschwundenem Haus an: Die »Villa Sonnenstrahl«-Bande versetzt die Stadt in Ausnahmezustand. Amerika-Rückkehrer Bohnkraut hält die lokale Polizei für unfähig und ermittelt auf eigene Faust. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel voller Überraschungen ...
Handelnde Personen
Eduard Bohnkraut: Amerika-Rückkehrer mit Breckendorf-Vergangenheit
Polizeiassessor Funke: Ermittler im Fall von Eduard Bohnkrauts verschwundenem Haus. Ist wegen zahlreicher Frauengeschichten von der Landeshauptstadt nach Breckendorf versetzt worden.
Meier III: Mysteriöser Rechtsanwalt, zuständig für das Erbe von Eduard Bohnkraut.
Ajax: Foxterrier von Meier III
Adele Cantelli: Berühmte Tänzerin und Sängerin.
Bürgermeister / Polizeipräsident / Kurdirektor: Sind vornehmlich am guten Ruf Breckendorfs als Nervenkurort interessiert -- koste es, was es wolle.
Schutzmann Winkel: Einer von Funkes Assistenten
I.
Vor sechzig Jahren noch war Breckendorf ein idyllisches Nest, das nur wenige Harzwanderer aufsuchten. Heute widmen die Reisehandbücher dem Kurort Breckendorf vier ganze Seiten. Häuser, die man ehedem pietätlos alte Baracken nannte, werden heute ob ihres Baustils von den Kurgästen ehrfürchtig bewundert, und vor dem Rathaus wird den Schaulustigen von den Fremdenführern mehr Gescheites vorgeschwätzt, als je in dem Rathaus geredet wurde.
Der jetzige Bürgermeister empfängt seine Schutzbefohlenen nicht mehr in Hemdärmeln, er redet seinen Schreiber nicht mehr mit »du« an und unterbricht nicht mehr die Gemeindesitzung, wenn seine Kuh kalbt -- nein, heute ist der Herr Bürgermeister ein wohlfrisierter, juristisch gebildeter Herr, der zu seinen Amtsstunden in schwarzem Anzug erscheint, eine stattliche Anzahl Orden besitzt und, je nachdem es die Rathausmehrheit verlangt, konservative, liberale, streng kirchliche und freidenkerische Reden halten kann.
Ja, Breckendorf ist Großstadt geworden. Seine herrliche Lage in einem der schönsten waldigen Harztäler wurde ihm zum Verhängnis. Zuerst siedelten sich in Breckendorf nur vereinzelt pensionierte alte Herren an, harmlose Rentenfresser, die die Ruhe liebten, und die hier vor übermäßigen Ausgaben sicher waren.
Die Ureinwohner betrachteten diese Ankömmlinge mit Gleichgültigkeit, waren wohl erstaunt, dass diese Fremdlinge sich Häuser ohne Kuh- und Schweineställe bauten, kümmerten sich aber mit der Duldsamkeit der Landbewohner, die jeden nach seiner Fasson närrisch werden lassen, nicht weiter um sie. Der Bürgermeister sorgte dafür, dass die Zugezogenen pünktlich Steuerzettel bekamen, und beschränkte sich im Übrigen darauf, die Bauern zu belehren, dass es ihre vaterländische Pflicht sei, den fremden Herrschaften die Grundstücke nicht zu billig zu verkaufen. Aber in dieser Hinsicht waren die Breckendorfer schon von selbst gute Patrioten gewesen.
Es entstand am Hügel östlich des Dorfes eine kleine Villenkolonie mit schönen Gärten, mit behaglichen Häuschen, auf deren Balkonen und Veranden bei gutem Wetter beschlafrockte Herren und vereinzelt auch halbfrisierte Frauen ihren zur Ruhe gesetzten Geist mit Kaffeetrinken und ungefährlicher Lektüre einbalsamierten. Ein angenehmer Hauch von Pensionsberechtigung lag über diesem Villenviertel. Namen wie »Villa Sonnenstrahl«, »Mein Ruheplätzchen«, »Landhaus Aurora« zeugten von der Friedfertigkeit der Bewohner.
An einem der Gartengitter prangte allerdings ein Schild »Vor dem Hunde wird gewarnt«, aber das hatte der Besitzer nur aus Pietät angebracht, --- der Hund war schon lange vor der Übersiedlung seines Herrn nach Breckendorf gestorben.
So war Breckendorf eine liebliche Novelle in dem großen Buch der Natur, bis es ihr leider erging, wie so mancher anderen unschuldigen Novelle: Sie wurde plötzlich Mode. Irgendein spekulativ veranlagter Mensch brachte heraus, dass die Luft von Breckendorf bedeutend mehr Stickstoff enthalte als die Luft des übrigen Kontinents, dass Stickstoff das beste Heilmittel gegen alle Krankheiten sei, von der Cholera bis hinab zum Hühnerauge, und er beeilte sich, diese Entdeckung in tausenden von Broschüren und Zeitungsartikeln der Menschheit mitzuteilen.
Dass dieser Menschenfreund kurz zuvor fast den ganzen Grund um Breckendorf aufgekauft hatte, war ein neckischer Zufall.
Die Bauernhöfe machten dreistöckigen Häusern Platz, Hotels schossen aus dem Boden, die Kirchstraße wurde in »Hauptallee« umgetauft, und wo früher die Kühe und Ochsen gelustwandelt hatten, promenierten alsbald elegante Herren und Damen. Statt der Kuhschwänze wedelten seidene Schleppen, statt der Hörner trug die neue Straßenbevölkerung Sonnenschirme, und statt »Muh« sagte sie: »Herrliches Wetter heute, nicht wahr? Oh, dieser Stickstoff!«
Die Eisenbahn, die bisher einen großen Bogen um Breckendorf gemacht hatte, gab ihre vornehme Zurückhaltung auf, legte ein großes Ei in Gestalt eines Bahnhofs und gackerte täglich dreimal herbei, um nachzusehen, ob das Ei noch da sei. Und jedes Mal legte sie dabei einige Dutzend Kurgäste.
Ein Park wurde angelegt, Rasenanlagen geschaffen, damit man ihr Betreten verbieten konnte, ein paar Schwäne durften sich auf dem Teich philosophischen Studien ergeben, ein Kurhaus und ein Kurtheater wurden erbaut, eine Krieger-Eiche wurde gepflanzt. Goethe, Schiller und der Lokalpoet Aloys Katzenberger bekamen ihr Pflichtdenkmal, auf die benachbarte Augustenhöhe wurde eine Drahtseilbahn geheftet, an deren Endstation man zu allen Tageszeiten kuhwarme Milch, Ansichtspostkarten und andere Fremdennahrung haben konnte -- kurz: Breckendorf machte sich.
Geschäftsleute siedelten sich an, eine Andenkenindustrie erblühte, Modegeschäfte taten sich auf, ein schlauer Konditor erfand die allein-echten Breckendorfer Zuckerplätzchen, ein Gelehrter schrieb die Geschichte der Stadt, angefangen bei Kunibert dem Einäugigen, der dort die erste Sau gehütet hatte, bis auf die Jetztzeit, die Verlobung einer jungen Milliardärin machte Breckendorf auch in Offizierskreisen berühmt, Frau Albertine Friederichsen, geborene Müller, errichtete ein Pensionat für die höheren Töchter besserer Kreise, in dem man den guten Ton und das schlechte Klavierspiel in allen Lebenslagen lernen konnte, eine Oberrealschule wurde hingelegt, und als gar eine Miss, die ihren letzten Atemzug im Breckendorfer Stickstoff ausgehaucht hatte, testamentarisch den Bau eines englischen Kirchleins gestiftet hatte, war das Schicksal des ehemals so idyllischen Ortes besiegelt. Breckendorf wurde Sitz der Provinzialbehörden und damit endgültig Großstadt.
Nur auf dem östlichen Hügel blühte noch ein schwacher Abglanz früherer Behaglichkeit, dort, wo die kleinen Villen standen, und wo noch immer vor dem Hunde gewarnt wurde.
Auf der Kurpromenade vor dem Musikpavillon schwirrten alle Sprachen des Erdballs durcheinander, Toiletten und Brillanten wurden spazieren geführt. In der Hochsaison stiegen die Hotelpreise ins ungemessene, und die Soubrette1 des Kurtheaters sparte in einer einzigen Spielzeit vierzigtausend Mark, obwohl ihr neues Gebiss allein achthundert Mark gekostet hatte.
Die Breckendorfer waren stolz auf die feudalen Namen, die in der Kurliste prangten. Ehrfurchtsvoll bestaunten sie die reichen Amerikaner und Engländer, weit ehrfurchtsvoller, als ihre wackeren Großväter einen Preisochsen bewundert hatten, und mit scheuer Andacht flüsterten sie sich die angenommenen Namen der Fürstlichkeiten zu, die inkognito den Breckendorfer Stickstoff einatmeten. Eine dieser Fürstlichkeiten war sogar echt.
Der höchste Stolz des großstädtischen Kurorts aber war der Maharadscha von Bungesi, der nun schon die zweite Saison hintereinander in Breckendorf zu stickstoffeln geruhte. Seine braune Hautfarbe und die Hautfarbe seines zahlreichen Gefolges machten ein Inkognito unmöglich. Aber darauf legte die indische Hoheit auch offenbar gar keinen Wert; er mietete ein ganzes Stockwerk im Palast-Hotel, zahlte fürstlich, ließ sich nur von seinen Untertanen bedienen und kümmerte sich wenig um das Aufsehen, das sein Erscheinen auf der Promenade und im Kursaal machte.
Von europäischen Einrichtungen schien er nur den Kognak zu schätzen, den er, wenn er guter Laune war, aus Wassergläsern trank. Ob dies eine indische Sitte ist, wage ich nicht zu entscheiden. An den vierzigtausend Mark Ersparnissen der Soubrette war er durchaus unbeteiligt, wie er überhaupt dem als schöner verschrienen Geschlecht gegenüber eine hoheitsvolle Interesselosigkeit an den Tag legte.
Man munkelte von einem unglücklichen Liebesroman, den Seine Hoheit an den heiligen Gestaden des Ganges erlitten habe und der den Maharadscha nicht nur in den Augen der höheren Töchter des Friederichsenschen Pensionats noch interessanter machte, als es ein lebendiger Ausländer ohnedies ist.
Wie der Lokalschriftleiter2 des »Breckendorfer Tageblattes«, der Seine Hoheit zwei Tage nach dem erstem Eintreffen interviewt hatte, schrieb, »umflorte den edlen Blick der melancholische Zug jenes Seelenschmerzes, der uns Menschenkennern von der Feder von den tausend Wundern und Leiden der tiefen Liebe so ergreifend zu künden weiß. Ja, lieber Leser, dieser edle Fürst, ein Vater seines Volkes, ach, er ist trotz seiner Jugend, trotz seiner Schönheit, trotz seines Reichtums nicht glücklich! Oh, dass mir die blumige Sprache der Dschungeln, dass mir der glühende Hauch der Lotosblume zur Verfügung stände, den erschütternden Eindruck zu schildern, den dieser gütige Herrscher in meinem Innern auslöste!«
Leider stand dem Lokalschriftleiter keine Lotosblume, sondern gottlob nur anderthalb Zeitungsspalten zur Verfügung. Übrigens gelang ihm das große Wunder, ein Lächeln aus die Lippen des sonst so ernsten, verschlossenen Ausländers zu zaubern, der nach Beendigung der Audienz sich mit den Worten an seinen Haushofmeister wandte: »Sprechen die deutschen Lokalredakteure alle ein so miserables Englisch?«
Ganz besonders hatte den Maharadscha der Bürgermeister in sein Herz geschlossen. Nicht nur, weil ihn die Hoheit zu einem Besuch in Indien eingeladen, ihm eine Tigerjagd in Aussicht gestellt und ihm versprochen hatte, er dürfe den Tiger auf drei Meter Entfernung persönlich erschießen -- eine Ehre, bei deren bloßer Erwähnung den Bürgermeister eine Gänsehaut von Stopfgansgüte überrieselte. Nein, die unbegrenzte Verehrung des Stadtoberhauptes für den braunen Fürsten hatte noch eine andere, gewichtigere Ursache.
Kurz vor seiner letzten Abreise hatte nämlich der Maharadscha den Bürgermeister zu sich bitten lassen, um ihm eine höchst peinliche Eröffnung zu machen: Ihm war ein wertvoller Perlenschmuck gestohlen worden.
Der Bürgermeister war außer sich. Wenn dieser Diebstahl bekannt wurde, welche Schande für Breckendorf! Wie würde der Ruf des Kurorts leiden! Mit welchem Hohn, welcher Schadenfreude würden alle Konkurrenzbäder den Fall aufgreifen und breittreten! Hatte nicht erst neulich der schäbige Kurarzt des benachbarten Badeorts3 Kümmelstadt in einem Zeitungsartikel behauptet, der Stickstoffgehalt der Breckendorfer Luft habe sich um 0,07 Prozent vermindert?
Sogar diplomatische Verwicklungen mit Indien konnten entstehen.
Das Hemd des Bürgermeisters glich an Feuchtigkeit einem Prießnitzschen Wickel.4 Das war ja beinahe noch schlimmer als eine Tigerjagd. Mit gemessenem Erstaunen sah der Maharadscha die Verzweiflung des Gewaltigen. »Weshalb regt sich mein weißer Freund so auf?«, sprach er in seiner kühlen Art, die niemals eine innere Erregung erraten ließ. »Wir in Indien haben eine sehr einfache Art, Diebe zu entlarven.«
»Hoheit werden mich durch jeden Wink glücklich machen ...«, stotterte der Bürgermeister und dienerte, als ob er mit der Nase ein Loch in den Teppich stoßen wollte. »Hoheit können überzeugt sein, dass wir alle die Weisheit Indiens zu schätzen wissen. Alles wird geschehen, was Hoheit befehlen!«
Der Maharadscha maß ihn einen Augenblick mit seinen braunen Augen. Feierlich hob er den rechten Arm und sprach: »Man lasse das gesamte Hotelpersonal so lange mit eisernen Ketten peitschen, bis sich der Dieb meldet! So mache ich es in meiner sonnigen Heimat.«
Der Zylinder entrollte den zitternden Händen des Bürgermeisters. Er wünschte dem Maharadscha in dieser Minute sämtliche Brillenschlangen des Ostens an den Hals.
Aber der Fall löste sich erfreulicher, als er hoffen konnte. Sei es, dass der Maharadscha Mitleid mit ihm hatte, sei es, dass bei seinen Reichtümern eine Perlenkette keine Rolle spielte -- der Fürst verzichtete auf die weitere Verfolgung des Falles, und die Angelegenheit drang nicht in die Ohren der Öffentlichkeit, deren Ohren an Größe bekanntlich nur noch von ihrem Mundwerk übertroffen werden.
Seit diesem Tage galt der Maharadscha dem Bürgermeister als Inbegriff aller Fürstentugenden. Er bedauerte jeden Morgen von neuem, nicht in Indien auf die Welt gekommen zu sein, und er befahl dem Kapellmeister des Kurorchesters, jedes Mal beim Annähern des hohen Gastes die indische Nationalhymne anzustimmen.
Der Kapellmeister, der dieses Tonstück in keinem deutschen Musikverlag auftreiben konnte, komponierte alsbald eine indische Nationalhymne, und seitdem hat Breckendorf seinen eigenen Maharadscha-Marsch, in dem sehr viel große Trommel und Triangel vorkommt und dem niemand mehr anmerkt, dass er ursprünglich aus dem »Rienzi«5 stammte.
Und nun war zum dritten Mal der Besuch des Maharadscha in Breckendorf angekündigt.
Das erste Stockwerk des Palast-Hotels war für ihn belegt, ein Teil seines Gefolges war bereits vor zwei Tagen eingetroffen, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen und für den entsprechenden Vorrat an Kognak zu sorgen. Der Begrüßungsartikel im »Tageblatt« war fertiggesetzt und harrte des Augenblicks, da er in die Druckpresse wandern durfte, der Lokalschriftleiter träumte schon von dem gelben Papageiorden am grünen Strumpfband oder einer anderen indischen Auszeichnung für treu geleistete Zeilenschinderei, der weibliche Teil der Kurgäste hatte bereits Unsummen fürs Ondulieren6 ausgegeben, und der Kapellmeister des Kurorchesters hatte schnell noch eine zweite Posaunenstimme in seine indische Nationalhymne hineingeschrieben -- alles war zum Empfang bereit.
Auf dem abgesperrten Bahnsteig stand der Bürgermeister mit den Abgeordneten der Rechtsparteien,7 alle in so tadellosen Fräcken, wie man sie sonst nur auf dem Stiftungsfest einer Kellnervereinigung zu sehen bekommt; er las schnell noch einmal seine Begrüßungsrede durch, deren Manuskript er im Zylinderboden verborgen hatte.
Im Wartesaal hatte die Kurkapelle Platz genommen, und der Dirigent flüsterte zum zehnten Male: »Also zuerst ein Tusch, und dann die Hymne! Meyer, den Triller8 auf dem Des recht zart! Recht indisch! Denken Sie dabei an einen Harem!«
Ob Seiner Hoheit dieser förmliche Empfang sonderlich behagen würde? Ach, wer in der Seele eines indischen Fürsten zu lesen vermöchte!
Dass er keinen Extrazug benutzte, sondern sich nur einen Wagen erster Klasse zu reservieren pflegte, wies eigentlich auf jene vornehme Schlichtheit hin, die man bei Fürstlichkeiten häufiger antrifft als bei Kommerzienräten.9
»... Und so begrüße ich denn Eure Hoheit im Namen der ganzen Stadt Breckendorf mit tiefgefühlter Verehrung und mit dankbarem Herzen«, memorierte der Bürgermeister an seiner Rede, als plötzlich ein Lokomotivpfiff tönte und der Zug sichtbar wurde.
Und ehe noch das Ehrenkomitee auf dem Bahnsteig sich militärisch ausrichten und die Dame mit dem Blumenstrauß ein eisernes Lächeln auf ihre Lippenschminke zaubern konnte, dampfte der Zug in die Halle.
Ein untersetzter, gutgenährter Herr, aus dessen bärtigem Gesicht die dicke Stumpfnase hervorleuchtete wie eine Glühlampe aus einer Tannengirlande, sprang aus dem noch fahrenden Zug, fröhlich eine altmodische, gestrickte Reisetasche schwingend, und sah sich verblüfft um.
»Hallo, Boys!«, brüllte er mit Bärenstimme. »Was ist denn hier los? Große Zylinderversammlung? Ehrt mich! Scheint ja ein verflucht fideles Nest geworden zu sein, die olle Stickstoffplantage!«
Entsetzt eilte der Bürgermeister auf den geräuschvollen Fremden zu, der den ganzen Empfang zu stören drohte, und flüsterte auf ihn ein: »Treten Sie zur Seite, mein Herr, ... wir erwarten Seine Hoheit, den ...«
»Quatsch, Hoheit!«, stieß ihn der Dicke gutmütig beiseite. »Bin in meinen Augen ebenso hoch, wie die höchste Hoheit! Komme aus dem freien Lande Amerika und habe kein Verstehstemich für eure Bauchtänze! Na, werdet mich schon noch näher kennenlernen, Kinder. Bin nämlich hier erblicher Häuserbesitzer! Eduard Bohnkraut -- kannst dir den Namen merken, altes Frackhemd!«
»Um Gottes willen, der Maharadscha kann jeden Augenblick aussteigen ... Ich bin der Bürgermeister ... Ich bin verantwortlich ...«
Eduard Bohnkraut begann eine Art Wonne-Twostep zu tanzen.
»Maharadscha!«, wieherte er. »Dachte, die gibt’s bloß im Kino! Was man nicht alles auf seine alten Tage zu begucken kriegt! -- Na, dann singt mal schön ›God save the Maharadscha‹, oder was Ihr euch sonst einstudiert habt! Will nicht stören. Schönen Gruß an den Indianerhäuptling! Von Eduard Bohnkraut! -- Good bye!« Und übermütig seine vorsintflutliche Reisetasche jonglierend, drängte sich der unangenehme Mensch durch das Komitee, stieß die Ehrenjungfrau beiseite und verschwand lärmend im Ausgang.
Im selben Augenblick entstieg der hohe Gast dem Salonwagen, schritt feierlich durch das spalierbildende Gefolge und blieb vor dem Bürgermeister stehen, der sich nun endlich seine Begrüßungsrede von der Seele wälzen konnte. Die Kurkapelle stimmte im richtigen Augenblick den Tusch an, die Dame überreichte ihren Blumenstrauß mit einem Hofknicks, der einen Radius von etwa zwei Metern aufwies, die indische Hymne erbrauste, Meyer blies den Triller auf dem Des wie eine Nachtigall, und der Maharadscha gab durch ein leichtes Nicken des Kopfes zu erkennen, dass er an dem Empfang nichts Wesentliches auszusetzen hatte.
Es war doch recht günstig, dass der Kapellmeister noch eine zweite Posaunenstimme komponiert hatte, sonst hätte der Streit, den Eduard Bohnkraut inzwischen in der Gepäckausgabe begonnen hatte, das edle Musikstück übertönt.
»Wünsche den Koffer in meine Villa, Höhenstraße 74!«, brüllte Eduard Bohnkraut, denn eine andere Tonstärke schien er nicht zu kennen. »Scheinen ja in meiner Heimatstadt nette Zustände eingerissen zu sein! Bitte mir denselben Prozentsatz Respekt aus, wie eure Stickstoffels von Kurgästen! Verstanden?«
Damit warf er dem Beamten seinen Gepäckschein hin, schob sich vor das Portal des Bahnhofs, steckte zwei Finger in den Mund, pfiff gellend einer Droschke und befahl: »Höhenstraße 74, Villa Sonnenstrahl! Hopp, hopp, könnten schon dort sein!«
Weibliche Rolle in Oper und Operette <<<
Leiter der Lokalredaktion <<<
gemeint: Kurort mit Badebetrieb <<<
Eine Anwendung bei Erkrankungen: Ein Wickeltuch wird in kaltes Wasser getaucht und dann auf die zu behandelnde Körperstelle gelegt und mit trockenen Wolltüchern belegt. So verwandelt sich die Kälte in feuchte Wärme. <<<
ref_endnotebookmark_end_133_5_51 <<<
die Haare mit einer Brennschere wellen <<<
Das 1922 veröffentlichte Buch spielt in der Weimarer Republik, demnach sind mit »Rechtsparteien« wohl im weitesten Sinne die folgenden gemeint: Die katholisch geprägte und »Mitte rechts« angesiedelte Zentrumspartei, die rechtsliberale DVP (Deutsche Volkspartei) sowie die nationalistische DNVP (Deutschnationale Volkspartei). Hinzu kamen noch einige kleinere Splitterparteien. Die extrem nationalistische NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) spielte zu diesem Zeitpunkt noch keine Rolle und war Ende 1923 bis Anfang 1925 reichsweit verboten. <<<
Beim Triller werden in schnellem Wechsel der notierte Hauptton und der darüber liegende Nebenton gespielt. <<<
Ein Ehrentitel, der im Deutschen Reich bis 1919 an Persönlichkeiten aus der Wirtschaft verliehen wurde, und zwar nach erheblichen »Stiftungen für das Gemeinwohl«. Die nächste Stufe war der »Geheime Kommerzienrat«, der den Titelträger sowie seine Frau und seine Töchter hoffähig machte und ihnen somit Zugang zu fürstlichen Gesellschaftskreisen ermöglichte. <<<
II.
So einen verrückten Kerl hab’ ich in meinem ganzen Leben noch nicht gefahren!«, knurrte der Kutscher vor sich hin, während er mühsam sein Vehikel durch die wartende Menge steuerte. »Ein bisschen verrückt sind ja unsere Kurgäste all’, dafür sind’s Kurgäste. Aber da hab’ ich, scheint’s, den Oberhanswurst erwischt.«
Eduard Bohnkraut lehnte hoheitsvoll in der offenen Droschke und grüßte herablassend die Kurgäste, die sich vor dem Bahnhof und in der Haupthalle drängten, um dem Maharadscha und ihrer Neugier zu huldigen.