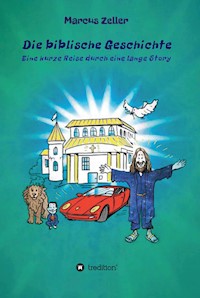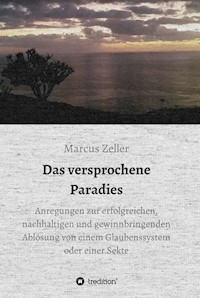
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Das versprochene Paradies" befasst sich mit der Problematik, der sich der/ die potentielle oder tatsächliche Sekten- AussteigerIn sozial, mental und psychisch in der Regel gegenübersieht. Dieser Ratgeber soll in einfacher und verständlicher Weise die komplexen Mechanismen hinter der Kultdynamik erkennbar sowie die eigenen, innerpsychischen Prozesse verstehbar machen, die während und nach der Sektenzugehörigkeit eine Rolle spielen. Das Ziel ist eine praxisnahe Hilfestellung mit hohem Umsetzungspotential, die sich sowohl an Betroffene als auch an deren Angehörige richtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
www.tredition.de
www.tredition.de
© 2015 Marcus Zeller
Umschlag, Illustration: Marcus Zeller, Deborah Zeller
Lektorat, Korrektorat: Deborah Zeller
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7345-0196-8
Hardcover
978-3-7345-0197-5
e-Book
978-3-7345-0198-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Marcus Zeller
Das versprochene Paradies
Anregungen zur erfolgreichen, nachhaltigen und gewinnbringenden Ablösung von einem Glaubenssystem oder einer Sekte
Inhaltsverzeichnis
1 Vorweggedanken
2 Die Gefühle ordnen - wenn die inneren Stürme sich legen
2.1 Angst
2.2 Zweifel
2.3 Wut/ Ärger
2.4 Traurigkeit
2.5 Scham, Schuld
2.6 Gefühle der Nutzlosigkeit
2.7 Orientierungslosigkeit
3 Wie funktioniert ein Glaubenssystem?
3.1 Begriffserklärung „Kult“
3.2 Der Kult als Konzept
3.3 Das Schuldkonzept
3.4 Merkmale eines Kultes
3.4.1 Der universelle Wahrheitsanspruch
3.4.2 Kritikunverträglichkeit
3.4.3 Die Logik im System
3.4.4 Die Abwehr von Kritik
3.4.5 Der In – out – Group Effekt
3.4.6 Die Plausibilität
3.4.7 Eine besondere Sprache
3.5 Was ist Bewusstseinskontrolle?
4 Wer bin ich?
4.1 Kognitive Dissonanz
4.2 Identitätsarbeit
4.3 Die Hineingeborenen
4.4 Die „Konvertierten“
4.5 Warum war ich….?
4.6 Am Anfang war der Mangel
5 Wohin gehen und wo bleiben?
5.1 Glaubenssätze
5.2 Aus der Abhängigkeit
5.3 Gewissensnöte
6 Das vier- Schritte Programm zur inneren Freiheit
6.1 Schritt eins: Anerkenne, dass du in einem Kult warst!
6.2 Schritt zwei: Hole dir deine Würde zurück!
6.3 Schritt drei: Baue dir deinen eigenen Werte- Kodex
6.4 Schritt vier: Feiere deine Freiheit!
7 Hinterfragen leicht gemacht
7.1 Liebe ist
7.2 „Aber das Böse in der Welt…“
7.3 Freiheit
7.4 Beweise?
8 Der Umgang mit den Zurück- gelassenen
8.1 Bekehrungsversuche
9 Nachgedanken
10 Literaturhinweise
11 Mein Hintergrund
1 Vorweggedanken
Irrtümer muss man teuer bezahlen, wenn man sie loswerden möchte.
Goethe
Diese Aussage macht deutlich, was der Abschied von einem vertrauten System, insbesondere einem Glaubenssystem, für den oder die Betroffene bedeuten kann: der Preis, den man für den „Irrtum“ bezahlt, ist in jedem Falle hoch. Er besteht aus Zeit, Identität, Freiheit im Handeln und Denken, seine gewohnte Zukunftshoffnung und möglicherweise auch dem Verlust seiner Gesundheit. Das versprochene Paradies kam nicht.
Dabei benutze ich bewusst den Begriff „Abschied“ anstelle von „Ausstieg“: wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass etwas nicht mehr da ist, was wir einst geliebt haben, was unser Leben, ja unser gesamtes Denken und Fühlen bestimmt hat. Es war uns lieb und teuer und hat sich nun in seiner Bedeutung für uns geändert.
Im Besonderen geht es in diesem Ratgeber um die Ablösung von Glaubenssystemen, die immer als Glaubensgemeinschaften (Kulte) organisiert sind. Ich benutze diese Begriffe wertungsfrei, denn der Fokus liegt nicht auf der speziellen Ausrichtung einer Glaubensgemeinschaft und deren Relevanz in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich bin der Ansicht, dass religiöse Gemeinschaften alle Merkmale gewöhnlicher sozialer Dynamik aufweisen - eben nur in extremerer Ausprägung. Deshalb lassen sich die Mechanismen dort auf alle sozialen Systeme übertragen – selbst auf die profane Zweierbeziehung.
Der Ausstieg oder Abschied aus einer Glaubensgemeinschaft ist in der Regel mit einer gewaltigen Lebenskrise verbunden. Aber wie alle Krisen beinhaltet auch der Ausstieg eine Chance: das chinesische Schriftzeichen für „Krise“ besteht daher beispielsweise aus zwei Symbolen. Das eine bedeutet „Gefahr“, das andere „Chance“. Die Gefahr auf dem „falschen“ Weg unterwegs zu sein, beinhaltet die Möglichkeit, die Chance, den passenden Weg zu finden.
Wie kann eine Ablösung „erfolgreich“ und „nachhaltig“ sein? Wenn wir auf die Zeit als Mitglied des Systems mit Wehmut, Zorn, Verbitterung, Selbstverachtung, Scham, Schuld oder ähnlichen Gefühlen zurückblicken, werden wir diese Zeit als verloren oder vergeudet ansehen. Wir werden mit dieser Vergangenheit nie vollständig abschließen können – sie wird immer in unsere Gegenwart hineinwirken und unser Denken und Fühlen beeinflussen.
Eine Ablösung bedeutet nicht nur ein „frei – werden – von“, sondern eine „Freiheit – zu – etwas“. Eine solche Freiheit integriert die gemachten Erfahrungen und erlebt sie letztendlich als Bereicherung.
Es geht mir in der vorliegenden Publikation nicht darum, die Mechanismen oder das System und seine Folgen für den Menschen rein intellektuell oder sachlich zu durchleuchten. Ich möchte eine Hilfestellung geben, den eigenen Ablöseprozess aus einer Meta-Perspektive zu beurteilen, sich nicht zu verrennen, nicht hängen zu bleiben und sich über die Vergangenheit zu definieren, sondern vorwärts zu denken, dabei aber nichts auszulassen, was für eine gesunde und vollständige Loslösung notwendig ist. Denn: „danach“ geht das Leben weiter, muss aber in Teilen neu „erfunden“ werden. Das kann ein sehr befriedigender Prozess sein, wenn er nicht den Stempel der alten Konditionierungen und Gewohnheiten trägt.
Ich versuche dabei, alle Anregungen so knapp wie möglich zu halten. Diese Arbeit soll ein „first- aid- kid“ darstellen, ein Erste Hilfe- Set für die Arbeit an sich selbst. Später kann eine intensivere Beschäftigung mit speziellen Themen nötig werden, doch zunächst geht es um eine Lagebestimmung: wo stehe ich, wo möchte ich hin? Es gibt keine zwei identischen Prozesse; bei jedem Menschen ist dieser Vorgang so einzigartig wie er selbst. Deshalb kann bestenfalls ein Impuls gesetzt werden, den der Leser oder die Leserin1 selbst mit Leben füllen muss. Das Buch soll diesem Zweck dienen.
1 Im Folgenden verwende ich der Einfachheit willen die männliche Form im Singular
2 Die Gefühle ordnen – wenn die inneren Stürme sich legen
Dunkle Wolken hängen
über dem Glück
Donner lässt Zorn
befürchten
Blitze zucken
erleuchten einen neuen Weg
Nebel steigt auf,
verwischt den Schmerz
Bald scheint die Sonne wiederwärmt uns
an einem hellen Tag
Die gefühlsmäßige Bandbreite, die sich bietet, wenn man ein Glaubenssystem verlässt, ist gewaltig. Es reicht von Euphorie bis hin zur Depression. Vor allem Enttäuschung über die nicht eingetretenen Versprechungen versteckt sich gerne hinter Wut auf die Organisation oder das Glaubenssystem. Insbesondere wenn der Abschied in vollem Gange ist, wenn er offiziell vollzogen wird, wenn Freunde und Familie damit konfrontiert werden, scheint es unerträglich.
Ängste plagen einen. Das Innere ist in einem Loyalitätskonflikt zerrissen. Zweifel nagen an einem. Trauer über die verschiedensten Reaktionen der lieben Menschen liegt schwer auf der Seele. Möglicherweise sind da Selbstvorwürfe. Bei manchen findet sich eine riesige Wut: Über sich selbst oder aber über das Glaubenssystem, das man verlassen hat.
Zunächst einmal müssen wir uns darüber im Klaren sein, was diese Gefühle sind: Sie sind Ausdruck einer unbezweifelbaren inneren Wahrheit, sie sind das Fundament unseres Befindens, unseres Glücks.
Emotionen oder Gefühle entstehen in Bereichen des Gehirns, die den rationellen und kognitiven Funktionen vorgeschaltet sind. Im Gegensatz dazu können die rationellen Bereiche, in denen das Denken stattfindet und wir die Vernunft verorten könnten, kaum Einfluss auf die emotionalen Funktionen und Reaktionen nehmen. Was bedeutet das? In erster Linie bedeutet das, dass wir nur schwer entscheiden können, wie wir uns fühlen.
Der Sinn der Gefühle mag u. a. darin liegen, uns zu zeigen, was gut für uns ist, und was stress- behaftet. Sie ermöglichen Individualität. Gefühle lassen sich nicht vorschreiben und gleichschalten. Sie machen, dass wir das Leben auf unsere ureigenste Art und Weise erleben.
Damit sind sie in großem Maße auch für unsere Reaktionen auf die uns umgebende Welt verantwortlich. Gefühle gehen dem Denken voraus; durch sie wird unsere innere Wirklichkeit gebildet. Nicht etwa der Verstand ist es, der bestimmt, was ich wie erlebe - immer sind es die Gefühle. Am anschaulichsten zeigt sich das bei kleinen Kindern. Ihr Verhalten repräsentiert immer ihren inneren, gefühlsmäßigen Zustand. Das ändert sich später, wenn die „Vernunft“, also der bewusste Wille, in der Lage ist, sozialisierte (antrainierte) Regeln durchzusetzen. Allerdings sind unsere Gefühle stark an Muster gebunden. Wir haben uns daran gewöhnt, uns so zu fühlen, wie wir es in bestimmten Situationen tun. Das bedeutet, dass wir unsere „Emotionalen Reaktionsmuster“, also unsere Gefühlsgewohnheiten, hinterfragen sollten. Besonders in fundamentalistischen Glaubensgemeinschaften werden solche Reaktionsmuster gebildet. Dort lernt man, über was Anlass zur Freude ist, welche Dinge einen „mit Abscheu erfüllen sollen“ und – was das Tiefgreifendste ist – wann das Gewissen anzuschlagen hat.
Daher gilt es zunächst, ein wenig Ordnung im Gefühlschaos zu schaffen: Welche Gefühle haben ihre Wurzel in mir selbst? Und welche sind „antrainiert“?
Grundsätzlich ist es von größter Wichtigkeit, allen Gefühlen Raum zu geben, sie ganz zu fühlen, sie wahrzunehmen und zu würdigen. Das bedeutet auch, sie nicht auszuagieren, nicht in den Aktionismus zu gehen, nicht in die Flucht der Ablenkung, nicht in die Sucht oder die Betäubung. Es bedeutet, diese Gefühle stillzuhalten. Ich halte sie in mir still, schaue sie an, lasse sie zu. Sie wollen gesehen werden! Dann werden sie selbst ruhiger. Sie verwandeln sich in Gehilfen, in zuverlässige Wegweiser. Sie verlieren ihre Bedrohlichkeit und schrumpfen auf eine gesunde Größe, die sich handhaben lässt. Handhaben? Wozu? Um ihr Wachstumspotential zu nutzen und sie als Wegweiser zu gebrauchen. Sie waren es, die einen Bruch erzeugt haben, nämlich als du dich in der Gemeinschaft oder Organisation nicht mehr wohlgefühlt hast. Dieser Bruch war der Beginn eines Weges in die Freiheit und seine Initialzündung lieferten deine Gefühle.
In der Glaubensgemeinschaft hast du gelernt, deinen Gefühlen zu misstrauen. Gefühle können gefährlich sein, sie können einen irreführen, so hast du es vermutlich gelernt. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Ist eine Angst etwa weniger real, nur weil sie keine objektive Grundlage im Außen hat? Keinesfalls! Oder hilft es einem Kind, wenn es hört, „es brauche keine Angst zu haben“? Es hat sie aber trotzdem!
Gefühle bilden unsere innere Wirklichkeit, denn sie wirken. Unser ganzes Leben ist auf Gefühle ausgerichtet: Wir streben nach Glück! Glück ist kein Zustand, der verstandesmäßig zu erschließen ist oder den man erreicht, wenn man genug und diszipliniert gearbeitet hat. Und was hat den Menschen am meisten bewegt, was hat seinem Leben Sinn gegeben? Das Gefühl, das sich einstellt, wenn man sein Kind oder seinen Partner im Arm hält: Liebe. Vollendete Liebe ist die Gewissheit, dass es gut ist.
Der Verstand hingegen ist für sich alleine völlig ungeeignet, Zufriedenheit und Glück zu erschaffen. Politische Konstrukte wie der Kommunismus und der Nationalsozialismus waren Ideen, die die rein verstandesmäßige Durchsetzung einer Vorstellung eines Weges zum Glück verkörperten. Geschlossene Glaubenssysteme tun das ebenfalls. Als Mitglied lernt man, seinen inneren Wegweisern, seinen Gefühlen, zu misstrauen. Der Verstand wird überbetont und eine scheinbare Vernunft wird allem vorgeschaltet. Das hat fatale Folgen; der Einzelne folgt dann nicht mehr einer inneren Wahrheit, die allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung steht (nämlich der Liebe), sondern der Vorstellung von Vernunft (oder Wahrheit) derjenigen Gruppe, der er angehört. Das Ergebnis dessen sehen wir vor uns: Eine zersplitterte Menschheit mit einer unvereinbaren Vielfalt von Vorstellungen von „Vernunft“.
In den Gefühlen liegt der Schlüssel zur Heilung. Weil die Menschen ihre unangenehmen Gefühle nicht fühlen wollen, gehen sie in die Abwehr. Diese Abwehr sieht oft gar nicht wie eine Abwehr aus; sie kann durchaus „vernünftig“ wirken. Leider ist sie oft aber der Versuch, durch Aktionismus weg von der Konfrontation und dem Durchleben unangenehmer Gefühle zu kommen. Dabei ist die Angst der wirkungsvollste Schutz. Es liegt allerdings ein erstaunlicher Frieden hinter diesem unentdeckten Land. Dort finden sich keine Rache mehr, kein Hass und kein Zorn. Dazu ist es aber notwendig, die unangenehmen Emotionen wie beispielsweise die Angst zunächst zuzulassen, sie auszuhalten. Dann zeigt sich oft, dass sie sich nur auf ein Szenario in meiner Vorstellung bezieht. Dieses Szenario aber ist auf eine spekulative Zukunft bezogen und hat keine wirkliche Grundlage in der tatsächlichen Gegenwart.
Gefühle bilden das Spektrum menschlichen Seins. Indem wir beginnen, alles in „Gut und Schlecht“ einzuteilen, verleugnen wir einen Teil dieses Spektrums. Diesen verleugneten Teil müssen wir mit „Tun“ füllen. Dann übernimmt der Verstand das Kommando und versucht alles zu unterwerfen und zu kontrollieren, was nicht seiner Vorstellung von „Gut“ entspricht. Der Wahnsinn beginnt.
Wenn du von einer Glaubens- oder Religionsgemeinschaft Abschied nimmst, durchlebst du in aller Wahrscheinlichkeit ein wahres Wechselbad der Gefühle und tiefer Emotionen.
Im Folgenden wollen wir einige dieser Emotionen im Einzelnen anschauen und sehen, wie sie einzuordnen sind, wo ihre möglichen Konditionierungen liegen und ihr Potential zum persönlichen Wachstum.
2.1 Angst
Angst dient dem Schutz. Angst soll uns vor Gefahr bewahren. Das vorzustellen, fällt uns nicht schwer, wenn es um eine spezifische Angst geht, beispielsweise Höhenangst. Etwas komplizierter ist es mit der unspezifischen Angst. Ein diffuses Gefühl der Furcht, z.B. etwas falsch gemacht zu haben, nicht zu wissen, wie es weitergeht oder die Angst vor sozialer Isolation, also vor Einsamkeit.
Die Angst, etwas falsch gemacht zu haben, kann als Hinweis gewertet werden, dass man innerlich noch mit dem Maßstab und den Normen des Systems identifiziert ist. Das Gewissen wurde jahrelang oder jahrzehntelang offen oder subtil von einem engen und festgesetzten Wertemaßstab geprägt. Jetzt greift es, es regt sich. Den Auftrag hat es von uns bekommen. Das kann man nüchtern zur Kenntnis nehmen; es ist die verdeckte Aufforderung, seinen eigenen Wertemaßstab aufzubauen. Darauf wird in einem späteren Kapitel genauer eingegangen.
Auch die Angst vor Einsamkeit kann stark sein.
Dieser Weg – wird kein leichter sein – dieser Weg- wird steinig und schwer. Nicht mit vielen – wirst du dir einig sein – doch dieses Leben bietet so viel mehr!
Diese Textpassage des Sängers Xavier Naidoo beschreibt vielleicht die Situation treffend. Alte Freundschaften haben ihren Boden verloren. Aber das ist eigentlich nur ein Indiz dafür, dass sie nicht auf der Basis der Beziehung zwischen Mensch und Mensch standen, sondern auf dem Boden des gemeinsamen Konsenses. „Einheit“ war vielleicht das Zauberwort, aus dem heraus die Illusion von Gemeinsamkeit oder gar Freundschaft definiert wurde. Aber diese Freundschaft war bedingt: Nur, wenn du dich innerhalb der Grenzen ihrer Bedingungen bewegt hast, wurdest du akzeptiert.
Nun gilt es, neue Freundschaften aufzubauen; Beziehungen, die ihre Grundlage nur in dir als Mensch haben. Es kann eine Weile dauern, bis sich diese aufbauen – aber es wird nicht ewig sein.
Eine weitere Form der Angst kommt aus der Orientierungslosigkeit: Wie geht es weiter in meinem Leben? Das ist eine Frage von ungemeiner Reichweite, denn sie betrifft möglicherweise die Familie, die Arbeit, Hobbys und Vorlieben, innere Überzeugungen, die religiöse Ausrichtung, die eigene Wertewelt usw. Bisher lagen die Dinge unverrückbar da, wo sie waren – Zweifel ausgeschlossen.
In der Psychologie gibt es dafür den Ausdruck des „floating“, des „Flutens“: Man verliert quasi den Boden unter den Füßen, auf dem man stand. Im Extremfall kollabiert die ganze gewohnte Welt. Nichts ist mehr wie es war und man spürt: Ein Zurück ist ausgeschlossen und auch nicht gewünscht. Die Bewegung hat eine Eigendynamik entwickelt, die mich mitreißt. Und es fehlt das Vertrauen. Worauf auch?
Die Antwort könnte lauten: Auf das Vertrauen in dich selbst. Du bist ein erwachsener Mensch, der gerade eine ungeheure Leistung vollbringt: Du befreist dich von dem, was dir nicht nützt, du bringst die Stärke auf, dir diese Freiheit zu erkämpfen, gegen deine Gewohnheiten und vermutlich auch gegen einen Großteil deiner Umwelt. Dazu stehen dir verlässliche Werkzeuge zur Verfügung: Dein Verstand auf der einen Seite und dein Gefühl auf der anderen. Dein Verstand hat es dir ermöglicht, Gewohnheiten und Strukturen zu durchschauen, die dir nicht mehr nützen. Dein Gefühl leuchtet dir den Weg zu deiner inneren Stimmigkeit, es strebt nach einer Harmonie, die im Außen fehlt.
Auch wenn es plakativ klingt: Es geht weiter! Vor dir steht ein freieres und selbstbestimmter-es Leben, in welchem du in viel größerem Maße du selbst sein darfst und wirst.
Die Angst vor der Zukunft ist ein Schutz: Sie bewahrt dich davor, unbedacht und unbewusst in die nächste Abhängigkeit zu geraten, sie mahnt dich, achtsam zu sein. Sie fordert dich auf, dich um dich selbst zu kümmern, dir über dich selbst klar zu werden. Du bist bereits losgelaufen. Auch wenn du den Weg nicht siehst, ist er bereits da. Vertraue in deinen nächsten Schritt. Der Boden wird dich tragen.
Auch die Angst vor einem eventuellen göttlichen Strafgericht wiegt schwer. Die Überzeugungen, die jahrelang dein Leben bestimmt und dein Denken geprägt haben, sind noch nicht überholt. Sie wirken noch in dir. Ich werde in dem Kapitel „Hinterfragen leicht gemacht“ ausführlicher darauf eingehen.
2.2 Zweifel
Wenn du aus einem festen Glaubenssystem kommst, hast du einen Vertrauensbruch erlebt: Die Welt ist nicht so, wie man sie dir erklärt hat. Du hast erkannt, dass es eine Mogelpackung war, oder aber dass die Menschen dahinter nicht leben, was sie predigen. Du hast vielleicht auch deine Abhängigkeit erkannt, in welche du recht perfide eingebunden warst.
Du hast dir nicht erlaubt, zu zweifeln. Der Zweifel ist ein zerstörerisches Werkzeug derer, die nur Schlechtes im Sinn haben, so hieß es. Nach außen hin durftest du ihn benutzen, nicht aber im System selbst.