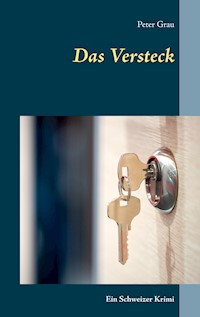
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Keller eines Wohnhauses werden zwanzig Waffen gefunden, die zum Teil als gestohlen gemeldet sind. Die Mieterin des Kellerabteils ist eine alte, alleinstehende Frau, die nach einem Unfall nicht mehr ansprechbar ist. Was hat die betagte Frau mit dem Waffendiebstählen zu tun? Wofür sollten die Waffen eingesetzt werden? Bei seinen Nachforschungen findet Kommissar Markus Goldbacher überraschende Verbindungen zu einem ungeklärten Fall seines Vorgängers und stösst auf Verbrechen, die niemand in dem kleinen Schweizer Bergkanton für möglich gehalten hätte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch
Im Keller eines Wohnhauses werden zwanzig Waffen gefunden, die zum Teil als gestohlen gemeldet sind. Die Mieterin des Kellerabteils ist eine alte, alleinstehende Frau, die nach einem Unfall nicht mehr ansprechbar ist. Was hat die betagte Frau mit dem Waffendiebstählen zu tun? Wofür sollten die Waffen eingesetzt werden?
Bei seinen Nachforschungen findet Kommissar Markus Goldbacher überraschende Verbindungen zu einem ungeklärten Fall seines Vorgängers und stösst auf Verbrechen, die niemand in dem kleinen Schweizer Bergkanton für möglich gehalten hätte.
Autor
Peter Grau, Jahrgang 1965, kam erst als 50-Jähriger völlig zufällig auf die Idee, ein Buch zu schreiben. Als er im Urlaub vor dem Bahnhof Milano Centrale auf seine Frau wartete, konstruierte er in Gedanken eine Krimi-Idee, aus der sein erster Roman „Spurlos verschwunden“ entstand. Sein neuer Roman „Das Versteck“ ist der zweite Fall von Markus Goldbacher, dem Leiter der Kriminalpolizei in einem fiktiven Schweizer Bergkanton.
In seinem Hauptberuf ist Peter Grau Statistiker. Er lebt und arbeitet in der Region Zürich.
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig und nicht beabsichtigt.
Für meine Eltern
Danke!
Mein herzliches Dankeschön geht an Franziska Tschudin, Hansruedi Oetiker und Janine Dünner, die bei der Entstehung dieses Buches wertvolle Hilfe geleistet haben.
Die wichtigsten Personen
Markus Goldbacher Luca Bertoldi Claudia Weber
Leiter der Kriminalpolizei Assistent von Markus Goldbacher Kriminaltechnikerin, Mitglied Kripo-Team
Thomas Baumann Lea Zurkirchen Dominic Bader Sarah Landolt Hans Spörri Martin Läubli Roger Fuchs
Kommandant der Kantonspolizei Empfang / Zentrale der Kantonspolizei Streifenpolizist Streifenpolizistin Pensionierter Leiter der Kriminalpolizei Regionalpolizist in Tellingen Mitarbeiter der Bundeskriminalpolizei
Alexandra Egger Norbert Sommer Ursula Matzinger
Staatsanwältin Gerichtsmediziner Justizdirektorin
Jolanda Hebeisen Stefan Wicki Adrian Rickenbacher Ernst Stadelmann
Rentnerin Ehem. Mitarbeiter des Seilbahnmuseums Alt-Regierungsrat, ehem. Justizdirektor Pensionierter Unternehmer
Der Kantonshauptort und seine Umgebung
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
1
Donnerstag, 23. Juni
Als ich um 8:30 Uhr um die Ecke kam und auf das Gebäude blickte, seufzte ich kurz. Ich arbeitete noch keine zwei Monate hier und schon drohte es, langweilig zu werden. Mein erster Fall als Leiter der Kriminalpolizei, die Suche nach der verschwundenen Joggerin Ivana Gobec, war abgeschlossen und ein zweiter Fall war nicht in Sicht.
Der Mangel an sinnvoller Arbeit war auch der Grund, warum ich recht spät auf dem Arbeitsweg war. So erfreulich es an sich ist, wenn wenig Verbrechen verübt werden: Es bedeutete, dass auf mich und mein Team wenig motivierende Aufgaben zukommen würden. Beispielsweise die Unterstützung der Verkehrspolizei bei Geschwindigkeitskontrollen.
Wenig enthusiastisch brachte ich die letzten hundert Meter hinter mich, passierte das Schild mit der Aufschrift Kantonspolizei und öffnete die alte Holztür.
»Guten Morgen Lea«, begrüsste ich die junge Frau am Empfangsschalter.
»Guten Morgen Markus«, antwortete Lea Zurkirchen, strich sich durch ihre langen blonden Haare, rückte ihre Brille zurecht und fuhr dann fort: »Ihr habt Besuch bei der Kripo: Zwei Mitarbeiter der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sind heute früh hierhergekommen, um einen Waffenfund zu melden. Luca hat sie empfangen.«
Luca Bertoldi war mein Assistent, mit 28 Jahren sechs Jahre jünger als ich und ebenfalls ganz neu bei der Kripo. Als die Pensionierung meines Vorgängers Hans Spörri näher gerückt war, wollte auch dessen jahrzehntelanger Assistent Martin Läubli die Kripo verlassen. Er wurde zur Regionalpolizei an seinen Wohnort Tellingen versetzt und Luca Bertoldi konnte von der Regionalpolizei zur Kripo wechseln, womit beide sehr zufrieden waren. Auch ich war froh darüber, denn ich schätzte die Zusammenarbeit mit Luca sehr.
Als ich das Büro der Kriminalpolizei betrat, fand ich dort nicht Luca, sondern Claudia Weber. Die Kriminaltechnikerin war das dritte Mitglied des Teams. Die 31-Jährige wirkte mit ihren leuchtend rot gefärbten Haaren, dem frech wirkenden Kurzhaarschnitt und den Tätowierungen auf beiden Oberarmen deutlich jünger. Sie arbeitete schon seit ein paar Jahren bei der Kantonspolizei und hatte auch schon unter meinem Vorgänger zum Kripo-Team gehört.
Da die Kriminalpolizei in unserem kleinen Kanton eine Kriminaltechnikerin nicht voll auslasten kann, unterstützte Claudia Weber auch die übrigen Abteilungen der Kantonspolizei in technischen Belangen. Sie hatte in unserem Teambüro ihren Büro-Arbeitsplatz, arbeitete aber vorwiegend in ihrem Labor im Keller.
»Sie sind da drin«, erklärte mir Claudia und deutete auf eines der Besprechungszimmer. Sie kannte Lea Zurkirchen gut genug, um zu wissen, dass diese mich bereits über den Besuch informiert hatte.
Nur wenige Sekunden später wurde die Tür des Besprechungszimmers geöffnet und Luca Bertoldi trat mit den beiden Besuchern hinaus.
»Guten Morgen Markus«, sagte er zu mir und wandte sich dann wieder an seine Gesprächspartner: »Jetzt ist Herr Goldbacher eingetroffen. Er ist der Leiter der Kriminalpolizei. Ich werde ihn über Ihren Fund informieren und das weitere Vorgehen mit ihm besprechen. Wir melden uns so bald wie möglich bei Ihnen.«
Ich begrüsste die Mitarbeiter der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB genannt. Danach begleitete Luca die beiden zum Ausgang.
»Wo haben die denn eine Waffe gefunden?«, fragte ich erstaunt, als Luca anschliessend begann, Claudia und mich über das Gespräch zu informieren.
»Nicht eine Waffe«, korrigierte Luca meine Überlegungen. »Du wirst staunen.« Dann erzählte er uns, was er soeben erfahren hatte: »Jolanda Hebeisen, eine 94-jährige alleinstehende Frau, ist letzte Woche im Treppenhaus zusammengebrochen. Eine Nachbarin hat sie dort gefunden und sie wurde ins Spital eingeliefert. Da sie seit dem Sturz nicht mehr ansprechbar ist, hat das Spital die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde eingeschaltet. Zwei Mitarbeiter der KESB haben gestern Nachmittag eine Bestandesaufnahme in der Wohnung gemacht und im Kellerabteil zwei grosse Stoffsäcke mit insgesamt zwanzig Waffen gefunden. Bis in den Abend hinein haben sie in der Wohnung und im Keller nach Belegen dafür gesucht, dass die Waffen Jolanda Hebeisen gehören. Weil sie keinerlei Hinweise auf die Herkunft der Waffen finden konnten, entschieden sie, sich an uns zu wenden.«
Luca, Claudia und ich fuhren sofort zur Wohnung von Jolanda Hebeisen. Mit den Schlüsseln, welche die KESB-Mitarbeiter Luca gegeben hatten, verschafften wir uns Zutritt zur Wohnung und zum Keller. Das Kellerabteil von Frau Hebeisen war dicht gefüllt mit allem möglichen Ramsch und roch entsprechend modrig.
Der Keller erinnerte mich an meine Grossmutter. Als wir nach ihrem Tod ihre Wohnung räumen mussten, fanden wir den Keller in einem ähnlichen Zustand vor. Im Keller meiner Grossmutter fanden wir zwar keine Waffen, dafür aber etwa ein Dutzend Geweihe von Wildtieren sowie einen verschimmelten Hirschsalami.
Die KESB-Mitarbeiter hatten sich offensichtlich bemüht, das Kellerabteil von Frau Hebeisen möglichst so zu hinterlassen, wie sie es angetroffen hatten. Deshalb lagen die beiden Stoffsäcke nicht gleich bei der Tür, sondern etwas versteckt hinter einer alten, verstaubten Kommode.
Claudia zog Handschuhe an und öffnete die verschnürten Säcke. Nachdem ich einen kurzen Blick in die Säcke geworfen hatte, schlug ich vor, die Säcke nach oben in die Wohnung zu nehmen. Ich wollte die Waffen nicht im Keller ausbreiten, wo jederzeit andere Hausbewohner herkommen konnten.
In der Wohnung legten wir eine Decke auf den Wohnzimmerteppich und breiteten darauf den Inhalt der Säcke aus. Zwölf Gewehre und acht Pistolen kamen zum Vorschein. Es waren unterschiedlichste Fabrikate. Ich erkannte einige Gewehre der Schweizer Armee, und zwar sowohl das Sturmgewehr 90 als auch das Vorgängermodell Sturmgewehr 57. In einem der Säcke fanden wir auch noch einige Kartonschachteln mit Munition.
»Entweder ist Frau Hebeisen eine leidenschaftliche Waffensammlerin oder ihr Keller wird noch von jemand anderem benutzt«, überlegte ich mir.
»Am einfachsten wäre, wenn wir sie fragen könnten. Aber die Männer von der KESB haben mir gesagt, dass das nicht möglich sei. Und es ist auch nicht damit zu rechnen, dass sie sich bald so erholt, dass man ein richtiges Gespräch mit ihr führen kann«, meinte Luca.
»Gut, aber davon müssen wir uns noch persönlich überzeugen. Wir fahren im Verlauf des Tages noch zu ihr ins Spital. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht so recht, dass eine alleinstehende 94-jährige Frau selbst so eine Waffensammlung anlegt. Deshalb möchte ich zuerst herausfinden, mit wem Frau Hebeisen regelmässig Kontakt hatte und wer Zugang zum Keller hatte.«
»Fangen wir doch bei der Nachbarin an, die Frau Hebeisen im Treppenhaus gefunden hat«, schlug Luca vor.
»Gute Idee. Und du, Claudia, schaust mal, ob du brauchbare Spuren in der Wohnung, im Keller, an den Stoffsäcken oder an den Waffen findest.«
»Mache ich. Allerdings wird da kaum viel Brauchbares dabei rauskommen, wenn die Typen von der KESB gestern alles in die Hand genommen haben.«
Gabriela Odermatt wohnte ein Stockwerk tiefer als Jolanda Hebeisen. Sie war glücklicherweise zuhause und bot uns einen Tee an. Ich schätzte sie auf 55 bis 60 Jahre. Mit ihren langen, leicht gewellten Haaren und auffallend grossen und breiten Ohrringen machte sie einen lebhaften und fast Hippie-haften Eindruck.
»Was ist denn mit Frau Hebeisen los?«, wollte sie wissen, etwas erstaunt darüber, dass die Polizei wegen der verunfallten Nachbarin vorbeikam.
Ich wollte nicht, dass der Waffenfund früher als nötig bekannt wurde und antwortete deshalb zurückhaltend: »Sie liegt noch immer im Spital. Es geht ihr leider nicht so gut. Wir wissen nicht, ob sie sich erholen wird. Darum möchten wir die Personen kontaktieren, die in Kontakt mit Frau Hebeisen stehen. Können Sie uns da weiterhelfen?«
Wirklich viel weiterhelfen konnte uns Gabriela Odermatt nicht. Nach ihren Angaben lebte Jolanda Hebeisen völlig zurückgezogen und es schien, dass Gabriela Odermatt die einzige Person war, mit der die betagte Frau regelmässig Kontakt hatte.
»Ich habe regelmässig Einkäufe für sie gemacht und wir haben mindestens einmal pro Woche zusammen Tee getrunken. Manchmal hat sie von Leuten erzählt, die sie früher kannte, aber seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Aber ich erinnere mich nicht, dass sie erzählt hat, dass sie mit jemandem in Kontakt steht. Ausser vielleicht mit dem Hausarzt.«
»Sie haben Frau Hebeisen im Treppenhaus gefunden?«, erkundigte sich Luca.
»Ja, letzte Woche. Ich war auf dem Balkon und habe die Blumen gegossen. Sie hat von oben gerufen, ob ich da sei und ob ich kurz Zeit hätte. Ich habe geantwortet, dass ich noch rasch die Blumen fertig giesse und dann zu ihr kommen würde. Als ich mich fünf Minuten später auf den Weg machte, lag sie im Treppenhaus. Ich vermute, sie wollte nicht länger warten und war auf dem Weg zu mir. Vielleicht fühlte sie sich nicht wohl.«
Nach der Mittagspause brachte Claudia die Waffen in ihr Labor im Untergeschoss der Kantonspolizei, um sie näher zu untersuchen. »Und ich versuche natürlich noch, etwas über die Herkunft der Waffen herauszufinden«, versprach sie.
Luca und ich fuhren zum Kantonsspital, sprachen mit der zuständigen Ärztin und konnten danach noch kurz Jolanda Hebeisen sehen. Wie aufgrund der Angaben der KESB-Mitarbeiter erwartet, brachte der Besuch im Spital nichts. Jolanda Hebeisen war zwar bei Bewusstsein, aber völlig teilnahmslos. Sie schien uns gar nicht wahrzunehmen.
»Ich befürchte, dass das nicht mehr besser wird«, dämpfte die zuständige Ärztin meine Hoffnung, in ein paar Tagen mehr von Frau Hebeisen erfahren zu können.
Zurück im Büro informierte ich kurz meinen Chef Thomas Baumann, den Kommandanten der Kantonspolizei. Ich musste mir Mühe geben, mir nicht allzu fest anmerken zu lassen, dass ich mich über den neuen Fall freute. Endlich gab es wieder eine sinnvolle Aufgabe für mein Team und mich!
Die Langeweile, mit der ich und mein Team bis zur Meldung des Waffenfundes gekämpft hatten, hatte mir mein Chef Baumann bereits bei meinem Vorstellungsgespräch und am ersten Arbeitstag angekündigt. »Bei uns auf dem Land ist es ganz anders als in der Grossstadt, in der sie bisher gearbeitet haben», hatte er mir damals gesagt und ich wusste nicht so recht, ob das ein Versprechen oder eine Drohung sein sollte.
Bezüglich des Waffenfundes teilte der Kommandant meine Meinung, dass wir versuchen sollten, etwas über das Umfeld von Jolanda Hebeisen herauszufinden, ohne jemandem von den gefundenen Waffen zu erzählen. Da es sonst ruhig war im Kanton, ordnete Baumann an, eine Polizeistreife zu unserer Unterstützung einzusetzen.
Eine Viertelstunde später waren die beiden Streifenpolizisten Sarah Landolt und Dominic Bader bei mir im Büro. Ich hatte die beiden bei meiner Einarbeitung und auch beim ersten Fall bereits kennengelernt. Dominic Bader war etwas älter als ich. Er war mir nicht so sympathisch, da er überaus von sich überzeugt und selbstzufrieden auftrat. Sarah Landolt war gut zehn Jahre jünger und eindeutig die Zurückhaltendere des Teams. Während man im Gesicht von Bader recht gut lesen konnte, was er dachte, wirkte Landolt bisher etwas unnahbar auf mich.
Wir beschlossen, dass ich alle Bewohner befragen würde, die im gleichen Mehrfamilienhaus wohnten wie Jolanda Hebeisen. Dominic Bader und Sarah Landolt würden sich in den umliegenden Häusern erkundigen, wer Frau Hebeisen kannte oder wusste, wer Kontakt zu ihr hatte. Luca Bertoldi kontaktierte den Hausarzt und versuchte herauszufinden, ob es wirklich keine Verwandten gab. Ausserdem überprüfte er, ob Jolanda Hebeisen einen Waffenerwerbsschein besass. Und Claudia Weber war weiterhin mit der Spurensicherung und der Klärung der Herkunft der Waffen beschäftigt.
2
Montag, 27. Juni
Die Ermittlungen zum Waffenfund bei der 94-jährigen Jolanda Hebeisen standen seit Donnerstagabend still. Wir hatten am Freitagmorgen von der polnischen Polizei Neuigkeiten erhalten, die den ersten Fall betrafen, den ich nach meinem Stellenantritt hier bearbeitet hatte. Die neuen Erkenntnisse zum Fall der spurlos verschwundenen Joggerin Ivana Gobec hatten uns den ganzen Freitag beschäftigt.
Ich fand es nicht schlimm, dass der neue Fall etwas warten musste. Bisher war ja nicht einmal klar, ob es irgendwelche strafbare Handlungen gab. Deshalb hatte ich auch noch keinen Anlass gehabt, die Staatsanwaltschaft über den neuen Fall zu informieren.
Auch der Montagmorgen stand zunächst noch im Zeichen des Falls Ivana Gobec. Ich hatte die zuständige Staatsanwältin Alexandra Egger und den Gerichtsmediziner Norbert Sommer zu uns ins Kripo-Büro eingeladen. Gemeinsam mit ihnen und meinem Team wollte ich besprechen, wie die Zusammenarbeit in unserem ersten gemeinsamen Fall verlaufen war, um daraus Lehren für die Zukunft ziehen.
Norbert Sommer war eine gross gewachsene, etwas übergewichtige Frohnatur. Der Mittfünfziger hatte häufig einen Scherz auf den Lippen, über denen er einen grauen Schnurrbart trug. Der Schnurrbart war fast das Einzige, was an Haaren am Kopf übriggeblieben war, denn abgesehen von ein paar Stoppeln am Hinterkopf war Norbert Sommer kahl.
Ganz anders die Staatsanwältin: Die attraktive Alexandra Egger trug ihre dichten, langen, blonden Haare offen. Sie war mit 35 Jahren ein Jahr älter als ich. Wie bisher immer, wenn ich sie gesehen hatte, war sie elegant gekleidet. Heute, mit einer hellblauen Bluse, schwarzen Hosen und einem schwarzen Blazer, gefiel sie mir besonders gut.
Sowohl von Alexandra Egger als auch von Norbert Sommer hatte ich in den ersten Wochen der Zusammenarbeit einen sehr positiven Eindruck gewonnen. So verlief auch die Sitzung am Montagmorgen sehr angenehm. Alle sprachen offen darüber, wie sie die ersten gemeinsamen Ermittlungen erlebt hatten, was sie irritiert hatte und was man im Nachhinein hätte besser machen können.
Es war zwar offensichtlich, dass es solche Nachbesprechungen unter meinem Vorgänger Hans Spörri nicht gegeben hatte. Aber alle liessen sich gut darauf ein.
Nach der Besprechung machten wir noch gemeinsam Kaffeepause. Bei dieser Gelegenheit informierte ich Alexandra Egger und Norbert Sommer kurz über die Ereignisse vom Donnerstag.
Norbert zeigte jedoch nur mässiges Interesse: Einerseits gab es keine Leiche, die der Gerichtsmediziner hätte untersuchen müssen, andererseits hatte ich noch zu wenig Informationen über die gefundenen Waffen, um bei ihm Interesse am Fall zu wecken. Ich nutzte die Gelegenheit aber, um nach seiner Einschätzung bezüglich des Gesundheitszustands von Jolanda Hebeisen zu fragen. Nachdem ich ihm erzählt hatte, was mir die Spitalärztin gesagt hatte, meinte Norbert: »Mach dir da nicht grosse Hoffnungen. Auch wenn die Frau bis zum Sturz in guter Verfassung war. Sie ist 94 Jahre alt. Wenn sie jetzt seit einer Woche nicht ansprechbar ist, dann ist zu befürchten, dass sie sich kognitiv nicht mehr richtig erholt. Wahrscheinlich müsst ihr ohne ihre Hilfe herausfinden, woher die Waffen kommen.«
Er grinste und fügte an: »Ist doch gut, dass ihr nicht einfach die alte Frau fragen könnt: So habt ihr wenigstens etwas zu tun.«
Alexandra Egger betrachtete unseren neuen Fall aus der Optik, ob sie als Staatsanwältin aktiv werden musste. »Im Moment betrifft mich das noch nicht«, war ihre Schlussfolgerung. »Meld‘ dich einfach bei mir, falls es konkrete Hinweise auf ein Verbrechen gibt.«
Nachdem Norbert und Alexandra gegangen waren, setzte ich mich zusammen mit Luca und Claudia an den grossen Besprechungstisch in unserem Teambüro.
»Also«, sagte ich, »machen wir weiter mit dem Waffenfund. Claudia, was weisst du schon über die Waffen?«
»Wie ihr bereits wisst, sind es zwölf Gewehre und acht Pistolen. Es ist eine bunte Mischung verschiedenster Fabrikate und Modelle.
Bei den Gewehren haben wir drei Exemplare des Sturmgewehr 90 und zwei Exemplare der älteren Version Sturmgewehr 57. Der Rest sind ausländische Waffen, vorwiegend Marke Kalaschnikow. Auffallend ist, dass drei AK-12 dabei sind. Das ist ein neues Kalaschnikow-Modell, das erst seit wenigen Jahren von der russischen Armee eingesetzt wird.
Bei den acht Pistolen sind es fünf verschiedene Modelle und drei verschiedene Hersteller, nämlich Walther, Glock und Star.
Es gibt Fingerabdrücke an den Waffen, den Munitionspaketen und den Säcken. Ich muss sie noch mit den Fingerabdrücken der beiden KESB-Mitarbeiter abgleichen und dann sehen, was übrig bleibt. Wahrscheinlich nicht allzu viel, denn die Waffen wurden offensichtlich gut gepflegt und regelmässig gereinigt.«
»Weisst du schon etwas über die Herkunft der Waffen?«, fragte ich.
»Nein, noch nicht. Aber fast alle Waffen haben noch lesbare Seriennummern. Ich will heute herausfinden, welche Waffen irgendwo registriert sind. Zumindest bei den Sturmgewehren der Schweizer Armee dürfte das keine grosse Sache sein.«
»Wenn Frau Hebeisen die Waffen gesammelt hat«, meldete sich Luca, »dann hat sie es nicht auf legale Art und Weise gemacht. Die Frau besitzt nämlich weder einen Waffenerwerbsschein noch einen Waffentragschein.«
»Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man die AK-12 legal beschaffen kann«, meinte Claudia.
»Was hast du sonst noch über Frau Hebeisen herausgefunden?«, erkundigte ich mich bei Luca.
»Es scheint wirklich keine Angehörigen zu geben, zumindest nicht in der Schweiz. Sie war verheiratet. Der Mann ist aber schon vor fast 50 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Sie hatten keine Kinder. Frau Hebeisen hatte einen Bruder und eine Schwester, die vor Jahren ebenfalls verstorben sind. Es gibt zwei Nichten und einen Neffen, die aber alle nicht in Europa leben. Ich bin daran, die aktuellen Adressen herauszufinden.
Der Hausarzt hat Frau Hebeisen vor ein paar Jahren darauf angesprochen, ob sie jemanden hat, der ihr bei Bedarf helfen kann, aber sie hat gesagt, dass sie ausser der Nachbarin niemanden habe.«
»Was hat der Hausarzt sonst noch gesagt?«, wollte ich wissen.
»Dass sie keine besonders gute Kundin war. Sie sei zwar jeweils zuverlässig zur jährlichen Kontrolle gekommen, aber abgesehen von einem etwas tiefen Blutdruck und einem leicht erhöhten Cholesterinwert immer gesund gewesen. Dem Alter entsprechend sei sie nicht mehr so gut zu Fuss gewesen. Ich glaube, er sagte, sie hätte Arthrose. Sie sei wahrscheinlich jeweils mit dem Auto zu ihm in die Praxis gefahren worden, aber Genaueres weiss er nicht.«
»Also grundsätzlich wäre sie wohl in der Lage gewesen, die Waffen selbst im Keller zu deponieren?«
»Ja, wahrscheinlich schon. Auch wenn ich mir das nicht so recht vorstellen kann«, antwortete Luca. »Ich meine, allzu kräftig war sie ja wohl seit Jahren nicht mehr. Da hätte sie wohl fast jede Waffe einzeln in den Keller tragen müssen.«
Leider hatte Luca kaum etwas erfahren, was uns weiterbrachte. Nun war es an mir, über meine Erkenntnisse zu berichten: »Ich konnte bis Donnerstagabend mit den meisten Hausbewohnern reden. Und Sarah und Dominic haben sich in der Nachbarschaft umgehört. Es scheint wirklich so, dass Jolanda Hebeisen ausser mit der Nachbarin Gabriela Odermatt mit fast niemandem regelmässig Kontakt hatte. Die Hausbewohner kennen Frau Hebeisen zwar, man grüsst sich im Treppenhaus, aber damit hat es sich.
Ausser Frau Hebeisen wohnen alle weniger als zehn Jahre im Haus und kennen sie nur als alte, zurückgezogen lebende Frau. In den umliegenden Häusern gibt es ein paar Alteingesessene. Sarah hat sogar mit einem Ehepaar gesprochen, das noch den Mann von Frau Hebeisen gekannt hat. Diejenigen, die schon lange im Quartier wohnen, erinnern sich noch an Zeiten, wo Frau Hebeisen häufig im Quartier unterwegs war und mit etlichen Leuten in der Stadt Kontakt hatte. Aber das ist offenbar viele Jahre her.«
Wir notierten die Namen der relevanten Personen sowie die wichtigsten Erkenntnisse auf farbige Blätter und hängten diese an eine Pinnwand.
»Im Moment sieht es sehr danach aus«, erläuterte ich meine Überlegungen, »dass es sich um eine illegale Waffensammlung handelt. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Waffen nicht von Jolanda Hebeisen im Keller deponiert wurden. Vielleicht wurden die Waffen ohne ihr Wissen dort deponiert. Vielleicht hat sie davon gewusst und jemandem den Keller zur Verfügung gestellt.
Für mich haben im Moment zwei Sachen Priorität: Claudia, du versuchst – wie du schon gesagt hast – herauszufinden, woher die Waffen kommen. Und Luca und ich fühlen der Nachbarin nochmals auf den Zahn. Vielleicht weiss sie mehr, als sie gesagt hat. Ich möchte wissen, ob sie oder sonst jemand Zugang zum Kellerabteil hatte. Aufgebrochen wurde es nicht, also hatte derjenige, der die Waffen dorthin gebracht hat, einen Schlüssel.«
Am Nachmittag führten Luca und ich das zweite Gespräch mit der Nachbarin Gabriela Odermatt. Sie trug wieder ihre riesigen, klimpernden Ohrringe. Leider ergaben sich kaum neue Erkenntnisse. Frau Odermatt bestätigte das, was sie schon im ersten Gespräch gesagt hatte und was wir auch von anderen Hausbewohnern und Personen aus den umliegenden Häusern erfahren hatte: Jolanda Hebeisen lebte seit Jahren äusserst zurückgezogen.
Um konkretere Angaben zu bekommen, musste ich etwas direkter werden: »Frau Odermatt, der Grund dafür, dass wir nachfragen, ist: Wir haben im Kellerabteil von Frau Hebeisen etwas gefunden, von dem wir glauben, dass es nicht Frau Hebeisen gehört.«
»Was denn?«
»Das darf ich Ihnen leider im Moment nicht sagen. Ich muss Sie auch bitten, diese Information für sich zu behalten.«
»Ja, selbstverständlich, Sie können sich auf mich verlassen, Herr Kommissar. Ist es Geld, das Sie gefunden haben? Vielleicht die Beute von einem Banküberfall?«
»Wie gesagt, ich darf Ihnen leider keine Auskunft geben«, antwortete ich und war nicht unglücklich, dass sie auf einer falschen Fährte war. Von dieser wollte ich sie nicht abbringen.
»Also, Frau Hebeisen war das nicht. Die ist ja immer so nett. Abgesehen davon: Ich habe sie schon seit Jahren nicht mehr im Keller gesehen. Aber ich habe auch nie jemand anderen im Kellerabteil von Frau Hebeisen gesehen.«
»Wer hätte denn Zugang zum Kellerabteil von Frau Hebeisen?«
»Das habe ich mir gar nie überlegt, aber ich würde meinen, niemand. Zumindest gehe ich davon aus, dass man mit seinem Kellerschlüssel nur den eigenen Keller öffnen kann.«
Davon ging ich auch aus. Trotzdem testeten wir es sicherheitshalber. Und es war so, wie es zu erwarten war: Mit dem Kellerschlüssel von Gabriela Odermatt liess sich der Keller von Jolanda Hebeisen nicht öffnen. Und umgekehrt auch nicht. Das Gleiche galt auch für die Wohnungsschlüssel und die Briefkastenschlüssel.
»Sie haben gesagt«, fragte ich anschliessend bei Frau Odermatt nach, »dass Sie Frau Hebeisen schon lange nicht mehr im Keller gesehen haben: Wissen Sie, warum sie nie in den Keller ging?«
»Früher ging sie schon regelmässig in den Keller. Aber in den letzten Jahren hatte sie immer mehr Schmerzen beim Gehen. Insbesondere wenn sie die Treppe hinunter musste. Ich habe vor drei Jahren dafür gesorgt, dass sie eine kleine Waschmaschine im Badezimmer erhielt. Danach hatte sie eigentlich keinen Grund mehr, in den Keller zu gehen.«
Und nach einigen Sekunden Pause fügte sie an: »Wenn ich mal so alt werde, möchte ich unbedingt in einem Haus mit Lift wohnen.«
»Aber Frau Hebeisen musste ja doch regelmässig die Treppe runter, beispielsweise um einzukaufen oder wenn sie zum Arzt ging«, fragte ich nach.
»Wenn es sein musste, schaffte sie es schon, die Treppe runter und wieder rauf zu gehen. Aber sie tat es einfach nicht häufiger als nötig. Einkaufen ging sie in letzter Zeit nur noch selten. Ich habe ihr ein- bis zweimal pro Woche ein paar Lebensmittel mitgebracht. Mehr brauchte sie nicht.«
»Und wenn sie zum Arzt musste?«
»Frau Hebeisen ist nicht eine Frau, die ständig zum Arzt rennt. Man muss sie schon fast zwingen, mal ein Aspirin zu nehmen. Früher ging sie immer mit dem Velo oder zu Fuss zum Arzt. Aber Velo fährt sie seit Jahren nicht mehr und als sie mir vor ein paar Jahren mal sagte, zu Fuss sei es ihr langsam zu anstrengend, bot ich ihr an, sie mit dem Auto hinzubringen. Das habe ich zwei oder drei Mal gemacht. Und sonst hat sie jeweils ein Taxi kommen lassen.«
Als wir das Gespräch beendeten, konnte Gabriela Odermatt ihre Neugier nicht mehr zügeln: »Mir können Sie es ja sagen, Herr Kommissar: Ist es viel Geld, das Sie gefunden haben?«
Ich blickte sie schmunzelnd an und antwortete: »Auf Wiedersehen, Frau Odermatt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Falls Ihnen noch etwas einfällt, dann rufen Sie uns doch bitte an.«
Zurück im Polizeigebäude rief ich den Vermieter an und liess mir bestätigen, dass jeder Mieter nur seinen eigenen Keller aufschliessen konnte. Selbst der Hauswart hatte keinen Schlüssel, mit dem er eine Wohnung, ein Kellerabteil oder einen Briefkasten hätte öffnen können.
3
Dienstag, 28. Juni
Kaum war ich am Morgen an meinem Arbeitsplatz angekommen, rief mich die Sekretärin des Kommandanten an: »Markus, der Chef will dich sehen.«
Zwei Minuten später stand ich im Büro von Thomas Baumann.
»Goldbacher«, sagte er ohne weitere Begrüssung, »mir scheint fast, als hätten Sie das Verbrechen aus der Grossstadt zu uns aufs Land gebracht. Jetzt war es jahrelang ruhig bei uns. Aber seit sie hier sind, ist ja die Hölle los!«
Ich kannte meinen neuen Chef schon ein wenig und wusste, dass man solche Aussagen nicht für bare Münze nehmen durfte. Insbesondere glaubte er zweifellos nicht ernsthaft, dass ich Schuld am Waffenfund hatte. Aber im Kern war seiner Aussage zweifellos ernst gemeint: Er betrachtete unseren kleinen Kanton durchaus noch als einen Flecken, in dem noch viel heile Welt übriggeblieben war. Und er sah es als seine Aufgabe, das so zu bewahren.
»Wieso meinen Sie«, fragte ich absichtlich etwas naiv. »Etwa wegen dem Waffenfund?«
»Natürlich!«
»Aber wir wissen ja noch nicht einmal, ob es da überhaupt strafbare Handlungen gegeben hat. Wir wissen noch nicht, woher die Waffen stammen und wer sie dort deponiert hat.«
»Sie wissen noch nicht, ob es strafbare Handlungen gegeben hat. Ich schon. Ihre Frau Weber versucht ja anhand der Seriennummern herauszufinden, ob die Waffen als gestohlen gemeldet wurden…«
Ich blickte ihn fragend an.
»Soeben hat mich fedpol angerufen«, begann er mit der Erklärung.
Allzu erstaunt war ich nicht darüber, dass sich die Polizei des Bundes, kurz fedpol genannt, einschaltete, wenn es um eine grössere Zahl von gestohlenen Waffen ging. »Das heisst, die Waffen sind gestohlen?«, fragte ich Baumann.
»Mindestens ein Teil. Die drei Exemplare des Sturmgewehr 90 sind als gestohlen gemeldet. Und offenbar muss das irgendeine grössere Sache sein, denn der fedpol-Typ wollte mir keine Auskunft darüber geben. Scheint, dass sie da etwas unter dem Deckel halten wollen. Typisch Bundespolizei…«
Er zögerte einen Moment, dann explodierte seine Stimme fast: »Was meinen die bei fedpol eigentlich? Sie wollen alle Informationen über unsere Ermittlungen und verweigern mir die Auskunft über ihren Fall. Das lasse ich mir nicht bieten! Schliesslich bin ich der Polizeichef in diesem Kanton!«
Seine Pupillen hatten sich während der letzten Sätze geweitet und Röte war in sein Gesicht geschossen. Er stand von seinem Bürostuhl auf, wahrscheinlich um der aufgestauten Energie etwas Raum zu geben. Wenn Baumann aufstand, umherging und fast schrie, wirkte er noch gewaltiger als er es aufgrund seiner beachtlichen Körpergrösse ohnehin schon war. Meist war er sehr ruhig und sachlich, aber in solchen Momenten konnte er einen ziemlich erschrecken. Ich hatte mich in meinen ersten zwei Monaten hier schon an seine Ausbrüche gewöhnt. So blieb ich gelassen und hatte gar etwas Mühe, ein Schmunzeln zu unterdrücken.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte ich.
Er überlegte einen Moment und antwortete dann mürrisch: »Es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als fedpol Auskunft zu geben. Aber wir liefern Ihnen nur so viel wie nötig. Gerade genug, damit wir keinen Ärger kriegen, aber nicht mehr. Verstanden?«
»Alles klar.«
»Und damit die sich nicht zu wichtig nehmen, verschieben wir den Kontakt in der Hierarchie nach unten. Wir machen es so, dass die Informationen nicht von mir oder von Ihnen geliefert werden, sondern von Frau Weber. Ich schicke Ihnen eine Mail mit den Kontaktangaben. Die können Sie dann an Frau Weber weitergeben.«
Zurück im Teambüro informierte ich Luca und Claudia darüber, dass ein Teil der Waffen als gestohlen gemeldet war. Die Anweisung von Baumann, nur das Nötigste weiterzugeben, unterdrückte ich dabei.
Danach rief ich die Staatsanwältin an, um sie zu informieren, dass nun klar war, dass es sich zumindest teilweise um gestohlene Waffen handelte. Alexandra Egger versprach, nach der Mittagspause bei uns vorbei zu kommen.
Den Rest des Vormittags brauchte ich, um mit Luca und Claudia einen Bericht für fedpol zu machen. Kurz vor dem Mittagessen schickte Claudia die Informationen per E-Mail nach Bern.
Nach der Mittagspause kam Alexandra Egger zu uns ins Teambüro. Wir gaben der Staatsanwältin den für fedpol verfassten Bericht und erläuterten ihr den Stand der Ermittlungen.
»Wissen wir, was fedpol mit diesen Informationen macht?«, wollte Alexandra wissen. »Stimmen wir uns mit ihnen ab oder ermitteln wir im Moment einfach weiter?«
»Bis jetzt haben sie nicht mehr verlangt, als über den Stand der Ermittlungen informiert zu werden. Ich denke, die Haltung von Baumann ist, dass wir normal weiter machen, solange die sich nicht melden.«
Wir diskutierten die Schlussfolgerungen aus den bisherigen Ermittlungen und das weitere Vorgehen. Weil drei der Waffen in der Schweiz gestohlen worden waren und man zudem wohl auch die AK-12 nirgends legal beschaffen konnte, schlossen wir, dass wir auf etwas mit ziemlich viel krimineller Energie gestossen waren.
»Frau Hebeisen traue ich das nicht zu«, überlegte ich. »Und nach dem, was uns Frau Odermatt und andere Nachbarn gesagt haben, müsste man fast vermuten, dass Frau Odermatt wohl beinahe als Einzige genügend Kontakt hatte, um Zugang zum Keller von Jolanda Hebeisen zu bekommen. Aber auch Frau Odermatt traue ich das nicht zu. Ich vermute, Frau Hebeisen hatte zu Leuten Kontakt, von denen wir bisher nichts wissen.«
»Meinst du Kontakte, von denen auch die Nachbarin nichts weiss? Oder meinst du, dass uns die Nachbarin etwas verheimlicht?«, wollte Alexandra wissen.
»Ich glaube nicht, dass uns Frau Odermatt absichtlich belügt. Vielleicht gibt es Leute, die Frau Hebeisen besucht haben, ohne dass die Nachbarin davon erfahren hat. Oder sie hat es wieder vergessen.«
»Ich möchte mir selbst ein Bild machen«, sagte Alexandra. »Kannst du mir die Wohnung und den Keller zeigen? Und vielleicht haben wir ja noch Gelegenheit, kurz mit der Nachbarin zu sprechen.«
Gabriela Odermatt war nicht zuhause, aber ich erreichte sie auf dem Handy und konnte sie am späteren Nachmittag zusammen mit Alexandra kurz am Arbeitsplatz besuchen.
Die Nachbarin versicherte uns noch einmal, dass sie nie im Kellerabteil von Jolanda Hebeisen gewesen war und nie jemand anderen als Jolanda Hebeisen dort gesehen hatte. Und dass es Jahre her sei, seit sie Jolanda Hebeisen letztmals im Keller gesehen hatte.
»Wissen Sie«, fragte Alexandra, »ob noch jemand anders als Sie für Frau Hebeisen eingekauft hat?«
»Ich weiss nicht. Aber ich glaube nicht.«
»Und wenn Sie in den Ferien waren?«
»Wissen Sie, ich bin nie lange weg. Ich habe es Frau Hebeisen immer vorher gesagt und dann vorher mehr eingekauft. Sie braucht eigentlich nicht viel. Ich glaube, wenn man so alt ist, dann isst man viel weniger.«
»Hat Frau Hebeisen ihren Briefkasten selbst geleert?«, fragte ich. »Oder haben Sie das gemacht?«
Gabriela Odermatt riss die Augen auf und starrte mich an. Nach einigen Sekunden schlug sie sich die Hand an die Stirn. »Wie kann man so blöd sein! Dass ich daran nicht gedacht habe! Natürlich, der Mahlzeitendienst. Frau Hebeisen hat ja nicht nur das gegessen, was ich für sie eingekauft habe. Das Mittagessen hat ihr meist der Mahlzeitendienst gebracht. Und ab und zu habe ich gesehen, dass die auch den Briefkasten für sie geleert haben.«
»Wissen Sie, was für ein Mahlzeitendienst das war?«
»Keine Ahnung. Wenn ich mich richtig erinnere, waren auf dem Lieferwagen so schöne Sterne aufgedruckt. Ich glaube, Frau Hebeisen hat es mir mal erzählt, wie die Firma heisst, aber ich kann mich nicht erinnern.«
Es kostete uns nicht viel Zeit, den Namen des Mahlzeitendienstes zu erfahren, denn Frau Odermatt hatte sich bezüglich der Sterne nicht getäuscht. Luzia Bürgin, die Ehefrau des bekanntesten Catering- und Mahlzeitendienst-Betreibers der Stadt, bestätigte mir am Telefon, dass Jolanda Hebeisen seit Jahren zu ihren Kunden gehörte. Sie versprach mir, bis zum nächsten Morgen eine Liste der Mitarbeiter zu machen, die Jolanda Hebeisen beliefert hatten.
4
Mittwoch, 29. Juni
Um 7:30 Uhr trafen Luca und ich bei der Firma Sternenkoch ein. Luzia und Silvio Bürgin empfingen uns im Pausenraum ihres kleinen Betriebs, der in einem Industriegebäude am Stadtrand untergebracht war.
Der Sternenkoch Silvio Bürgin, ein kräftig gebauter, etwa 60 Jahre alter Mann mit kurzen grauen Haaren, war der Chefkoch des Betriebs und zusammen mit drei Angestellten für Küche und Einkauf verantwortlich. Seine Frau Luzia, noch etwas beleibter, war für die Auslieferung des Essens, Personal, Administration und Buchhaltung verantwortlich.
Mir als Neuzuzüger war Silvio Bürgin kein Begriff, aber Luca hatte mich im Voraus informiert, dass Bürgin im Kanton eine gewisse Bekanntheit hatte. Er hatte mehr als zwanzig Jahre lang als Koch im Restaurant Sternen gearbeitet und war deshalb vielen als »der Koch vom Sternen« bekannt gewesen. Nach einem Besitzerwechsel war er entlassen worden, weil sich der neue Restaurantbesitzer nicht mit Bürgin über die Speisekarte einigen konnte. Danach gründete der Koch zusammen mit seiner Frau eine eigene Firma, die er Sternenkoch nannte.
»Der Name ist ein Wortspiel«, erklärte mir Bürgin. »Spitzenköche bezeichnet man ja als Sterneköche, wegen der Sterne, die von Gastrokritikern verteilt werden. Ich bin zwar kein Sternekoch, aber immerhin der ehemalige Koch des Restaurants Sternen, also der Sternenkoch. Selbstverständlich will ich damit auch ein wenig den neuen Sternen-Chef ärgern.«
Es klang, als wäre Bürgin auch nach Jahren noch ein wenig verbittert über seine Entlassung. Und als würde er bei jeder Gelegenheit von der Entstehung seiner Firma und über den Grund der Namenswahl erzählen.
Sternenkoch war primär ein Cateringbetrieb für Private und Firmen. Luzia Bürgin erklärte uns aber, sie hätten von Anfang an auch einen Mahlzeitendienst für Seniorinnen und Senioren angeboten: »Das ist enorm wichtig für uns, weil es eine schöne Grundauslastung über die ganze Woche gibt. Beim Catering gibt es grosse Schwankungen. Da kann man viel weniger planen und braucht viel mehr Aushilfskräfte. Ausserdem sind einige frühere Stammkunden aus dem Sternen heute in einem Alter, wo sie froh sind, wenn wir ihnen ein gutes Essen nach Hause liefern. Beim Mahlzeitendienst zahlen die Kunden zwar viel weniger als beim Catering, aber wir bekommen dafür Subventionen von der Stadt. Ausserdem sind es nicht normale Angestellte, die beim Mahlzeitendienst ausliefern.«
»Sondern?«, fragte Luca.
»Leute, die Freiwilligenarbeit machen. Häufig Pensionierte, die noch fit und aktiv sind. Aber auch jüngere Leute, die zum Beispiel arbeitslos sind und etwas machen müssen, damit ihnen die Decke nicht auf den Kopf fällt. Die Freiwilligen bekommen keinen Lohn, nur kleine Aufmerksamkeiten. Zum Beispiel können sie hier gratis essen.«
So interessant die leidenschaftlichen Erzählungen der beiden über ihr Unternehmen waren - ich musste auf den Punkt kommen und fragte Frau Bürgin: »Jolanda Hebeisen ist seit Jahren ihre Kundin?«
»Ja genau. Seit etwa zweieinhalb Jahren. Am Anfang drei Mal pro Woche, später haben wir jeden Tag das Mittagessen gebracht. Bis sie jetzt ins Spital gekommen ist.«
»Von wem haben Sie erfahren, dass Frau Hebeisen im Spital ist und sie nicht mehr liefern müssen?«
»Unser Mitarbeiter wollte ihr grad das Essen liefern, als der Krankenwagen da war. Ich habe dann bei meiner Tochter nachgefragt, ob sie länger im Spital bleiben muss. Wissen Sie, Herr Goldbacher, meine Tochter arbeitet im Spital. Und wenn man ältere Leute beliefert, kommt das halt ab und zu vor, dass mal jemand plötzlich ins Spital muss und uns nicht Bescheid geben kann. Da bin ich natürlich froh, dass mir meine Tochter Auskunft geben kann.«
Ich musste innerlich schmunzeln über den pragmatischen Umgang, den die Tochter von Frau Bürgin mit dem Datenschutz pflegte. Aber ich sagte nichts dazu, sondern fragte weiter:
»Haben Sie die Liste der Mitarbeiter, die Essen an Frau Hebeisen geliefert haben?«
»Ja. Warum brauchen Sie die Liste?«
»Das darf ich Ihnen leider im Moment nicht sagen. Nur so viel: Es wäre möglich, dass Ihre Mitarbeiter etwas beobachtet haben, was uns in einer Ermittlung weiterhilft.«
Luzia Bürgin gab mir eine Liste mit zwölf Namen sowie den dazu gehörenden Adressen und Telefonnummern. Vier davon hatte sie mit Leuchtstift hervorgehoben. »Die gelb markierten sind diejenigen, die über längere Zeit regelmässig bei Frau Hebeisen waren. Für welchen Zeitraum interessieren Sie sich?«
»Das wissen wir nicht genau.«
»Sie sehen ja: ich habe ihnen mit Bleistift hingeschrieben, wer von wann bis wann für Frau Hebeisen zuständig war. Die anderen auf der Liste sind diejenigen, die Ferienablösungen auf der Tour gemacht haben, zu der das Quartier gehört, in dem Frau Hebeisen wohnt.«
»Das heisst, auf der Liste sind sämtliche Personen, die irgendwann einmal Essen an Frau Hebeisen ausgeliefert haben.«
»Nein, ganz sicher nicht«, antwortete Frau Bürgin. »Wenn zum Beispiel jemand krank ist und ich kurzfristig einen Ersatz brauche, dann schreibe ich natürlich nicht auf, wer eingesprungen ist. Muss ich ja auch nicht. Die Freiwilligen bekommen ja keinen Lohn. Es gibt sicher noch ein paar andere Personen, die ein oder zwei Mal bei Frau Hebeisen waren. Aber ich kann Ihnen beim besten Willen nicht sagen, wer das war. Spielt denn das eine Rolle?«
Ich war enttäuscht, dass die Liste nicht vollständig war, denn ich war überzeugt, mit dem Mahlzeitendienst auf der richtigen Fährte zu sein. Aber ich versuchte, meine Enttäuschung zu verbergen, und bedankte mich bei ihr.
Luca und ich waren uns einig, dass es sich lohnen konnte, diese Spur weiter zu verfolgen. Wir beschlossen, zuerst die vier auf der Liste farbig markierten Personen zu befragen. Und danach, falls uns das nicht weiterbrachte, die weiteren acht Personen.
Drei der vier konnten wir sofort telefonisch erreichen und einen Befragungstermin noch am gleichen Tag vereinbaren. Das erste Gespräch fand noch im Verlauf des Vormittags statt:
Fabian Hunkeler, 40 Jahre alt und stark übergewichtig, arbeitete Teilzeit in einer Brockenstube. An diesem Tag musste er erst am Nachmittag anfangen und war deshalb am Vormittag zuhause.
Die kleine Wohnung von Fabian Hunkeler war so dicht mit Möbeln zugemüllt, dass man das Gefühl hatte, dass er aus einer grösseren Wohnung umgezogen war. Ausserdem war er wohl ein Mensch, der sich schwer tat, Dinge wegzuwerfen. Irgendwie wirkte seine Wohnung fast wie eine Brockenstube, so dass er sich wahrscheinlich recht wohl fühlte an seinem Arbeitsort.
Es war irgendwie ein sonderbares Bild: Dieser gross gewachsene, korpulente Mann passte eigentlich nicht in diese kleine, vollgestopfte Wohnung. Ausserdem hatte er einen eher kleinen Kopf, der auf dem voluminösen Oberkörper irgendwie eingeschrumpft wirkte. Und sein Poloshirt mit weissen und schwarzen Querstreifen, das so eng war, dass sich die Brustwarzen deutlich abzeichneten, schien mir auch nicht unbedingt vorteilhaft gewählt.
»Ich war mehrere Jahre lang arbeitslos«, erklärte er uns. »Mein Betreuer beim RAV hat mir empfohlen, Freiwilligenarbeit zu machen, um nicht aus dem Rhythmus zu kommen. Das verbessere die Chancen, wieder einen Job zu finden. Darum habe ich fast ein Jahr lang für den Mahlzeitendienst gearbeitet. Jetzt habe ich zum Glück diesen Job in der Brockenstube. Ist zwar nur Teilzeit und schlecht bezahlt, aber ich komme einigermassen durch.«
Wenn Luca und ich gemeinsam Befragungen durchführen, führe ich normalerweise das Gespräch und Luca protokolliert. Diesmal hatte ich mit ihm vereinbart, dass wir die Rollen tauschen, damit ich ihm später Feedback zur Gesprächsführung geben konnte. Denn Luca war noch jung und erst seit wenigen Monaten bei der Kripo.
»Jolanda Hebeisen gehört zu den Kundinnen, die sie regelmässig beliefert haben?«, fragte Luca.
»Ja genau. Eigentlich jeden Tag. Die ganze Zeit, in der ich das gemacht habe. Andere Kunden sagen ja immer mal wieder für ein paar Tage ab. Zum Beispiel, wenn sie im Spital oder in einer Kur sind. Oder wenn zum Beispiel am Wochenende Verwandte für sie kochen. Aber bei Frau Hebeisen kann ich mich nicht erinnern, dass es mal einen Tag gab, an dem ich nicht bei ihr war.«
»Frau Hebeisen ist gestürzt und im Spital. Wir suchen Personen, die Kontakt mit ihr hatten. War mal jemand bei ihr, als sie das Essen gebracht haben?«
Fabian Hunkeler überlegte kurz, sagte dann aber sehr überzeugt: »Nein, ich glaube, daran würde ich mich erinnern. Es war nie jemand bei ihr.«
»Hat sie Ihnen erzählt, mit wem sie Kontakt hatte?«
Wieder dauerte es eine Weile, bis Hunkeler antwortete: »Ja, doch. Sie hat ab und zu von einer Frau erzählt, die für sie einkauft. An den Namen kann ich mich nicht erinnern, aber ich glaube, sie wohnt im gleichen Haus. Und ab und zu hat sie von ihrem verstorbenen Mann erzählt.«
»Und sonst«, fragte Luca nach.
»Hm, ich weiss nicht. Ich kann mich nicht erinnern.«
»Worüber haben Sie denn mit ihr gesprochen, wenn Sie bei ihr waren?«, mischte ich mich in die Befragung.





























