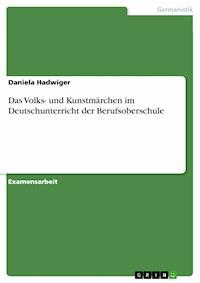
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Gattungen, Note: 1, , Veranstaltung: Hausarbeit des 2. Staatsexamens, Sprache: Deutsch, Abstract: Unterrichtseinheiten zur Entstehung des Volksmärchens sowie ihrer Funktion für Erwachsene und Kinder. Anschließende Betrachtung des Kunstmärchens. Die unterschiedlichen Merkmale der Volks- und Kunstmärchen werden abschließend verglichen und gegenübergestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Page 1
Page 3
Es war einmal… Diesen formelhaften Beginn verbindet ein jeder mit der Gattung der Märchen und die fabulösen Erzählungen sind Jung und Alt von frühester Kindheit an bekannt. Jedoch kaum einer der faszinierten Zuhörer oder Erzähler kann erklären, was da denn einmal war und vor allem wann und warum es geschah.
Diesen Fragen soll unter anderem im Deutschunterricht der 12. Klasse an der BOS nachgegangen werden. Die Wahl für die behandelte Unterrichtseinheit fiel aus verschiedenen Gründen auf die epische Kleinform des „Märchens“. Als erster Anstoß zur Auseinandersetzung innerhalb der Unterweisung wurde Punkt vier des Rahmenlehrplans der Jahrgangsstufe 12 mit dem Schwerpunkt „Literatur“ genommen. Schüler und Schülerinnen∗sollen demnach Möglichkeiten erhalten, ihre Kenntnisse bezüglich literarischer Werke zu vertiefen. In 4.1 heißt es weiter, dass der Literaturunterricht die Grundlagen literarischer Bildung vermitteln und einen Einblick in verschieden Werke unter Berücksichtigung der jeweiligen zeitgeschichtlichen Bedingtheit geben soll unter der Berücksichtigung, dass Literatur befähigen kann, sich mit der Realität sowohl zu befassen als auch auseinanderzusetzen.
Märchen sind kurze Prosaerzählungen, die von fantastischen Vorgängen berichten, aber weitaus mehr als reiner Erzählstoff für gemütliche Abende am Kamin: Sie weisen bestimmte Merkmale auf, lassen sich in verschiedene Typen einteilen und waren ursprünglich nicht einmal für Kinderohren bestimmt. Sie reflektieren das zeitgenössische Leben mehrerer Epochen und Kulturen und anhand der Behandlung unterschiedlicher Werke dieser Gattung im Unterricht wird den Schülern verdeutlicht, dass die Texte die Realität und Gedanken der Menschen widerspiegeln.
4.2 des Rahmenlehrplans gibt an, Texte gezielt zu hinterfragen und die wesentlichen Merkmale zu erfassen. Die Klasse soll daher selbständig Merkmale und Inhalte von Märchen erschließen sowie abschließend ein bekanntes Werk aus der Romantik lesen und analysieren.
Als weiterer Beweggrund, gerade Märchen zur Erarbeitung heranzuziehen, soll meine persönliche Neigung und Vorbildung hinsichtlich dieser Gattung aufgeführt werden. Bereits während meines 1. Staatsexamens kam ich in intensive Berührung mit den Erzählungen der damaligen Zeit und möchte meine Faszination auf die Schüler übertragen. In der Klasse W 12 B der BOS in Landshut sind die Voraussetzungen sehr gut gegeben,
∗Die Ausdrücke ‚Schüler’ und ‚Lernende’ sind, auch im weiteren Verlauf, stellvertretend zu sehen für ‚Schülerinnen
und Schüler’.
Page 4
Es befindet sich zudem eine Mutter in dieser Klasse, was unterstreicht, dass die Jugendlichen sich in einem Alter befinden, in dem Familiengründung bereits eine Rolle spielt. Die Lehrenden können also bereits die Rolle des Märchenerzählers einnehmen und Befragungen zufolge erzählen sie schon ihren Nichten und Neffen Geschichten. In dem heutigen Computer- und Filmzeitalter finde ich es außerdem wichtig, das kulturelle Erbe der Volkserzählungen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und die allgemeine Bereitschaft des Lesens zu fördern. Aufgrund des hohen pädagogischen Wertes bieten sich Märchen hierfür insbesondere an.
Mein Ziel im Unterricht der Klasse W 12 B ist es, das Kunstmärchen „Der goldne Topf“ von E.T.A Hoffmann zu analysieren, die Merkmale herauszuarbeiten und es im Klassen-verband zu interpretieren. Da jedoch die Lektüre für eine erste Begegnung mit dem KM zu umfangreich ist, wird der „Blonde Eckbert“ von Ludwig Tieck als Einstieg bearbeitet. Hieran werden die wichtigsten KM-Merkmale und Abgrenzungen zum VM herauskristallisiert, um im späteren Verlauf mit der Lektüre frei arbeiten zu können. Dieser Schwerpunkt findet in dieser Arbeit zwar keinerlei Beachtung, jedoch um diese Intention zu erreichen, muss zu Beginn der Unterrichtseinheit eine Basis geschaffen und die Unterschiede zwischen Volks- und Kunstmärchen abgegrenzt werden. Hierzu wurden die Historie, Grundlagen und Zusammenhänge der Märchen im Allgemeinen erarbeitet, was eingangs dieser Arbeit mit einer Begriffsbestimmung theoretisch reflektiert und an-hand des Volksmärchens „Rotkäppchen“ veranschaulicht wird. Im weiteren Verlauf wird die Theorie des Kunstmärchens besprochen und am „Blonden Eckbert“ näher erläutert.
2.DDerBBegriff„„Märchen“2
Bereits die Namensgebung weist auf eine bestimmte Charakterfunktion dieser speziellen Gattung hin, so dass eine Begriffsdefinition vorangestellt werden soll. Abgeleitet wird der Begriff „Märchen“ von dem mittelhochdeutschen Substantiv mære (ausgesprochen: märe), welchesKunde, Erzählung1, Botschaft oder auch „Nachricht von einer geschehenen Sache“bedeutet.2Ergänzt wurde dieses Substantiv im Laufe der Zeit
1http://www.wissen.de - Suchbegriff: Märchen (Anlage 5)
2Rölleke, Heinz: Die Märchen der Gebrüder Grimm: Quellen und Studien: Gesammelte Aufsätze. Trier 2000, S. 2294ebd.
Page 5
Die Folgerung der wörtlichen Ableitungen lässt den Rückschluss zu, dass Märchen ursprünglich mündlich überlieferte Erzählungen sind5und der Weiterverbreitung von Begebenheiten dienen. Diese erscheinen so beachtenswert, dass es ihnen zusteht, über die Grenzen hinaus bekannt zu werden.6Das Bertelsmann Universal Lexikon definiert „Märchen“ als „kurze Prosaerzählungen, die von phantastischen Zuständen und Vorgängen berichten“7.
Da die sprachlichen Wurzeln des Wortgebrauchs bis ins Germanische und Gotische zurück zu verfolgen sind, geht die Forschung davon aus, dass es sich bei dem Märchen um eine der ältesten Erzählformen der Literatur handelt.
Die Durchsetzung des konkreten Gattungsbegriffs erfolgte erst durch Jacob (1785 - 1863) und Wilhelm (1786 - 1859) Grimm, welche die Gattung in drei Typen unterschieden: das Tiermärchen, den Schwank und das so genannte „eigentliche Märchen“, welches nochmals in Volks- und Kunstmärchen gegliedert wird.
Im Folgenden wird zunächst auf das Volksmärchen eingegangen, um im späteren Verlauf die Abgrenzung zum Kunstmärchen ermöglichen zu können. Die anderen zwei Varianten finden sowohl hier als auch in den Unterrichtseinheiten keine weitere Betrachtung.
3.DDasVVolksmärchen3
Märchen9wurden über Jahrhunderte hinweg in Küchen, auf Schiffen und in den Lagern der Soldaten erzählt.10Da lediglich das Volk mit Hilfe seiner Alltagssprache als Erzähler agierte und sein jeweiliges Leben in die Handlung integrierte, werden diese Art der Märchen heutzutage unter dem Begriff „Volksmärchen“ (VM) zusammengefasst und stellen die traditionelle Form des Märchens dar. Dieser Grundsatz wird auch als „romantisches Paradigma“11bezeichnet.
5http://www.wissen.de - Suchbegriff: Märchen (Anlage 5)
6Rölleke 2000, S. 229
7vgl. Bertelsmann Universal Lexikon. Bd. 11, S. 230
9Der Begriff “Märchen” soll im Folgenden zur Vereinfachung innerhalb der abgrenzenden Abschnitte sowohl für das Volks- als auch das Kunstmärchen angewendet werden.
10Pleticha, H (Hg): dtv junior Literatur Lexikon. Sprache, Lebensbilder, literarische Begriffe und Epochen. München 1987, S. 53
11Pöge-Alder, Kathrin: Märchen als mündlich tradierte Erzählungen des Volkes? Frankfurt a.M. 1994, S. 17
Page 6
Anlässlich der verbalen Überlieferungen haben sie keinen bestimmten Autor oder Urheber, selbst Zeit und Ursprung sind (meist) unbekannt.12Sie wurden ab dem 17. Jahrhundert lediglich von Schriftstellern sowie Dichtern gesammelt und letztendlich von ihnen aufgezeichnet.
Welche historischen Entwicklungen diesen Aufzeichnungen vorausgingen, soll anknüpfend nähere Betrachtung finden.
3.1DDieGGeschichteddesVVolksmärchens3
„Soerzählt eine Generation der andern merkwürdige Träume, dabei nehmen diese Träume schärfer umrissenen Gestalten an, und es verliert sich unmerkbar die Erinnerung an ihre Herkunft, man
vergisst, dass es eigentlich Träume sind, die man sich erzählt, dadurch werden die berichteten
Begebenheiten nur noch seltsamer, bis sich endlich die Schöpfung vollendet, die wir Märchen nennen.“13
Auf diese Weise erklärte sich Friedrich von Leyen im Jahr 1901 den Ursprung des Märchens. Fakt ist, dass diese tradierte Gattung uralt ist und zu den ältesten Dichtungen der Menschheit überhaupt gehört. Aufgrund des daraus resultierenden umfangreichen historischen Hintergrundes soll in dieser Ausarbeitung auf den Aspekt der geschichtliche Entwicklung eingegangen werden. Einegenauezeitliche Rückverfolgung ist wegen der fehlenden schriftlichen Überlieferungen so gut wie ausgeschlossen.
3.1.1DDasAAltertum3
Die Wiege der europäischen Märchen steht neben Indien, Griechenland und Rom in Ägypten.14Dort wurden Erzählungen mit märchenähnlichen Abläufen gefunden, deren Motive ebenfalls in den uns bekannten europäischen Märchen aufgegriffen werden. Die auf
12Arnold, Heinz Ludwig / Detering, Heinrich (Hg.): Märchen. In: Grundzüge der Literaturwissenschaft. München 1996, S. 676
13von der Leyen, Friedrich: Traum und Märchen. In „Märchenforschung und Tiefenpsychologie“ hg. v. Wilhelm Laiblin. Darmstadt 1995, S. 2
14http://www.br-online.de/wissen-bildung/collegeradio/medien/deutsch/maerchen/arbeitsblaetter: Arbeitsblatt 4 (Anlage 6)
Page 7
3.1.2DDasMMittelalter3
Über Spanien und Byzanz gelangten die Märchen durch Kreuzfahrten nach Europa.15Das VM „Das Eselein“, bekannt geworden durch die Aufzeichnung der Gebrüder Grimm in ihren „Kinder- und Hausmärchen“ (KHM), lehnt sich an die Übersetzung eines Gedichtes an, welches in verschiedenen Handschriften in Städten von München bis Leningrad vorliegt.16Die weitflächige Verbreitung untermauert die individuellen Überlieferungen der Völker und sein Ausgangspunkt lässt sich bis in die Römerzeit zurückverfolgen. Alte indische Nachweise erzählen von Jünglingen aus gutem Hause, welche in Tiere verwandelt wurden und ihre menschliche Gestalt auf die gleiche Weise versuchen zurück zu gewinnen wie der Prinz in dem Märchen „Das Eselein“.17
3.1.3DDieRRenaissance3
Das 16. Jahrhundert liefert weitaus mehr historischen Hintergrund. Verschiedene Aschenbrödelvarianten in Deutschland, Frankreich und Portugal weisen auf die sichtliche Existenz und weite Verbreitung der VM im europäischen Raum hin. Das Erscheinen der „Ergötzlichen Nächte“ von Giovanni Francesco Straparola (1480-1558), eine Sammlung von 73, aus mündlichen Überlieferungen stammenden Erzählungen, kann als erstes Ereignis in der Geschichte des VM bezeichnet werden. In diesem Band befinden sich unter den zusammengetragenen 21 Märchen bekannte Geschichten, die ihren Weg in die KHM gefunden haben, wie beispielsweise „Der gestiefelte Kater“ oder „Der Meisterdieb“.18
Im Jahr 1557 sammelte der Dichter Martin Montanus auf seinen Wanderungen zum Zeitvertreib Schwänke und nannte aufgrund des Beweggrundes seine niedergeschriebene Zusammenstellung „Schwankbuch Wegkürzer“. Eine der beliebtesten Erzählungen hieraus ist „Das tapfere Schneiderlein“.19
15ebd.
16ebd.
17ebd.
18ebd.
19ebd.
Page 8
Im Barock trug vor allem die italienische Literatur mit dem „Pentamerone“ (Das Fünftagewerk) von Giambattista Basile (1575-1632) zum Erhalt des Volksmärchens bei.20Es ist anzunehmen, dass Basile durch mündliche Überlieferungen Kenntnis von den Geschichten erlangte und sie später, durchsetzt von typisch barocken Wortvariationen, Allegorien und Schnörkeln nicht nur weitererzählte, sondern auch niederschrieb. In den Märchen des Pentameron finden sich Parallelen zu „Tischlein deck dich“, „Der gestiefelte Kater“ und „Schneewittchen“.
Als Beweis für die Existenz von deutschen Märchen gilt die Erzählung des „Bärenhäuters“ in den „Simplicianischen Schriften“ von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1622 - 1676).
Einer der bekanntesten französischen Dichter des Barocks war Charles Perrault (1628 -1703). Er besuchte die besten Schulen, studierte Jura, war als Anwalt tätig und beaufsichtigte letzten Endes die königlichen Bauten Louis’ XIV.21Durch das „Pentamerone“ von Basile zum Schreiben inspiriert, verfasste er die „Märchen für Erwachsene“ („Contes de ma mère l´Oye") und publizierte sie 1697. In dieser Sammlung griff er bekannte VM wie beispielsweise „Dornröschen“, Rotkäppchen“, „Der gestiefelte Kater“, „Frau Holle“ und „Aschenputtel“ erneut auf.22





























