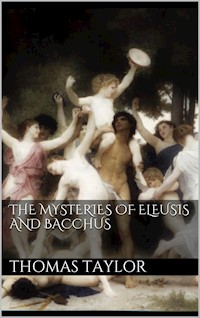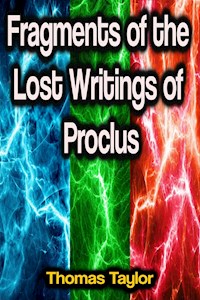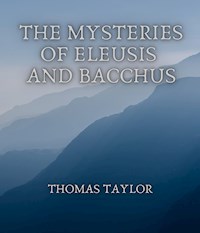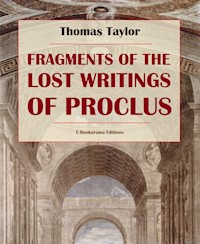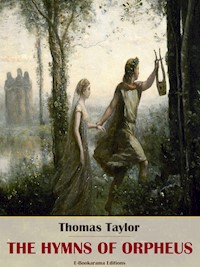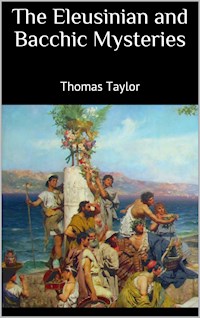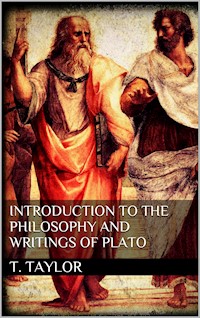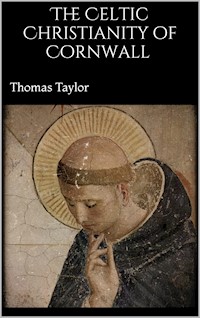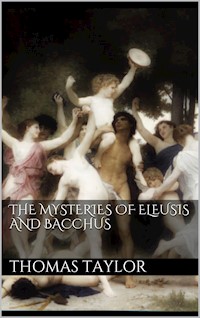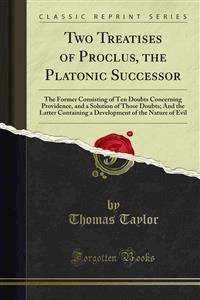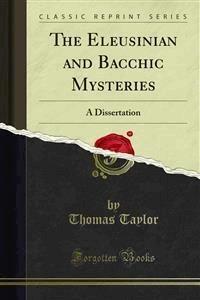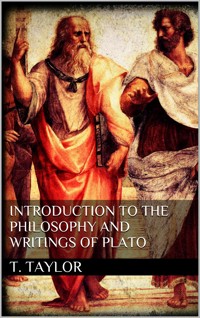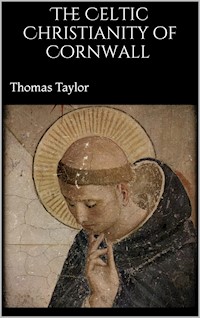Das Vollkommene Leben. Ein hermeneutischer– amerikanischer Gesellschaftskrimi für Germanisten. E-Book
Thomas Taylor
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der wahre Standort der Philosophie besteht nicht in der Begründung, wohl aber in der Entgründung. Besagte Begründung erfolgt durch den Versuch, das Denken durch den Gegenstand des Denkens zu ersetzen, wobei zweierlei herbeigeführt wird: Die erhabene Unergründlichkeit des Denkens wird übersehen oder verdrängt; zweitens wird obendrein dem jeweiligen Denkgegenstand ein inhalt- und sinnstiftender, daseinsbestimmender ästhetischer Inhalt beigefügt bzw. angedichtet. Dieser Vorgang, in einen gesellschaftlichen Zusammenhang gesetzt, führt letztendlich zu einer ungezügelten, sprich zerstörerischen Erhabenheitsvorstellung. Das Vorliegende handelt eben von den Folgen, die eintreten, wenn das Denken vermeintlich abdenkt, abdankt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Sophia
Impressum
Das Vollkommene Leben.
Ein hermeneutischer–amerikanischer Gesellschaftskrimi für Germanisten.
T. Alfred Taylor
Copyright: © 2014 T. Alfred Taylor
published by: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
ISBN 978-3-7375-3241-9
Inhaltsverzeichnis
Das Vollkommene Leben
Ein hermeneutischer–amerikanischer Gesellschaftskrimi für Germanisten
Von T. Alfred Taylor
Kapitel 1 – Phoenix, Arizona 1992
Meine Veranda geht auf die Weite der menschenleeren Wüste Arizonas hinaus. Als ich am frühen Morgen – viel früher als sonst – aufstand und wie gewohnt als erstes am Tag die Veranda betrat, um kurz den Ausblick zu genießen, wurde ich von neuem von der wohltuenden Vermengung und Bilanz der sich bietenden, erhaben tief in den Horizont hineindringenden augenmaßtrotzenden Aussicht erfaßt. In weiter Ferne verstreute, steilwändige Hügel warfen dunkle langgezogen Schatten, die sich gestochen scharf von dem blendend sonnenbeschienen, in Grau und Rot getauchten Flachland abhob. Der sich aus dem Überblick heraus ergebenden kristallen stillen Starre der weitläufigen Umgegend stand ahnungsweise, in einer den Sinnen zu vermittelnden Nähe, das wachende Regen und Rühren kleinster Lebewesen entgegen, von denen es an der Zahl und Gattungsvielfalt überraschend in Hülle und Fülle gibt. Überraschend, weil, wenn die meisten an eine Landschaft denken, der die Bezeichnung, “Wüste” zugewiesen ist, ihnen in der Regel gleich das Bild durchgängig wehender Sanddünnen, jäher und gefährlicher Temperaturschwankungen, allgemein dem Leben unwirtliche Verhältnisse in den Sinn kommt. Dieser Begriff, Wüste, ist jedoch in seiner tatsächlichen Anwendung ein breiter, ein Sammelbegriff, der, eben weil er eigentlich keine verbindliche Vorstellung übermittelt, nun einmal salopp verwendet werden kann. Er unterzieht sich in vielen Fällen erst im Erlebnis, in selbstgemachter Erfahrung einer festen bedeutsamen Präzisierung, die wohl des öfteren herzlich wenig mit der zur Metapher gewordenen Gleichsetzung von Wüste mit Lebensleere zu tun hätte. Denn unbeirrt hier, in meiner Wahlheimat, den Uneingeweihten wahrscheinlich wider aller Erwarten, zeigt sich nicht nur das pralle Bestehen gedeihenden Lebens, wohl aber auch, da die Bedingungen eingestandenermaßen schwer sind und wenig einladend wirken, die bewundernswerte, dazugehörige Zähigkeit von alledem, was sich Wurzeln fassend oder kreuchend und fleuchend behauptet. Gleichwohl um sie alle zu sehen ist mitunter ein geduldiges, geschultes Auge erforderlich, denn der abweisend hartsteinige, rauh–karge zerklüftete Boden bietet den meisten, ohnehin gut getarnten Tierarten reichlich Verstecksgelegenheiten, die unweigerlich wahrzunehmen, nun ein Gebot der Natur zu sein scheint. In der um diese Tageszeit meist vorherrschenden Windstille, und da es noch zu früh für das Einsetzen der Verkehrsstoßzeit war, waren von der sämtlichen motorisierten Verkehrswegen abgewandten Rückfront des Bungalows nur noch das lieblich leise zwitschernde Stakkato etlicher, ihre Wege wohlwissend und muntergeschäftig begehenden Vogelarten sowie einen gelegentlichen, sanften, das Ohr anhauchenden Luftzug zu vernehmen. Zu dieser Jahreszeit, im Frühlenz, kurz nach der Morgendämmerung, ist es für gewöhnlich recht kühl, den Übergang aufzeigend von einer Nacht, die ihrer Kälte wegen ohne Schutz nicht zu vertragen ist, zu dem Tag, dessen zeitweilig übermäßige Wärme Vorsicht gebietet. Meinem Dafürhalten nach ist diese Witterung der idealste und lieblichste Klimazustand, der die Arizona–Natur, und ich nehme an, wohl auch jedes Wüstengebiet überhaupt dem Menschen zuteil werden lassen kann. Da hat man Abwechselung im Maße, im Rahmen erträglicher Extreme, und zwar in einer Kulisse, die die Seltenheit und eben deswegen die Kostbarkeit eines wahren, das heißt unbekümmerten, unversiegbaren und unbezwingbaren, ja eigentlich geradezu beneidenswerten Lebenswillens unterstreichen und würdigen läßt. Es ist schön, die Natur selbstbetätigend, eine Mitte für uns heraufbeschwörend zu erleben, ein Wohlgefühl, das vorhält, solange man nicht zu viele Fragen stellt. Denn diese Mitte ist sowohl eine erfreuliche als auch vornehmlich im Grunde eine zufällige, wofür man überhaupt nichts kann.
Der Grund, warum ich mich fast tagtäglich in dieser zu einem festen Ritual gewordenen Gewohnheit ergehe, ist, mich einfach von den Größenverhältnissen der Wüste lästig kleinliche Sorgen zerstreuend und verscheuchend ergreifen zu lassen. Das wird mir bestimmt den Vorwurf ein hoffnungsloser Romantiker zu sein einhandeln. Und ich gebe es gerne zu, aber das ändert nichts an der realen Erfahrung, daß die meisten vernünftigen Menschen eines gewissen Maßes bedürfen, auf eine Ausgewogenheit der Dimensionen ihrer wahrnehmbaren Welt angewiesen sind, wie uns Goethe dies belehrte und vorlebte, und der bekanntlich, oder eher der eigenen Aussage nach keine romantischen Flausen im Kopf gehegt habe.
Wie dem auch sei, an jenem Morgen verfehlte das morgige Ritual die erhoffte Wirkung, denn statt zeitweilig vollends in dem Anblick der Wüste aufzugehen, war ich eher von gänzlich anderweitigen Anliegen beansprucht, dadurch von gespaltenen Gefühlen erfüllt. An dem Morgen, nämlich, sollte ich nach Los Angeles fliegen, was schon an sich eine garstige Sache ist – verzeihen Sie mir meine Vorurteile, aber die Stadt ist meines festen Erachtens der Nährboden ausfallendster kultureller Auswüchse, Spitzenreiter in der Erzeugung all dessen, was unfugmäßig im Namen der Freiheit geschehen könnte. Was ich daran jedoch am meisten ärgerlich finde, ist daß sein Einfluß weltweit zu spüren ist, und somit zum Teil auch der Vorbote des noch auf uns alle Zukommenden, insofern wir alle mehr oder minder, aber insgesamt zunehmend erfolgreich Freiheit und Zwanglosigkeit anstreben, und diese dort in nie dagewesenem Ausmaß erreicht sind. Daß Los Angeles dadurch, was es an Freiheitsbegriffen vertritt sowie, was es an Weltheilern und Menschheitsbeglückern bis hin zu den Ikonen der “Popkultur” hervorbringt, zum Vorbild genommen wird, zum Ziel und zur Kulisse so vieler Träume avancieren konnte, ist eingestandnermaßen nicht ganz gewollt noch selbstverschuldet. Denn Los Angeles ist für die Einwohnerschaft der Nabel der Welt und kümmert sich wenig um die Begebnisse und Geschehnisse im übrigen Erdball, vorausgesetzt betreffende Einwohnerschaft sich der Existenz einer wirklichen übrigen Welt, die mehr als Filmkulisse dienen könnte, überhaupt noch bewußt ist.
Daß die Hochburg nervtötender Banalität, die Heimat schell– und kurzlebiger Moden und bahnbrechender Lebenswandel, die alle auf zwei Punkte gebracht auf witzlose Sinnlichkeit und unbedarfte Selbstdarstellung hinauslaufen, zur Leuchte am geistigen Horizont von eigentlich gescheiten Leuten aufsteigen konnte, geht über meine leider bescheidenen Begriffe, zumal noch in Rechnung gestellt wird, daß dieser geistigen Ödnis offenkundig und allbekannt eine ungehemmte Geldjagd zugrunde liegt. Sollte dabei ein Erfolg eintreten, dann will er raschstens und möglichst auffällig, sprich geschmacklos zur Schau gestellt werden. Ich will nicht ungerecht sein, es gibt in dieser Stadt genug nette beständige Leute, ohne die die Stadt schon längst zugrunde gegangen wäre. Aber wie jeder weiß, der etwa für eine Vorlesung oder Unterrichtsstunde vor einer Gruppe von Studenten gestanden hat, es entwickelt sich oft in einer Menschenansammlung eine kollektive Persönlichkeit, die nicht im geringsten mit der Wesensart oder Eigenart auch nur eines der Teilnehmenden zu tun hat. Dieses Phänomen auf eine Stadt bezogen bestimmt nicht zum geringen Teil die vorherrschende Stimmung, den genius loci der Stadt, in dessen Bildung die Anständigen in diesem Fall als langweilig geltend nicht übermäßig ins Gewicht fallen. Das x–beliebig gestaltet Tonangebende von Los Angeles wird nur von dem einen, von der gerade in Mode geltenden Art des Arriviertseins getragen und beflügelt, dem allemal Geld bzw. die dadurch ermöglichte, zum Idealismus hochstilisierte Freiheit unterliegt. Denn im Grunde, wie es dort im Volksmund so schön schnöde heißt: Money talks, shit walks. Nirgends sonst steht das Leben derart nackt da bar allgemein zwingender Wertvorstellungen oder zum Handeln und Denken richtunggebender verbindlicher Traditionen oder gemeinschaftlichen Rückhalt gewährender Glaubenszwänge.
Und sollte in der Stadt das Einzelwesen doch eine vorgezeichnete bindende Ordnung vermissen und die überzogene Freiheitspflege als Haltlosigkeit empfinden, das Ausbleiben einer vorgegebenen, tatsächlich erstrebenwerten Lebensrichtung als Manko auffassen, dann läßt sich der Mißstand künstlich, in einträchtiger Übereinstimmung mit vielen anderen Lebensaspekten der Stadt, abstellen. Die Lösung vollzieht sich im Extremfall in der Form von entsprechend extremem, religiösem Gehalt für sich beanspruchenden, Zusammenhalt sowie Zusammengehörigkeit bietenden Gruppierungen, von Sekten, denen man sich restlos unterwirft, mit den bekannten, oft zu beklagenden Resultaten. Wenn Freiheit zu einem Problem wird, macht man sich aus freien Stücken eben unfrei zugunsten der Zucht und Zwangsordnung im Namen einer von einem Anführer angepriesenen Sache fast immer beliebigen gedanklichen, eben der Substanz reiner Freiheit passenden Inhalts. Damit ist die oft zu beobachtende Erscheinung wohl erklärt, wieso es im Allgemeinen keine auch nur widersinnige Sache gibt, für die sich Verfechter und Mitstreiter nicht auftreiben lassen, wobei je inhaltloser die Sache je ausgeprägter die Geschlossenheit und umso glühender der den besagten Mangel ausgleichende Eifer der Anhänger, wobei desto unerreichbarer wird die bewußte Gehaltlosigkeit umgewandelt in die Gestalt eines wohlbehüteten Mysteriums. Wenn Marx in einem Punkt Recht behielt, so wird es wohl in der Beobachtung gewesen sein, daß die Zivilgesellschaft infolge der in ihr verbrieften bürgerlichen Rechte den Samen des eigenen Untergangs in sich berge. Wenn dem so ist, so liefert uns die Stadt der Engel alles in allem reineweg bestürzend weitaus weniger als erfreuliche Botschaften des Künftigen.
Dem Drückenden des Stadtbildes hinzukommend soll ich diese Reise antreten – der Hauptgrund meines Mißmutes – in einem höchst unerfreulichen Auftrag. Ich wollte und pflichtgemäß mußte als Leumundszeuge vor einem Universitätsgericht auftreten zur Verteidigung eines meiner ehemaligen Studenten. Ein Ortswechsel, ein liebsameres Reiseziel hätte allenfalls wenig dazu gekonnt, das bevorstehende Unternehmen zu versüßen.
Ich sage unerfreulich, weil ich von vornherein wußte, daß der Fall aussichtslos war. Der Student, dessen Leistung, Fähigkeiten und guten Charakter ich zu bescheinigen aufgerufen werden sollte, hat wahrscheinlich nichts weiter verbrochen als nach seinem Abgang bei uns weiterhin eine überdurchschnittliche Leistung zu erbringen. Mit Schiller zu reden, ist es vergebens nicht nur mit der Dummheit zu kämpfen, wohl aber auch mit jeder Art wesensbehafteter Unzulänglichkeit, in diesem Fall mit ungezügelt überbordend empfindlicher Eitelkeit. Hier leistet Nietzsche Schiller nicht wenig Schützenhilfe: “... daß jeder Mann so viel Eitelkeit hat, als ihm an Verstande fehlt”. Ging es da zu nach dem die Wirklichkeit entstellenden Prinzip: Eitelkeit macht dumm, und noch mehr Eitelkeit macht bei gesteigertem Realitätsverlust störrisch–dämlich? Die Antwort sei für jetzt dahingestellt. Was fest bleibt, ist, wie ein Student sich zu gehaben habe. Denn Regel Nummer eins für jeden Studenten im Universitätsbetrieb, vor allem in den schwammigen Geisteswissenschaften lautet schlicht und einfach, stelle deinen Doktorvater nie und auf keinerlei Weise in den Schatten, stimme allen Ansichten, zumal politischen zu, bringe ihn bzw. sie nie auch nur entfernt in Verlegenheit oder in sonstige das herrliche, mühsam konstruierte Selbsterscheinungsbild zersetzende Schwulitäten. Um dafür zu sorgen, daß das heikle Professor–Doktorand–Verhältnis reibungslos abliefe, müßte das Kunststück erbracht werden, daß man überzeugend scharwenzele, das heißt, daß man sich nun einmal uneingeschränkt dienstbeflissen dem Professor gegenüber gibt und dabei unverschämt natürlich wirke. Es ist nicht klar, ob oder inwiefern der Student sich tatsächlich hat etwas zuschulden kommen lassen, es kommt nun einmal auf den (eingebildeten?) Eindruck an, der peinlichst gepflegt werden will. Die Folge der Mißachtung oder etwa der unumsichtigen Nicht–Strengbefolgung dieser Regel war, daß unserem Studenten finanzielle Unterstützung entzogen wurde, die Benotung seiner Arbeit postwendend in den Keller fiel, und daß er ansonsten nach Strich und Faden schikaniert wurde, was zu einer formellen Klage führte, was wiederum, doch absehbar, Repressalien, eine massive, zuweilen gar unflätige Verleumdungskampagne gegen den Studenten nach sich zog.
Der Student tat mir leid, aber die Professoren boten einen noch traurigeren Anblick. Da haben gar Professoren, die sich bis aufs Blut gehaßt und seit Jahren kein Wort mehr miteinander gewechselt hatten, zu der restlosen Wiederherstellung einer nach allen Seiten fest abgedichteten Eintracht in der (Deutsch)Abteilung gefunden. Gegenseitige Bewunderung gar feierte fröhliche Urständ. Es ist schon erstaunlich wie schnell und gründlich, sich langjähriger, vorgeblich auf Prinzipien fußender Groll und Mißmut ablegen läßt, wenn nun einmal gewittert wird, daß auch nur die geringste, das ist, die Pfründe nicht einmal gefährdende Bedrohung von außerhalb im Anzug sei. Daß es soweit kommen würde, war dem Studenten wohl bewußt, denn die Abteilung setzte sich durch die Bank aus kleinbürgerlichen europäischen Strebern zusammen, die nach ihrer Ankunft in Amerika ihr der amerikanischen Kultur vermeintlich überlegenes Europäertum vorschiebend rechthaberisch und machtbewußt auftretend sowie eine merkwürdige biologische Wandlung durchmachend ungeheuer große Ellbogen entwickelten. Bewußte Überlegenheit äußerte sich zumeist darin, daß man gegen Spießer wetterte – leider gibt es nichts Spießbürgerlicheres und Verspießerteres als einen Deutschen, der eben dies zum Lebensinhalt macht. Es ist den meisten vernünftigen Leuten wohlbekannt, daß jeder Anlauf auf Vergangenheits- und Abkunftsverleugnung, wie die Amis es formulieren, eine Übung in Vergeblichkeit, wie die Deutschen, verlorene Liebesmüh’ ist, nur ihnen, den lieben und gescheiten Herren Professoren ist diese fundamentale Erkenntnis entgangen. Tu, was man will, eine klein angelegte Herkunft läßt, wenn man groß auftreten will, unverkennbare Spuren an Geschmacksirrungen und Ressentiments zurück, die nicht verwischt noch verheimlicht werden können. Ich habe meinen Militärdienst bei den Amis geleistet, wo es so zutreffend hieß: “You can’t shine shit”, in diesem Fall nicht einmal mit Doktortiteln. Allesamt unangenehmes Gesindel waren diese mit Doktor– und Professortiteln ausgeschmückten Hanswürstchen, deren Mangel an wahrer Erziehung, geschweige denn ihr unangemessenes Auftreten ihrer Bereitschaft, sich unehrlich verbohrt und dummdreist zu Durchsetzungszwecken anzustellen, keinen Abbruch tat. Hauptsache ist, daß man gewinnt, koste es, was es wolle, auch wenn man sich dabei bodenlos blamiert. Es wird gesagt, daß Dankbarkeit keine politische Kategorie sei, aber wenn die nur lose mit Professor zu Titulierenden sich überlegten, daß Amerika sie vor einer Karriere als Volkschullehrer, der zwar ein ehrenhafter Beruf ist, aber damit läßt sich leider in des Strebers Sinne kein Staat machen, bewahrt hat, hätten sie das Einsehen gewinnen können, daß diesem Land auf angebrachtere Weise zu vergelten war, als ausgerechnet hier, der Ort, dem sie soviel zu verdanken haben, solch peinlich, meinen Beruf in Verruf bringenden, übelriechenden Mist zu bauen. Anderes war aber eigentlich nicht zu erwarten, denn: “Pöbel hört nicht auf, Pöbel zu sein, und wenn Sonne und Mond sich wandeln.” Die vorliegende Sache war Schillers Sinn fürs Dramatische in diesem Fall gleichwohl aufgrund der mitspielenden zwerghaften Gestalten nicht gewachsen. Denn auch unter dem Pöbel treten nicht selten gewisse Tugenden zutage – jeder Mensch, der viel herumgekommen ist, kann da mit Beispielen von Mut, Großmut und Großzügigkeit aufwarten. Und das ist genau, was den in Frage kommenden akademischen Windbeuteln vorzuwerfen war: Sie waren darauf und daran, bar jeglichen Einsatzes von Tugend den Sieg davon zu tragen. Im Gegenteil: da sollte eine ausgesprochene Neigung zu Untugenden in der Form von heimlichen Absprachen, Klüngeleien und Kungeleien zur vollen Geltung kommen. Auch die kleinstdosierte Tugend kann hierbei einem durchaus in die Quere kommen.
Daß ich der Aufforderung des Studenten nachkam, lag daran, daß ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen wollte, den am Rufmord schadenfröhlich wichtigtuerisch beteiligten Professoren zumindest ein Schlägchen ins Gesicht zu verpassen, und daß ihre Seilschaft vielleicht einen kleinen Riß abbekam. Darüber hinaus habe ich mir nicht viel versprochen. Denn bewußte Professoren saßen fest im Sattel, waren beamtet, sprich unschassbar, was ihnen die Führung eines unendlichen Zermürbungskrieges ermöglichte, zu dessen gelungener Durchführung Freiheit kein Hindernis war. Dies war ein Kampf, dessen Ausgang bereits zu Beginn eine ausgemachte Sache war, weil er auch noch von der Zunft zugehörigen Kollegen und Zeitgenossen aus anderen Universitätsabteilungen im Akademischen Senat bestimmt werden sollte. Wie heißt das bei Bernard Shaw? “Jeder Beruf ist eine Verschwörung gegen die Öffentlichkeit”, oder so Ähnliches, was man wohl auch von jeder Gruppierung sagen kann, vor allem wenn durch ein Bedürfnis nach einem Zusammengehörigkeitsgefühl gesteigert eine Suche nach “Identität” losgetreten wird. Nur die Hohlen und Leeren, das heißt nun letzten Endes die Schwachen brauchen nun einmal eine Identität irgendwo aufgeklebt, und die moralisch Schwachen mögen je nach dem Geschmack des jeweiligen Beobachters verächtlich oder mitleidenswert sein, sind aber zu jeder Zeit ungleich hinterhältig gefährlicher als ihre anderweitig und sinnvoller geistig gesonnenen und dementsprechend beschäftigten Zeitgenossen.
Nicht nur die Ansatzbedingungen der Klage litten unter Schlagseite zuungunsten des Studenten, sondern auch die möglichen Ergebnisse und Folgen für beide Parteien lagen schief. Wie oben erwähnt, die Professoren bewegten sich in uneingeschränkter Freiheit und Unverwundbarkeit, für den Studenten stand alles, seine Existenz auf dem Spiel. Und eben aus diesem Grund kämpften sie, auch noch mit kostenloser Rechtsvertretung bestückt, so unerbittlich verbissen, eben weil für sie sowenig außer ihrer Eitelkeit auf dem Spiel stand. Das Bewußtsein, daß man gut verschanzt, rundum gedeckt und von oben herab eine Existenz mit einem Federstrich zunichte machen kann, muß nachgerade ein berauschendes sein. Das merkte man unter anderem an ihrer überzogenen selbstzufriedenen Betulichkeit. Um dem Vorwurf zu entgehen, daß die Mannsbilder darunter elfenbeinturmnaiv seien und einen unmännlichen Beruf gewählt hätten, legten sie eine forsche Bereitwilligkeit zur Gemeinheit an den Tag. Denn, wer die Fähigkeit dazu klipp und klar aufweist, kann gar nicht naiv sein, oder? Natürlich sind nicht alle sich mit Literatur und Philosophie, Kunst und Musik sich befassenden akademischen Einrichtungen mit derlei Personal belegt. Aber in einer kleinen, hermetisch abgeschotteten Welt, um die sich sonst keine Sau kümmert – ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn heute die ganze Deutschabteilung mit Maus und Mann restlos in irgendeiner Versenkung verschwände, würde dies morgen nicht direkt Betroffenen nicht im geringsten auffallen, geschweige denn unbedingt Aufsehen erregen – findet man allzu oft einen festen, bürokratisch abgesicherten Unterbau für jegliches Tun und Lassen und damit reichen Anlaß für eine maßlos positiv–schmeichelhafte Selbstschätzung, die einer auftrumpfenden Wichtigtuerei weichend und pompöses Gewese fördernd sich nicht von einer unabhängigen obwaltenden Realität bremsen läßt. Da täuscht man aus dem Nichts ein unanfechtbares Sein vor, und wenn dem tatsächlich so sei, muß nun das weitere Treiben im einzelnen glattweg unmotiviert, d.h. nichtig wirken. Wie der gute alte Hegel hinwies: Das reine Seyn ist eben nichts.
Man möge hier einwenden, daß eine die Professoren bestätigende Instanz von außerhalb doch vorhanden war. Denn da hat auch ein Gastprofessor den besagten werten Professoren beim auf der sanften Tour begangenen Meuchelmord des Betroffenen durchaus nützliche Schützenhilfe geleistet. Das war ein Mensch, den ich zwar nur im Vorbeigehen erlebt habe, aber auch flüchtigerweise ließ er es sich nicht entgehen, seinen markanten Mangel an Schliff zu erkennen zu geben. Gleich zu Gleich gesellt sich eben liebend gern. Also doch: trotz auswärtigen Besuchs aus dem Norden Deutschlands, lag nichtsdestominder ein geschlossener gesinnungsbedingter Kreis unversehrt vor. Erst im Kampf zeigt sich das wahre Wesen, im Wofür, Warum und Worum, aber zumal im Wie.
Da wird man sich wohl gewundert haben, wie ich anno dazumal als Student durch diese Klippen laviert habe. Die Antwort: Reines Glück, daß ich schon in älteren Jahren auf ein Germanistikstudium umgestiegen bin, hat nichts geschadet, aber auch, daß die Deutschen, mit denen ich zu tun gehabt habe, aus der alten, jetzt fast ausgestorbenen Schule und absolut integer waren. Die haben es fertiggebracht, daß unliebsame Zusammenrottungen und verschwörerische Kumpaneien in Keim erstickt wurden, wenn ich selber zeitweise etwas aneckte. Hätte es sie nicht gegeben... wer weiß, wo ich gelandet wäre? Im akademischen Bereich, wo der Mensch nicht zweckmäßig mäßigenden Zwängen unterworfen ist, zeigt sich allzu oft die eigentliche raubtierische Fratze von den allseitig anzutreffenden Ottilia und Otto Normalverbrauchers. Da erhebt sich nur noch die Frage, um was für Raubtiere es sich dort handelt, die da so ungehemmt tummeln? Antwort: alles was sich vorstellen läßt: ideologische Raubtiere, karrierelechzende, politische d.h. gern Ränke schmiedende, Egoraubtiere, sexuelle, und, und, und… Weitere Frage: Wer war der Doktorvater vom lieben Gott?
Die Wüste war vergessen, zumindest die richtige. Ich spähte ein letztes Mal in die von mir liebgewonnene Arizona–Wüste, ohne daß sie sich auf mich auswirkte, drehte mich um und ging in die Küche, um Kaffee aufzusetzen. Während der Kaffee kochte, sah mich in meiner spärlich und spartanisch, jeglichem Hagestolz zur Ehre gereichend eingerichteten Wohnung um, faßte den Vorsatz, irgendwann mal wieder für Ordnung zu sorgen. Nicht, daß ich von Haus aus unordentlich bin, sondern daß einem zur Verfügung stehende Zeit zu eng bemessen ist, hat an dem beklagenswerten Zustand schuld. Zwischen Konferenzen und Sitzungen, Büro– und Lehrstunden sowie dem Abfassen von zu veröffentlichenden Artikeln und Buchbesprechungen blieb nicht viel Zeit übrig für sonstig Zweitrangiges. Ich hielt damals Ordnung im Großen für wichtiger denn Ordnung im Kleinen. Letztere ergebe sich irgendwann von selbst, und wenn nicht, dann sei die Schadensbegrenzung auf übersichtliche Weise zu handhaben.
Ich holte aus meiner Schreibstube meine Zigaretten, um, einem festen Entschluß folgend, auf Vorrat meinem mir liebgewordenen Laster tüchtig zu frönen, und das heißt mich beim Kaffeetrinken satt zu schmauchen. Die Aussicht auf einen Aufenthalt in Kalifornien, in dem Land des außer Rand und Band geratenen Kokainkonsums aber dafür des unbegrenzten Rauchverbotes, tat nun ein Übriges, meine ohnehin gedämpfte Stimmung noch ärger zu vermiesen.
Beim Kaffee wendeten sich meine Gedanken wieder zu der bevorstehenden Aufgabe. Ich meine damit nicht meine Lehrtätigkeit als Professor für deutsche Literatur, wo der stillschweigende Auftrag im Grunde heißt, gegen Unwissenheit und Stumpfsinnigkeit ankämpfen, auch wenn die Studenten unwillig oder aber auch geradezu unfähig sind, sondern an die Gerichtsverhandlung und deren Notwendigkeit. Diese Notwendigkeit stellte den Wert und die Erfüllung des ersten Auftrages gründlich und konsequent in Frage und machte ihn dadurch umso kräftezehrend schwerer und aussichtsloser. Denn der volle Auftrag lautet, beseitige die Unwissenheit und ein besserer, stärkerer, anstandsbewußterer Mensch werde sich da schon entpuppen. Sie halten mich wohl für blauäugig, wenn ich sage, daß ich an diesen Grundsatz glauben will. Gleichwohl, daß große herrliche Literatur, mit der die Professoren, mit denen ich mich demnächst würde herumschlagen müssen, bestens vertraut sind, sowenig Wirkung, Niederschlag in deren persönlichem Denken und Verhalten zeigte, wirft die alte sokratische Fragestellung erneut auf, wo die Grenze der Erziehbarkeit des Menschen läge, ob Weisheit oder auch nur ihre niederen Erscheinungsweisen wie Aufrichtigkeit und Höflichkeit überhaupt vermittelbar sei. Ich befürchte, daß die Frage, in diesem Fall wenigstens, entschieden mit einem schallenden Nein beantwortet werden muß. Diese Erkenntnis, daß Bildung nicht unbedingt bildet, ist natürlich nichts Neues und fand ihre extremste Erscheinungsform während des zweiten Krieges in bestimmten Konzentrationslagern mit hauseigenen Orchestern – der Sträfling, der an einem Tag Brahms zum Ergötzen der Henker spielen durfte, hat nicht selten tags darauf durch die von ihm soeben Muntergemachten sein Leben lassen müssen. Bösewichter haben also doch durchaus ihre Lieder und beides muß nicht nur irgendwie zusammenpassen, sondern kann auch sich gegenseitig bedingen.
Aber es wird sowieso herzlich wenig aus der Geschichte gelernt, wenn man bedenkt, daß so gut wie kein Opfer des Zweiten Weltkrieges, das sich nicht später bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit als Täter gemausert und stehenden Fußes die eigene Befähigung und Berufung, selber Grausamkeiten und Frevel zu begehen, durchaus überzeugend unter Beweis gestellt hat. Werfen Sie mal einen Blick auf die Nachkriegsgeschichte kurz davor Niedergeworfener und Besetzter, also die Geschichte Belgiens, Frankreichs, Hollands und so fort und so weiter. Es mag sein, die Grundvoraussetzung zu einem sittlichen Bewußtsein reicht weiter zurück als bloß geschichtliche Erkenntnis, oder tiefer, zu vielleicht etwas Angeborenem. Wissen Sie noch, was Stifter Stephan Murai in Brigitte darüber sagen läßt, was ihn von der Laufbahn als Professor abbrachte? Nicht jeder kommt auf die Welt mit der einschlägig ausschlaggebenden Ausstattung, das heißt mit einem großen Herzen. Das Wissen hat offenkundig einen zweifelhaften Wert. Aber ich schweife ab und daher breche ich auch ab, zumal ich durchaus nicht so verstanden werden will, als einer unter denen, die Gerechtigkeit in der Welt erwarten und sich über historische Missetaten empören, als hätten sie in der jeweiligen, unbeirrt Gerechtigkeitssinn fordernden Lage selbstverständlich mutiger und ehrenhafter gehandelt. Enttäuscht zu sein in derlei an andere gestellten Erwartungen signalisiert in der Gegenwart zumeist ein abwartendes Verhalten, das letztendlich wegen der darin enthaltenen, verleitend verlogenen, eitlen Selbstüberschätzung die Einschränkung, die bedingte Bereitschaft besagt, das Gute nur dann zu tun, solange die anderen auch gut sind.
Ich verlange keine Gerechtigkeit, denn, was noch hinter Gerechtigkeitserwartungen steckt, ist ein Mangel an Vorstellungskraft, die selbstverständliche Annahme, daß das Universum (allenfalls durch irgend etwas noch Unbekanntes, nichtsdestotrotz Wirksames) so ordentlich konstruiert worden sei, daß es für eine auch immer aufgefaßte Gerechtigkeit, für ihre Entstehung, überhaupt für den Begriff schlechthin gesorgt sei. Mit dem vorrückenden Alter lernt man, oder es wird einem zunehmend vergegenwärtigt, daß nichts aber auch gar nichts auf dieser Welt und in dem Universum selbstverständlich ist. Und Empörung, vor allem offen zu Tage getragene, lauthals vorgetragene Empörung ein Zeichen dafür ist, daß man aufgrund mangelnder Einbildungskraft nicht weiß, worin man eigentlich verstrickt ist. Denn, daß man sich mit Empörung auf eine mitgemeinte Ordnung stützt, die es gar nicht geben muß, sich also auf die weiter gefaßte Annahme beruft, daß irgendwo eine vorgezeichnete, fest verankerte, für alle verbindliche, unserer aller Seele in Wohlgefallen sich auflösende, endgültig zufriedenstellende, kurzum vollkommene Daseinsgestaltung irgendwo unumstritten Bestand habe und dies auch noch irgendwie heraufzubeschwören sei, zu deren Verwirklichung und Erfüllung Gerechtigkeit als ein unentbehrliches Mittel ausgeübt werden müsse. Dem Leben wird von denen das Meiste abverlangt, die davon am wenigsten verstehen, ausgerechnet dies, in einem Maß, daß einem die Augen richtig übergehen.
Es gibt aber keine Einrichtung, Unternehmung oder Daseinsvorstellung, die sich nicht vor unseren wachen Augen auflösend “von Klippe zu Klippe” in tiefe Abgründe zu stürzen droht. Und da hilft Gott nichts, auch der fromme Meister Eckhart vermochte keinen Gott aufzufassen, der das eigene Sein rechtfertigen konnte und darauf hin das Sorgekind, den Menschen erfunden habe, um eben in der Sorge um den Menschen aufzugehen. Sollten in diesem Sinne Gedanken über die Beschaffenheit der Welt einmal Fuß fassen, kommt man davon zuweilen nie ganz wieder weg. Was ich davon in meinem späteren Denken bewußt beibehalten habe, ist eben, daß Gerechtigkeit kein Endzweck sein kann, und zu ihrer Entstehung ein ihr vorangehendes, über sie hinausgreifendes Fertigwerden mit den Dingen im allgemeinen vonnöten ist. Das sieht man am ehesten daran, daß Gerechtigkeitsbestrebungen nämlich darauf hinarbeiten, sich eben wahr zu machen, in Erfüllung zu gehen, das ist nun, sich eben überflüssig zu machen, und wenn es soweit ist, was dann? In einer ringsum völlig abgesicherten Existenz Däumchen drehen? Diejenigen, die nicht so weit vorausgedacht haben, und darum wegen der eigenen Rechtschaffenheit und Gerechtigkeitsforderungen auf sich aufmerksam wollen, haben sich entblößt. Sollte man von Gerechtigkeitsvorstellungen nicht ablassen, so lieber nach dem chinesischen Sprichwort: “Üb’ Gerechtigkeit, erwarte keine.” Zum äußersten getrieben kann diese Haltung allerdings bedeuten, daß man für Dinge sterben muß, für die man aber nicht leben will oder kann. Tatsache ist, man tut Gutes, nicht weil die Welt gut ist, sondern allzu oft gedächtnismäßig unauslöschlich grauenhaft, nicht weil der Mensch gut ist, sondern schwach–schlecht, und nicht weil einer selbst gut ist sondern, weil man keine Lust hat, sich vor sich selbst zu ekeln. Wenn dabei Eigennutz eine Rolle spielt, dann in dem Sinne, daß man durch sein bescheidenes Zutun in einer rundum etwas weniger mißlichen Lage leben darf. Dazu schöpft man Kraft von der ganzen Hoffnungslosigkeit und letztendlicher Vergeblichkeit. Man bleibt eben gefaßt in dem Bewußtsein, am Ende ist nichts zu verlieren. Oder vielleicht doch: Wer nicht weiß, daß er/sie eine verlorene Seele ist, hat überhaupt keine, oder ist eine verwöhnte, eine dumm–verderbte, ein armer Wicht eben. Das Maß des metaphysischen Mißbehagens ist schließlich das Maß des Menschen schlechthin. Wenn dies alles, d.h. also die niedergeschraubten Erwartungen zur Kenntnis genommen und verinnerlicht wird, entdeckt man eine ausgesprochen wohltuende Nebenwirkung: nervenzerreibende moralische Empörung wird durch einen die Seele verschonenden Gleichmut abgelöst. Was zu diesem Zustand führt, ist die Einsicht, daß man langjährig die eigene größte Baustelle sein muß, die wiederum in der Erkenntnis besteht, die gute Tat ergibt sich einzig und allein aus Trotz, sonst liegt man grundfalsch, was nun mal die Grundbeschaffenheit des Guten anbelangt. Und die wirkt bisweilen wie ein kopfloser Tanz aus der Wirklichkeitsreihe ins Nichts.
Meinen bisherigen Ausführungen entnehmend wird der Leser sicherlich darauf gekommen sein, nicht nur daß ich meines Zeichens Germanist bin, das liegt auf der Hand, aber dies mit Leib und Seele, Haut und Haar. Ich liebe die ganze Bandbreite deutscher Philosophie und Literatur, und finde, wenn es sie nicht gäbe, wäre es eben nötig sie zu erfinden. Aber man unterliegt beruflichen Auflagen als Germanist und wird gezwungen, sich auf ein Gebiet, oder noch enger auf einen Autor zu spezialisieren. Meine Fachidiotie läuft unter dem Namen Franz Kafka, da bin ich eigentlich nicht schlecht aufgehoben. Immer wieder bei einer Auseinandersetzung mit Kafka zu landen, den ich für den bei weitem größten Romancier des 20, Jahrhunderts halte, ist Auslastung genug. Das besagt aber nicht, daß ich ihm alles abkaufe. Seine Einsicht in die “Unmöglichkeit des Lebens” ist etwas, dem ich doch nicht nur nicht zustimme, sondern wogegen ich mich mit allen Mitteln sperre und sträube. Da bin ich vielleicht einer eher ordinären Anhänglichkeit an das das Leben verfallen. Aber lassen wir das vorerst beiseite, es tut nichts zur Sache, denn ich bin längst nicht die Hauptperson in den vorliegenden Erzählungen und meine Meinungen sind ohnehin nicht so gewichtig, wohl aber eine mir eigene Beobachtungsgabe.
Was die Details meiner Person anlangt, reicht es, daß Einiges zur Kenntnis genommen wird. Daß ich zum Beispiel reichlich Zeit gehabt habe, über das, das was sich noch heute zutragen wird, nachzudenken und die destillierten Ergebnisse davon niederzuschreiben. Daß ich ein mäßig einsichtvoller intelligenter Mensch bin, mit ausreichendem Maß an Bildung, um das intellektuell einzuordnen, was ich noch erleben und erfahren werde und vor allem mir mitgeteilt werden sollte, halte ich mir zugute. Ich bin aber zugleich auch nicht bar jeder Lebenserfahrung und dermaßen in Gelehrsamkeitswahn verrannt, daß ich glaube, daß das größte Abenteuer sich ausschließlich zwischen den Ohren abspielt: “Dieses ist der Grund, weswegen man nicht selten Gelehrte (eigentlich studierte) antrifft, die wenig Verstand zeigen, und warum die Akademien mehr abgeschmackte Köpfe in die Welt schicken als irgend ein anderer Stand des gemeinen Wesens.” Wer meint, Kant habe keinen Humor, kennt ihn schlecht.
Sehen Sie in mir einen Berichterstatter, einen zuverlässigen und gar einen gewissenhaften. Auf jeden Fall möchte ich mich in den Hintergrund versetzt wissen. Wo ich zum Beispiel herkomme, daß ich zu der Germanistik auf Umwegen sagen wir, über eine eigene, überaus “exzentrische Bahn” gekommen bin, ist schon schön und gut, aber das sind Tatsachen von zweitrangiger Wichtigkeit. Man kann nach meinem Alter fragen mit der Begründung, daß mit dem Alter eine zur Einsichtentstehung nötige Reife und Verläßlichkeit kommt. Ich bin so frei, mir diese Reife durchaus, die damit einhergehende Zuverlässigkeit vorbehaltlos zuzutrauen. Ich verrate Ihnen, daß ich in den mittleren Jahren bin und daß ich also an dem Lebensabschnitt angelangt bin, daß ich neutral der Zeit gegenüberstehe, weder vorwärts noch rückwärtsblickend, weder von dem Wahn der Unsterblichkeit der Jugend geblendet noch von der Endzeitstimmung des Altseins ergriffen. Wenn die Frage des Alters wichtig ist, so dann in dieser letzten Beziehung, daß ich perspektivisch gesehen aus mittigen Mißgriffen frei bin.
Wohl weitaus wichtiger als diese Einzelheiten ist aber, daß ich durchaus ein einfacher Mensch bin, und wenn ich eine, sagen wir: anerzogene Tugend habe, dann ist es, daß ich über eine aus meiner Militärdienstzeit stammende Eigenschaft verfüge: ich dulde keinen Firlefanz, ich habe eine gute Nase für effekterhaschende Selbstinszenierungen und für verlogenes sich In–Positur–Setzen. Das Militär hat den Vorteil, auf sehr lebhafte Weise, einem die Tatsache beizubringen, daß eine falsch geschätzte Lage mit dem Tod, die Wahrheit mit Leben und Überleben gleichbedeutend ist. Auf meine Auffassung von Literatur bezogen, heißt es, daß ich ein Gespür für Werke, deren Entstehung von einer durchgestandenen Feuerprobe Zeugnis ist, das einzige, was untrüglich für eine ehrliche Arbeit, ein Kunstwerk, dem man sich also bedenkenlos anvertrauen darf, verbürgt. Der Urheber eines ehrlichen Werkes ist einer, der sich der dringend empfundenen, an der Schnittstelle zwischen Leben und Tod sich bewegenden Frage stellt, und die heißt schlicht und einfach, was ist und wo steckt der Mensch?, und wie wirken sich die Frage und die jeweilige Antwort und auf den auf der Kippe stehenden Lebenswillen aus? Kafka zähle ich selbstredend zu den Ehrlichen, zu den philosophischen Novellisten, wo ein Philosoph ein Mensch ist, dessen Leben und Überleben davon abhängen, was er versteht. Da ist das Verstehen nicht mehr Werkzeug und Mittel für vermeintlich unterliegend Wesentlicheres. Aus der Sicht vieler gehört zur Schaffung auf dieser Grundlage wohl ein überzüchtetes Wesen. Aber dagegen kann man nur darauf hinweisen, daß Kafka es doch fertig gebracht hat, den größten Roman des 20. Jahrhunderts zu schreiben als er buchstäblich schon im Sterben lag. Als Kafka–Leser muß man leider eine entsprechende halbwegs, d.h. ahnungsträchtige gesammelte Haltung seinen Werken entgegenbringen. Ich sage leider, denn die Sekundärliteratur zu Kafka bekundet einen deutlichen Mangel an der soeben angerissenen Einstellung und läßt sich allzu oft eher allenfalls als höheres hohles Edelgewäsch einstufen. Trotz der großen Mühe Kafkas, sich klar und unmißverständlich ausdrücken, haben ungemein viele dieser Klarheit erfolgreich Widerstand geleistet. Ich bin allerdings kein Kafka, und nur in einer Hinsicht will ich ihn übertreffen, und das eben in Sachen berichterstatterischer Klarheit. Die Hinnahme des Mißverstandenwerdens, womit manch ein Künstler oder Denker sich gerne schmückt, ist nun einmal kein Heldenstück. Lediglich das Schwerstverdiente lohnt sich, mitgeteilt zu werden, alles andere ist müßiges Geplapper oder auch gerne verkannte Weisheit leider getarnt als mißverstandenes Gelaber.
Ich bevorzuge geordnete Verhältnisse in meiner Umgegend, die einen zulassen, sich ungestört dem Spekulativen hinzugeben. Es mochte ein bißchen hochgestochen klingen, aber so bin ich nun mal. Ich bin skeptisch, aber doch auch zu einem gewissen Maß zur Heldenverehrung fähig. Ich habe Freunde und genieße ihre Gesellschaft, aber liebe auch Zurückgezogenheit und Einsamkeit, was den Vorteil mit sich bringt, daß ich weder für anderer Meinung anfällig noch auf anderer Anerkennung zu meinem geistigen Wohlbefinden angewiesen bin. Ich verfolge einen gesetzten, bürgerlich angesehenen Beruf, und zugleich bin ich aber ein begeisterter Anhänger fast aller Sportarten. „Ah ha!“, werden Sie sich sicher gesagt haben, „der ist doch im Grunde wohl so ein Fußballümmel oder so, in dessen Urteilsvermögen kein Vertrauen zu setzen ist.“ Da kann ich Sie nur darauf hinweisen, daß auch Heidegger, Gadamer und Jens als ausgesprochene Sportsfreunde gelten. Also, bitte sehr! Mit letztem Hinweis auf meine Interessen will ich gleichwohl nur mein ausgeglichenes Gemüt, wenn nicht meine ausgewogene Mittelmäßigkeit unterstreichen. Ich bin also eine graue Erscheinung, sagen wir, ein ausgesprochener Durchschnittsmensch, der sich zu einer Ausnahme macht, indem er ebendies zur Genüge weiß.
Ich habe genug Erfahrung mit Rückschlägen und Enttäuschungen gemacht, daß mir in meiner Zunft häufig auftretende Spuren von Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit weitgehend abgehen. Ich weiß also, mich zurückzunehmen und bin dafür ein umso besserer, aufmerksamer Zuhörer, was, wie es sich herausstellen wird, mir in Kürze zugute kommen wird. Ich bin damit zusammenhängend auch ein Asket, ein Minimalist in meiner eigenen Lebensgestaltung und Arbeitsweise. Besagter Minimalismus ist nicht eine zufällige Geschmacksmarotte, oder ein empfehlungsmäßiges Formgefühl, sondern ein auf der Einsicht beruhendes Urteil, daß wir alle hoffnungslose Vereinfachungskünstler sind und daß man am besten verfährt, wenn dies eingesehen und gleichermaßen zugegeben wird. .
Hinzu kommt – und vielleicht ist dies wirklich nur Geschmackssache – aber asketisch minimal in meinen Augen ist eben auch Sauberkeit. Damit sind wir schon wieder beim Militär gelandet, beim Prinzip KISS: Keep it simple, stupid; von Euripides standesgemäßer ausgedrückt: “Der Wahrheit Rede ist schlicht.” Bei jeder ernstzunehmenden Erzählung, allem Anschein zum Trotz, darf nichts, aber gar nichts der Willkür, Laune oder dem Zufall überlassen werden. Um die Teile, auf die es ankommt, und die Notwendigkeiten von deren Verhältnissen unter sich herausstreichen zu lassen, daß klar wird, daß nichts von ungefähr eingeschoben wird, ist die Einfachheit als das Waltende erforderlich. Der bei der Einhaltung des Prinzips anfallende Vorteil ist, daß alles vorübergehend Modische bei mir gar nicht erst verfängt. Soweit ich deren überhaupt gewahre, gleiten Modewellen, wie sie auch in literarischen Bewegungen widergespiegelt sind, an mir spurlos ab. Nur das zusammengefaßte, sich dem Willkürlichen der Mode entziehenden Einfache bleibt in Erinnerung bewahrt und sorgt für den eigenen Erhalt, denn das, was den Menschen bewegt, mag zwar in seinen zerlegten Bestandteilen kompliziert sein, muß in seiner Gesamtheit jedoch einfach sein oder so wirken, um nachzuwirken. Vom Instinkt war ich immer, wie gesagt, “Minimalist”, erst später ist es mir aufgegangen, was noch dahinter steckt: Alles, selbst das nur denkbar raffinierteste Wissen, hat da lediglich insofern Geltung, wenn Dinge in Bewegung bzw. zum Halten gebracht, hervorgerufen oder zerstört werden können, Momente also, die jedes Kind zu verstehen vermag. Das einen Gedanken entstehen Lassende mag unergründlich verwickelt sein, der Gedanke selber ist immer einfach, weil er oft mit Glauben und Wollen verbunden, und sollte er sich nicht dazu eignen, so geriete er sowieso ohne weiteres in gähnende Bedeutungslosigkeit.
Sei es, wie es sei, ich wollte meinem ehemaligen Studenten gegenüber meine Schuldigkeit tun. Allerdings wollte ich nicht zu lange in Anspruch genommen und in ein langwieriges Verfahren verwickelt werden und hatte meine Reisepläne dementsprechend zugeschnitten. Ich drückte meine letzte morgige Zigarette im Aschenbecher aus, raffte mich auf.
Kapitel 2 – „Himmelshafen“
Um zum Flughafen zu gelangen mußte ich zum Stadtkern hin fahren. Was die Stadtplaner dazu bewogen haben mochte, den Flughafen ausgerechnet dort anzusiedeln, wo die Bevölkerungsballung und Bautendichte am ausgeprägtesten sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich nehme an, daß der Ort des Flughafens, Sky Harbor, zu Deutsch “Himmelshafen” einstmals gleich am Stadtrand oder ein bißchen außerhalb des alten Phoenix gelegen haben muß, und daß der rasante Bevölkerungszuwachs, der Phoenix in allen Himmelsrichtungen in die Wüste hinein ausweiten ließ, das Flughafenareal einfach eingekreiste und verschluckte. Auf jeden Fall fuhr ich zuerst gemächlich in dünnem Verkehr, der jedoch je weiter in die Stadt hinein mit zunehmendem Betrieb eine entsprechende Geschwindigkeitserhöhung hinlegte. Bald war nichts mehr von der Wüste zu spüren und die Innenstadt glich jeder anderen bis auf die Tatsache, daß in Phoenix nicht so hoch gebaut wird, wie es in den meisten Großstädten in den USA der Fall ist. Und da hat man noch das Empfinden einer noch vorhandenen Weite.
Am Flughafen angekommen stellte ich meinen Wagen in der zum Terminal nächsten Parkgarage und schloß ab, und mit noch fast zwei Stunden bis zum Abflug ließ ich mir Zeit, die Strecke zum Flughafengebäude hinter mich zu bringen. Die normale Geschäftigkeit prägte das Geschehen um mich herum und halb ziellos daher bummelnd ließ ich Eindrücke des Flughafenbetriebes auf mich einströmen. Phoenix ist eine künstliche Stadt, das ist, sie ist auf künstliche Versorgungswege angewiesen. Die Lebensader Wasser zum Beispiel muß von weit her im Norden durch eine Serie von Staudämmen geholt werden, zweitens, die einzige, wirklich übriggebliebene Existenzgrundlage ist die günstige Winterwitterung, denn die frische und blütenstaubfreie Luft von einstmals, die man zur Stadtwerbung anpries, ist indes trotz aller umweltschützenden Anstrengungen so arg verschmutzt, daß die Berge, die die Stadt, the Valley of the Sun, das Sonnental, großenteils umgeben, oft nur noch als diesige, gelblich schimmernde Umrisse auszumachen sind. Es gibt eigentlich keinen Grund, keine wirtschaftliche Notwendigkeit, daß gerade dort, wo sich Phoenix befindet, eine Siedlung weiterbestehen soll. Aber sie tut es trotzdem.