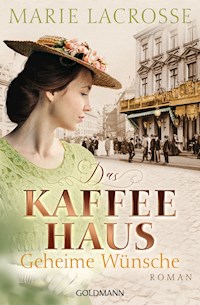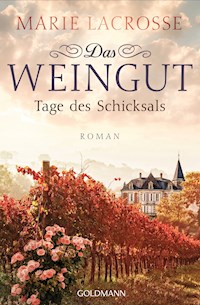9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Weingut
- Sprache: Deutsch
Die Ehe zwischen dem Dienstmädchen Irene und dem reichen Erben Franz sollte eine Liebesheirat sein. Doch nach einer ungeheuerlichen Enthüllung von Franz' Vater verlässt die schwangere Irene ihren geliebten Bräutigam ohne ein Wort. Einsam bringt sie ihren kleinen Sohn zur Welt und tritt eine Stelle als Textilarbeiterin in einer Fabrik an. Die Bedingungen dort sind grausam, und Irene muss bis zur Erschöpfung arbeiten. Aber dann lernt sie den charismatischen Arbeiterführer Josef kennen, der ihr Kraft und Geborgenheit gibt. Obwohl sie Franz noch immer liebt, beginnt sie eine Beziehung mit ihm. Aber kann Irene den Verlust von Franz wirklich überwinden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 876
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Die Ehe zwischen dem Dienstmädchen Irene und dem reichen Erben Franz sollte eine Liebesheirat sein. Doch nach einer ungeheuerlichen Enthüllung von Franz’ Vater verlässt die schwangere Irene ihren geliebten Bräutigam ohne ein Wort. Einsam bringt sie ihren kleinen Sohn zur Welt und tritt eine Stelle als Textilarbeiterin in einer Fabrik an. Die Bedingungen dort sind grausam, und Irene muss bis zur Erschöpfung arbeiten. Aber dann lernt sie den charismatischen Arbeiterführer Josef kennen, der ihr Kraft und Geborgenheit gibt. Obwohl sie Franz noch immer liebt, beginnt sie eine Beziehung mit ihm. Aber kann Irene den Verlust von Franz wirklich überwinden?
Autorin
Marie Lacrosse hat in Psychologie promoviert und arbeitet heute als selbstständige Beraterin überwiegend in der freien Wirtschaft. Unter ihrem wahren Namen Marita Spang schreibt sie erfolgreich historische Romane. Die Autorin lebt mit ihrem Mann in einem beschaulichen Weinort. Ein weiterer Band der Weingut-Saga ist bei Goldmann in Vorbereitung.
Weitere Informationen unter www.maritaspang.de
Marie Lacrosse
Das Weingut.Aufbruch in ein neues Leben
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung April 2019
Copyright © 2019 by Marie Lacrosse
Copyright der deutschen Erstausgabe © 2019 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Gestaltung des Umschlags und der Umschlaginnenseiten: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © FinePic®, München; gettyimages/© Max shen; gettyimages/© Flavia Morlachetti
Redaktion: Heike Fischer
BH · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-22648-0V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Meinem Mann Jürgen für achtunddreißig gemeinsame Jahre
Die Beaufsichtigung der Maschinen, das Anknüpfen zerrissener Fäden ist keine Tätigkeit, die das Denken des Arbeiters in Anspruch nimmt, und auf der anderen Seite wieder derart, dass sie den Arbeiter hindert, seinen Geist mit anderen Dingen zu beschäftigen.
In demselben Maße, in dem die Widerwärtigkeit der Arbeit wächst, nimmt daher der Lohn ab.
Nichts ist fürchterlicher, als alle Tage von morgens bis abends etwas tun zu müssen, was einem widerstrebt. Und je menschlicher der Arbeiter fühlt, desto mehr muss ihm seine Arbeit verhasst sein, weil er den Zwang, die Zwecklosigkeit für sich selbst fühlt, die in ihr liegen.
Drei Zitate von Friedrich Engels, das zweite aus dem gemeinsam mit Karl Marx verfassten Kommunistischen Manifest von 1848
In Österreich dürfen Kinder vom zehnten bis vierzehnten Jahre zehn Stunden, vom vierzehnten bis sechzehnten Jahre zwölf Stunden täglich, Letztere ausnahmsweise auch noch zwei Stunden länger beschäftigt werden.
Man braucht nur (…) die Spinnsäle (…) zu besuchen und wird (…) überall nur jugendfrische und lebensfrohe Kinder erblicken.
(…) dass in der regelmäßigen andauernden Beschäftigung schon an sich ein großer Segen für die jugendlichen Arbeiter zu erblicken ist, (…), als sie ihnen unmöglich macht, träge herumzulungern, Unfug zu treiben, zu betteln und zu stehlen (…)
Argumente von sächsischen Tuchfabrikanten aus einer Bittschrift im Jahr 1874 an das zuständige Ministerium in Dresden, um das Mindestalter von Kinderarbeitern wieder von zwölf auf zehn Jahre zu senken und die Arbeitszeitbeschränkung von zehn Stunden täglich für jugendliche Fabrikarbeiter wieder auf zwölf Stunden heraufzusetzen
Dramatis Personae
Es werden nur die handlungstragenden Figuren aufgeführt. Historische Persönlichkeiten werden mit einem * gekennzeichnet.
Irenes Familie
Irene Weber, unehelich geboren in einer Gebäranstalt, aufgewachsen in Waisenhäusern; »Weber« ist nicht ihr echter Familienname
Fränzel, ihr kleiner Sohn
Franz Gerbans Familie
Wilhelm Gerban, deutscher Weinhändler mit Firmensitz im elsässischen Weißenburg
Pauline Gerban, seine französische Ehefrau
Franz Gerban, Wilhelms und Paulines ältester Sohn
Mathilde Gerban, ihre jüngere Tochter
Gregor Gerban, Wilhelms Bruder, ehemaliger Leiter des familieneigenen Weinguts im pfälzischen Schweighofen
Ottilie Gerban, Ehefrau vonGregor und Wilhelms Schwägerin
Sophia, ihre verstorbene Schwester
Fritz Gerban, Gregors und Ottilies im Krieg gefallener Sohn
Louis Krämer, Großcousin mütterlicherseits aus Straßburg
Hauspersonal der Gerbans in Altenstadt
Niemann, erster Hausdiener
Frau Burger, Hausdame
Frau Kramm, Köchin
Riemer, Kutscher
Personal auf dem Weingut bei Schweighofen
Hansi Krüger, Arbeiter und späterer Verwaltungslehrling
Stromberg, entlassener Verwalter
Nikolaus Kerner, neuer Verwalter
Johann Hager, neuer Kellermeister
Clemens Dick, Vorarbeiter
Irenes Bekannte in Lambrecht
Josef Hartmann, Arbeiterführer
Emma Schober, Textilarbeiterin in der Tuchfabrik Reuter
Georg Schober, ihr Mann, ebenfalls Textilarbeiter bei Reuter
Marie und Thea, ihre kleinen Töchter
Trude Ludwig, Vermieterin Irenes
Else Gläser, Vorarbeiterin in der Spinnerei der Tuchfabrik Reuter
Gerti Gläser, Elses Tochter
Erika Bauer, Betreuerin der Stillstube in der Tuchfabrik Reuter
Robert Sieber, Vorarbeiter in der Färberei der Tuchfabrik Reuter
Magda Sieber, seine Frau, Arbeiterin in der Färberei
Anna, Kinderarbeiterin
Benjamin Reuter, Tuchfabrikant in Lambrecht
Plotzer, Reuters Verwalter in der Tuchfabrik
Johann Jakob Marx*, Tuchfabrikant in Lambrecht
Hartmann Botzong*, Tuchfabrikant in Lambrecht
Personen in der Anstalt Klingenmünster
Dr. Dietrich, Leiter der Anstalt
Dr. Klaus Bertram, Oberarzt
Schwester Rosa, Paulines Wärterin
Schwester Berta, Wärterin
Lisa Wolter, eine junge Patientin
Weitere Personen von Bedeutung
(Es werden nur die wichtigsten Personen in der Reihenfolge ihres Erscheinens im Roman aufgeführt.)
Eduard von Wernitz, Oberleutnant und Bewerber von Mathilde
Pfarrer Carl Klein*, evangelischer Pastor in Fröschweiler
Edgar Hepp*, ehemaliger Unterpräfekt von Weißenburg
Schwester Clémentine*, Lehrerin in Fröschweiler
Hussein Ben Salah*, kriegsversehrter Turko in Fröschweiler
Kegelmann, preußischer Beamter in Weißenburg
Monsieur Payet, Notar in Weißenburg
Marianne Serge, eine begüterte Dame in Saint-Quentin
Jean-Jacques Serge, ihr Schwager und Leiter der dortigen Eisenwarenfabrik
Minna, Irenes Freundin aus Altenstädter Zeiten
Eduard Förster*, preußischer Schulinspektor für den Kreis Weißenburg
Ilse Stockhausen, Oberaufseherin in der Weißnäherei und Herbert Stockhausens Tante
Martha, Zuschneiderin in der Weißnäherei
Herbert Stockhausen, Tuchfabrikant in Oggersheim und Mathildes Verlobter
Ernestine Körber, Franz’ Verlobte
Ernest Lauth*, abgesetzter Bürgermeister von Straßburg
Otto Back*, sein Nachfolger
Im Roman erwähnte historische Persönlichkeiten ohne aktive Rolle
General Mac-Mahon*, Marschall von Frankreich
Major Leopold von Kaisenberg*, in der Schlacht um Weißenburg gefallener preußischer Offizier
Otto Graf Bismarck*, deutscherReichskanzler
Karl Marx*, einer der wichtigsten Protagonisten der Arbeiterbewegung
Friedrich Engels*, Kollege, Freund und Mitkämpfer von Karl Marx
August Bebel*, Arbeiterführer
Adolf von Ernsthausen*, preußischer Präfekt in Straßburg
Prolog
Lambrecht in der Pfalz März 1871
Die ersten Strahlen des sonnigen Märzmorgens fielen durch die kleinen Fenster der Kammer und auf das Gesichtchen des Säuglings, den Irene behutsam und zärtlich in ihren Armen hielt. Draußen zwitscherten die Vögel um die Wette.
»Was für ein herrlicher Tag!«, flüsterte sie. Tränen traten ihr in die Augen. »Und was bist du nur für ein wunderbares Wesen!« Sie drückte dem kleinen Fränzel einen Kuss auf die seidenweiche Stirn. »Du gleichst einem kleinen Engel!«
Die Hebamme hatte ihr gesagt, dass sich das durch die Geburt zerknautschte Antlitz des Kleinen noch glätten würde, obwohl Irene das gar nicht bemerkte. Für sie war ihr Sohn das schönste Kind der Welt!
»Nie werde ich dich verlassen, mein Schatz, und in fremde Hände geben. Nie wirst du eine Waise sein, wie ich es war.«
In ihr überströmendes Glück mischte sich auf einmal Traurigkeit. Hat meine Mutter mich einst auch so im Arm gehalten? Musste sie mich fortgeben, oder hat sie es freiwillig getan? Wo ist sie? Lebt sie noch irgendwo ein bescheidenes Leben, oder ist sie längst verschieden? Ich würde sie so gern einmal kennenlernen!
Ihren Vater kannte Irene dagegen sehr wohl. Doch für ihn spürte sie nur Verachtung. Er hatte sie zu grausam behandelt!
Doch wer warst du, Mutter? Wirklich nur ein Dienstmädchen wie ich? Ein Dienstmädchen mit dem Talent zum Malen? Das einzige Erinnerungsstück an ihre unbekannte Mutter war ein kleines Aquarell, das eine gütige Schwester im Waisenhaus Irene überlassen hatte.
Sie griff mit einem Arm nach ihrer schäbigen Tasche, die neben dem Bett stand, und zog sie zu sich heran. Aus einem Innenfach zog sie das in Seidenpapier eingeschlagene Bild, faltete es vorsichtig auseinander und betrachtete es wohl zum tausendsten Mal. Es war ein düsteres Bild. In dunklen Farben gehalten, zeigte es ein aufziehendes Gewitter.
Du warst noch viel unglücklicher, Mutter, als ich es je war. Ich habe Franz zwar für immer verloren. Aber er hat mir ein wunderbares Abschiedsgeschenk gemacht, unseren Sohn. Du bliebst einst ganz allein zurück.
Die Tränen strömten ihr nun über die Wangen. In einem plötzlichen Impuls legte sie das Aquarell beiseite und hob den Säugling ein Stück in die Höhe.
»Doch wo du auch immer bist, liebste Mutter«, sagte sie halblaut. »Ich hoffe, dass du es spürst, wenn du noch am Leben bist, und es siehst, wenn du schon in einer besseren Welt weilst. Dies ist Fränzel, dein Enkelsohn!«
Teil 1 Trübsinn
Kapitel 1
Weingut bei Schweighofen Februar 1871, vier Wochen vorher
Es hatte endlich zu nieseln aufgehört, als Franz mit dem Einspänner in die Auffahrt einbog, die in schnurgerader Linie auf das Gutshaus der Gerbans bei Schweighofen zulief. Obwohl nicht so prächtig und opulent wie das Herrenhaus bei Altenstadt, in dem Franz aufgewachsen war, wirkte auch das Elternhaus seines Vaters Wilhelm majestätisch. Seine Fassade bestand aus von weißen Kacheln umrahmten beigefarbenen Klinkersteinen. Aus dem hohen Walmdach mit den drei vorgelagerten Gauben erhob sich an der linken Seite ein schlanker Eckturm mit spitzem Dach. Immer wenn Franz als kleiner Knabe hier zu Besuch war, hatte er das Haus für ein ehemaliges Märchenschloss gehalten.
In Wahrheit hatte der Bau, den sein Großvater väterlicherseits errichten ließ, beinahe zum Ruin der Familie geführt. Als in drei aufeinanderfolgenden Jahren Unwetter und Pilzkrankheiten fast die gesamte Weinernte vernichteten, fehlte plötzlich das Geld, um die Hypothek abzuzahlen. Das war jedoch weit vor Franz’ Geburt gewesen.
Letztlich hatte sein Vater die Gerbans durch die Heirat mit Franz’ Mutter Pauline, einer vermögenden Straßburger Weinhändlertochter, gerettet. Wilhelm Gerban war heute der wohlhabendste Weinhändler im nördlichen Elsass und der südlichen Pfalz. Doch seit Franz denken konnte, war die Ehe seiner Eltern unglücklich.
Auch wenn er widerwillig zugeben musste, dass sein Vater mit Paulines Geld überaus geschickt agierte und dadurch den Wohlstand der Familie Jahr um Jahr sicherte, hatte vor allem der Deutsch-Französische Krieg die Zerrissenheit der Familie, deren Mitglieder beiden Nationen angehörten, offenbart und sogar noch vertieft. Franz, der gemäß dem Ehevertrag seiner Eltern wie seine Mutter als einziger Sohn und Erbe französischer Staatsbürger war, hatte gegen die Deutschen gekämpft und litt nun unter der Niederlage Frankreichs. Diese schien besiegelt zu sein, da die Franzosen bislang keine einzige Schlacht gewonnen und kürzlich einem Waffenstillstand zugestimmt hatten.
Doch auch innerhalb der Familie seines Vaters gab es Konflikte. Wilhelms jüngerer Bruder Gregor bewirtschaftete das Weingut, das allerdings mit dem Geld von Franz’ Mutter entschuldet worden war.Trotz seines großen Erfolgs war Wilhelm nur der Nutznießer des Stammvermögens. Unter der Voraussetzung, dass seine Ehe mit Pauline Bestand hatte, besaß er lediglich den in dreißig Jahren erwirtschafteten Zugewinn abzüglich der Zinsen für die ursprünglich eingebrachte Summe. Deren genaue Höhe würde Franz erst am Tag seiner Volljährigkeit erfahren.
Gregor hatte kein eigenes Geld. Seine Familie lebte ausschließlich von den Zuwendungen seines Bruders. Diese völlige Abhängigkeit hielt Franz für den Hauptgrund der Feindseligkeit seiner Tante Ottilie gegenüber Wilhelm und vor allem gegenüber seiner Mutter Pauline. Vielleicht gab es auch noch andere Ursachen, die Franz nicht kannte. Jedenfalls hatten Gregor und Ottilie schon wenige Jahre nach seiner Geburt das Herrenhaus in Altenstadt verlassen und waren nach dem Tod des Großvaters ins Weingut übergesiedelt.
Ich bin gespannt, wie Vater und Onkel Gregor sich einigen, wenn ich im September volljährig werde und mein Erbe antreten möchte, dachte Franz, während er den Blick über die noch kahlen Rebenfelder gleiten ließ. Hier rund um das Gutshaus, das zwischen dem Straßendorf Schweighofen und dem winzigen Weiler Windhof lag, waren die Weinberge relativ flach. Grauburgunder, Silvaner und eine Rotweinsorte, die man »Portugieser« nannte, wurden dort angebaut.
Passierte man einige Streuobstwiesen, die auch zum Gut gehörten und aus deren Baumfrüchten man begehrte Obstbrände herstellte, kam man zu den wertvollsten Lagen der Gerbans. Bei Schweigen, wo die Weinhänge am Rand des südlichen Pfälzer Waldes immer steiler wurden, wuchsen Riesling und Spätburgunder, aus deren Trauben Jahr für Jahr Spitzenweine gekeltert wurden, die sogar bis nach Übersee verschifft wurden.
Kurz überlegte Franz, ob er am Gutshaus anhalten und vorsprechen sollte, entschied sich dann aber dagegen. Denn sein Cousin Fritz war als Offizier der preußischen Königsgrenadiere schon in der ersten Schlacht des Krieges auf dem Geisberg bei Weißenburg gefallen. Seitdem verfolgten dessen Eltern, insbesondere seine Tante Ottilie, Franz mit unversöhnlichem Hass, obwohl er völlig unschuldig am Tod ihres Sohnes war.
Auch wenn es Vater ärgern wird, werde ich ihnen keinen Besuch abstatten, beschloss er im Vorbeifahren, zumal ihn ohnehin eine weitere traurige Folge des Krieges hierherführte. Er wollte der Familie seines gefallenen Freundes Karl Krüger einen Besuch abstatten. An den Gewürztraminer- und Weißburgunderlagen vorbei lenkte Franz den Einspänner unter dem trüben Februarhimmel bis zum Abzweig, der zu dem kleinen Dörfchen der Landarbeiterfamilien führte, das ebenfalls zum Gut der Gerbans gehörte.
Karl war zuletzt einer der Vorarbeiter auf dem Weingut gewesen. Im letzten Sommer wurde er nach Kriegsbeginn eingezogen und fiel am 1. September als Soldat der bayerischen Truppen in den Kämpfen um Bazeilles. Franz, damals Sanitätsgefreiter bei den französischen Marineinfanteristen, die diesen Vorort von Sedan buchstäblich bis zur letzten Patrone verteidigt hatten, war Zeuge seiner tödlichen Verwundung geworden. Da er ihm nicht mehr helfen konnte, gab er Karl vor dessen Tod das Versprechen, für seine Familie zu sorgen. Insbesondere seinen begabten ältesten Sohn Hansi wollte er fördern.
Auch an Franz war der Krieg nicht spurlos vorübergegangen. Als der Einspänner auf dem unbefestigten Weg zum Dörfchen durch ein Schlagloch rumpelte, durchzuckte ihn ein scharfer Schmerz.
Kurze Zeit nachdem Karl verblutet war, hatte eine Granate Franz’ linkes Bein zerfetzt. Nur noch ein kurzer Oberschenkelstumpf war zu retten gewesen, der zum Glück gerade noch ausreichte, um eine nach den neuesten technischen Möglichkeiten gefertigte Beinprothese daran zu befestigen. Sie verschaffte Franz zwar eine vergleichsweise große Bewegungsfreiheit. Doch der Stumpf schmerzte gerade an feuchten, kühlen Tagen wie heute immer noch stark.
Jetzt erreichte der Einspänner die ersten Häuschen. Neugierige Augen folgten ihm durch das trübe Glas der kleinen Fenster. Leute aus dem Gutshaus verirrten sich nur selten hierher. Da kam auch schon Hansi aus dem Haus seiner Familie, ihm auf dem Fuß folgten seine jüngeren Geschwister.
»Ich glaube, ich habe gerade Franz vorbeifahren sehen.« Ottilie Gerban schob die Spitzengardine zurück und rümpfte ihre spitze Nase. »Was hat er hier zu schaffen?« Wie immer, wenn sie sich ärgerte, nahm ihre Stimme eine höhere Tonlage an. »Noch dazu, ohne uns seine Aufwartung zu machen!«
Gregor Gerban stellte seine Teetasse aus geblümtem Porzellan vorsichtig auf einem Beistelltischchen mit geschwungenen Beinen ab. Das Service sollte wie echtes Geschirr aus Meißen wirken, war aber nur eine Imitation. Trotzdem hütete Ottilie es wie ihren Augapfel.
»Nun freu dich doch, dass er uns mit seinem Besuch verschont hat! Du kannst ihn doch genauso wenig leiden wie ich.«
»Trotzdem ist es ein Zeichen von fehlendem Anstand«, beharrte Ottilie.
Gregor seufzte leise. Je älter seine Gattin wurde, umso weniger konnte es ihr jemand recht machen.
»Hast du schon mit Wilhelm gesprochen?«, wechselte sie nun zu einem für ihn sehr unangenehmen Thema.
»Dazu ergab sich noch keine Gelegenheit«, wich er aus.
»Keine Gelegenheit?« Wieder wurde Ottilies Stimme unangenehm hoch. »Dann musst du sie eben herbeiführen, Gregor! Schau dich doch einmal in diesem Salon um! Der Teppich ist abgewetzt, die Vorhänge müssen dringend erneuert werden, Sofa und Sessel brauchen dazu passende neue Polster. Gar nicht davon zu reden, dass wir überhaupt zwischen diesem alten Gerümpel hausen müssen.« Sie machte eine weit ausholende Geste, die die Möblierung des Raumes umfasste. »Außerdem hätte ich gerne wieder eine echte Zofe. Das neue Dienstmädchen ist nicht dazu ausgebildet, meine Garderobe zu pflegen, geschweige denn, mich ordentlich zu frisieren. Überhaupt ist Gitta in allem furchtbar ungeschickt. Sie taugt nur zum Saubermachen.«
Gregor musterte die Einrichtung des Salons, der auch als Damenzimmer diente, wenn die Gerbans kleine Gesellschaften gaben. Die geschnitzten Schränke und Vitrinen aus Nussbaum und Eiche stammten aus der Hinterlassenschaft seines Vaters und waren zugegebenermaßen nicht neu. Aber sie waren auf Hochglanz poliert und wiesen keinen einzigen sichtbaren Kratzer auf.
Ebenso verhielt es sich mit dem bunt gemusterten Perserteppich, der einen Teil des blank gewienerten Parkettbodens bedeckte. Er wies keine Flecken oder gar abgewetzte Stellen auf, wie Ottilie behauptete. Die Farben wirkten frisch. Die dunkelroten Samtportieren passten perfekt dazu, ebenso wie die mit gemustertem, rotem Brokat bezogenen Sitzmöbel. Vorhänge und Polster waren zudem erst vor fünf Jahren erneuert worden.
Aber er widersprach Ottilie nicht. Aus leidvoller Erfahrung wusste er, dass dies ihren Kampfgeist nur noch mehr anstacheln würde. Stecktdahinter etwa wieder dein zänkisches Weib, das du nicht im Zaum halten kannst?, hörte er im Geiste schon seinen Bruder Wilhelm spöttisch fragen, würde er ihm seine Bitte vortragen, ihren prozentualen Anteil an den Gewinnen des Weinhandels zu erhöhen. Sie erhielten die Summe monatlich zu seinem Salär als Leiter des Weinguts. Es war die Gegenleistung für ihr Schweigen über Franz’ Kampf auf der falschen Seite.
Denn Franz war kein regulärer Soldat gewesen, sondern hatte als Zivilist für die Sache Frankreichs gekämpft. Das stand noch immer unter strenger Strafe, da der Krieg ja noch nicht vorbei war. Würde man Franz bei den preußischen Besatzern anzeigen, drohte ihm zwar nicht mehr die standrechtliche Erschießung, da die aktiven Kämpfe beendet waren. Aber er müsste mit einer langen Kerkerhaft rechnen, die Gregor ihm einerseits von Herzen gönnte.
Andererseits war ihm klar, dass es dem ganzen Weinhandel großen Schaden zufügen würde, wenn den Besatzern, mit denen Wilhelm glänzende Geschäfte machte, bekannt werden würde, dass sein Sohn kein deutscher Staatsbürger war, der sein Bein auf dem Altar des deutschen Vaterlandes geopfert, sondern im Gegenteil beim Feind gedient hatte.
Da sich Gregor damit den eigenen Ast absägen würde, auf dem er saß, war es, im Grunde genommen, eine leere Drohung, Franz bei den Behörden zu denunzieren. Das wusste Wilhelm genauso gut wie er selbst. Warum nur ist Ottilie das einfach nicht klarzumachen? Zumal sie doch das Schicksal ihres eigenen Vaters, der mit seinem Geschäft bankrottgegangen ist und mir nicht einmal die Mitgift zahlen konnte, vor Augen haben müsste?
»Also, wirst du mit Wilhelm sprechen?«, keifte Ottilie und riss ihn aus seinen Grübeleien. Sie stand mit in die Hüften gestemmten Armen zwei Schritte vor ihm. Ihre bernsteinfarbenen Augen, die ihn an die einer Eule erinnerten, funkelten vor Wut.
Überhaupt glich Ottilies Gesicht mit ihrer spitzen, leicht gebogenen Nase und den dünnen Lippen diesem Nachtvogel. War sie früher noch gertenschlank gewesen, würde man sie heute eher als hager bezeichnen. Ihr schwarzes, hoch geschlossenes Kleid war ihr schon wieder zu weit und schlackerte um ihren Körper. Seit dem Tod ihres einzigen Sohnes Fritz, der ihr Ein und Alles gewesen war, trug sie Trauer und wurde von Tag zu Tag unleidlicher.
»Ich will sehen, was ich tun kann«, gab Gregor nach und stand auf. »Jetzt muss ich noch einmal ins Verwalterkontor, um etwas mit Stromberg zu besprechen«, log er.
Es war schade um den gerade erst angebrochenen Nachmittag, den er eigentlich gemütlich mit dem ausführlichen Studium verschiedener Zeitungen hatte verbringen wollen. Aber in dieser Stimmung ist mit Ottilie nicht zu spaßen. Da gehe ich ihr lieber erst einmal aus dem Weg.
Franz stieg aus dem Einspänner und bemühte sich, keine Miene zu verziehen, als er sein linkes Bein oder das, was davon übrig war, mit der daran befestigten Prothese auf den matschigen Untergrund der schmalen Straße setzte. Wo immer er konnte, verbarg er die Schmerzen, die ihm seine Kriegsverstümmelung bereitete, vor Außenstehenden.
»Wir haben Sie gar nicht erwartet, lieber Herr Franz«, freute sich Hansi. »Mutter ist noch bei einer Nachbarin am unteren Ende des Dorfes. Ich laufe rasch, um sie zu holen. Anni, du bereitest dem Herrn Franz derweil einen Kräutersud, und du, Liesel, achtest auf die Kleinen.«
Ehe Franz einwenden konnte, dass man sich keine Mühe mit ihm machen solle, war Hansi schon auf und davon. Anni, mit ihren elf Jahren das zweitälteste der Geschwister, hantierte derweil am Herd, in dem nur ein kleines Feuer brannte. In der Wohnküche, die den größeren Teil des Zwei-Zimmer-Häuschens ausmachte, war es im Vergleich zum behaglichen Salon in Altenstadt empfindlich kalt. Der Raum war reinlich gehalten, der Boden aus groben Brettern sauber gefegt. Doch es gab nur wenige Möbel.
Der große Tisch, den Karl zu seinen Lebzeiten aus groben Brettern selbst gezimmert hatte, nahm mit den einfachen Stühlen und Schemeln, die um ihn herum gruppiert waren, den größten Teil des Platzes ein. Es gab außerdem eine Holztruhe mit verblichener Malerei, in der Wäsche und Kleidung aufbewahrt wurden, einen Eckschrank aus unbehandeltem Fichtenholz und einige Wandborde mit Geschirr und anderen Gegenständen des täglichen Gebrauchs. An der hinteren Längswand war eine schmale Pritsche senkrecht hochgestellt, damit sie tagsüber nicht zu viel Platz wegnahm. Franz wusste, dass dies Hansis Schlafplatz war. Lene schlief mit den vier jüngeren Kindern im einzigen Nebenraum.
Franz schnitt die Ärmlichkeit der Ausstattung ins Herz, zumal Karl Krüger noch zu den wohlhabenderen Arbeitern des Weinguts gehört hatte. Wieder einmal nahm er sich vor, mehr für die Landarbeiter zu tun, sobald er als Erbe des mütterlichen Vermögens die Gelegenheit dazu bekäme.
»Aus welchen Kräutern soll ich Ihren Sud zubereiten, Herr Franz?« Anni knickste und schenkte Franz ein schüchternes Lächeln. Sie glich ihrer Mutter Lene und würde einmal eine hübsche Frau werden.
»Was hast du denn im Angebot, Anni?«, fragte er.
»Wir haben Kamille, Pfefferminze, Melisse und Salbei. Ich habe die Kräuter im Herbst selbst getrocknet«, antwortete Anni nicht ohne Stolz.
Franz seufzte innerlich. All diese Kräutertees mochte er eigentlich nicht. Als Kind war er bei verschiedenen Wehwehchen damit behandelt worden. Doch andere warme Getränke gab es im Haushalt der Krügers nicht, und er wollte das Mädchen nicht kränken.
»Melisse! Ich nehme einen Melissensud«, entschied er sich für das kleinste Übel.
Während Anni den Kessel mit Wasser aus einem Krug füllte und ein Scheit aufs Herdfeuer legte, ließ Franz seinen ersten Besuch vor drei Wochen Revue passieren. Gleich nach seiner Rückkehr aus dem Krieg war er schon einmal hier gewesen. Die Situation, die er damals vorfand, war trostlos.
»Ich würde den Hansi ja gerne weiter auf die Schule schicken oder ihn zumindest ein einträgliches Handwerk lernen lassen. Zumal er so ein hervorragendes Abschlusszeugnis aus der Volksschule hat«, erklärte Karls Witwe Lene. »Aber er ist nun unser Hauptverdiener. Karls Lohn fehlt uns an allen Ecken und Enden. Ich bin froh, dass Hansi eine feste Beschäftigung auf dem Weingut hat. Doch als Jungarbeiter verdient er nicht einmal die Hälfte von dem, was ein Vorarbeiter bekommt. Mit den paar Kreuzern, die ich als Wäscherin im Gutshaus dazuverdiene, kommen wir kaum über die Runden. Das habe ich auch schon dem Pfarrer gesagt.«
»Erhältst du denn keine Hinterbliebenenrente?«, fragte Franz bestürzt. Lene schüttelte mutlos den Kopf.
»Es gibt keinen offiziellen Beweis dafür, dass Karl gefallen ist. Seine Dienstmarke wurde nicht gefunden, und niemand weiß, wo er begraben liegt. Ich spüre in meinem Innersten, dass er tot ist. Karl wäre schon längst zu Hause, wenn er noch am Leben wäre.« Bei den letzten Worten konnte sie ein Schluchzen nicht unterdrücken.
Franz wusste nur zu gut, wie recht sie hatte. Doch obwohl er Zeuge von Karls Tod gewesen war, konnte er ihr nicht helfen. Anhand der Einschreibungslisten und Soldbücher hätten die steifen deutschen Beamten, die mittlerweile fast alle Verwaltungsposten im Kreis Weißenburg besetzten, schnell festgestellt, dass er in Bazeilles nicht in Karls Kompanie gekämpft hatte. Von da aus wäre es nur ein kleiner Schritt herauszufinden, dass er überhaupt nicht auf deutscher Seite in den Krieg gezogen war.
Andererseits wusste Franz aus eigener Anschauung, wie lieblos man die Leichen vieler Gefallener nach den großen Schlachten in namenlosen Massengräbern verscharrt hatte. Wahrscheinlich war man so auch mit Karls Leichnam verfahren.
Und so kurz nach seiner Rückkehr verfügte Franz noch nicht über so viel eigenes Geld, dass er Lene maßgeblich unterstützen konnte. Deshalb hatte er bei seinem ersten Besuch auch nur dalassen können, was er an Bargeld mit sich führte. Am nächsten Tag aber war er als Erstes in die Weißenburger Präfektur gefahren, um dort die Bewilligung von Lenes Antrag zu beschleunigen.
Doch wie Lene hatte auch er keinen Erfolg. »Es gibt unzählige Gefallene, deren Schicksal ungeklärt ist«, argumentierte er gegenüber dem sturen Verwaltungsbeamten, der die Anträge bearbeitete. »Deren Familien leiden Not, wenn ihnen nicht rasch geholfen wird.«
Doch bei dem Mann, der seinen starren Vorschriften durch und durch verhaftet war, biss Franz auf Granit. »Das ist möglicherweise korrekt, Herr Gerban«, antwortete der Beamte gestelzt. »Doch zunächst werden die Anträge der Heimkehrer bearbeitet, die zu Invaliden geworden sind, sowie die Renten für die Angehörigen der Gefallenen bewilligt, deren Tod im Dienst der deutschen Nation außer Frage steht. Da kann ich keine Ausnahme machen. Zumal es auch immer wieder Fälle gibt, in denen Familienväter zwar überlebt haben, sich ihrer Verantwortung aber dadurch entziehen, dass sie nicht zu ihren Frauen und Kindern zurückkehren.«
»So ein Mann war Karl Krüger nicht. Ich habe ihn gut gekannt.«
Das behaupten sie alle. Auch wenn der Beamte die Worte nicht aussprach, konnte Franz sie ihm vom Gesicht ablesen.
So kam er also heute mit leeren Händen. Bislang hatte er seine Tätigkeit in der Weinhandlung noch nicht aufgenommen und bekam also auch kein Gehalt. Bis zu seiner Volljährigkeit würde es überdies bescheiden sein. Dennoch wollte er Lene einen Vorschlag machen.
Anni hatte den Kräutersud gerade in einen irdenen Becher gefüllt und vor ihm abgestellt, als ihre Mutter mit Hansi zurückkam.
»Herr Franz, wie schön, dass Sie uns besuchen«, strahlte sie, was ihrem verhärmten Gesicht etwas von seiner früheren Attraktivität zurückgab. Ihr Blick fiel auf Franz’ Getränk.
»Anni, du hast dem Herrn Franz ja gar keinen Honig zu seinem Tee angeboten«, tadelte sie ihre Tochter.
Die errötete. »Ich wusste nicht, ob …« Sie stockte und wurde noch verlegener. »Es war wegen Bertis Husten!« Berti war Karls jüngster Sohn, der erst vier Jahre alt war.
Franz verstand sofort, worum es ging. Honig war das einzige Süßungsmittel im Haus, da er im Vergleich zu Zucker, den man nur für teures Geld im Kolonialwarenladen bekam, weitaus preiswerter war. Honig war aber auch eine der wenigen Arzneien, die sich arme Leute leisten konnten. Aufgelöst in warmer Milch, war er ein gutes Hausmittel bei Erkältungen.
»Liebe Lene, lass es gut sein. Ich mag gar keinen Honig«, wehrte er ab. Das war zwar eine Notlüge, aber das Einzige, was ihm einfiel, um das Angebot seiner Gastgeberin abzulehnen, ohne diese zu beschämen.
Falls Lene das Manöver durchschaute, ließ sie es sich nicht anmerken. »Brüh mir auch einen Melissensud auf«, wies sie Anni an. »Ich bin in dieser feuchten Kälte ganz durchgefroren.«
Dann blickte sie Franz erwartungsvoll an. »Konnten Sie etwas in Weißenburg erreichen?«
Franz schüttelte bedauernd den Kopf. »Leider noch nicht, Lene. Ich habe gestern eigens noch einmal auf dem Amt vorgesprochen, doch die Lage ist unverändert.«
Lenes Gesichtsausdruck schlug in Bestürzung um. Ihre Augen wurden feucht.
»Ach Gott, Herr Franz. Ich hatte so sehr darauf gehofft. Der Krämer will endlich bezahlt werden, sagte er mir erst heute Morgen. Wir können nicht länger anschreiben lassen.«
»Was ist mit dem Vorschuss auf deine Hinterbliebenenrente, um den ich meinen Onkel beim letzten Besuch gebeten hatte?« Franz schwante Böses, und er sollte recht behalten.
»Bislang wurde mir nichts ausbezahlt, Herr Franz. Erst gestern hat mir Herr Stromberg den Waschlohn gegeben. Dabei hat er nichts von dem Vorschuss erwähnt. Und danach zu fragen, wagte ich nicht.«
Franz knirschte vor Wut mit den Zähnen. Dann wird mir heute wohl nichts anderes übrig bleiben, als mich damit an Onkel Gregor zu wenden und ihm einen Besuch abzustatten, dachte er grimmig. Hätte ich doch schon jetzt mein eigenes Geld!
Doch es half nichts. Bis zum September konnten die Krügers nicht warten. Er zog seine Börse hervor und legte ein paar Münzen auf den Tisch. »Hier hast du erst einmal sechs Gulden, Lene. Mehr habe ich leider nicht dabei. Und nachher spreche ich noch einmal mit meinem Onkel. Es muss sich um ein Missverständnis handeln.«
Lene lächelte zaghaft. »Ich danke Ihnen so sehr für Ihre Fürsorge, Herr Franz.«
Das habe ich deinem sterbenden Mann versprochen, lag es ihm schon auf der Zunge, als er sich im letzten Moment zurückhielt. Stattdessen meinte er: »Auch wenn eure jetzige Lage schlimm ist, möchte ich euch zumindest einen Vorschlag machen, der eure Zukunft absichert. Es dauert zwar noch bis Mitte September. Aber dann werde ich Geld genug haben, um Hansi auf ein gutes Internat zu schicken. Ich übernehme natürlich die Schulkosten und bezahle dir die Summe, die er jetzt auf dem Weingut verdient. Und falls du dann noch immer keine Hinterbliebenenrente erhältst, übernehme ich auch das. So leidet ihr keine Not, und Hansi wird es einmal zu etwas bringen.«
Zu seiner Überraschung füllten sich Lenes Augen erneut mit Tränen. Auch Hansi, mittlerweile ein hochgewachsener Jüngling mit dem krausen, dunklen Haarschopf seines Vaters, dem er auch sonst sehr ähnlich sah, mied seinen Blick.
»Was ist denn?«, fragte Franz bestürzt. »Ist euch dieser Plan nicht recht?«
Hansi antwortete zuerst. »Ich würde schon gerne mehr lernen, Herr Franz, und ich danke auch recht schön für Ihr Angebot. Doch ich kann die Mutter nicht mit den Kleinen allein lassen.« Er war gerade im Stimmbruch und klang bereits wie ein Erwachsener.
»Oh!« Franz fehlten die Worte. Wieder musste er auf sein stärkstes Argument, das Versprechen, das er Hansis totem Vater gegeben hatte, verzichten. Und ein anderes fiel ihm erst einmal nicht ein.
Zaghaft meldete sich jetzt auch Lene zu Wort. »Ich hoffe, Sie halten uns nicht für undankbar, Herr Franz.« Ihre leise Stimme zitterte. »Aber Hansi ist jetzt der einzige Mann im Haus. Ich möchte ihn nicht auch noch verlieren.«
Franz spürte eine Mischung aus Empörung, Mitleid und Hilflosigkeit. Doch ein Blick in die Mienen von Mutter und Sohn machte ihm klar, dass er ihren Entschluss wohl oder übel akzeptieren musste.
Er war frustriert. Dann muss ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen, um mein Versprechen einzulösen.
Eine halbe Stunde später hielt er den Einspänner vor dem Eingang des Gutshauses an. Die Unterhaltung mit den Krügers war nach ihrer Absage, Hansi auf eine weiterführende Schule gehen zu lassen, immer zäher verlaufen. Franz hatte sich daher rasch verabschiedet.
Zudem hatte es draußen jetzt sogar leicht zu schneien begonnen. Er wollte die Unterredung mit Onkel Gregor so rasch wie möglich hinter sich bringen.
Hoffentlich wachsen sich diese Schneeschauer nicht zu einem Unwetter aus, dachte er besorgt. Denn morgen wollte er seine Mutter Pauline in der Anstalt in Klingenmünster besuchen. Und davon hing einiges für ihn ab.
Doch daran wollte er jetzt nicht denken. Jetzt ging es darum, Onkel Gregor zur Rede zu stellen.
Wobei ich dabei diplomatisch vorgehen sollte, nahm er sich vor. Denn ein Zugeständnis vonseiten seines Onkels war völlig freiwillig.
Im Büro des Verwalters brannte Licht. Franz beschloss, zuerst dort nach Onkel Gregor zu suchen. Tatsächlich fand er ihn mit einer Zeitschrift in einer Nische sitzend. Stromberg schien mit seiner Buchführung beschäftigt zu sein.
»Einen guten Nachmittag«, grüßte Franz, trat nacheinander auf Gregor und Stromberg zu und reichte beiden die Hand.
»Was führt dich denn hierher?« Gregor tat überrascht, obwohl er Franz schon durchs Fenster hindurch hatte anhalten und vom Wagen steigen sehen.
»Ich habe die Krügers besucht, Onkel. Du weißt ja, dass ich Karl sehr geschätzt habe. Obwohl es noch keine sichere Nachricht darüber gibt, dass er gefallen ist, besteht meiner Ansicht nach jetzt kaum mehr ein Zweifel daran. Karl hätte seine Familie nie im Stich gelassen.«
Gregor räusperte sich. »Ja, ich erinnere mich. Du warst vor einiger Zeit schon einmal da, um Lene Krüger einen Kondolenzbesuch abzustatten.«
»Und hatte dich damals darum gebeten, ihr einen monatlichen Vorschuss auf ihre Hinterbliebenenrente auszuzahlen. Allein mit Hansis Lohn und ihrem Zuverdienst als Wäscherin kommt die Familie nicht aus.«
Gregor tippte sich an die Stirn. »Ach ja, auch daran erinnere ich mich jetzt! Ich wollte darüber nachdenken und mich mit Ihnen, Stromberg, beraten. Habe ich die Sache schon einmal erwähnt?«
Stromberg wirkte ehrlich verdutzt. »Nicht dass ich wüsste, Herr Gerban.«
»Dann muss ich es über all den täglichen Anforderungen leider vergessen haben, Franz. Hier gibt es jeden Tag so vieles zu regeln.«
Franz versuchte, seine Mimik im Zaum zu halten. Früher hätte er seine Gedanken in zynischer Art und Weise offen ausgesprochen. Ja, das sehe ich. Im Februar ist auf einem Weingut wahrlich kaum Zeit, um zu Atem zu kommen.Da müssen Zeitschriften studiert werden, da muss entschieden werden, aus welchem Holz die neuen Fässer sein sollen und, und, und. Was kümmert einen da die Witwe eines treuen, in einem sinnlosen Krieg gefallenen Arbeiters mit ihren unmündigen Kindern!
Laut sagte er: »Nun, dann ist es ja gut, dass ich noch einmal nachgefragt habe. Stromberg kann die Sache dann gleich auch von mir erfahren.« Er wandte sich zu dem dünnen, kleinen Mann um, der in den letzten Jahren stark gealtert war. Sein Schädel war bis auf einige darüber gekämmte Strähnen mittlerweile fast kahl. Nur sein überdimensionaler, nach oben gezwirbelter Schnurrbart trotzte den Jahren.
»Ich war erst gestern wieder auf der Weißenburger Präfektur und habe mich erkundigt. Karl scheint bei Sedan gefallen zu sein. Doch aufgrund der vielen Opfer dieser Schlacht konnte man seine Dienstmarke noch nicht hierher übersenden. Sobald sie eingetroffen ist, wird Lenes Antrag bearbeitet, und sie erhält ihre Rente«, konstruierte Franz eine Mischung aus Wahrheit und Lüge.
»An welche Summe hatten Sie denn gedacht?«, kam Stromberg gleich zum Wesentlichen.
»An zwanzig Gulden pro Monat.«
»Zwanzig Gulden? Sind Sie sicher, dass ihre Rente so hoch ausfallen wird?«
»Der Verwaltungsbeamte rechnet damit«, log Franz.
»Das ist so viel an Vorschuss, wie ein guter Arbeiter verdient«, wandte Gregor Gerban ein.
»Karl war zuletzt Vorarbeiter, soweit ich weiß. Seit er Lesen und Schreiben gelernt hat, also seit mindestens drei Jahren. Hat er zuletzt nicht sieben Gulden pro Woche bekommen?«
Stromberg nickte widerwillig.
»Nun, Hansi erhält nur zweieinhalb Gulden als Lohn.«
»Er ist auch erst fünfzehn Jahre alt«, fiel Gregor ihm ins Wort.
»Das weiß ich.« Franz behielt einen kühlen Kopf. »Mit den zwanzig zusätzlichen Gulden im Monat könnten sich die Krügers das Gleiche leisten wie zu Karls Lebzeiten. Sie wären nicht doppelt bestraft durch den Tod ihres Ernährers und durch das daraus resultierende Leben in Armut.«
»Gut. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen«, wich Gregor aus. »Möchtest du noch mit nach oben kommen und deine Tante Ottilie begrüßen? Der Nachmittagstee dürfte gleich serviert werden.«
Franz hatte genug. Mit Diplomatie schien er nicht weiterzukommen. Spontan wechselte er die Taktik.
»Leider zweimal nein, Onkel Gregor. Ich möchte dich bitten, Stromberg hier und jetzt in meinem Beisein die Order zu erteilen, Lene Krüger wöchentlich fünf Gulden auszuzahlen. Ich bürge für die Summe.«
»Als zinsloses Darlehen?«, erkundigte sich der Verwalter.
»Selbstverständlich nicht«, polterte Gerban. »Das ist ja alles schön und gut, mein Junge. Aber womit willst du denn für die Summe bürgen?«
Franz maß seinen Onkel mit kühlem Blick. Gregor war von kleinerer Statur als sein Vater Wilhelm. Er neigte wie dieser in den letzten Jahren zu einem starken Bauchansatz, doch seine Gesichtszüge waren teigig, der Blick seiner wässrig blauen Augen unstet. Obwohl sich die Brüder äußerlich glichen, hatte Gregor weder etwas von der Kaltblütigkeit noch vom Geschäftssinn seines älteren Bruders. Er war leicht aus der Fassung zu bringen, und genau das wollte Franz sich jetzt zunutze machen.
»Von meinem Anteil am Familienvermögen, Onkel Gregor«, antwortete er. »Ich werde am 14. September volljährig. Hast du das etwa vergessen?«
»Natürlich nicht. Aber … aber ich dachte …« Gregor stockte.
»Du dachtest was?«, hakte Franz nach.
»Ja, dass du … also dass du erst einmal …«, stotterte Gregor.
»Dass ich erst einmal keine Ansprüche erheben würde? Warum sollte ich denn darauf verzichten? Es ist das Erbe meiner Mutter.«
»Und … und was hast du damit vor?« Gregor wirkte jetzt ausgesprochen nervös.
»Nun, das möchte ich nicht hier in Gegenwart von Herrn Stromberg erörtern«, ließ Franz ihn auflaufen. Dabei hatte er noch überhaupt keine Pläne gemacht.
Am liebsten würde ich dieses Weingut übernehmen, schoss es ihm plötzlich durch den Kopf. Und sei es nur, um dir Geizkragen endlich das Handwerk zu legen.
»Natürlich. Du hast recht.« Gregor riss sich zusammen. »Apropos«, wich er erneut auf ein anderes Thema aus. »Wie geht es denn deiner Mutter?«
Die Frage hatte Franz befürchtet und war darauf vorbereitet. »Das werde ich morgen erfahren. Ich breche schon früh nach Klingenmünster auf, um sie zu besuchen. Das ist auch der Grund, warum ich deine freundliche Einladung zum Tee ablehnen muss. Ich möchte heute zeitig wieder in Altenstadt sein. Das Wetter schlägt vielleicht um. Ich weiß nicht, wie früh ich morgen aufbrechen muss.«
»Wie schade. Ottilie hätte sicher auch gerne etwas über deine Mutter erfahren. Sie macht sich große Sorgen um sie.«
Du Heuchler! Sie will nur ihre Neugierde und Schadenfreude befriedigen, nichts anderes, und das weißt du genau.
Jetzt hatte er es satt. »Also, Onkel Gregor, grüße Tante Ottilie von mir! Ich möchte mich nun empfehlen. Und Sie, Stromberg, stehen mir dafür gerade, dass Lene Krüger schon morgen die ersten fünf Gulden erhält. Sie haben es soeben gehört. Ich stehe als zukünftiger Juniorchef dieser Firma, wozu auch das Weingut gehört, als Bürge mit meinem eigenen Geld dafür ein.« Die schlecht verhohlene Drohung war beabsichtigt.
»Und nachdem ich dir, lieber Onkel, den Sachverhalt jetzt auseinandergesetzt und dir damit versichert habe, dass für dich und das Weingut keinerlei Risiko mit diesen Zahlungen an Lene Krüger verbunden ist, bist du sicherlich einverstanden!«
Er fixierte Gregor, bis der schließlich widerwillig nickte. »Führen Sie Buch über jeden Kreuzer, den Sie Lene auszahlen, Stromberg«, fügte sein Onkel Franz’ Worten überflüssigerweise im Versuch, sein Gesicht zu wahren, hinzu.
»Das versteht sich von selbst, Herr Gerban«, erwiderte der Verwalter denn auch.
»Gut, dann verabschiede ich mich jetzt und wünsche den Herren einen angenehmen Feierabend.« Damit drehte sich Franz, der erst jetzt registrierte, dass ihm niemand einen Stuhl angeboten hatte, um, setzte seinen Hut auf und ging nach draußen, ohne einem der beiden zum Abschied die Hand zu schütteln.
Im Einspänner auf dem Weg nach Altenstadt durch den trüben nasskalten Spätnachmittag ließ Franz sich die Szene im Verwalterbüro noch einmal durch den Kopf gehen. Was er spontan im unterdrückten Zorn gedacht hatte, erschien ihm auf einmal alles andere als abwegig.
Die Leitung des Weinguts würde ich viel lieber übernehmen als eine führende Position in der Weinhandlung, wurde ihm klar. Ich mochte die Arbeit in den Weinbergen schon, als ich vor fünf Jahren hier mithelfen musste, und empfand sie zu keiner Zeit als Strafe, auch wenn ich sie mit meinem verkrüppelten Bein heute nicht mehr ausüben kann. Aber als Gutsherr könnte ich wirklich etwas für unsere Arbeiter erreichen und müsste darüber hinaus diesen arroganten Preußen nicht dauernd schöntun, nur damit sie unsere Weine kaufen. Das kann Vater viel besser als ich.
Aber zuerst, er spürte den Stich, der ihn jedes Mal durchfuhr, wenn er an sie dachte, wie einen körperlichen Schmerz, aber zuerst muss ich Irene wiederfinden. Hoffentlich ist Mutter in besserer Verfassung als bei meinem ersten Besuch. Sie ist meine letzte Hoffnung.
Kapitel 2
Irrenanstalt in KlingenmünsterFebruar 1871, am nächsten Tag
Franz Gerbans Puls beschleunigte sich, als der Landauer von der kleinen Landstraße abbog und nach einer kurzen Auffahrt vor einem hohen, schmiedeeisernen Tor anhielt. In dessen gemauertem Bogen prangte in großen silberfarbenen Lettern die Aufschrift »Kreis-Irrenanstalt Klingenmünster«. Franz’ Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Jetzt spürte er auch den dumpfen, pochenden Schmerz in seinem Beinstumpf wieder, der sich regelmäßig einstellte, wenn er aufgeregt war.
Riemer, der Kutscher, stieg vom Bock und betätigte eine Glocke aus Messing, deren schriller Ton über das von einem hohen Zaun umschlossene, weitläufige Gelände schallte. Nach kurzer Zeit öffnete sich die Tür eines kleinen Gebäudes links neben dem Tor, das wohl dem Wächter als Wohnung diente. Riemer verhandelte kurz mit dem Mann, Franz hörte undeutlich die Worte »Klinikdirektor« und »wird erwartet«.
Der Mann zog seine Wollmütze vom Kopf, nachdem er das Tor mit einem großen, eisernen Schlüssel geöffnet und eine schwere Kette, die den Eingang zusätzlich sicherte, gelöst hatte.
In der Nacht hatte es weiter geschneit. Da die Kranken bei den kalten Temperaturen den Park mit seinen hohen, jetzt winterkahlen Bäumen anscheinend nicht betreten durften, glitzerte die Schneedecke unberührt in der fahlen Nachmittagssonne, die durch die Wolken brach. Doch Franz hatte keinen Blick für den Zauber der stillen Gartenlandschaft.
Wie würde er seine Mutter Pauline heute vorfinden? Wäre sie bei klarerem Verstand als vor drei Wochen, als er sie nach seiner Heimkehr aus dem Krieg zum ersten Mal besucht hatte? Und was würde ihm der Klinikdirektor über ihre Heilungschancen sagen? Bei seinem ersten Besuch war er auf einer Dienstreise gewesen, sodass Franz nicht mit ihm hatte sprechen können.
Deshalb wusste er bislang nur von seinem Vater Wilhelm, dass Pauline angeblich als unheilbar krank galt. Sie war aufgrund ihres jahrelangen Konsums der Opiumtinktur Laudanum im Herbst des vergangenen Jahres zusammengebrochen und in lebensbedrohlichem Zustand nach Klingenmünster eingeliefert worden. Nach dem Entzug des Giftes wäre sie in Krämpfe verfallen, ihr Verstand sei irreversibel durch das Laudanum geschädigt, hatte ihm sein Vater erklärt.
Tatsächlich fand Franz seine über alles geliebte Mutter bei seinem ersten Besuch in einer erbärmlichen Verfassung vor. Nach einem Anfall war sie fixiert worden und so verwirrt, dass sie ihn nicht erkannte.
Doch da Frau Burger angeblich nicht weiß, warum Irene fortgegangen ist, und Minna es mir nicht sagen will, ist Maman meine letzte Hoffnung.
Irene war Dienstmädchen im Herrenhaus der Gerbans in Altenstadt gewesen, einem Vorort des ehemals zu Frankreich gehörenden und nun schon seit August 1870 von den siegreichen Deutschen annektierten, elsässischen Städtchens Weißenburg. Franz hatte sich heftig in Irene verliebt, die seine Gefühle zu erwidern schien. Er hatte ihr versprochen, sie ungeachtet ihres niedrigen Standes nach dem Krieg auch gegen den heftigen Widerstand seines Vaters zu heiraten.
Trotzdem hatte Irene aus unerfindlichen Gründen das Haus mit unbekanntem Ziel genau an dem Tag verlassen, an dem Franz in der Schlacht von Sedan sein linkes Bein verlor. Und weder Frau Burger, die Hausdame in Altenstadt, noch Minna, Irenes beste Freundin, noch sonst jemand konnte oder wollte ihm sagen, was der Grund dafür war.
Riemer brachte den Landauer mit knirschenden Rädern auf dem Kies vor dem Hauptgebäude der Anstalt zum Stehen, die im Jahr 1857 mit dem Ziel eröffnet worden war, sich vor allem der Heilung psychisch kranker Menschen zu widmen. In den vergangenen Wochen hatte Franz sich ausführlich über die Anstalt informiert.
Dabei erfuhr er, dass die Klinik zwar weit moderner gebaut und fortschrittlicher geführt wurde als das Irrenasyl in Frankenthal, in dem die Kranken unter unwürdigen Umständen vor sich hin vegetierten und aus dem die Anstalt in Klingenmünster eigentlich heilbare Kranke aufnehmen sollte. Doch es hieß, dass auch Klingenmünster mittlerweile völlig überfüllt wäre und es dort, ebenso wie in weiteren ähnlichen Einrichtungen, an Ärzten und geschulten Wärtern fehlte.
»Doch dies gilt nur für die niederen Klassen, Herr Gerban«, versicherte ihm Dr. Frey, der seit Jahren der Hausarzt der Familie war und Franz’ Mutter nach ihrem letzten Zusammenbruch nach Klingenmünster eingewiesen hatte. »Für Patienten Ihres Standes werden sogar gerade zwei Landhäuser mit kleinen Einzelwohnungen errichtet, das eine für Männer, das andere für Frauen. Dort werden die Insassen dann den gleichen Komfort wie in ihrem früheren Zuhause genießen. Die Gebäude können bereits in wenigen Tagen bezogen werden.«
Tatsächlich hatte Wilhelm Gerban Franz vor seiner Abfahrt aus Altenstadt mitgeteilt, dass Pauline seit einer Woche zwei Zimmer in der Frauenvilla bewohnte. Auch eine eigene Wärterin habe er für sie eingestellt, die sie rund um die Uhr betreuen würde. »Du siehst, deine Mutter liegt mir sehr am Herzen, Franz«, beteuerte sein Vater. »Die Kosten für ihre Unterbringung sind immens. Doch jeden Gulden, den ich dafür bezahlen muss, ist sie mir wert.«
Franz glaubte ihm kein Wort. Maman ist ihm völlig gleichgültig. Am Herzen liegen dem Alten nur sein Stand und sein Status. Nur deshalb wäre es ihm ein Gräuel, wenn Maman in einem überfüllten Schlafsaal dahinvegetieren würde, sinnierte Franz bitter, während er seinen Zylinder aufsetzte, nachdem er die Kutsche verlassen hatte. Wie immer lehnte er Riemers Arm ab, den dieser ihm fürsorglich anbot, seit Franz verkrüppelt nach Hause zurückgekommen war. Obwohl ihn seine Beinprothese heute besonders quälte, biss er die Zähne zusammen, als er die immerhin von Schnee befreite, aber wegen der Glätte mit Schotter bestreute breite Eingangstreppe hinaufhumpelte.
Ein adrettes Dienstmädchen in weißer Halbschürze und Häubchen öffnete Franz die Tür und nahm ihm Mantel und Hut ab. Während sich Riemer in die Gesindeküche begab, wo er mit heißem Tee und Kuchen versorgt werden würde, betrachtete Franz das Porträt des Klinikleiters Dr. Dietrich, das die Eingangshalle, in der er wartete, dominierte.
Ein dichter, bereits ergrauter Vollbart mit Koteletten verbarg den unteren Teil des Gesichts und auch nahezu den gesamten Mund. Umso imposanter stach die große, leicht gebogene Nase ins Auge, die Dr. Dietrich gemeinsam mit seinen stechenden Augen das Aussehen eines Habichts verlieh. Franz war der Dargestellte auf Anhieb unsympathisch. Seine Beklommenheit verstärkte sich, als er daran dachte, dass dieser Mann der unumschränkte Herrscher dieser Anstalt war, dem alle anderen, seien es Ärzte, Wärter, Bedienstete für die Wirtschaft und natürlich sämtliche Patienten, ungeachtet ihres Standes, aufs Wort zu gehorchen hatten.
»Herr Gerban?« Das Dienstmädchen kam zurück, knickste und lächelte ihm schüchtern zu. »Herr Dr. Dietrich erwartet Sie nun.«
Franz folgte dem Mädchen in ein mit dunkel gebeizten, schweren Möbeln eingerichtetes Zimmer, das ihn wegen der bis zur Decke reichenden Bücherregale entfernt an die Bibliothek seines Altenstädter Elternhauses erinnerte. Hinter einem mächtigen, perfekt aufgeräumten Schreibtisch erhob sich ein Mann von überraschend kleiner Statur, die das Porträt in der Halle nicht offenbart hatte. Franz überragte Dr. Dietrich nahezu um Haupteslänge.
»Der junge Herr Gerban!« Der Klinikleiter umrundete den Schreibtisch und bot Franz die Hand. »Herzlich willkommen in der Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster!«
»Ja, ich sehe, nun sind Sie erstaunt«, kam Dr. Dietrich Franz’ Frage zuvor. Sein Lächeln enthüllte blitzende Zähne zwischen schmalen Lippen. Doch der Blick, mit dem er ihn nun musterte, erinnerte Franz jetzt weniger an den eines Raubvogels als an den eines Wolfes, der seine potenzielle Beute fixierte.
»Ginge es nach mir und nicht nach der bayerischen Landesregierung, trüge dieses Haus einen vielversprechenderen Namen als den der von oben verordneten ›Kreis-Irrenanstalt‹. Das können Sie mir glauben, junger Herr Gerban«, fuhr Dietrich fort. »Denn hier wird den Heilbaren die beste Behandlung zuteil und den Unheilbaren, wie Ihrer verehrten, bedauernswerten Frau Mutter, die beste Pflege.«
»Aha.« Franz war erst einmal sprachlos angesichts der Unverblümtheit, mit welcher der Nervenarzt seine Hoffnung auf eine Besserung von Paulines Gesundheitszustand schon zunichtemachte, bevor das Gespräch überhaupt richtig begonnen hatte. Dann riss er sich zusammen. »Und was bedeutet ›die beste Pflege‹?«
»Gemach, gemach, junger Herr Gerban.« Der Klinikleiter war Franz bereits derart zuwider, dass er am liebsten auf dem Absatz kehrtgemacht hätte. Kurz überlegte er, ob er sich die dümmliche Anrede verbitten sollte, mit der Dr. Dietrich ihn offenbar ansprach, um den Unterschied zwischen ihm und seinem Vater Wilhelm zu betonen. Doch ein Gefühl warnte ihn, dass Dr. Dietrich ihm dies verübeln könnte. Am Ende lässt er das noch an Maman aus. Der Gedanke sprang ihn an wie ein Raubtier und ließ ihn während des gesamten Gesprächs nicht wieder los.
Daher zwang Franz ein Lächeln auf seine Lippen und erhob auch keinen Einspruch, als ihm Dr. Dietrich keinen Platz in der behaglichen Sitzgruppe vor dem Kamin, sondern auf einem harten Holzstuhl vor seinem Schreibtisch anbot, wo er nun, wiederum in seinem Sessel sitzend, seinerseits Franz überragte. Auch den türkischen Mokka, den das Dienstmädchen auf das Läuten des Direktors hin servierte, nahm er dankend entgegen und musste sich widerwillig eingestehen, dass der Kaffee tatsächlich vorzüglich war.
»Ich freue mich, dass das Getränk Ihnen zusagt, junger Herr Gerban«, meinte Dietrich und fletschte dabei die Zähne. »Es gibt Ihnen zugleich einen Einblick, auf welch hohem Niveau unsere Patienten in der ersten Klasse verpflegt werden. Wenn es die Verfassung Ihrer Frau Mutter erlaubt, erhält sie diesen Kaffee sowohl morgens als auch am Nachmittag.«
»Und was bedeutet dieses: ›Wenn es die Verfassung meiner Mutter erlaubt‹?«, kam Franz endlich zur Sache. Dietrich ließ sich Zeit mit seiner Antwort. Er nahm noch einen Schluck Kaffee und wischte sich dann umständlich mit einer Serviette über die Lippen.
Franz versuchte, sich seine Ungeduld nicht anmerken zu lassen. Wieder sagte ihm sein Gefühl, dass Dietrich negativ darauf reagieren würde.
»Nun, junger Mann. Die Wissenschaft über die sogenannten Seelenstörungen ist noch jung«, begann der Arzt, schließlich in belehrendem Tonfall zu dozieren. »Vieles erschließt sich uns Medizinern trotz all unserer Forschung und unseres Wissensdrangs bis heute nur unzulänglich, was ich auch schon Ihrem verehrten Herrn Vater erläutert habe.«
Er machte eine Pause. Franz’ Puls beschleunigte sich. Aber er nahm sich weiterhin zusammen.
Dr. Dietrich fixierte ihn. »Ihre Frau Mutter ist wahrscheinlich bereits von Haus aus von schwacher Konstitution. Sie ist Französin, wie man mir mitteilte?«
»Was tut das denn zur Sache?« Nun verlor Franz doch die Beherrschung. Dr. Dietrich betrachtete ihn weiterhin ungerührt.
»Ich konstatiere mit Wohlgefallen, dass in Ihren Adern das Blut Ihres deutschen Vaters dominiert. Sie wissen sich zu wehren, wenn Ihnen etwas nicht behagt.«
Franz verschlug es vor Empörung die Sprache. Das gab Dietrich die Gelegenheit, ungestört fortzufahren.
»Frauen haben ohnehin eine schwächere Konstitution, junger Herr Gerban«, salbaderte er. »Tritt dann noch eine gewissermaßen angeborene Nervenschwäche hinzu, entwickelt sich auf dieser Grundlage rasch ein schwacher Charakter. Ihr verehrter Herr Vater teilte mir mit, Ihre werte Frau Mutter habe aus diesem Grund schon über Jahre hinweg Laudanum eingenommen, um sich zu beruhigen. Diese Information ist doch korrekt?«
Franz erstickte fast an seiner zustimmenden Antwort.
»Ich sehe, das alles nimmt Sie sehr mit, junger Herr Gerban.« Dietrich beobachtete ihn scharf. »Glauben Sie denn, überhaupt in der Verfassung zu sein, Ihrer Frau Mutter heute einen Besuch abzustatten? Ich kann keine Visite erlauben, die sie aufregen könnte.«
Franz erschrak bis ins Mark. Gewaltsam riss er sich zusammen. »Ich bin ganz gelassen«, versicherte er.
Der bleckte die Zähne erneut wie ein gefährliches Raubtier. »Nun gut, das will ich einem Kriegshelden glauben, selbst wenn er auf der falschen Seite gekämpft hat«, konnte er sich den Seitenhieb nicht verkneifen.
Franz’ Mundwinkel begannen zu schmerzen. Trotzdem erhielt er sein Lächeln aufrecht. Anders als die preußischen Besatzer in Weißenburg wusste Dietrich offenbar gut über ihn Bescheid. Kurz überlegte er, wer dem Nervenarzt diese Information wohl gegeben hatte, sein Vater oder seine Mutter. Dann konzentrierte er sich wieder auf dessen Ausführungen.
»Ich fahre also fort. Es ist Ihnen bekannt, dass Laudanum ein Präparat auf der Basis von Opium ist?«
Franz nickte.
»Und ist Ihnen auch bekannt, welche Folgeschäden übermäßiger Opiumgenuss haben kann?«
Franz nickte wieder. »Man sagt, dass die Konsumenten davon abhängig werden.«
»Sie sagen es!« Nun klang Dietrich sogar begeistert. »Die Dosis, die Sie benötigen, um zur Ruhe zu kommen, wird ständig höher und höher. Das können Sie doch auch bei Ihrer Frau Mutter bestätigen?«
Diesmal beschränkte sich Franz auf ein knappes Ja.
»Man weiß noch nicht allzu viel über die Langzeitwirkungen dieses Gifts«, schwafelte Dietrich weiter. »Doch die Forschung geht davon aus, dass eine mögliche Folge des dauerhaften Abusus die unheilbare Schädigung des Gehirns ist. So könnte es auch bei Ihrer Frau Mutter sein. Nachdem wir ihr das Laudanum entzogen hatten, entwickelte sie zunächst eine große Unruhe, die auch durch die bewährten Dauerbäder nicht zu vertreiben war. Schließlich verfiel sie sogar in Krämpfe, als litte sie an der Fallsucht. Sie brabbelte zudem wirres Zeug, sodass ich davon ausgehe, dass sie auch an Wahnvorstellungen leidet.«
»Was sagte sie denn?«, fand Franz endlich seine Sprache wieder.
»Zum Beispiel behauptete sie, Ihr Vater würde ihr nach dem Leben trachten.« Nun klang Dietrich theatralisch. »Um eines Dienstmädchens willen wolle er sie ermorden. Können Sie sich etwas Derartiges vorstellen?«
Franz saß wie erstarrt. Also weiß meine Mutter etwas über Irene!
»Was für ein Dienstmädchen meinte sie denn?«, fragte er mit schwacher Stimme.
Dietrich schüttelte unwillig den Kopf. »Das tut doch überhaupt nichts zur Sache. Außerdem weiß ich es nicht.«
»Darf ich jetzt zu ihr?« Plötzlich war Franz des Gesprächs mit dem Klinikdirektor völlig überdrüssig. Von ihm würde er nichts weiter von Wert erfahren.
Dietrich zog seine buschigen Augenbrauen zusammen. Dann läutete er. »Rufen Sie einen Wärter, der den jungen Herrn Gerban zu seiner Frau Mutter in die Frauenvilla begleitet!«
Während sie warteten, ergänzte er: »Da Sie ja schon einmal hier waren, ist Ihnen bekannt, dass Ihre Frau Mutter zuerst im oberen Stockwerk dieses Gebäudes untergebracht war, wo die Patientinnen erster Klasse eine eigene Station haben. Nur die ganz Begüterten finden einen Platz in der hochmodern eingerichteten Frauenvilla. Dorthin dürfen sie sogar ihre eigenen Möbel mitbringen und speisen wie zu Hause stilvoll allein für sich anstatt im gemeinsamen Speisesaal. Letzte Woche ist Ihre Frau Mutter dorthin übergesiedelt, nachdem ihre Möbel geliefert wurden. So hat sie wenigstens eine beständige Erinnerung an die glücklichen Zeiten ihres Lebens.«
Franz antwortete nichts. Die Kehle war ihm wie zugeschnürt.
Dietrich bemerkte es gar nicht. »Denn dass Ihre liebe Frau Mutter uns je wieder verlässt, ist sehr unwahrscheinlich, junger Herr Gerban. Ihre Pflege ist ganz besonders aufwändig und schon aufgrund der fehlenden Möglichkeit der beruhigenden Dauerbäder in Ihrem trauten Heim gar nicht zu leisten.«
Wieder erwähnte Dietrich dieses für Franz unverständliche Wort. Was versteht man unter einem Dauerbad?, lag es ihm schon auf der Zunge, als ein Klopfen ankündigte, dass sein Begleiter zur Frauenvilla eingetroffen war.
Da Franz der unangenehmen Gegenwart Dietrichs so rasch wie möglich entkommen wollte, verzichtete er auf die Frage. Sie sollte ihm jedoch nur allzu schnell wieder in den Sinn kommen.
Zehn Minuten später saß Franz im Salon, wie das kombinierte Wohn- und Esszimmer seiner Mutter genannt wurde, und wartete auf Pauline.
In den Räumen seiner Mutter, die im ersten Stock der Villa lagen und deren Fenster auf den winterlichen Park hinausgingen, erwartete ihn die Privatwärterin seiner Mutter. Sie war in eine Schwesterntracht gekleidet und stellte sich ihm als »Rosa« vor.
»Ihre Frau Mutter ist noch nicht ganz fertig angekleidet, Herr Gerban«, erläuterte sie Franz. »Darf ich Ihnen derweil einen Tee anbieten?«
»Ja, müssen Sie denn meiner Mutter nicht behilflich sein?«, wunderte sich Franz.
»Dr. Dietrich bat mich, Sie hier zu erwarten, Herr Gerban. Zudem gibt es für die Badestuben eigenes Personal«, erläuterte Rosa ihm kryptisch. »Es kleidet unsere Patientinnen nach der Behandlung auch wieder an. Ihre Frau Mutter ist also bestens versorgt. Bis sie fertig ist, hole ich Ihnen derweil den Tee aus der Küche.«
Während Franz wartete, sah er sich um. Wieder schnürte es ihm die Kehle zu, als er den kleinen Schreibsekretär seiner Mutter erkannte, eine verglaste Vitrine mit einem Teil ihres Meißener Porzellans sowie den Teppich, der zuvor im kleinen Salon gelegen und den seine Schwester Mathilde im vorigen Jahr mit Cassis-Torte befleckt hatte. Die Sitzgarnitur, in der er Platz genommen hatte, und eine Kommode mit vergoldeten Beschlägen stammten aus ihrem Altenstädter Schlafzimmer. Offensichtlich war das zweite Zimmer, in dem Pauline schlief, zu klein, um diese Möbel aufzunehmen. Der kleine, runde Esstisch aus hellem Kirschbaumholz mit den vier gedrechselten Stühlen war dagegen neu.
Nach ungefähr fünf Minuten öffnete sich die Tür. Rosa brachte den Tee und schob seine Mutter wenig später in einem Rollstuhl ins Zimmer. Franz durchfuhr es heiß und kalt. Schon vor drei Wochen hatte Pauline elend ausgesehen. Aber heute erkannte er sie fast nicht wieder.
Ihre ehemals ausdrucksstarken, dunklen Augen starrten stumpf und blicklos vor sich hin. Tiefe Schatten lagen darunter. Ihr Gesicht war verhärmt, sie sah mindestens zehn Jahre älter aus, als sie war. Das grünseidene Nachmittagskleid, das aus ihrer Altenstädter Garderobe stammte und ihr früher so gut zu Gesicht gestanden hatte, kontrastierte nun äußerst unvorteilhaft zu ihrer fahl blassen Gesichtsfarbe.
»Heute geht es Ihrer Frau Mutter leider gar nicht gut, Herr Gerban«, erläuterte Rosa. »Es ist nicht davon auszugehen, dass sie Sie überhaupt erkennt.«
»Woher wollen Sie das im Voraus wissen? Sie kennen meine Mutter doch erst seit ein paar Tagen!« Franz unterzog die Wärterin einer näheren Inspektion und stellte fest, dass sie ihm genauso unsympathisch war wie Dr. Dietrich. Er schätzte sie auf Anfang fünfzig, also in etwa auf das gleiche Alter wie seine Mutter. Ihr hageres Gesicht mit der dünnen Nase, den schmalen Lippen und den leicht vorstehenden Zähnen erinnerte ihn an eine Spitzmaus.
Rosa schürzte auf seine Frage hin beleidigt die Lippen. »Ich verfüge über große Erfahrung im Umgang mit seelengestörten Patientinnen«, erklärte sie.
»Soso!«, erwiderte Franz. »Dann wollen wir doch einmal sehen, ob Sie recht behalten!«
Er beugte sich, behindert durch die Beinprothese, zu seiner Mutter hinunter, küsste sie auf die Wangen und ergriff ihre Hände. »Maman, Maman«, sprach er sie an. »Ich bin es, Franz! Dein Sohn! Erkennst du mich?«
Ein winziges Zucken der Mundwinkel antwortete ihm. Noch ehe Franz sich über dieses mögliche Zeichen seiner Mutter freuen konnte, erstarrte er jedoch vor Entsetzen. Erst jetzt fiel ihm auf, dass ihre Hände ganz aufgequollen waren wie die einer Wäscherin. Die Haut war faltig und leicht gerötet. Als er den Ärmel ihres Kleides ein Stück hinaufschob, bemerkte er überdies, dass ihre Handgelenke mit Lederriemen an die Armlehnen des Rollstuhls gebunden waren.
Sein Entsetzen schlug in Wut um. »Was hat das zu bedeuten, Rosa?«, schnauzte er die Wärterin an. »Wieso binden Sie meine Mutter fest wie ein wildes Tier? Und warum ist ihre Haut derartig rau und geschwollen?«
Rosa richtete sich kerzengerade auf und sah Franz ruhig in die Augen. Anscheinend gehörte zu ihrer Berufserfahrung auch der Umgang mit den medizinisch ungebildeten, erregten Verwandten ihrer Patientinnen.
»Ihre Frau Mutter kommt geradewegs aus dem Dauerbad«, erklärte sie mit fester Stimme. »Dort hat sie die letzten acht Stunden verbracht, da sie zuvor wieder einen ihrer Anfälle hatte. Da wir die Behandlung eigens wegen Ihres Besuchs unterbrochen haben, erschien es mir angezeigt, die Arme Ihrer Frau Mutter festzubinden, damit sie weder Ihnen noch sich selbst Schaden zufügen kann.«
»Was? Wie bitte? Meine Mutter soll irgendjemandem Schaden zufügen? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?«
Anstatt einer Antwort zog Rosa den Ärmel ihrer Schwesterntracht hoch und zeigte Franz zwei frisch verschorfte Kratzer. »Diese Wunden hat mir Ihre Frau Mutter erst heute früh zugefügt, als wir sie ins Bad brachten. Zuvor tobte sie und schlug um sich. Dr. Dietrich persönlich hat die Badekur angeordnet.«
»Wovon reden Sie da?« Plötzlich fasste Franz einen Entschluss. »Ich will sehen, was das für eine Behandlung ist. Führen Sie mich zu einem solchen ›Dauerbad‹, wie Sie das nennen!«
Rosa betrachtete ihn kühl. »Sie haben Glück, Herr Gerban«, äußerte sie dann mit einem schnippischen Unterton. »Ihre Frau Mutter verfügt in der Tat über ihr eigenes Badezimmer, sonst könnte ich Ihnen den Raum gar nicht zeigen. Die anderen Wannen in den Gemeinschaftsbädern sind ununterbrochen belegt. Dr. Dietrich scheint geahnt zu haben, dass Sie sich über die Behandlung Ihrer Frau Mutter informieren möchten. Er hat ausdrücklich erlaubt, dass ich Ihnen diesbezüglich alle Auskünfte erteilen darf.«
»Ausdrücklich erlaubt!«, echote Franz. Dann straffte er sich.
Wenig später starrte er fassungslos auf eine Wanne aus weißem Porzellan, über deren ganze Länge ein Holzbrett mit einem Loch am Kopfende gelegt war.
»Was geschieht hier mit meiner Mutter?«
Rosa blieb weiterhin gelassen. »Das Dauerbad ist die bewährteste Kurmethode für unruhige Kranke. Das Wasser ist warm, es wird auf genau fünfunddreißig Grad erhitzt. Dann werden die Kranken in die Wanne gesetzt und mit leichten Riemen fixiert, damit sie sich nicht stoßen. Zuletzt wird das Brett über die Wanne gelegt mit einem Loch für den Hals. So hält sich das Wasser länger warm, wobei es natürlich beständig nachgeheizt wird, um die Temperatur zu halten. Ihrer Frau Mutter lege ich außerdem immer ein kleines Lederkissen unter den Kopf, damit sie es recht bequem hat.«
Franz glaubte, nicht recht gehört zu haben. Dieses Szenario stand den Schrecken seiner Albträume, die ihn seit den Schlachten des vergangenen Jahres immer wieder heimsuchten, in nichts nach. »Acht Stunden und mehr sitzt meine Mutter in diesem nassen Gefängnis? Angebunden an Händen und Füßen?«
»Sie wird währenddessen auf das Beste versorgt«, verteidigte sich Rosa, nun doch zunehmend nervös. »Sie erhält zu essen und zu trinken, so viel sie begehrt, und das Wasser wird sofort gewechselt, wenn sie es verschmutzt hat. Außer dem Morphium, das das Gehirn Ihrer Frau Mutter in zu hoher Dosierung weiter schädigen würde, ist es die einzige Methode, um sie zu beruhigen. Ihr Herr Vater hat ausdrücklich darauf bestanden, dass Ihre Frau Mutter ein eigenes Badezimmer zusätzlich zu ihrer Wohnung erhält. Es ist das einzige Einzelbad in der ganzen Anstalt!«