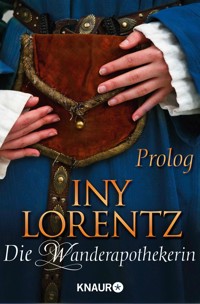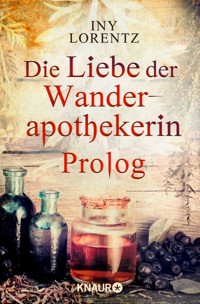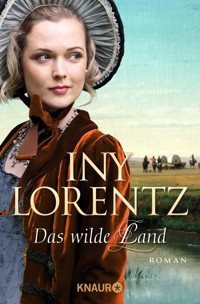
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Auswanderer-Saga
- Sprache: Deutsch
Der dritte Band der Texas-Saga - die historische Auswanderersaga um Walther Fichtner und seine Familie. Nach dem texanischen Unabhängigkeitskrieg von 1836 ist Walther Fichtner ein einflussreicher Mann in Texas geworden. Als seine zweite Frau, die Indianerin Nizhoni, ihre Tochter zur Welt bringt, scheint das Glück vollkommen. Bald aber ziehen Schatten über Texas auf, denn der Nachfolger von Präsident Sam Houston will die Komantschen aus ihren Jagdgründen vertreiben und betreibt im großen Stil Spekulation auf das Land der Indianer. Walthers Todfeind beteiligt sich daran und beginnt die Fehde gegen ihn mit einem Überfall auf dessen Ranch. Zwar kann der Angriff abgewehrt werden, doch fortan müssen Walther und seine kleine Familie um ihr Leben fürchten … »Ein großartiger Roman im besten Iny Lorentz-Stil, mit vielen Spannenden Handlungssträngen, sorgfältig recherchiert und 'gewürzt' mit zahlreichen Personen der Zeitgeschichte.« Ruhr Nachrichten Eine große Familiensaga voller Liebe und Dramatik im historischen Amerika des 19. Jahrhunderts »Das wilde Land« ist der 3. Band der historischen Auswanderer-Saga voller schicksalhafter Liebe und atemberaubender Abenteuer von Bestseller-Autorin Iny Lorentz. Die historische Roman-Reihe findet ihren fulminanten Abschluss in Band 4 »Der rote Himmel«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Iny Lorentz
Das wilde Land
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nach dem texanischen Unabhängigkeitskrieg von 1836 ist Walther Fichtner ein einflussreicher Mann in Texas geworden. Als seine zweite Frau, die Indianerin Nizhoni, ihre Tochter zur Welt bringt, scheint das Glück vollkommen.
Bald aber ziehen Schatten über Texas auf, denn der Nachfolger von Präsident Sam Houston will die Komantschen aus ihren Jagdgründen vertreiben und betreibt im großen Stil Spekulation auf das Land der Indianer. Walthers Todfeind beteiligt sich daran und beginnt die Fehde gegen ihn mit einem Überfall auf dessen Ranch. Zwar kann der Angriff abgewehrt werden, doch fortan müssen Walther und seine kleine Familie um ihr Leben fürchten …
Inhaltsübersicht
Erster Teil Maggie
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Zweiter Teil Spencerville
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Dritter Teil Ruf der Heimat
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Vierter Teil Die Geister der Vergangenheit
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Fünfter Teil Ein Stern unter Sternen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Sechster Teil Niemals aufgeben
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Siebter Teil Krieg und Frieden
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Achter Teil Die letzte Barrikade
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Neunter Teil Veränderungen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Historischer Überblick
Die Personen
Geschichtliche Personen
Glossar
Erster Teil Maggie
1.
Es war ein Mittwochmorgen im Sommer 1839, und doch wirkte die Farm so still wie an einem Sonntag. Dabei wartete gerade in dieser Jahreszeit viel Arbeit auf Walther Fichtner und seine Männer. Statt anzupacken, standen er und seine mexikanischen Rancharbeiter nahezu regungslos neben der Remise und starrten auf das Wohnhaus. Aus diesem hatten Gertrude Poulain und Rachel Coureur Pepe und den Hausherrn schon kurz nach Sonnenaufgang vertrieben und bewachten es nun wie zwei Engel mit dem Flammenschwert.
Quique, der Vorarbeiter der Vaqueros, war zur Ranch gekommen, um einiges mit seinem Herrn zu besprechen. Doch er begriff schnell, dass Walther nicht in der Lage war, ihm zuzuhören. Daher hielt er zunächst den Mund. Aber als Walthers Gesicht sich grau vor Sorge färbte, zupfte er ihn am Ärmel.
»Keine Angst, Señor! Diesmal geht bestimmt alles gut!«
Seinen Worten zum Trotz erinnerte sich Quique mit Grausen daran, dass Walthers erste Ehefrau Gisela vor drei Jahren bei Waldemars Geburt gestorben war. Unwillkürlich wanderte sein Blick zu den beiden Kindern hinüber. Josef saß neben dem Grab, in das man Gisela Fichtner vor drei Jahren umgebettet hatte, und hielt seinen jüngeren Bruder eng umschlungen. In den Gesichtern der beiden Jungen stand ebenso viel Angst wie in dem ihres Vaters, denn nun lag die Stiefmutter der Knaben in den Wehen, und alle drei befürchteten, auch sie zu verlieren.
»Keine Angst, Señor. Diesmal geht alles gut!«, wiederholte Quique.
Endlich vermochte Walther ihm zu antworten. »Das wird es! Gott kann nicht zulassen, dass den Kindern auch die zweite Mutter wegstirbt.«
Der Vaquero verstand, wie es in Walthers Innerem aussah, und schlug ein ums andere Mal das Kreuz. Dabei flehte er im Stillen die Heilige Jungfrau an, sich Maria Amalie Fichtners, die alle noch immer Nizhoni nannten, anzunehmen.
»Vielleicht sollten Sie mit mir zu den Herden reiten, Señor«, schlug Quique vor.
Walther schüttelte den Kopf. Er konnte sich nicht vorstellen, nach seinen Rindern zu sehen, während seine Frau sich damit abquälte, neues Leben in die Welt zu setzen.
»Es wäre auch gut für Ihre Söhne«, versuchte Quique ihn zu überzeugen. »José hat miterleben müssen, wie seine Mutter bei Waldemaros Geburt gestorben ist.«
Obwohl Texas sich vor drei Jahren von Mexiko gelöst hatte und eine eigene Republik geworden war, nannte er die Söhne seines Herrn noch mit der spanischen Form ihres Namens, die damals Vorschrift gewesen war.
Walther nahm es ihm nicht übel, denn er fragte sich oft genug, ob das neue amerikanische Texas besser war als das frühere mexikanische Tejas. Zwar besaß er mehr Land als jeder andere im weiten Umkreis, aber ihm missfiel die Unruhe, die das Land seit der Loslösung von Mexiko erfasst hatte. Beinahe jede Woche trafen seine Vaqueros auf Siedler, die sich einfach auf seinem Besitz niederließen und nicht akzeptieren wollten, dass es hier kein freies Land für Neuankömmlinge mehr gab.
Walther brach seine Überlegungen ab und blickte wieder zum Wohnhaus hinüber. Von dort drang immer noch kein Laut zu ihm herüber. Wenn er Nizhoni wenigstens schreien hören würde, dachte er, dann wüsste er, dass die Wehen vorangingen. So aber erschreckte ihn die Stille fast noch mehr als der Gedanke an seine erste Frau, die schon ihre erste Niederkunft beinahe nicht überlebt hatte und bei der zweiten gestorben war.
Mit dem Gefühl, feige zu handeln, wandte er sich Quique zu. »Gut, reiten wir zu den Herden!«
»Ich werde Waldemaro vor mich aufs Pferd nehmen«, versprach der Vaquero. »José wird selbst reiten wollen.«
»Ich glaube kaum, dass man ihm das ausreden kann!« Für einen Augenblick huschte der Anflug eines Lächelns über Walthers Gesicht. Trotz seiner knapp zehn Jahre war Josef bereits ein besserer Reiter als er selbst. Als er den Befehl gab, die Pferde zu satteln, lief der Junge zu seinem gescheckten Mustang und schwang sich auf dessen blanken Rücken, ohne auf die Hilfe eines Rancharbeiters zu warten.
»Schauen wir, wer als Erster bei den Herden ist, Papa?«, fragte er und vergaß darüber für einen Moment die Angst um seine Stiefmutter.
Walther schüttelte den Kopf. »Heute gibt es kein Wettrennen! Ich will die Pferde nicht anstrengen, denn es kann sein, dass wir rasch zurückreiten müssen.«
»Dann aber hoffentlich, um unseren neuen Bruder willkommen zu heißen«, rief Josef und ritt los.
Walther und Quique folgten ihm etwas langsamer und blickten sich, solange die Ranch noch in Sicht war, immer wieder um. Doch nach wie vor war kein Ton zu vernehmen, und es rührte sich auch nichts.
2.
Im Wohngebäude der Fitchner-Ranch, wie sie von den amerikanischen Texanern genannt wurde, saßen Rachel und Gertrude am Tisch, tranken Kaffee und aßen von dem Kuchen, den Nizhoni noch am Vortag gebacken hatte.
»Der schmeckt ausgezeichnet!«, erklärte Rachel gerade. »Du musst mir unbedingt das Rezept geben, Nizhoni.«
Auch ihr kam der Name Maria Amalie, auf den die Diné-Indianerin getauft worden war, nur selten über die Lippen, und wenn doch, dann in seiner amerikanisierten Version Mary Amely.
»Ich werde es dir aufschreiben«, erklärte die Gebärende, während sie das Gesicht unter dem Ansturm einer Wehe kurz verzog.
Gertrude beobachtete Nizhoni und nickte zufrieden. »Sie kommen schon schneller. Lange wird es nicht mehr dauern, dann wird das Kleine sich sehen lassen. Was wünschst du dir eigentlich, einen Bruder für Josef und Waldemar oder lieber ein Mädchen?«
»Ich werde willkommen heißen, was die Geister mir bestimmt haben.«
Nizhoni lächelte versonnen. Zwei Jahre lang hatte sie geglaubt, sie würde Walther keine Kinder schenken können. Doch nun wölbte sich ihr Leib unter der Last, die er trug, und sie spürte das Streben des Ungeborenen, endlich ans Licht der Welt zu kommen.
»Lange sollte es nicht mehr dauern, sonst machen Walther und die Jungen sich zu viele Sorgen«, setzte sie hinzu.
Rachel warf einen kurzen Blick durch das Fenster und verzog spöttisch die Lippen. »Die nehmen gerade Reißaus! Manchmal würde man ihnen wirklich mehr Mut wünschen. Bei Thierry war es ebenso. Als ich das erste Mal in den Wehen lag, ist er zu Lucien geritten.«
»Männer!«, spottete Gertrude. »Als ich im vorletzten Jahr meinen Jungen bekam, brauchte mein Albert mehr Zuspruch als ich.«
»Haben er und Thierry damals nicht zwei Flaschen Tequila geleert, so dass es beiden hinterher recht elend erging?«, fragte Nizhoni, während eine weitere Wehe ihr ein leises Stöhnen entriss.
»Das war bei meiner Abigail!«, korrigierte Rachel sie. »Allerdings habe ich da auch geschrien, dass es Gott erbarmen mochte. Bei Thamar ging es dann ganz leicht. Ich bin rein ins Haus, hab das Kleid gehoben, und das Girl war da.«
»Thierry war aber trotzdem betrunken«, sagte Gertrude lachend. Dann wandte sie sich wieder Nizhoni zu. »Wie ist es mit den Wehen? Langsam dürften sie schneller kommen!«
»Das tun sie!«, antwortete Nizhoni mit einem weiteren Stöhnen. »Ich habe das Gefühl, als würde alles aus mir hinausgepresst!«
»Dann dauert es nicht mehr lange. Leg dich ins Bett!« Rachel stellte die Kaffeetasse, aus der sie gerade hatte trinken wollen, wieder ab und trat zu der Gebärenden.
Diese schüttelte den Kopf. »Liegen ist bei einer Geburt nicht gut, Sitzen ist besser!«
»Du kannst doch dein Kind nicht zur Welt bringen, als würdest du auf dem Feld kurz die Röcke schürzen«, rief Rachel aus.
»Lass sie!«, mischte sich Gertrude ein. »Es geht leichter, wenn man ihr ihren Willen lässt. Übrigens ist jetzt die letzte Gelegenheit zu einer Wette, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ich setze einen Topf meiner Pfirsichmarmelade auf einen Sohn!«
»Ich setze einen Korb Pekannüsse dagegen«, antwortete Rachel und sah dann Nizhoni an, die mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt auf den Fersen hockte.
»Glaubst du wirklich, dass du das Kind so zur Welt bringen willst?«
»Sie ist schon dabei«, erklärte Gertrude und griff rasch genug zu, um das Bündel Mensch, das ans Licht der Welt drängte, aufzufangen. Mit einem raschen Blick sah sie ihm zwischen die Beine und stöhnte.
»Du bekommst die Marmelade von mir, Rachel.«
»Ein Mädchen also!« Rachel klang zufrieden, denn Gertrudes Pfirsichmarmelade kam hier im French Settlement keine gleich.
»Gib sie mir!«, sagte Nizhoni und streckte die Arme nach ihrer Tochter aus.
»Lass mich sie wenigstens noch abnabeln«, meinte Gertrude mit sanftem Lächeln. »Auf jeden Fall war es eine leichte Geburt. Das muss man dir lassen!«
Nizhoni lächelte. Es ging die beiden Frauen nichts an, welche Schmerzen sie sich hatte verbeißen müssen. Doch das zählte nun nicht mehr. Wichtig war allein das kleine Menschenkind, das Gertrude eben säuberte und mit einer Windel versah. Diese war aus Leinen, wie es bei den Weißen der Fall war. Nizhoni beschloss aber, sie mit getrocknetem Moos und Gras auszupolstern, damit der Hintern ihrer Kleinen nicht wund wurde.
Endlich reichte Gertrude ihr den Säugling, der sie aus großen Augen ansah und dabei die kleinen Fäuste ballte. »Schätze, die Kleine wird bald Hunger haben«, sagte sie.
»Daran wird es hoffentlich nicht scheitern!« Für einen Augenblick verdüsterte ein Schatten Nizhonis Gesicht. Bei ihrer ersten Niederkunft im Lager der Komantschen war ihre Milch reichlich geflossen, obwohl das Kind nur wenige Stunden am Leben geblieben war. Noch heute verspürte sie tiefe Trauer, wenn sie daran dachte, und in manchen Nächten kam die Erinnerung mit schlechten Träumen zurück. Bei Gisela, Walthers erster Ehefrau, aber war die Milch weggeblieben, und aus diesem Grund hatte Walther sie als Amme für seinen ersten Sohn ins Haus geholt. Mittlerweile war Josef ein munteres Bürschchen und zusammen mit seinem kleinen Bruder ihr ganzer Stolz. Nun würden die beiden Jungen sich ihre Liebe mit einer Schwester teilen müssen.
»Wir sollten den Männern auf dem Hof mitteilen, dass alles gutgegangen ist und sie Walther holen können. Er wird sein kleines Mädchen gewiss sehen wollen.« Um Gertrudes Lippen zuckte es leicht, denn alles, was mit der Geburt eines Kindes zusammenhing, war für die Männer ein Mysterium, mit dem sie schlecht zurechtkamen.
»Ich übernehme das!« Rachel trat zur Tür, drehte sich dort aber noch einmal um, um sicherzustellen, dass Nizhoni von draußen nicht zu sehen war. Daher öffnete sie die Tür erst, als die Indianerin sich erschöpft aufs Bett setzte und die Kleine in den Armen wiegte.
»He, Pepe!«, rief Rachel dem Hausdiener zu. »Du kannst Mister Fitchner mitteilen, dass er Vater eines hübschen kleinen Mädchens geworden ist.«
Es hatte eine Zeit gegeben, in der Rachel sich eher die Zunge abgebissen hätte, als mit einem Mexikaner zu reden. Mittlerweile aber hatte sie sich im French Settlement mit seiner bunt gemischten Bevölkerung eingelebt und den Wert der einzelnen Menschen kennengelernt.
»Ein Mädchen! Da wird Señor Waltero sich aber freuen, denn Söhne hat er ja schon.« Pepe strahlte übers ganze Gesicht, wurde dann aber auf einmal ernst. »Wie geht es der Señora?«
»Mir geht es gut«, rief Nizhoni, die seine Frage gehört hatte.
»Dann wird der Señor sich doppelt freuen!« Pepe drehte sich um und winkte einen der jüngeren Rancharbeiter zu sich. »Benito, sattle ein Pferd und reite zu den Herden. Melde dem Señor, dass alles glücklich verlaufen ist und er sich Vater einer kleinen Señorita nennen kann!«
Das Reiten war nicht Pepes Ding, und so schob er diese Aufgabe an den jungen Mestizen ab. Benito strahlte, denn es war sein Traum, ein Vaquero zu werden wie sein großes Vorbild Quique. Dafür aber musste er reiten können wie ein Komantsche, und dieser Botenritt stellte eine gute Gelegenheit dar, sich dem Vormann zu empfehlen. Innerhalb kürzester Zeit sattelte er einen der Mustangs im Pferch, schwang sich auf dessen Rücken und galoppierte los.
»Brich dir aber nicht das Genick!«, rief Pepe ihm warnend nach. Doch da war Benito bereits außerhalb der Hörweite und jagte nach Westen, wo die Herden der Ranch weideten.
3.
Trotz der Sorgen um seine Frau empfand Walther beim Anblick der Rinderherde, die, von Quiques Untergebenen bewacht, weidete, großen Stolz. Vor knapp zehn Jahren hatte er mit einem Bullen und zwei Kühen angefangen, und mittlerweile war seine Herde durch eigene Nachzucht, den Ankauf der Tiere von Nachbarn, die ihre Farmen aufgegeben hatten, und das Einfangen herrenloser Rinder auf mehrere hundert Stück angewachsen. Dabei hatte er schon mehrmals zehn oder zwanzig Rinder an die Bewohner der Städte verkauft, die im Umfeld des French Settlements wie Pilze aus dem Boden schossen. Darüber hinaus besaß er eine stattliche Herde gezähmter Mustangs und zwei großrahmige Hengste, mit denen er Reitpferde züchtete, die im weiten Umkreis ihresgleichen suchten.
Quique war für die Rinderherde verantwortlich, während die Pferde seinem Freund Lope anvertraut waren, und die beiden arbeiteten ausgezeichnet zusammen. Auch jetzt trabte Lope heran und winkte schon von weitem mit seinem Sombrero.
»Hola Señor! Wie geht es der Señorita? Ist das Kind schon geboren?«
Walther schüttelte den Kopf. »Nein, noch nicht. Quique meinte, ich solle zu den Herden kommen, damit ich mir nicht vor lauter Aufregung die Fingernägel abkaue.«
Beide Vaqueros lachten. Lope gesellte sich zu der Gruppe, sah Josef auf dem blanken Rücken des Mustangs sitzen und schüttelte den Kopf.
»Hast du vergessen, dass du ein junger Caballero bist und kein wilder Komantschenjunge? Was sollen die Leute von dir halten und von uns, wenn du wie ein Indio bravo auf dem Pferd sitzt?«
»Nizhoni sagt, ich müsste beides können, sowohl wie ein Vaquero als auch wie ein Komantsche reiten«, antwortete der Junge selbstbewusst.
Unwillkürlich nickte Lope. »Du kannst auch beides! Deshalb solltest du, wenn Fremde da sind, einen Sattel verwenden. Ohne Sattel kannst du reiten, wenn niemand es sieht.«
»Hier ist doch niemand«, wandte Josef ein.
»Ist Señor Sam Houston niemand?«, fragte Lope und blickte Josef dabei so treuherzig an, dass dieser sich erschrocken umsah.
»Mister Houston ist hier? Aber ich sehe ihn nicht!«
»Dort kommt er!«, erklärte der Vaquero und wies nach Süden.
Jetzt entdeckte auch Walther den siegreichen General des texanischen Unabhängigkeitskrieges und ersten Präsidenten der Republik Texas. Zwar war mittlerweile Mirabeau B. Lamar zum neuen Präsidenten gewählt worden, dennoch war Houstons Einfluss noch immer groß. Zudem war er Walthers Freund.
»Schön, Sie zu sehen, Sam!«, grüßte dieser den Besucher.
»Ich dachte mir, ich schaue mal bei Ihnen vorbei, Walther. Schön haben Sie es hier – und verdammt viele Kühe. Glaube nicht, dass es hier in Texas mehr als eine Handvoll Siedler gibt, die ähnlich viel Vieh besitzen – höchstens ein paar alteingesessene Tejanos.« Houston wies zum Lagerfeuer. »Haben Sie einen Becher Kaffee für einen durstigen Mann und einen Pfannkuchen übrig? Ich habe nichts mehr gegessen, seit ich von Andreas Belchers Farm aufgebrochen bin. Es gibt zwar einige neue Farmen zwischen seinem Besitz und den Grenzen Ihres Settlements, aber die werden von Greenhorns geführt, die erst beweisen müssen, dass sie echte Texaner sind, bevor ich auch nur einen Schluck Wasser von ihnen annehme.«
Houston lachte wie über einen guten Witz, doch Walther verstand die Anspielung. Gerade diese Neulinge in Texas hatten dafür gesorgt, dass Houston eine zweite Präsidentschaft versagt geblieben war. Die siegreiche Schlacht gegen die Mexikaner am San Jacinto River lag zwar erst drei Jahre zurück, doch in dieser Zeit waren mehr Neusiedler ins Land geströmt als in den zwanzig Jahren zuvor. Für diese Neuankömmlinge waren die Verdienste der Vergangenheit nicht mehr wert als ein Drink, den sie für Sam Houston oder einen der anderen Teilnehmer an jener Schlacht ausgeben würden.
Während Walthers Gedanken sich mit der derzeitigen Situation in Texas beschäftigten, wies Quique lachend auf Jones, ihren dunkelhäutigen Koch. »Wir haben nicht nur einen Becher Kaffee für Sie übrig, Señor Houston, sondern auch ein großes Steak. Kommen Sie, steigen Sie ab! Wir kümmern uns um Ihr Pferd, und Sie essen erst einmal.«
»Da sage ich nicht nein!« Houston schwang sich aus dem Sattel, reichte die Zügel einem heraneilenden Vaquero und reckte sich dann, um den Blutfluss in Armen und Beinen wieder anzuregen.
»Irgendwie wird man im Sattel steif. Oder ist es das Alter?«, meinte er mit einer gewissen Koketterie.
»Vielleicht sind Sie das Reiten nicht mehr so gewohnt wie früher«, antwortete Walther mit dem Anflug eines Lächelns. »In den letzten Jahren sind Sie auf jeden Fall weitaus länger auf Ihrem Präsidentenstuhl gesessen als im Sattel. Das merkt man einfach.«
»Würde gerne noch immer auf dem Präsidentenstuhl sitzen, um ein paar Dummheiten verhindern zu können. Doch darüber möchte ich nicht mit leerem Magen reden.«
Houston ließ sich von Jones einen Becher mit dampfendem Kaffee und einen Teller mit einem riesigen Steak reichen, setzte sich auf seinen Sattel, den ein Vaquero auf den Boden gelegt hatte, und begann mit Genuss zu essen.
»Hieß es nicht, Ihre Frau würde bald niederkommen?«, fragte er Walther zwischen zwei Bissen.
»Sie durchlebt gerade ihre schweren Stunden. Quique hat mich hierhergeschleppt, damit ich auf dem Ranchhof nicht aus lauter Angst und Sorge vergehe«, antwortete Walther mit hörbarem Selbstspott.
»Dann ist es vielleicht ganz gut, dass ich gekommen bin. So können wir über alte Zeiten reden und damit ein wenig die Gegenwart vergessen.« Houston lachte zwar, doch seine Miene verriet, dass ihm alles andere als froh zumute war.
»Das Steak schmeckt ausgezeichnet«, sagte er zu Jones. »Ebenso der Kaffee! Ich habe in letzter Zeit selten besseren getrunken.«
»Das freut mich, Mister President«, antwortete der Schwarze.
Houston hob abwehrend die Hand. »Präsident? Das war ich mal. Jetzt sitzt ein anderer auf meinem Stuhl, und der wird uns noch gewaltig in die Scheiße reiten. Entschuldigen Sie den derben Ausdruck, Walther. Aber es ist nun einmal so.«
»Da kommt Benito!«, rief Josef und zeigte auf den Rancharbeiter, der im vollen Galopp heranfegte und den Gaul erst kurz vor Walther zum Stehen brachte.
»Ich soll Ihnen mitteilen, dass Ihnen eine Tochter geboren worden ist, Señor!«, rief er atemlos. »Ja, und Ihrer Señora geht es gut.«
»Gott sei Dank!«, entfuhr es Walther.
Houston reichte ihm die Hand. »Ich gratuliere, Walther! Das ist wenigstens eine Neuigkeit, über die man sich freuen kann. Sie werden sicher zu Frau und Kind eilen wollen.«
»Das möchte ich natürlich«, antwortete Walther.
»Dann bezähmen Sie Ihre Ungeduld wenigstens so lange, bis ich mein Steak gegessen und meinen Kaffee ausgetrunken habe. Später wird es sicher etwas Stärkeres zu trinken geben.«
»Sie werden mit Tequila vorliebnehmen müssen, denn Whisky habe ich keinen.« Walther lächelte, denn er kannte Houstons Vorliebe für geistige Getränke. Doch ob nüchtern oder betrunken, dieser Mann war bei weitem mehr wert als der, der jetzt als Präsident von Texas auf seinem Amtsstuhl saß. Daher wartete er, während Houston gemütlich sein Steak aß und dabei über Belanglosigkeiten sprach.
Unterdessen lenkte Josef seinen Mustang neben Quiques Hengst und streckte die Arme nach seinem Bruder aus. »Waldemar kann diesmal mit mir reiten!«
Der Vaquero überlegte kurz und setzte dann den Dreijährigen vor Josef aufs Pferd. »Gib gut acht auf ihn!«, mahnte er.
»Das tue ich!«, versprach Josef und hielt seinen Bruder fest. »Das schaffen wir beide schon, nicht wahr, kleiner Wolf?«
»Ja, großer Puma«, antwortete der Kleine und drehte sich zu Josef um. »Wir wollten doch ein Brüderchen haben!«
»Ja, das wollten wir«, sagte Josef seufzend. »Mädchen sind zu nichts nütze! Sie quieken wie Tante Rachels Abigail, wenn man sie in eine Pfütze stößt, und kneifen einen ganz böse, wenn niemand hinsieht.« Er dachte an Rachels und Thierrys älteste Tochter. Abigail war vier Monate jünger als Waldemar, sofort beleidigt, wenn man ihr nicht nachgab, und petzte fürchterlich bei den Erwachsenen.
Der Gedanke, dass auf der eigenen Ranch bald eine jüngere Ausgabe einer Abigail Coureur herumlaufen würde, gefiel Josef ebenso wenig wie seinem Bruder. Doch er würde sich zu wehren wissen.
»Wir werden ihr schon zeigen, wo es bei uns langgeht«, flüsterte er Waldemar zu. »Unsere Schwester darf einfach nicht quieken, wenn sie schmutzig wird, und sie hat auch den Mund zu halten, wenn wir einen Eselshasen oder ein anderes Stück Wild schießen wollen.«
Obwohl er Josefs Flinte bislang nur hatte ansehen dürfen, nickte Waldemar eifrig. »Das tun wir! Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so schlimm sein wird wie Abigail oder die anderen Nachbarsmädchen. Da passt Mama schon auf. Die schießt besser als die meisten Männer und lacht höchstens, wenn sie schmutzig wird.«
Anders als Josef, der sich noch an ihre leibliche Mutter erinnern konnte, nannte er Nizhoni Mama. Ihm kam auch nicht in den Sinn, dass Josef und er nur den Vater mit der Kleinen teilten, nicht aber die Mutter. Da die beiden Jungen ihr Schwesterchen trotz ihrer Vorbehalte bald sehen wollten, blickten sie böse zu ihrem Gast hinüber, den nichts aus der Ruhe zu bringen schien.
Endlich steckte Sam Houston den letzten Bissen in den Mund, wischte das Messer an seinem ledernen Hosenbein ab und nickte Walther zu. »Jetzt können wir zu Ihrer Ranch reiten.«
Walther befahl, die Pferde zu bringen, und stieg in den Sattel. Dabei sah er kurz zu Josef und Waldemar hinüber, sagte aber nichts, weil er seinem Ältesten genug Sorgfalt zutraute, weder sich noch Waldemar in Gefahr zu bringen.
Während sie zur Ranch ritten, blickte Houston sich immer wieder um. »Sie halten Ihren Besitz gut in Schuss, Walther. Das kann man hier wahrlich nicht von jedem sagen. Etliche besitzen zwar Land, sind aber kaum in der Lage, sich und ihre Familien davon zu ernähren.«
»Viele bilden sich ein, hier in Texas müssten ihnen die gebratenen Tauben ins Maul fliegen, und vergessen dabei, wie viel Mühe es kostet, das Land urbar zu machen.« Walther klang verächtlich, denn er kannte genügend Neusiedler, die genau diesem Bild entsprachen.
»Etlichen Siedlern wird bald etwas anderes um die Ohren fliegen als eine Taube, mag sie nun gebraten sein oder roh«, stieß Houston aus und vollzog mit seiner Linken eine abwiegelnde Geste. »Aber darüber reden wir später. Jetzt begrüßen wir erst einmal unsere neue Erdenbürgerin.«
4.
Obwohl Gertrude und Rachel Nizhoni rieten, im Bett zu bleiben, stand sie auf, kaum dass die Nachgeburt abgegangen war, und wusch sich von Kopf bis Fuß mit frischem Wasser. Sie badete auch die Kleine, die das kalte Nass nur protestierend ertrug und erst ruhig wurde, als ihre Mutter sie an die Brust legte und sie die Milchquelle entdeckte.
»Baden! So etwas! Hoffentlich wird das Kind nicht krank«, wandte Rachel ein.
»Das glaube ich nicht«, antwortete Nizhoni, während sie der Kleinen über das fast kahle Köpfchen strich.
»Ein kaltes Bad regt den Kreislauf an!«, zitierte Gertrude aus einem der wenigen Bücher, die es im French Settlement gab. Es beschrieb die Vorzüge, die es bringen sollte, sich in frischem Wasser und besser noch in einem fließenden Gewässer zu waschen.
Rachel verdrehte die Augen, sagte aber nichts, sondern blickte zum Fenster hinaus. »Langsam müsste Walther kommen!«
»Wenn die Vaqueros ihm gratulieren, kann er nicht einfach wegreiten«, wandte Gertrude ein.
»Mein Mann ist nach Abigails Geburt sofort zu mir gekommen«, rief Rachel.
Gertrude lachte sie aus. »Er war aber so betrunken, dass euer Knecht ihm aus dem Sattel helfen musste. Wir konnten ihm nicht einmal die Kleine in den Arm legen, aus Angst, er würde sie fallen lassen.«
Das stimmte zwar, dennoch zog Rachel ein langes Gesicht. »Dein Mann war bei der Geburt deines Jungen noch betrunkener als der meine.«
»Jetzt streitet euch nicht!«, mahnte Nizhoni die beiden. »Ihr habt beide prächtige Männer und solltet ihnen diese kleine Schwäche nachsehen. Immerhin haben sie nur aus Angst um euch getrunken.«
Nun mussten beide Geburtshelferinnen lachen.
»… und der deine hat Reißaus genommen!«, antwortete Gertrude. »Das war auch schon bei Josefs Geburt so. Allerdings hat Gisela sich damals sehr schwergetan. Wir hatten die ganze Zeit Angst, sie und das Kind zu verlieren.«
Für einen Augenblick war es Nizhoni, als sähe sie Walthers erste Frau, die ihre beste Freundin gewesen war, mitten im Zimmer stehen und ihr zulächeln. Tränen stahlen sich in ihre Augen, denn Gisela hatte diese Welt viel zu früh verlassen müssen.
»He! Du wirst doch nicht etwa anfangen zu weinen!«, rief Rachel, die von den anderen Frauen in der Nachbarschaft nicht zu Unrecht als Tolpatsch bezeichnet wurde. Da man im Allgemeinen aber gut mit ihr zurechtkam, sah man ihr diese Schwäche nach.
Nizhoni fühlte sich in ihrem Andenken an Gisela gestört und reagierte unwirsch. »Diese Tränen gelten jemandem, der mir heilig ist …«
… und der du die letzten Tage ihres Lebens zur Hölle gemacht hast! Den Rest des Satzes verschluckte sie jedoch. Immerhin hatte Giselas Tod alle Frauen in der Nachbarschaft tief getroffen, sogar Rachel, die sich seitdem besser in die Gemeinschaft eingegliedert hatte.
»Walther kommt zurück!« Gertrudes Bemerkung ließ sie die Unstimmigkeit zwischen ihnen vergessen.
Während Rachel begann, die Spuren der Entbindung zu entfernen und alles aufzuräumen, stellte Gertrude Wasser für frischen Kaffee auf den Herd. Zwar würden die Männer stärkere Getränke vorziehen, doch sie selbst und Rachel hatten ihrer Ansicht nach ein paar Tassen verdient.
Da die Kleine sich satt getrunken hatte und eingeschlafen war, richtete Nizhoni ihr Kleid und trat ans Fenster. Ihr Herz machte einen Sprung, als sie Walther entdeckte. Neben ihm ritten Josef und Waldemar auf Josefs Mustang. Da sie den Älteren gelehrt hatte, was Verantwortung bedeutete, lächelte sie zufrieden. Dann bemerkte sie einen weiteren Reiter, kniff kurz die Lider zusammen, um besser sehen zu können, und drehte sich dann zu den beiden anderen Frauen um. »Mister Houston ist bei Walther.«
»Der Präsident? Oh!«
Zwar war Houston abgewählt worden, doch wie viele andere nannte auch Rachel ihn aus Hochachtung oder Gewohnheit immer noch so. Sie trat aufgeregt an Nizhonis Seite und blickte ebenfalls den Reitern entgegen.
»Bei Gott, die beiden Jungen reiten auf einem Pferd. Ich würde sterben, wenn das meine wären!«
Da sie bislang nur zwei Mädchen geboren hatte, sagten weder Nizhoni noch Gertrude etwas. Beide waren gespannt, was Walther zu seiner Tochter sagen würde, und sie freuten sich, Sam Houston begrüßen zu dürfen. Seit jenem siegreichen Feldzug gegen die Truppen des mexikanischen Diktators Antonio López de Santa Ana, bei dem alle Männer des French Settlement bis auf einen gesund nach Hause gekommen waren, wurde Houston in diesem Landstrich beinahe wie ein Heiliger verehrt.
Nun ritt er mit Walther und den Jungen auf den Hof und stieg aus dem Sattel. Sofort eilten mehrere Rancharbeiter auf die vier zu. Pepe hob Waldemar vom Pferd und stellte ihn auf den Boden, während Josef leichtfüßig herabsprang und seinen Bruder bei der Hand fasste.
Walther strich beiden über den Schopf. »Gleich werdet ihr euer Schwesterchen sehen.«
Während Josef etwas unglücklich dreinschaute, verzog Waldemar das Gesicht. »Ein Brüderchen wäre mir lieber! Jemand wie Abigail können wir nicht brauchen.«
»Das ist eine klare Aussage!«, meinte Houston lachend, während die Knechte die Pferde wegführten, um sie abzusatteln. Er zerzauste Waldemars hellblonden Schopf und zwinkerte ihm zu.
»Da musst du dich beim Herrgott beschweren, denn der ist dafür verantwortlich. Weißt du, wie du ihm schreiben kannst?«
Waldemar und Josef schüttelten den Kopf.
»An Sankt Petrus, Himmelspforte. Der übergibt den Brief dem Heiligen Geist, der ihn dann dem Herrgott bringt!«
»Waldemar kann doch noch gar nicht schreiben!«, rief Josef mit einer gewissen Erleichterung. »Und ich werde es auf keinen Fall tun.«
»Feigling!«, maulte sein Bruder, doch das sah ihm Josef in dieser Situation gerne nach.
Walther warf den beiden einen mahnenden Blick zu und trat ins Haus. Er hatte erwartet, Nizhoni im Bett vorzufinden, doch diese stand mitten im Raum, das Neugeborene auf dem Arm, und sah ihn halb hoffend, halb ängstlich an.
»Wie geht es dir? Hast du alles gut überstanden?«, fragte er.
»Aber ja«, antwortete Nizhoni. »Das Kind ist gesund und hat auch schon getrunken. Doch es ist eben ein Mädchen und kein Junge, der einmal ein großer Krieger werden kann.«
»Wie kommst du auf den Gedanken, ich hätte einen Jungen gewollt?«, fragte Walther erstaunt.
»Nun, gesagt hast du nichts, aber ich dachte, ein Mann will …«, brachte Nizhoni heraus und wurde von Sam Houston unterbrochen.
»Wenn alle Frauen nur noch Knaben zur Welt bringen würden, weil die Väter es so wünschen, würde die Menschheit innerhalb einer Generation aussterben. In unserem Texas ist ein Mädel ebenso viel wert wie ein Bub. Das lass dir gesagt sein! Und jetzt zeige sie uns. Wenn ihr wollt, mache ich den Paten. Oder wollt ihr unbedingt eine Frau dafür nehmen?«
Walther sah ihn erfreut an. »Es wäre uns eine Ehre, Sam, wenn Sie der Pate unserer Kleinen würden. Das sagst du doch auch, Schatz?«
»Natürlich!«
Nizhoni lächelte erfreut. Wenn ein großer Häuptling wie Sam Houston Patenstelle an ihrer Tochter vertrat, würde dies die Geister ihrer Ahnen zufriedenstellen. Diese Überlegung erinnerte sie daran, dass sie ihrer Tochter auch das Erbe ihres eigenen Volkes würde vermitteln müssen und nicht nur das Leben der Weißen, auch wenn sie einen von ihnen zum Vater hatte.
»Dann machen wir es so!« Houston nahm die Kleine von Nizhoni entgegen und kitzelte sie am Kinn. Sofort öffnete das Mädchen die Augen und gluckste vergnügt.
»Na, wer sagt es denn! Ich habe immer noch Erfolg bei der Damenwelt.« Lachend reichte Houston das Kind an Walther weiter, der es mit einer Mischung aus Stolz und Dankbarkeit betrachtete.
»Hast du dir schon einen Namen ausgesucht, Walther?«, fragte Rachel, der es gar nicht gefiel, von Houston ignoriert zu werden.
Walther betrachtete das Neugeborene, das rebellisch in seinen Armen strampelte. »Nizhoni und ich hatten den einen oder anderen Namen in Erwägung gezogen, uns aber noch nicht entschieden.«
»Dann solltest du es bald tun«, forderte Rachel ihn auf.
»Dafür sollten wir ihm Zeit lassen«, sagte Houston lächelnd. »Es ist immerhin eine schwerwiegende Entscheidung, denn die Kleine wird diesen Namen ihr ganzes Leben lang tragen. Aber wollen wir nicht auf sie anstoßen?«
Es war eine Aufforderung, die Nizhoni sofort verstand. Sie holte mehrere Gläser vom Bord sowie eine große Flasche mit Tequila und schenkte den beiden Männern ein.
Rachel gab nicht nach. »Wenn ihr auf das Kind anstoßen wollt, müsstet ihr wissen, wie es heißt!« Sie machte auch sogleich einige Vorschläge, die jedoch alle der englischen Bibel entnommen waren.
Houston verdrehte ein wenig die Augen, trank dann sein Glas in einem Zug leer und nickte Nizhoni zu. »Der Schnaps ist gut! Wo gibt es den zu kaufen?«
»Den brennt Emilio Sanchez. Er mag kein besonders guter Farmer sein, aber sein Tequila ist ausgezeichnet«, erklärte ihm Walther.
»Können Sie zusehen, ob Sie ein paar Flaschen für mich bekommen, Walther?« Houston grinste breit. Auch wenn er nicht mehr so viel trank wie früher, gefiel es ihm doch, das eine oder andere Glas zu leeren. Nun füllte er sein Glas eigenhändig nach und stieß mit Walther an.
»Als Pate ist es doch eigentlich meine Sache, den Namen für die Kleine auszuwählen, nicht wahr?«
»Es wäre mir eine Ehre!«, sagte Walther.
»Dann lassen Sie unseren Goldschatz auf den Namen Maggie taufen.«
»Ein schöner Name«, fand Nizhoni und nahm Walther das Kind wieder ab. Sie hauchte einen Kuss auf dessen Stirn und wiegte es dann sanft in den Armen. »Du heißt jetzt Maggie«, flüsterte sie der Kleinen ins Ohr. Diese öffnete die Augen, verzog das Mündchen und machte dann lautstark klar, dass sie erneut Hunger hatte.
»Eine kräftige Stimme hat sie ja«, sagte Houston lachend, trank aus und zupfte Walther am Ärmel. »Wir sollten ein wenig spazieren gehen.«
Es lag ein Unterton in seiner Stimme, der Walther aufhorchen ließ. Unterwegs hatte Houston bereits einige Andeutungen fallengelassen, die Walther Übles ahnen ließen.
5.
Sam Houston blickte auf das Wasser des Rio Colorado, das im Gegensatz zu seinem Namen absolut klar an ihnen vorbeifloss, und setzte sich ins Gras. »Schön haben Sie es hier, Walther. Euch Deutschen geht doch einiges besser von der Hand als den Siedlern aus dem Norden. Die sind einfach zu ungeduldig und erwarten, dass sie das, was sie am Vormittag gesät haben, bereits am Nachmittag ernten können.«
»Ich hatte zehn Jahre Zeit dafür«, warf Walther ein.
»Ich hoffe, dass Sie auch weiterhin die Zeit haben, Ihre Ranch auszubauen!« Houston verzog das Gesicht und spuckte in den Fluss. »Präsident Lamar will die Komantschen aus ihren östlichen Jagdgründen vertreiben und ihr Land an Neusiedler verteilen.«
»Das werden sich die Komantschen nicht gefallen lassen!«, rief Walther erschrocken aus. »Wenn es zum Krieg kommen sollte, sind wir im French Settlement ebenfalls in Gefahr.«
»Nachdem seine Anhänger mehrere Karankawa-Gruppen vernichtet haben, glaubt Lamar, er könnte bei den Komantschen genauso weitermachen. Dieser Narr will mit einer Staatskasse, die so leer ist wie eine ausgetrunkene Whiskyflasche, und einer Armee, die nicht existiert, ein Indianervolk angreifen, das über tausend erfahrene Krieger einsetzen und an jedem Ort unseres Landes zuschlagen kann. Dieses Vorgehen wird zahlreiche Siedler das Leben kosten und das Land ruinieren. Ich habe es zu verhindern versucht. Aber in den Augen der meisten neuen Siedler bin ich nur ein alter, lahmer Wolf, der Angst davor hat, jüngere Männer könnten seinen Ruhm aus früheren Tagen übertreffen.« Houston klang bitter angesichts der Machtlosigkeit, zu der er verurteilt war.
»Das wird hart werden«, antwortete Walther nachdenklich, »und hinterher wird Texas Sie nötiger brauchen als jemals zuvor.«
»Schön wär’s!« Houston rieb sich über die Stirn und schüttelte dann den Kopf. »Wissen Sie, was es für ein Gefühl ist, wenn Sie alles, was Sie aufgebaut haben, den Bach hinabgehen sehen?«
»Doch, das weiß ich!« Walther erinnerte sich an seine Heimat, aus der er hatte fliehen müssen, aber auch an Gisela, die so lange ein Teil seines Lebens gewesen war. »Doch, das weiß ich«, wiederholte er und reichte Houston die Hand. »Es mag kommen, was will – ich stehe immer zu Ihnen, Sam!«
»Das weiß ich!« Houston ergriff die Hand und blickte sinnend auf das Wasser des Flusses. »Wissen Sie noch, wie wir mit unserer Armee vor Santa Anas Truppen davongerannt sind und unsere Soldaten uns deswegen verflucht haben?«
»Daran erinnere ich mich nur allzu gut!«
»Aber wir haben es ihnen allen gezeigt, den Mexikanern ebenso wie unseren Jungs – und vor allem den Geschäftemachern, die sich wie Blutsauger an uns geheftet hatten und für minderwertige Ware teure Landrechte haben wollten.«
»Auch das habe ich nicht vergessen«, sagte Walther leise.
»Ich habe damals einige der übelsten Kerle an die frische Luft gesetzt«, fuhr Houston fort. »Jetzt, nachdem ich weg bin, sind sie wiedergekommen und beschwatzen unseren neuen Präsidenten, und dieser Trottel hat ihnen etliches an Land überschrieben. Ein guter Teil davon muss jedoch von den Komantschen geholt werden. Es würde mich freuen, wenn ein paar dieser Schurken am Marterpfahl der Roten enden würden. Aber diese Kerle halten sich vornehm zurück und schicken andere vor, die die Sache an ihrer Stelle werden ausbaden müssen.«
»Wissen Sie, welche von diesen Geschäftemachern wieder aufgetaucht sind?«, fragte Walther beunruhigt.
»Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr ›Freund‹ Nicodemus Spencer wieder mit von der Partie ist, und der Kerl arbeitet wie damals mit James Shuddle zusammen. Die beiden spielen jetzt Empressarios, haben sich aber auch ein hübsches Stück Land für sich selbst gesichert. Spencers Besitz liegt etwas weiter im Norden, beginnt jedoch direkt an der Grenze des French Settlements. Damit ist er so gut wie Ihr Nachbar. Hüten Sie sich vor ihm! Er hat etliche Drohungen gegen Sie ausgestoßen und einige Schurken um sich versammelt. Er nennt sie zwar Cowboys, aber für die paar Kühe, die er bis jetzt auf seinem Land weiden lässt, würde ein Junge mit einer Haselrute ausreichen.«
»Spencer ist also wieder hier!« Walther erinnerte sich mit einer Mischung aus Grauen und Wut an den Mann, der nach der Schlacht von Waterloo Giselas Mutter erstochen hatte, weil diese ihn daran hatte hindern wollen, ihren Mann auszuplündern. Noch immer schmerzte es ihn, dass Spencer durch das Eingreifen eines englischen Offiziers seiner gerechten Strafe entgangen war.
»Er nennt sich inzwischen General, um bei den Siedlern Eindruck zu schinden. Daher habe ich als eine meiner letzten Amtshandlungen Sie ebenfalls zum General befördert und Ihren Freund Coureur zum Colonel.«
»Wie war das mit der nicht vorhandenen Armee?«, fragte Walther mit dem Rest von Spott, der ihm verblieben war.
»Ich glaube nicht, dass Lamar auf Sie und Coureur zurückgreifen wird. Sie gelten als Freund der Komantschen und – was noch schlimmer ist – als mein Freund.« Houston klopfte Walther auf die Schulter und grinste. »So einfach ist Politik! Sobald du gewählt worden bist, jagst du alle zum Teufel, die dein Vorgänger eingestellt hat, und setzt deine Freunde an deren Stelle, gleichgültig, ob sie für den jeweiligen Posten taugen oder nicht.«
»Das ist eine sehr dumme Sichtweise. Es wäre besser, Männer auf ihren Plätzen zu belassen, die etwas davon verstehen«, antwortete Walther kopfschüttelnd.
»Lamars Freunde wollen belohnt werden, und wenn etwas schiefgeht, waren eben andere schuld. Und diese Sache wird schiefgehen, das schwöre ich Ihnen.« Houston stand wieder auf und streckte Walther die Hand hin. »Kommen Sie! Kehren wir zu Ihrem Haus zurück und bewundern die kleine Maggie. Das ist angenehmer, als daran zu denken, welchen Unsinn unsere Regierung in den nächsten Monaten anstellen wird.«
6.
Zwei Tage blieb Sam Houston auf der Ranch, ließ sich Sanchez’ Tequila schmecken und ritt dann weiter nach Waterloo – oder vielmehr Austin, wie die Stadt Stephen Austin zu Ehren umbenannt worden war. Walther blieb als Opfer aufgewühlter Gedanken und Gefühle zurück. Ihn bedrückte nicht nur der drohende Krieg, sondern auch der Gedanke an den Mörder Nicodemus Spencer und all die Probleme, die mit diesem Mann verbunden waren.
Der geplante Krieg gegen die Komantschen erschien Walther im Augenblick jedoch wichtiger, und so beschloss er, das Lager von Po’ha-bet’chy aufzusuchen, jenem Häuptling, mit dem er seit Jahren Handel trieb. Ihm war klar, dass es ein Spiel mit dem Feuer war, denn wenn die Indianer zum Kampf entschlossen waren, würden sie auch ihn als Feind ansehen.
Als er sich mit Nizhoni darüber beriet, sah diese ihn nachdenklich an. »Es wäre am besten, wenn ich mitfahren würde! Dann sehen die Komantschen, dass wir in friedlicher Absicht kommen.«
»Das geht nicht!«, rief Walther. »Zum einen ist es zu gefährlich, und zum Zweiten ist Maggie noch viel zu klein für eine solche Reise.«
»Komantschinnen und die Frauen der Diné nehmen ihre Kinder vom ersten Tag an mit«, wandte Nizhoni ein.
»Nein, ich will nicht!« Walthers Ton ließ keinen Zweifel daran, dass er den Vorschlag seiner Frau ablehnen würde.
»Es wäre besser«, sagte Nizhoni leise. »Wenn du nur mit Männern kommst, halten die Komantschen euch für Krieger oder Späher.«
»Ich werde Josef mitnehmen. Er ist jung genug, um Po’ha-bet’chys Leuten zu zeigen, dass wir nicht als Feinde kommen!«
Das schien Walther ein guter Kompromiss. Der Junge war über sein Alter hinaus erfahren und ein ausgezeichneter Reiter. Auch traute er ihm zu, allein den Weg nach Hause zu finden, falls es doch Schwierigkeiten geben sollte.
Nizhoni wäre es lieber gewesen, sie und die Kleine begleiteten die Gruppe, doch sie hoffte, Josefs Anwesenheit würde ausreichen, um die Komantschen zu besänftigen. »Lass den Jungen auf seinem Mustang reiten, denn das Tier ist ein Geschenk von Po’ha-bet’chy. Auch soll er keinen Sattel nehmen, sondern die Decke, die ich für ihn genäht habe. Das zeigt den Komantschen, dass wir ihre Bräuche und ihr Leben respektieren.«
»Dieser Rat ist gut!« Walther küsste seine Frau und spürte in diesem Moment eine Zufriedenheit in sich, die ihn glauben ließ, alle Probleme bewältigen zu können.
»Reite mit dem Segen Gottes und mit dem der Geister meines Volkes«, flüsterte Nizhoni und lehnte sich gegen ihn. »Und komm gesund zurück!«
»Das werde ich!«, versprach Walther und sah zur Tür. »Die Jungen sind noch nicht im Haus. Dabei wissen sie, dass sie bei Dunkelheit hier sein müssen.«
»Sie werden sicher gleich kommen«, antwortete Nizhoni, um ihn zu beruhigen. Insgeheim dachte sie, dass alle Jungen gleich waren, mochten es nun Komantschen oder Weiße sein. Sie reizten jedes Gebot bis an seine Grenzen aus.
So war es auch diesmal, denn in dem Augenblick, in dem das letzte Licht des Tages erlosch, schossen Josef und Waldemar zur Tür herein, und der Große wies stolz einen ausgewachsenen Waschbären vor. »Den habe ich eben geschossen!«
»Aber ich habe keinen Schuss gehört«, entfuhr es Walther.
Sein Sohn zwinkerte Nizhoni spitzbübisch zu. »Ich habe auch nicht meine Flinte benützt, sondern den Bogen, den ich mir gebaut habe. Nizhoni sagt zu Recht, dass der Knall eines Schusses das Wild vertreibt. Machst du mir aus dem Fell eine Waschbärenmütze, wie David Crockett eine hatte?«
Die Frage galt Nizhoni, doch an ihrer Stelle antwortete Walther. »Wie kommst du auf den Gedanken, Colonel Crockett hätte eine Waschbärenmütze besessen?«
»So heißt es doch! Old Hedgehog Rudledge sagt, dass diese Mütze bei Alamo zwanzig mexikanische Kugeln aufgefangen hätte. Erst die einundzwanzigste wäre durchgegangen. Doch vorher hat David Crockett selbst mindestens zwanzig Mexikaner erschossen.«
»Rudledge erzählt zu viele blutrünstige Geschichten«, erklärte Walther und zupfte seinen Ältesten kurz am Ohr. Dann sah er sich den erlegten Waschbären an und nickte anerkennend. »Den hast du ausgezeichnet getroffen!«
»Ich will auch einen Bogen«, maulte Waldemar, dem es nicht gefiel, dass alle auf seinen großen Bruder schauten.
»Ich werde dir morgen einen schnitzen«, versprach Josef großzügig.
Doch da schüttelte sein Vater den Kopf. »Dazu wirst du nicht kommen! Ich werde morgen zu den Komantschen aufbrechen, und du wirst mich begleiten.«
Josef sprang voller Freude hoch. »Hurra! Endlich darf ich mit!«
»Es ist gefährlich«, erklärte Walther, »denn es könnte Krieg mit den Komantschen geben. Daher müssen wir vorsichtig sein.«
»Krieg mit den Komantschen? Aber wieso? Die haben uns doch nichts getan«, rief der Junge verblüfft.
»Es kommen immer mehr Siedler aus den Staaten nach Texas. Daher will der neue Präsident den Komantschen einen Teil ihres Landes wegnehmen und es den Siedlern geben.«
Josef sah ihn verdattert an. »Aber das Land gehört den Komantschen! Wir würden unseres doch auch nicht hergeben.«
»Nein, mein Junge, das würden wir nicht – und die Komantschen werden es gewiss nicht freiwillig tun. Daher dürfte es zum Krieg kommen. Aber ich will versuchen, uns und unsere Nachbarn aus diesem Krieg herauszuhalten.«
Walther klopfte Josef wie einem Erwachsenen auf die Schulter und hob Waldemar auf den Schoß, um ihm zu zeigen, dass auch er für ihn wichtig war.
Unterdessen ging Josef weiter zu der Wiege, in der Maggie lag, und streckte den rechten Zeigefinger aus. Sofort schloss sich eines der kleinen Händchen darum und hielt ihn fest.
»Man sollte nicht glauben, wie kräftig sie schon ist«, sagte er lächelnd.
Es war, als würde das Mädchen sich ihn zum Vorbild nehmen, denn auch auf ihren Lippen erschien ein Lächeln.
»Du bist eine ganz Süße«, fuhr Josef fort und hatte längst vergessen, dass er sich einen weiteren Bruder erhofft hatte.
7.
Am nächsten Morgen brach Walther kurz nach Sonnenaufgang auf. Außer Josef begleiteten ihn Quique und Jones. Den Vaquero kannten die Komantschen bereits, und der Schwarze sollte mitkommen, weil die Indianer wussten, dass viele weiße Männer seinesgleichen verachteten. Ihn an der Seite eines Weißen zu sehen würde den Komantschen zeigen, dass ihr Besucher nicht so war wie viele der neuen Siedler in Texas.
Walther wunderte sich, wie viel ihm auf den ersten Meilen ihres Weges durch den Kopf ging. Während Quique, Josef und er ritten, lenkte Jones den Wagen mit den Waren, die er zu den Komantschen bringen wollte. Wie immer verzichtete er darauf, Schusswaffen und Schießbedarf mitzunehmen. Nur Po’ha-bet’chy erhielt gelegentlich ein paar Bleikugeln oder ein Beutelchen Pulver. Diesmal hatte er jedoch nur eine Handvoll Rehposten für den Schrotlauf der Büchse dabei, die er dem Häuptling einst als Bezahlung für Nizhoni gegeben hatte. Seit jenem Handel waren fast zehn Jahre vergangen. Mittlerweile war Nizhoni seine Frau und hatte ihm eine Tochter geboren. Einige Augenblicke lang galten Walthers Gedanken den beiden, und er betete zu Gott, sie gesund wiederzusehen.
Im Gegensatz zu seinem Vater genoss Josef den Ritt aus vollen Zügen und bedauerte nur, dass er nicht auch indianische Tracht tragen durfte, wenn er schon auf die Art der Komantschen ritt. Für ihn war das Ganze ein großes Abenteuer, und er vertraute seinem Vater und Quique, sie alle wieder heil nach Hause zu bringen.
Josefs Freude wuchs noch mehr, als er bei der ersten Übernachtung ganz normal als Wachtposten eingeteilt wurde. Er übernahm zwar die erste Wache, in der Indianer nur selten angriffen, doch gab es ihm das Gefühl, ein wichtiges Mitglied ihrer Gemeinschaft zu sein.
Als sie am nächsten Tag weiterzogen, war Josef der Erste, der in der Ferne einen Indianer entdeckte. Als er seinen Vater auf ihn aufmerksam machte, nickte dieser anerkennend.
»Sehr gut, mein Sohn! Blicke aber nicht zu oft in diese Richtung, sonst glaubt der Mann, wir würden uns überlegen, wie wir ihn am besten erwischen können.«
»Wie weit ist es noch bis zu Po’ha-bet’chys Lager?«, fragte Josef.
»Wir werden diesen Tag und noch einen weiteren über die Prärie reiten. Wenn wir Glück haben, erreichen wir das Lager morgen Abend, sonst erst am dritten Tag«, erklärte Quique.
»In dieser Zeit legen wir fast einhundert Meilen zurück«, setzte Walther hinzu. »Die Komantschen schlagen jene Lager, in denen sie länger bleiben wollen, nicht in der Nähe der weißen Siedlungen auf, denn sie wollen mit unserer Welt nichts zu tun haben.«
»Aber unsere Sachen – die wollen sie doch!«, rief der Junge und wies auf den voll beladenen Wagen.
»Die wollen sie natürlich haben«, stimmte Jones ihm zu. »Was dein Vater sagen wollte, ist, dass die Komantschen nicht in Häusern aus Holz leben wollen wie die weißen Siedler, und auch nicht ackern und Vieh züchten. Sie jagen Büffel und anderes Wild und leben davon. Was sie darüber hinaus brauchen, das kaufen sie von uns.«
»Ich sehe weitere Indianer!«, rief Quique in dem Moment.
Walther warf einen Blick in die Runde und entdeckte ein halbes Dutzend Reiter, die etwa eine halbe Meile Abstand zu ihnen hielten.
»Das gefällt mir nicht!«, sagte Quique zu ihm. »Wenn wir sonst zu den Komantschen gefahren sind, hat uns nur ein einzelner Späher beobachtet. Jetzt sieht es so aus, als würden die Kerle nur auf eine Gelegenheit lauern, über uns herfallen zu können.«
»Das wäre ein recht einseitiges Geschäft«, meinte Jones mit einem missratenen Grinsen. »Unsere Pferde, unsere Waren und unsere Skalps – ohne ein einziges Büffelfell dafür bezahlen zu müssen.«
»So billig werden sie unsere Haare nicht bekommen«, antwortete Walther. »Immerhin sind unsere Büchsen und Pistolen geladen, und wir schießen gut.«
»Noch greifen sie nicht an«, wandte Josef ein. »Vielleicht sollten wir ihnen zeigen, dass wir friedlich sind.«
»Und wie?«, fragte Walther.
Der Junge trieb seinen Mustang mit einem schrillen Schrei an, den er von Nizhoni gelernt hatte, und legte rasch ein-, zweihundert Yards zwischen sich und den Wagen. Im nächsten Moment riss er das Pferd wieder herum und ritt in einem gut hundert Yard durchmessenden Bogen um seinen Vater und ihre Begleiter herum, bevor er sich wieder zu ihnen gesellte und sich so auf den Mustang setzte, dass beide Beine an einer Seite herunterhingen.
»Ich glaube, sie haben jetzt etwas, worüber sie nachdenken können«, meinte der Junge lachend.
Walther hatte einen gehörigen Schrecken ausgestanden, doch nun nickte er Josef zu. »Das war nicht schlecht, mein Sohn! Sie wissen jetzt, dass ein Junge bei uns ist, der wie einer der ihren reitet. Das wird sie hoffentlich davon abhalten, uns anzugreifen, bevor wir mit ihren Häuptlingen gesprochen haben.«
So ganz sicher war er sich dessen nicht, denn es gab immer wieder ehrgeizige Krieger, die auf eigene Faust losschlugen, um Ruhm zu erwerben. Daher hielt er sein Gewehr schussbereit, bemühte sich aber gleichzeitig, nicht den Eindruck zu erwecken, als sei er auf Kampf aus.
Scheinbar ohne sich beirren zu lassen, zogen sie weiter nach Westen und schlugen am Abend ihr Lager an einem kleinen Bach auf, der ihnen und ihren Pferden Wasser bot. Als sie am Lagerfeuer Pfannkuchen buken, sah Quique sich angespannt um.
»Ich weiß nicht, ob wir heute nicht Doppelposten aufstellen sollten«, meinte er. »Zwar ist kein Komantsche zu sehen, aber ich würde mein Pferd verwetten, dass sie sich ganz in der Nähe versteckt haben.«
»Wenn die Komantschen darauf aus sind, uns zu überfallen, helfen uns auch zwei Wachen nichts«, antwortete Walther. »Und wir müssten uns jeweils die halbe Nacht um die Ohren schlagen.«
»Das stimmt auch wieder«, gab Quique widerwillig zu. Er wollte schon vorschlagen, dass nur die drei Männer die Wache übernehmen sollten, dachte dann aber, dass die Indianer wahrscheinlich nicht gleich zu Anbruch der Nacht angreifen würden, sondern höchstens im Morgengrauen des nächsten Tages.
»Also schlafen wir uns aus und hoffen, dass der Schlaf kein ewiger wird«, erklärte er, sah noch einmal nach seinem Wallach und wickelte sich anschließend in seine Decke.
»Gute Nacht!«, wünschte Walther ihm laut genug, damit es ein Komantschenspäher in der Umgebung hören konnte. Unter denen war gewiss einer, der genug Englisch konnte, um ihre Worte zu verstehen.
»Werden wir morgen zu Po’ha-bet’chys Lager kommen?«, fragte Josef im Grunde auch viel zu laut.
Walther nickte dem Jungen zu. »Wenn wir früh aufstehen und unterwegs nicht trödeln, müssten wir es schaffen.«
»Dann ist es gut! Ich möchte dem Häuptling zeigen, wie gut ich mit dem Mustang zurechtkomme, den er dir für mich geschenkt hat, Vater.«
Die kurze Unterhaltung diente ebenfalls dem Zweck, den Komantschen, die mit Sicherheit in der Nähe lauschten, etwas zum Nachdenken zu geben. Nicht nur Po’ha-bet’chys Stamm, auch andere Gruppen der Komantschen wussten von dem Handel, den Walther mit diesem betrieb, und das konnte bewirken, dass man sie in Ruhe weiterreiten ließ.
8.
Am nächsten Tag hatte sich die Zahl der Indianer, die sie begleiteten, verdoppelt, und sie ritten nun knapp außerhalb der Schussweite einer guten Büchse neben Walthers Gruppe her. Nach einer Weile wandte Quique sich an Walther. »Was meinen Sie dazu, Señor? Werden sie bald angreifen, oder warten sie noch auf Freunde, um auch diesen das Vergnügen zu gönnen, uns umzubringen?«
Walther schüttelte den Kopf. »Hätten sie uns angreifen wollen, hätten sie es heute Morgen getan. Die Krieger wollen nur dafür sorgen, dass wir zu Po’ha-bet’chys Lager reiten, und uns nicht vorher in die Büsche schlagen.«
»Soll ich mit ihnen reden?«, fragte Josef. Nizhoni hatte ihm so viel von der Sprache der Komantschen beigebracht, dass er sich mit ihnen verständigen konnte.
»Du bleibst brav hier!«, beschied Walther ihm. »Die Komantschen sind stolze Krieger und würden es als Beleidigung ansehen, wenn wir einen Knaben als Boten zu ihnen schicken.«
»Genauso ist es«, stimmte Quique seinem Herrn zu, als er die Enttäuschung des Jungen wahrnahm. »Um von den Komantschen anerkannt zu werden, musst du deinen Wert als Krieger beweisen. Und das hat noch ein paar Jahre Zeit.«
Das sah Josef ein und fügte sich ohne Murren. Trotz Walthers beruhigender Erklärung wurden die nächsten Stunden zur Geduldsprobe. Alle atmeten daher auf, als sie am Abend den Bach der Hirschkuh erreichten und wenig später das Komantschenlager vor sich sahen, bei dem Walther schon mehrfach mit den Indianern Tauschhandel betrieben hatte. Nie zuvor hatte er so viele Zelte, Pferde und indianische Krieger gesehen. Es schien, als hätte sich das gesamte Volk der Komantschen an dieser Stelle versammelt. Reiter strömten ihnen mit schrillen Schreien entgegen, Schüsse aus alten Musketen und Pistolen ertönten, und Dutzende Pfeile zuckten haarscharf an ihnen vorbei.
»Keine Sorge!«, sagte Walther zu Josef. »Die Komantschen wissen genau, wie sie zu zielen haben. Sie wollen uns, aber auch ihren Frauen zeigen, wie gut sie mit ihren Waffen umgehen können – und uns ein wenig Angst machen.«
»Das gelingt ihnen recht gut«, meinte Jones mit einem missglückten Grinsen.
Walther übernahm nun die Spitze und grüßte mehrere Komantschen, die er von früheren Besuchen her kannte, darunter auch Po’ha-bet’chys Unterhäuptling Ta’by-to’savit. Mit einem Mal wurden die Krieger ruhiger und öffneten ihnen eine Gasse. Mehrere Häuptlinge schritten ihnen entgegen, an der Spitze ein Mann im wallenden Federschmuck. Po’ha-bet’chy, der einen halben Schritt hinter ihm ging, hielt die silberbeschlagene Doppelbüchse im Arm, die ihren Weg aus den deutschen Wäldern in die texanische Wildnis gefunden hatte. Er wirkte ernst, als er auf Walther zutrat und vor dessen Pferd stehen blieb.
»Du kommst zu einer schlechten Zeit, Fahles Haar!«
Der Spitzname, den Nizhoni ihm einst gegeben hatte, wurde seit einer Weile auch von den Komantschen benutzt. Walther wiegte lächelnd den Kopf und befahl Jones, die Plane des Wagens zurückzuschlagen.
»Wir haben gute Ware für das Volk der Nemene dabei«, sagte er, ohne auf Po’ha-bet’chys Worte einzugehen.
»Pah!«, rief der Mann mit der Federkrone. »Was soll an diesen Waren gut sein? Ich sehe nur Messer, aber keine Büchsen oder Pistolen, ja nicht einmal Pfeilspitzen aus Eisen!«
»Fahles Haar verkauft weder Waffen noch Feuerwasser«, erklärte Po’ha-bet’chy. »Doch seine Decken sind warm, seine Kochtöpfe fest, und seine Messer helfen den Weibern, die Büffel zu zerlegen, die die Krieger töten.«
Es machte sich bezahlt, dass Walther den Komantschen stets gute Qualität geliefert hatte, denn viele Händler brachten ihnen nur minderwertige Ware und ließen sich diese teuer bezahlen. Einen solchen Händler hätte der jetzige Besuch bei den Komantschen das Leben kosten können. So aber wies Po’ha-bet’chy Jones an, den Wagen ins Lager zu fahren, und winkte mehrere junge Burschen heran, sich um die Pferde der Gäste zu kümmern.
»Du kommst wirklich zu einer schlechten Zeit, Fahles Haar«, wiederholte der Häuptling. »Der große Häuptling der Texaner hat beschlossen, Krieg mit den Nemene zu führen. Männer mit weißer Haut sind daher in den Zelten unseres Volkes nicht mehr willkommen.«
»Ich bin kein Feind der Nemene und werde meine Waffen nicht gegen euch erheben«, antwortete Walther ernst. »Es sind auch nicht alle Texaner mit Häuptling Lamar einverstanden, sondern stehen zu Häuptling Houston, der Frieden mit dem Volk der Nemene halten will.«
»Häuptling Houston hat jedoch nicht mehr die Macht, den Stamm der Texaner vom Krieg abzuhalten«, wandte Po’ha-bet’chy ein.
Walther hob beschwichtigend die Hand. »Ein Teil der Texaner will vielleicht den Krieg. Ich aber werde mich nicht daran beteiligen, und ich glaube, auch für meine Freunde und Nachbarn sprechen zu können!«
»Fahles Haar war immer ein Freund der Nemene!« Po’ha-bet’chys Worte galten weniger Walther selbst als vielmehr den Stammesanführern, die sich in seinem Lager versammelt hatten und seine Beziehung zu dem weißen Mann nicht kannten.
»Warum verkauft Fahles Haar uns dann keine Büchsen?«, fragte der Federkronenträger bissig.
»Weil Fahles Haar ein Mann des Friedens ist. So, wie er keine Waffe gegen das Volk der Nemene erheben wird, so verkauft er keine Waffen, die gegen sein Volk eingesetzt werden können.«
Po’ha-bet’chy klang noch immer ehrerbietig, doch seine Augen blitzten ärgerlich auf. Obwohl er einer der nachrangigen Häuptlinge seines Volkes war, so ärgerte es ihn doch, sich und Walther in seinem eigenen Lager verteidigen zu müssen.
»Du hast auch diesmal gute Waren gebracht, Fahles Haar«, erklärte er noch einmal laut genug, so dass alle es hören konnten. »To’sa-mocho mag sich ein Messer, eine Decke und einen Kochtopf als Geschenk nehmen, dann können wir handeln.«
Obwohl der hochrangigere Häuptling gegen Walther gestichelt hatte, wollte er nicht auf die Geschenke verzichten. Er stieg auf den Wagen und musterte die Messer, die zwar etwas kürzer waren als Jim Bowies sagenumwobenes Knife, aber vom Schmied nach diesem Vorbild hergestellt worden waren. Zuletzt nahm er eins und schnitt damit einen Span von der Bordwand ab.
»Das Messer ist gut!«, sagte er anerkennend. Bei der Decke und dem Kochtopf war er weniger wählerisch, sondern griff einfach zu. Danach kehrte er mit gravitätischen Schritten zu dem Zelt zurück, das er bewohnte.
Walther suchte passende Geschenke für Po’ha-bet’chy und einige andere Häuptlinge aus, die sein Handelspartner ihm nannte. Es kostete ihn fast ein Fünftel seiner Waren, doch das Opfer würde dazu beitragen, so hoffte er, den Frieden mit den Komantschen zu bewahren.
Anschließend kamen andere anerkannte Krieger und schließlich die Frauen, denen vor allem an Decken, Töpfen und Nähzeug gelegen war. Sie kauften auch Glasperlen, um ihre Kleider und die der Kinder zu verzieren. Andere Händler verlangten oft unverschämte Preise dafür, aber Walther gab sie billig her. Im Gegenzug stapelten die Indianer ihre Tauschwaren neben dem Wagen auf. Es waren vor allem Waren, die wegen des bevorstehenden Krieges mit den Texanern für überflüssig erachtet wurden, wie die schweren Büffelfelle, die beim Abbruch des Lagers eine zusätzliche Last bedeuteten, aber auch Mustangs, die nicht gebraucht wurden. Ein Komantsche reichte Walther sogar einige mexikanische Silbermünzen, die nur von einem Überfall auf eine Siedlung südlich des Rio Grande stammen konnten.
Als die Nacht hereinbrach, war der Handel abgeschlossen. Quique und Jones luden die eingetauschten Waren auf den Wagen, während Josef mit ein paar Knaben die Mustangs bewachte. Zuerst spotteten die jungen Komantschen über ihn, doch als er sie in ihrer eigenen Sprache anfuhr, nicht so dumm daherzureden, schlossen sie rasch Freundschaft.
Walther wurde unterdessen von Po’ha-bet’chy in dessen Zelt eingeladen. Es gab Büffelfleisch sowie gekochten Mais, dem allerdings ein wenig die Würze fehlte. Bedient wurden sie von Per’na-pe’ta, einer der Frauen des Häuptlings, und deren Mutter To’sa-woonit. Letztere war eine alte, verhutzelte Frau, die Walther nicht mochte, weil weiße Männer ihren Mann erschossen hatten. Dies hinderte sie jedoch nicht, einige Glasperlen von ihm zu erbetteln, mit denen sie das neue Gewand ihrer Enkelin schmücken wollte.
Nach dem Essen zündete sich Po’ha-bet’chy seine Pfeife an und blies nachdenklich Rauchringe gegen die Wände des Zeltes. Erst jetzt kam er wieder auf die Situation in Texas zu sprechen. »Der neue Häuptling der Texaner ist ein Narr!«, erklärte der Häuptling. »Wir Nemene sind tapfere Krieger. Wir werden die weißen Männer aus unseren Jagdgründen vertreiben und ihre hölzernen Zelte verbrennen.«
»Krieg ist immer schlecht«, antwortete Walther. »Dieses Land ist groß und könnte beide Völker, sowohl die Nemene wie auch die Texaner, ernähren. Doch einige weiße Männer wollen mehr Land, als sie brauchen.« Er dachte an Nicodemus Spencer, jenen betrügerischen Spekulanten, der sich von der Regierung von Texas Landrechte über mehrere hundert Quadratmeilen guten Bodens erschwindelt hatte. Mit Sicherheit steckte Spencer auch hinter Lamars Entschluss, die Komantschen aus ihren östlichen Jagdgründen zu vertreiben. Wenn dies gelang, war das Land, das Spencer an sich gebracht hatte, so viel wert, dass es ihn zum reichsten Mann von Texas machen würde.
»Fahles Haar ist ein Mann des Friedens! Doch wer den Frieden will, muss jene bekämpfen können, die ihm diesen Frieden nicht gönnen«, antwortete der Häuptling mit einem nachsichtigen Lächeln.
Walther nickte zustimmend. »Damit hast du recht! Doch ich weiß meinen Frieden durchaus zu schützen. Erinnere dich daran, wie wir Texaner vor fünf Jahren die Krieger des mexikanischen Häuptlings Santa Ana besiegt haben.«
Po’ha-bet’chys Miene wurde ernst. »Daran erinnere ich mich, und ich bin froh, dass Fahles Haar nicht an der Spitze der Texaner reitet, die gegen uns ziehen werden. Du bist ein großer Krieger!«