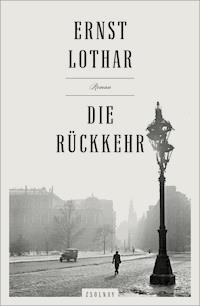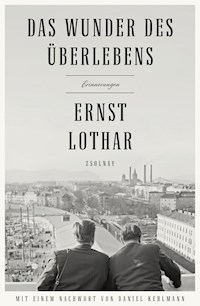
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Diese Erinnerungen sollten Pflichtlektüre sein.“ (Daniel Kehlmann) – Ein bewegendes Dokument von Ernst Lothar, Autor des internationalen Erfolgs „Der Engel mit der Posaune“. „Der Tag, an dem Österreich-Ungarn unterging, traf mich ins Herz … etwas Unersetzliches war gestorben.“ Ernst Lothar war ein Kind des Habsburgerreiches und blieb es bis zu seinem Ende. In der Ersten Österreichischen Republik machte er sich einen Namen als Theaterkritiker, und bis zu seiner Emigration leitete er gemeinsam mit Max Reinhardt das Theater in der Josefstadt. Nach Kriegsende kehrte er als Entnazifizierungsoffizier zurück und übernahm trotz Anfeindungen führende Positionen am Burgtheater und bei den von ihm mitbegründeten Salzburger Festspielen. „Es ist schwer möglich, diesen genialen kindlichen Menschen nicht ins Herz zu schließen“, schreibt Daniel Kehlmann in seinem Nachwort zu "Das Wunder des Überlebens": „Diese Erinnerungen sollten Pflichtlektüre sein.“
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»Diese Erinnerungen sollten Pflichtlektüre sein.« (Daniel Kehlmann) — Ein bewegendes Dokument von Ernst Lothar, Autor des internationalen Erfolgs »Der Engel mit der Posaune«.»Der Tag, an dem Österreich-Ungarn unterging, traf mich ins Herz … etwas Unersetzliches war gestorben.« Ernst Lothar war ein Kind des Habsburgerreiches und blieb es bis zu seinem Ende. In der Ersten Österreichischen Republik machte er sich einen Namen als Theaterkritiker, und bis zu seiner Emigration leitete er gemeinsam mit Max Reinhardt das Theater in der Josefstadt. Nach Kriegsende kehrte er als Entnazifizierungsoffizier zurück und übernahm trotz Anfeindungen führende Positionen am Burgtheater und bei den von ihm mitbegründeten Salzburger Festspielen. »Es ist schwer möglich, diesen genialen kindlichen Menschen nicht ins Herz zu schließen«, schreibt Daniel Kehlmann in seinem Nachwort zu »Das Wunder des Überlebens«: »Diese Erinnerungen sollten Pflichtlektüre sein.«
ERNST LOTHAR
DAS WUNDER DES ÜBERLEBENS
Erinnerungen
Mit einem Nachwort von Daniel Kehlmann
Paul Zsolnay Verlag
Inhalt
Erster Teil
Klanglose Ouvertüre
Ankläger
Ein Reich wird klein
Kritiker
Adrienne
Experimente
Theaterdirektor
Flüchtling
Bettler
Zweiter Teil
»Spell your name!«
»Keep us out of war!«
Der Garten der Götter
Das Wunder des Überlebens
Bürgerprüfung
Was kränkt, macht krank
Eine Minute Panik
Europa taucht auf
Entzauberung
Dritter Teil
Das Alltägliche
Österreichisches Zwischenspiel
Simplifizierung
Relativität der Wichtigkeiten
Indizien
Der stoische Regenschirm
Der Autor ruft sich zur Ordnung
Jedermann oder: Die Künste von Hellbrunn
Angeklagter
Ein Mann des Theaters und die Sache des Theaters
Der Regenbogen oder: Österreich wird frei
Siebzig Jahre in sieben Minuten oder: Der Rhythmus meines Lebens
Nachwort von Ernst Lothar
Nachwort
von Daniel Kehlmann
Personenregister
»Denn dieses scheint die Hauptaufgabe der Biographie zu sein, den Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze widerstrebt, inwiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenansicht daraus gebildet …«
Goethe
Erster Teil
DIE GRENZEN DER GEOGRAPHIE
Klanglose Ouvertüre
Meine ersten Erinnerungen sind aufgepflanzte Bajonette und eine Theatervorstellung. Beides in Brünn, der Hauptstadt Mährens, jener Markgrafschaft der österreichisch-ungarischen Monarchie, die eine aus Deutschen und Tschechen gemischte Bevölkerung hatte. Die Tschechen verlangten gleiche Rechte wie die Deutschen und demonstrierten dafür, daher waren Gewehrpyramiden mit aufgepflanzten Bajonetten nächst unserer Wohnung aufgestellt. Vom Fenster sah es lustig aus, wie die Leute auf dem Platz sich plötzlich nicht bewegen konnten, doch als ich darüber lachte, wurde es mir verwiesen. Ich gedenke der schrillen tschechischen Schreie und der Stimme meines Vaters, der sagte: »Da ist nichts zu lachen!«
Mein Vater war Rechtsanwalt, zu lachen nicht gewohnt. Auch meine Mutter hatte sich das Lachen frühzeitig abgewöhnt, zumindest sah ich sie meist ernsthaft; nur wenn sie Scherzgedichte zu spärlichen geselligen Anlässen verfertigte und sie mit ihrer Altstimme vortrug, erkannte man, wie fröhlich sie hätte sein können.
Ihr danke ich die zweite mir bewusste Erinnerung, einen Theaternachmittag. Selbst damit lief es nicht zum Besten ab, weil ich, vor Aufregung oder was es sein mochte, gerade als ich mich zum Weggehen fertigmachte, Krämpfe bekam, weshalb man mir einen erhitzten irdenen Deckel — »Stürzel« genannt — vorband. So ausgerüstet, schaffte eine ältere Aufsichtsperson mich in das nur eine Straße entfernte Stadttheater.
»Die Geisha« führten sie auf, eine in China spielende Operette, und der Deckel auf meinem Leib behinderte den Anfang. Auf einmal spürte ich ihn nicht mehr. Eine jähe Vergessenheit des Wirklichen kam über mich, »Tschin, tschin, Tschainamann, bist ein armer Tropf!«, sangen sie, dass jemand mich beaufsichtigte, wusste ich nicht, dass andere Leute außer mir da waren, verschwand, ich war glücklich. Davon, was auf der Bühne vorging, weiß ich nichts mehr, nur von dem Glücksgefühl. Und von einer willigen Bereitschaft, dem Wirklichen zu entlaufen.
Wenn ich daran zurückdenke, erscheinen mir diese ersten beiden Erinnerungen, vor denen ein absolutes Bewusstseins-Nichts liegt, kennzeichnend für mein Leben. Mit Bajonetten und dem Theater fing es an. Fast endete es so.
Wir wohnten auf dem Glacis, einer ehemaligen Befestigungsanlage, zu einer hübschen grünen Promenade umgewandelt, wo mittags und abends Leute lustwandelten, die sich Muße leisten konnten, vom »Schwedendenkmal« bis hinauf in die Nähe des »Deutschen Hauses«, fast täglich dieselben. Ein Finanzrat, der die Musikkritiken für den »Tagesboten« schrieb — die Schauspielkritiken schrieb ein Mathematiklehrer —; die koketten Töchter des Polizeidirektors; der Schauspieler Recke, der ihm begegnenden Bekannten den Text seiner Rollen rezitierte, um ihn bequemer zu erlernen, etwa mit den Worten: »Wie sagt Dr. Rank?«; der Professor der Technischen Hochschule von Bleyleben, dessen Söhne in Wiener Ministerien saßen; der liberale Reichsratsabgeordnete Baron d’Elvert, der gelegentlich stehenblieb, mit dem Spazierstock ärgerlich auf den Boden klopfte und seine Opposition kundgab; der Reichsratsabgeordnete Otto Lecher, den eine sechzehnstündige Obstruktionsrede berühmt und den »Filibuster«-Senatoren auf Capitol Hill zum Muster gemacht hatte; der bucklige Halsarzt Landesmann, sein Vater, Hieronymus Lorm genannt, zählte zur mährischen Literatur wie der düstere J. J. David, Richard Schaukal, modisch und hoffähig, und der robuste Karl Hans Strobl, schon damals ein brüderlicher Heimatkünder, der den deutschen Bruder herbeiwünschte; der blutjunge, flinke Hubert Marischka vom Stadttheater, an der Seite eines nicht viel älteren, schnurr- und knebelbärtigen Kapellmeisters namens Robert Stolz; immer dieselben Leutnants des Infanterieregimentes No. 8, gelegentlich einige des gleichfalls in Brünn stationierten nobleren Dragonerregimentes No. 6 mit wechselnden Begleiterinnen, an Sonntagmittagen spielte die Militärkapelle von No. 8 blechern dazu auf. Vom Oktober bis zum April.
Im Mai aber »übersiedelten« wir, das heißt, es wurde ein Möbelwagen gemietet, der Kisten und Körbe verfrachtete, während wir mit der »Lokalbahn«, einer dampfbetriebenen Beförderung, die kleine halbe Stunde zurücklegten, um in einen Vorort zu gelangen. Dort besaßen wir, Schreibwaldstraße 120, ein Sommerhaus, »Villa« genannt, ein einstöckiges Fünfzimmergebäude mit brauner, wildweinbewachsener Schweizerstil-Veranda, deren Aussicht die Rübenfelder der Bauer’schen Zuckerfabrik bildeten. Von dieser Veranda sah ich einen in Bärenfelle notdürftig gehüllten jungen Hünen bei einem Festzug das Ganze zum jähen Stillstand bringen und, unterhalb unseres Hauses, meiner Mutter ein Ständchen bringen, er schmetterte es zu ihr hinauf, hieß Leo Slezak und war ein Sänger des Stadttheaters. Von hier geschah es auch, dass ich den Posten kerzengerade auf und ab schreiten sehen durfte, wenn allsommerlich der Kommandant des 2. Armeekorps, Graf Alexander Üxküll-Gyllenband, die Brünner Garnison inspizierte und bei meinen Eltern zu Mittag speiste.
Mit der Rückfront ging unsere Villa in einen Garten über, der die Freude meiner Kindheit blieb. Nicht breit, doch langgestreckt, führte er mäßig steigend, in Zier-, Gemüse- und Obstgarten geteilt, endlos ins Unendliche, wie mir damals schien, obschon es kaum mehr als zehn Minuten in Anspruch nahm, um zu dem Holzzaun zu gelangen, der ihn abschloss, und womit er an die unbebauten Hügel der »Pulvertürme« grenzte; doch eine Tür mit verrostetem Schloss, zu der es einen versteckten Schlüssel an einem rostigen Nagel gab, öffnete ihn. Und sobald diese Tür aufging, hinter der sich nie jemand befand, nur Halden, Sträucher und im Hintergrund dichte Laubwälder, herrschten Unbegrenztheit und Einsamkeit, die mich mit Lust erfüllten, mit Schutz vielmehr. In der Einsamkeit und in der Grenzenlosigkeit, fand ich, war gut sein.
Ein spätgeborenes Kind alternder Eltern, hätte ich eine Schwester ersetzen sollen, die ein Jahr vorher gestorben war. Meine beiden Brüder, Robert um dreizehn, Hans um acht Jahre älter, befanden sich längst in Wien auf der Universität, als ich in die Brünner Volksschule eintrat. So war ich zeitig auf mich angewiesen. Die Eltern taten das Erdenkliche für mein leibliches Wohl, woran es oft gebrach, die Aufsichtspersonen sorgten für ihr eigenes; Kinder, meiner Anfälligkeit für ansteckende Krankheiten wegen, kamen selten in meine Nähe; es gab Wochen, Jahre will mir scheinen, da ich außer mit meinen Eltern mit niemandem sprach, in beständiger Angst vor neuem Fieber, abermaligem Bettgefängnis, jedes Klopfen an der Tür den Arzt androhend, das verhasste Niederhalten der Zunge mit einem großen kalten Löffel nebst jenem »Ah!«-sagen-Müssen, das sich von Freudenrufen unerfreulich unterschied.
Kinderspiele kannte ich kaum. Umso inniger genoss ich jene grenzenlose Freiheit unseres Gartens. Ich stieg den steilen Weg in die Unendlichkeit hinauf, bis zum »großen Nussbaum«, vergewisserte mich, dass ich allein war, öffnete die rostige Tür und, wohin ich schaute, trat nichts mir in den Weg. Von Märchen belehrt, die ich gierig las, erhob ich mich zum Herrscher einer gefügig hingebreiteten Welt, indem ich, auf einem Stein sultanisch thronend oder mit zusammengezogenen Knien und verschränkten Armen indianisch auf der Erde kauernd, meine Wälder aufbot, dafür zu sorgen, dass ich ungestört blieb. Später baute ich mir unter dem Nussbaum ein »Verlies«. Dort las ich, was mir in die Hand kam. Andersen blieb mein Liebling, und »Das hässliche junge Entlein« wusste ich auswendig.
Wenn man dergleichen nach sehr vielen Jahren zu Papier bringt, regt sich beträchtlicher Widerstand. Nicht nur, dass einem das Mitgeteilte, außer für einen selbst und an den Fingern einer Hand abzuzählende andere, bedeutungslos erscheint, was Grund genug wäre, die Menge der Selbsterinnerungen nicht zu vermehren, tritt das sich dabei einschleichende Übel der Selbstbeweihräucherung noch unliebsamer hervor. Mag man immerhin, da man nun einmal Rechenschaft über das eigene Leben abzulegen beschloss, sich damit beschwichtigen, dass manches in diesem Leben verdiente, der Vergessenheit zu entgehen, nicht nur weil es ungewöhnlich war, sondern weil es zu den Ergebnissen der Einordnung führte, in der die Existenz den Sinn empfängt, so bleibt trotzdem das Peinliche bestehen, sich darstellen zu sollen. Da lauert auf Schritt und Tritt die Gefahr der Voreingenommenheit, weil man mit sich ja ebenso schlecht bekannt wie nachsichtig ist. Doch mag der Leser glauben, dass der Autor, dieser Gefahr inne, ihr begegnen will; wie er sich auch, wo es die Wahrheit verlangt, an sie und sonst an nichts halten wird. Anders erscheinen Lebenserinnerungen mir zwecklos, weil sie, wenn überhaupt etwas, Tatsachen sind, die weder der Schminke noch der Schmückung bedürfen. Wer die Schuld am Verschuldeten nicht sich und denen gibt, die sie haben, kann auch das Anzuerkennende nicht rühmen.
Die grundsätzliche Bemerkung zwang sich auf, angesichts der rühr- und trübseligen Figur des kränklichen Knaben, der, seiner Einsamkeit märchenhaft ergeben, Vorahnungen irgendwelcher Auserwähltheit zu erwecken bestimmt schien. Dies aber ist nicht der Fall. Denn er brachte es zwar nie zur Robustheit, verlor indes allmählich seine Scheu, machte weder zu gut noch zu schlecht die Aufnahmsprüfung in das Brünner »Erste Deutsche Staatsgymnasium« und wurde, als seine Eltern Brünn verließen und Wien zum Wohnsitz wählten, ein Gymnasiast, der Wien verführerisch und, wie tausende andere Gymnasiasten, das Gymnasium eine Zwangsanstalt fand. Daher entlief er ihr, sooft er konnte, bestand trotzdem die Matura und wurde, weil sein Vater keinerlei besondere Fähigkeiten an ihm entdecken konnte, Jurist an der Wiener Universität, um später die väterliche Kanzlei zu übernehmen, obschon ihr bereits in dem Ältesten, Robert, ein juristisch graduierter Anwärter zur Verfügung stand. Dass der Jüngste inzwischen Gedichte gemacht hatte, von denen einige abgedruckt wurden, erweckte in der Familie umso weniger Eindruck, als sie an einem Schriftsteller bereits genug hatte, dem Zweitgeborenen, Hans.
Die Familie war von Seiten der Mutter mit dem Theater entfernt verknüpft. Einer ihrer Onkel war der Münchner Hofschauspieler und Molière-Darsteller Alois Wohlmuth, ein anderer der Musikkritiker Eduard Hanslick, von Wagner in den »Meistersingern« als Hans Lick — der später Beckmesser hieß — mit einem Denkmal gerechten Zornes bedacht. Des zarten eisgrauen Männchens, das mich auf dem Tappeiner-Weg in Meran unwillig nach meinem Namen fragte und dem damals Elfjährigen, nur damit er sich schnell wieder entferne, einen Apfel schenkte, erinnere ich mich gut. Und standen zwar die sogenannten »unsoliden Berufe« bei meinem Vater nicht hoch im Kurs, im Falle der schriftstellerischen Raketenlaufbahn meines Bruders Hans war eine Ausnahme erlaubt, und sie wurde gemacht; Hans war der Stolz der Familie, im Besonderen der meine.
Die Beziehung zu ihm, erst in späteren Jahren durch äußere Umstände getrübt, behielt eine tiefe Zärtlichkeit. Auf Studienurlaub in Brünn, war er immer wieder an meinem Bett gesessen, um mir vorzulesen oder vorzuspielen, und ihm danke ich es, wenn trotz Masern und Mumps, Rippenfellentzündung und Wechselfieber selige Stunden der Verzauberung schlugen; einmal, bei jenem Aufenthalt in Meran, wohin man mich zur Rekonvaleszenz geschickt hatte, war er meine einzige Aufsicht und unterrichtete mich auf Spaziergängen in den vielen versäumten Gegenständen mit solcher Geduld und Phantasie, dass sich die Ziffern, Vokabeln und Regeln einfanden, als wären sie keine Bürde, sondern Spielgefährten. Und als ich heranwuchs, erfüllten mich, dem dergleichen ungleich schwerer wurde, die Leistungen seines strömenden Talentes, die Leichtigkeit seiner Erfindung, die Ursprünglichkeit seiner Formbegabung mit Bewunderung. Ich gedenke des Tages, als ich, achtzehnjährig, vor der Direktionstür des Burgtheaters, durch die ich später so oft gehen sollte, stundenlang auf Hans wartete, der eines seiner ersten Schauspiele, »Die Puppenschule«, dem Direktor Paul Schlenther eingereicht hatte; an den Gitterstäben des gegenüberliegenden Volksgartens zählte ich: ja, nein, ja, nein, desto aufgeregter, je länger es dauerte, bis er mit der Nachricht erschien: »Angenommen! Premiere 8. Mai, Hauptrolle Sonnenthal!« Da hatte dieser junge Mann mit dem Dutzendnamen Hans Müller verwirklicht, was mir so entscheidend schien, das Ausbrechen aus der geordneten, erbötigen, selbstzufriedenen Bürgerlichkeit, das Hinzeigendürfen auf eine brüchig gewordene Majoritätsmoral, den Anspruch, gehört zu werden, wenn für unsere Gerechtigkeit das Wort genommen wurde — so jedenfalls erschien mir damals sein Beginnen. Denn das war es ja, was mich selbst zum Schreiben zwang, wobei ich, im Schatten des Erfolgumglänzten unsichtbar, mir keinen Augenblick einbildete, es ebenso gut oder gar besser zu machen. Und als ich einsah, dass ich es anders machte, sah das sonst niemand, zumindest nicht die Familie, ich legte den Familiennamen ab und beschränkte mich auf meine Vornamen.
In dieser Feststellung liegt keine Bitterkeit. Es versteht sich, und ich verstand es, dass in einem auf Disziplin gestellten Haushalt — nicht zufällig war mein Vater Vizepräsident des Disziplinarrates der mährischen Advokatenkammer gewesen — gerade noch für einen Einzelgänger Raum blieb, nicht für deren zwei; und dass vor dessen Lorbeerkränzen und Einkünften die einzelne Postkarte, ein Gedicht sei für fünfzehn Mark zum Abdruck erworben worden, wenig Glanz verbreitete. Wenn ich mir neben so Brotlosem gar noch in den Kopf gesetzt hatte, sozialkritische Essays, ja einen länglichen, nie fertiggewordenen »Versuch über die ideelle Verpflichtung des Dramas« zu verfassen, behielt ich es für mich; wurde aber hin und wieder in Hardens »Zukunft«, in der »Münchner Allgemeinen Zeitung« oder in der Wiener Monatsschrift »Der Merker« etwas davon gedruckt, dann schaffte ich die Belegexemplare beiseite oder verbarg sie wie meine übrigen Schreibereien in den Skripten des Römischen Rechtes.
Diese waren damals mein Teil, und ihnen bewahre ich kein gutes Gedenken. Dass ich je an einem Beamtenschreibtisch sitzen würde, hielt ich für ausgeschlossen, weil Ämter mich abstießen — Stefan Zweig sagte mir in New York, nicht lange vor seinem Selbstmord: »Man fühlt sich schon schuldbewusst, wenn man nur in das Vorzimmer eines Beamten tritt!« Dass ich Rechtsanwalt werden könnte, kam mir noch unmöglicher vor. Denn nach allem, was zu Hause über die »Kanzlei« geredet worden war, fabelte ich sie mir als einen Ort der Rechtsverdreherei und des Ohrenabschneidens zusammen, deren Sinn es blieb, Recht nicht herzustellen, sondern zu verdunkeln.
Auch das verbarg ich, wenn ich, anscheinend ein fleißiger Student, morgens die elterliche Wohnung verließ, um bei Herrn Professor Adler Rechtsgeschichte, bei Herrn Professor Wlassak »Römische Institutionen« zu hören. Ich nahm auch den richtigen Weg zur Universität — fast bis dorthin. Nur begab ich mich, hinter dem Burgtheater, in das Café Landtmann, wo man, winters durch die Fenster, in der guten Jahreszeit von der Terrasse, die Universität, doch auch das Burgtheater vor Augen hatte. Mit der Aussicht auf beide und den Honoraren für meine Gedichte als Taschengeld, entnahm ich meinen Studienbehelfen die Manuskriptblätter, an denen ich gerade schrieb, und so gelang es mir, binnen zwei Semestern zwar nicht die erforderlichen Kolloquien, dafür aber einen Roman zu machen; er hieß »Der Strom«, befasste sich mit dem Leerlauf des äußeren Lebens, enthielt eine Studentenrevolution und eine Belagerung der Universität — die Gewehrpyramiden meiner Kindheit! — und erschien niemals. Das nahm ich in Kauf, denn ich hatte, mit neunzehn, an der Rolle eines Weltverbesserers genug. Das Fatale war nur, wie die Sache aufkam.
Seit dem Frühjahr hafteten meine Augen beim Schreiben auf einer Dame am Nebentisch. Da ich sie reizend fand, grüßte ich sie beim Kommen und Gehen, und als ich nicht mehr zweifeln konnte, dass ihr Lächeln einiges verhieß, sprach ich sie an, das erste weibliche Wesen, bei dem ich das wagte. Sie ließ es nicht nur zu, was mir umso mehr schmeichelte, als sie älter war als ich, sie ließ sich auch in Gespräche ein, ja eines Junimorgens folgte sie meiner Einladung, ihr Frühstück an meinem Tische einzunehmen.
Es ergab sich, dass sie nicht, wie ich vermutet hatte, eine Dame der Gesellschaft, sondern eine Studentin war, die Moralphilosophie bei Laurenz Müllner hörte, also meinesgleichen, und ihr schmeichelhaftes Interesse an mir ging so weit, dass sie mich bat, ihr aus dem Manuskript vorzulesen, dessen Wachstum, sie erwähnte das, seit längerem ihre Aufmerksamkeit erwecke. Ob auch das Vorgelesene sie fesselte, erfuhr ich von ihr nicht, weil sie aufbrechen musste, um ihre eigene Vorlesung nicht zu versäumen. Doch als ich am selben Mittag nach Hause kam, gab mir mein Vater bekannt, er wisse längst, ich vergeude, statt zu studieren, die Tage mit Nichtstun; da indes die ersten beiden Semester eines Juristen traditionell durchfaulenzt würden, habe er mich meiner Wege in der Erwartung gehen lassen, ich würde ihrer endlich von selbst überdrüssig werden. Dass ich allerdings seine Langmut damit lohne, Schundromane zu erzeugen, ja mir zur Stätte des darin getriebenen Unfugs die Universität ausersehe, sei ein zu starkes Stück, um es seinerseits hinzunehmen. Er erging sich dann absprechend über das Kapitel, das ich am Vormittag jener an mir so freundlich interessierten Dame vorgelesen hatte.
Erfahrene Juristen lassen sich nicht hinters Licht führen, das wunderte mich nicht. Dass sich aber reizende junge Damen dazu hergaben, ihnen das Licht aufzustecken, enttäuschte mich. Ich weigerte mich daher entschieden, das mir abgeforderte Manuskript herauszugeben, fasste jedoch zwei Entschlüsse: den Roman niemandem mehr zu zeigen und vor dem Lächeln angeblicher Moralphilosophinnen auf der Hut zu sein. Den ersten Entschluss führte ich aus, brachte mich sogar dahin — vermöge sogenannter Schnellsiederkurse —, Staatsprüfungen und Rigorosen abzulegen. An der Verwirklichung des zweiten scheiterte ich, weniger kraft der Moralphilosophinnen als dank der Verzauberung, die sie und minder gewitzte Geschlechtsgenossinnen in unsere Existenz bringen, die ihrer unermesslich bedarf. Die zu nüchtern waren, sterben früh. Doch die zu wenig Freude hatten, leben nicht.
Ankläger
14. Juni 1914. Durch die hohen Fenster eines Prüfungssaales der Wiener juristischen Fakultät fällt die Sonne. Der Rigorosant im Gehrock, der weiße Glacéhandschuhe aus einer Hand in die andere nimmt und entlang dem mit grünem Tuch überzogenen Prüfungstisch hin und her geht, hat keine Augen für den Sommer, der, unter den Fenstern, aus dem Rathauspark und, weiter links, aus dem Volksgarten herüberstrahlt, er behält die Tür im Auge, durch die der Prüfer jeden Augenblick eintreten wird. Es ist das letzte Rigorosum, der Rigorosant bin ich.
Nach dieser Prüfung ist die Zeit der Knechtschaft vorbei. Dann liegt die Welt offen da — gut, man ergab sich darein, das staubige Zeug, das man sowieso nie brauchen wird, in sich hineinzupauken, jedoch die Abrede lautete: Sobald das Doktorat bestanden ist, darf ich ein Jahr auf Reisen gehen; die Mittel dazu liefern mir zwei inzwischen erschienene Bücher, und was fehlt, werde ich mir durch Zeitungsberichte erwerben; keinem werde ich zu Hause fehlen, niemandem zur Last fallen, aber Rom, Paris, London, das Meer endlich gesehen haben! Und sollte ich mir nach diesem Jahr zu meinen Vornamen einen Namen gemacht haben, von dem sich leben ließ, werde ich in die väterliche Anwaltskanzlei nicht eintreten, sondern Schriftsteller bleiben. So lautete die Abrede mit meinem Vater. Und die nächsten eineinhalb Stunden würden darüber entscheiden.
Die Tür öffnete sich, ein kleiner nervöser Herr tritt ein. Hat er sich geirrt? Es ist Hofrat Bernatzik, Professor des Staatsrechtes, das nicht zum Lehrgebiet des »Romanum« gehörte, einer der sarkastischesten Prüfer der Universität — er hatte bei der Staatsprüfung des jungen Grafen Kielmansegg, dessen Vater Statthalter gewesen war, gesagt: »Dass Sie Statthalter werden, kann ich nicht verhindern, aber verzögern werd’ ich’s!« Und als Fritz Stiedry, später Wagner-Dirigent der Metropolitan, Herrn Bernatzik, der nach der ersten unbeantworteten Frage aufstand, tollkühn erklärte: »Ich habe meine Prüfungstaxe für je fünfzehn Minuten bezahlt!«, hatte er sich wieder hingesetzt, die Uhr in der Hand, weitergeprüft, ohne dass der Prüfling den Mund auftun konnte, und nachher bemerkt: »Danke, Herr Kandidat, Ihre fünfzehn Schweigeminuten sind auf die Sekunde vorbei.«
Er nennt meinen Namen, nimmt Platz. Ich fühle mich verpflichtet, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass ich das »Römische Rigorosum« abzulegen habe, nicht das von mir bereits bestandene staatswissenschaftliche; er antwortet: »Das stimmt. Ich suppliere für Herrn von Hussarek.« Mehr Pech konnte man nicht haben! Auf Herrn von Hussarek, Ordinarius für Kirchenrecht, einen der freundlichsten Examinatoren, hatte ich meine Hoffnungen gebaut, denn in Kirchenrecht wusste ich mich am schwächsten.
»Sagen Sie mir, Herr Kandidat«, begann sein Stellvertreter im typischen Prüferton, »schreiben Sie nicht in der ›Neuen Freien Presse‹?« Auf die Pflichten des Diözesanbischofs oder die Ehehindernisse nach kanonischem Recht gefasst, bejahte ich. »Das war also von Ihnen, dieses Feuilleton ›Kunst und Zeit‹?« Ich bejahte neuerlich. »Sie meinen aber, dass die Kunst der Zeit nachzuhinken hat?«
»Mit ihr zusammen- oder ihr vorauszugehen, Herr Hofrat.«
»Wie die Damenkleider? Sie glauben, weil man nicht mehr in der Postkutsche fährt, sind Hexameter nicht mehr möglich, und weil man elektrisches Licht brennt statt Kerzen, muss man den ›Faust‹ im heutigen Anzug spielen?«
Jetzt war ohnedies alles verloren, denn wenn er zu höhnen anfing, ließ er durchfallen. Daher sagte ich genauso scharf: »Ich glaube, dass jede Zeit der Kunst ihren Ausdruck prägt. Es gibt überzeitliche Kunst, den Homer, den ›Faust‹, und es gibt zeithafte Kunst; aber keine zeitlose. Das Nachahmen der überzeitlichen ist Sache der Epigonen, das Der-Zeit-Ausweichen ist Sache der Amüseure. Die es ernst meinen, suchen in der Kunst ihre Zeit und umgekehrt.«
»Und Sie meinen es ernst, Herr Kandidat?« Sein sarkastischestes Lächeln begleitete die Frage, und weil ein solenner Durchfall jetzt unzweifelhaft war, bejahte ich sie. Jedoch der supplierende Prüfer für Kirchenrecht zeigte ein Lächeln. »Was wissen Sie vom Aufgabenkreis des Patrons?«
Aus dem Schnellsiederkurs fiel mir ein lateinischer Vers ein:
»Patrono debetur honor, onus, utilitasque,
Praesentat, praesit, defendat, alatur egenus.«
Der Prüfer stand auf. »Ausgezeichnet, Herr Kandidat. Ich hoffe, dass Sie das bald wieder vergessen werden. Meinerseits habe ich vergessen, Ihnen zu sagen, dass ich Ihr Novellenbuch ›Die Einsamen‹ für eine Talentprobe halte. Schaun S’ nur, dass Sie den Schnitzler nicht kopieren! Kirchenrecht werden Sie jedenfalls nicht mehr brauchen!« Und ging.
Wie typisch österreichisch! Unter der Maske des Sarkasmus Teilnahme; im exakten Beruf die Lust am Musischen. Dass die Wiener Chirurgen Klarinette, die Internisten Geige, die Laryngologen Klavier spielten, wusste ich aus den Büchern Arthur Schnitzlers, den nicht zu kopieren mir empfohlen war; dass die Staatsrechtslehrer in Literatur dilettierten, erfuhr ich jetzt. Eine Stunde später stand ich, »per majora« approbiert, in der wolkenlosen Sonne. Von den vier Prüfern hatten nur drei mir ihre Stimme gegeben. Sollte der für das Kirchenrecht supplierende Staatsrechtslehrer sie mir verweigert haben? Auch das wäre typisch österreichisch gewesen. Man zeigt Charme und hat Tücke.
Durchgekommen war ich, das Jahr der Freiheit begann. Es endete zwei Wochen später. Da befand ich mich schon in Belgien, von allem entzückt, von Brüssel, von »Bruges, la morte«, von Verhaeren, an den ich eine freundliche Empfehlung Stefan Zweigs hatte, vom Meer, von dem Badeort Westende, wo ich eine junge Wienerin wiedertraf, deren Vater Franzose war — so entzückt war ich, dass ich mich, ich war kaum angekommen, mit der in London geborenen jungen Wienerin verlobte; es war der 27. Juni.
Am 28. ging ich zum Postamt, um den Eltern meine Verlobung mitzuteilen. »Bin unaussprechlich glücklich«, telegraphierte ich. Als ich das Postamt verließ, wurde eine Depesche öffentlich angeschlagen: Der österreichische Thronfolger und seine Gattin waren in Sarajevo einem Attentat zum Opfer gefallen.
Auf der »Plage« fand ein Kinderfest statt. Mary, meine Braut, führte ihre zehnjährige Schwester im Zuge mit, die vielen Kinder jauchzten, Mary winkte mir selig. Am nächsten Morgen kam ein Telegramm meines Vaters: »Musst du alles überstürzen. Politische Situation erfordert sofortige Rückkehr.« Offenbar sah Mary mir an, dass dieses Telegramm nichts Gutes enthielt, denn sie fragte: »Bin ich deinen Eltern zu arm oder zu hässlich? Oder beides?«
Die elf Worte entschieden über einen Teil meines Lebens. »Sie sind von dir begeistert«, antwortete ich.
»Willst du’s mich nicht lesen lassen?«, fragte sie.
Ich las ihr etwas vor, das nicht darin stand, nur die politische Situation zitierte ich. Doch dass sich diese drohend verändert haben sollte, schien uns in unserem Sommerglück Schwarzseherei. Was für andere Folgen konnte der abscheuliche Mord haben, als dass man ihn abscheulich fand? Das sprichwörtliche Maßhalten unseres alten Kaisers jedenfalls schloss jede Voreiligkeit aus.
»Sur le pont d’Avignon — on y dance tout en rond«, sangen die Kinder auf der »Plage«. Zärtlich sangen die Erwachsenen »Ouvre tes yeux bleux, ma mignonne!«, in der »Rotonde«. So viele Sterne über dem Ozean wie diese Nacht hatte ich vorher nie gesehen.
Sie verschwanden, raues Wetter setzte ein. Kaum jemand badete im Meer, wir befanden uns unter den wenigen. Dass der Zuruf »Sales Autrichiens!« uns gelten konnte, als wir frierend in die Badekarren zurückliefen, war unwahrscheinlich. Doch galt er uns, und mein zukünftiger Schwiegervater, der trotz seiner Jugend in London und den Mannesjahren in Wien die französische Denkart beibehalten hatte, erklärte uns, »le Ballhausplatz« — was er »Ballohplace« aussprach — treibe eine unmögliche Politik der Herausforderung, die vom Quai d’Orsay gebremst werden müsse, sollte nicht »une conflagration Européenne formidable« entstehen. Als wären sie heute gesprochen, höre ich seine Worte, die ich, auf der obersten Stufe des Badekarrens sitzend, absurd empfand. Im Frieden aufgewachsen, von Vätern oder Müttern stammend, die mitunter in dem Hause starben, wo sie geboren waren, solcher selbstverständlichen Sicherheit genossen sie, war meiner Generation der Begriff Krieg abhandengekommen.
In dem Staatsanwaltssubstituten-Zimmer, dreieinhalb Jahre später, war er mir, wie meiner ganzen Generation, fürchterlich bekannt. Dem k. u. k. Dragonerregiment No. 6, hellblauer Waffenrock, schwarze Aufschläge, das dreimal totgeschossen, dreimal wieder aufgestellt wurde, gehörte ich nicht mehr an. Ich war kriegsunfähig erklärt worden, »superarbitriert« nannte man das, und machte jetzt Dienst im Hinterland als Staatsanwaltsgehilfe; Zwang und improvisierende Eile, damals an der Macht, verwandelten mich aus einem widerwilligen Rechtspraktikanten in einen »Auskultanten«, wie die erste Stufe der richterlichen Laufbahn hieß; als solcher hatte ich nach Wels in Oberösterreich »abzugehen«, um den auf einen wichtigeren Posten berufenen Staatsanwaltsstellvertreter zu ersetzen — ich schneite im wahrsten Sinne des Wortes in meine Bestimmung hinein; es war ein eisiger, schneegepeitschter Winter, und von meinem neuen Dienst wusste ich nicht viel mehr als die Schneeflocken, die an mein Fenster flogen.
Gleichwohl musste ich dem »Chef«, Erstem Staatsanwalt Dr. Erwin Budinsky, einem Mann von sittlichem Ernst und Menschenkenntnis, »oben« und »unten« zur Verfügung stehen. Oben, das heißt im zweiten Stock des Kreisgerichtsgebäudes — es verfügte über ein Gefangenenhaus, das buchstäblich »Fronfeste« hieß —, hatte ich Anklagen zu verfassen, unten, nämlich im Parterre, hatte ich sie als sogenannter »staatsanwaltschaftlicher Funktionär« zu vertreten: Die oben galten jenen schweren Delikten, die Staatsanwälte in Barett und Talar einem Gerichtshof vorbringen; die unten den Vergehen und Übertretungen, welche lediglich vor einen Bezirksrichter kamen. Zu den »oberen« Agenden aber gehörte auch die Kriegszensur der Presse, strengen Permanenzdienst erheischend, ob es sich nun darum handelte, »Nachrichten über die Entbindung der Kaiserin Zita zu unterdrücken«, oder um die Unterdrückung der Unterdrückungen Krieg, die mir aus etwas Unvorstellbarem in dreieinhalb Jahren gespenstisch vertraut geworden war.
»Anzuklagen« befand ich mich hier, jedoch das, was ich innerst anzuklagen und für dessen Sträflichkeit ich aus dreieinhalb Jahren niederschmetternde Beweise anzuführen gehabt hätte, genoss meinen ausdrücklichen Schutz. Ein Zyniker hätte sagen können: Der Mörder klagte den Mord an.
Ich sitze dort in der grünen, mit violettem Samt ausgeschlagenen Dienstbluse der Gerichtsleute, schreibe aus dem Formelvorrat meines Vorgängers ab: »Die k. k. Staatsanwaltschaft Wels erhebt gegen X. Y. die Anklage, X. Y. habe an dem und dem Tage dies und jenes Unzulässige und dadurch das Verbrechen nach Paragraph soundso begangen«, ohne es ein wirkliches Verbrechen zu finden. Denn aus dreieinhalb Jahren weiß ich viel zu viel von Mord, Meuchelmord, Totschlag und schwerer körperlicher Beschädigung, die nicht angeklagt, sondern belohnt worden waren.
»Sie müssen über diesen innern Konflikt hinwegkommen«, meinte der Chef, »Sie haben ja nicht für sich allein einzustehen. Sie haben Frau und Kind!« Jawohl, der Herr Erste Staatsanwalt hatte recht — ich hatte geheiratet, und das Kind lag im Wägelchen, das Mary schob, pünktlich um eins und sechs holte sie mich vom Kreisgericht ab, wenn die Anklagen erhoben, »vertreten« und die Strafen ausgeteilt waren. Denn dass unnachsichtlich gestraft wurde, war unser Amt, gegen zu geringe Strafen erhoben wir Berufung und gegen Freisprüche die Nichtigkeitsbeschwerde.
»Du taugst zu dem Beruf nicht«, sagte Mary.
Beide hatten sie recht, der Chef und sie. Ich taugte zu dem Beruf nicht, doch ich übte ihn aus; ich hatte nicht für mich allein einzustehen, denn ich besaß eine Frau und ein Kind, und war sechsundzwanzig.
Eines Nachmittags trat jemand, dessen Anblick mich aufspringen und verneigen ließ, in mein Arbeitszimmer. Heinrich Lammasch war es — bei dem ich Strafrecht inskribiert, teilweise sogar gehört hatte —, später österreichischer Ministerpräsident und, als Mitglied der Haager Friedenskonferenz, eine Weltgestalt, von der Welt mit Respekt genannt. Sein weißbärtiges Gesicht musterte mich einen Augenblick, dann sagte er: »Der Herr Erste Staatsanwalt ist auf einer Dienstreise, höre ich. Darf ich mich an Sie wenden?«
An mich wenden! Dürfen! Ich bejahte dienstfertig und lud den alten Herrn zum Sitzen ein, doch er zog es vor zu stehen. Er wäre hier auf der Durchreise, sagte er, nehme bereits den nächsten Zug, sein Anliegen sei kurz. Die Staatsanwaltschaft Wels behandle den Fall eines gewissen jungen Mannes, dessen Namen er nannte: Der junge Mann sei ein Verwandter. War der Fall mir bekannt?
Er war es, und es war kein leichter Fall. Dies aber schien der berühmte Besucher anzunehmen, oder schien er zu wünschen, dass es angenommen werde? Ich fürchtete, was er jetzt sagen würde. Denn er war es gewesen, der uns Studenten die Unabhängigkeit der Justiz gelehrt und streng gefordert hatte, sie zu wahren, um jeden Preis: keine Interventionen, keine Beeinflussungen. »Das Einzige, was bei einem Richter zu intervenieren hat«, pflegte er zu sagen, »ist das gesatzte Recht.« Würde er im Amtszimmer seines Schülers seine Lehre verleugnen?
Den Akt in der Hand, fürchtete ich es. Er fragte: »Wird die Anklage erhoben werden?« Als ich bejahte: »Hat das die Voruntersuchung unangreifbar ergeben?« Auf mein abermaliges Ja zögerte er, sagte dann: »Ich danke für Ihre Auskunft.« Die Worte fielen ihm schwer, er fügte nichts hinzu, reichte mir die Hand und empfahl sich. Vom Fenster aus sah ich ihn, wie er im Schnee fortging, ein wenig gebückt. Jedoch seine Grundsätze hatte er aufrechterhalten und mir ein Beispiel gegeben, um dessentwillen ich zum ersten Male Stolz empfand, der Justiz zu dienen.
Unvergesslicher Besuch. Wann immer seither Persönliches das Sachliche bei mir zu verdrängen drohte, beschwor ich die Erinnerung an den alten, makellosen österreichischen Herrn, der im Schnee verschwand.
Noch als ich mich in Wels aufhielt, rief ich sie zu Hilfe. In der kleinen Provinzstadt, an der gemessen die Provinzstadt Brünn eine Metropole gewesen war, gab es weniges, das verborgen blieb, jeder erfuhr von jedem, und so wurde auch bekannt, der Erste Staatsanwalt verfüge über einen Gehilfen aus Wien, der dort Bücher geschrieben hatte und damit hier fortfuhr. In der Tat war ich an dem tintigen Schreibtisch im zweiten Stock des Kreisgerichtes, wann immer eine freie Stunde kam, mit einem Roman beschäftigt. »Der Feldherr« hieß er, und was anderes hätte er zum Inhalt haben können als den Krieg.
Eines Abends befand ich mich wieder beim Schreiben, da erschien unvermutet der Chef; schnell wollte ich mein Manuskript unter Akten verschwinden lassen, als er neben mir stehend sagte: »Um diese Gabe beneid’ ich Sie! Wie schön muss es sein, sich von dem allen befreien zu können!« Dabei schob er die Akten auf den Platz zurück, wohin sie gehörten. Dass ich Schriftsteller sei, wusste er von Frau Urban, der Zuckerbäckerin, Frau Urban hatte es von Herrn Höng, dem Fleischhauer und Eigentümer des Hotels Greif, erfahren, und dieser von dem Oberleutnant Heine-Geldern des in Wels garnisonierten Landwehrulanenregimentes; gelesen freilich hatte keine der Gewährspersonen etwas von mir, man hielt nicht viel von Büchern in der kleinen Stadt, deren künstlerische Ansprüche von Operettengastspielen des Linzer Landestheaters im Saal des Hotels Greif befriedigt wurden.
Immerhin wusste der Chef, wie meine Bücher hießen, und missbilligte nicht einmal, dass ich auch hier im Amte eines schrieb — keiner meiner Vorgesetzten übrigens hat das je getan, im Gegenteil. Vom Ersten Staatsanwalt Budinsky bis zum Sektionschef Siméons fühlten sie sich als Schutzherren meiner Arbeiten, fast stolz darauf; sie trachteten sogar, mir ihrethalben den Dienst zu erleichtern. Wie österreichisch auch das!
»Eigentlich g’hört’s dazu«, meinte Herr Budinsky an jenem Abend. »Der Grillparzer hat ja auch im Amt g’schrieben. Und der Sektionschef Schaukal und der Wildgans, wie er bei Gericht war. Wenn s’ zu schreiben anfangen, sind s’ meistens Rechtspraktikanten oder Auskultanten wie Sie. Und wenn s’ Hofräte sind, sind s’ berühmt und schreiben noch immer. Passen S’ auf, auch bei Ihnen wird’s so sein. Und glauben S’ mir, eine bessere Schule zum Schreiben als die Justiz, wo man die Menschen sieht, wie sie wirklich sind, kann’s gar nicht geben!«
Dass ich Hofrat und berühmt werden würde, brachte mich zum Lachen, die Freundlichkeit und das Verständnis aber bewegten mich. War es die Vermehrung meiner Kenntnisse von den Menschen, »wie sie wirklich sind«, die den Ersten Staatsanwalt bestimmten, mich bald darauf zu einer Hinrichtung zu delegieren? An einem allzu frühen Morgen jedenfalls befand ich mich in einer zum Kreisgerichtsprengel gehörigen Strafanstalt, um einem Hinzurichtenden als Amtsperson gegenüberzutreten.
Da ich dessen gedenke, wird mir noch heute vor Grauen kalt. Es ist Winter und finster. Im Gefängnishof, notdürftig beleuchtet von übelriechenden Karbidlampen, wird ein Mann »vorgeführt« werden, der um 5 Uhr 15 tot sein muss. Es ist 5, einige Gerichtspersonen, der Henker und sein Gehilfe warten. Dahin führt das, denke ich. Das Anklageerheben, das Anklagevertreten, das Scharfsein. Das Aufschnellen vom Sitz, wenn der Verteidiger etwas zugunsten des Angeklagten vorbringt oder ein Zeuge ihn entlastet, der Hohn, womit man dergleichen abtut, dahin führt das: dass aus dem bewachten Tor dort einer kommen, in der linken Ecke am Galgen hängen und um 5 Uhr 15 tot sein wird — jetzt lebt er noch, betet vielleicht, hat Frau und Kinder und irrsinnige Angst! Aber er hat ein Verbrechen begangen, rede ich mir zu, einen tückischen Mord, mit Gift, meuchlerisch, das fordert Sühne — wohin käme die menschliche Gesellschaft, wenn das ohne Todesstrafe abginge! Es geht aber ohne sie ab, widersprach ich mir, zu ebendieser verzweifelt-frühen Stunde geschah hundertfach, was dieser einzelne Mann tat, mit Trommelfeuer geschah es, am Isonzo und an der Somme, es wurde sogar verlangt, wer es nicht tat, wurde als Kriegsverbrecher bestraft, wer es am tödlichsten tat, als Held dekoriert.
Da wird er schon hereingeführt, zwischen zwei Justizwachen, der Gefängnisgeistliche geht voran. Ein junger Mensch ist es, er schaut zuerst in die falsche Richtung, auf uns, dann in die richtige, auf den Galgen. Sein Gesicht, von den stinkenden Lampen angeleuchtet, ist fahl und glatt, hat er sich rasiert? Es bekommt einen unsäglichen Ausdruck um die schmalen Lippen, als er des Galgens ansichtig wird, er schreit: »Hilfe!«
»Sie müssen jetzt sprechen«, sagt einer der Gerichtsleute leise zu mir. Was ich zu sprechen habe, habe ich gelernt: »Ich übergebe den Delinquenten dem Herrn Scharfrichter.« Ich spreche diesen Text als Antwort auf den Schrei: »Hilfe!«, eingedenk des Beispiels, das Professor Lammasch gab. Dann dreht sich alles um mich, »Ihnen ist von dem Karbidgeruch nicht ganz wohl geworden«, sagt jemand neben mir, da bin ich wieder bei Bewusstsein, und am Galgen hängt der Mann, der »Hilfe!« geschrien hatte, starr.
Wie ich zu meiner Frau zurückkam, ist mir entschwunden; ich weiß nur, dass sie ein Frühstück bereit hatte, das ich erbrach. Und die Stunde darauf bewahre ich im Gedächtnis, in der ich meinem Chef gegenüberstand, um ihm zu melden, dass ich aus dem staatsanwaltschaftlichen Dienst auszutreten entschlossen sei. Der Erste Staatsanwalt wollte gerade zu einer Verhandlung gehen, er nahm den schwarzen rotgeränderten Talar und das roteingefasste schwarze Barett aus dem Kasten. »Es ist gekommen, wie ich mir’s gedacht hab’«, sagte er und zog den Talar an. »Dabei hab’ ich Ihnen mit Absicht einen Fall ausg’sucht, wo Mitleid überhaupt nicht in Frage kommt!«
Mitleid komme immer in Frage, erinnere ich mich, geantwortet zu haben. Und dass darauf eine — für seine sonst gedämpfte Tonart ungewöhnlich heftige — Entgegnung erfolgte. Er warf mir mit der höhnischen Schärfe, die er sonst für die Verteidiger und unzuverlässigen Zeugen bereithatte, meinen Irrtum vor, Menschlichkeit mit menschlicher Schwäche zu verwechseln und dieser doppelt zu erliegen, weil ich an und für sich schwach sei, daher für die Schwäche anderer viel zu viel Verständnis habe. Einem typischen Kriegsfolgen-Defätismus sei ich verfallen, »taedium vitae ex horrore belli«, wie der geübte Lateiner sich ausdrückte. Dann nahm er die Anklageschriften und ging zur Verhandlung.
Bei diesem Gegenüberstehen, damals wie ungezählte Male später, beunruhigte mich die Erkenntnis, dass von zwei, die grundsätzlich anderer Meinung sind, anscheinend jeder recht hat; wer Schwächling sagt, hat recht, und wer Stärke nur bedingt gelten lässt, hat recht. Aller Gegensatz im Grundsätzlichen aber, damals zum ersten Mal empfand ich es so stark wie heute noch, verschwindet, sobald das Individuelle daraus verschwindet; jedoch sobald es auftritt und sich behauptet, wird der Gegensatz unversöhnlich. Mord darf gerechter Strafe nicht entgehen, und wäre sie der Tod, das ist richtig; es wird im selben Atemzug fragwürdig, wenn man statt Mord Mörder sagt und des Weges gedenkt, den er aus seiner Zelle zum Galgen, zum Erschießen, zum elektrischen Stuhl geht. War das Schwäche, dann bekannte ich mich dazu, in Wels damals, wie ich mich noch heute leidenschaftlich dazu bekenne. Denn damals schien es mir, heute aber weiß ich es, dass in der Stärke, die fast immer Härte wird, der Fluch liegt und nicht in der Schwäche, die Mitleid zeugt. Und dass der Inbegriff alles Daseins, die Gerechtigkeit, mehr dieser entspricht als jener, weil Abstraktes nur im Hinblick auf das Konkrete sich erprobt, Gesetz wie Idee. Die Menschen machen und sind das Maß der Dinge, von den Menschen zu dem Menschen aber ist nur ein Schritt. Will das Gesetz die Menschen schützen, dann hat es auch den Menschen zu schützen. Geschähe es zulänglich, würde er nicht zum Dieb, zum Mörder, würfe nicht Bomben auf die Welt, wäre, geschähe es, nicht ein Atom im Atomkrieg, ein Gesichtsloser in der namenlosen Masse, sondern ein Einzelner mit der Bestimmung, weder leiden zu müssen noch leiden zu machen.
»Unverstandener Individualismus«, urteilte der Erste Staatsanwalt. Sollte ich ihn damals nicht verstanden haben, so habe ich in der Epoche der Vermassung und Verparteiung mehr als genug Zeit gehabt, ihn zu verstehen. Jedenfalls beharrte ich ihm gegenüber darauf, eine Pflicht nicht länger erfüllen zu müssen, gegen die sich meine »Schwäche« wehrte, ich nahm mir das zweite Beispiel an Professor Lammasch, fuhr nach Wien zu Herrn Oberstaatsanwalt Schuster, an den meinetwegen ein Bericht abgegangen war — dank der Einsicht meines Vorgesetzten ein wohlgesinnter —, und ich wurde abberufen.
Es dauerte kaum einen Monat, da wartete Mary mit der kleinen Agathe vor dem Handelsmuseum in der Wiener Berggasse, um mich von einem Dienst abzuholen, der nicht mehr im Anklagen bestand. Und es dauerte kaum einen weiteren Monat, da wurden die Ankläger des Nachgebens und der Schwäche stumm, denn es gab die österreichisch-ungarische Monarchie nicht mehr.
Ein Reich wird klein
Der Tag, an dem Österreich-Ungarn unterging, traf mich wie Unzählige ins Herz. Wir wussten mit schneidender Klarheit: Etwas Unersetzliches war gestorben, dessengleichen nicht wiederkam.
Denn was da unterging, war eine Macht und Herrlichkeit ohne Beispiel gewesen; um sie herrlich zu finden, brauchte man kein Österreicher zu sein, als der ich ja über Nacht nicht länger galt: Durch Geburt gehörte ich der gleichfalls über Nacht entstandenen tschechoslowakischen Republik an, sofern ich nicht für Österreich optierte, was ich selbstverständlich tat. Jedoch das Österreich, das ich wählte, nannte sich Deutsch-Österreich und umfasste statt der vierundfünfzig Millionen Einwohner der Monarchie nur noch deren sieben.
Auf ein Achtel war ein Reich reduziert worden, worin ein kleines Universum Platz gefunden hatte: das Meer und die Steppe, die Gletscher und die Kornfelder, der Süden, der Westen und der Osten, das Deutsche, das Romanische, das mannigfach Slawische, das Magyarische, ja das Türkische — die Vereinigten Staaten von Europa, hier existierten sie seit Menschenaltern, obschon sie heute noch nirgendwo anders zum Zusammenleben gebracht werden konnten. Und die Hundertfalt dieses einen Reiches, seiner Sprachen, Kulturen, Temperamente, die aus diametralen Gegensätzen leuchtend gemischte Farbe, gab es nur hier. Reiste man aus den Kukuruzfeldern Ungarns am Morgen weg, fast aus Asien, abends konnte man unter den Lorbeeren der Adria sein. Vom Firnschnee des Großglockners kommend, fand derselbe Staatsbürger sich nachmittags im Schatten der Apfelgärten Bozens, tags darauf in den Weingärten des Wienerwaldes zu Hause.
Dass solch verschwenderischer Reichtum der Geographie nationalen Anwartschaften nicht genügt, hatte ich aus den fanatischen Widerspruchschreien der Tschechen schon als Kind erfahren; dass er dagegen die Kultur der Sinne, die Üppigkeit des Schöpferischen großartig fördert, steht fest.
Das Geheimnis der Fruchtbarkeit ist, nach einem Worte Montaignes, die Mischung aus dem Konträren der Existenz. Hier gab es sie. Ob es den Nationalitäten der Monarchie politisch wohl ging, ist eine andere Frage; den Österreichern, die sich für nichts anderes hielten, erwuchs aus dem Zusammenhang von Wien und Budapest, Prag und Lemberg, Salzburg und Triest, Agram und Trient eine Weite und Diskriminierung des Anzuschauenden, die sie zu Weltbürgern ihrer eigenen Welt machte. Diese Welt war untergegangen, und ich, der unverbrüchlich an sie geglaubt hatte, konnte mich nicht fassen.
Jedoch derselben Fassungslosigkeit, und das blieb das Unvergesslichste, begegnete man auf Schritt und Tritt; die Leute auf der Straße waren ein einziges endloses Leichengefolge. Zwanzig Jahre später würden die Straßen Wiens einen treuloseren Anschein haben, so als jubelten sie über die Untreue zu Österreich. Damals trauerten sie. Mit einer merkwürdig schrillen Stimme hielt ein mir damals von Angesicht unbekannter Herr im Vortragssaal des Buchhändlers Hugo Heller auf dem Bauernmarkt einem pessimistischen politischen Resümee Josef Redlichs entgegen: »Die Verstümmelung Österreichs wird der Kultur des Westens mehr schaden, als der von ihm gewonnene Krieg ihm jemals nützen kann!« Wie ich nachher erfuhr, war der Herr, der dies in die Debatte warf, Hugo von Hofmannsthal, und er hat es, als ich ihn Jahre später kennenlernte, noch prägnanter formuliert: »Die Kulturwelt hat in einem historischen Irrtum die Botschafter der Kultur abberufen!« Im europäischen Sinn traf dies zu, die Verwirrung, die Ratlosigkeit, die Erkenntnis der Vergeblichkeit — die tödlichste, die es geben kann — nahmen überhand.
In jenen Tagen des Stürzens der Fundamente suchte ich in einem Hause Trost, das dem Amtsgebäude in der Berggasse, wo ich zurzeit Dienst versah, gegenüberlag. Zum ersten Mal war ich mit meiner Mutter dort gewesen, die den Arzt Dr. Sigmund Freud konsultieren wollte. Seither hatte ich ihm einen Artikel, den ich über ihn veröffentlicht hatte, geschickt und von ihm die Aufforderung zu einem Besuch erhalten, »sollte es mir danach zumute sein«. »Ich fürchte fast«, endete der Brief, »dass das öfter ist, als Sie zugeben werden.«
Wusste er das von seinem Adepten Baron Alfred Winterstein, der im selben Departement 29 arbeitete wie ich? Oder aus der seine Befürchtungen unzulänglich verbergenden Miene des Sohnes einer Sterbenden? In meinem Aufsatz hatte ich über ihn geschrieben: »Er sieht einem durch die Stirn.« Als ich in einer Nachmittagspause die Berggasse überquert hatte, kam ich zu jemandem, der das tat.
»Der berühmteste Österreicher«, wie H. G. Wells ihn später nannte, war in einer typisch österreichischen Ärztewohnung zu Hause. Man gelangte in ein finsteres, auch bei Tageslicht künstlich beleuchtetes Vorzimmer, danach in ein Wartezimmer, so bedrückend wie alle Wartezimmer. Und der Herr, der nach einigem Wartenlassen auf der Schwelle erschien und routinemäßig »Bitte einzutreten« sagte, sah wie ein typisch österreichischer Arzt aus. Schnurr- und Kinnbart, kurzgehalten in einem schmalen Gesicht, tiefer Kragen, der dem Hals Bequemlichkeit ließ, eine kleine schwarze Masche zwischen den Kragenrändern — so trugen sich sein Verkleinerer, der Neurologe und Nobelpreisträger Wagner-Jauregg, und der Anatom Tandler.
Hinter den Schreibtisch tretend, von dem aus man die gegenüberliegenden Fenster meines Amtszimmers sehen konnte, sagte er: »Nehmen Sie Platz.« Wie andere österreichische Ärzte. Doch schon im nächsten Augenblick war er keineswegs wie andere, da um seine Lippen ein wissendes Lächeln ermutigend lag und, während er sich setzte, mit seinen Augen etwas geschah, was ich seither an niemandem gesehen habe: Sie erhielten Licht von innen. Da saß dieser Mann am Schreibtisch und machte eine Röntgenaufnahme der Seele mit nichts als seinen Augen. Das dauerte weder lange noch war es Quacksalberei; man hätte sagen können, er verabfolge eine Injektion, zu gleichen Teilen gemischt aus Phantasie und Wissen — ein Wissen freilich von einer Abgründigkeit, Schärfe und Kompromissfeindschaft, das der Einbildungskraft so viel wie der Exaktheit, dem Dichterischen nicht weniger als der Medizin verdankte. War es das, was ihn den Wiener Medizinern so verdächtig, der Wiener Universität so zweitklassig machte, dass sie keine Professur für ihn übrig hatte? Da saß der typische Österreicher, dem Österreich nicht wohlwollte, und stellte untypische Fragen. Aber ich wehrte ab. Als Patient sei ich nicht gekommen — »obwohl Sie einer sind!«, sagte er —, ich sei da, um ihn meinerseits etwas zu fragen; des Widersinnes meiner Absicht wurde ich erst inne, als ich sie äußern wollte, allein da war es zu spät. »Fragen Sie«, sagte er. Ich fragte: »Wie kann man ohne das Land leben, für das man gelebt hat?«
Er hatte, offenbar anderes erwartend, etwas aufgeschrieben, das strich er durch. »Dass Ihre Frau Mutter gestorben ist, hat mich bewegt«, sagte er. »Wie lang ist das jetzt her?« Es waren fünf Monate. »Und Sie leben weiter. Die Mutter ist die Heimat, die man hat. Dass man ohne sie weiterlebt, ist eine biologische Tatsache, weil die Mutter vor den Kindern stirbt.«
Er verfehlte den beabsichtigten Eindruck. Da Österreich ihn ungebührlich behandelt, dachte ich zu spät, bedeutet Österreich ihm nichts. Eine falschere Adresse für mich kann es nicht geben! Da sagte er: »Zu einem bestimmten Zeitpunkt verwaist jeder Erwachsene. ›Das Land gibt es nicht mehr‹, sagen Sie? Vielleicht hat es das Land, das Sie meinen, nie gegeben, und wir haben uns darüber hinweggetäuscht. Das Sich-hinwegtäuschen-Müssen ist auch eine biologische Tatsache. Zu einem bestimmten Zeitpunkt erkennt man zum Beispiel, dass ein Mensch, der einem nahesteht, nicht das ist, was man in ihm zu sehen glaubte. Man täuscht sich darüber hinweg.« Etwas Unversöhnliches war jäh um seinen Mund, die Lippen pressten sich zusammen.
»In Österreich habe ich mich nicht getäuscht! Es ist das einzige Land, wo ich leben kann!«, beharrte ich.
»In wie vielen Ländern haben Sie schon gelebt?«, fragte er, die Unversöhnlichkeit war verschwunden. »Seien Sie nicht ungehalten, ich will Ihnen helfen. Sie glauben an mich — zumindest steht das in dem Artikel, den Sie mir sandten. Da werden für Sie einige Daten vielleicht von Interesse sein. Ich stamme wie Sie aus Mähren. Ich habe wie Sie eine unbändige Zuneigung zu Wien und Österreich, obschon ich, vielleicht nicht wie Sie, seine Abgründe kenne. Erst vor wenigen Tagen, am 11. November, als es, wie Sie sagen, ›das Land nicht mehr gab‹, habe ich mir Folgendes notiert.« Er nahm Papiere aus der Schreibtischlade, las: »Österreich-Ungarn ist nicht mehr. Anderswo möchte ich nicht leben. Emigration kommt für mich nicht in Frage. Ich werde mit dem Torso weiterleben und mir einbilden, dass es das Ganze ist.«
Der nächste Patient wurde gemeldet. »Sie haben nämlich recht«, beendete er, »es ist ein Land, über das man sich zu Tod ärgert und wo man trotzdem sterben will.« Er war aufgestanden. »Vielleicht hilft Ihnen das.«
Ich schrieb es sofort darauf nieder, und da ich es jetzt in dem Bewusstsein wieder schreibe, dass Sigmund Freud, wenn nicht der größte, so doch der berühmteste und umkämpfteste Österreicher, einundzwanzig Jahre später an Zungenkrebs in der Emigration starb, erscheint mir die falsche Prophetie gespenstisch. Damals tröstete sie mich.
Ein Essaybuch, »Weltbürgerliche Betrachtungen zur Gegenwart«, noch während des Krieges erschienen und gegen die Kriegsverblendung gewendet, die jedes Fremdwort bespie, hatte mir mehr Feinde als Freunde eingetragen, und jenem im Welser Staatsanwaltszimmer beendeten Roman »Der Feldherr« erging es nicht viel besser; er gewann zwar einige Verbreitung und seinem Verfasser den Bauernfeld-Preis, zog ihm aber auch den Verdacht unverbesserlichen Defätismus zu. Der Kritiker Alexander von Weilen — »Langweilen« war sein Spitzname — tat mich in Acht und Bann, jeden der Absätze seines Verdikts mit der Frage schließend: »Was weiß denn so ein Menschenkind davon?« Meine schriftstellerische Existenz also war wie die staatsbürgerliche in Frage gestellt, und ich konnte nichts anderes tun als »mich darüber hinwegtäuschen«. Dies vermochte ich nur, indem ich weiterschrieb, ohne das Geschriebene zu veröffentlichen, ja dies auch nur zu versuchen — für den Sinn des Schreibens hielt ich nach wie vor die Wahrheit, die Wahrheit aber war missfällig und wurde nicht gekauft. Und da Mary, wenn sie mich abholen kam, die kleine Hansi im Kinderwagen liegen hatte, während Agathe bereits daneben ging, blieb es beim Beamtendienst.
Damals trafen sich bei Stefan Zweig in der Kochgasse 8 des achten Wiener Bezirks einige Schriftsteller, zu denen Robert Musil, Franz Werfel, Joseph Roth, Hermann Broch, Felix Braun, der Lyriker Grünewald, F. Th. Csokor und ich zählten, ein Kreis jüngerer Wiener Literatur, während der viel ältere — noch immer »Jung-Wien« genannt — aus Hofmannsthal, Schnitzler, Beer-Hofmann, Wassermann, Kassner, Bahr, Auernheimer und Salten bestand, und ein nur wenig jüngerer sich um Mell, Wildgans, F. K. Ginzkey und meinen Bruder sammelte. Auch bei unseren damaligen Zusammenkünften war von fast nichts anderem als vom österreichischen Zusammenbruch und seinen geistigen Folgen die Rede, und als ich einmal den Amtszwang beklagte, der mir das Schreiben verleide, apostrophierte mich Zweig mit seiner ganzen Verve und Luzidität: »Sie sind ein Dichter, der zufällig in einem Amt ist. Das brauchen wir jetzt am wenigsten. Was wir brauchen, sind Beamte mit Ideen im Hauptamt. Warum dichten Sie mit Ihren Akten nicht das kleine Österreich größer! Das wäre eine Aufgabe!«
Mit der Wirklichkeit ohnehin auf schlechtem Fuß, hatte ich die Verwirklichung des Unwirklichen immer herausfordernd gefunden. Im Augenblick fand ich das mehr denn je. Es bleibt eine merkwürdige Erfahrung, und mancher wird sie machen, der den Menschen skeptisch, ihren Möglichkeiten optimistisch gegenübersteht, dass solcher Skepsis unvergleichlich mehr Positives entspringt als der Bejahung. Der Hemmschuh, den sie den Anfängern anlegt, verhindert nicht die Bewegung, nur den Absturz, wogegen unbedingte Zuversicht, wie Jakob Burckhardt gültig erkannte, auf den Kreuzweg der Enttäuschungen, also in die Irre führt. Daher ist es ein Irrtum, dass den Optimisten die Existenz gehört; ihnen gehört nur das Leichternehmen; das tätige, ja das schöpferische Überwinden des Schweren vielmehr ist die Sache der Pessimisten, die mit dem Schwersten rechnen.
In der verzweifelten Verwirrung jedenfalls, die mich damals überfiel, griff ich nach Strohhalmen. Und als ein Krawattenfabrikant namens Hochmuth, wegen eines Exportförderungsanliegens vorsprechend, das zu den Aufgaben des Departements 29 gehörte, vorwurfsvoll bemerkte: »Warum hat Wien nicht längst eine Messe gegründet wie Leipzig?«, ergriff ich die vage Anregung, die mich unter anderen Umständen gleichgültig gelassen hätte, mit Begier. Würde Herr Hochmuth einen Vorschlag beibringen, Vergleiche, Ziffern, Einzelheiten, das, was man ein »Exposé« nannte? Er fand sich dazu bereit. So großsprecherisch es klingt und war: Zwei Jahre später wurde die erste Wiener Messe eröffnet.
Kraft hieß der Minister, dem dies oblag und den ich zu begleiten hatte, ein ehemaliger Schuhhändler aus Graz; beim Rundgang an allem Bemerkenswerten vorbeigegangen, blieb er auf den geflüsterten Rat des Präsidialisten Baron Dahlen, es wäre an der Zeit, etwas Anerkennendes zu äußern, abrupt vor einer Terrakottagruppe stehen. »Das ist was Schönes!«, äußerte er zu Hofrat Alfred Roller, Gustav Mahlers berühmtem Bühnenbildner.
»Das ist Kunstgewerbe!«, widersprach dieser streng. »Was Herr Minister vorher besichtigten, waren Kunstwerke!«
»Ah, da irren S’ sich, Herr Hofrat!«, widersprach Herr Kraft seinerseits. »Ganz was Ähnliches hab’ ich mir vor vierzehn Jahren in Klagenfurt ’kauft, und es haltet mir immer noch!« Die lapidare Äußerung verwies das angestrebte Weltunternehmen zwar sofort wieder in die Provinz, jedoch die Wiener Messe war gegründet und der erste Akt meines »Dichtens in Akten« vorbei.
Drei sollten es im Ganzen werden.
Der zweite bestand in der Umwandlung der Exportakademie in die »Hochschule für Welthandel«, wozu ein Gesetz nebst zahl- und endlosen Besprechungen im Parlament notwendig waren. Zu jung, um Abgeordnete zu beeindrucken — Franz Josephs Österreich ist vom Thron bis zum kleinen Beamten hinab jahrzehntelang ein Land der Greisenherrschaft gewesen —, zu unpolitisch, um Politiker imposant zu finden, fiel ich in dem pompösen, der griechischen Antike nachgebauten Palast jenen auf die Nerven, die den »jungen Mann« und seine Persistenz unterschätzten. Dabei musste ich in den mir gezogenen Grenzen bleiben, ich hatte ja wieder einmal etwas zu »vertreten«, keine Anklage zwar, sondern einen Gesetzentwurf, obschon die Art, wie ich es tat, sich von der eines Anklägers nicht wesentlich mochte unterschieden haben. Jedenfalls klagte ich so deutlich über den mangelnden Ehrgeiz, einem entkräfteten Land auf jede Weise wieder zu Kräften zu helfen, dass ich zum Minister beschieden wurde, es war nicht mehr der Schuhgroßhändler, und mich darüber unterrichten ließ, was man unter parlamentarischem Benehmen verstand.
»Ich hör’ ja, Sie schreiben auch?«, sprach der hohe Vorgesetzte unwirsch. »Wenn S’ das schon müssen, dann machen S’ es gefälligst in Ihrer freien Zeit. Und bitt’ Sie, reden S’ mir keine Leitartikel, wenn S’ im Amt und gar wenn S’ als Regierungsvertreter in einem parlamentarischen Ausschuss sind! Der Herr Nationalrat« — er nannte einen völkischen Abgeordneten — »hat mir erzählt, Sie halten blumige Ansprachen. Also, bitte, der Grillparzer hat zwar auch Gedichte g’schrieben, aber damals waren halt andere Zeiten. Heut’ ist es zu so was zu ernst!« Um Gedichte zu schreiben, war, dem Herrn Minister zufolge, die Zeit zu ernst. Bisher hatte ich gemeint, sie sei nur in Gedichten zu überwinden.
Immerhin stutzte ich das Blumige meiner Werbung um eine neue Schule bis zur Dürre, ließ aber so lange nicht nach, bis das von mir entworfene Gesetz angenommen wurde. Nicht der Minister, sondern Stefan Zweig hatte recht behalten; die »Hochschule für Welthandel« gedieh mit den Jahren zu Weltruf.
Noch an einem dritten und letzten Akt des »Dichtens in Akten« war mir teilzuhaben erlaubt, geheimnishaft zog sich von ihm die Brücke in die Zukunft. Zu meinem Referat im Handelsministerium gehörten die Exportförderung und das gewerbliche Schulwesen, was jeweiliges Einvernehmen mit dem Unterrichtsministerium verlangte; von dort erhielt ich die Mitteilung, es liege ein Antrag vor, in Salzburg Festspiele zu begründen; ob »vom Standpunkt der Exportförderung« etwas dazu zu bemerken sei?
Von wem der Antrag stamme, war meine Gegenfrage.
Von dem »Schauspieldirektor und Regisseur« Max Reinhardt in Berlin, sowie von dem Wiener »Dichter und Schriftsteller« Hugo von Hofmannsthal. Die schrille Stimme, die in Herrn Hellers Buchladen Österreichs Verstümmelung zornig beklagt hatte, klang mir nach. Noch in derselben Nacht schrieb ich an Reinhardt nach Berlin, an Hofmannsthal nach Rodaun — jenem überhaupt nicht, diesem aus flüchtigen Begegnungen und einigen Veröffentlichungen bekannt. Meine Zwitterstellung als Beamter und Schriftsteller bestehe darin, erklärte ich beiden, dass meine österreichischen Bemühungen, mangels eines großen Gedankens, bisher nur auf Umwegen unternommen werden konnten. Allein was jetzt angestrebt sei, treffe das Problem ins Wesen, weil es das aus der Welt vertriebene Österreich der Welt wieder vor Augen bringen würde. Und ich stellte, ohne von irgendwem dazu ermächtigt worden zu sein, meine Dienste zur Verfügung.
Reinhardt antwortete nicht. Von Hofmannsthal, in seiner eiligen Hand geschrieben, kam eine freundliche Zeile der Bestätigung: Vielleicht könnte ich im Unterrichtsministerium nachfragen, was man dort zu unternehmen gedenke. Das tat ich unverweilt, bekam auch das bisher Vorliegende zu Gesicht; mit Amtsbräuchen vertraut, hielt ich Ergänzungen für angebracht, um Missverständnisse und Quertreibereien hintanzuhalten. Daher schrieb ich, unaufgefordert, den Entwurf eines Memorandums, das von den Anregern — »Proponenten« nannte man sie im Amtsstil — benutzt werden konnte.
Den täglichen Notizen, die ich während des größten Teiles meines Lebens machte und die mir diese Aufzeichnungen ermöglichen, entnehme ich die Worte: »Wessen Salzburg bedarf, das ist die Konzentrierung der bedeutendsten künstlerischen Anreger, wettbewerbend, in seiner Mitte. Wessen die Welt bedarf, ist dieses Zentrum angestrebter Vollkommenheit, die zur Höhe der Kunst und zum Fundament des internationalen Verständnisses führt, so dass die Reise dahin einer Pilgerfahrt gleichkäme.« Der missfällige Blick des Ministers, der mir »blumige Ansprachen« verwiesen hatte, muss mir, als ich das schrieb, warnend erschienen sein, denn ich ging zu trockenen Ziffern, Kompetenzen und Kleinkram über; Reinhardt und Hofmannsthal erhielten je eine Abschrift. Diesmal war es Reinhardt, der mir antwortete; vermutlich von Hofmannsthal aufmerksam gemacht, fand er für die Sendung überaus herzliche Worte und fragte mich, ob er einiges davon in einer Schrift verwenden könne, die er vorbereite. Genau das hatte ich bezweckt.
So ereignete sich nach einiger Zeit der eigentümliche Fall, dass einem Beamten eine Denkschrift zur Einsicht vorlag, an der er mitgeschrieben hatte. Um nicht in den Verdacht eines Amtsmissbrauches zu geraten, packte ich den Stier bei den Hörnern, ließ mich beim Minister melden und gestand, ich hätte an dem Memorandum, das ich ihm übergab, einen schmalen Anteil. Daher möge mir seine amtliche Bearbeitung erlassen und einem unparteiischen Kollegen zugewiesen werden. War es dieser Freimut oder der inzwischen gefestigte Ruf der Hochschule für Welthandel, ich wurde weder verwarnt noch der an sich durchaus unwesentlichen Bearbeitung des Aktes enthoben. Vielmehr ließ sich der Minister erklären, worum es sich handle, und — die Gerechtigkeit widerfahre ihm — war auf der Stelle dafür eingenommen, ja er erklärte aus freien Stücken, er werde für die Sache eintreten. »Das hat an’ Sinn! Das wird denen draußen zeigen, wer wir sind!«
Sonderbares Österreich, das immer überrascht, weshalb man sich so selten darauf verlassen kann. Sein angeborenes Misstrauen gegen den Geist — »Tolstoj ist ein alter Tepp!«, hatte, hiedurch denkwürdig, der christlichsoziale Gemeinderat Bielohlawek dereinst in öffentlicher Sitzung ausgerufen — verschwindet im Augenblick, da man es »denen draußen« zeigen kann.
Der Stein war jetzt im Rollen, und dass er nicht innehielt, dafür sorgte Hofmannsthal mit einer beispiellosen, in dem zarten Manne nicht zu vermutenden Stoßkraft. Treppauf, treppab eilte der schnell Ermüdende, von Unverstand und Unzartheit leicht zur Verzweiflung zu Treibende, um das Großwerden eines kleingewordenen Reiches kämpfend — ein unsäglich ermutigender Anblick, ihn der Utopie nachlaufen zu sehen, die er als Realität erreichte.
Denn es stand auf einem Brettergerüst vor dem Dom in Salzburg der Schauspieler Moissi in der Rolle des »Jedermann« und riss, von Reinhardt geführt und gesteigert, die Zuschauer so völlig hin, dass sie, nachdem alles längst zu Ende war, regungslos auf ihren Plätzen verharrten: Die Salzburger Festspiele hatten begonnen. Es wäre mir damals wie ein Fiebertraum erschienen, dass ich auf demselben Platz dreißig Jahre später denselben »Jedermann« auf demselben Gerüst inszenieren sollte.
Mit meinem »Dichten in Akten« aber war es vorbei.
Kritiker
Es fügte sich, dass nach dem Tode Hugo Wittmanns, des Burgtheaterkritikers der »Neuen Freien Presse«, eine Stelle frei wurde, die ich bekam. Abermals hatte sich, wie das in meinem Leben öfter geschah, etwas mit mir ereignet, das ich nicht anstrebte, das es aber von Grund auf änderte. Von heute auf morgen: Gedichtemacher, Ehemann, Dragoner, Staatsanwaltsgehilfe, Romanschreiber, Ministerialbeamter, jetzt also Kritiker und kulturpolitischer Mitarbeiter einer Zeitung, deren Einfluss im liberalen Bürgertum beträchtlich war.
Mit den Londoner »Times« als Vorbild, hatte die »Neue Freie Presse«, die sich, ihrer literarischen Ambitionen wegen, gern das »Burgtheater der Journalistik« genannt hörte, namhafte Zeitgenossen zu Beiträgern, und an ihrem »Feuilleton« mitzuarbeiten, jener aus Paris importierten impressionistischen Tageschronik — ihr berühmtester Feuilletonist, Ludwig Speidel, hatte sie »die Unsterblichkeit eines Tages« genannt —, verschmähten weder Hofmannsthal noch Schnitzler oder Bahr. In dieser Gattung hatte ich mich bereits früher versucht und gedenke einer Antwort, womit der Urwiener Eduard Pötzl, Feuilletonredakteur des »Neuen Wiener Tagblattes«, mir eine Einsendung zurückgab: »Wenn Sie beim Schreiben den Smoking aus- und den Hausrock anziehen würden, wären Sie etwas für uns.« In der »Neuen Freien Presse« aber war man mit dem Smoking und sogar damit einverstanden, dass ich bis zu der von mir angesuchten Pensionierung aktiver Ministerialbeamter bleibe. Tagsüber »Sektionsrat«, besuchte ich daher an den Premierenabenden das mir als Referat zugewiesene »Deutsche Volkstheater« — die »Neue Freie Presse« konnte es sich leisten, fünf Kritiker zu besolden: für das Burgtheater Raoul Auernheimer, für das Theater in der Josefstadt Felix Salten, für das Deutsche Volkstheater mich, Julius Korngold für die Musik, A. F. Seligmann für bildende Kunst — und stellte jede zweite Woche das »Sonntagsfeuilleton« bei.
Ein junger Feuilletonist, das ging noch an. Ein junger Kritiker dagegen? Jedoch Ernst Benedikt