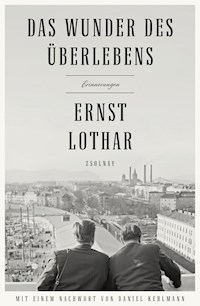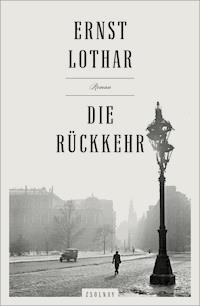
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit dem Ende des Krieges fiebert er darauf hin, jetzt, Ende Mai 1946, ist es so weit: Felix von Geldern besteigt ein Schiff Richtung Europa, Richtung Wien. Acht Jahre vorher, unmittelbar nach dem „Anschluss“, flüchtete die altösterreichische Familie vor dem Nationalsozialismus ins Exil nach New York. Und nun, wie steht es jetzt um Österreich, nach der Niederlage, nach der Befreiung? Rasch muss er erkennen, dass der Jubel auf dem Heldenplatz nicht durch Manipulation zustande gekommen ist, dass sich seine ehemalige Freundin zuerst Goebbels an den Hals geworfen hat und nun einem US-Oberst … Nach dem internationalen Erfolg der Neuauflage von Ernst Lothars „Engel mit der Posaune“ ist nun sein nächster großer Roman zu entdecken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Seit der Landung der Alliierten in der Normandie kann er es kaum mehr erwarten, seit dem Ende des Krieges fiebert er darauf hin; jetzt, Ende Mai 1946, ist es endlich so weit: Felix von Geldern schifft sich gemeinsam mit seiner Großmutter auf der Brasil ein, Richtung Europa, Richtung Wien: »Ich fahre nach Hause! Tausendmal hatte er es sich vorgestellt. Jetzt geschah es.«
Acht Jahre vorher, unmittelbar nach dem »Anschluss«, flüchtete die altösterreichische Familie vor den Nazis nach New York. Felix war es damals unerträglich, Deutscher zu werden. Und nun, wie steht es jetzt um seine Heimat, nach der Niederlage, nach der Befreiung? Rasch muss er erkennen, dass der Jubel auf dem Heldenplatz nicht durch Manipulation zustande gekommen ist, dass sich seine ehemalige Freundin zuerst Goebbels an den Hals geworfen hat und jetzt auf dem Schoß eines US-Obersten sitzt …
Nach dem internationalen Erfolg der Neuauflage von Ernst Lothars Engel mit derPosaune ist ein weiterer großer Roman zu entdecken.
Zsolnay E-Book
ERNST LOTHAR
DIE RÜCKKEHR
Roman
Mit einem Nachwort von Doron Rabinovici
Paul Zsolnay Verlag
»Und wendet es,
wie es euch beliebt,
das Wichtigste bleibt doch
die Wahrheit.«
Goethe
Kapitelverzeichnis
Vorspiel
VERLASS DICH NICHT AUF MICH
1 Ein Vogel fliegt weg
2 Bürgerprüfung
3 Die Familie
4 Heiratsversprechen
5 Ein glänzender Jurist
Erstes Buch
EUROPA TAUCHT AUF
6 Das Orakel
7 Das Wunder geschieht
8 Komische Leute
9 Das Gegenteil von Strohfeuer
10 Vienne en Autriche
11 Das fehlende Bild
12 Grenzen des Gefühls
13 Die Natur verlangt ihr Recht
14 Feststellung einer Tatsache
15 Das Herz der Stadt
16 Ein guter Zeuge
17 Urteilsgabe und Menschenkenntnis
Zweites Buch
EUROPA, WOHIN?
18 Der Richterstuhl
19 Ein Mann in ihrem Alter
20 Heiratsversprechen
21 Mangel an Phantasie
22 Bigamisten der Heimat
23 Der Menschheit Würde
24 Nachtlokal
25 Auf einem anderen Kontinent
26 Die geistliche Schwester
27 Der Rausch des Ungeahnten
28 Gemeinsame Sache
29 Sieben Jahre Hitler
Drittes Buch
WOHIN, EUROPÄER?
30 Das Unglück weckt auf
31 Gesetz des Simplen und Trivialen
32 Zwei Männer in Zivil
33 Verhör
34 Staatsbesuch
35 Andrerseits
36 Die Ursache
37 Alles bleibt phantastisch gleich
38 Ferngespräch
39 Kreutzersonate
40 Vor einem Denkmal
41 Noch zehn Minuten
Nachspiel
VERLASS DICH AUF MICH
42 Die Familie nimmt Stellung
43 Die Dinge sind einfach
44 Kosmos
45 Abschied von Viktoria
46 Der tiefe Schnitt
47 Weltteile
48 Oratio pro domo Austriae
49 Vor einem Denkmal
50 Die Kompetenz der Zeit
Nachwort
DER RISS DER ERSTEN LIEBE
von Doron Rabinovici
Vorspiel
VERLASS DICH NICHT AUF MICH
1
Ein Vogel fliegt weg
Felix zog den Regenmantel an. Als er vierzig Minuten vorher vom Grand-Central-Bahnhof in New York wegfuhr, war es heiß und feucht, aber wolkenlos sonnig gewesen. Bei der 125. Straße wurde der Himmel plötzlich grau. In Mt. Vernon war er schwarz. In Tuckahoe begann es zu regnen, und als er ausstieg, war es ein Wolkenbruch. Alles in vierzig Minuten.
Er stellte den Kragen auf und ärgerte sich. Auch darin war Felix ein Wiener, dass Kleinigkeiten ihn plötzlich in Wut versetzten. Monatelang war er hin und her gefahren, ohne dass ein einziger Regentropfen fiel. Ausgerechnet heute, da er ein Kleid von Lanz in einer dünnen Pappendeckelschachtel in der Hand trug, musste es so schütten. Es würde total aufgeweicht sein, bevor er es Livia geben konnte. Er praktizierte die lange Schachtel über Brust und Magen und knöpfte den Regenmantel darüber zu. Zum Teufel mit den amerikanischen Quantitäten! Wenn’s heiß war, war es eine Hitzewelle, wenn’s regnete, eine Sintflut. Alles im Extrem. In Salzburg regnete es im Sommer auch nicht wenig, aber mit einem Schirm und einem Regenmantel war man seines Lebens sicher.
Es entging ihm, dass er keinen Schirm hatte, und seine Wut wuchs, als die Taxi-Chauffeure, die am Kopf der von der Station zur Straße führenden Treppe warteten, die Ankommenden, fünf zusammen, von denen keiner zum anderen gehörte, in die Cabs pferchten. Felix hasste es, wenn man über ihn verfügte, und er konnte es einfach nicht mehr hören, dass man alles, was geschah, mit »There is a war on, Mister« erklärte. Dass es Krieg gab, war ihm nicht entgangen. Er hatte diesen Krieg für unvermeidlich gehalten, seit der Sekunde, da Hitler in Wien eingezogen, die Familie von Geldern (Haupthaus in Wien, Filiale in Paris) an ihrem Leben bedroht und Wien zu einer obskuren deutschen Provinz geworden war. Er hatte es bei seiner Musterung in New York gesagt und den Herren in Washington immer wieder geschrieben: There is a war on, Mister, und ich, Felix von Geldern, will mitmachen. Ich kann Ihnen von Nutzen sein, glauben Sie mir das! Aber man hatte ihm höflich geantwortet: »Danke, nein, Ihre Augen sind zu schlecht.«
Er war kurzsichtig, aber um sich seiner Haut zu wehren, dazu sah er genug. Sei doch froh, hatte ihm die Familie (mit Ausnahme von Großmama Viktoria) gesagt, so hast du wenigstens Ruhe. Zum Teufel mit der Familie! Denen musste man tatsächlich erzählen, dass Krieg war. Die waren so felsenfest davon überzeugt, dass sie durch ihre mehr oder weniger erzwungene Auswanderung (Luxuskabinen auf der »Queen Mary« und der »Normandie«) unendlich gelitten hatten; dass sie in ihren Appartements im Hotel Plaza, in ihren Wohnungen, Ecke Fifth Avenue und 68. Straße, in ihren Sommerfrischen am Lake Placid, bei ihren Golf-Weekends im Westchester County Club als Dulder und Opfer auftraten. Als ihm die Familie einfiel, warf Felix mit einer ihn kennzeichnenden Gebärde heftig den Kopf zurück. Mit unbelehrbaren Menschen gab es keine Verständigung.
Auch in seiner Erscheinung war Felix ein Wiener. Er war groß, hielt sich aber nicht stramm (»leger« nannte man es in Wien). Die Augen unter den horngefassten Brillen hatten trotz ihrer Kurzsichtigkeit etwas Anziehendes; ihre Bereitwilligkeit zog an und ihre jungenhafte Neugier. Felix war, wie seine Großmutter Viktoria, einer der neugierigsten Menschen auf der Welt. Dass er sein Haar länger als notwendig trug, wie ein Musiker, obwohl er Jurist war, und auf seine Anzüge und Krawatten mehr Sorgfalt verwendete, als er zugab, gehörte zu den wienerischen Widersprüchen seines Wesens: Er hasste Prätention oder, wie es in Wien hieß, Getue, aber er hatte eine ausgesprochene Schwäche, zu gefallen. Einer seiner bleibenden Kindheitseindrücke war ein zufällig aufgefangener Ausspruch seines Onkels Richard gewesen: »Der Felix ist der wenigst hübsche in unserer Familie.« Onkel Richard, der später gesagt hatte: »Amerika wird nie in den Krieg eintreten«, hatte sich auch damals geirrt. Sein Verdikt klang Felix trotzdem nach, bis zu diesem Augenblick im Wolkenbruch.
»Nein, danke«, sagte er zu den Chauffeuren, obschon es purer Wahnsinn war, zu Fuß zu gehen. Impulsen nachzugeben, war ein anderes seiner Merkmale; er tat Dinge, von denen er noch eine Sekunde zuvor nicht geglaubt hätte, dass er sie tun werde. Sie hätten wissen können, dass er sich die fünfunddreißig Cent für ein Taxi nicht einmal bei einem Wolkenbruch leistete; seit Jahren hatten sie ihn hier ein- und aussteigen gesehen, in der Früh, 7 Uhr 49 nach New York, abends, 6 Uhr 25 von New York.
Er ging die Abkürzung unter dem Viadukt und entlang des Baches. Bei gutem Wetter legte er die wenigen Minuten von der Station zu seiner Wohnung mit zwei Männern und vier Mädchen zurück, die er nicht persönlich kannte. Sie waren wie er »Commuters«, das heißt, sie lebten in einem Vorort, arbeiteten in der Stadt und benutzten dieselben Züge. Vor Pearl Harbor waren es vier Männer gewesen, und zwei Mädchen weniger. Felix kannte ihre Namen nicht, aber die Farbe ihrer Anzüge. Bis Dezember waren die Anzüge lebhaft blau oder braun; später trugen die Männer helle Regenmäntel; die Zeitung »Sun« oder »World-Telegram« schaute ihnen aus der Rocktasche, sie waren ihm immer um einige Schritte voraus. Die Mädchen dagegen gingen hinter ihm. Sie kicherten die ganze Zeit. Wenn er über die kleine Holzbrücke nach rechts abbog, pflegte er sich umzuschauen und festzustellen, dass sie kleine, blaue, quadratische Schachteln trugen; sie hatten beim Bäcker Cushman-Torten für das Dinner gekauft.
Es war ein so lächerlich maßloser Wolkenbruch, dass man in Pfützen watete, wo noch vor Augenblicken Straße gewesen war. Die lange Schachtel auf Felix’ Magen wurde feucht. Dann geb ich’s ihr eben erst morgen. Es muss erst trocknen, entschied er. Der Aufschub erleichterte ihn irgendwie.
Er hätte ihr gern eine Freude gemacht. Deshalb war er, bevor er das Kleid gekauft hatte, wochenlang vor Schaufenstern in der Fifth Avenue gestanden. Aber seit er sich erinnerte, konnte er zu niemandem sagen: »Hier. Das hab ich dir geschenkt.« Er fand es anmaßend, dass man sich mit hundert österreichischen Schilling oder hundert Dollar, oder was es eben war, zu einem Mann machte, der sich Anspruch auf Dank erwarb. Außerdem würde er bestimmt nicht »Happy Birthday to you!« singen können, dazu war er zu gehemmt. Beneidenswert, dachte er und meinte die Leute, die sich einfach hinstellen und »Happy Birthday« singen konnten. Der Regen riss Löcher in den Boden. Die Eichen, deren Höhe riesig war, schüttelten ihre Kronen im Sturm. Im Westen blitzte es. Donner folgten wie Detonationen. Die Luft war vor Elektrizität kaum zu atmen.
In Schweiß und Regen gebadet, trat Felix durch die Hintertür ins Haus.
Livia schien ihn kommen gehört zu haben. Sie stand im Vorraum. »Hat es Sie erwischt, Herr von Geldern?«, fragte sie. Sie sagte nicht Mr. van Geldern, sondern Herr von Geldern zu ihm.
»Guten Abend, Livia. Ich hätte ein Taxi nehmen sollen.«
»Es sind ja nur ein paar Schritte.« Noch nie hatte sie etwas getadelt, was er tat oder sagte.
Er fingerte an dem Regenmantel, den er wegen der Schachtel nicht ausziehen wollte.
»Vielleicht behalten Sie ihn lieber an«, sagte Livia, »Hansl ist weg.«
Sie sagte »Hansl«, mit dem österreichischen Diminutiv, und sie sagte es nicht einmal mit dem langen amerikanischen »a«.
Hansl war ein Kanari, Großmama Viktorias Geschenk; sie behauptete steif und fest, er komme aus Österreich. Jedenfalls hatte der Vogel in Felix’ Zimmer österreichisch getrillert.
Es schien, dass Livia wusste, wie schlecht die Nachricht war. Sie wusste jedenfalls, was Felix freute oder verstimmte. Seit er bei ihrer Schwester Joyce als Mieter eingezogen war, hatte sie das zu ihrer Hauptaufgabe gemacht. Hatte jemand sie gefragt: »Was studieren Sie?«, sie hätte nicht länger beschämt sein müssen, dass ihre Schwester sie verhindert hatte, das College zu beenden, und dass sie jetzt in Altman’s Kaufhaus in White Plains ihren Unterhalt als Verkäuferin verdienen musste. Sondern sie hätte geantwortet, ihr Hauptfach sei ihre Liebe zu Felix.
Sie hatte Narben an Kinn und Hals, die man unter Puder fast nicht sah; als kleines Kind war sie in den Kamin gefallen, und Joyce hatte sich schon damals wenig aus ihr gemacht. Hätte sie rechtzeitig ärztliche Behandlung gehabt, die kleinen weißen Narben wären ihr erspart geblieben. Doch Joyce war damals zwölf, und sie war zwei. Und sogar wenn Joyce damals erwachsen gewesen wäre, hätte sie wie heute gefunden, es sei Verschwendung, den Arzt zu holen.
Wenn es sein musste, kämpfte Joyce mit den Nägeln. Sie hatte es hart gehabt und sah nicht ein, warum andere es leicht haben sollten. In ihren Augen war Livia ein unreifes Geschöpf, außerdem dumm.
Trotzdem würde Livia Felix heiraten und mit Joyce um ihn kämpfen. Auch Joyce wollte Felix heiraten; sie hatte das nie gesagt, aber Livia wusste genau, dass es so war.
»Sind Sie böse?«, fragte sie ihn.
»Ja.« Das bisschen Aufmerksamkeit, auf einen Vogel aufzupassen, hätte sie wirklich haben können. »Wieso ist das passiert?« Die Schachtel mit dem Kleid wurde ihm immer lästiger.
Sie hatte, erzählte Livia, wie jeden Abend das Gläschen im Käfig mit Wasser gefüllt; ein Blitz hatte so nahe eingeschlagen, dass sie fürchtete, es sei im Garten; sie war hinausgelaufen, die Käfigtür blieb einen Augenblick offen. Als sie zurückkam, war Hansl nicht mehr da.
»Aber der Blitz hat natürlich nicht im Garten eingeschlagen?«
»Nein. Leider.«
Darüber musste er wider Willen lachen.
»Es war sehr dumm von mir«, sagte sie.
Wenn jemand ein Verschulden zugab, war er sofort versöhnt. »Das hätte jedem passieren können, Livia.«
»Ich hätte die Käfigtür schließen sollen. Oder das Fenster. Selbstverständlich.«
»Unsinn. Selbstverständlich wird alles erst, wenn es vorbei ist.«
»Sie sind wundervoll«, sagte sie. Sie verbesserte sich sofort. »Glauben Sie, wir bekommen ihn zurück?«
»Nein.«
»Wir können ihn rufen. Ich kann pfeifen wie er.«
»Im Regen?« Er fügte hinzu: »Wenigstens hat er jetzt seine Freiheit.«
»Er hat so viel …« Sie vollendete nicht, was sie sagen wollte. Vielleicht hatte sie sagen wollen: »Er hat so viel gesungen.« Wer so viel sang, konnte die Freiheit nicht entbehrt haben. »Geben Sie mir Ihren Mantel. Ich hänge ihn in die Küche zum Trocknen.«
»Nein, danke«, sagte er schnell. »Ich gehe noch ein bisschen hinaus. Der Regen hat nachgelassen. Vielleicht höre ich ihn wirklich.«
»Joyce ist zum Dinner eingeladen. Ich komme mit Ihnen.«
»Mit Ihren bloßen Beinen!«
Sie hatte ihre weißen Shorts an. Ihre Beine irritierten ihn. Nicht zum ersten Mal packte ihn das Verlangen, sie in seine Arme zu nehmen.
»Es wäre hübsch, wenn Sie endlich wüssten, dass ich mir nichts verbieten lasse. Von Joyce nicht, von niemandem.« Auch sie gab dem Gewitter einen Augenblick nach. »Ich ziehe meinen Regenmantel an.«
»Nein!«, sagte er heftig.
»Sie können mir nicht verbieten, in unseren Garten zu gehen, Herr von Geldern.«
Er überlegte, ob er ihr jetzt das Geschenk geben sollte. Es hätte ihm ähnlich gesehen, aus etwas, das er als Freude gedacht hatte, im letzten Moment eine Bagatelle zu machen. Dazu war er im Begriff, als er auf dem Tischchen, worauf die Post gelegt wurde, einen Brief sah.
»Für Sie«, sagte sie. Ihr Ton war wieder beherrscht.
Der Brief kam vom Naturalization Service und forderte Mr. Felix van Geldern auf, am 29. Juli 1944, 8.30 a.m., Columbus Avenue 70, mit zwei Zeugen und seinen Papieren zu erscheinen und seine Bewerbung um die amerikanische Bürgerschaft vorzubringen. »Und das sagen Sie mir erst jetzt!«, rief er. »Livia, in ein paar Wochen bin ich Ihr fellow citizen!«
»Freuen Sie sich?«
»Sehr.«
»Sie freuen sich nicht.«
»Seien Sie nicht dumm, Livia!«
»Sie wollen doch zurück nach Wien.«
»Woher wissen Sie das?«
Sie hätte ihm antworten können: Ich denke viel über Sie nach, denn Sie sind anders als alle Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, und ich mache jetzt eine entscheidende Probe. »Sie wollen nicht zurück?«, fragte sie, hielt den Atem an.
»Nein.«
Mit einem jähen Schritt kam sie näher zu ihm. Der Vorraum war von einer kleinen Stehlampe beleuchtet, die nur die Umrisse deutlich machte.
»Sie freuen sich wirklich!«, sagte sie. »Gute Nacht.« Ohne sich umzusehen, lief sie hinauf in ihr Zimmer.
Felix sperrte die Schachtel mit dem Kleid ein und trat vors Haus. Eine Wiese mit Eichen und Eschen fiel schräg davor gegen die Fahrstraße ab. Der Regen hatte so jäh aufgehört, wie er begonnen hatte, aber die Tropfen, die der Wind aus den Blättern schüttelte, klangen wie Regen. Die Blitze hatten sich verzogen, manchmal warfen sie fahlen Schein auf das nasse Grün und die Jasmingebüsche, welche die Wiese säumten. Die Luft war rein.
Wenn man scharf hörte, konnte man die Geräusche der Nacht unterscheiden: die Enten im Teich drüben, die Spechte, die Rotkehlchen. Wie zu Hause.
Hoffentlich hat er während des Regens in einem Baum Schutz gesucht, dachte er. Er hätte sich sehr gewünscht, ihn wiederzuhaben. Zu Hause hatte er fast immer einen Kanari gehabt – drüben heißt das. Zu Hause war drüben.
»Hansl«, rief er. Er pfiff ihm auch. Die Enten lärmten. Ein Specht klopfte fleißig.
Felix ging die schräge Wiese hinunter, von Baum zu Baum. Geduldig stand er unter jedem und schaute in die Kronen. Jenseits der Fahrstraße waren keine Bäume mehr.
Der Wind ließ nach, das Tropfen von den Bäumen hörte auf. Hoch über den Baumkronen erschienen Sterne.
»Ist er weg?«, rief jemand aus einem Fenster.
»Ja«, sagte Felix. »Er hat eine schöne Nacht zum Nach-Hause-Fliegen. Übrigens müssten Sie nicht so selig drüber sein! Entschuldigen Sie. Ich habe vergessen, dass Sie sich nichts sagen lassen.«
»Glauben Sie, er fliegt nach Hause?«, fragte die Stimme. »Von Ihnen lasse ich mir alles sagen.«
»Ich hoffe.«
»Sie wollen doch zurück«, sagte die Stimme.
2
Bürgerprüfung
»Sie wollten auswandern?«
»Ja.«
»Obwohl Sie zuerst nur um ein Besucher-Visum ansuchten?«
»Damals sagte man mir in Wien, die Quote der Emigrations-Visa sei auf Jahre hinaus überzeichnet.«
»Wieso bekamen Sie es schließlich doch?«
»Meine Großmama kannte einen Senator.«
»Sie meinen, bei uns kann man so etwas durch Beziehungen bekommen?«
»Natürlich.«
»Sie glauben also nicht an Demokratie?«
»Und an Beziehungen.«
Der Beamte in dem winzigen, heißen Quadrat des vierten Stocks, Columbus Avenue 70, lehnte sich zurück. Über dem Sessel hing sein auffallend blauer Rock.
»Wann haben Sie Wien verlassen?«
»19. März 1938.«
»Wie lange nach Hitler war das?«
»Acht Tage.«
»Das heißt, Sie sind aus Österreich geflohen?«
»Ja.«
»Sind Sie Jude?«
»Nein. Mein Großvater mütterlicherseits hatte fünfundzwanzig Prozent jüdisches Blut. Zu wenig für die Nürnberger Gesetze.«
»Warum sind Sie dann geflohen?«
»Es war mir unerträglich, Deutscher zu werden.«
»Was heißt das?«
»Das, was ich sage.«
»Ein so guter Österreicher sind Sie?«
»War ich.«
Der Beamte legte ein Bein, das linke, auf den Schreibtisch. »Wenn Sie die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten, um die Sie sich heute bewerben, werden Sie schwören müssen, keinem anderen Land ergeben zu sein als Amerika.«
»Ich weiß das.«
»Sie werden bei dieser Erklärung keinen Hintergedanken haben dürfen.«
»Ich weiß das.«
»Und das Land, aus dem Sie kommen, ist dann nicht mehr das Ihre. Auf Lebenszeit nicht mehr. Wissen Sie das auch?«
»Ja.«
»Mr. van Geldern. Nehmen wir an, dass der Krieg heute oder morgen aus ist, und die Möglichkeit besteht, nach Österreich zurückzukehren. Was würden Sie tun?«
Eine Pause entstand. Der Beamte legte auch das rechte Bein auf den Schreibtisch.
»Wieso?«, fragte Felix.
»In diesem Zimmer habe ich eine Reihe von Beobachtungen gemacht. Emigranten wie Sie, Leute, die Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hatten, um in die Staaten auszuwandern, dann herkamen, die Privilegien dieses Landes genossen, sogar in ihrem Beruf Glück hatten – diese Leute warteten nur darauf, dass sie wieder zurückkonnten. Sie betrachteten dieses Land als eine Art Wartesaal zwischen zwei Zügen, oder sagen wir, zwischen zwei Booten. Sie akzeptierten die verhältnismäßigen Bequemlichkeiten des Wartesaals und schauten dabei ständig aus dem Fenster, ob ein Boot ging. Mr. van Geldern, finden Sie das fair?«
Vor dem Fenster des in der feuchten Julihitze dampfenden kleinen Raumes stand statt des schmutzig roten Rohziegelbaues einer Infanteriekaserne eine Sekunde lang schmerzhaft lieblich der Kirchenplatz von Grinzing. »Ich würde Österreich gern wiedersehen«, sagte Felix.
»Würden Sie wieder dort leben wollen? Nehmen wir an, mit den Vorteilen, die ein amerikanischer Bürger dort nach dem Friedensschluss genießen könnte?«
»Nein.«
»Weshalb nicht?«
»Die Österreicher haben sich 1938 nicht gegen Hitler gewehrt. Viele haben ihn sogar gewollt. Am 10. April 1938 haben siebenundneunzig Prozent ihn gewählt.«
Der Beamte lächelte zum ersten Mal. »Sie betrachten also Amerika nicht als einen Wartesaal?«
»Ich habe es lieb gewonnen.«
»Sie mochten es nicht, als Sie herkamen?«
»Ich fand es unerträglich.«
»Weshalb sind Sie anderen Sinnes geworden?«
»Ich habe es kennengelernt.«
»Okay. Was für eine Regierungsform hat Amerika?«
»Eine demokratische.«
»Was ist eine demokratische Regierungsform?«
»Eine, in der nicht ein Herrscher entscheidet, sondern das Volk.«
»Was ist das wichtigste amerikanische Gesetz?«
»Die Constitution.«
»Sie kennen ihren Hauptgrundsatz?«
»Alle Menschen sind mit gleichen Rechten geboren.«
»Danke, Mr. van Geldern. Unterschreiben Sie hier unten.«
Felix begann zu unterschreiben: »Felix«, zögerte vor dem Wörtchen »von« einen Augenblick, schrieb es und seinen Zunamen und ging. Seine beiden Zeugen erwarteten ihn. Trotz dem Juli und der Hitze brannten Lampen. Es war ein breiter Raum. An der Längswand, hinter Mattscheiben, liefen fünfzehn zellenartige Verschläge, wie der, aus dem Felix kam; auf Bänken davor saßen die Leute, die Vorladungen erhalten hatten wie er; sie hatten, wie er, Zeugen bei sich, die dafür bürgen sollten, dass sie gute amerikanische Bürger sein würden; aufgeregt redeten sie fehlerhaftes Englisch mit starkem Akzent: Sie fürchteten die bevorstehende Viertelstunde, in der sie eine Prüfung darüber ablegen sollten, was sie von Amerika wussten. Für Schüler waren sie ausnahmslos zu alt; dass sie eine Zukunft haben könnten, ließ sich bei ihrer Verbrauchtheit nicht vorstellen; der Gegensatz zwischen einer wilden Hoffnung auf etwas, das keine Hoffnung versprach, und der ängstlichen Begier, sich in diese Hoffnungslosigkeit zu stürzen, raubte dem außerordentlich hässlichen Saal den Rest des Sauerstoffs.
Felix’ Zeugen waren Joyce und sein Bürokollege, Mr. Graham. Joyce hatte für den Anlass ein neues hellblaues Kleid mit einem weißen Lackgürtel. Sie schien auch beim Friseur gewesen zu sein, sah üppig und auffallend aus wie immer, und roch ein wenig zu stark nach Parfum. Mr. Graham wischte den Schweiß von seiner Stirn. Er hatte Geduld wie immer.
In Brown’s Kaufhaus auf der Dritten Avenue, wo Mr. Graham die letzten einundzwanzig Jahre von halb neun bis halb eins und von halb zwei bis sechs zugebracht hatte, war Geduld der Artikel, der am leichtesten ausging. Felix, Verkäufer im vierten Stock (Abteilung Bücher), hatte neben vielem anderen auch das an Mr. Graham bewundern gelernt: nie ein verletzendes Wort, keine Klage. Vor etwa einem Jahr war Mr. Grahams Frau gestorben. An diesem Tag hatte »Brown’s Department Store« Inventur gehabt, und Mr. Graham war zehn Minuten vor sechs fortgegangen. Erst bei dieser Gelegenheit hatte er erwähnt, was ihm geschehen war. Ein glatzköpfiger, sechzigjähriger Mann mit Brille; etwas anderes Kennzeichnendes ließ sich nicht von ihm sagen. »Alles in Ordnung?«, fragte er.
»Natürlich«, antwortete Joyce an Felix’ statt. »Felix weiß mehr als alle Clercs zusammen. Wissen Sie nicht, dass er einer der größten Rechtsgelehrten von Europa ist?« Sichtlich missbilligte sie, dass ein so untergeordneter Mann Felix’ zweiter Zeuge war; nicht die richtige Folie für sie beide.
Felix sagte geniert: »Es war alles ganz leicht.« Er hatte in seinen sechs Jahren Amerika bereits gelernt, so zu antworten. Dabei war es viel schwerer gewesen, als er geahnt hatte.
Man musste zu einem in der Mitte des Saales stehenden Schalter gehen, eine geringe Gebühr entrichten und abermals unterschreiben. Dann wurde man vor drei Herren gerufen, die rechts hinten auf einer kleinen Estrade saßen, wie ein Miniaturgericht. Ungefähr dieselben Fragen, dieselben Antworten. Was wusste Felix von der Regierungsform? Würde er, falls es notwendig wäre, die Waffen für Amerika ergreifen?
Ja, das würde er.
Wie lange kannten ihn die Zeugen, und hatten sie ihn mindestens einmal wöchentlich gesehen?
Sie kannten ihn mehr als fünf Jahre. Sie hatten ihn viel öfter gesehen als einmal wöchentlich.
»Täglich«, sagte Joyce.
»An allen Arbeitstagen«, sagte Mr. Graham.
Dann wurden sie mit der Mitteilung entlassen, dass Felix in drei oder vier Wochen aufgefordert werden würde, seinen Eid als neuer amerikanischer Bürger zu leisten.
Während sie die Treppen hinuntergingen, hängte Joyce sich ein. »Wir müssen feiern«, sagte sie Felix ins Ohr. »Sehen wir, dass wir den kleinen Mann loswerden.«
Felix hatte Großmama Viktoria versprochen, zum Tee zu kommen.
»Warum nehmen Sie mich nicht mit?«, fragte Joyce. »Das wäre endlich die Gelegenheit, Ihre Familie kennenzulernen.«
»Ich glaube nicht, dass Ihnen das eine Freude machen würde«, sagte Felix. »Danke vielmals für die Mühe, die Sie sich genommen haben, Joyce. Danke vielmals, Mr. Graham.«
Joyce antwortete nicht. Mr. Graham sagte: »Nicht der Rede wert.«
3
Die Familie
Die kurze Strecke vom Columbus Circle, Central Park South entlang, bis hinunter zum Hotel Plaza hätte höchstens zehn Minuten zu dauern gehabt. Für Felix dauerte sie fast eine halbe Stunde. Er schaute auf den Central Park, dessen Bäume zu verdorren anfingen, obwohl es erst Juli war. Mit anderen Worten, sagte er sich und blieb stehen, als schraubte ihn jemand fest, das alles ist für Dauer. (Er dachte es mit dem Ausdruck »for keeps«, den man hier für Dinge gebrauchte, die für immer waren.) Das ist mir doch nicht neu, dachte er. Ich habe gewusst, dass ich eine bindende Erklärung abgeben werde. Ich habe auch gewusst, dass es dabei keine Hintertür gibt (er dachte »Mentalreservation«, den Juristen wurde er nicht los).
Die Vorstellung, er würde die nächsten dreißig oder vierzig Jahre seines Lebens solche vertrockneten Bäume im Juli zu sehen haben, auf asphaltierten Parkwegen gehen, den Fettgeruch der Drugstores zur Lunchzeit, den Subwaygeruch heißgelaufenen Gummis am Abend zu riechen haben, nagelte ihn dort an, wo er stand. Die wilde Sehnsucht, in fast zweitausend Tagen und Nächten genährt, schmerzte plötzlich wie ein Geschwür. Gut, sagte er sich, herausschneiden. Chirurgischer Eingriff. Die Frage ist nur, Lokalanästhesie oder volle Narkose. Sekundenlang stand Livia vor seinen Augen, er rief wie zum Schutz ihr Bild auf, es half nichts. Ich habe sie gern, dachte er, trotzdem wäre es kindisch zu denken, dass sie mir das ersetzen kann! Gut, ich werde die Prüfung für die amerikanische Advokatenpraxis bestehen, wir werden irgendwo in der Nähe von New York ein kleines Haus haben, in Bronxville oder in Tuckahoe oder Scarsdale. Vielleicht werden wir in die Provinz ziehen müssen, weil es dort billiger ist. Kleines Haus in New Jersey oder in Dallas, Texas, oder in Cincinnati, Ohio. Wenn ich zu wenig für ein Haus verdiene: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad, kleine Küche. Wöchentlich zweimal eine Negerin zur Hilfe.
Nicht das Schlechteste, sagte er sich. Aber warum kann es nicht besser sein? Warum kann ich nicht ein beschäftigter Anwalt werden und eine Masse Geld machen? Park-Avenue-Wohnung. Eigener Buick. Golf. Dinner-Partys. Einfluss in Wall Street und Washington. Vielsicht sogar eine Berufung für internationales Recht an die Columbia-Universität.
Alles das hatte er unzählige Male gedacht. Aber da er es jetzt zu denken versuchte, widerstand es ihm. Dann muss ich mich also geirrt haben, sagte er sich. Habe ich es mir nur eingeredet, dass ich dieses Land liebe? Das half sofort. Er wusste, dass er es sich nicht eingeredet hatte. Aber er wusste ebenso, dass die zwei Unterschriften vor einer halben Stunde einen Endstrich gezogen hatten, und dass es das war, was ihn quälte. Der Gedanke, man könne hier und drüben leben, an beidem hängen, war ein Betrug. Sogar im juristischen Sinn. Darin gab es keinen Kompromiss mehr. Als er damit im Reinen war, setzte er seinen Weg fort, um mit Großmama Viktoria die Gewissheit zu feiern, die er erhalten hatte.
Trotz dem Sommer war das Plaza überfüllt. In der mächtigen Halle saßen die Leute beim Tee, und die Nachmittagsmusik bemühte sich, stimulierend zu sein. Felix blieb einen Augenblick vor dem Zeitungs- und Buchstand stehen, was er automatisch überall tat, wo Bücher verkauft wurden; er wollte sich davon überzeugen, ob die Bestseller aus Brown’s Kaufhaus überall Bestseller waren. In Ordnung: »A Bell for Adano«, »A Tree Grows in Brooklyn«, »Strange Fruit«. Die Nachmittagsausgaben meldeten, dass die Teilnehmer an dem Attentat auf Hitler eruiert seien und gehängt werden würden. In der Blumenhandlung neben dem Zeitungsstand gab es verspätete Dog-Wood-Blüten rosa und weiß in Riesenvasen, weiße Rosen, Schlingpflanzen und ungeheure weiße Lilien. Fehlerlos prachtvoll, trotzdem ohne Leben.
Kathi öffnete. Sie war nur um zwei Jahre jünger als Großmama Viktoria und sprach noch immer kein Wort Englisch. »Frau Gräfin werd sie sofort kommen«, meldete sie mit dem harten Akzent ihrer Heimat. Sie war groß, hatte eine der kleinsten weißen Schürzen über ihrem schwarzen Kleid, trug hohe Knöpfelschuhe, die man hier nirgends bekam, und ihre Hände steckten in weißen Zwirnhandschuhen. Obwohl sie ein bequemeres Leben führte als je zuvor (ihre Aufgabe bestand fast nur noch darin, Besucher anzumelden, Großmama Viktoria zu frisieren und ihr beim Ankleiden behilflich zu sein), fand sie es eine Zumutung, in Amerika existieren zu sollen. Nichts gefiel ihr. »Bitte, sich einen Moment hinsetzen, junger Herr«, forderte sie Felix auf, als wäre es vor zwanzig Jahren im von Geldern’schen Haus auf der Hohen Warte in Wien gewesen, und verließ das Zimmer.
Viktoria lachte schon auf der Schwelle, ihre gute Laune war schrankenlos. Die Blumen, die sie zu ihrem achtzigsten Geburtstag bekommen hatte, blühten noch überall in Fülle. Und die Familienfotografie, von der Familie gestiftet, stand auf dem Klavier. Großmama Viktoria hatte sich ein Klavier in den Livingroom stellen lassen. Zwar kannte sie die Noten nicht, aber sie hatte es gern, wenn Leute kamen, die ihr vorspielten oder vorsangen.
»Gratuliere«, sagte die kleine alte Dame. »Also hast du’s überstanden. Bist du stolz?«
»Ja«, sagte Felix.
»War’s schwer? Bleib sitzen. Erzähl mir jede Frage. Ich komm ja jetzt auch bald dran.« Sie setzte sich zu ihm; sie hatte sehr schnelle, sehr leichte Bewegungen, trotz ihrer Rundlichkeit. Ihr Imprimékleid, grün und weiß, ohne Ärmel, wäre für eine Vierzigjährige zu jung gewesen. Um den Hals hatte sie zwei Reihen großer Perlen. Ihr Mund war kirschenrot geschminkt, ihr Haar nach der Mode frisiert, die Tallulah Bankhead in »The Skin of Our Teeth« eingeführt hatte.
»Du willst doch nicht wirklich Tee?«, sagte sie. »Hol dir Whisky und bring mir auch ein Glas.« Viktoria war eine geborene Gräfin Teleky aus Budapest. Ihr Großvater war Minister gewesen, und noch ihr Vater hatte, wie sie gern erzählte, mit Franz Joseph in Gödöllő gejagt. Die Heirat mit Edmund von Geldern, Felix’ Großvater, hatten die Telekys für eine Mesalliance gehalten – der Adel der Gelderns war kaum eine Generation alt, außerdem mit einem Bankgeschäft belastet; wenngleich es ein großes Bankhaus war, nicht so groß wie Rothschild, größer als Bleichröder, war es jedenfalls eine Heirat unter dem Stand, fand Viktorias Familie.
Sie selbst hatte das nie gefunden. Sie hatte Felix’ Großvater dreißig Jahre lang geliebt und war, nach ihrer eigenen Behauptung, dreißig Jahre lang restlos glücklich gewesen. Ihre Behauptungen stimmten nicht immer, doch sie machte sie in einer dezidierten Art, die Widerspruch ausschloss.
»Du schaust aber eher so aus, als ob du von einem Begräbnis kämst«, sagte sie. Sie hatte eine Vorliebe, direkt zu sein und den Leuten die Wahrheit zu sagen, oder was sie für die Wahrheit hielt; es schien ihr Spaß zu machen, wie das meiste. Und trotzdem gehorchte sie dabei einem Wunsch, den Felix von ihr geerbt haben mochte: Sie hatte einen scharf ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Was sie an Vorurteilen durch Herkunft und Erziehung mitbekommen hatte, dem widersetzte sie sich mit ihrem gesunden Menschenverstand und ihrer noch gesünderen Liebe zum Leben. »Erzähl schon, was hat er dich gefragt?«
Er wiederholte wörtlich die Fragen des Clerks und seine Antworten darauf.
»Na ja«, sagte sie, zwei Worte, mit denen sie gern begann. »Ich glaub, das hätt ich auch alles gewusst.«
Neben den letzten Romanen lag die Geschichte Amerikas auf ihrem Nachttisch und ein kurzer Leitfaden für neu Eingewanderte. Sie erwartete dieselbe Vorladung, die Felix erhalten hatte, und bereitete sich darauf vor.
»Und was wirst du jetzt machen?«, fragte sie den Enkel.
»Dasselbe«, antwortete Felix einsilbig.
»Beharrst du auf dem Unsinn?« Damit war Felix’ hartnäckige Weigerung gemeint, von Viktoria oder denen aus der Familie, die Geld herübergerettet hatten, etwas anzunehmen. Sie pflegte es Unsinn zu nennen, aber sie fand offenbar Sinn darin.
»Natürlich«, sagte Felix.
»Na ja«, sagte Viktoria. »Und du wirst sie natürlich nicht heiraten? Ich hab sie unlängst wieder mit dir gesehn. Wie heißt sie? Joyce?«
»Nein. Die nicht.«
»Gratuliere«, sagte Viktoria noch einmal.
»Warum bleibst du eigentlich in der heißen Zeit hier?«, fragte Felix, nur um etwas zu sagen. Er war mit seinen Gedanken noch in dem kleinen heißen Quadrat, und während er den mit typischem Hotelpomp ausgestatteten Raum vor Augen hatte, empfand er die Absurdität seiner Existenz noch stärker, Hitler entgangen sein, um der Buchabteilung in Brown’s Department Store vorzustehen? Österreichs Wiederaufrichtung miterleben, um Livia Fox zu heiraten und, bei phantastischem Glück, Rechtsanwalt in Cincinnati zu werden?
»Du solltest dich mehr freuen«, sagte Viktoria, ohne ihm zu antworten. »Trink! Bei dieser Feuchtigkeit braucht man es.« Sie trank ein wenig Bourbon ohne Wasser.
»Es hat wenig Sinn«, sagte Felix. Er hatte seinen Rock ausgezogen und überlegte, wann er es so weit gebracht haben würde, seine Beine auf den Tisch zu legen. In einem Jahr vielleicht. Vielleicht erst in drei. Dann würde er schon ein oder zwei Kinder mit Livia haben oder mit sonst jemand. »Es hat überhaupt keinen Sinn«, sagte er.
»Den Unsinn hab ich von dir noch nicht gehört«, sagte Viktoria, der weder der Bourbon noch die feuchte Hitze etwas anhatten. Untadelig frisiert, die Haut leicht gepudert, saß sie da, als fühlte sie sich erfrischt. »Natürlich wirst du tun, was du mit dir vereinbaren kannst, das muss jeder, der Verstand und Rückgrat hat. Es wär nur schad, wenn du von beiden den schlechtesten Gebrauch machen würdest. Ich misch mich in niemandes Sachen, aber mach einen Strich, Felix, schreib Österreich von deinem Saldo ab, würde dein Großvater gesagt haben, wenn er’s erlebt hätt, dass er hätt auswandern müssen. Wenn du deine Energie darauf verwenden würdest, statt Österreich zu entschuldigen, Amerika gernzuhaben, hätt alles einen Sinn. Sag jetzt nicht, dass das eine Frage des Alters und der Bequemlichkeit ist, und dass man mit achtzig und im Hotel Plaza anders über die Sachen denkt, als wenn man einen Dickschädel hat wie du. Ich hab Amerika vom ersten Tag an gerngehabt. Damals war ich erst vierundsiebzig und hatte die gräuliche kleine Wohnung in der Lexington Avenue. Du musst dich entschließen, Felix. Nicht weil du heut etwas unterschrieben hast, sondern weil du sonst nicht weiterkannst.«
Das alles war so wahr wie das Selbstverständliche. Gerade deshalb war es so schwer. Felix sagte: »Vollkommen richtig, Großmama«, und legte ein Bein, das linke, auf einen kopierten Louis-Seize-Fauteuil.
»Übrigens, wenn man wieder wird reisen können, und die Chancen dafür sind nach dem Attentat auf den Irrsinnigen eher gestiegen, kannst du ja hinüberfahren und dir’s anschaun. Dann wirst du definitiv wissen, wie recht ich hab.«
Plötzlich wurde Felix guter Laune. Der Vorschlag löste das Problem auf eine verblüffend einfache Art. Wenn es soweit sein würde, würde man hinfahren, sich’s anschauen und wieder hierher zurückkommen, vollständig geheilt.
»Würdest du mitkommen, Großmama?«
»Natürlich«, sagte Viktoria. »Ich hab ein paar Leuten die Wahrheit zu sagen. Außerdem …« Sie zögerte.
»Möchtest du’s auch gern wiedersehn.«
»Natürlich«, sagte Viktoria.
»Du bist eine großartige Frau«, sagte Felix.
»Nein«, sagte Viktoria. »Wenn ich eine großartige Frau wär, würde ich nicht hier im Plaza leben, sondern wohnen wie du und die andern Emigranten, denen’s miserabel geht. Ich bin eine krasse Egoistin; das Gute ist nur, dass ich’s weiß.«
Das Telefon läutete, und obwohl Kathi kein Wort verstand, machte sich Viktoria wie sonst den Spaß, sie hereinzurufen und antworten zu lassen.
»Was?«, fragte Kathi, viermal. »Ich versteh ich nicht.« Dreimal. Dann, verklärt: »No freilich, Herr Graf, Frau Gräfin is sie hier. Wird sie sich enorm freun. Kommen nur herauf.« Sie legte den Hörer nieder und meldete, dass Graf Thassilo Teleky im Begriff sei heraufzukommen.
Er kam mit Onkel Kari, und Onkel Kari hatte seine zwei Hunde bei sich, den Scotch-Terrier Crazy und den weißen Pudel Fun. Kari von Geldern, Felix’ zweiter Onkel väterlicherseits, war ein stiller, vergnügter, ziemlich kranker Mann, der zwischen Anfällen von Angina Pectoris, die ihn zum Stillliegen zwangen, ständig in Bewegung war und trotz seinen vierundfünfzig Jahren inständig verliebt. Die Neugier hatte Felix von ihm.
»Hier bring ich den Thassilo«, sagte Onkel Kari.
Thassilo war Viktorias Lieblingsbruder. Sie verzieh ihm alles, auch seine Frau. Eigentlich war er ihr Stiefbruder, denn er stammte aus der zweiten Ehe ihres Vaters. Aber sie hatte ihn, Felix ausgenommen, lieber als die ganze übrige Familie, weil er in ihren Augen besaß, was sie an den anderen vermisste: eine Vorliebe für heute, ja sogar für morgen. »Ihr lebt alle vorgestern«, pflegte sie zu sagen. Thassilos Gattin allerdings, eine Französin, die an die Metropolitan Opera engagiert werden wollte, und da ihr das nicht gelang, in Hollywood auf den Tag ihrer Entdeckung wartete, war ihr unausstehlich.
»Bist du allein?«, fragte sie, um sich zu vergewissern.
Er war diesen Morgen »von der Küste« angekommen. Auch seine Zeit, Staatsbürger zu werden und die Fragen zu beantworten, die Felix heute beantwortet hatte, war nahe. Er brachte Hollywood in seinen Kleidern mit, braune Hose, gelblicher, großkarierter Rock, Wildlederschuhe, gelbes offenes Hemd. »Nein, Yvonne ist nicht mit. Es ist eine gewisse Chance, dass Lubitsch sie in seinen nächsten Film nimmt.«
»Das ist wirklich eine Chance«, sagte Viktoria, und ließ keinen Zweifel, wie sie es meinte.
Die Geschwister küssten einander. Onkel Kari verlangte einen Drink, der ihm verboten war.
»Schenk dir ein«, sagte Viktoria. Warum sollte sie ihm abreden. Erwachsene Leute wussten, womit sie sich schadeten oder nützten.
An der Küste war es auch heiß, aber nicht so feucht. Nein, Viktoria blieb trotz der Hitze in New York und ging nicht auf Sommerfrische. Erstens konnte jeden Augenblick die Vorladung kommen, und zweitens waren ihr Sommerfrischen unleidlich.
»Es kann jetzt nicht mehr lange dauern«, sagte Thassilo. Eine Sekunde später sagten sie alle, was in dieser Minute Tausende sagen mochten. Dass die vor sieben Wochen begonnene Invasion Europas märchenhafte Fortschritte mache, und dass es mit den Nazis vorbei sei. Eisenhower. Patton. Clark.
»Eigentlich könntest du dir deinen Platz schon reservieren, Felix«, sagte Viktoria.
Onkel Kari fragte, was für einen Platz.
Seinen Flugplatz nach Wien.
»Was? Du wirst doch nicht nach Wien gehn?«, fragte Thassilo. Wenn man in sein von der Sonne systematisch schokoladebraun verbranntes Gesicht schaute, sah man zugleich den elastischen Liegestuhl, die Pond’s Cream, die dreieckige blaue Schwimmhose und den Swimmingpool vor sich, die zu dieser Farbe geführt haben mussten.
»Natürlich will er gehn. Wir haben das gerade besprochen«, sagte Viktoria.
Crazy und Fun hatten die Plätze gefunden, nach denen sie bisher gesucht hatten: Crazy auf dem geblumten Fauteuil vor dem Fenster mit Aussicht auf den Central Park; Fun wälzte sich vor dem Klavier. »Natürlich ist das nicht«, sagte Onkel Kari. »Benimm dich, Fun!«
Felix wäre in diesem Augenblick zu allem bereit gewesen, nur nicht zu einer Diskussion mit Thassilo, den er gern mochte, aber für faul und beschränkt hielt. Trotzdem hörte er sich antworten: »Ja, ich werde nach Wien gehen. Hast du etwas dagegen?«
Die Mitglieder der Familie, die in Kalifornien wohnten, weil sie das Klima dort vorzogen, hatten keine hohe Meinung von Felix. Dass er seinerzeit im Justizministerium eine Stelle gehabt hatte, die eine Karriere versprach, war ziemlich lange her. Inzwischen hatte er Dummheiten gemacht, den Mund mit Phrasen voll genommen: sich selbst weiterbringen; nicht die Zeit für Luxusexistenz; leben wie die anderen Emigranten – schön und gut. Wenn es ihm Spaß machte.
»Ich hab alles dagegen«, sagte Thassilo. In vier Worte konnte er den Hochmut legen (und die Vorurteile), die seine Ahnen in Jahrhunderten aufgespeichert hatten. »Sag du mir – hast du ein so miserables Gedächtnis? Du willst dorthin zurück, wo man dich hinausg’schmissen hat?«
Onkel Kari versuchte zu erzählen, warum das gestrige Dinner im »Pavillon« hatte abgesagt werden müssen, doch es nützte nichts.
»Das muss jeder mit sich abmachen«, sagte Felix.
»Ja, aber das ist ganz einfach eine Charakterlosigkeit«, sagte Thassilo. »Bei uns an der Coast dürftest du so was nicht sagen.«
Mit seinem Ohr für Unechtes hörte Felix den falschen Ton in »bei uns an der Coast«. »Ich weiß«, sagte er, »die Leute, die sich Swimmingpools leisten können, sind dagegen. Vermutlich auch die Filmbranche.«
»Warum sagst du nicht gleich, die Juden? Also Philosemitismus kann man mir bestimmt nicht nachsagen.«
»Aber mir. Ich finde, dass ich – ganz abgesehen von den gewissen fünfundzwanzig Prozent in unserer Familienvergangenheit – im gleichen Boot bin wie sie. Du natürlich auch. Wir alle. Auch wenn wir nur deswegen hier sind, weil wir Schuschniggs Plebiszit unterstützt haben.«
»Du identifizierst dich mit den diversen Herren Cohn?«
»Leider kann ich das nicht. Seit Hitlers Gaskammern hat jeder Herr Cohn einen Schein um den Kopf. Aber – um ihn zu behalten und ihn die ganze Welt für immer sehen zu lassen, dürfen sie jetzt nicht nach Rache schreien. Vergeben und vergessen? Nein. Weder vergeben noch vergessen. Aber nicht vergelten. Auch nicht vergelten wollen!«
Eine verlegene Pause entstand.
Nie hatte Viktoria das Ehepaar Richard und Ernestine von Geldern lieber gesehen als in diesem Augenblick, da sie (nicht ohne Richards betont diskretes, zweimaliges Klopfen) eintraten, um Felix zu der bestandenen Prüfung Glück zu wünschen.
Es war Richard von Geldern geglückt, einen Teil seines Vermögens herüberzubringen und, mit einer bemerkenswerten Weitsicht in Geschäften, so anzulegen, dass es für ihn arbeitete. Übrigens besaß er in Paris noch eine Zweigniederlassung des Geldern’schen Bankhauses. Er glich Felix’ verstorbenem Vater, dessen um vier Jahre älterer Bruder er war, in vielem; in der betonten Unauffälligkeit vor allem, die trotzdem in der Summe aufdringlich wirken konnte. Jeder seiner Sätze, der Schnitt seiner Anzüge, seine Enthaltsamkeit im Lachen und im Teilnehmen versicherten: Ich wünsche nicht aufzufallen. Daran gemessen war die ruhelose, flinke Tante Ernestine von wohltuender Natürlichkeit. Sie erzählte von den Zwillingen, Ilona und Margaret, Felix’ Schwestern, die sie im Vassar College besucht habe. Ilona sei phantastisch hübsch und Margaret phantastisch gescheit. Richard sagte: »Übertreib nicht, Ernestin’.«
Mit ihnen war die Familie vollständig. Nur Felix’ Mutter fehlte, Frau Anita von Geldern, geborene Dammbacher, die in Wien zurückgeblieben war und sich nicht entschließen konnte (oder, wie Onkel Richard behauptete, nicht entschließen wollte), Wien zu verlassen. Felix entbehrte sie so sehr, wie er Wien entbehrte. Seit vier Jahren hatte er keine Nachricht mehr von ihr gehabt.
Dinner wurde auf dem Zimmer serviert. Kathi half den beiden Kellnern und sagte geringschätzig, als sie die heiße Schokoladensauce zur Ice cream anbot: »Nicht amal Mehlspeis!«
4
Heiratsversprechen
Livia wartete. Zum soundsovielten Mal hatte sie sich in den Spiegel geschaut. Seit einer Stunde hätte Felix da sein sollen, aber der 11 Uhr 10 war vorbei, und wenn er nicht in fünf Minuten mit dem 12 Uhr 48 kam, blieb er heute Nacht in der Stadt. Auch Joyce war noch nicht zu Hause.
Dass er Joyce als Zeugin gehabt hatte, daran wollte Livia nicht einmal denken. Wenn sie auch noch nicht volljährig war, die wenigen Zeugenfragen hätte sie genauso gut wie Joyce beantworten können, wahrscheinlich besser. Die fragten ja nur, ob die Leute, für die man als Zeuge ging, gute oder schlechte amerikanische Bürger sein würden. Und wer hätte klarer als sie sagen können. »Der beste, den es seit Abe Lincoln gegeben hat!«
Sie hatte ihm ja lang genug aus nächster Nähe zugeschaut.
Joyce wollte ihn einfangen; ein Blinder sah das. Sie war hübscher als Livia, viel attraktiver, und sie würde sich nicht dazu verstehen, mit ihm zu schlafen, außer wenn er sie heiratete. Darauf legte sie es an. Etwas Einfacheres gab’s nicht.
Livia ging zum Fenster, vom Fenster zur Tür, aus der Tür auf die Veranda. Nicht einmal in der Nacht wurde es kühl.
Sie hatte das Kleid, das Felix ihr geschenkt hatte, zum ersten Mal an. Weiß stand sie im Dunkeln und liebte ihn so, dass sie nichts anderes denken wollte.
Wahrscheinlich feierte er die bestandene Prüfung mit Joyce. Längst hatte Joyce ins »El Marocco« mit ihm gehen und sich zeigen wollen. Heute hatte sie es sicher durchgesetzt. Morgen würde es in der Nachtlokal-Rubrik der »New York Post« stehen.
Sie hasste Joyce. Das Schlimme war, dass sie Felix so gefiel. Livia hatte oft gedacht, ob sie ihm nicht einmal erzählen sollte, dass Joyce ein Tiller Girl gewesen war, bevor sie den Mann heiratete, der sich von ihr hatte scheiden lassen. Joyce verbarg das.
Aber das war es ja gerade mit Joyce, dass sie aus sich etwas machen wollte, was sie nicht war. Wie dumm von ihr, nicht zu sehen, dass Felix Prätention nicht mochte. Vielleicht wäre es ihm sogar lieber gewesen, wenn er gewusst hätte, dass sie ein Tiller Girl hatte sein müssen, um das Leben zu verdienen.
Nicht denken. Es führte zu nichts.
Warum konnte nicht einmal – ein einziges Mal im Leben geschehen, was man sich wünschte? Warum konnte er jetzt nicht hier sein? Einmal fünf Stunden mit ihm allein sein. Zehn. Einen Tag.
Sie sah ihn kommen. Die Straßenlampe, die den kleinen Hügel beleuchtete, auf dem das Haus stand, schien ihm ins Gesicht. Niemand war mit ihm.
Das Glück strömte ihr so zum Herzen, dass sie sich eine Sekunde festhielt. Dann lief sie über die Veranda und die paar Steinstufen den Hügel hinunter, um sich ihm in die Arme zu werfen. Es war das, was sie tun wollte, und was es sie zwang zu tun, denn sie dachte nichts als: Er ist da! Gott sei Dank!
Er dagegen, den Abend mit der Familie in allen Gliedern, dachte den ganzen Weg nichts als: Ich bin im Begriff, etwas Falsches zu tun. Halte ich das Versprechen, das ich nachmittags unterschrieben habe, dann ist es falsch, denn ich werde es nicht aushalten können. Erkläre ich, dass ich meine Unterschrift zurückziehe, bevor ich den Bürgereid leiste, so ist es ebenso falsch. Denn Bürger will ich werden.
»Da sind Sie ja«, sagte Livia.
Er sagte nichts. Er sah nicht, wie glücklich und bereit sie war. Er dachte an sich.
Sie dachte, er ist glücklich.
Zwei Menschen trafen sich auf einem Hügel, unweit der Station Scarsdale im Staate New York, und ihnen widerfuhr, was in diesem Augenblick den Menschen überall begegnete, wo sie einander trafen. Sie wussten nichts voneinander.
»Freuen Sie sich nicht?«, fragte Livia.
»O ja.«
»Es klingt nicht so.«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Ich glaube, ich bin ein ziemlich schäbiger Kerl.«
»Sie? Nein!« Sie musste lachen, denn etwas, das dümmer war, hätte er nicht sagen können. Sie hatte die Menschen kennengelernt, mehr als bei ihrer Jugend notwendig gewesen wäre; Felix war der beste von allen, die sie kannte. Ihr Herz schlug so für ihn, dass sie nicht länger einsah, warum sie daraus ein Geheimnis machen sollte.
Sie stiegen ein paar Schritte.
»Heiß«, sagte er, »gar nicht abgekühlt.« Es klang wie ein Vorwurf, und es war ein Vorwurf. So wird es für den Rest meines Lebens sein, war damit gemeint. Zum Ersticken heiß am Tag, keine Abkühlung in der Nacht.
»Haben Sie gefeiert?«, fragte sie.
»Ja. Nein. Ich war bei meiner Familie.«
»War Joyce auch mit?«
»Nein.«
»War sie eine gute Zeugin?«
»Ja.«
»Wo ist sie?«
»Ich weiß nicht.«
Sie traten durch die Glastür, die von der Veranda ins Haus führte.
»Sie hatten doch so auf den heutigen Tag gewartet« sagte Livia.
Abfahrt in Le Havre, 13. April 1939. Drei Tage raue See. Bei der Ankunft in New York sagt der Zollbeamte: »Welcome to the States.« Ein Zollbeamter! Kleines Hotel, Westen, 89. Straße, an der Amsterdam Avenue, Negerkinder spielen auf den Stufen. Eine Bank im Central Park, nahe dem Museum, immer mit der Zeitung in der Hand, in der Zeitung immer Hitlers Siege. Gegen elf Uhr erscheinen die ersten Mittagsblätter. Was werden die Schlagzeilen sein? Hitlers Siege? Brown’s Department Store, die unerträgliche Stunde vor fünf nachmittags, wo man völlig ausgepumpt ist. »Keep us out of war!« »Wir wollen keinen Krieg!« Ein kleiner Mann ist an der Ecke Plaza und 58. Straße von einem Auto überfahren worden; jemand fragt ihn, wie es ihm geht. Er antwortet: »Fein.« Die Wälder von Connecticut, wie grüne Ozeane. Die Negerin, die ihm Kaffee macht, als er mit Lungenentzündung liegt, sagt: »Sie werden leben oder sterben, Mr. van Geldern, beides ist herrlich.« Eine Negerin. Roosevelts Stimme: »They bed for it and they’ll get it.« »Sie haben darum gebeten, und sie werden’s bekommen!« D-Day, die Alliierten landen in der Normandie.
Es zog an ihm vorbei, Fragmente aus sechs Jahren, dahinter der brennende Wunsch: Dazugehören! Teil davon sein, was Hitler stürzt!
»Ja, ich habe auf den heutigen Tag gewartet, und ich hin glücklich«, sagte er. Es gab nur einen Weg. Er hatte ihn heute Nachmittag endgültig gewählt, der Weg war richtig. »Das Kleid steht Ihnen gut, Livia.«
»Danke.«
»Was ist Ihnen denn?«
»Nichts.«
»Sie sind so einsilbig.«
»Ich?«
»Sie sollten sich auch ein bisschen mit mir freuen.«
»Das tu ich, Herr von Geldern.«
»Warum sagen Sie mir eigentlich noch immer Herr von Geldern?«
»Gewohnheit.«
»Sie könnten Ihre Gewohnheiten ja auch einmal ändern. Oder ist das so schwer?«
»Nein, Felix.«
Sie standen noch an der Glastür. Der Schein der Straßenlampe fiel schräg herüber. Er traf ihre Schläfe und ihren Hals.
»War etwas mit Joyce?«
»Nein. Warum?«
Wenn man nicht einmal an diesem Tag reden durfte, wann denn? Es war der Entscheidungstag. Sie nahm ihre Kraft zusammen und fragte: »Haben Sie Joyce lieb?«
»Was ist denn mit Ihnen, Livia?«
»Ich möchte es wissen.«
»Sie wissen doch, dass ich Joyce nicht liebhabe.«
Wahr! Nie hatte sie ihn auf einer Lüge betreten. »Sie werden sie nicht heiraten?«
»Nein.«
Sie wollte etwas sagen und verstummte.
Er wusste, was sie sagen wollte. Obschon er das seit langem wusste, rührte es ihn in diesem Augenblick. Ohne dass er vor einer Minute geahnt hätte, dass er das sagen würde, sagte er: »Vielleicht werde ich Sie heiraten.«
Sie trat aus dem Licht. »Mein Gott!«, sagte sie. »Aber das meinen Sie nicht.«
»Doch«, sagte er. »Je länger ich’s mir überlege.«
Er überlegte es wirklich. Dann gab es überhaupt kein Zurück mehr. Dann erst hatte er sich ganz gebunden.
Sie sah ihn zögern. Er dachte etwas, sah sie, das nichts mit ihr zu tun hatte. War es Joyce? »Sie müssen mich nicht heiraten, Felix, Sie können mich auch so haben.«
Was die paar Worte sie kosten mussten!
»Wann heiraten wir?«, fragte er schnell. Er hatte tatsächlich etwas gedacht, das weder Joyce war noch die Unterschrift von heute. Er hatte gedacht: Dass ich das zu jemandem andern sage als zu Gertrud!
Joyce trat ins Zimmer, niemand hatte sie kommen gesehen. »Geh hinaus, Livia«, sagte sie laut.
»Livia bleibt hier«, antwortete Felix.
Joyce trat näher. Sie musste getrunken haben, man merkte es an ihren Augen. »Ich weiß, wie du bist«, sagte sie zu Livia. »Glaube nicht, dass ich es nicht weiß. Ich weiß es. Ich weiß es.«
»Was weißt du?« Livia stand wieder im Licht.
»Du hast es darauf angelegt, die ganze Zeit, die ganzen Jahre. Ich dulde es nicht.«
»Du hast nichts zu dulden.«
»Das ist der Dank. Ich habe dich erhalten. Ich habe dich erzogen. Ich dulde es nicht.«
»Joyce«, sagte Felix, »es hat keinen Sinn. Sie können Livia nichts verbieten. Ich liebe Livia. Es ist eine Schande, dass ich es ihr erst heute gesagt habe. Seien Sie vernünftig, Joyce.«
»Ich bin vernünftig, und ich sage euch, Ihnen und ihr: Dazu kommt es nicht. Sie sagen, Sie lieben sie. Jeder Mann lügt. Und sie sagt Ihnen, dass sie Sie liebt. Ich habe Ihnen das nicht gesagt, Felix, aber Sie haben es gewusst. Danke. Ich gehe jetzt schlafen.«
Sie ging über die Treppe, die aus dem Wohnzimmer in das obere Stockwerk führte.
»Sie meint es nicht so«, sagte Felix.
»Sie meint es so. Und das Schlimme ist, dass sie recht hat.«
Die Grillen auf der schrägen Wiese waren laut. Keine Sekunde setzten sie aus.
Plötzlich war alles undurchsichtig, drohend, feindselig.
»Kümmern wir uns nicht um Joyce«, sagte Felix. »Danke dafür, was Sie mir vorhin gesagt haben. Es ist großartig.«
»Sie lieben mich nicht.«
»Ich liebe dich.«
»Es hat keinen Sinn, sich etwas vorzumachen.«
»Das ist es gerade, was ich nicht tue. Ich bin mir absolut klar.«
Sie musste denken, und es tat ihr weh: Wenn jemand so klar ist und so klar redet, dann ist es der Verstand und sonst nichts. Das Gebirge von Glück, auf dem sie gegangen war, schrumpfte zusammen.
»Morgen reden wir weiter«, sagte er. »Gute Nacht.«
Die Grillen machten einen mörderischen Lärm.
5
Ein glänzender Jurist
Mr. Graham hatte gerade gefragt, ob Felix mit ihm Lunch haben wolle, als Onkel Richard sagen ließ, er sei da und habe dringend mit Felix zu reden.
»You’re entirely welcome«, sagte Mr. Graham, als Felix sich entschuldigte.
Einen Augenblick später stand Richard mitten unter den Damen, die nach den letzten Neuerscheinungen fragten. An den drei Felix anvertrauten Tischen nahmen sie die Romane, die Biografien und die politische Tagesliteratur zur Hand, welche die Verkäufer ihnen empfahlen. Immer wieder hatte es Felix erstaunt, mit welcher Bereitwilligkeit sie glaubten, was die Verkäufer ihnen sagten. Sie standen da und blätterten in den ihnen angepriesenen Büchern, als wählten sie Seifen oder Zahnpaste. Sie lasen ein paar Sätze, beschauten den Schutzumschlag und was darunter war und legten dann die Ware, ohne sie zu kaufen, zurück auf den Stapel. Warum, da sie den Anpreisungen der Verkäufer solchen Glauben schenkten? Es war ein Rätsel, das Felix bisher nicht hatte lösen können.
»Nichts als verschwendete Energie, was du da machst«, sagte Richard. »Ich hätte gern, dass du diesen Brief liest. Wir haben keine Zeit zu verlieren.«
Sie gingen miteinander weg. Die Mittagsausgabe der »Sun« meldete: »Die deutschen Armeen auf der ganzen Linie zusammengebrochen.« Es war ein Spätherbsttag, voll des herrlichen Lichtes, das New York zuzeiten hat. Die Umrisse standen gegen den blauen Himmel mit einer Klarheit, Freiheit und Reinheit, die mit dem Harten und Beschmutzten versöhnten.
»Phantastisch«, sagte Felix. Er meinte beides, das Licht und die Meldung.
»Eben«, sagte Richard. »Nur muss man die Konsequenzen daraus ziehen.« Durch die Fenster des Restaurants hinter der St.-Patrick-Kathedrale sah man die Eisläufer. Sie tanzten.
Die Zeit sei gekommen, stand in dem Brief, den Richard bei sich hatte, einen Sachwalter der von Geldern’schen Interessen in dem Augenblick nach Europa zu senden, da die Okkupationsarmeen die Regierung übernehmen würden.
»Natürlich kannst nur du das sein«, sagte Richard. »Wenn man jemanden hinschickt, muss es ein Jurist sein, der mit Behörden umgehen kann.«
»Warum gehst du nicht?«, fragte Felix.
»Du wirst mir schon zugutehalten müssen, dass ich in meinen Jahren und bei meiner Gesundheit erst dann gehen möchte, wenn ich weiß, weshalb und wohin. Du wirst gehen, Felix. Du weißt besser als wir alle, was auf dem Spiel steht.«
Der Kellner hatte die Shrimp Cocktails hingestellt.
Banken standen auf dem Spiel. Häuser. Eine Menge Geld.
»Du bist doch sowieso nicht so gern hier«, sagte Richard. »Außerdem gibst du nichts auf. Kommis in einer Buchhandlung kannst du immer sein.«
»Ist das ein Beschluss der Familie?«
»Wir wollen, dass du hinübergehst und dich davon überzeugst, wie die Dinge stehen und was sich für uns alle machen lässt.«
Das Licht war fast zu grell. Es leuchtete auf dem schmalen Rechteck aus Kunsteis, worauf die Tänzerinnn ihre Künste zeigten, und auf den hellen himmelhohen Steinwänden der Häuser.
Die deutschen Armeen auf der ganzen Linie zusammengebrochen. Was sich für uns machen lässt.
»Oder hast du Bedenken?«, fragte Richard.
»Ja.«
»Darf ich dir jetzt etwas sagen, Felix? Du hast dich während dieser ganzen Jahre mit oder ohne Absicht von uns distanziert. Mit Absicht, natürlich. Aber das war deine Sache – solange nichts anderes davon abhing als dein Hochmut, dich hier unabhängig von uns fortzubringen. Bitte sehr, du hast bewiesen, dass du als Buchhandlungsgehilfe dein Leben fristen kannst und auf uns nicht angewiesen bist – ich gebe das bereitwillig zu. Aber jetzt sind wir auf dich angewiesen. Du bist der Jurist in der Familie. Man müsste dich erfinden, wenn es dich tatsächlich nicht gäbe. Außerdem warst du ein guter Österreicher. Du hast nie den mindesten Zweifel daran gelassen, dass du im selben Moment wieder zurückwillst, in dem man zurückkann. Der Moment steht vor der Tür. Was ich dir jetzt sage, hätte dir dein Vater genauso gesagt, wenn er es erlebt hätte. Von deiner Mutter nicht zu reden. Ich sage dir ganz offen, es ist für uns einfach unverständlich, dass wir dich erst auffordern müssen, etwas zu tun, was du von dir aus längst hättest anbieten müssen! Hat die junge Dame, die wir noch immer nicht zu kennen das Vergnügen haben, einen so entscheidenden Einfluss?«
Felix hätte antworten können, ich habe mich nicht angeboten, weil es mir nicht wichtig ist, mich drüben um Geld zu kümmern. Wenn ich hinübergehe, möchte ich mich um etwas ganz anderes kümmern. Die junge Dame hat leider sehr wenig Einfluss. Meine Schuld. Sie verliert den Einfluss von Stunde zu Stunde. Vielleicht auch ihre Schuld.
»Ich halte den Zeitpunkt für verfrüht«, sagte Felix. »Man kann nicht in Geschäften reisen, solange gekämpft wird.«
»Du betonst ›Geschäfte‹ sehr merkwürdig. Hast du dich wirklich so verändert, seit du amerikanischer Bürger geworden bist?«
»Ja«, sagte Felix. Er hätte sagen können: Und wahrscheinlich du auch und die ganze Familie. Nicht weil wir Bürger geworden sind, sondern weil Amerika einen verändert.
»Also, wie entscheidest du dich?«
»Wenn’s so weit sein wird, werde ich fahren. Ich kann dir nur nicht versprechen, dass ich das, was ihr von mir wollt, werde machen können.«
»Da verlassen wir uns ganz auf dich. Ein so glänzender Jurist wie du.«
»Verlass dich nicht auf mich. Ich tu’s auch nicht.«
Der Kellner hatte gefragt, ob die Herren ihr Steak »medium« oder »rear« wünschten. Onkel Richard gab die Auskunft: »Medium.« Die Eistänzerinnen wirbelten halsbrecherisch auf einem Fuß. Überscharf stand alles im Licht.
»Du wirst deine Sache schon gut machen«, sagte Richard.
Erstes Buch
EUROPA TAUCHT AUF
6
Das Orakel
Das Schiff hieß »Brazil«. Es war noch nicht in ein Passagierschiff umgewandelt, sondern machte seine Reise wie in den letzten Jahren, in denen es Truppen befördert hatte. Es gab also nur ganz wenige Kabinen für Bevorzugte. Die anderen, Felix gehörte zu ihnen, hatten ihre Schlafstätte mit vier, sechs oder zehn Mitreisenden zu teilen. Felix teilte sie mit zehn.
Die »Brazil« lag fast zwei Stunden im Dock an der 52. Straße, bevor sie in See stach. Rechts von dem schrägen, steilen Steg, auf dem die Passagiere das Schiff erreichten, drängten sich die Zurückbleibenden.
Die Familie von Geldern stand vollzählig da, Felix’ Schwestern in der vordersten Reihe. Auch Livia war da (Joyce nicht), sie war ein wenig zu spät gekommen, weil Joyce sie nicht hatte gehen lassen wollen. Sie sah ihn den schrägen Steg hinaufgehen. Er hatte den Mantel über dem Arm und in der Hand die Aktentasche, die sie ihm gekauft hatte. Es war eine schöne, hellbraune, lederne Aktentasche, die schönste, die sie hatte bekommen können, und sie fand, dass er damit aussah wie ein Diplomat.
Sie fand, dass es die traurigste Stunde ihres Lebens sei, denn sie wusste, er würde nicht zurückkommen. Jedenfalls nicht zu ihr. Sie sah ihn jetzt zum letzten Mal in ihrem Leben. Wenn sie gewollt hätte, hätte er sie geheiratet, dann wäre sie jetzt mit ihm auf dem Schiff. Sie hatte es mehr gewollt als irgendetwas, sie hatte es ihm nur nicht sagen können. Es waren hundert Gelegenheiten gewesen, es ihm zu sagen; sie hatte alle verpasst. In ihrer Traurigkeit war sie ein bisschen stolz darauf. Sie wusste, dass das seine Familie war, die dort rechts von ihr beisammenstand. Einen Augenblick überlegte sie, ob sie hingehen und sich dazustellen sollte. Auch Fremde standen ja zusammen, die ein Schicksal verband, und vielleicht wäre es richtig gewesen, bei denen zu stehen, zu denen er gehörte.
Aber sie tat es nicht.
Das Schiff bewegte sich noch immer nicht, die Passagiere mussten Formalitäten erledigen und hatten keine Zeit, sich um die zu kümmern, die unten standen und traurig waren.
Livia war so traurig, dass sie es nicht ertragen zu können glaubte. Die Jahre mit ihm waren eine einzige fliegende Stunde Seligkeit. Jetzt erschienen sie ihr so, angesichts des großen Schiffes, das mit der Abfahrt drohte. Er, der offenbar schon in diesem Augenblick so wenig an sie dachte, wie er es von nun an sein Leben lang tun würde, war der beste Mensch auf der Welt. Keinen einzigen Vorwurf hatte sie ihm zu machen – sie kannte ihn besser als die, die dort standen und zu ihm gehörten! Wie hätte sie ihm einen Vorwurf machen können, man macht ja auch der Luft keinen Vorwurf, weil sie blau ist. Er war, wie er war, ein Glücksfall. Auch andere hatten Freundlichkeit und Teilnahme. Bei ihm aber kam es nicht von den Lippen, sondern aus seinem Blut, er lebte vom Helfen, vom Leichtermachen und Verstehen. Wo gab es einen Menschen, der wie er zuhörte, wenn man ihm etwas sagte. Der es in derselben Sekunde zu seiner Sache machte und dem man es mitzutragen gab, weil er es nicht anders wollte. Selbstverständlich, dass man so einen Menschen nicht für sich allein haben konnte. Sie empfand das so klar, dass es wehtat.
Seine beiden Schwestern waren hübsch. Die brünette sah ihm ähnlich, die blonde hatte sein Lachen. Livia schaute auf die zwei jungen Mädchen, die etwas zum Schiff hinaufriefen, was sie nicht verstand. Dann deutete sie es sich als »Großmama«, denn von oben antwortete ihnen eine alte Dame. Von Großmama Viktoria hatte Livia gehört und zweifelte nicht, dass sie es war, die den Mädchen herunterwinkte. Genau so hatte sie sich sie vorgestellt, zwischen einer Königin und einer kleinen Frau, mit der man herrlich spaßen konnte. Sie schrie etwas in deutscher Sprache, und die Enkelinnen antworteten begeistert: »Ja!« Die anderen aus seiner Familie mochten Felix nicht, Livia hätte darauf geschworen; sie wollten nur, dass er wegfuhr. Livia hasste sie. Gäbe es die nicht, Felix wäre jetzt nicht auf dem Schiff. Falsch! Immer hatte er wegfahren wollen, sogar wenn sie am glücklichsten gewesen waren, hatte er einen blitzschnellen Schatten in den Augen gehabt, für eine Sekunde oder zwei – da war er drüben gewesen, wohin er jetzt fuhr.