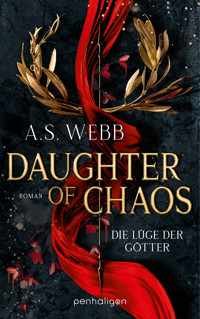
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dark Pantheon
- Sprache: Deutsch
Damit die Menschen frei sein können, müssen die Götter fallen ...
Die letzte Tochter wird kommen, die Herrschaft des Donners beenden und zum Licht werden, das die Menschheit befreit. Im antiken Griechenland klammern sich die Menschen an diese uralte Prophezeiung, laut der eine Frau die gnadenlose Herrschaft der Götter beenden wird. Fischerstochter Danae kannte nie etwas anderes als Gehorsam den grausamen Gottheiten gegenüber – bis zu dem Tag, an dem sie mysteriöse Kräfte zu entwickeln beginnt und einen Skandal entfacht. An der Seite von Herakles macht Danae sich auf, legendäre Monster zu jagen. Doch es sind die Götter des Olymps, auf deren Fährte sie ist.
High Fantasy meets Greek Retelling – der Auftakt einer göttlichen Fantasy-Trilogie mit einer unvergleichlichen Heldin!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 684
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Die letzte Tochter wird kommen, die Herrschaft des Donners beenden und zum Licht werden, das die Menschheit befreit. Im antiken Griechenland klammern sich die Menschen an diese uralte Prophezeiung, laut der eine Frau die gnadenlose Herrschaft der Götter beenden wird. Fischerstochter Danae kannte nie etwas anderes als Gehorsam den grausamen Gottheiten gegenüber – bis zu dem Tag, an dem sie mysteriöse Kräfte zu entwickeln beginnt und einen Skandal entfacht. An der Seite von Herakles macht Danae sich auf, legendäre Monster zu jagen. Doch es sind die Götter des Olymps, auf deren Fährte sie ist.
Autorin
A. S. Webb studierte Englische Literatur und Theaterwissenschaften an der Leeds University. Sie wurde bereits für Serien von BBC, Channel 4 und Netflix gecasted und hat selbst einige Drehbücher für Kurzfilme und Theaterstücke verfasst, die unter anderem am Hampstead Theatre aufgeführt wurden. Ihre Inspiration findet die Autorin in historischen und mythologischen Werken, die die Grenzen der Vorstellungskraft sprengen und gleichzeitig zum Nachdenken anregen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Webbs Debütroman »Daughter of Chaos – Die Lüge der Götter« eroberte die Spitzenplätze der »Sunday Times«-Bestsellerliste und ist der Auftakt einer Trilogie.
A. S. Webb
DAUGHTER
OF CHAOS
DIE LÜGE DER GÖTTER
Roman
Aus dem Englischen von
Charlotte Lungstrass-Kapfer
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel »Daughter of Chaos« bei Michael Joseph, a part of the Penguin Random House group of companies, London.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Das Zitat stammt aus Orvids »Metamorphosen«, übersetzt von David Raeburn. In: Penguin Classics (Hrsg.): Metamorphoses (Reprint Edition), London 2004.
In diesem Buch werden Neopronomen verwendet. Da es zum Zeitpunkt des ersten Erscheinens für die deutsche Sprache noch keine einheitliche Regelung gibt, haben wir uns als Verlag für das Neopronomen dey entschieden.
Copyright © 2025 by A. S. Webb
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Penhaligon
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Wiebke Bach
Umschlaggestaltung: © Anke Koopmann | Designomicon
Umschlagdesign und -motiv: © Shutterstock.com (blackboard1965,
Tatkhagata, Lena Bukovsky, Anastasiya Deriy, Anjar G)
SH · Herstellung: fe
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-32511-4V001
www.penhaligon.de
Für Sam, auf ewig.
Bevor die Erde, das Meer und
der allumfassende Himmel entstanden,
entfaltete sich die Natur in ihrer Gänze
im Antlitz dessen, was die Menschen
später Chaos nannten.
Ovid, Metamorphosen
DIE HÖHLE
Danaes Atem glitt in geisterhaften kleinen Schwaden durch das Halbdunkel. Mit einem Ruck rollte sie sich von der finsteren Tiefe der Höhle fort und starrte hinaus in das trostlose Weiß. Sie befand sich auf einem Felsvorsprung auf halber Höhe eines unbezwingbaren Berges am Ende der Welt, umgeben vom eisigen Dunst endloser Wolkenbänke. Seit Jahrhunderten hatte sich niemand mehr so weit vorgewagt. Zumindest kein Sterblicher.
Indem sie die Lider zusammenpresste, versuchte sie die Wärme zurückzuholen, die sie in ihrem Traum gespürt hatte. Doch egal wie sehr sie sich auch anstrengte, sie konnte nicht dorthin zurück. Die Kälte des Berges war ihr bereits tief in die Knochen gedrungen.
Schließlich ergab sie sich der Wirklichkeit, zog ihren Beutel von der Schulter und widmete sich ihren schmerzhaft pochenden Händen. Nur mithilfe ihrer Zähne gelang es ihr, sich die Ziegenlederhandschuhe von den Fingern zu ziehen. Aus den Schnitten, die sie sich beim Aufstieg zugezogen hatte, quoll noch immer Blut. Sie sog scharf die Luft ein, drückte eine Hand gegen die Wand und zog sich hoch. Ein roter Fleck blieb auf dem Fels zurück. Nun auf den Knien rutschend, kroch sie tiefer in die Höhle hinein, um sich vor den beißenden Windböen in Sicherheit zu bringen. Der Salzgeschmack in ihrem Mund ließ sie die blutende Hand an die Wange heben; sie hatte geweint, ohne es zu merken.
Von einem Strand hatte sie geträumt. Von weißem Sand, der von den Füßen ihrer Brüder aufgewirbelt wurde, während sie zu den Felsenpools vorne am Wasser rannten. Sie selbst war hinterhergerast, wollte sie unbedingt einholen, wollte unbedingt die Erste sein, die einen Krebs fing. Ihre Schwester sah ihnen vom Strand aus zu, der Wind trug Aleas leises Lachen mit sich fort.
Dieses jüngere Ich, das den Strand hinunterrannte, erkannte Danae kaum noch wieder. Fast schien es, als gehörten diese Kindertage zu einem anderen Menschen, als trüge sie die Erinnerungen einer Fremden in sich. Doch schon der Anblick ihrer geschundenen Hände führte ihr deutlich vor Augen, was sie alle getan hatten, was sie getan hatte, um hierher zu gelangen.
Achtzehn war sie gewesen, als sie Naxos verließ. Jetzt musste sie schon fast zwanzig sein. Einerseits fühlte es sich an, als wäre sie erst wenige Tage fort, dann wieder schienen es Jahrzehnte zu sein. Sie dachte an ihre Eltern, ihre Brüder, ihre kleinen Neffen. Diese Menschen waren ihr Anker, gaben ihr Halt bei dem, was sie hier tat. Wie sehr hatte sie sich an die Hoffnung auf ein Wiedersehen geklammert, doch wenn sie nun versuchte, sich an ihre Gesichter zu erinnern, entglitten sie ihr wie flüchtiger Rauch.
Sie zog das Löwenfell zurecht, das ihre Schultern bedeckte. Das Maul des Untiers ruhte weit geöffnet auf ihrem Kopf, sodass die Reißzähne ihre Schläfen streiften. Die struppige Mähne ergoss sich über ihren Rücken. Angeblich konnte dieses Fell von keiner Waffe der Welt durchdrungen werden, hatte es doch einst dem berüchtigten Nemeischen Löwen gehört, bis es ihm von dem größten Helden aller Zeiten vom Körper gerissen worden war.
Wenn sie daran dachte, wie Herakles den Diebstahl entdeckte, wurde ihr flau im Magen. Ja, sie brauchte es dringender als er, trotzdem konnte sie nicht aufhören, sich sein Gesicht vorzustellen, wenn er das Ausmaß ihres Verrates begriff.
»Hör auf damit«, murmelte sie in die leere Höhle hinein.
Mit einem Griff in ihren Beutel beförderte sie ein tintenschwarzes Kleid zutage, von dem sie mit dem Messer lange Stoffstreifen abschnitt. Nachdem sie damit ihre Finger verbunden hatte, inspizierte sie ihre Ausrüstung: Sie verfügte über ein Messer, einen Wasserschlauch, den Splitter des Omphalos-Steines, ihre Pfeife, einen beinahe leeren Kräuterbeutel, ein Säckchen voller Drachmen, ihren dunkelblauen Mantel und eineinhalb Scheiben Zwieback.
Ihr Magen knurrte. Mit einem entschlossenen Atemzug nahm sie den halben Zwieback und aß ihn. Dann hob sie den Wasserschlauch an die Lippen.
Danae fluchte.
Das Wasser war gefroren. Sie schob den Schlauch unter die Felle, die sie am Körper trug. Ihr entkam ein leises Keuchen, als das kalte Material ihre Haut berührte. Hoffentlich würde ihre Körperwärme ausreichen, um das Wasser aufzutauen, denn sonst würde sie verdursten, bevor sie den Gipfel erreichte.
Ihr Blick wanderte zu der letzten Zwiebackscheibe. Dabei fiel ihr etwas ins Auge: Eine schmale Kerbe zog sich über den felsigen Boden der Höhle. Als sie den Zwieback beiseiteschob, erkannte sie, dass es Krallenspuren waren. Sofort suchte sie weiter und entdeckte noch mehr. Verwirrt runzelte sie die Stirn. Welcher Vogel würde sich einen so unwirtlichen Ort für sein Nest aussuchen?
Leise Hoffnung ließ sie tiefer in die Höhle hineinkriechen. Falls es hier ein Nest gab, gab es vielleicht auch Eier. Je weiter sie vordrang, desto schwächer wurde das Licht, trotzdem sah sie, dass die Höhle sich im hinteren Teil ausdehnte und eine Art Vorkammer bildete, die sogar groß genug war, um aufrecht darin zu stehen.
Etwas Hartes zerbrach unter ihrem Fuß. Danae bückte sich danach und hob einen geborstenen Knochen auf. Also war es wohl ein großer Vogel. Groß genug, um Beutetiere von der Größe einer Ziege zu fangen, das verriet ihr die Länge des Knochens. Schnell drückte sie sich flach an die Wand, um möglichst viel Licht in den hinteren Teil der Höhle zu lassen.
Auf dem Boden lagen die unterschiedlichsten Dinge herum: Zweige, Münzen, Steine, Tonscherben, Stofffetzen und sogar etwas, das früher zu einer Rüstung gehört haben mochte. Ihr Puls beschleunigte sich. Vögel legten sich nicht solche Sammlungen zu, nicht einmal Elstern.
Ein schrilles Kreischen durchdrang das Heulen des Windes. Hastig zog sich Danae wieder an den Höhleneingang zurück und tastete dabei nach ihrem Messer. Schon im nächsten Moment wirbelte etwas Großes, Fedriges an ihr vorbei und glitt mit rutschenden Krallen über den Boden.
Auf den ersten Blick schien es ein Adler zu sein. Der gefiederte Kopf wandte sich ihr zu. Die gelben Augen blickten wild, an dem gebogenen Schnabel hingen Eiskristalle. Mächtige braune Flügel füllten die Höhle aus und blockierten das Licht, wann immer sie gegen die Wände schlugen. Dann erst sah Danae den restlichen Körper.
Jenseits der auf Schulterhöhe wachsenden Flügel hatte die Kreatur den Leib, die Hinterbeine und den Schwanz eines Löwen. Die Vorderbeine waren eine groteske Mischung aus beiden Tieren – kraftvoll wie die einer riesigen Raubkatze, aber mit der schuppigen Haut und den langen, gebogenen Krallen eines Raubvogels ausgestattet.
Es war ein Greif. Ein Wesen, das sie nur aus Sagen und Legenden kannte.
In einem anderen Leben wäre sie vermutlich starr gewesen vor Angst, aber dieses Untier war nur ein kleiner Tropfen im Meer des Grauens, das sie bereits durchschwommen hatte.
Halb blind durch das fehlende Licht wich sie den Krallen des Greifen aus – nicht schnell genug. Danae schrie auf, als die Kreatur ihr den Unterarm aufriss, genau dort, wo die Haut nicht durch das Löwenfell geschützt war. Ihr aufwärtsstoßendes Messer streifte lediglich eine Flügelspitze. Der Greif stieß einen kehligen Laut aus, irgendetwas zwischen Kreischen und Knurren, und griff sie noch wütender an.
Sie war so müde. Lange würde sie das nicht durchhalten.
Doch es gab immer noch eine andere Möglichkeit.
Keuchend warf sie sich gegen die Wand, um dem nächsten Schlag zu entgehen, und prallte dabei mit dem Ellbogen gegen den Fels. Nein, sie war zu schwach, um ihre Kräfte einzusetzen. Ihre Unterarme waren schon halb zerfetzt, und ihre Energie reichte kaum noch aus, um den Angriffen des Greifen auszuweichen.
Was würde Herakles tun? Er hatte gegen ein Dutzend Kreaturen gekämpft, die schrecklicher waren als diese, und hatte überlebt. Der hatte allerdings den Vorteil seiner übermenschlichen Kraft auf seiner Seite. Ohne ihre besonderen Fähigkeiten blieben ihr nur das Messer und das schützende Löwenfell, das allerdings so leicht von ihrem Rücken gerissen werden konnte wie die Flügel eines Schmetterlings.
Das Löwenfell.
Wieder stürzte sich der Greif auf sie. Wenn ihr Plan schiefging, war sie tot. Die Kreatur hatte sie bereits bis an das hintere Ende der Höhle getrieben. Bald hätte sie nur noch die nackte Felswand im Rücken, und dann würde das Untier sie auf jeden Fall in Stücke reißen.
Sie senkte den Kopf, sodass sich das Löwenhaupt direkt vor dem Greifen befand, und stieß ein lautes Brüllen aus.
Für einen kurzen Moment zögerte die Kreatur.
Danae packte das Messer mit beiden Händen, legte ihr gesamtes Gewicht in den Stoß und riss die Klinge hoch. Sie schob sich zwischen Federn hindurch, bohrte sich in festes Fleisch. Der Schrei des Greifen erstarb, als die Waffe seine Luftröhre durchstieß. Blut spritzte auf Danaes Hände. Sie klammerte sich weiter an ihr Messer, während sich das Untier im Todeskampf wand. Erst als es reglos zusammenbrach, ließ sie los.
Am liebsten hätte sie sich ebenfalls fallen lassen, aber jetzt musste sie schnell handeln. Schon in wenigen Sekunden wäre die Lebenskraft des Greifen verloren. Suchend drückte sie eine Hand auf die Wunde und tastete nach dem immer schwächer werdenden Puls.
Plötzlich schien sie doppelt zu sehen, denn die glühenden Stränge der Energie, die alle Lebewesen durchströmte, legten sich über die stoffliche Welt. Auch unter der eigenen Haut konnte Danae sie sehen, nahm wahr, wie sie durch ihre Adern schoss, unaufhaltsam in ihrem zyklischen Netz der Kraft. Ebenso strahlten die Lebensfäden des Greifen, sie quollen zwischen ihren Fingern hervor und lösten sich in der Dunkelheit auf, als die Kreatur nach und nach den Kampf gegen den Tod verlor. Sie konzentrierte sich, zwang die feinen Stränge, sich auf ihre Hand zuzubewegen. Und tatsächlich änderten sie die Richtung und strömten nun in ihre Handfläche und ihren Arm hinauf, um sich dort dem glühenden Netz anzuschließen, das ihren gesamten Körper durchzog.
Der Blick des Greifen wurde trüb, als der letzte Lebensfaden in Danaes Fingern verschwand. Ihre schmerzenden Glieder erholten sich und ihre Wunden heilten, als die Lebensenergie der Kreatur durch ihre Adern strömte. Berauscht von der einsetzenden Euphorie lehnte Danae sich zurück und atmete tief durch. So viel Leben barg sie nun in sich.
So viel Macht.
TEIL EINS
1
DREI JAHRE VOR DER HÖHLE
Ausgerechnet heute!« Danaes Mutter zog hektisch die Chlaina ihrer Schwester zurecht. »Wir werden noch zu spät kommen!«
Danae war vollkommen auf das große Fischernetz konzentriert, das auf dem Holztisch in der Mitte ihrer kleinen Hütte ausgebreitet war. Zusammen mit ihrem Vater beugte sie sich über die filigrane Struktur und versuchte, sie zu entwirren. Ihre Miene war angespannt, die Worte ihrer Mutter kaum mehr als ein Hintergrundrauschen.
Alea entzog sich dem fordernden Griff der Mutter, ging zu Danae hinüber und legte ihr eine Hand auf den Arm.
»Na komm, sie wird es uns ewig vorhalten, wenn wir jetzt nicht aufbrechen.«
»Wenn du dein Kleid beschmutzt hast …« Ihre Mutter stand bereits an der Tür, die Hände in die Hüften gestemmt.
»Nur noch dieser eine …« Danae packte einen besonders widerspenstigen Flachsfaden, klemmte ihn zwischen ihre Fingernägel und zog.
Ihre Mühen wurden durch den zufriedenen Seufzer belohnt, den ihr Vater ausstieß, als sich das Netz löste und in die gewünschte Form zurückfand.
»Vielen Dank, Tochter. Du hast so geschickte Hände. Und jetzt geh.«
Lächelnd wollte Danae sich ihrer Schwester anschließen, als sie bemerkte, wie sich ein Schatten über das wettergegerbte Gesicht ihres Vaters legte.
»Ist alles in Ordnung, Pa?«
Er winkte ab. »Es wird alles in Ordnung sein, solange ihr noch pünktlich kommt. Geht jetzt.« Sanft schob er sie Richtung Tür.
Nachdem sie die Mädchen auf den Hof hinausgescheucht hatte, blieb Danaes Mutter noch einmal stehen und drückte die Hand ihres Mannes.
»Sie werden ganz sicher nicht auserwählt, Odell«, flüsterte sie. »Die Ernte ist dieses Jahr zwar nicht besonders üppig ausgefallen, aber das bedeutet ja nicht, dass Demeter …« Mit einem tiefen Atemzug fuhr sie fort: »Und selbst wenn sie es verlangt: Alea ist jemandem versprochen und Danae … nun ja.« Ihr Blick huschte zu ihrer Jüngsten hinüber. »Normalerweise trifft es doch die stilleren Mädchen.«
Sanft küsste der Vater die Finger seiner Frau. Nun war er wieder ganz er selbst, ein Mann, von dem die Sorgen so mühelos abglitten wie Wassertropfen von geöltem Holz.
Mopsus und Pilops trotteten aus ihrem Unterstand an der Seite der Hütte herbei, um sich den Tumult genauer anzusehen. Danae löste sich vom Anblick ihrer Eltern und streichelte Mopsus’ Schnauze, als die Ziege den Kopf durch den Zaun ihres Geheges streckte.
Schnell ließ sie die Hand in die Tasche ihrer Chlaina gleiten und holte einen leicht zerdrückten Honigkuchen daraus hervor.
»Aber nicht petzen«, ermahnte sie die Ziege flüsternd, während das Tier auch noch die letzten Krumen von ihrer Handfläche leckte.
»Nun komm endlich, Danae!« Ihre Mutter marschierte an ihr vorbei durch das Tor und drängte Alea auf den staubigen Pfad hinaus.
Nachdem sie die Ziege noch einmal hinter den Ohren gekrault hatte, eilte Danae hinter den beiden her.
»Seid brav, schon eurer Mutter zuliebe«, rief der Vater ihnen hinterher. Seine drahtige Silhouette zeichnete sich deutlich vor dem dunklen Eingang der Hütte ab. »Und bringt unserem Dorf Segen!«
Danae wusste, dass damit vor allem sie gemeint war. Sie drehte sich noch einmal um und winkte ihm, dann schloss sie sich schnell der stetig wachsenden Menge von Frauen an, die über die Küstenstraße wanderten.
Im Westen überzog die untergehende Sonne das türkisblaue Wasser mit ihren goldenen Strahlen. Obwohl die Hitze des Tages noch immer andauerte, überlief Danae ein erwartungsvoller Schauer. Sie musterte Mutter und Schwester, die vor ihr gingen. Die beiden waren sich so ähnlich: hochgewachsen und grazil, die gleichen rotbraunen Locken, die gleichen Sommersprossen auf der gebräunten Haut. Danae hingegen hörte immer, sie sähe aus wie ihr Vater. Und auch wenn sie stolz darauf war, seine scharfen Gesichtszüge geerbt zu haben, war es bisher noch niemandem eingefallen, sie als Schönheit zu bezeichnen.
Die Menge wuchs, da sich ihr immer mehr Frauen anschlossen. Bald war die Luft ebenso vom Lied der Zikaden erfüllt wie von nervösem Geplapper. Dies war der eine Anlass, bei dem die Frauen von Naxos ohne ihre Männer unterwegs sein durften. Jedes Jahr kamen an diesem einen Abend die Frauen der Insel zusammen und pilgerten gemeinsam zum Tempel der Demeter, um dort die Thesmophorien zu feiern.
Es war lebenswichtig, die Erntegöttin in dieser geheiligten Nacht zu ehren. War Demeter mit ihren Opfergaben unzufrieden, würde die Ernte im nächsten Jahr schlecht ausfallen und es würde zu Totgeburten kommen.
Und schon in diesem Jahr waren Weizen und Gerste von Fäulnis befallen gewesen.
Offensichtlich war im Jahr zuvor also nicht genug geopfert worden, und falls die Göttin sich durch die heutigen Gaben nicht beschwichtigen ließ, bliebe nur noch eines, um ihren Zorn zu besänftigen.
Danae war bislang vier Mal Zeugin von Menschenopfern geworden und in jedem Jahr mit schlechter Ernte kreiste diese Drohung über den Häuptern der unverheirateten Mädchen wie ein Geier über Aas. Doch sie fürchtete sich nicht. Wie ihre Mutter bereits gesagt hatte, hielten die Priesterinnen stets das Blut der scheuesten Unverheirateten für würdig, um die Göttin zufriedenzustellen. Niemals wurde jemand auserwählt, der seine Mutter so zur Weißglut trieb, wie sie es tat.
Nun musterte sie die vielen Frauen in ihren bunten Gewändern. Während die Mütter ihre feinsten Kleider angelegt hatten, wanderten ihre jungfräulichen Töchter in weißen Gewändern hinter ihnen her wie Lämmer. Einige verbargen ihre Furcht sehr gut, während andere sich durch ihre zitternden Lippen verrieten.
Immer wieder fuhren Köpfe herum, wenn sie vorbeiging. Oft waren es nur subtile Blicke, manch eine starrte ihre Familie aber auch ganz offen an. Plötzlich nervös, zupfte Danae am bestickten Saum ihrer leicht angegrauten Chlaina herum. Als sie hochblickte, glaubte sie eine der Frauen beim Starren zu erwischen, doch deren Blick wanderte weiter und blieb an Alea hängen. Natürlich, niemand würde ihr einen zweiten Blick schenken.
Das Band, das ihr die Mutter um ihr straff gewickeltes Haar geschlungen hatte, juckte schrecklich. Vorsichtig schob Danae ihre Finger unter den festen Stoff, um sich zu kratzen.
Sofort bekam sie einen Klaps auf die Hand.
»Lass das.« Mit einem schweren Seufzer fügte ihre Mutter hinzu: »Es sieht sowieso schon aus wie ein Vogelnest.«
Danae sah zu ihrer Schwester hinüber und verdrehte die Augen.
Mit einem leisen Kichern flüsterte Alea: »Also, ich finde dein Haar wunderschön.«
Zwar wusste Danae, dass das nicht wahr sein konnte, aber sie war ihrer Schwester dankbar für den Versuch. Auf Aleas Kopf saß jede Locke perfekt. Sie trug ein herrliches grünes Stirnband, in das gelbe Getreideähren eingeflochten waren. Ihre Mutter hatte dieses Band am Tag ihrer Hochzeit getragen. Es war kein Wunder, dass die Leute sie anstarrten: Alea war schöner als die Erntegöttin selbst. Was Danae natürlich niemals laut aussprechen würde. Schließlich hörten die Götter alles.
»Eleni!«
Melia, die Frau des Schmieds, schob sich durch die Menge. Sie hatte zwei Töchter ganz in Weiß dabei, die ihr brav folgten. Die beiden Familien bahnten sich einen Weg zueinander, damit sie gemeinsam weiterwandern konnten.
Eleni und Melia setzten gleichzeitig zum heiligen Gruß an, doch die Frau des Schmiedes war ein wenig schneller.
»Mögen die Zwölf dich sehen und erkennen«, intonierte Melia hastig, dann lächelte sie zufrieden.
Natürlich musste Melia unbedingt die Erste sein, die mit ihren Worten die Götter in jeden Winkel ihres Lebens einlud. Danaes Mutter hob lächelnd den Mittelfinger an die Stirn, um den Gruß zu erwidern.
Dann blieb Melias Blick kurz an Alea hängen. »Sieht sie nicht wundervoll aus?« Sie trat dichter an Eleni heran, ohne jedoch ihre Stimme zu senken. »Du musst mir unbedingt sagen, wann mit der Hochzeit zu rechnen ist. Das wird das Fest des Jahres! Also, falls Odell es sich leisten kann.« Wohlwollend tätschelte sie Elenis Arm. »Aber um so etwas wirst du dir ja bald keine Gedanken mehr machen müssen. Der Sohn eines Kaufmannes, ich kann es immer noch nicht glauben.«
Krampfhaft biss sich Danae auf die Innenseite ihrer Wange. Es war ihr zuwider, zu den Klatschbasen des Dorfes auch noch freundlich sein zu müssen. Als sie sah, dass sich auf Aleas Wangen eine tiefe Röte ausgebreitet hatte, biss sie noch fester zu.
Aleas Verlobung war außergewöhnlich und vielen ein Dorn im Auge. Manch einer im Dorf war der Ansicht, dass Aleas Zukünftiger mit der Tochter eines Fischers zu weit unter seinem Stand heirate. Und es wurde sogar getuschelt, dass er sie kompromittiert habe und nun von ihrem Vater zu dieser Heirat gezwungen werde. Danae fand, dass diese Lästermäuler alle direkt in den Tartarus hinabfahren sollten.
»Wenn Alea erst verheiratet ist, wird es sicherlich auch leichter, jemanden für Danae zu finden. Will sie von den Fischerssöhnen denn wirklich keiner haben?«
Alea griff nach Danaes Hand, doch es war bereits zu spät.
»Sind deine Töchter denn bereits jemandem versprochen, Melia?«
Die Frau des Schmieds blinzelte irritiert, so als hätte sie bereits vergessen, dass Danae anwesend war. Ihre Lippen teilten sich, zögerten aber einen Moment, bevor sie sich zu einem »Nein« formten.
»Nun, dann solltest du deine Ratschläge vielleicht besser für dich behalten.«
»Verzeih bitte«, murmelte Eleni betreten, als Melias Gesicht sich röter färbte als der Sonnenuntergang. »Wir müssen … äh … wir sehen uns dann beim Fest!« Ohne Melia die Chance auf eine Erwiderung zu lassen, packte sie ihre Töchter und schleifte sie in das dichte Gedränge hinein.
»Danae«, seufzte die Mutter dann kraftlos.
»Es tut mir leid, aber die redet immer, als hätte sie einen der Schürhaken ihres Mannes im Arsch.«
Alea schnaubte belustigt.
Seufzend rügte ihre Mutter sie: »Du kannst nicht immer mit deinen Gedanken herausplatzen, wie es dir gefällt.«
Wieder einmal wanderte Danaes Blick zu ihrer Schwester, die ihr ein ermutigendes Lächeln schenkte. Alea war mit einem reichen Mann verlobt, in dessen Gesellschaft sie sich sogar recht wohlfühlte. Mehr konnte man sich als Frau nicht wünschen. Deshalb sollte sie sich eigentlich für ihre Schwester freuen. Und doch spürte sie einen nicht ganz unbekannten Druck auf der Brust, wann immer sie an Aleas bevorstehende Hochzeit dachte. Ja, es war egoistisch, aber in gewisser Weise fürchtete sie sich davor. Dann wäre sie das letzte Kind, das noch bei den Eltern blieb. Ihre Brüder Calix und Santos waren schon lange ausgezogen und bewohnten ihre eigenen Hütten, um ihre wachsende Kinderschar unterbringen zu können. Natürlich fehlten ihr die beiden, doch bei Alea fühlte es sich an, als würde sie einen Teil von sich selbst verlieren.
Mit ihren sechzehn Jahren war sie nur ein Jahr jünger als ihre Schwester und wusste deshalb, dass auch von ihr erwartet wurde, bald eine eigene Familie zu gründen. Eigentlich war ihr das schon bewusst geworden, als die Männer anfingen, ihr diese Blicke zuzuwerfen. Die Gier in ihren Augen jagte Danae einen Schauer über den Rücken. Doch der eigentliche Grund für ihre Scharfzüngigkeit gegenüber jedem Landarbeiter oder Fischer, der sich ihr näherte, war ein anderer: Sobald eine Frau verheiratet war, war sie unauflöslich an das Heim ihres Mannes gekettet. Und nachsichtige Männer wie ihr Vater waren eine Seltenheit.
In den Köpfen der übrigen Mädchen des Dorfes schien es kaum einen anderen Gedanken zu geben als den Wunsch nach einer guten Partie. Doch selbst ein reicher Ehemann konnte einem nicht die Freiheit erkaufen.
Als sich die Prozession von der Küste wegbewegte, flammte die Anspannung in Danae wieder auf. Nun konnte sie Demeters Tempel sehen. Von schützenden Hügeln umgeben, hoben sich die weißen Steinsäulen deutlich von den goldbraunen und grünen Farbnuancen des Umlandes ab. Irgendwie ließ sie das immer an die Knochen eines Leviathans denken, sauber abgenagt und glänzend, Jahrhunderte zuvor vom Meer angespült.
Die Menge drängte sich nun auf einer von hohen Zypressen gesäumten Straße zusammen. Die Sonne versank gerade hinter den Hügeln, sodass die Körper der Frauen lange Schatten warfen. Als sie schließlich den mit Blumen bestreuten Fußweg zum Tempel hinaufgingen, war es bereits dunkel. Feuerschalen säumten den Pfad, deren Rauch zusammen mit dem Blumenduft eine berauschende Mischung erzeugte.
Die üppige Blumenoase des Tempelgartens überlebte nur dank der sorgfältigen Pflege durch die Tempeldiener, die jeden Tag weit laufen mussten, um genügend Wasser herbeizuschleppen. Opulente Fuchsienblüten leuchteten zwischen leuchtend grünen, dicken Blättern; Beete voller gelber und oranger Blumen wurden von winzigen meerblauen Blüten eingerahmt. Selbst im Licht der Feuerschalen strahlten die Farben noch herrlich.
»Eleni, Danae, Alea! Hier drüben!« Danaes Schwägerin Kafi winkte sie herbei. Sie hatte ihnen ihren üblichen Platz freigehalten. Neben ihr wartete Calix’ Frau Carissa. Ihr hübsches Gesicht war gereizt verzogen, da Kafis dröhnende Rufe ihr einige missbilligende Blicke eintrugen.
Sie kämpften sich durch das Gedränge, bis sie die beiden Frauen erreichten. Kafi schenkte Danae ein breites Lächeln, bei dem ihre Zahnlücke sichtbar wurde, und drückte sie herzlich an sich. Danae mochte sie gern. Sie war laut und unverblümt und hatte sich laut eigener Aussage für Danaes Bruder Santos entschieden, weil der sie bei ihrer ersten Begegnung so zum Lachen gebracht hatte, dass ihr beinahe schlecht geworden war.
Als Kafi sie losließ, wandte sich Danae dem Tempel zu. Vor dem heiligen Bauwerk war ein Altar errichtet worden, auf dem Schalen mit reifen Feigen, knackigen Äpfeln und Granatäpfeln sowie Körbe voller Gemüse standen. An seinem Fuß stapelten sich dicke Getreidesäcke, Fässer voller Fisch, Amphoren mit Olivenöl und Bronzeschalen mit verdünntem Wein. Die Männer des Dorfes hatten diese Gaben am Morgen geliefert, zusätzlich zu dem monatlichen Zehnt, den jede Familie an den Tempel zahlte. Und sie alle gaben mehr, als sie übrig hatten.
Danaes Magen knurrte. Sie hatten seit dem Sonnenaufgang gefastet, um der Zeit zu gedenken, in der Demeter jede Nahrung verweigert hatte, als ihre Tochter Persephone von Hades, dem Gott der Unterwelt, gefangen gehalten worden war.
Während sie auf die Opfergaben starrte, bemerkte sie am Rand des Altars eine Bewegung. Die Luft schien an dieser Stelle zu wabern. Für den Bruchteil eines Augenblicks glaubte sie ein körperloses Paar roter Augen zu sehen. Dann blinzelte sie und der verstörende Anblick verschwand. Bestimmt hatten der Hunger und die berauschenden Düfte des Gartens dafür gesorgt, dass ihre Augen ihr einen Streich spielten.
Dumpfe Trommelschläge ließen die Menge verstummen.
»Jetzt geht es los«, flüsterte Alea.
Danae nahm die Hand ihrer Schwester.
Drei Frauen kamen aus dem Tempel und gingen gemessenen Schrittes auf den Altar zu. Die erste Priesterin trug eine grüne Robe und ein goldenes Stirnband, um ihre Arme waren Efeuranken geschlungen. Sie war Demeter. Die zweite war in leuchtendes Rot gekleidet, ihr Gesicht war hinter einer furchteinflößenden Maske mit gewundenen Hörnern verborgen. Sie war Hades. Die dritte trug ein dünnes weißes Kleid, das im Abendwind flatterte. Sie stellte Demeters Tochter Persephone dar. Hinter ihnen liefen vier Tempeldiener und schlugen dicke Trommeln, die sie sich mit Lederriemen um ihre Hälse gehängt hatten.
Als die Prozession den Altar erreichte, stellten sich die Priesterinnen in einer Reihe vor den Opfergaben auf und hoben die Arme. In ihre Handflächen war das allsehende Auge gemalt worden, das Symbol der Allmacht der olympischen Götter. Demeter war zwar die Schutzgöttin der Insel Naxos, trotzdem herrschten alle zwölf Götter über das Leben der Sterblichen.
Die Priesterinnen wandten sich nun der Menge zu und richteten das göttliche Auge auf die Frauen von Naxos.
Drückende Stille senkte sich über die Menge.
Danaes Mund war trocken. Dies war der Moment des Richtspruchs, in dem die Zwölf in ihre Seelen vordrangen und offenlegten, was sich darin verbarg. So wussten sie, ob jemand etwas zurückhielt, das eigentlich geopfert werden müsste.
Vor den Göttern konnte man nichts verbergen.
»Mögen die Zwölf euch sehen und erkennen«, intonierten die Priesterinnen.
Als Antwort drückten die Frauen in der Menge alle einen Finger an die Stirn.
Nun stieß die als Demeter gekleidete Priesterin einen langen hohen Ton aus. Ihre Schwestern schlossen sich ihr an, die drei Stimmen verschmolzen miteinander. Dann löste sich die Hades-Priesterin aus der Reihe und verschwand in den Schatten, während Demeter und Persephone sich an den Händen fassten und anfingen zu tanzen.
Danae grinste. Das Schauspiel war für sie der beste Teil der Zeremonie.
Die Priesterinnen wirbelten fröhlich herum, der Rhythmus der Trommeln lenkte ihre Schritte. Schneller und schneller drehten sie sich, schneller und schneller schlug Danaes Herz.
Plötzlich sprang Hades aus den Schatten hervor, packte Persephone am Arm und zog sie vom Altar fort. Obwohl sie es schon so oft gesehen hatte, keuchte Danae erschrocken. Der Trommelschlag verlangsamte sich und Demeter tat so, als würde sie die Reihen absuchen. Als sie ihre Tochter nicht fand, brach sie zusammen und verbarg den Kopf in den Armen. Dann tauchten Hades und Persephone wieder auf und stellten sich vor den Altar. Hades nahm einen Granatapfel aus einer Bronzeschale und zerdrückte ihn zwischen den Fingern. Der weinrote Saft lief der Priesterin über die Arme, während sie Persephone eine Hälfte der Frucht entgegenstreckte.
Die Menge rief ihr zu, sie bloß nicht zu nehmen. Jeder wusste doch, dass Persephone sich zu einer Ewigkeit an Hades’ Seite verdammen würde, wenn sie von den Früchten der Unterwelt kostete. Das Geschrei erreichte seinen Höhepunkt, als Persephone den Granatapfel nahm und zum Mund führte. Der rote Saft rann der Priesterin über das Kinn und befleckte ihr weißes Gewand.
Wieder ging ein aufgeregtes Keuchen durch das Publikum. Hinter den Trommlern war eine Standarte aufgetaucht. Die Musikanten traten beiseite und verneigten sich so tief, wie ihre Instrumente es erlaubten. Auf der langen Stange, die von einem schwitzenden Tempeldiener getragen wurde, prangte ein goldener Adler – das Symbol von Götterkönig Zeus. Stille breitete sich aus. Demeter lag einen Moment lang reglos vor dem goldenen Vogel, dann erhob sie sich mit tränennassen Wangen – diesen Teil fand Danae immer besonders beeindruckend –, um sich anschließend an die Seite ihrer Tochter zu stellen.
»Persephone aß sechs Granatapfelkerne«, verkündete die Demeter-Darstellerin. »Deshalb beschloss der Vater der Menschheit in seiner unendlichen Weisheit, dass sie sechs Monate des Jahres bei ihrer Mutter auf dem Olymp verweilen dürfe. Während dieser Zeit der Freude segnet Demeter die Erde mit Leben und Wohlstand. Doch während der restlichen sechs Monate muss Persephone bei Hades in der Unterwelt leben. In diesen schrecklichen Monaten wird die Erde kalt und verdorrt durch Demeters Trauer.«
Die Zuschauerinnen senkten die Köpfe, um dem Leid der Erntegöttin Tribut zu zollen.
»Heute Nacht, ihr Frauen von Naxos, preisen wir die Göttin, die dieses fruchtbare Land segnet. Wir preisen die Göttin, die Pest und Schaden von unserer Ernte fernhält. Wir preisen die Göttin, die für uns sorgt, damit wir aufblühen und unsere Kinder gedeihen können. Demeter, wir bitten dich, auch weiterhin über alle zu wachen, die sich heute hier versammelt haben, über unsere Familien daheim und über jene, die zu Verschollenen wurden. Wir beten dafür, dass sie eines Tages zu uns zurückkehren.«
Die Verschollenen waren jene Menschen, die einfach verschwanden. Das geschah schon immer, so weit die Menschen hier zurückdenken konnten. Hin und wieder war jemand plötzlich nicht mehr da. Auf Naxos waren es durchschnittlich fünf Menschen pro Jahr, auf dem Festland deutlich mehr. Nicht einmal die Priesterinnen hatten eine Erklärung dafür. Und obwohl sie Demeter Jahr für Jahr anflehten, die Vermissten zurückzubringen, war bisher noch niemand je wieder aufgetaucht.
»Demeter, bitte wache über uns«, murmelte die Menge.
Zwei Tempeldiener traten vor und führten ein fettes Schwein zum Altar. Diesen Teil mochte Danae überhaupt nicht. Langsam und schleppend setzten die Trommeln wieder ein.
Die Priesterinnen strichen dem Tier über den Rücken und gaben beruhigende Laute von sich, während sie es direkt vor dem Altar festhielten. Ein Tempeldiener erschien, sank auf ein Knie und präsentierte eine lange silberne Klinge. Die Demeter-Priesterin packte den Griff des Messers und hob es hoch über ihren Kopf.
Ein Mondstrahl traf auf das Metall und ließ es aufleuchten. Nun erreichte der Trommelschlag seinen Höhepunkt, das Schwein stieß einen schrillen Schrei aus. Blut spritzte auf die Gewänder der Priesterin. Sie schlitzte dem Tier den Bauch auf, griff hinein und holte die Innereien heraus. Im Licht des Mondes ließ sie die glitschigen Gedärme durch ihre Finger gleiten und untersuchte sie sorgfältig, Stück für Stück.
Atemlose Stille hatte die Menge erfasst.
Schließlich ließ die Priesterin die Innereien in eine Schale fallen und wandte sich wieder den Frauen von Naxos zu.
»Die Zeichen haben sich offenbart. Demeter sieht alles, hört alles, weiß alles. Sie hat in eure Herzen geblickt, und was sie dort sah, hat sie nicht glücklich gemacht.«
Alle schnappten nach Luft. Jemand rief: »Aber wir haben alles gegeben, was wir haben!«
»Eure Opfergaben sind nicht ausreichend«, fuhr die Priesterin fort. »Eine unter euch hat Demeter nicht alles gegeben, was ihr zusteht. Eine unter euch dachte, sie könne die Göttin hintergehen.«
Einige der jüngeren Mädchen fingen an zu weinen. Danaes Finger krampften sich um die Hand ihrer Schwester; ihre Mutter hatte ihnen so fest den Arm um die Schultern geschlungen, dass sich ihre Nägel in Danaes Haut bohrten.
Die Priesterin hob ihre bemalte Hand und ließ das göttliche Auge über die Menge gleiten, während sie mit der anderen Hand eine blutige Linie auf ihre Stirn zeichnete. Danaes Rippen drohten ihre Lunge zu zerquetschen, als das Auge näher und näher kam. Dann verharrte es.
Die Priesterin hatte ihre Wahl getroffen und zeigte sie mit ausgestrecktem Finger an.
»Nein!«
Melia hielt ängstlich ihre Töchter umschlungen, als die Priesterin die jüngere der beiden fixierte.
Die Tempeldiener schoben sich durch die Menge, doch die nun wild schluchzende Frau des Schmieds weigerte sich, ihre Tochter loszulassen.
Ein schriller Schrei zerriss die dumpfe Stille. Danae fuhr herum, sah aber nichts außer den Gesichtern ringsum, die ihre eigene Verwirrung widerspiegelten.
Wie aus dem Nichts tauchten sie auf, schoben sich durch die Büsche und sprangen hinter den Bäumen hervor. Ihre Haare waren verfilzt, Zweige und Farnblätter hatten sich darin verfangen. Mindestens zwanzig Frauen waren es, alle vollkommen nackt – die Mänaden, Anhängerinnen des Dionysos. Für den Gott des Weines und der Vergnügungen hatten diese Frauen ihre Familien verlassen und lebten nun in der Wildnis des Waldes. Gerüchten zufolge überließen sie ihren Geist zur Gänze ihrem Gott, ergötzten sich an seinem Wein, bis sie in eine ekstatische Trance verfielen und wilde Tänze vollführten, um seinem wollüstigen Willen zu gehorchen. Angeblich hatten sie bei einem dieser Rituale sogar mit bloßen Händen einen Säugling in Stücke gerissen.
Wie Wölfe unter Schafen zerteilten die Mänaden nun die Menschenmenge, ihr Gelächter hallte laut durch den Tempelgarten. Statuen wurden umgeworfen, Blumenbeete zertrampelt, zwei Mänaden sprangen sogar auf den Altar und stopften sich Opfergaben in den Mund. Allerdings konnten sie nur eine Handvoll davon genießen, bevor die Tempeldiener sie wieder herunterzerrten. Trotzdem, der Schaden war getan. Demeter würde außer sich sein vor Zorn.
Eleni packte ihre Töchter an den Händen.
»Bloß nicht loslassen, Mädchen.«
Damit zog sie die beiden in Richtung des Fußweges, doch inzwischen war die Menge endgültig in Panik geraten, sodass sie von den verängstigten Frauen, die sich bei ihren Fluchtversuchen gegenseitig umrannten, heillos herumgeschubst wurden.
Auch Melia stürmte mit ihren beiden Töchtern heran, offenbar war es ihr gelungen, den Tempeldienern ihre Jüngste wieder zu entreißen. Sie prallte mit einer solchen Wucht gegen Danae, dass diese das Gleichgewicht verlor und stürzte. Unzählige Füße trampelten über sie hinweg. Sie versuchte verzweifelt, sich Mutter und Schwester wieder anzuschließen, kam aber nicht einmal auf die Beine. Ängstlich schlang sie die Arme um den Kopf und rollte sich schützend zusammen. Plötzlich wurde sie gepackt und aus der erdrückenden Menge herausgezogen. Kräftige Hände halfen ihr hoch und vollkommen unvermittelt blickte sie in das Gesicht einer Mänade.
In atemloser Anspannung wartete sie auf den Schlag, der nun folgen musste.
Doch die Mänade musterte sie besorgt. »Bist du verletzt?«
Danae wollte antworten, war aber so verblüfft, dass ihr kein Wort über die Lippen kam. Stumm schüttelte sie den Kopf.
»Gut.« Ein breites Grinsen huschte über das Gesicht der Frau, die ihr noch einmal kräftig auf die Schulter klopfte und dann im Gebüsch verschwand.
»Danae!« Ihre Mutter drängte sich durch die flüchtende Menge. »Den Göttern sei Dank, ich dachte schon, ich hätte dich verloren.« Erleichtert drückte sie ihre Tochter an sich. »Wo ist deine Schwester?«
»Ich dachte, sie ist bei dir?«
Ihre Mutter wurde blass. Wie ein Schraubstock schlossen sich ihre Finger um Danaes Handgelenk, als sie sich wieder der Menge zuwandte.
»Alea!«
Danaes Herz raste. Auch sie rief nach ihrer Schwester, musterte prüfend die vorbeihastenden Frauen, doch Alea war nirgendwo zu sehen.
Sie suchten den Garten ab, bis sie sich heiser geschrien hatten und außer ihnen nur noch die Tempeldiener geblieben waren, die das hinterlassene Chaos beseitigen mussten.
»Hast du meine Tochter gesehen? Weißes Kleid, grünes Band im Haar, sieht aus wie ich«, krächzte Eleni zum hundertsten Mal.
Der Mann schüttelte stumm den Kopf und fegte weiter Tonscherben zusammen.
Danae drehte sich zu ihrer Mutter um. »Was sollen wir jetzt tun?«
Eleni, die sonst auf alles eine Antwort hatte, sagte: »Ich weiß es nicht.«
2
ZWEI TÖCHTER
Als Danae und ihre Mutter nach Hause kamen und ihrem Vater erzählten, dass Alea verschwunden war, ging Odell sofort los, holte ihre Brüder und suchte die Insel nach seiner Tochter ab.
Die Berichte über die Geschehnisse bei den Thesmophorien verbreiteten sich wie ein Lauffeuer in den umliegenden Dörfern. Man verbarrikadierte sich in den Hütten und malte das allsehende Auge der Zwölf auf die Türstöcke. Allerdings hatten die Inselbewohner und -bewohnerinnen kaum Möglichkeiten, um die Mänaden für ihre Tat zu bestrafen. Zwar hatte es auch in der Vergangenheit immer wieder Versuche gegeben, ihr Lager aufzuspüren, doch die Männer waren stets blutend und zerschlagen zurückgekehrt und hatten verlegen behauptet, Dionysos beschütze seine Herde mit aller Macht. Deshalb mussten die Bewohner von Naxos diese Bestrafung den Göttern überlassen.
Bis zum Mittag des folgenden Tages erreichte die Nachricht von Aleas Verschwinden auch ihren Verlobten.
Philemon war ein dünner Mann Anfang zwanzig mit milchweißer Haut, blondem Haar und traurigen Augen. Irgendwie erinnerte er Danae immer an einen Weizenhalm. Sie half ihrer Mutter gerade dabei, den Unterstand der Ziegen auszubessern, als Philemon sich zusammen mit seinem Vater ihrer Hütte näherte. Thaddeus war das komplette Gegenteil seines Sohnes. Heute trug der massige, ungestüme Mann einen rotbraunen Chiton, der sein stets gerötetes Gesicht unvorteilhaft betonte. Schwungvoll stieß er das Tor zum Hof auf, während Philemon sich beinahe verschämt hinter ihm herumdrückte.
»Odell!«, bellte Thaddeus und wischte sich mit der fleischigen Hand den Schweiß von der Stirn.
Schnell ging Eleni zu ihm hinüber, um ihn zu begrüßen.
»Thaddeus.« Sie neigte ehrerbietig den Kopf und murmelte den heiligen Gruß.
Nach einer knappen Erwiderung stapfte Thaddeus weiter und streckte ungefragt den Kopf in die Hütte.
»Ist es wahr? Ist die Zukünftige meines Sohnes tatsächlich mit den Mänaden abgehauen?«
»Wie kannst du es wagen …«, protestierte Danae, doch ihre Mutter fiel ihr ins Wort.
»Meine Tochter war vollkommen verängstigt, als diese Frauen das Fest überfielen. Niemals wäre sie mit ihnen davongelaufen. Alea ist in dem Tumult verloren gegangen, aber Odell kümmert sich bereits darum. Es gibt also keinen Grund zur Sorge, sie wird bald wieder zu Hause sein.«
Das schien Thaddeus nicht zu überzeugen. »Tja, wenn sie sich nicht diesen Huren angeschlossen hat, wird sie wohl bei den Verschollenen gelandet sein.« Kopfschüttelnd wandte er sich an seinen Sohn. »Sie war deine Wahl.«
Stumm starrte Philemon auf seine Füße.
Danae bohrte sich die Nägel in die Handflächen. »Alea hat sich weder den Mänaden noch den Verschollenen angeschlossen. Pa und meine Brüder suchen bereits nach ihr. Und sie werden sie finden.«
Thaddeus sah zu Eleni hinüber, als wäre dieser Einwand von ihr gekommen.
»Falls sie das Mädchen wie durch ein Wunder tatsächlich finden …« Er legte eine vielsagende Pause ein. »Dann sollte sie besser unberührt sein.«
Seine Worte trafen Danae wie ein Schlag. Welch eine Schande. Im Geiste griff sie nach einem Fischspeer ihres Vaters und rammte ihn in Thaddeus’ feistes Gesicht.
»Selbstverständlich wird sie unberührt sein.« Es gelang ihrer Mutter erstaunlich gut, sich ihren Zorn nicht anmerken zu lassen. Lediglich die pochende Ader an Elenis Hals verriet, dass sie ebenso wütend war wie Danae.
»Vater.« Ohne den Blick vom Boden zu lösen, trat Philemon einen Schritt vor. »Ich möchte bei der Suche helfen.«
»Pure Zeitverschwendung.«
Nun wagte der junge Mann einen kurzen Blick in das Gesicht seines Vaters. »Bitte.«
Seufzend rieb sich Thaddeus über die Stirn. »Wo haben sie denn bislang gesucht?«
»In den Feldern rund um den Tempel und in unserem Dorf. Heute Morgen sind sie dann weitergezogen nach Sangri.«
Thaddeus nickte. »Wir werden mein Schiff auf die andere Seite der Insel verlegen und uns dort umhören. Vielleicht weiß jemand etwas.«
»Vielen Dank.« Elenis Hände zuckten.
Thaddeus antwortete mit einem abfälligen Brummen, das Danaes Zorn noch weiter anstachelte. Wenn die beiden nicht bald gingen, würde sie vielleicht noch etwas sagen, das sie später bereute.
»Wir werden sie finden«, versicherte Eleni an Philemon gewandt. »Und ehe ihr euch verseht, seid ihr beide verheiratet.« Trotz der zur Schau gestellten Tapferkeit spürte Danae, dass Eleni sich damit vor allem selbst Mut machen wollte.
Der junge Mann bedankte sich mit einem schwachen Lächeln.
»Los jetzt, Sohn, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns.« Thaddeus legte Philemon die Hand auf die Schulter und schob ihn vom Hof.
Stumm sah Danae zu, wie die beiden sich entfernten.
»Was für ein Mistkerl.«
»Wir müssen den Göttern dafür danken, dass der Sohn so ganz anders ist als der Vater«, murmelte Eleni. »Aber seine arme Mutter tut mir leid.«
Danae musterte die roten Halbmonde, die ihre Fingernägel auf ihren Handflächen hinterlassen hatten.
»Ma, was ist, wenn Thaddeus recht hat?«, fragte sie zögernd. »Glaubst du auch, dass Alea bei den Verschollenen ist?«
»Nun hör mir mal gut zu«, befahl ihre Mutter mit der Schärfe einer frisch geschmiedeten Klinge. »Dein Vater wird sie finden. Wir müssen uns nur in Geduld üben.«
Eleni warf ihr einen so stechenden Blick zu, dass Danae automatisch nickte. Sie konnten nichts anderes tun als abzuwarten.
Die blaue Stunde war angebrochen, jene stille Zeit zwischen Nacht und Tag, wenn der Mond verblasst und die Sonne sich noch nicht zeigt, sodass der Himmel vorübergehend ohne Herrscher ist.
Danae lief zum Strand hinunter, in der Hand einen leeren Eimer. Normalerweise ließ man sie nicht allein von der Hütte fortgehen, aber sie konnte nicht schlafen, und ihre Mutter war es irgendwann leid gewesen, dass sie rastlos auf und ab lief, also hatte sie ihr aufgetragen, »etwas Nützliches zu tun«. Was in diesem Fall hieß, dass sie Salz für den Käse sammeln sollte, den sie aus Mopsus’ Milch machen wollten. Danae war froh darüber. Hätte sie noch länger tatenlos in der Hütte sitzen und warten müssen, wäre sie verrückt geworden.
Als der staubige Pfad in weißen Sand überging, verlangsamte sie ihre Schritte. Das Gefühl der feinen Körner zwischen den Zehen war tröstlich. An diesem Strand war sie groß geworden. In diesen Wellen hatte sie schwimmen gelernt und ihren ersten Fisch gefangen. Dies war ihr wahres Zuhause.
Schwungvoll rannte sie los, so schnell, dass der Eimer gegen ihre Beine schlug. Viel Zeit in Freiheit blieb ihr nicht, und sie wollte jeden Moment auskosten, den sie ohne die wachsamen Blicke ihrer Mutter war. Bald schon erreichte sie die Felsen und begann zu klettern. Mit dem Eimer über der Schulter folgte sie der vertrauten Route, stieg über die Becken hinweg, in denen sie als Kind geplanscht hatte, immer weiter die flache Klippe hinauf. Oben angekommen, stapfte sie über den rissigen Felsen, bis sie die versteckte kleine Bucht unter sich sah.
Klappernd landete der Eimer auf dem Boden, während Danae bereits aus ihrer Kleidung schlüpfte und die Sandalen abstreifte. Ein erwartungsvoller Schauer packte sie, als sie sprang. Wie ein Pfeil schoss sie hinab und tauchte in die See ein; das kühlende Wasser glitt entspannend über ihre von der Sonne gebräunten Glieder. Genau das brauchte sie jetzt. Natürlich wollte sie zu Hause sein, wenn Neuigkeiten über ihre Schwester eintrafen, aber das Meer war der beste Balsam für ihren aufgewühlten Geist. Außerdem würde sie nicht lange bleiben.
Danae tauchte kurz auf, schnappte nach Luft und ließ sich dann wieder in die Tiefe sinken.
Diese Bucht barg ein Geheimnis. Und sie stellte sich gerne vor, dass es allein ihr gehörte.
Sie öffnete die Augen. Das Salzwasser brannte, doch daran war sie gewöhnt. Langsam schälten sich die Ruinen aus dem verschwommenen Nebel. Sie hielt darauf zu, schwamm an Seetangschwaden vorbei zu den längst vergessenen Steinhaufen.
Früher einmal musste das ein sehr besonderer Ort gewesen sein. Ein Großteil der Steine war von den Gezeiten glatt geschliffen worden, doch auf einigen waren noch Zeichen zu erkennen. Danae folgte der runden Struktur, bis sie ihre Lieblingsstelle erreichte. Die verwitterte Säule war beinahe so groß wie sie und ragte wie ein einsamer Zahn aus dem Meeresboden auf. Ein Baum war in den Stein eingemeißelt, die Zweige behangen mit Früchten, deren Umrisse das Meer beinahe vollständig ausgelöscht hatte. Ehrfürchtig streckte sie die Hand aus und ließ sie über den gezeichneten Stamm gleiten.
Irgendetwas an diesem Bildnis faszinierte sie. Vielleicht waren diese Steine einmal Teil eines Tempels gewesen. Wahrscheinlich ein Bauwerk, mit dem der Meeresgott Poseidon geehrt werden sollte.
Mit aller Kraft drückte Danae ihre Hand auf das Bild.
Bitte wache über meine Schwester, mächtiger Poseidon. Hilf meinem Vater und meinen Brüdern, sie nach Hause zu bringen.
Ihre Lunge begann zu brennen. Widerwillig verließ sie die Ruinen und schwamm Richtung Oberfläche. Oben angekommen, sog sie in tiefen Zügen die kühle, salzige Luft ein. Dann ließ sie sich auf dem Rücken treiben und blickte zum immer heller werdenden Himmel hinauf. An ihren Wimpern hingen feine Wassertröpfchen.
Früher hatte ihr Vater sie oft seine kleine Nereide genannt, seine Meeresnymphe. Schon als Baby hatte sie das Wasser geliebt. Als Kind dann war sie oft den pfeilschnellen roten Thunfischen nachgejagt und hatte sich gewünscht, ebenfalls so kraftvolle Flossen zu haben.
Im Wasser war alles einfacher. Das Meer konnte ein gefährliches Untier sein, doch es hatte sie stets sicher getragen und niemals im Stich gelassen.
Auch auf dem Rückweg hetzte Danae so eilig über den Strand, dass der Inhalt ihres Eimers beinahe überschwappte. Ihre Sandalen klapperten, als sie festen Boden erreichte. Die erste Morgenröte war bereits verflogen – sie hatte sich zu lange aufgehalten.
Auf dem Pfad, der zu ihrer Hütte führte, prallte sie beinahe mit Carissa zusammen, die ihr entgegenkam.
Sofort beschleunigte sich ihr Herzschlag. »Gibt es Neuigkeiten?«
Stumm schüttelte Carissa den Kopf und verzog dann mahnend die Lippen, als sie Danaes nasses Haar und die sandverklebten Beine bemerkte. Ohne ein Wort zu sagen, setzte sie ihren Weg fort.
Mit bleischweren Gliedern schleppte sich Danae weiter und betrat ihren Hof.
Ihre Mutter saß im Ziegengehege und war gerade dabei, Mopsus zu melken.
»War Carissa wegen Alea hier?«
Eleni schüttelte den Kopf. Ihr Gesicht war ungewöhnlich blass. »Es ging um Melias Töchter. Die Tempeldiener haben sie aus dem Haus des Schmieds geholt und noch vor Sonnenaufgang geopfert.«
Vor Schreck hätte Danae beinahe ihren Eimer fallen gelassen. Durch den chaotischen Überfall der Mänaden und Aleas Verschwinden hatte sie ganz vergessen, dass Demeter bei den Thesmophorien ein Blutopfer gefordert hatte.
»Beide?«
Mit zitternden Händen strich ihre Mutter eine Haarsträhne zurück, die sich aus ihrem Kopftuch befreit hatte.
»Demeter verlangte in ihrer Weisheit ein zusätzliches Leben als Entschädigung für die Entweihung ihres Festtages.«
Da ihre Knie ihr Gewicht nicht mehr tragen wollten, stellte Danae den Eimer ab und lehnte sich gegen den Zaun.
»Die Göttin hat zwei Töchter aus derselben Familie ausgewählt?«
Mahnend hob Eleni die Hand. »Es steht uns nicht zu, den Willen der Götter zu hinterfragen.«
»Nein, natürlich nicht«, stimmte Danae leise zu.
Mit einem kraftlosen Seufzer fuhr Eleni fort: »Bei den Göttern, Melia liegt mir wahrlich nicht am Herzen, aber das wünsche ich niemandem …« Sie fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. »Im Asphodeliengrund werden sie wieder vereint werden. So wie wir alle eines Tages.«
Die Unterwelt teilte sich in drei Ebenen, die alle der Herrschaft des Gottes Hades unterstanden: Der Asphodeliengrund nahm alle frommen Seelen auf, die ein rechtschaffenes Leben geführt hatten. Danaes Großeltern und ihr Onkel Taron waren bereits dort. In diesem herrlichen Land mit seinen sonnigen Feldern und sanften Hügeln wuchsen prachtvolle Blumen, deren Blüten niemals welkten. Dort herrschten Friede und Glückseligkeit, ewiger Frühling ohne einen einzigen Wintertag.
In das paradiesische Eylsium wurden Seelen geschickt, denen Unsterblichkeit verliehen wurde, bevor sie in den Himmel aufsteigen durften. Es war großen Kriegern und Helden vorbehalten, die in der Schlacht ihr Leben ließen. Danae fand es allerdings traurig, dass diese tapferen Männer die Ewigkeit nicht im Kreise ihrer Liebsten verbringen durften. Denn egal wie prachtvoll er auch sein mochte – ohne ihre Familie käme ihr der Himmel sicher trostlos und leer vor.
Das letzte Totenreich war der Tartarus, ein Ort unendlicher Qualen und Pein, an dem jene Seelen litten, deren Lebensführung für unwürdig befunden wurde. Und in den dunkelsten Tiefen der Unterwelt waren die Titanen eingekerkert; bösartige Riesen, die versucht hatten, die Welt zu zerstören, bis die Zwölf sie in den jahrelangen Kämpfen der Titanomachie in die Knie zwangen. Danae hatte den sicheren Boden unter ihren Füßen den tapferen Göttern des Olymps zu verdanken. Wie alle Sterblichen.
Elenis Hände zuckten nervös in ihrem Schoß. Ein kleiner Blutstropfen landete auf ihrem Rock, als sie sich geistesabwesend ein Stück der Nagelhaut abriss. Sie schien es gar nicht zu bemerken.
»Ma?«, fragte Danae.
Ihre Mutter blinzelte. »Komm jetzt.« Mit einem Ruck stand sie auf und trug den Milcheimer zur Hütte hinüber. »Der Käse macht sich nicht von allein.«
Danae blickte ihr einen Moment lang hinterher, bevor sie ihr nach drinnen folgte.
Ihre Mutter schüttete die Milch in einen eisernen Kessel, der bereits über dem Feuer hing. »Früher hat sie mehr Milch gegeben. Das arme Mädchen wird langsam alt.«
Heißer Dampf schlug Danae ins Gesicht, als sie das Salz zugab und nach dem kleinen Tonkrug griff, der neben dem Herd stand. Sie gab einen Schuss Essig in die Milch.
Gerade als Eleni den hölzernen Kochlöffel in den Kessel tauchte, knarrte draußen das Hoftor. Mit einem Satz schob sich Danae durch die Tür und rannte auf den Hof hinaus.
Ihr Vater hetzte auf sie zu; er sah aus, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. Hinter ihm gingen ihre Brüder. Alea hing schlaff in ihren Armen, die rotbraunen Locken schleiften im Staub.
Danae wollte zu ihren Brüdern laufen, doch ihr Vater hielt sie zurück.
»Lebt sie noch?«
»Ja, sie lebt.« Noch immer hielt ihr Vater sie am Arm fest. »Aber wir müssen sie sofort in die Hütte bringen.«
»Alea!« Eleni lief zu ihren Söhnen und schob sie durch die Tür in die Hütte. Dabei stützte sie sanft Aleas kraftlos herabhängenden Kopf. Vorsichtig legten die Brüder sie auf das Strohlager, das Danae sich mit ihr teilte. Aleas Gesicht war reglos und fahl wie Marmor.
Eleni hob ihre Lider an. Keine Reaktion.
»Wo war sie?«, verlangte sie zu wissen.
Müde sank der Vater auf einen Stuhl. »Eine Priesterin hat sie heute Morgen gefunden, sie lag zu Füßen der Demeterstatue.«
Erschrocken schnappte Eleni nach Luft. Dann kniete sie sich auf das Lager und umfasste Aleas Hand. »Die Göttin hat sie uns zurückgebracht. Das Opfer hat sie zufriedengestellt, und sie hat uns unsere Alea zurückgegeben.«
Danae wusste nicht, was sie empfinden sollte. »Wann wacht sie wieder auf?«
Kopfschüttelnd antwortete ihr Vater: »Das weiß ich nicht, Danie.«
Ihr fiel auf, wie ihre Brüder sich ansahen. Ein ungutes Gefühl machte sich in ihr breit, also starrte sie Santos so lange an, bis er ihren Blick erwiderte. Mit einem kurzen Nicken gab sie ihm zu verstehen, dass er ihr nach draußen folgen solle. Es dauerte einen Moment, doch dann trat er zu ihr vor die Tür.
»Was verschweigen sie mir?«
Verlegen trat er von einem Fuß auf den anderen.
»Santos.«
»Pa hat uns verboten, es dir zu sagen.«
Wütend boxte Danae gegen seinen Arm. »Sag es mir. Ich bin ihre Schwester, ich habe ein Recht, es zu wissen.«
»Na schön.« Gereizt rieb sich Santos den Oberarm und sah kurz zur Hütte hinüber. »Alea wurde unter Drogen gesetzt.«
Verwirrt runzelte Danae die Stirn. »Warum sollte …?« Als sie den Zorn und die Trauer im Blick ihres Bruders sah, zerfielen die restlichen Worte auf ihrer Zunge zu Staub.
Nun kam auch Odell aus der Hütte. Er sah aus, als wäre er in den letzten drei Tagen um Jahrzehnte gealtert. Hinter ihm tauchte Calix auf. »Deine Mutter möchte mit deiner Schwester allein sein.«
Doch bevor er sie packen konnte, schoss Danae bereits an ihm vorbei.
Als sie die Hütte betrat, hockte Eleni zwischen den gespreizten Beinen ihrer Schwester und untersuchte sie. Dann hob sie den Kopf. Die Verzweiflung in ihren Augen legte sich wie ein schwerer Felsbrocken auf Danaes Brust und drohte ihr die Luft abzuschnüren.
Am nächsten Tag waren sie alle von dem Drang erfüllt, sich zu beschäftigen. Calix und Santos waren zu ihren Familien zurückgekehrt und ihr Vater war vor Sonnenaufgang aufgestanden und zum Fischen hinausgefahren, sodass Danae und ihre Mutter mit der noch immer schlafenden Alea allein in der Hütte zurückblieben.
Eleni hielt an Aleas Seite Wache und wischte ihr immer wieder mit einem feuchten Tuch über die Stirn. Danae drückte sich hinter ihr in der Hütte herum.
Schließlich stieß ihre Mutter einen scharfen Seufzer aus. »Mach dich nützlich! Geh zum Fluss und hol mir etwas Bergtee. Vielleicht hilft das Kraut dabei, ihre Lebensgeister zu wecken. Und denke daran: Es sind die Pflanzen mit den kleinen gelben Blüten.«
Froh, helfen zu können, holte sich Danae einen Leinensack vom Haken an der Tür. Doch bevor sie auf den Hof hinaustreten konnte, schrie ihre Mutter plötzlich auf. Als sie herumfuhr, sah sie, wie Eleni sich über das Strohlager beugte und Alea in die Arme schloss.
Ihre Schwester war aufgewacht.
Sofort stürmte Danae los und warf sich auf die beiden. So lagen sie ineinander verschlungen, bis Alea irgendwann keuchte: »Ich kann nicht atmen.«
»Bring ihr Wasser, Danae«, rief die Mutter.
Hastig ging Danae zu der Hydria neben der Feuerstelle und gab etwas Wasser aus dem großen Krug in eine Schale. Dann eilte sie zurück zu Alea. Ihre Mutter nahm ihr die Wasserschale ab und führte sie an die Lippen ihrer Schwester. Zunächst verschluckte sich Alea, dann aber setzte sie sich auf, griff nach der Schale und trank mit großen Schlucken. Als sie sich den Mund abwischte, erschien eine tiefe Falte zwischen ihren Brauen.
»Wie fühlst du dich?«, wollte Eleni wissen, während sie ihr die Schale abnahm.
»Als wäre eine ganze Viehherde durch meinen Kopf getrampelt.« Stirnrunzelnd musterte sie ihr zerknittertes Kleid. »Waren wir nicht gerade noch beim Fest?«
»Du warst tagelang verschwunden, Alea«, klärte Danae sie auf.
Das verwirrte ihre Schwester nur noch mehr.
»Aber … wir waren doch bei den Thesmophorien. Wir haben uns das Stück angesehen, dann wurde das Schwein geopfert, und dann …« Sie schnappte nach Luft.
»Woran erinnerst du dich zuletzt?«, unterbrach die Mutter sie. »Hast du einen Mann gesehen?«
Alea schüttelte den Kopf. Tränen stiegen ihr in die Augen.
Sanft strich die Mutter ihr über das Haar. »Nun gut, das genügt erst einmal.« An Danae gewandt befahl sie: »Geh ins Dorf und hol uns bei Myron ein Huhn, damit wir feiern können.« Sie stand bereits wieder und wirbelte durch die Hütte. »Calix und Santos sollen auch zum Essen kommen. Die ganze Familie. Hier.« Drängend schob sie Danae zur Tür und drückte ihr den vergessenen Leinensack in die eine Hand, eine Münze in die andere.
»Aber …«
»Na los! Sonst hat er vielleicht keins mehr.«
Mit einem letzten Blick zu Alea verließ Danae die Hütte.
Mit klatschenden Sandalen rannte sie den Küstenweg zum Dorf entlang, stets begleitet vom türkisblauen Meer.
Am Dorfrand hastete sie an dem kleinen Dionysosschrein vorbei und hielt erst an, als sie die bunt zusammengewürfelten Marktstände auf dem Dorfplatz erreichte. Nachdem sie kurz durchgeatmet hatte, ging sie zur Hütte des Metzgers.
Ihr Drang, möglichst schnell wieder an Aleas Seite zu sein, wurde von einer Fischersfrau aus der benachbarten Bucht ausgebremst. Die dürre Ceto mit der fahlen Haut und dem stechenden Blick stellte sich ihr mitten in den Weg. Nachdem sie hastig den heiligen Gruß heruntergerattert hatte, fragte sie: »Ist es wahr? Haben sie deine Schwester gefunden?«
»Ja, sie ist wieder zu Hause.«
»Der Gnade der Götter sei gedankt.« Ceto drückte die Hände an die Brust. »Hat sie erzählt, was ihr passiert ist?«
»Ich muss jetzt wirklich weiter …«
Aber Ceto wollte sie nicht gehen lassen. Frustriert biss sich Danae auf die Lippe, wich schließlich nach rechts aus und rannte weiter Richtung Metzger.
»Wir sind alle so froh, dass sie wieder da ist!«, rief Ceto ihr hinterher. »Auch wenn die Zeit noch zeigen wird, ob das ein Segen oder ein Fluch ist!«
Diese Worte brachten Danae so aus dem Konzept, dass sie mit finsterer Miene unter das ausgebleichte Sonnensegel des Metzgerstands trat. Myron, gebaut und gebräunt wie eine mächtige Eiche, zerteilte gerade den Körper einer Ziege. Während sie an Fischgeruch gewöhnt war, empfand Danae den metallischen Blutgeruch in Myrons Domäne immer als unangenehm. Der Metzger blickte hoch und wischte sich mit der blutverschmierten Hand den Schweiß von der Stirn.
»Die Zwölf sehen und erkennen dich«, grüßte Danae atemlos.
Myron drückte einen blutigen Finger an die Stirn. »Mit einer solchen Leichenbittermiene solltest du aber nicht herumlaufen. Sonst dreht sich der Wind und du siehst am Ende so aus wie ich.«
»Ich bin gerade Ceto begegnet«, berichtete Danae.
»Ah. Mehr brauchst du nicht zu sagen.«
»Ich bräuchte ein Huhn, falls du noch eines hast?«
Mit einem Nicken rammte Myron sein Beil in den Hackblock, ging in die Hütte und nach hinten hinaus auf den Hof. Wenig später hörte Danae ein schrilles Gackern und panische Flügelschläge, gefolgt von einem lauten Knacken.
Als Myron wieder auftauchte, trug er ein schlaffes Hühnchen in der Hand. Danae öffnete ihren Sack, damit er das Tier hineinlegen konnte, und streckte ihm dann ihre kleine Kupfermünze entgegen.
Leicht verlegen musterte Myron das Geld.
»Es kostet jetzt … zwei Oboli.«
Mutlos starrte nun auch Danae auf die Münze in ihrer Hand.
»Bei uns ist wieder etwas Kleines unterwegs, und nachdem auch der Tempelzehnt gestiegen ist …« Der Metzger kratzte sich am kahlen Schädel. »Ich mache das wirklich nicht gerne, aber es geht eben nicht anders.«
»Ma hat mir nicht mehr gegeben.« Danae reckte den Kopf. »Aber ich werde nach Hause gehen und den Rest holen.« Damit streckte sie ihm die Münze und den Sack mit dem Huhn entgegen.
Das Mitleid, das sie in seinem Blick entdeckte, trieb ihr die Schamesröte in die Wangen.
Myron nahm die Münze, ließ ihr aber das Huhn. »Nur dieses eine Mal.«
Schnell warf sich Danae den Sack über die Schulter.
»Es freut mich, dass deine Schwester wieder da ist.«
»Vielen Dank«, sagte sie leise.
Der Metzger räusperte sich und griff wieder zum Beil. Voller Erleichterung darüber, das nun erledigt zu haben, rannte Danae aus dem Laden.
3
REIFE FRÜCHTE
Sechs Wochen später wollte Danae gerade hinausgehen und die Ziegen füttern, als sie Philemon entdeckte, der sich unschlüssig vor ihrer Tür herumdrückte. Er trug einen nagelneuen roten Chiton mit Goldstickerei, der ihm nicht sonderlich gut stand.
Sie wechselten den heiligen Gruß, dann hielt er stolz ein kleines, in Stoff gewickeltes Päckchen in die Höhe. »Ich bin hier, um Alea zu besuchen.«
Innerlich stieß Danae einen schweren Seufzer aus. Philemon war seit Aleas Rückkehr jede Woche erschienen, und der Gedanke, sich wieder einen Nachmittag lang seine öden Geschichten anhören zu müssen, war nur schwer zu ertragen. Deshalb wollte sie ihm gerade mitteilen, dass ihre Schwester sich ausruhe und er morgen wiederkommen solle, als plötzlich ihre Mutter hinter ihr auftauchte.
»Philemon.« Eleni strahlte. »Es dauert nur einen Moment. Danae, unterhalte dich mit unserem Gast, während ich Alea bereit mache.«
Damit schloss sie die Hüttentür, sodass Danae sich plötzlich Nase an Nase mit dem Zukünftigen ihrer Schwester wiederfand. Er wich sofort zurück. Sobald er wieder einen sicheren Abstand zu ihr wahrte, fing er an, an der Verpackung seines Geschenks zu nesteln.
Eine Zeit lang standen sie sich schweigend gegenüber. Danae hatte die Arme vor der Brust verschränkt und suchte krampfhaft nach einem angemessenen Gesprächsthema. Schließlich zeigte sie auf das Päckchen in seiner Hand.
»Was ist denn da drin?«
Auf Philemons Gesicht breitete sich ein zufriedenes Lächeln aus und er tippte sich vielsagend an die Nase. »Ah, ah, ah. Ich möchte nicht, dass du mir die Überraschung verdirbst.«
Fragend zog Danae eine Augenbraue hoch.
»Ich kann dir allerdings verraten«, fuhr er großmütig fort, »dass es sich um ganz besonderes Geschenk handelt, das ich extra aus …«
»Athen?«





























