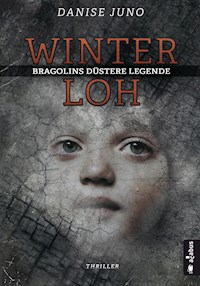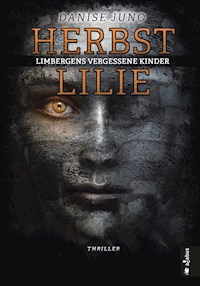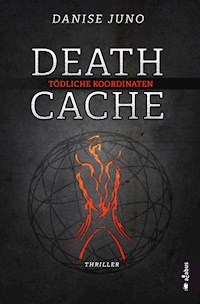
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Mann liegt tot im Wald. Enthauptet. In unmittelbarer Nähe eine als Geocache getarnte Falle. In der Geocaching-Szene scheint ein erbitterter Kampf um die Toplist der besten Cacher ausgebrochen zu sein. Angeführt von einem Spieler namens Sammaël, den niemand persönlich kennt. Als Michael Tonelli sich an dessen Spuren heftet und versucht Sammaëls wahre Identität zu lüften, gerät er ins Visier eines Killers. Schon bald muss Michael erkennen, dass er von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt wird. Geocaching wird mehr und mehr zum Trend, doch ist diese GPS-Schatzsuche wirklich so ungefährlich oder überdeckt der Nervenkitzel einfach jegliche Gefahr? Ein Thriller, der die Sicherheitslücken des Geocaching beleuchtet und sich mit den Gefahren auseinandersetzt, die GPS-Verfolgung mit sich bringt – nicht nur für Kenner der Geocaching- Szene!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danise Juno
DEATH CACHE
Tödliche Koordinaten
Juno, Danise: Death Cache. Tödliche Koordinaten,
Hamburg, acabus Verlag 2016
Originalausgabe
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-417-5
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-418-2
Print: ISBN 978-3-86282-416-8
Lektorat: Lara Maaß, Laura Künstler, acabus Verlag
Umschlaggestaltung: © Marta Czerwinski, acabus Verlag
Umschlagmotiv: 67470924 - Wall, © Stillfx - Fotolia.com; Engel © Danise Juno; globe: https://pixabay.com/de/globus-dr%C3%A4hte-l%C3%A4nge-kugeln-307094/
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag
GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
© acabus Verlag, Hamburg 2016
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
Prolog
Das ehemalige Schlosscafé im Wald oberhalb der Stadt Remagen beherbergte an diesem Samstagnachmittag einen einsamen Gast. Er saß auf einem Kissen welker Blätter, den Rücken an die Ziegelmauer gelehnt, die Augen geschlossen. Bei gestrecktem Nacken ruhte das Kinn auf der Brust. Eine Windböe zupfte an seiner Trekkingkleidung, ließ eine Hand voll Laub in einem kleinen Wirbel tanzen und umwob die Ruine wie ein feines Gespinst aus flüsternden Stimmen der Vergangenheit. Der Himmel lag wolkenlos über den Baumwipfeln des Waldes, der das Gemäuer über die Jahre beinahe gänzlich verschluckt hatte.
Man könnte diesen Ort ein idyllisches Plätzchen nennen, dachte Kommissar Gerke, als er an den Mann herantrat und den Blick über die mit Efeu überwucherten Mauerreste schweifen ließ. Wenn man die Leiche außer Acht lässt.
Er versuchte, den süßlichen Gestank zu ignorieren und richtete sein Augenmerk auf die Brustpartie des Mannes. Das einst kakifarbene Hemd war mit dickflüssigem Blut verklebt, sodass es beinahe schwarz wirkte. Aus einer Falte krabbelte ein dunkelbrauner Käfer hervor, dessen lange Fühler zuckend die Mahlzeit sondierten.
Angewidert besann sich Kommissar Gerke auf seinen Job und zog sich dünne Handschuhe über, die mit einem peitschenden Laut seine Gelenke umschlossen.
»Der arme Kerl hätte in den 60er Jahren herkommen sollen«, sagte sein Kollege König mit belegter Stimme und richtete seinen Blick auf den brüchigen Uhrenturm, der dem Café etwas Unheilvolles verlieh. »Zu der Zeit bekam man hier wenigstens noch frischen Kuchen.« Er richtete seine Kamera auf den Mann und schoss einige Fotos. Anschließend zupfte er ihm eine verrottete Eichel aus dem schmutzig blonden Haar und tütete sie sorgfältig ein.
Gerke hockte sich vor die Leiche. Vorsichtig hob er den Kopf des Opfers und betrachtete die Schnittwunde an dessen Hals. »Siehst du das?«, fragte Gerke seinen Kollegen und deutete auf einen silbernen Draht, der zu beiden Seiten aus der Wunde hinausführte. »Er wurde halb geköpft.«
»Scheint am Halswirbel gescheitert zu sein«, stellte König fest. Seine Augen folgten dem Draht. »Es sieht so aus, als ob er hinter der Mauer befestigt wurde. Da sind Bohrungen.« Er legte den Kopf schräg und ging um die baufällige Wand herum. Einen Augenblick später rief er: »Das musst du dir ansehen! Ist das krank.«
Gerke bettete den Kopf des Mannes zurück auf die Brust, folgte König und sah sich den Mechanismus an, der den Draht peitschenartig hatte zurückschnellen lassen.
»Eine ausgeklügelte Falle, würde ich behaupten«, sagte König betroffen. »Vollautomatisch.«
»Das spricht für die Intelligenz des Täters«, stellte Gerke fest. »Irgendwo muss ein Auslösemechanismus sein.« Er wandte sich erneut der Leiche zu, besah sich deren Position, den halbverrotteten Dielenboden und das wie zufällig verteilte Laub. Schließlich schüttelte er den Kopf. »Ich begreife das nicht. Was zum Teufel hatte der Mann hier zu suchen?«
König war neben ihn getreten. Gerke sah ihn an, seine Brauen schnellten in die Höhe. »Was ist?«, fragte er. Sein Kollege sah aus, als habe er einen Geist gesehen. Kommissar Gerke folgte dessen Blick, der starr auf dem Boden unweit der Leiche ruhte.
»Oliver?«, fragte Gerke.
»Das ist ein Geocacher.«
»Ein was?«
König stieg über die ausgestreckten Beine des Opfers, stellte eine Nummernmarke zwischen die Blätter und schoss ein Foto. Hernach hob er einen Gegenstand auf. »Geocacher sind Leute, die an einem Schatzsuchspiel teilnehmen.« Er hielt ein grau-braunes, etwa faustgroßes Gerät in die Höhe. »Das ist ein GPS. Hiermit finden sie die Dosen, die von anderen Spielern versteckt wurden.« Er schaltete es ein. Der kleine Monitor flackerte auf. »Es funktioniert noch, aber die Batterien sind schwach.«
»Und woher wissen die Leute, wo sie suchen sollen?«, fragte Gerke, der das Spiel nicht kannte.
König kam zu ihm zurück und zeigte ihm das Display. »Siehst du diese Zahlen?«
Gerke achtete sorgfältig darauf, die Blutspritzer auf dem Gerät nicht zu verwischen, als er es König aus der Hand nahm. Dann las er die Ziffernfolge vom Display ab. N50°34.427 E007°13.595. »Das sind Koordinaten«, stellte er überrascht fest.
»Der Owner, also der Besitzer, der den Schatz versteckt hat, gibt diese Koordinaten in einem Internetportal bekannt. Damit ist der Cache, so wird das Versteck genannt, aktiv und jeder kann losziehen und den Behälter suchen.«
»Dieser Owner ist also unser Täter«, stellte Gerke fest, dann seufzte er und fügte resigniert hinzu: »Lass mich raten: Die Leute benutzen anonyme Nicknamen bei der Registrierung.«
König nickte knapp.
Gerke rieb sich mit dem Handrücken die Stirn. »Wir könnten unsere IT-Jungs da ransetzen. Vielleicht finden wir über die IP-Adresse den Anschluss heraus. Kann man in diesem Portal auch die Koordinaten rückwärts suchen, damit wir auf den Owner kommen?«
»Nur, wenn der Cache nicht komplett gelöscht wurde. Aber wenn wir die Dose finden, dann müsste darin auch ein Logbuch mit dem GeoCache-Code, kurz ›GC-Code‹, liegen. Das ist die Nummer, mit der jeder Cache im Portal registriert ist.«
Gerke entgegnete ungläubig: »Meinst du wirklich, der Täter ist so nachlässig, wenn er eine solche Falle bauen kann?«
König verzog den Mund. »Wahrscheinlich nicht.«
»Wir sollten nachsehen«, entschied Gerke. »Ich will mir nicht den Vorwurf machen lassen, geschlampt zu haben.«
»Du hast nicht zufällig ein Paket Batterien dabei?« König sah Gerke fragend an. »Ich weiß nicht, wie lange das Gerät noch durchhält.«
Gerke schüttelte den Kopf. »Beeilen wir uns. Du kennst dich mit den Dingern aus?«, fragte er und gab König das GPS zurück.
»Das ist ein Garmin mit Touchpad«, sagte er und tippte auf ein Icon. »Die Gerätenavigation ist intuitiv. Damit komme ich zurecht.« Augenblicklich erschien ein kleiner Pfeil nahe einer Markierung. »Wir stehen praktisch neben dem Cache.« Er legte den Kopf in den Nacken und sah nach oben. »Allerdings dürfte es Abweichungen geben, wegen der Bäume.«
Gerke folgte seinem Blick, sah das dichte Blattwerk, das die Sonnenstrahlen gefiltert durchließ, und stellte sich ein GPS-Signal vor, das womöglich ebenso abgelenkt wurde.
»Ich könnte aber nachsehen, ob er die Daten zum Cache aus dem Internet runtergeladen und in das GPS übertragen hat.«
Während König sich auf das Gerät konzentrierte, musterte Gerke die Lage des Leichnams und folgte seinen ganz eigenen Gedanken. Der Mann musste die Falle ausgelöst haben. Das ließ den Schluss zu, dass er etwas gefunden hatte. Wenn der Draht mit Wucht auf ihn zugeschossen war, ihn von den Füßen gerissen hatte, dann wäre es logisch, den Cache in derselben Achse zu suchen.
»Das war’s«, sagte König und verstaute das GPS sorgfältig in einem Beutel. »Das Garmin ist aus, aber ich habe den GC-Code.«
»Hervorragend«, murmelte Gerke, setzte sich in Bewegung und ging auf Höhe der Füße des Opfers in die Hocke. Er richtete seinen Blick in die entgegengesetzte Richtung, dann schnalzte er mit der Zunge. »Schleifspuren. Undeutlich, aber …«
König folgte Gerkes Fingerzeig. Er hockte sich neben ihn und richtete seine Kamera auf winzige Kratzspuren, die auf eine Weise von Laub bedeckt waren, dass man sie beinahe hätte übersehen können. Er platzierte eine weitere Marke daneben und stellte das Objektiv scharf. »Dann muss der Cache in dieser Richtung liegen«, sagte er. »Sieh nach aufgestapelten Ästen. Geocaches werden oft so getarnt.«
Gerke trat umsichtig auf eine Mauernische zu, die knipsenden Geräusche der Kamera im Rücken. Darin entdeckte er neben welken Blättern, die der Wind hineingeweht haben musste, einen von Menschenhand aufgeschichteten Reisighaufen. Abrupt blieb er stehen. Er kam sich vor wie ein Tier, das schnurstracks in die Falle geht. Es gab nur diesen Weg hinein. Er zog die Brauen zusammen. War es überhaupt möglich, dass der Cache noch getarnt sein könnte? Wenn der Mann den Mechanismus ausgelöst hatte, dann doch, weil er das Versteck manipuliert hatte. Gerke versuchte, sich in dessen Lage zu versetzen. Das Opfer erreicht die Koordinaten, entdeckt das Reisig, das vermutlich auf dem Cache als Tarnung liegt. Es schichtet es zur Seite, legt den Cache frei. Dabei löst es die Falle aus. Vielleicht. »Kannst du kurz die Ausgangssituation fotografieren?« Er wies in die Nische.
»Bin schon da.« Das Blitzlicht der Kamera zuckte über die mit Efeu überwucherte Ziegelwand.
Als König ihm ein Zeichen gab, schob Gerke das Laub zur Seite und beugte sich über die verschlossene Klappe, die in den Boden eingearbeitet worden war. Sie war nicht größer als der Deckel eines Schuhkartons. Er streckte die Hand danach aus. Mitten in der Bewegung spürte er eine Hand auf seiner Schulter.
»Bist du sicher?«, fragte König mit belegter Stimme. »Nicht dass da noch mehr auf uns lauert.«
Gerke sah zu ihm auf. »Mehr als eine tödliche Falle, die schon ausgelöst wurde? Was sollte das noch sein?«
König atmete hörbar ein, verzog die Lippen. Schließlich entgegnete er: »Wenn du meinst.«
Gerke wandte sich erneut der Klappe zu und musterte sie. Konnte man an eine solche Sache überhaupt mit Logik herangehen? Tot ist tot, schlimmer geht nimmer, dachte er. Er schloss einen Augenblick die Augen, atmete tief durch und nickte entschlossen. Er hob den Deckel.
Ein Schuss peitschte durch den Wald.
Das Adrenalin zuckte durch seine Adern bis unter den Scheitel. Er ließ die Klappe los, prallte zurück.
König duckte sich. »Verdammt.«
Gerke sah, wie der Deckel zuschnappte, wartete auf den Schmerz – der nicht kam. Verwirrt sah er an sich herab, klopfte mit beiden Händen auf seine Brust. »Was …?« Er hörte einen weiteren Schuss – Kilometer entfernt.
König stieß einen lauten Seufzer aus.
Gerke begriff, schüttelte matt den Kopf. »Verflucht sollen sie sein. Verdammte Jäger.«
»Ich habe mir fast ins Hemd gemacht«, presste König hervor.
»Frag mich mal. Mir ist beinahe das Herz stehen geblieben.« Immer noch kopfschüttelnd sagte Gerke: »Nicht zu fassen.« Er rappelte sich auf und besah sich den verschlossenen Deckel. »Ein weiterer Mechanismus. Deshalb war das Ding geschlossen.« Da er nun wusste, dass keine Gefahr drohte, öffnete er die Kiste wesentlich entspannter.
Innen lag eine weiße Plastikbox. Wasserdicht versiegelt, einer Gefrierdose nicht unähnlich. Gerke hob sie heraus, wischte den Schmutz vom Deckel und öffnete sie. Erstaunt hob er die Brauen. »Das ist ein Logbuch?«, fragte er. Er nahm ein kleines Heftchen heraus und schlug die erste Seite auf.
»Ein FTF«, sagte König und fügte schnell hinzu: »First to find. Wenn du dich jetzt an die erste Stelle in dieses Logbuch eintragen würdest, als erster Finder, dann hast du den Cache als FTF geloggt. Es gibt umfangreiche Statistiken im Onlineportal. Da sind die besten FTF-Jäger verzeichnet. Das sind Leute, die sich zur Elite zählen; die absoluten Topcacher.«
»Unser Opfer ist also solch ein FTF-Jäger?«, folgerte Gerke.
König schüttelte den Kopf. »Nicht unbedingt, manchmal haben die normalen Cacher einfach nur Glück.« Er biss sich auf die Zunge, warf einen Blick zurück zum Opfer und korrigierte sich. »In diesem Fall wohl eher Pech.«
»Und was soll das sein?«, fragte Gerke. Er nahm einen kleinen Gegenstand aus der Dose, den er sogleich als Hasenpfote erkannte. Daran baumelte eine kleine Metallplakette. Die Vorderseite war mit einem Symbol bedruckt, das einem Skarabäus nachempfunden war. Darunter befand sich eine eingeprägte Nummer, darüber las er: »The Travel Bug.«
»Der muss vom Owner oder vom Opfer sein. Das waren offenbar die einzigen Personen an diesem Cache«, stellte König fest, zückte einen Notizblock und schrieb sich die Nummer auf.
»Noch ein Code?«, fragte Gerke.
»Ja. Jeder Travel Bug ist mit dieser Nummer im Portal registriert. Dazu gibt es normalerweise eine Beschreibung, ein Listing. Travel Bugs, abgekürzt TBs, haben eine Aufgabe, die im Listing erklärt wird. Die meisten sollen einfach von Cache zu Cache reisen. Die Leute nehmen ihn aus der Dose raus und legen ihn dann in einen anderen Cache. Im Internet wird er dann geloggt. So kann der Owner des TBs immer nachverfolgen, wo sich das Teil gerade befindet.«
»Klingt kompliziert«, sagte Gerke.
König schüttelte den Kopf. »Ist es gar nicht. Es ist wie bei den Geocaches auch. Kontrolliert wird das ganze Spiel übers Internet. Jeder Cache und jeder TB hat ein zugehöriges Listing. In der Beschreibung steht dann, was zu beachten ist und wie schwierig der Cache zu finden ist. Ein einziger Stern steht für ›absolut simpel‹, fünf Sterne bedeuten ›besonders schwer‹. Wenn man einen Cache oder einen TB gefunden hat, trägt man das vor Ort ins Logbuch und am Ende im Internet ein. Das ist alles.«
Gerke hatte verstanden. Das Opfer hatte demnach diesen Geocache im Internet gefunden. Dass er registriert war, wussten sie durch den GC-Code, den König im GPS-Gerät gefunden hatte. Im Cache hatte dieser Travel Bug gelegen. Auch der war registriert. Die zugehörigen Listings mussten sichergestellt werden. So würden sie vielleicht herausfinden können, wer den Geocache gelegt hatte und wem der Travel Bug gehörte.
Gerke besah sich den Deckel genauer. Die Scharniere wiesen Federn auf, sodass er zuschnappte, sobald man ihn losließ. Als er mit den Fingern über einen leicht gebogenen Metallsplint strich, der am vorderen Teil des Deckels angebracht war, wurde ihm die Funktion der Falle schlagartig bewusst. Er schauderte bei dem Gedanken, wie detailliert und kaltblütig hier vorgegangen worden war. Er testete den Öffnungswinkel. »Wie groß ist das Opfer?«, fragte er unvermittelt. »Was meinst du, Oliver?«
»Durchschnittlich würde ich sagen. Etwas um die 1,80 m.«
Gerke überlegte kurz, dann schlussfolgerte er: »Wäre der Mann kleiner gewesen, wäre ihm wahrscheinlich gar nichts passiert.«
König sah irritiert aus. »Wie meinst du das?«
»Sobald man den Deckel um etwa dreißig Grad geöffnet hat, rutscht der Draht über den Splint und schießt heraus. Er hat das Opfer an der Kehle erwischt und mitgerissen. Ich bin etwa zehn Zentimeter kleiner und habe einen kürzeren Oberkörper. Wenn ich so wie jetzt vor der Kiste hocke …«, er führte seine flache Hand in einem Dreißig-Grad-Winkel vom Splint ausgehend auf sich zu, »… dann hätte mich der Draht vielleicht skalpiert, aber nicht getötet.«
»Der Täter hat bei der Konstruktion der Falle demnach explizit das Opfer im Sinn gehabt.« König runzelte die Stirn. »Er muss den Mann also gekannt haben.«
»Es sieht zumindest danach aus«, sagte Gerke. »Außerdem glaube ich, dass unser Opfer keine Zeit mehr hatte, um die Dose zu entnehmen, geschweige denn, den Travel Bug hineinzulegen.«
»Wir haben also schon zwei Spuren, die den Tatort mit unserem Täter verbinden. Die Frage ist jetzt: Wer hat beide registriert?«
»Wir müssen unsere IT-Jungs sofort da ransetzen«, sagte Gerke und zog sein Mobiltelefon aus der Tasche. Er wählte die Nummer der Zentrale, hörte das Freizeichen, doch in diesem Augenblick fesselte ein anderes Geräusch seine Aufmerksamkeit. Stimmen drangen durch den Wald, Äste knackten. Jemand kam auf sie zu. Abrupt wandte er sich zu König um. »Sag bloß, der Cache ist noch aktiv.«
Kapitel 1
Drei Monate zuvor.
Michael Tonelli baumelte fünfundvierzig Meter über der Erde und fragte sich nicht zum ersten Mal, ob er verrückt geworden war. Seine behandschuhten Finger klammerten sich um das Kletterseil, während er versuchte, einen sicheren Stand zu finden. Er schätzte die Entfernung zur nächsten Astgabel, die ihn problemlos würde tragen können, auf etwa drei Meter, stieß sich mit den Beinen vom glatten Stamm der mächtigen Ulme ab und langte zu.
Seine Finger streiften die anvisierte Gabel. Er hatte den Schwung falsch eingeschätzt. Leicht vorgebeugt nutzte er nun die Kraft der Pendelbewegung, um sich erneut abzustoßen. Tollkühn ließ er das Seil los und packte mit beiden Händen zu. Blätter raschelten, ein morscher Ast fiel an ihm vorbei, stürzte mit einer halben Drehung um sich selbst hinab und landete schließlich dumpf auf dem Waldboden. Einige abgerissene Blätter segelten sanft hinterher.
Michael zögerte nicht, rammte seinen Fuß in die Gabel, schlang das Sicherungsseil herum und hakte es klirrend an seinem Gurt ein. Vorsichtig lehnte er sich rücklings gegen das Holz, das unter seinem Gewicht knarrte. Erst als er sicher war, seinen Stand gefunden zu haben, schaute er sich um. In der Krone huschte ein schwarzes Eichhörnchen durch die Zweige. Der buschige Schwanz wippte, als es in den benachbarten Baum sprang und raschelnd zwischen dichtem Blätterwerk verschwand.
Wo zum Teufel hat Geopapst den Cache versteckt? Unweit seiner Position, weitere drei Meter schräg über ihm, sah er einige Misteln zwischen dem Geäst ruhen. Sie sahen aus, als wären sie eigens dort platziert worden. Keine schlechte Tarnung, dachte er und begann hinüberzuklettern.
Vorsichtig prüfte er die Haltbarkeit der Äste, die er erklimmen wollte, bevor er sie mit seinem ganzen Gewicht belastete. Doch er kam gut voran und wenige Minuten später hatte er die Misteltraube erreicht. Hier muss es sein, dachte er, streckte seine Finger aus und bog die Zweige auseinander.
Schwarze Augen starrten ihm entgegen. Der nackte Fluchtreflex schoss in seine Glieder. Ehe er sich besann, hechtete er schon rückwärts. Ins Leere. Der Fallwind strich ihm um die Ohren. Ein einziger Gedanke schoss ihm durch den Kopf: Scheiße.
Er ruderte mit den Armen, riss Blätter und Zweige mit sich. Der heftige Ruck folgte prompt. Das Seil hatte den Absturz gestoppt. Michael hing im Gurt. Die Lenden schmerzten, der Rücken nicht minder. Verdammt noch mal, was war das?
Es war ihm von vornherein klar gewesen, dass dieser Cache nicht leicht sein würde. Die Bewertung war mit fünf Sternen angegeben und kennzeichnete damit den höchsten Schwierigkeitsgrad. Abgesehen von diesem mysteriösen Sammaël, der außer Konkurrenz lief, war nur er selbst Geopapst dicht auf den Fersen. Ehrensache, dass er dessen Herausforderung angenommen hatte und diese Dose hinter Sammaël zumindest als Zweiter finden wollte. Doch um welchen Preis?
Michael baumelte immer noch im Gurt, hatte sich jedoch wieder in der Gewalt und sah hinauf zu den Misteln. Sie hingen an derselben Stelle wie zuvor. Nichts regte sich, und wenn er recht darüber nachdachte, war ihm auch nicht aufgefallen, dass irgendein Tier daraus geflüchtet wäre. Was war das? Verdammt, ich habe mich beinahe zu Tode erschreckt.
Auf alles gefasst begann er den Aufstieg erneut, nicht ohne sich zu vergewissern, jederzeit sorgfältig gesichert zu sein. Er ließ sich absichtlich Zeit. Im Grunde wollte er gar nicht genau wissen, was sich in der Mistel verbarg, doch ein Aufgeben kam für ihn erst recht nicht in Frage.
Als er die Stelle erreicht hatte, zögerte er einen Moment. Eine sanfte Brise strich durch die Baumkrone und trug aus der Tiefe des Laubwaldes das Klopfen eines Spechts heran. Augenblicklich sträubten sich ihm die Nackenhaare.
Vorsichtig und auf Abstand bedacht bog er die grünen Zweige auseinander. Nichts rührte sich. Er beugte sich näher heran, griff beherzter zu. Was er dann zu sehen bekam, verschlug ihm buchstäblich den Atem.
»Jack«, wisperte er. Er fühlte sich mit einem Schlag zurück in seine Kindheit versetzt, als er etwa zehn Jahre alt gewesen war.
Alles wird wieder gut, dachte er damals, während er sich über die Wiese auf den kleinen Stall zuschleppte, der unter wenigen Bäumen am Rande des Villenparks stand. Die flache Hand hielt er auf seine linke Seite gepresst, die nach Alex’ Tritt höllisch schmerzte. Er wagte es nicht, seine Nase mit den Fingern abzutasten. Sie war bestimmt gebrochen. Er fühlte das warme Blut über seine Lippen rinnen. Um zu verhindern, dass es auf sein T-Shirt tropfte, fuhr er sich mit der Zunge darüber.
Wo war Alex eigentlich hergekommen? Er hatte ihn nicht kommen sehen, sonst wäre er gar nicht erst in den Park gegangen. Und was er sich noch weniger erklären konnte, war, warum Alex ihn nicht leiden mochte. Der Kerl lebte erst wenige Tage bei seiner Mutter. Sie war die Haushälterin in der Villa Auwald und wohnte in der dazugehörigen Dienstwohnung.
Wann immer er Alex begegnete, hatte der nichts Besseres zu tun als ihn zu beleidigen und zu quälen. Alex war ein fünfzehnjähriges Arschloch mit Flaum um den Mund. Als wenn der je einen Bart bekommen würde. Es sieht lachhaft aus. Und doch, irgendetwas war an ihm, das ihn schaudern ließ.
Derart in Gedanken versunken erreichte Michael die Pforte zum Stall. Sie stand einen Spalt breit offen. Es kostete ihn keine Mühe, sie ein Stück weiter zur Seite zu schieben. Michael quetschte sich hinein und stand im Dämmerlicht des Geräteraums. Seine Augen brauchten eine kleine Weile, bis sie sich an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnt hatten. Dann ging er am Rasenmähertraktor vorbei in den hinteren Teil des Raumes. An der Wand hingen die Gartengeräte, darunter standen drei Paar Gummistiefel. Über einem altersschwachen Porzellanwaschbecken war ein angelaufener, rechteckiger Spiegel mit rostigen Krallen an der Trennwand zum Kaninchenstall befestigt.
Michael trat an das Becken heran und sah sein blutverschmiertes Gesicht. Vor Schreck wich er einen Schritt zurück, das Blech des Traktors drückte an sein Gesäß. Es war, als starre ihm ein Zombie entgegen. Er erkannte sich kaum wieder. Seine Nase war stark geschwollen und knapp unterhalb der Wurzel klaffte ein blutiger Riss.
Mit zitternden Fingern tastete er nach dem Wasserhahn und drehte ihn auf. Sofort hörte er das Wasser mit vollem Druck ins Becken fließen. Überrascht sah er sich den Strahl an. Anstelle der üblichen anfänglichen Rostbrühe floss es weiß schäumend aus dem Hahn, als wäre er erst vor kurzem genutzt worden. Er fuhr mit der Hand am Rand des weißen Porzellans entlang und tatsächlich blieben feuchte Tropfen an seinen Fingern haften. Michael sah zu Boden. Er stand in einer kleinen Pfütze.
Ob Johann hier gewesen war? Wahrscheinlich, denn der alte Gärtner zog sich immer Gummistiefel an, wenn er rund um die Villa arbeitete und es fehlte ein Paar. Aber wo trieb er sich herum? Im Park hatte er ihn nicht gesehen.
Er widmete sich wieder seinem Spiegelbild, schöpfte das Wasser in die hohle Hand und wusch sich vorsichtig das Gesicht. Erst zum Schluss träufelte er ein wenig Wasser in die Wunde und atmete zischend ein, als ein schmerzender Stich durch seinen Kopf jagte. Er wiederholte den Vorgang mehrere Male. Mit jedem Tropfen spülte er etwas Blut aus dem Riss. Es mischte sich mit dem Wasser und lief hellrosa seine Wangen hinab. Als er glaubte, es nicht mehr aushalten zu können, wusch er sich ein letztes Mal das Gesicht, dann betrachtete er sein Werk. Unauffällig war etwas anderes. Das stand fest. Aber zumindest sah er größtenteils wieder aus wie er selbst, auch wenn das nicht gerade für seine Nase galt.
Er drehte den Hahn ab und ging zum Kaninchenstall. Die kleine Pforte war nur angelehnt. Er hob die Hand, um sie aufzuschieben und dachte an den kleinen Jack. An sein warmes, weiches Fell. Er sehnte sich danach, ihn im Arm zu halten, sich von ihm trösten zu lassen, doch etwas ließ ihn zögern. Es war, als ob sein Verstand längst wusste, was sein Herz zu leugnen schien. Er hatte Johann nicht gesehen; nur Alex.
Nur Alex. Alex.
Der Name hallte in ihm nach. Er schüttelte den Kopf, wollte ihn hinaustreiben, die Ahnung fortschieben so wie die Tür, die wie im Zeitlupentempo nach innen schwang und in den Angeln quietschte.
Sein Blick fiel auf die offenen Kaninchenboxen. Das Stroh hing halb heraus und lag verteilt auf dem ausgetretenen Lehmboden. Ein schwarzer Gummistiefel stand im Raum, der andere lag umgekippt daneben. Michael wollte die Augen schließen, doch er konnte nicht. Er musste hinsehen. Das Grauen ergoss sich in seinem Körper wie flüssiges Eis, als er sah, was aus dem Stiefel herausgeflossen und sich davor in einer Lache gesammelt hatte. Blut. Überall sah er Blut.
Michael sank auf die Knie, krabbelte auf die Stiefel zu. Tränenblind fasste er hinein. Seine Finger stießen auf weiches Fell, schlossen sich darum und er zog es heraus. Der schlaffe, kalte Körper eines schwarzen Jungkaninchens lag in seiner Hand. Er griff erneut in den Stiefel, fand ein weiteres. Gernots weiß geflecktes. Es starrte ihn aus toten Augen an, der Körper zerquetscht und blutverschmiert.
Michael heulte auf. Was ist das für ein Mensch, der so etwas macht? Hastig griff er nach dem anderen Stiefel. Zog das zweite schwarze Kaninchen heraus. »Jack! Bitte, bitte. Jack!«, heulte er, fuhr mit der Hand abermals hinein, glaubte, der Stiefel sei leer. Dann stieß er auf etwas Warmes. »Jack!«
Vorsichtig zog er das blaue Jungkaninchen heraus und legte es behutsam auf seine Handfläche. »Oh Jack.«
Das Kaninchen atmete flach, regte sich kaum. Die Glieder waren grotesk verdreht. Michael weinte bitterlich. Der Schmerz saß so tief in seinem Herzen, dass er glaubte, es jeden Augenblick brechen zu hören. Sanft streichelte er über Jacks Fell, senkte den Kopf und nässte ihn mit seinen Tränen. »Verzeih mir, Jack«, wimmerte er. »Verzeih mir.«
Mit einem Ruck brach er dem kleinen Kaninchen das Genick und erlöste es von seinem Leid. Michael sank zusammen und schluchzte. Trauerte um seinen Freund, dem so schreckliches Leid zugefügt worden war; von einer Bestie. Alex war ein Tierquäler, ein Mörder.
Bisher hatte er nicht gewusst, was Hass war. Doch in diesem Augenblick hatte ihn die Empfindung bis in den tiefsten Winkel seiner Seele durchflutet.
Michael schüttelte den Kopf und vertrieb die furchtbaren Bilder der Vergangenheit. Er musste sich zwingen, nicht daran zu denken, wozu er damals fähig gewesen war, ausgelöst durch dieses traumatische Erlebnis; achtzehn Jahre in der Vergangenheit, tief in seinem Unterbewusstsein vergraben – bis jetzt.
Neuerliche Gedanken drängten sich ihm förmlich auf. Wie war das tote Kaninchen in diese Baumkrone gekommen? Hatte Geopapst es hier deponiert? Warum? War ihr Konkurrenzkampf um die Geocacher-Toplist schon so weit gediehen, dass der zu solchen Mitteln griff? Wollte er ihn dadurch vom Geocache abhalten; verhindern, dass er ihn loggte und damit in seine Statistik eintragen konnte? Das war für ihn schwer zu glauben. So was tat man einfach nicht. Undenkbar.
Das tote Kaninchen, das im Inneren der Mistel verborgen gewesen war, sah Jack nicht einmal ähnlich. Es war ein agoutifarbenes Wildkaninchen. Hatte ein Greifvogel es vielleicht hier heraufgebracht? Wie lange mochte es schon zwischen den Zweigen ruhen?
Michael runzelte die Stirn. Es kam ihm mehr als seltsam vor, dass es dann im Inneren einer Mistel hätte liegen können. Aber wie kam es dann hierher? Und wo war der Cache versteckt? Gab es überhaupt einen Zusammenhang?
Er durchsuchte den Rest der Misteltraube, doch darin steckte der Geocache nicht. Hatte er sich in den Koordinaten geirrt? War es ein unglücklicher Zufall?
Mit der rechten Hand tastete er seinen Gürtel ab, ergriff das GPS-Gerät, das er mit einer Schlaufe daran befestigt hatte, und schaute auf das Display. Inmitten der Blätter hatte er keinen guten Empfang, doch es war deutlich zu erkennen, dass er ein gutes Stück von den Koordinaten des Verstecks entfernt sein musste. Sein Blick folgte dem Pfeil auf dem GPS durch die breit verästelte Krone. Suchend sah er sich nach weiteren Versteckmöglichkeiten um. Schließlich entdeckte er eine Aushöhlung in einem dicken Ast; etwa zehn Meter entfernt.
Specht, dachte er. Das könnte ein ehemaliges Nest gewesen sein. Voller Zuversicht wollte er sich auf den Weg machen, als sein Blick wieder auf das tote Kaninchen fiel. »Was machen wir jetzt mit dir?«, sagte er halblaut. Schließlich fasste er einen Entschluss.
Er zog das verendete Tier vorsichtig aus der Mistel heraus und band die Pfoten mit einem Stück Schnur zusammen, das er bei sich trug. »Entschuldige«, flüsterte er dem Kaninchen zu, dann hakte er es mit einem Karabiner an seinen Gurt. Er hätte es nicht übers Herz gebracht, es in die Tiefe zu werfen. Stattdessen würde er es mitnehmen und später im Waldboden vergraben. Ein guter Gedanke.
Ohne weitere Zwischenfälle kletterte er hinüber, schlang das Sicherungsseil um den aufrecht gewachsenen Ast und setzte sich in den Gurt. Er hakte eine kleine Taschenlampe ab und leuchtete in die Spechthöhle. Sie führte nicht weit in den Stamm hinein, sondern knickte schon kurz nach dem Eingang nach unten wie eine Art Tasche. Michael zog einen kleinen Handspiegel aus der Trekkingweste und versuchte, damit weiter hineinzusehen.
Das Nest war verlassen. Am Boden konnte er weißes Plastik ausmachen, das ganz nach einer Geocaching-Dose aussah. Er wollte gerade seine Hand hineinstecken, als er einen winzigen Draht entdeckte, der in die Öffnung gehakt worden war. Die Handschuhe hinderten ihn daran, feinmotorisch vorzugehen. Michael streifte sie sich von den Fingern, um zu verhindern, dass der Draht sich womöglich lösen und in die Höhle hineingleiten würde. Sorgfältig verstaute er die Handschuhe am Gürtel, dann fasste er den Haken behutsam mit zwei Fingern und begann ihn herauszuziehen. Der Behälter klemmte kurz und für einen Augenblick fürchtete Michael, der Draht würde reißen. Doch schließlich bekam er ihn frei und zog den PET-ling vollends heraus.
Die zylindrische Dose war gerade so groß, dass er sie locker mit der Faust umschließen konnte. Der opake Kunststoff ließ das darin liegende Logbuch erahnen, gesichert durch einen blauen Schraubdeckel. Als er ihn aufgedreht hatte, sah er inliegend einen Aufkleber, auf den der GC-Code des Caches notiert worden war. Michael stülpte die Dose in der hohlen Hand um und ließ das Logbuch herausgleiten. Gespannt, ob er vielleicht doch der erste Finder sein könnte, blätterte er das kleine Heftchen auf. Auch hier stand zuoberst der GC-Code notiert, den er für die Online-Statistik brauchen würde.
Er schnaubte missmutig. Zu spät. Gleich unter dem Code befand sich der Aufkleber, der einen stilisierten Engel zeigte. Darauf der Name des Geocachers, der auch diesen hier als FTF und damit als Erstfund geloggt hatte: Sammaël.
Michael schüttelte den Kopf und verzog die Lippen zu einem schiefen Grinsen der Anerkennung. »War klar«, sagte er in die Stille des Waldes hinein. Erschreckt flatterte ein Vogel auf. Ein Griff in die Westentasche und er förderte seine eigenen Aufkleber zu Tage. Er gab sich schon lange nicht mehr mit einfachen Kugelschreibereinträgen zufrieden. Schließlich hatte er sich inzwischen einen Ruf erarbeitet. Eine mittelalterlich anmutende Schrift in einem verwehenden Nebelschwaden war sein Erkennungszeichen. Mysthunter. Er trug noch das Datum ein, gefolgt von dem Schriftzug ›Silber‹, der ihn als zweiten Finder auswies. Dann schob er das Logbuch zurück in die Dose, schraubte den Deckel zu und verstaute sie in ihrem Versteck.
Zeit, sich abzuseilen, bevor ein weiterer Geocacher auf den Plan trat. Mit dem toten Kaninchen am Gurt hakte er das Sicherungsseil aus und ließ sich hernach surrend hinab. Als er festen Boden unter den Füßen hatte, löste er das Kletterseil, verstaute alle Utensilien in seinem Rucksack, den er am Boden zurückgelassen hatte, und entfernte sich einige Meter von der mächtigen Ulme. Dann packte er einen kleinen Klappspaten aus, den er mit sich trug, und begrub das Kaninchen im feuchten Waldboden. Seine Gedanken kreisten darum, wie es in den Baum gelangt war. Er weigerte sich, daran zu glauben, Geopapst hätte es absichtlich zwischen den Mistelzweigen platziert. Es kam nur eine Möglichkeit in Betracht, die ihm zumindest halbwegs logisch erschien. Ein Raubvogel hatte das Kaninchen gefangen und es im Flug verloren, weil es ihm zu schwer gewesen war. Als es dann zu Boden stürzte, musste es sich in der dichten Krone zwischen den Misteln verfangen haben.
Ein Zufall; nichts weiter.
Kapitel 2
Tenner hatte seine Kleidung sorgfältig ausgewählt. Gewöhnliche Jeans und T-Shirt ohne Markenlabel, festes Schuhwerk, Basecap und Rucksack, wie ihn die Meisten ihr Eigen nannten. Seinen Wagen parkte er etwas abseits und achtete penibel darauf, dass niemand ihn aussteigen sah. Er verließ sich auf die herrschende Anonymität. Sein Nickname sollte ihm Schutz geben, dennoch war er nervös. Er hegte nicht die Absicht, bei diesem Cachertreffen irgendwelche Kontakte zu knüpfen. Er wollte sich lediglich umhören und möglichst bald wieder verschwinden, doch je länger er auf dem Platz verweilte, desto stärker wurde ihm bewusst, dass sich viele Geocacher untereinander kannten. Er durfte keinesfalls als Einzelgänger wahrgenommen werden, also änderte er seine Taktik und verließ sich fortan auf seine Instinkte.
Er stellte sich wie selbstverständlich in die Nähe einer losen Gruppe, als gehöre er dazu. Er wusste, es war riskant, doch er setzte darauf, dass niemand Fragen stellen würde. Er war wie der uneingeladene Hochzeitsgast; in den Augen der Anwesenden würde er schon zu jemandem gehören. Alles Weitere würde sich von selbst ergeben. Er widmete sich seiner Suche nach dem Phantom. Sammaël.
Der Typ war wie ein Geist, ungreifbar wie ein Luftzug, der einem durch die Finger streicht. Was auch immer er anstellte, Sammaël loggte jeden anspruchsvollen, frisch ausgelegten Cache zuerst und entzog sich ihm erfolgreich. Solange er nicht im Stande war, herauszufinden, wer sich hinter diesem Nicknamen verbarg, war sein Plan zum Scheitern verurteilt. Sammaël würde der Kollateralschaden sein, den er mehr als gewillt war zu akzeptieren, doch wie zum Teufel fängt man einen nebulösen Schatten? Er lauschte den Gesprächen der Geocacher und hoffte auf Informationen, die dessen wahre Identität verraten würden.
Die Themen drehten sich um allgemeine Dinge, die ihn nicht interessierten. Eine Gruppe plante einen neuen Multi auszulegen und sammelte Ideen für die einzelnen Stationen, andere unterhielten sich über ihre jeweiligen Jobs, die Familie, die Nachrichten; ödes Gegacker ohne Sinn und Verstand.
Nur wenige Schritte trennten ihn von ein paar Leuten, die es sich am Ende einer Bierzeltgarnitur gemütlich gemacht hatten. Der Name Sammaël fiel und fesselte augenblicklich seine Aufmerksamkeit. Unauffällig trat er einen Schritt heran.
Die schwarzhaarige Frau, die über Sammaël sprach, strich sich eine pinkfarbene Strähne aus der Stirn. Sie unterhielt sich mit einem Mann mittleren Alters, dessen Haar überwiegend ergraut war. Nur wenig erinnerte daran, dass es einst mittelbraun gewesen sein musste. Sein Gesicht wirkte aufgedunsen und teigig. Er saß mit hängenden Schultern neben ihr und nickte leicht.
Worum es genau ging, konnte Tenner nicht verstehen, denn das Thema schien just in dem Moment beendet, als ein südländisch wirkender Kerl an ihren Tisch trat und sie überschwänglich begrüßte. Diesen günstigen Augenblick der Ablenkung nutze er, um sich unbemerkt an den Nebentisch zu setzen. Er stellte seinen Rucksack unter die Bank. Der Mann ihm gegenüber, etwa Mitte dreißig und mit einem Bartgestrüpp, das nur dürftig eine lang zurückliegende Jugendakne zu verbergen suchte, schnitt gerade ein Würstchen in mundgerechte Happen. Er spießte eines der Stücke auf seine Gabel und schob es sich zwischen die Zähne. Dann blickte er von seinem Teller auf.
Angewidert verfolgte Tenner, wie sich klebrig weiße Speichelmasse in dessen Mundwinkel sammelte, ließ sich jedoch nichts anmerken und legte überfließende Freundlichkeit in seinen Gesichtsausdruck.
Der Mann sah ihn aus wässrig blauen Augen an, lächelte und nickte höflich, dann schluckte er geräuschvoll und sagte: »Tag. Bist du auch hier aus der Gegend?«
Mit einem raschen Seitenblick stellte Tenner fest, dass die Gruppe ihn nicht beachtete. Erleichtert wandte er sich dem Kratergesicht zu. In verbindlichem Ton antwortete er: »Ich bin hier geboren, und du? Ich habe deinen Namen mit Sicherheit schon einmal in einem Logbuch gelesen, nicht wahr?«
Der Mann wirkte erfreut. »Oh bestimmt. Ich bin Artschi der Bär.« Er legte die Gabel ab, ergriff die manikürte Hand einer dürren Blondine neben sich und verschränkte seine krummen Finger in ihre fast zerbrechlich wirkenden. »… und das ist Lilli Rose, meine Frau. Wir haben vor zwei Wochen geheiratet.«
Sie unterbrach das Gespräch mit ihrer Sitznachbarin, schaute ihren frisch Angetrauten an und lächelte. Dann glitt ihr Blick zu Tenner.
Augenblicklich war er sich sicher, dass ihr Interesse an Artschi wohl eher seiner Börse galt als seinem unwiderstehlichen Esprit.
Ihre Augen streichelten seinen muskulösen Oberkörper, bis ihr scheinbar bewusst wurde, was sie tat. Lilli schlug die Wimpern nieder.
»Meinen allerherzlichsten Glückwunsch«, sagte Tenner erfreut und schickte ein überaus charmantes Lächeln an die welkende Rose.
Sie ließ ein gurrendes Kichern hören, dann löste sie ihre Hand aus Artschis Pranke. Sanft strich sie ihrem Gatten über die bärtige Wange und hauchte mit honigsüßer Stimme: »Ist er nicht wunderbar? Er schwärmt allen von unserer Hochzeit vor. Erzähl ihm von der Kutsche, Schatz.«
Artschi wirkte selig. Beflügelt von ihrer Anregung begann er detailreich von ihrem großen Tag zu erzählen, was ihn nicht davon abhielt, sich zwischendurch das ein oder andere Stück Wurst zwischen die Lippen zu schieben. Dabei sammelte sich sein Speichel nun auch noch im anderen Mundwinkel wie weißlich schimmernder Flüssigklebstoff.
Lilli warf noch einen bedeutungsvollen Blick zu Tenner herüber, beteiligte sich jedoch nicht weiter und wandte sich ihrer Sitznachbarin zu, um die zuvor unterbrochene Unterhaltung fortzuführen.
Tenner wusste genau, was dieser Blick zu bedeuten hatte. Er kannte solch seichte Frauen zur Genüge. Es waren nur eine winzige Gelegenheit und ein abgeschiedener Busch vonnöten. Er bedauerte beinahe, dass er den kleinen Fick am heutigen Tag nicht würde zulassen können. Stattdessen ergab er sich in Artschis Ausführungen. Er hielt die freundliche Fassade aufrecht, obwohl er sich beherrschen musste.
Waren die vorigen Gespräche öde, so war dieses hier absolut nervtötend. Folter für die Ohren, erst recht, da er wusste, wie es um Artschis Ehe stand. Nicht dass es ihn auch nur im Entferntesten interessierte; es war eine unwillentlich aufgezwungene Feststellung. Dass er dazu noch genötigt wurde, zuzusehen, wie sich ein klebriger Speichelfaden zwischen Ober- und Unterlippe bildete, der sich bei jedem Wort wie ein elastisches Band spannte und verkürzte, setzte dem Ganzen die Krone auf. Der weißlich schimmernde Faden wollte einfach nicht reißen. In Tenners Gedanken flackerten Bilder einer zerstückelten Leiche wie ein Blitzlichtgewitter auf: Artschis leblos zum Himmel starrende Augen, sein Mund geschlossen, auf dass ihm die Spucke endlich ausging.
Tenner trug sein Lächeln meisterhaft und nickte verbindlich. Er hätte es nicht ertragen, wäre da nicht ein positiver Nebeneffekt gewesen. Die Gruppe am Nachbartisch musste glauben, dass er zu Artschi und seiner Frau gehörte. Auf diese Weise konnte er zumindest am Rande ihr Gespräch verfolgen, ohne aufzufallen; wenn er sich konzentrierte. Er focht einen inneren Kampf mit sich selbst. Wie weit konnte er gehen? Sollte er lauschen und sich alsbald verdrücken oder sich nach einer Weile vorsichtig an deren Unterhaltung beteiligen? Die wenigen Gesprächsfetzen, die er aufschnappte, brachten ihm nicht viel ein. Es war für ihn entscheidend, herauszufinden, wer sich hinter diesem Sammaël verbarg.
Seine komplette Situation änderte sich schlagartig, als Artschi plötzlich verstummte. Die Gabel fiel klirrend auf den Teller, die Augen vor Entsetzen aufgerissen. Ein Röcheln drang aus seiner Kehle.
Die welke Rose sprang auf, beugte sich über Artschi, der die Hände gegen den Hals presste. Lilli kreischte.
Der nun ausbrechende Tumult zwang Tenner dazu, sich schneller auf eine neue Taktik zu besinnen, als ihm lieb war. Die Unauffälligkeit war dahin. Sollte er sich im Trubel klammheimlich verdrücken oder beherzt eingreifen?
Menschen drängten herbei, umschlossen den Tisch wie ein Schwarm Ameisen den Käse. Auch Tenner kam auf die Beine, stieg rücklings über die Bank in eine Lücke. Er wurde zurückgedrängt. Die Weichen waren gestellt. Sein Blick glitt zu der dunkelhaarigen Frau, deren Haare wie schwarzes Öl glänzten. In diesem Augenblick traf er seine Wahl.
Kapitel 3
Gleichstand. Zufrieden lehnte sich Michael im Lederstuhl zurück, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und sah sich seine Online-Statistik an. Er hatte soeben die letzten beiden Caches, die ihm zum Ausgleich auf Geopapst gefehlt hatten, eingetragen. Sollte der ruhig sehen, wie dicht er ihm auf den Fersen war. Was konnte es Besseres geben, als zum Cachertreffen zu fahren und Geopapst auf Augenhöhe zu begegnen? Der zweite Platz der Rangliste war nicht zu verachten, auch nicht, wenn er sich diese Position vorerst mit seinem Konkurrenten teilen musste. Noch.
Michael warf einen Blick auf die altmodische Standuhr, die in diesem muffigen alten Büro stand, solang er denken konnte. Das ehemals alleinige Reich seines Vaters. Sechs Monate waren vergangen, seit er seinen alten Herrn zu Grabe getragen hatte und doch hatte er das Gefühl, als könnte Quentin Tonelli Senior jeden Augenblick durch die Tür hereintreten.
Die Anwesenheit seines Vaters war immer noch spürbar. Nichts hatte sich seither verändert. Der wuchtige Schreibtisch, dessen Zwilling im Firmenbüro stand, der erhöhte Lederstuhl, auf dem er saß wie auf einem Thron, und der niedrige Stuhl gegenüber, auf dem sich Geschäftspartner und Untergebene niederzulassen hatten.
Augenblicklich fühlte er sich in seine Kindheit zurückversetzt und hörte die Worte seines Vaters über sich hereinbrechen.
»Das ist Psychologie«, erklärte Quentin Tonelli ihm damals, tippte sich mit dem Zeigefinger gegen die Schläfe und sah ihn eindringlich an. »Wenn du selbst erhöht sitzt, zeigst du deutlich, wer das Sagen hat und degradierst jeden potentiellen Geschäftspartner zu einem Bittsteller.«
Michael wusste nur zu gut, was Vater ihm damit sagen wollte, verspürte er die Wirkung doch gerade am eigenen Leib. Er rutschte unruhig auf dem Sitz herum. Die Finger kneteten das zerknüllte Taschentuch in seinen Händen. Der stattliche Mann wirkte übermächtig, schon sein bloßer Wille trotzte ihm ein Kopfnicken ab.
»Merk dir das, Junge.«
»Ja, Vater«, brachte er flüsternd hervor und senkte den Kopf. Er musterte den Teppich. Ein schweres Flechtwerk aus rot-bunter Wolle. Aus dem Orient vielleicht.
»Eines Tages wird die Tonelli-Firmengruppe dir gehören und ich werde dafür sorgen, dass der Vorsitz nicht an einen Schwächling geht.«
Michael schluckte. Er wusste, welcher Sermon nun folgen würde, vermied es aber tunlichst, einen Ton von sich zu geben.
»Als ich die Firma gegründet habe, wollte die Konkurrenz mich augenblicklich vom Markt drängen. Sie schnappten mir die Aufträge nur so vor der Nase weg und unterboten jeden Preis.« Er schlug mit der Faust auf den Tisch. »Ich habe nicht gezetert wie ein altes Weib. Ich habe mir etwas einfallen lassen, egal, wie übermächtig der Feind war.«
Die Blütenmuster des Teppichs begannen ineinanderzufließen. Aber ich habe mich doch gewehrt, dachte Michael. Trotzdem hat Alex mir die Nase eingeschlagen. Warum verstehst du das denn nicht? Ich bin doch viel kleiner.
»Kampfgeist ist das Zauberwort.« Er hob die Stimme und spie das Wort förmlich auf den Tisch. »Kampfgeist! Ich habe mir Großvaters klappriges Fahrrad geschnappt und mir einen Sack voll Steine geladen. Dann bin ich durch die Stadt gefahren und habe reihenweise Fenster eingeschmissen. Reihenweise, sage ich dir.«
Krampfhaft versuchte Michael, das Zittern seiner Hände zu verstecken. Er klammerte sich fester an das Taschentuch, als wäre es ein Damm gegen das wogende Meer in seinen Augen, das versuchte hinauszustürzen.
Die folgenden Worte ließ Tonelli auf der Zunge zergehen wie ein Sahnebonbon: »Angebot und Nachfrage, Junge. Die Aufträge kamen wie von allein. Massenweise. Und rate mal, wer liefern konnte, weil er nicht die Auftragsbücher mit schnödem Kleinkram voll hatte, an dem nichts zu verdienen war. Sie haben sich ihr eigenes Grab geschaufelt, weil sie ihre Produktion damit verstopft haben.« Er grinste. »Sie hatten mich fertigmachen wollen und ich habe am Ende obsiegt.« Er hob den Zeigefinger wie ein Mahnmal in die Luft. »Und wie habe ich das gemacht? Wie, Junge?«
»Durch List und Tücke«, flüsterte Michael die Worte, die er schon gefühlte tausend Mal gesprochen hatte.
»Richtig. Durch List und Tücke. Du musst die Züge deiner Gegner voraussehen, sie dir zunutze machen und dann handeln.« Quentin Tonelli beugte sich in seinem Ledersitz vor und fixierte ihn. »Handeln! Nicht davonlaufen!«
»Ja, Vater.« Michael schluckte den Kloß hinunter, der sich in seinem Hals gebildet hatte. Er hatte die Augen weit geöffnet, hoffte verzweifelt, die Tränen mochten eintrocknen.
Tonelli lehnte sich zurück, seine Züge wurden weicher. Die Pause dehnte sich aus. Das Ticken der Standuhr dröhnte in Michaels Ohren. Endlich schloss sein Vater mit den Worten: »Jetzt geh zu deiner Mutter. Sie freut sich, dass du wieder zurück bist.«
Michael nickte, widerstand jedoch der Versuchung aufzuspringen. Stattdessen sagte er: »Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe, Vater.«
Quentin Tonelli brummte.
Michael glitt vom Stuhl und ging hinaus. Erst als er die Tür hinter sich fest verschlossen hatte, wischte er sich die Tränen aus den Augen. Er würde nicht weinen. Heute nicht.
Heute nicht, dachte Michael und sein Blick blieb an den aufgestapelten Kisten hängen. Sie waren vollgestopft mit Unterlagen, die vom Leben und Wirken des großen Quentin Tonelli Zeugnis ablegten. Michael wusste, dass er sich mit seinem Erbe auseinandersetzen musste, doch bisher hatte er sich erfolgreich dagegen gewehrt. Der Aktenturm stand seit dem plötzlichen Herztod seines Vaters unangetastet am selben Fleck, sah aus wie der mahnend erhobene Zeigefinger des alten Herrn und begann Staub anzusetzen wie die Erinnerungen an ihn. Die von ihm geschaffene Maschinerie lief, indessen gut geölt, in den fähigen Händen des Geschäftsführers weiter. Glas wurde bestellt, produziert und ausgeliefert und das ohne nennenswerte Konkurrenz. Es gab zwar hin und wieder einige Emporkömmlinge, die versuchten, am Lack der Firma zu kratzen, doch hinterließen diese hochstudierten Hohlköpfe lediglich einen Schmierfilm ihrer Unfähigkeit und verschwanden so schnell wieder in der Versenkung, wie sie gekommen waren.
Michaels Sorge galt einzig und allein seinem Gewissen, das ihn immer noch glauben machen wollte, seinem alten Herrn etwas schuldig geblieben zu sein.
Er schüttelte den Kopf und klappte energisch seinen Laptop zu. Nach kurzer Suche entdeckte er seinen Schlüsselbund, der verwaist hinter einem Papierstapel ruhte, raffte ihn vom Schreibtisch und lenkte sich alsdann mit Gedanken an das bevorstehende Treffen ab. Es war schon seit einer guten Stunde im Gange. Er musste sich sputen.
Auf das Äußerste gespannt, welche Menschen sich hinter den Nicknamen verbargen, die ihm häufig in den Logbüchern begegnet waren, ging er um den Schreibtisch herum und verließ eilends das Büro. Vor allem interessierte ihn ein bestimmter Cacher: das Phantom, Sammaël.
Wie er es auch anstellte, er verpasste ihn stets um Haaresbreite. Ob Standardcache oder Schwierigkeitsgrad fünf. Sammaël loggte Gold. Den ersten Fund, FTF, gab es für Michael nie. Das ging ihm mittlerweile gehörig auf die Nerven. Was ihn jedoch noch mehr wurmte, war, dass er bisher nicht in der Lage gewesen war, einen Cache zu loggen, den Sammaël persönlich ausgelegt hatte. Der Typ war auch als Owner nicht zu toppen. Die Rätsel, hinter denen sich die Cachekoordinaten verbargen, waren knifflig. Der Typ jagte sie nicht nur durch die Enigma, sondern verschlüsselte diese zusätzlich noch auf alle erdenklichen Arten. Runenschrift, Akkadisch, ägyptische Hieroglyphen; all diese Dinge waren ihm schon im Listing zu Sammaëls Caches begegnet. Es sah ganz so aus, als wollte er um jeden Preis verhindern, dass ein Anfänger sich an seinen Geocaches vergriff.
Elitär, dachte Michael, als er die geschwungene Treppe ins Erdgeschoss hinabstieg.
Anders hätte er es nicht ausdrücken können. Dieser Umstand verletzte ihn in seinem Stolz, wenn er daran dachte, wie weit er schon gekommen war, seit er mit dem Geocachen begonnen hatte. Sie beide, sollte er sagen.
Er war inzwischen in der mit sandfarbenem Marmor ausgelegten Halle angelangt und ging auf das Eingangsportal zu.
Daran wollte er gar nicht erst zurückdenken. Es erfüllte ihn mit einer gewissen Genugtuung, dass Geopapst sich an Sammaëls Caches ebenso die Zähne ausbiss. Bisher war zumindest noch keiner in seiner Statistik aufgetaucht. Wer würde das Rennen machen? Es hieß »Mysthunter gegen Geopapst«. Wie immer.
Er schnappte sich den Trekkingrucksack, den er noch vor wenigen Stunden an eine der Säulen gelehnt hatte, und kontrollierte kurz, ob sein Equipment komplett war. Dann schulterte er ihn und verließ die Villa Auwald.