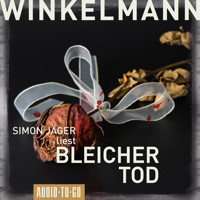9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf den Gleisen liegt ein Mädchen. Das jämmerliche Kreischen von Metall auf Metall. Ein zerstörter Körper. Unmengen an Blut. Ein Selbstmord? Die 15-jährige Kathi war Andreas Winkelmanns Lieblingsnichte. Der Thrillerautor kann nicht glauben, dass sich das lebenslustige Mädchen das Leben genommen hat, und macht sich auf die Suche nach Hinweisen. Auf ihrem Computer findet er seltsame Videos. Videos, die zeigen, dass Kathi verfolgt wurde. Die Spur führt immer tiefer ins Netz hinein, zu immer grausameren Videos. Worauf hat sich Kathi da eingelassen? Und in wessen Hände ist sie dabei geraten? Als Andreas Hinweise auf eine Webseite namens Deathbook entdeckt, ahnt er, dass Kathi ein tödliches Spiel gespielt hat – und dass sie nicht die Einzige war. Denn wer einmal in die Fänge des Deathbook geraten ist, den lässt es nicht mehr los … «Deathbook» erschien zuerst als digitaler, interaktiver Serien-Thriller in 10 Episoden. Dieses E-Book ist eine vom Autor ergänzte reine Textfassung, mit zahlreichen neuen Passagen. Hochspannung garantiert!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Andreas Winkelmann
Deathbook
Thriller
Über dieses Buch
Auf den Gleisen liegt ein Mädchen. Das jämmerliche Kreischen von Metall auf Metall. Ein zerstörter Körper. Unmengen an Blut. Ein Selbstmord?
Die 15-jährige Kathi war Andreas Winkelmanns Lieblingsnichte. Der Thrillerautor kann nicht glauben, dass sich das lebenslustige Mädchen das Leben genommen hat, und macht sich auf die Suche nach Hinweisen.
Auf ihrem Computer findet er seltsame Videos. Videos, die zeigen, dass Kathi verfolgt wurde. Die Spur führt immer tiefer ins Netz hinein, zu immer grausameren Videos. Worauf hat sich Kathi da eingelassen? Und in wessen Hände ist sie dabei geraten? Als Andreas Hinweise auf eine Webseite namens Deathbook entdeckt, ahnt er, dass Kathi ein tödliches Spiel gespielt hat – und dass sie nicht die Einzige war. Denn wer einmal in die Fänge des Deathbook geraten ist, den lässt es nicht mehr los …
«Deathbook» erschien zuerst als digitaler, interaktiver Serien-Thriller in 10 Episoden. Dieses E-Book ist eine vom Autor ergänzte reine Textfassung, mit zahlreichen neuen Passagen. Hochspannung garantiert!
Vita
Andreas Winkelmann, geboren im Dezember 1968 in Niedersachsen, ist verheiratet und hat eine Tochter. Er lebt mit seiner Familie in einem einsamen Haus am Waldesrand nahe Bremen.
Er studierte Sport in Saarbrücken, war vier Jahre Soldat und arbeitete unter anderem als Fitnesslehrer, Taxifahrer, Versicherungsfachmann und freier Redakteur, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete.
Seine Leidenschaft für unheimliche Geschichten entwickelte er bereits in jungen Jahren. Mit seinen Büchern «Blinder Instinkt», «Bleicher Tod» und «Wassermanns Zorn» eroberte er die Bestsellerlisten.
Wenn er nicht gerade in menschliche Abgründe abtaucht, geht er einer weiteren Leidenschaft nach, dem Outdoorsport. Er überquerte bereits zweimal zu Fuß die Alpen, steigt dort auf die höchsten Berge und in die tiefsten Canyons oder fischt und jagt mit Pfeil und Bogen in der Wildnis Kanadas.
Erfahren Sie mehr über Andreas Winkelmann auf www.facebook.com/andreas.winkelmann.schriftsteller oder im Internet: www.andreaswinkelmann.com
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2013
Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Hamburg,
nach einem Entwurf von © glorienschein
Coverabbildung Gregor Middendorf
ISBN 978-3-644-21321-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Dieses Buch widme ich Gregor. Für unheimliche Nächte im Shining-Hotel, lange nächtliche Spaziergänge durch den Finsterwald und dafür, dass er mit mir auf den Berg gestiegen ist.
Prolog
Im Netz bin ich überall und jederzeit, bin Bedrohung und Erfüllung zugleich. Ich bin in den Leitungen, Verbindungen und Schaltkreisen aus Kunststoff, Silizium und Kupfer, schwinge als millionenfaches Raunen und Wispern ungebunden durch kabellose Sphären, finde meinen Weg und mein Ziel in einer Dimension, die der Mensch nicht versteht. Unwissentlich hat er mir einen virtuellen Raum und eine endlose Zeit geschaffen, in der ich allgegenwärtig sein kann.
Technik hat mich nicht domestiziert, sondern befreit.
Eingesperrt ist nur der Mensch, in dem von ihm selbst geschaffenen Raum. Und darin ist Sterben so einfach wie ein Mausklick. Jemanden zu finden, der stirbt, so einfach wie ein Download. Wenn nichts mehr geheim ist, wenn die digitale Welt der realen ihre Verstecke und Rückzugsräume raubt, dann liegt das Leben der Menschen offen wie Eingeweide in einem aufgeschlitzten Bauch.
Wo bist du heute um acht? Ich weiß es, bevor du selbst dort bist. Wo wirst du in einer Woche sein, wer ist bei dir, zu welcher Minute bist du an welchem Ort allein, schutzlos, ausgeliefert? Ich weiß es, bevor du die Gefahr auch nur ahnst. Welche Wünsche und Sehnsüchte treiben dich? Du vertraust sie mir an, bevor sie dir selbst bewusst sind. Datenschutz. Privatsphäre. Vergiss es! Du bist längst durchschaut, ich habe alles, was ich brauche. Ich bin schon lange nicht mehr nur auf den Friedhöfen und in den Mausoleen, nicht in den Sterbestationen und Altenheimen. Ich habe die Pest- und Choleraenklaven hinter mir gelassen und den alten Schlachtfeldern den Rücken gekehrt.
Ich bin das Raunen und Rauschen im Netz. Ich bin die Eins zwischen den Nullen, der Anhang, der Download, die Datei.
Ich bin der Tod 3.0.
Episode 1
Zwei stählerne Adern zerteilten die Schwärze. Ihre Oberflächen, blank poliert von Tausenden Tonnen rasender Last, glänzten matt im schwachen Licht des halben Mondes, so als flösse silbernes Blut hindurch. Sie zogen sich endlos dahin, eingebettet in eine zehn Meter breite grauschwarze Schneise. Wie scharfgeschnittene Klüfte ragte der Wald an ihren Rändern auf und schirmte den leblosen Todesstreifen ab. Keine Geräusche, keine Blicke drangen hinein. Stille.
Aber nur scheinbar.
Ein feines Vibrieren strömte bereits durch die glänzenden metallenen Adern, genau wie Blut durch menschliche Venen. Es sickerte in den Boden, in die kapillarfeinen Wurzeln der nahestehenden Bäume, drang durch das Holz in die Kronen empor und ließ Blätter und Nadeln schwingen. Kaum wahrnehmbar.
Aber das Mädchen spürte es.
Ihr Blick zuckte von rechts nach links, immer wieder und immer schneller. Die großen, von langen Wimpern eingefassten Augen suchten etwas, fanden es aber nicht. Tränen tropften aus den Augenwinkeln die Wangen hinab. Sie ließen die Wimperntusche zerfließen, und es sah aus, als verließe dunkles, zähes Blut den Kopf des Mädchens durch die Augenhöhlen.
Mit dem Nacken lag sie auf dem einen Schienenstrang, mit den Oberschenkeln auf dem anderen, dazwischen ihr schmaler Körper auf dem Schotterbett, die Arme locker an den Seiten, die Finger auf den schmutzigen Steinen. Sie war gekleidet in eng anliegende Jeans, wadenhohe braune Stiefel und eine kurze schwarze Jacke. Ihr Brustkorb hob und senkte sich unter kurzen, raschen Atemzügen.
Aus Westen näherten sich drei Augen. Kreisrunde, glimmende Kugeln, die in der Nacht schwebten. Diese Augen und das feine Vibrieren in den Stahlsträngen gehörten untrennbar zusammen. Das Mädchen wusste das, und ihre Atmung wurde schneller und schneller. Sie hechelte jetzt wie ein Hund.
Die Atmosphäre im Todesstreifen lud sich mit der Energie des herannahenden Kolosses auf. Vielleicht verlieh diese Energie dem Mädchen zusätzliche Kraft, vielleicht wurde ihre Angst übermächtig, denn sie wandte unter äußerster Anstrengung den Kopf nach rechts, den drei Augen entgegen. Sie waren größer geworden in den vergangenen Sekunden und wuchsen weiter heran. Aus dem Glimmen wurde kräftiges gelbes Licht, das auf die Stahlstränge fiel und dem Koloss vorauseilte. Die Erde begann zu beben.
Das Mädchen schwitzte stark. Keuchend kämpfte sie gegen den Fluchtreflex an. Doch sie blieb liegen und ließ das metallene Ungeheuer kommen. Blickte ihm in die Augen, die größer und heller wurden und den Todesstreifen mit Licht fluteten. Licht, das den jugendlichen Körper des Mädchens aus der Dunkelheit riss.
Ohrenbetäubender Lärm erfüllte die Luft, die Schienenstränge schüttelten den Körper durch. Ganz sacht bewegten sich die Finger des Mädchens, ertasteten den scharfkantigen Schotter, schienen sich daran festhalten zu wollen. Ihr Gesicht verzerrte sich zu einer grauenvollen Maske. In ihren letzten Sekunden ertrug sie den Anblick nicht mehr und kniff die Augen zusammen. Den Mund aber riss sie weit auf, und vielleicht verließ jetzt doch ein Schrei ihre Lippen. Hören konnte ihn niemand.
Als der Lokführer das Hindernis auf den Schienen entdeckte, leitete er sofort die Bremsung ein, doch es war zu spät. Der Körper verschwand unter seiner Lok, als wäre er gar nicht da gewesen. Kein Rumpeln oder Zittern, nur das jämmerliche Quietschen von Metall auf Metall wie das Geschrei einer zänkischen alten Hexe. Ein wenig Blut spritzte auf die ohnehin schon schmutzige Frontscheibe. Der Lokführer klammerte sich mit beiden Händen an die Haltegriffe, um nicht nach vorn gegen die Instrumententafel zu kippen, und starrte auf die rotbraunen Flecken. Dann wandte er das Gesicht ab und kämpfte gegen den Würgereflex an.
Durch die Seitenscheibe meinte er, im dunklen Unterholz des nahen Waldes schwarze Schatten umherhuschen zu sehen. Wild vielleicht, das vor dem Lärm flüchtete.
Aber er sah auch ein bläuliches Licht, wie von Glühwürmchen. In anderthalb Meter Höhe zuckte es unruhig umher.
Als der lange Güterzug endlich stand, hatte er das Gesehene bereits wieder vergessen.
Dieses Bild von Kathi mochte ich besonders. Darauf sitzt sie in ihrem Zimmer vor der vertäfelten Wand und hält ihre schwarzweiße Katze «Lady». Dem Betrachter dieses Fotos drängt sich unweigerlich der Eindruck auf, von zwei Katzen angeschaut zu werden. Die Aufnahme wird von den Augen der beiden beherrscht. Ladys sind weit geöffnet und von intensiver grüner Färbung, mit den katzentypischen, aufrecht stehenden Pupillen.
Kathis Augen sind ebenfalls grün. Es gab nicht viele Teenager mit solchen Augen, voller Neugierde und dem unbändigen Drang, alles zu erfahren, und ich stellte mir nicht zum ersten Mal die Frage, ob an der hinduistischen These der Wiedergeburt etwas dran sein könnte – so viel Weisheit lag darin.
In diesem Moment wollte ich daran glauben.
Denn Kathi war tot.
Ich ließ das vor Lebendigkeit vibrierende Bild auf mich wirken und spürte, wie mir der Hals eng wurde. In meiner Familie haben die Männer nie viel geweint, und ich war da keine Ausnahme. Kathi war vor gerade mal drei Tagen gestorben, und noch hielten der Schock und die bohrenden Fragen nach dem Wie und Warum die Tränen zurück. Ich konnte vor lauter Grübelei nicht mehr schlafen – schon gar nicht schreiben. Warum, warum, warum? Keine Erklärung, von niemandem. Und was die Polizei zu berichten hatte, war absolut unglaubwürdig. Ich war zwar nur Kathis Onkel, aber ich wusste es besser. Nie und nimmer hatte es sich so zugetragen.
Sie war häufig bei mir gewesen, hatte sich mir anvertraut, wenn es in der Schule oder zu Hause mal wieder Ärger gegeben hatte. Zu behaupten, ich hätte sie besser gekannt als mein Bruder und seine Frau, wäre vermessen, aber ich konnte in vielen Dingen lockerer sein als Kathis Eltern, und Kathi vertraute mir. Ach, verdammt … die Enge im Hals verstärkte sich, und ich spürte, wie meine Mundwinkel zu zittern begannen. Vielleicht hätte ich heute nicht herkommen sollen. Vielleicht hätte ich das Foto nicht ausdrucken und in den schlichten Holzrahmen stecken sollen. Kathi hatte es mir erst vor ein paar Wochen per Dateianhang zugeschickt. Das war kurz nach ihrem Praktikum bei mir gewesen. Sie hatte mich angefleht, den Zukunftstag der Schule bei mir verbringen zu dürfen. Ihre Lehrerin hatte nichts dagegen gehabt, auch wenn es ein wenig ungewöhnlich war. Und ich gebe zu, ich fühlte mich geschmeichelt. Sie hatte gesagt, sie würde in der Schule mit mir angeben, und ich bezichtige jeden der Lüge, der behauptet, so etwas würde nicht der Eitelkeit schmeicheln.
Kathi war es nicht darum gegangen, diesen Praktikumstag möglichst bequem irgendwie herumzukriegen. Ich wusste ja schon länger von ihrer Leidenschaft für Bücher und ihrem Wunsch, selbst etwas zu schreiben. Vielleicht rührte auch daher unsere enge Verbundenheit.
Jetzt kamen die Tränen. Sie taten weh, und ich schämte mich ihrer nicht. Die ersten tropften auf Kathis Bild. Ich wischte sie mit dem Ärmel meines Pullovers fort und sah genauer hin. Kathi strahlte nicht nur mit ihren Augen, sondern mit dem ganzen Gesicht. Sie hatte einen breiten Mund, fast wie Julia Roberts, mit zwei Reihen weißer, gerader Zähne. Einzig die beiden oberen Schneidezähne waren ein wenig länger, aber nicht viel, und diese kleine Unregelmäßigkeit machte sie nur noch hübscher. Aus diesem Mädchen wäre eine Schönheit geworden, die viele Jungs um den Verstand gebracht hätte.
Davon war nichts mehr übrig.
Ich sah zum Sarg hinüber. Er stand auf zwei Holzböcken im halbrunden Anbau der Kapelle zwischen den beiden bodentiefen Buntglasfenstern. Es fiel kaum Licht herein, die Dämmerung hatte bereits eingesetzt. Ich war absichtlich so spät gekommen. Morgen würde Kathi beerdigt werden. Viele Menschen würden ihr letztes Geleit gewähren, und das war kein Rahmen, in dem ich Abschied nehmen konnte. Dafür musste ich heute hier mit ihr allein sein.
Dort lag sie also, in dieser aufwendig gearbeiteten Holzkiste. Trotz all der schmückenden Messingbeschläge und Schnitzereien war es doch nichts weiter als eine Holzkiste, die irgendwann im Erdboden verrotten würde. Genau wie Kathis Körper.
Der lange schwere Güterzug hatte nicht viel von ihm übrig gelassen.
Einige Teile waren gar nicht gefunden worden. Tiere hatten sie wohl in den Wald getragen und gefressen. Manches war einfach zermalmt und vom Regen in den Boden gewaschen worden. Deshalb hatte ich das Foto mitgebracht. Ich kannte meine Phantasie, mir war klar gewesen, wenn ich den Sarg betrachtete, würde ich mir automatisch diesen zerstörten Körper vorstellen. Ich konnte das nicht abstellen, nicht einmal bei Kathi. Es war Teil meines Ichs. Fluch und Segen zugleich. Ich lebte gut davon. Und jetzt fragte ich mich zum ersten Mal, ob das nicht schäbig war.
Kathi hatte bei mir stets elterliche Gefühle ausgelöst, und es hatte mir gutgetan, dass sie mich ab und an gebraucht hatte.
Aber war ich wirklich für sie da gewesen?
Ich erinnerte mich an ihren letzten Anruf, drei Tage vor dem Unglück. Wenn ich schrieb, befand ich mich oft «im Tunnel». Ich nannte diesen Zustand so, weil ich mich dann abkapselte und nichts von der Außenwelt mitbekam. Ich ging dann nicht einmal ans Telefon. Nur bei meinem Agenten, zwei guten Freunden und eben Kathi machte ich eine Ausnahme. Aber wenn ich im Tunnel war, war ich kein guter Zuhörer.
Bei ihrem letzten Anruf hatte mich Kathi gefragt, ob ich noch Kontakt zu diesem Hacker hätte. Wahrscheinlich hatte sie mal wieder Probleme mit ihrem Computer. Ich hatte ihr versprochen, mich darum zu kümmern. Diesem Versprechen war ich bis heute nicht nachgekommen.
Ich stand von dem harten Besucherstuhl auf, trat vor den Sarg hin und stellte das Bild vorn auf den Deckel des Sarges. Von dort aus würde Kathi morgen während der Beerdigung die Trauergäste anlächeln. Genau so sollten alle sie in Erinnerung behalten. Keinen Moment sollten sie daran denken, was der Güterzug aus ihr gemacht hatte. Es reichte, wenn die Bilder meinen Kopf füllten.
«Das kann nicht die Wahrheit sein», sagte ich leise. In der stillen engen Kapelle klangen meine Worte trotzdem laut.
«Niemals hättest du so etwas getan.»
Ich strich mit dem Daumen über das Foto, über ihr Gesicht.
«Wenn es etwas herauszufinden gibt, ich schwöre dir, ich finde es heraus. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue.»
Die basslastige Musik klang über die neuen interaktiven Lautsprecher und den übergroßen Subwoofer besonders intensiv. Er hörte die Musik nicht nur, er spürte sie. In seinen Knochen, seinen Muskeln, seinem Kopf. Sie füllte ihn aus und ließ ihn sich lebendig fühlen. Alles in ihm vibrierte. Und genau das brauchte er jetzt.
Vor ihm auf dem Bildschirm befand sich das Video-Rohmaterial. Es war eine äußerst filigrane und langwierige Arbeit, jeden einzelnen Frame zu bearbeiten, aber er würde sich niemals mit einem Ergebnis zufriedengeben, bei dem nicht jede Kleinigkeit seinen Vorstellungen entsprach.
Sobald er dieses Video öffentlich machte, würde alle Welt daran herummäkeln und im Nachhinein seinen Stolz und seine Freude zerstören. So war das eben heutzutage. Das Web war zu einer Müllhalde verkommen, in der schmierige Subjekte ohne eigenen Anspruch und ohne Kreativität es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatten, alles zu kritisieren, was andere erschufen. Beurteile, rezensiere, kritisiere, darauf reduzierte sich alles. Die in der Schule verhasste Allmacht der Lehrerschaft mit ihrem staatlich organisierten System von Unterdrückung und Herabsetzung war ins Netz gesickert und hatte es verpestet. Spießigkeit und Intoleranz waren eingezogen, jeder war nur noch daran interessiert, sich über den anderen zu stellen. Freiheit gab es schon lange nicht mehr. Zumindest nicht für die breite Masse.
Er öffnete den nächsten Frame.
Er zeigte ihr Gesicht kurz vor dem Aufprall.
Wegen der schlechten Lichtverhältnisse war die Aufnahme nicht besonders gut, und er war auch nicht wirklich nah dran gewesen. Schon fragte er sich, ob es überhaupt eine gute Idee gewesen war, es auf diese Art zu tun. Da war zu viel Schnelligkeit, zu viel Energie im Spiel gewesen. Er hatte nicht die volle Kontrolle gehabt, war nicht Herr der Situation gewesen. Aber wahrscheinlich spielte es für den Erfolg des Videos keine große Rolle. Die User würden sich darauf stürzen wie die Maden auf rohes Fleisch, das wusste er. Allein schon wegen des vielen Blutes und der abgetrennten Körperteile.
Doch er selbst hatte etwas anderes erhofft. Je länger er durch die Frames zappte, desto größer wurde seine Enttäuschung. Er fand Angst und Panik in ihrem Gesicht, sah Zerstörung und Tod – aber nicht das, wonach er suchte.
Bevor aus Enttäuschung Ärger werden konnte, öffnete sich auf dem zweiten Bildschirm ein Chat-Fenster, und eine Nachricht erschien.
Absender war ein gewisser TommyX5.
Wir hatten seit einigen Tagen gutes Wetter, und es hielt auch am Tag der Beerdigung an. Nur ein paar wenige weiße Wolken standen am freundlichen blauen Himmel. Ich fand das unpassend, denn in mir sah es so düster aus wie selten. Ich wünschte mir Hagel, Blitz und Donner – und einen pechschwarzen Himmel.
«Wie schön», sagte die alte Dame neben mir, als wir die Kapelle betraten.
Ich antwortete nicht und sah sie nur fragend an.
«Na, das Wetter», klärte sie mich auf und wies mit dem Finger nach oben. «Es ist so, wie Kathi war. Sonnig und verspielt. Das ist doch schön … nicht wahr.»
Das letzte Wort klang zittrig. Die alte Dame wandte ihr Gesicht ab, zog ein Taschentuch hervor, eines dieser unmöglichen Dinger aus Baumwolle, schnäuzte sich lautstark hinein und schluchzte auf.
Ich blieb im Eingang zur Kapelle stehen und sah ihr nach. Ich kannte die Frau nicht, hatte sie nie zuvor gesehen, und doch würde sie mir ewig in Erinnerung bleiben. Denn sie hatte recht mit dem Wetter. Es passte zu Kathi. Anders durfte es gar nicht sein.
Jemand stupste mich zaghaft von hinten an.
«Nur Mut, auch das geht vorbei», sagte eine warme weibliche Stimme. «Sie sind der Schriftsteller, oder?»
Ich nickte. Sie zog mich mit sich, und wir suchten uns zwei Plätze in der vierten Reihe. «Und wer sind Sie?», fragte ich.
«Astrid Pfeifenberger, Kathis Klassenlehrerin», erwiderte sie.
Sie war sicher nicht älter als vierzig, hatte schulterlanges braunes Haar und braune Augen. Wie ich – bis auf die Haarlänge natürlich.
Wir ließen uns nebeneinander auf der kalten Holzbank nieder. Ihre Schulter berührte meine. Normalerweise meide ich eine so große Nähe zu fremden Personen, aber heute war sie mir nur recht. Außerdem war mir Frau Pfeifenberger sofort sympathisch.
Nur das Rascheln von Kleidung und das Schaben von Sohlen auf dem Betonboden war zu hören, hie und da murmelte jemand etwas. Die Kapelle füllte sich, die Trauergäste suchten sich still ihre Plätze. Die Stimmung war bedrückend, einengend, sie nahm mir den Atem.
«Kannten Sie Kathi gut?», fragte ich die Lehrerin.
Sie sah mich von der Seite an und zuckte mit den Schultern.
«Ich dachte schon, ja, aber … na ja, vielleicht war das auch ein Trugschluss. Mädchen in dem Alter können sehr verschlossen sein.»
«Kathi war aber kein verschlossenes Mädchen», entgegnete ich etwas zu laut und zog damit Blicke auf mich. Ich beugte mich zu Frau Pfeifenberger hinüber. Sie roch dezent nach einem teuren Parfum. «Eher im Gegenteil, aber das müssten Sie als ihre Klassenlehrerin doch wissen.»
Sie presste die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen und nickte. War ich ihr zu nahe getreten, hatte sie vielleicht sogar verletzt? Es tat mir auf der Stelle leid. Diese verdammte Wut. Sie machte mich ungenießbar.
«Glauben Sie denn, dass Kathi Selbstmord begangen hat?», raunte ich der Lehrerin zu. Etwas Besseres fiel mir nicht ein. Mein ganzes Denken drehte sich seit Tagen nur um diese eine Frage.
Frau Pfeifenberger musterte mich. Es war ein wenig unangenehm, so direkt angesehen zu werden, aber ich hielt ihrem Blick stand. Schließlich schüttelte sie mit einer kaum wahrnehmbaren Bewegung den Kopf.
«Nein», sagte sie leise. Ihre Stimme klang jetzt tränenerstickt. «Ich bilde mir ein, über eine gute Menschenkenntnis zu verfügen, und ich kann das einfach nicht glauben.»
Zwei weitere Personen schoben sich in unsere Bankreihe, wir mussten aufrücken. Die Lehrerin kam mir noch näher, unsere Oberschenkel lagen nun aneinander. Ich konnte ihre Körperwärme spüren. Ein offenerer Mensch als ich hätte ihr in diesem Moment vielleicht einen Arm um die Schultern gelegt, um sie zu trösten. Ich tat es nicht. Wie immer in solchen Situationen zog ich mich zurück in meinen Schildkrötenpanzer.
«Sie … Ihnen stand Kathi doch nahe», sagte Frau Pfeifenberger und wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. «Das habe ich gespürt, als Kathi wegen des Zukunftstages gefragt hat.»
Sie sprach es nicht aus, aber es war auch so klar, was sie wissen wollte: Haben Sie nichts bemerkt?
Ich schüttelte den Kopf. «Schon … ja … aber da war nichts … ich habe keine Veränderung bemerkt. Zwar hatte ich sie zwei oder drei Wochen nicht gesehen, aber so etwas kommt ja nicht über Nacht, nicht einmal bei Teenagern, oder?»
Die Lehrerin schüttelte den Kopf.
«Nein, nicht einmal bei Teenagern. Ich … wir sind alle fassungslos … das ist so … so unbegreiflich.»
«Und Kathis Freundinnen? Was sagen die dazu?», wollte ich wissen.
«Nichts bisher. Ich habe in der Klasse versucht, ein Gespräch darüber zu führen, aber der Schock ist einfach zu groß. Nur Theresa, Kathis beste Freundin, hat da so eine Bemerkung fallenlassen.»
«Was für eine Bemerkung?», fragte ich viel zu laut und fing mir den bösen Blick eines Mannes in der Bankreihe vor mir ein. Viel fehlte nicht, und ich hätte ihm den Stinkefinger gezeigt.
Astrid Pfeifenberger wollte antworten, doch in diesem Moment begannen die Glocken zu läuten, und der Pastor betrat die Kapelle. Ihm folgten Iris und Heiko, Kathis Eltern. Sie stützten sich gegenseitig, fanden aber beide nicht die Kraft aufzusehen. Zusammen mit Kathis Großeltern nahmen sie in der ersten Bankreihe Platz. Auch für mich war dort ein Platz reserviert, doch hier hinten fühlte ich mich wohler. Ich glaubte, Iris aufschluchzen zu hören. Sofort zog sich mein Magen zusammen, und der Hals wurde mir eng.
Die Trauerandacht begann.
«Angeblich hat Kathi sich in ihren letzten Monaten für den Tod interessiert.»
Astrid Pfeifenberger stand mit mir auf der anderen Seite der Friedhofsmauer im Schatten einer großen Rotbuche. Der Strom der Trauergäste zog in mehr als zwanzig Meter Entfernung in Richtung Parkplatz. Ein Wagen nach dem anderen fädelte sich auf die Bundesstraße ein und verschwand. Die meisten würden sich im Gasthaus wiedertreffen, zum Leichenschmaus. Ich fand die Tradition, nach einer Beerdigung Kaffee und Butterkuchen zu sich zu nehmen, einfach geschmacklos und würde mich dort nicht blicken lassen.
«Für den Tod», wiederholte ich. «Wer sagt das?»
«Ihre beste Freundin, Theresa.»
«Und wie soll ich mir das vorstellen?»
Astrid Pfeifenberger schüttelte den Kopf. «Ich weiß es nicht. Theresa wollte sich nicht weiter dazu äußern. Sie war vollkommen aufgelöst. Ich hatte den Eindruck, sie fürchte sich vor etwas. Aber ich kann mich auch getäuscht haben. Mir ging es ja selbst nicht besonders gut.»
Ich nickte. Ja, das konnte ich gut verstehen. Seit ich von Kathis Tod erfahren hatte, lebte ich in einem Kokon, der die beschissen banalen Dinge des Alltags von mir fernhielt und mein Denken beträchtlich einschränkte. Es war fast so, als wäre eine Hälfte meines Ichs abgeschaltet worden. Ich lief sozusagen im Notfallmodus. Und wenn es Frau Pfeifenberger ähnlich ging, konnte sie sich sehr wohl getäuscht haben.
Aber ich war jetzt neugierig geworden. Ich beobachtete die abfahrenden Autos und überlegte mir die nächste Frage.
«Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich in die Schule käme und mit ein paar von Kathis Klassenkameradinnen spräche?»
Die Lehrerin zog die Augenbrauen zusammen. Mir fiel auf, dass ihre Wimperntusche verlaufen war. Sie musste während der Zeremonie am Grab geweint haben.
«Wozu?»
«Weil ich wissen will, was passiert ist. Kein Mensch kann mir erzählen, dass Kathi den Freitod gewählt hat. Das stimmt einfach nicht.»
Da lag schon wieder Wut in meiner Stimme, und ich befürchtete, die Lehrerin damit zu verschrecken. Aber sie schaute mich intensiv an und nickte dann.
«Okay. Aber nur wenn die Mädchen freiwillig mit Ihnen reden. Außerdem gibt es in der Schule etwas, das Sie sehen sollten.»
Anima Moribunda
Was suchst du, TommyX5?
TommyX5
Wer bist du denn?
Anima Moribunda
Jemand, der dir helfen kann.
TommyX5
Was ist das für ein bescheuerter Nickname? Anima … was?
Anima Moribunda
Das kannst du später herausfinden. Das Internet hat auf alles eine Antwort. Ich hätte auch eine für dich.
TommyX5
Wüsste nicht, dass ich dich etwas gefragt hätte. Wie kommst du überhaupt in diesen Chat?
Anima Moribunda
Bin Member, und deine Posts sind öffentlich.
TommyX5
Echt! Scheiße, Mann, das wusste ich nicht.
Anima Moribunda
Du langweilst mich, TommyX5. Sag mir, was du suchst, oder ich bin weg.
TommyX5
Was ich suche … ich hab von diesem Video gehört.
Anima Moribunda
Aha.
TommyX5
Da soll man alles sehen können, ich meine, wirklich alles, ohne Schnitt oder Verpixelung oder so ’n Scheiß, ich find’s nur nicht.
Anima Moribunda
Ich weiß, ich habe es gesehen. Ich kann dir versprechen, es ist echt krass. Mehr geht nicht.
TommyX5
Verdammt, Alter, wo finde ich das Teil?
Anima Moribunda
Ist nicht für jeden gedacht.
TommyX5
Was willst du dafür?
Anima Moribunda
Was ich will? Das verrate ich dir vielleicht später. Aber willst du das wirklich sehen?
TommyX5
Klar, Alter, zeig her das Gemetzel, ich will jemanden krepieren sehen.
Anima Moribunda
Dann sieh mal hier nach. Aber beeil dich. Ist nicht lange online.
Ich wartete in der Aula des Gymnasiums am Goetheplatz auf Kathis Klassenlehrerin Astrid Pfeifenberger. In fünf Minuten würde ihre Unterrichtsstunde zu Ende sein, sie hatte versprochen, mich danach vor der Vitrine mit den ausgestopften Ratten zu treffen. Sie waren das Ergebnis einer Kunstprojektgruppe, die sich mit dem Tod befasst hatte – mit den Mythen, die sich um ihn rankten, seinen Erscheinungsformen und seinem Einfluss auf die Menschen. Es verlangte keine große Kombinationsgabe, um zu erahnen, warum Frau Pfeifenberger mich ausgerechnet an dieser Vitrine treffen wollte.
Ich trank von dem Kaffee, den ich mir aus einem der drei Automaten im Treppenhaus gezogen hatte. Er war nicht schlecht, und ich brauchte das Koffein. Ich schlief nicht mehr. Mir wollte einfach keine brauchbare Idee für ein neues Buch einfallen. Es war zum Verzweifeln.
Denn immer wieder driftete ich in Gedanken zu Kathi ab.
Zwei Tage waren seit ihrer Beerdigung vergangen. Natürlich war ich immer noch tieftraurig, aber der Schock war mittlerweile einer unbändigen Wut gewichen. Ich brannte darauf herauszufinden, was meiner einzigen Nichte Kathi widerfahren war. Und sollte sie etwa jemand in den Tod gemobbt haben, würde ich ihn finden, und nicht einmal Gottes Gnade könnte diese Person dann noch retten. Ja, meine Wut loderte, und ich würde Mühe haben, sie vor Astrid Pfeifenberger zu verbergen.
Einen derart zornigen Autor abgründiger Psychothriller würde sie sicher nicht mit ihren Schützlingen sprechen lassen. Ich wunderte mich ohnehin über ihre Bereitschaft, mich zu unterstützen. Sie musste Kathi sehr gemocht haben.
Die Schulglocke läutete. Es war ein angenehmer, tragender Ton, fast wie der einer Domglocke. Nur Sekunden darauf sprangen überall Türen auf, und Schüler und Schülerinnen quollen in die weitläufige Aula. Ich blieb einfach sitzen und beobachtete. Niemand schien von mir besondere Notiz zu nehmen, nur vereinzelt streiften mich Blicke. Die Geräuschkulisse war erstaunlich. Eben noch war es still gewesen, jetzt vernetzten sich Hunderte Stimmen zu einer Flut von Geräuschen und undeutlichen Worten. Lebendigkeit umhüllte mich und schien die Mauern dieses altehrwürdigen Gebäudes von innen heraus sprengen zu wollen. Kathis Tod hatte hier kaum etwas hinterlassen.
Astrid Pfeifenberger kam auf mich zu. Ich war überrascht, dass sie immer noch Schwarz trug. Ich stand auf und schüttelte ihr die Hand.
«Wie geht’s Ihnen?», fragte sie und sah mich wieder mit diesem direkten, intensiven Blick an. Ich schätzte, dass ihre Schüler mit Lügen bei ihr nicht durchkamen.
Ich rang mir ein Lächeln ab und deutete mit dem Daumen auf die Ratten in der Vitrine.
«Die beobachten mich schon die ganze Zeit.»
«Man meint, sie würden noch leben, oder?»
«Ist es das, was Sie mir unbedingt zeigen wollten?»
Frau Pfeifenberger nickte. «Kathi hat in dieser Projektgruppe mitgearbeitet.»
«Haben Sie sie geleitet?»
«Nein, ein Kollege. Franz Altmaier. Ich weiß noch, wie begeistert er von Kathis Engagement war. Sie hat sich von allen Teilnehmern am stärksten engagiert. Die Idee mit den Ratten stammt zum Beispiel von Kathi. Franz meinte, Kathi sei von der Idee fasziniert gewesen, dass der Tod eine ansteckende Krankheit ist. Allerdings war die Arbeit der Projektgruppe schon vor drei Monaten abgeschlossen.»
Für den Tod keine lange Zeit, schoss es mir durch den Kopf, doch ich behielt es für mich.
«Vielleicht hat die Arbeit bei Kathi Spuren hinterlassen», sagte ich stattdessen und betrachtete die Ratten nachdenklich. «Aber ich kann es mir kaum vorstellen. Nicht bei einem so starken, lebendigem Mädchen wie Kathi.»
Astrid Pfeifenberger sah mich direkt an. «Ich verstehe es auch nicht. Vor einer Woche saß sie mir noch gegenüber, in der ersten Reihe, wie immer. Lehrer zu sein ist kein einfacher Job, aber in jedem Jahrgang gibt es einen Schüler oder eine Schülerin, aus der ich meine Motivation, meine Kraft beziehe. In diesem Jahrgang war das Kathi. Jeden Tag. Wenn ich sie angesehen habe, wusste ich sofort, warum ich tue, was ich tue. Und dass es nie vergebens ist.»
Ihre Augen wurden wieder feucht, und in dieser Sekunde nahm ich alle negativen Bemerkungen zurück, die ich je über Lehrer gemacht hatte. Und das waren viele.
Ich räusperte mich.
«Ihr Kollege, der die Projektgruppe geleitet hat …»
«Franz Altmaier.»
«Ja, ob ich mit dem wohl auch sprechen könnte?»
Die Lehrerin zuckte mit den Schultern. «Ich denke schon, aber er ist heute auf einer Fortbildung. Ich frage ihn, wenn er wieder hier ist.»
«Gut, danke. Und die Mädchen. Wollen die mit mir sprechen?»
«Zwei haben sich bereit erklärt. Viola und Theresa. Aber gehen Sie behutsam vor, vor allem Theresa ist noch immer sehr verschlossen, wenn es um Kathi geht. Ich habe mich gewundert, dass sie überhaupt mit Ihnen sprechen will. Sie haben eine Viertelstunde, bevor die beiden zum Sportunterricht müssen.»
Astrid Pfeifenberger hatte recht. Theresa war verschlossen. Außer einem Hallo sagte sie in den ersten fünf Minuten des Kennenlernens gar nichts. War sie vielleicht nur im Klassenzimmer geblieben, um auf ihre deutlich gesprächigere Freundin Viola aufzupassen? Ihre missbilligenden Blicke ließen diese Vermutung jedenfalls zu.
«Ich zeig Ihnen mal was», sagte Viola und tippte flink mit ihren blau lackierten Fingernägeln auf dem Display ihres Smartphones herum. Seit ich hier bei ihnen saß, hatte keines der Mädchen sein Handy auch nur eine Sekunde aus der Hand gelegt. Theresa, nach Astrid Pfeifenbergers Auskunft Kathis beste Freundin, hatte sogar ständig den Blick darauf geheftet. Sie hatte nicht einmal bei der Begrüßung aufgeschaut.
«Hier.»
Viola hielt das Handy so, dass ich den großen Bildschirm sehen konnte. Dort startete gerade ein Video.
«Aber nicht erschrecken», sagte das Mädchen noch. Da war es schon zu spät.
Auf dem Bildschirm erschien Kathi. Erst nur ihr fröhliches, offenes Gesicht, wie immer mit einem verschmitzten Lächeln.
«Hi», sagte sie. Die Tonqualität war erstaunlich gut. «Darf ich euch meine neuen Freunde vorstellen.»
Die Kamera zoomte aus ihrem Gesicht und offenbarte, wen sie mit «neue Freunde» meinte. Rechts und links auf ihren Schultern saßen zwei der ausgestopften Ratten, die ich draußen in der Aula in der Vitrine gesehen hatte.
«Das sind Frank und Dean», sagte Kathi und nickte einmal nach rechts und links. «Mein Ratpack.»
Die Kamera zoomte jetzt auf Frank, der auf ihrer rechten Schulter saß. Ganz nah heran an die schwarzen Augen und die scharfen Schneidezähne.
Aus dem Off sprach Kathi weiter.
«Im Mittelalter galten Ratten als Todesboten, weil sie die Pest übertrugen. Dabei waren sie gar nicht Schuld. Es waren ihre Flöhe, die die Bakterien von der Ratte auf den Menschen übertrugen. Winzig kleine Tiere übertragen noch winzigere Lebewesen auf einen Menschen, und der stirbt daran. Ist es nicht krass, wie wenig es braucht, einen Menschen zu töten? Und ist es nicht faszinierend, welche Möglichkeiten dem Tod zur Verfügung stehen? Ein Bakterium, ein Virus – und schnipp: Weg bist du.»
An dieser Stelle hörte man Kathi mit den Fingern schnippen, und dann war das Video zu Ende.
Viola nahm ihr Handy herunter. «So was hat sie damals, als wir die Projektgruppe hatten, dauernd gemacht. Hat immerzu vom Tod gequatscht und wie faszinierend das alles sei. Kathi ist richtig aufgegangen in dem Projekt und hat sogar die beste Note bekommen.»
«Das war doch nur Spaß», unterbrach Theresa sie plötzlich ungehalten.
«Dachte ich ja auch, und weil ich es witzig fand, habe ich das Video behalten, aber jetzt … nach dieser Sache … vielleicht … ach, ich weiß auch nicht», versuchte Viola sich gegen ihre Freundin zu verteidigen.
«Hattet ihr beiden den Eindruck, dass Kathi niedergeschlagen war in der letzten Zeit?»
«Vielleicht», sagte Viola und zuckte mit den Schultern. «Ich meine, na ja, sie war auch nicht immer nur gut drauf. Schlimme Sachen konnten sie echt fertigmachen.»
Ich wusste genau, was das Mädchen meinte. Ich konnte mich noch gut erinnern, wie herzzerreißend Kathi nach dem Sandy-Hook-Massaker geweint hatte. Aber das war es nicht, worauf ich hinauswollte.
«Aber hat sie nicht vielleicht davon gesprochen, dass sie … na ja, ihr wisst schon, auf all das keine Lust mehr hat.» Ich hob die Hände, deutete auf den Klassenraum und ließ sie wieder sinken. Das war mehr als ungeschickt ausgedrückt für jemanden, der seine Brötchen mit Schreiben verdiente, aber ich brachte die richtigen Worte einfach nicht heraus. Worte wie Selbstmord hatten nichts zu suchen in einem Satz mit Kathis Namen darin.
Viola zuckte mit den Schultern. «Keine Ahnung, aber sie hat mal gesagt …»
«Willst du jetzt alles wiederholen, was Kathi jemals gesagt hat?», unterbrach Theresa sie rüde.
Die beiden wechselten einen vielsagenden Blick. Ich kam mir wie ein Eindringling vor, der in dieser Schulwelt nichts zu suchen hatte.
«Hört zu», begann ich, «ihr müsst nicht mit mir reden, ich verstehe das, kein Problem. Was ich aber nicht verstehe, ist Kathis Tod. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie sterben wollte. Also, wenn ihr irgendwas wisst, bitte … es wäre eine große Hilfe. Auch für Kathis Eltern. Die sind total verzweifelt.»
Beide Mädchen senkten den Blick. Viola starrte auf ihr Handy, Theresa zu Boden. In der Stille hörte ich auf dem Gang einige Schüler vorbeilaufen. Plastiksohlen quietschten auf Linoleumboden.
«Sie hatte Angst», sagte Theresa unvermittelt. Sie starrte noch immer zu Boden. Ihre Augenlider zuckten nervös.
«Was sagst du da? Vor wem hatte sie Angst?»
«Weiß ich nicht.»
«Aber sie muss doch etwas gesagt haben.» Ich stand auf, vielleicht etwas zu ruckartig, jedenfalls erschraken beide Mädchen, und Theresa sah mich endlich an.
«Sie fühlte sich verfolgt», stieß sie aus.
«So ein Quatsch», fuhr Viola dazwischen. «Damit wollte sie sich doch nur wichtig machen. Für Marco.»
«Wer ist Marco?»
«So ein Typ hier auf der Schule.»
«Ihr Freund?»
«Nee, nicht wirklich, aber Kathi fand ihn schon süß.»
«Das hatte absolut nichts mit Marco zu tun», beharrte Theresa. «Sie hat mir gesagt, dass ihr ein paarmal ein Wagen gefolgt ist. Auf dem Weg nach Hause.»
«Was?», platzte ich heraus. «Was für ein Wagen?»
«Ich weiß nicht, hat sie nicht genau gesagt, ein großer schwarzer, glaube ich.»
«Wann war das?» Ich hätte das Mädchen am liebsten geschüttelt, weil ich ihr alles so mühsam aus der Nase ziehen musste.
«Vor zwei Wochen oder so. Keine Ahnung. Aber dann hat sie es nicht mehr erwähnt, und ich hab’s vergessen. Bis … na ja, bis …»
Sie sprach nicht zu Ende, sah mich an, und eine Träne kullerte ihre Wange hinab. «Meinen Sie, das hat etwas mit ihrem Tod zu tun?»
«Würdest du das der Polizei gegenüber wiederholen?», fragte ich.
«Ich weiß nicht … warum?»
«Hat Kathi vielleicht ein Foto von dem Wagen gemacht?»
Beide zuckten mit den Schultern.
«Schauen Sie doch auf ihrem Handy nach», sagte Viola. «Kathi hat immer wie eine Verrückte fotografiert. Wenn sie den Wagen fotografiert hat, dann finden Sie das Bild dort. Aber wie gesagt, ich glaub die Geschichte nicht so ganz.»
«In den letzten Tagen …», begann Theresa und sah wieder zu Boden. «Kathi … sie hat ständig diese kleinen schwarzen Kästchen fotografiert und gescannt. Sie meinte, die wären irgendwie unheimlich, weil man nicht wissen kann, was sich dahinter verbirgt.»
«Was für kleine schwarze Kästchen?»
«Diese QR-Codes.»
«Was sind QR-Codes?», fragte mein Bruder Heiko. Seine Hand zitterte, während er an der Zigarette zog, und für einen Moment verschwanden seine Augen hinter dem hastig ausgepafften blauen Qualm. Es waren nicht mehr die gleichen wie früher. Der grenzenlose Optimismus darin war verschwunden. Heiko war ein grundehrlicher, herzensguter Typ, der in allen Menschen immer nur das Beste sah, aber diese beneidenswerte Eigenschaft hatte durch Kathis Tod Schaden genommen.
«Diese kleinen schwarz-weißen Rechtecke, die man heute auf fast allen Produkten findet. So ähnlich wie Barcodes, nur eckig. Man scannt sie mit dem Handy ein, bekommt darüber weitere Informationen und kann an einem Gewinnspiel teilnehmen oder so was.»
«Ach so … Nein», sagte Heiko und schüttelte den Kopf. «Ich hab nicht bemerkt, dass Kathi sich dafür interessiert hat.»
Sein Blick weitete sich und ging ins Leere.
«Sie war wie immer … meine Kathi war doch wie immer, oder?»
Diese Frage war nicht an mich gerichtet, das wusste ich. Heiko hatte einen regulären Job in einer Papierfabrik und fuhr an den Wochenenden und Feiertagen Taxi, um seine Familie und das Haus durchzubringen. Iris arbeitete in Teilzeit als Krankenschwester. Die beiden hatten nicht viel Zeit für ihr einziges Kind, vor allem Heiko nicht. Jetzt fragte er sich, ob er eine Veränderung an seiner Tochter überhaupt bemerkt hätte.
Ich legte ihm die Hand auf die Schulter. Wir standen draußen auf seiner Terrasse, drinnen rauchte er nicht. Es war längst dunkel geworden, und in der Nachbarschaft war es sehr still. Fast schien es, als würde Kathis Tod auf der ganzen Wohnstraße lasten.
«War sie, und ich glaube auch nicht, dass es Selbstmord war.»
Heiko schüttelte den Kopf, zog abermals an der Zigarette und sah mich dann an. «Aber niemand würde doch meiner Kathi etwas antun. Warum denn auch? Das verstehe ich genauso wenig. Weißt du irgendwas, was ich nicht weiß?»
Die Trauer und Verzweiflung in seinem Blick hatte mich in den letzten Tagen schon bedrückt, dass er mich jetzt aber so ansah, als misstraue er mir, setzte mir noch mehr zu. Übel nahm ich es ihm nicht, er war traumatisiert. In diesen Tagen hätte er mich schlagen und beleidigen können, es hätte unserer Beziehung keinen Abbruch getan.
«Nein», sagte ich und sah ihm fest in die Augen. «Ich weiß nicht mehr als du. Aber ich weiß, dass Kathi sich niemals umgebracht hätte. Und das kann mir auch niemand weismachen.»
«Aber die Polizei sagt …»
«Ach», unterbrach ich ihn scharf, «was wissen die denn schon. Die kannten deine Tochter doch gar nicht. Es ist die einfachste Erklärung, deshalb wird sie leichtfertig akzeptiert.»
«Aber … aber was soll ich tun? Ich meine … ich weiß nicht, was ich tun soll.»
«Lass dir von mir helfen», sagte ich. «Wenn du wissen willst, was wirklich passiert ist, dann lass dir von mir helfen.»
Sein Blick wurde jetzt eindringlich, fast schon flehend. «Okay … okay, ja, ich will es wissen, egal, was es ist.»
«Und Iris?» Ich wusste natürlich, wie schlecht es ihr ging. Iris wollte nur um ihr Kind trauern und sich nicht mit irgendwelchen Theorien beschäftigen, die womöglich alles nur noch schlimmer machten. Seit der Beerdigung schlief sie die meiste Zeit, blätterte in Fotoalben oder stierte stumpf vor sich hin. Das verstand ich. Ich musste, was Iris betraf, ohnehin vorsichtig sein. Unser Verhältnis war nicht das beste. Ich konnte nicht einmal sagen, woran das lag. Als Heiko und Iris sich kennengelernt hatten, hatte ich meinen Bruder bereits das eine oder andere Mal mit auf Bergtouren genommen. Wir hatten dabei immer viel Spaß, aber Iris gefiel nicht, was wir taten. Sie hielt es für zu gefährlich. Es war nie etwas passiert, trotzdem redete sie, als sie mit Kathi schwanger wurde, meinem Bruder so lange ins Gewissen, bis er mir verkündete, er könne jetzt nicht mehr mit mir in die Berge gehen. Seine Verantwortung für die Familie ließe das nicht weiter zu. Auch das konnte ich verstehen, die Begründung war ja vernünftig. Ich hatte es Iris nicht übelgenommen – oder vielleicht doch ein bisschen –, aber ich hatte nie wieder versucht, meinen Bruder zu einer Tour zu überreden. Trotzdem behandelte sie mich seitdem, als würde ich ihr den Mann wegnehmen.
Heiko hielt den Blick auf den Boden gerichtet.
«Iris auch, nur im Moment noch nicht. Das ist zu viel für sie», sagte er. Dann sah er mich an. «Aber was hast du vor?»
«Ich würde gern hinauf in Kathis Zimmer.»
«Iris schläft nebenan», wandte Heiko ein.
«Ich werde sie nicht wecken.»
«Und was erwartest du dort zu finden?»
«Das weiß ich nicht, vielleicht finde ich auch gar nichts. Aber ich muss schließlich irgendwo anfangen.»
Heiko zog ein letztes Mal an der Zigarette, warf sie zu Boden und trat mit dem Fuß auf die Kippe. «Gut, geh nur rauf. Du brauchst mich doch nicht dabei, oder?»
Ich schüttelte den Kopf. Ich wusste, dass er es nicht fertigbringen würde, Kathis Zimmer zu betreten.
«Gut, es ist nicht wegen … ich muss aber hier unten noch aufräumen, du weißt schon.»
«Kein Problem. Ich schaff das allein.»
Ann-Christin verharrte, die Hand auf die Gartenpforte gelegt. Sie drehte sich langsam um und starrte in die Dunkelheit hinter sich. Zwischen den kleinen Lichtinseln der Straßenlaternen schienen Schatten zu huschen.
Hatte sie gerade Schritte gehört?
Sie sah eine Weile hin, konnte aber niemanden entdecken. Sie hasste es, im Dunkeln nach Hause zu kommen, aber heute hatte sie der Filialleiter des Supermarktes, in dem sie ihre Ausbildung machte, gebeten, länger zu bleiben. Das hatte sie nicht ablehnen können.
Diese verfluchte Angst. Kein Tag verging, an dem sie nicht das Gefühl hatte, verfolgt zu werden.
Sie zitterte, drückte die Gartenpforte auf und lief über die Waschbetonplatten auf die Haustür zu. Dort bemerkte sie, dass drinnen kein Licht brannte. Nirgends. Nicht einmal die Funzel neben der Tür.
Merkwürdig, dachte Ann-Christin. Ihre Mutter war kein Mensch, der seine Gewohnheiten änderte. Es war zwanzig Uhr durch, um diese Zeit war sie immer daheim. Sie ging nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr hinaus. Eigentlich ging sie sowieso kaum noch hinaus, nur noch zum Einkaufen und für die regelmäßigen Arztbesuche. Sie lebten hier zusammen wie auf einer einsamen Insel.
Ein rascher Blick auf ihr Smartphone: kein Anruf und keine SMS von ihrer Mutter.
Ann-Christin drückte den Klingelknopf, steckte gleichzeitig den Schlüssel ins Schloss und schob die Tür auf. Das machte sie immer so.
«Ich bin da», rief sie in den dunklen Hausflur.
Es roch schwach nach gebratenen Frikadellen. Mama hatte angekündigt, sie mittags zubereiten zu wollen. Ann-Christins Magen zog sich schmerzhaft zusammen, und ihr wurde bewusst, wie wenig sie heute gegessen hatte.
«Mama?»
Keine Antwort.
Ann-Christin drückte die Haustür zu und hängte ihr mit Nippes überladenes Schlüsselbund an den Haken. Dann ließ sie ihre schwere Tasche zu Boden fallen und machte Licht.
Sofort sah sie den Hausschuh auf der Treppe in den Keller. Ein einzelner blauer Filzpantoffel auf der vierten Stufe von oben. Ann-Christin hatte Mama diese Hausschuhe vor vielleicht sechs oder sieben Jahren zu Weihnachten geschenkt. Damals hatte Papa noch bei ihnen gewohnt. Und auch wenn es schon schlimm gewesen war, hatte es zwischendurch immer Normalität gegeben, Phasen, in denen sie eine glückliche Familie waren. Alle hatten das mit gelbem Garn gestickte Smiley-Gesicht vorn auf den Schuhen witzig gefunden. Mama hatte seitdem nie andere Schuhe im Haus getragen, entsprechend abgewetzt und speckig waren sie heute. Und dieser eine Pantoffel auf der Treppe schien Ann-Christin hämisch anzustarren. Was früher lustig gewesen war, machte ihr jetzt Angst. An keinem Tag in ihrem Leben hatte je ein einzelner Hausschuh auf der Treppe gestanden. Nie!
«Mama, wo bist du?», rief sie.
Keine Antwort.
Sie schaltete das Licht ein. Es beleuchtete nur den geraden Teil der mit braunen Kacheln gefliesten Kellertreppe. Die Treppe beschrieb im unteren Drittel eine Kurve, und alles, was sich dahinter befand, lag im Dunkeln.
Ann-Christin setzte einen Fuß auf die erste Stufe. Gleichzeitig schrie in ihrem Inneren eine Stimme: «Hau ab, bring dich in Sicherheit!» Sie zögerte einen Moment und dachte daran, zu den Böses hinüberzulaufen, ihren Nachbarn. Aber wie peinlich wäre es, wenn Mama nur früh zu Bett gegangen oder auf der Couch eingeschlafen wäre! Für den verfluchten Hausschuh gab es sicher eine ganz einfache Erklärung.
Also nahm sie all ihren Mut zusammen und stieg über den einzelnen Hausschuh in den Keller hinab. Für einen kurzen Moment glaubte sie, die aufgestickten Augen würden ihr folgen, aber das lag sicher nur an ihren überreizten Nerven.
Auf der sechsten Stufe erstarrte Ann-Christin.
Von unten herauf starrte sie das Smiley-Gesicht des zweiten Hausschuhs an. Er steckte noch auf dem Fuß ihrer Mutter.
Sie lag verdreht und leblos am Ende der Treppe.
Ich ließ mich auf den Drehstuhl nieder, der vor dem kleinen Schreibtisch aus Kiefernholz in Kathis Zimmer stand. Ich hatte bewusst die Deckenlampe nicht eingeschaltet, beugte mich nun vor und betätigte den Schalter der schwenkbaren Arbeitsleuchte. Kaltes blaues LED-Licht flutete über den unaufgeräumten Schreibtisch.
Am Schirm der Lampe klebte ein Post-it mit einem einzigen Satz darauf. Als ich ihn las, lief mir ein kalter Schauer den Rücken hinab.
Das digitale Virus ist die Pest der Neuzeit.
Ich nahm den Zettel ab. Das war eindeutig Kathis Handschrift. Virus, Pest, Ratten, Tod … was war nur in ihrem Kopf vorgegangen? Ich wurde einfach nicht schlau daraus.
Ich betrachtete den Schreibtisch. An den Rändern stapelte sich ein Wust aus Kleinkram. Schmuck, Schminkutensilien, gerahmte Fotografien, Figuren aus Überraschungseiern. Dazwischen eines meiner älteren Bücher: «Blinder Instinkt». Es sah aus, wie ein Taschenbuch aussehen sollte: abgegriffen und schmuddelig. Sie hatte mir gesagt, dass sie die Geschichte um das blinde Mädchen besonders mochte. Ich nahm es in die Hand, blätterte durch die Seiten und legte es wieder weg. Keine Zeit für Sentimentalitäten jetzt. Ich war hier, um zu recherchieren.
Der Laptop stand vor mir. Ich hatte ihn ihr zur Konfirmation geschenkt. Ich hatte in meinen Büchern oft genug beschrieben, wie sich Ermittler, auch Privatdetektive, notwendige Informationen beschafften. So gut wie jeder Polizist wusste ich, dass ein Computer eine Fundgrube sein konnte, wenn die Person eher sorglos damit umgegangen war. Und ich war in Computerdingen fit genug, um einiges herauszufinden. Für alles andere hatte ich Jan Krutisch, einen Programmierer, auf den ich bereits bei einigen Recherchen zurückgegriffen hatte.
Für das Zugangspasswort brauchte ich ihn aber nicht. Ich kannte es.
Kathi hatte es mir nicht selbst verraten, aber sie hatte diesen Laptop an ihrem Praktikumstag bei mir dabeigehabt. Als sie ihn gestartet hatte, hatte ich beim Eingeben des Passwortes zugesehen. Ich erinnerte mich so genau daran, weil ich ihr danach einen Vortrag darüber gehalten hatte, dass es viel zu simpel war. Vier Buchstaben. Ein Name aus ihrem Leben.
Lady.
Kathis Facebook-Account war noch geöffnet.
Das tat weh. Ihre Timeline war voller Fotos. Kathi allein oder mit einer ihrer Freundinnen in witzigen oder provokanten Posen. Kathi auf einer Feier, im Bus, das Bild mit ihrer Katze im Arm, das ich schon kannte. Kurz nach ihrem Tod hatten einige ihrer Freunde etwas gepostet, nicht wissend, dass sie nicht mehr lebte. Es waren makabre Einladungen. Was machst du heute Abend? Hey, meld dich mal, kann dich nicht erreichen. So still bei dir, hast du einen neuen Freund?
Dann änderte sich der Ton. Posts erschienen, hinter denen man den Schock und die Trauer erahnen konnte. Ich wollte sie nicht lesen, das ging mir viel zu nahe.
Kathi hatte 533 Freunde. Einige davon waren auf der rechten Seite abgebildet. Mir fiel auf, dass ich ein paar der Gesichter kannte.
Ich loggte mich in meinen Facebook-Account ein.
Einige meiner Freunde waren auch ihre. Viele, die auf meiner Fanpage «Gefällt mir» geklickt hatten, fand ich auch unter Kathis Freunden. Ich hatte sie gebeten, bei den sozialen Netzwerken keinen sichtbaren Kontakt zwischen uns herzustellen. Ich schrieb Thriller und wollte nicht, dass irgendein realer Psychopath da draußen an meinen Familien- oder Freundeskreis herantrat. Kathi hatte sich daran gehalten. Da wir den gleichen Nachnamen trugen, hatte sie sich Kathi Weepunkt genannt. Aber vernetzt waren wir trotzdem. Die ganze Welt war vernetzt.
Ich scrollte durch ältere Posts auf ihrer Seite, fand aber nichts, was mich aufmerksam werden ließ. Daraufhin sah ich mir an, wo sie auf «Gefällt mir» geklickt hatte. Das war eine Menge. Zu viel, um es auf die Schnelle durchzuschauen. Es waren einige Posts darunter, die mit dem Tod zu tun hatten.
Meine Finger schwebten für einen Moment über der Tastatur. Mir war plötzlich danach, etwas auf Kathis Seite zu hinterlassen. Ein paar Worte für sie, die meine Trauer ausdrückten. Ich fand keine, weil es keine Worte dafür gab.
Also schrieb ich schlicht Ruhe in Frieden und fragte mich, was wohl mit all den Accounts der Toten dieser Welt geschah. Ich nahm mir vor, diese Frage zu recherchieren.
Dann wandte ich mich ihrem E-Mail-Konto zu.
Es war nicht passwortgeschützt. Sie hatte ihrem simplen Zugangspasswort voll und ganz vertraut. Die verschiedenen Ordner waren prall gefüllt. Allein im Ordner für gesendete Nachrichten lagerten 142 Mails. Der Papierkorb war lange nicht geleert worden. Im Eingangsordner warteten siebzehn Mails darauf, gelesen zu werden. Der Datumsangabe zufolge waren sie alle nach ihrem Tod eingegangen. Die nahm ich mir zuerst vor.
Unglaublich! Es waren drei Mails dabei, die ganz bewusst und als Abschied an eine Tote gerichtet waren. Ich las sie, dabei liefen mir die Tränen nur so herunter. Die anderen vierzehn Mails waren belanglos. Das war ein wenig enttäuschend. Es war spät, und wenn ich mich wirklich durch den Papierkorb wühlen musste, wäre es wohl besser, Kathis Rechner mit zu mir nach Haus zu nehmen. Heiko würde sicher nichts dagegen haben, bei Iris war ich mir nicht sicher. Aber die schlief ja.
Ich entdeckte einen Ordner mit dem Titel «wichtige Post». Er enthielt lediglich drei Mails. Ich klickte ihn an und öffnete die erste Mail. Sie enthielt keinerlei Text, aber einen sehr großen Anhang, eine Videodatei, wie ich an dem Format erkennen konnte. Das war zunächst einmal nichts Ungewöhnliches, schließlich versendeten gerade Jugendliche heutzutage haufenweise Videos. Wahrscheinlich war es Musik. Was mich aufmerksam werden ließ, war der Absender. Anima Moribunda.
Was frei übersetzt so viel hieß wie «todgeweihte Seele».
Ich klickte auf den Videolink.
Kathi ging eine Straße hinunter. Sie trug knöchelhohe schwarze Schuhe mit Absätzen, eine schwarze Strumpfhose und eine kurze graue Hose. Dazu eine engtaillierte Jacke. Über ihrer Schulter baumelte eine graue Ledertasche. Ihr langes braunes Haar trug sie offen. Plötzlich blieb Kathi stehen, drückte auf den Taster einer Fußgängerampel, und noch bevor sie sich zur Kamera umdrehen konnte, brach das Video ab.
Merkwürdig. Sie ging einfach nur die Straße hinunter, sah sich weder um noch nach rechts oder links. Sie schien ein Ziel zu haben. Aber warum hatte sie sich dabei filmen lassen? Die Aufnahme war mit einem Handy gemacht worden. Die Qualität war nicht besonders gut, zudem war sie durch Schritte und Bewegungen verwackelt. Die Person, die gefilmt hatte, war gleichbleibend zehn Meter hinter Kathi gegangen. Am rechten Bildschirmrand konnte ich hin und wieder ein Auto vorbeifahren sehen. Es musste abends gewesen sein. Gelbes Licht von hohen Peitschenlampen schimmerte auf feuchtem Straßenbelag. Die Straße kam mir bekannt vor, doch ich kam nicht drauf, welche es war.
Der Film endete mit dem Standbild meiner Kathi, die im Begriff war, sich mir zuzuwenden. Oder der Person, die gefilmt hatte.
Plötzlich war ich wie elektrisiert. Kathi hatte sich nicht freiwillig filmen lassen, sie war heimlich gefilmt worden! Jemand war hinter ihr her gewesen. Was hatte Theresa in der Schule gesagt? Kathie hatte sich von einem schwarzen Wagen verfolgt gefühlt.
Ich startete das zweite Video und beugte mich gespannt über den Bildschirm. Es dauerte einen Moment, ehe ich begriff, was ich da sah. Und dann raubte es mir den Atem.
Mein Kopf ruckte hoch, und ich blickte über den Rand des Bildschirms zum Fenster. Draußen war es dunkel. Im Glas spiegelte sich mein Gesicht, angestrahlt von der kalten blauen LED-Lampe. Es wirkte, als starre mich von draußen ein geisterhaftes Wesen an, das ein paar Meter über dem Boden schwebte. Ich warf einen schnellen Blick auf das Video, schaute dann nach rechts und links und suchte die Vergleichspunkte im Raum. Das Regal, die Yucca-Palme, der kitschige Kristalllüster aus Plastik unter der Decke.
Verdammte Scheiße! Das durfte doch nicht wahr sein.
In einer hastigen Bewegung stieß ich mich vom Schreibtisch fort und stand gleichzeitig auf. Der Stuhl rollte noch ein Stück weiter und krachte gegen das Regal. Wenn Iris nicht sehr fest schlief, musste der Lärm sie wecken, aber das war mir gerade egal.
Ich verließ Kathis Zimmer, polterte die Treppe hinunter und traf unten auf dem Flur auf Heiko.
«Was ist … was war das für ein Poltern?», fragte er.
«Heiko?», kam eine dünne Stimme von oben. Iris war wach.
«In den Garten, los, komm mit.»
Ohne eine weitere Erklärung lief ich voraus. Öffnete die Terrassentür, trat auf die Terrasse, auf der Heiko und ich vor einer halben Stunde noch gestanden hatten, und sah zum Giebel des Hauses hoch. Das Fenster zu Kathis Zimmer war blau erleuchtet. Ich orientierte mich kurz, lief dann über den Rasen bis fast an die Grundstücksgrenze und sah wieder hinauf.
Ja, die Perspektive stimmte.
Aber wo? Wo war sie versteckt?
«Andreas, was soll das?» Heiko hatte mich eingeholt und sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren.
Ich drehte mich im Kreis und suchte nach einer Möglichkeit. Es gab nur eine: das Vogelhaus. Heiko hatte es aus Birkenholz selbst gebaut. Es stand auf anderthalb Meter hohen Stelzen und war durch einen umlaufenden breiten Teller aus Holz katzensicher. Darauf thronte ein viel zu großes Häuschen mit Satteldach und vorgezogenen Landeplätzen für die Vögel.
«Ich brauche eine Taschenlampe», blaffte ich Heiko an.
«Wieso eine Taschenlampe, was soll …»
«Bitte! Eine Taschenlampe», unterbrach ich ihn. Er starrte mich an, dann drehte er sich um und lief zurück ins Haus.
Während ich wartete, brachte ich mich hinter dem Vogelhäuschen in Position, ging ein wenig in die Hocke und visierte über die Kante des Häuschendaches Kathis Zimmerfenster an.
Ja, das passte. Ich sah sowohl das Regal als auch den Lüster und die Palme. Und ich sah – Kathi, die vor ihrem Schreibtisch stand!
Ich taumelte erschrocken einen Schritt zurück. Erst als das Vogelhaus aus meinem Blickfeld verschwand, erkannte ich, dass nicht Kathi dort am Fenster stand, sondern Iris. Die beiden sahen sich sehr ähnlich, und aus der Entfernung hatte es wirklich so ausgesehen, als schaue Kathi aus einer anderen Sphäre auf mich hinab.
Mein Herz wummerte wie verrückt.
Über den Rasen kam Heiko mit einer Taschenlampe angelaufen.
Gleichzeitig öffnete Iris oben das Fenster.
«Hier», sagte Heiko.
«Heiko, was soll das, wer war in Kathis Zimmer?», rief Iris.
Ich nahm die Taschenlampe und suchte das Vogelhäuschen ab.
Leider fand ich nicht, wonach ich suchte.
«Was tust du da?», fragte Heiko.
«Da», sagte ich und deutete zu dem Fenster hinauf. «Der Winkel stimmt ganz genau. Eine Kamera … hier war entweder eine Kamera installiert, oder jemand hat von hier aus Kathi in ihrem Zimmer gefilmt.»
«Tommy, was ist das?!«
Als Thomas Resing ihre Stimme hörte, wusste er, dass er etwas vergessen hatte. Er hatte den Verlauf seiner letzten Online-Sitzung nicht gelöscht, und nun hatte er dummerweise seiner aktuellen Freundin Tatjana erlaubt, an seinem Laptop zu surfen.
«Scheiße», flüsterte Tommy, der gerade auf der Toilette saß. Er hatte oben im Haus sein eigenes Bad mit einer Verbindungstür zu seinem Zimmer.
Was hatte Tatjana entdeckt? Alles? Hoffentlich nicht. Tommy wusste ja, wie empfindlich sie auf solche Sachen reagierte. Mit ihr zusammen konnte man sich nicht einmal einen für Jugendliche freigegebenen Horrorfilm anschauen. Schon bevor der Film losging, verkrampfte sie die Hände in der Decke und zog später bei jeder guten Slasherszene die Decke vors Gesicht. Anfangs hatte Tommy sich darüber amüsiert, nach dem dritten Film fand er es nur noch ärgerlich. Dieses Verhalten verdarb ihm selbst den Spaß an diesen Filmen. Jetzt sah er sie sich nur noch allein an. Und dann war wiederum Tatjana sauer, weil er keine Zeit für sie hatte.
Weiber.
«Tommy!», kam es nachdrücklich aus seinem Zimmer.
Tommy seufzte, spülte, zog die Shorts hoch, wusch sich die Hände, überprüfte sein Aussehen im Spiegel über dem Waschbecken und öffnete dann die Tür.
Tatjana lag bäuchlings auf dem breiten Bett. Sie trug nur ihre Unterwäsche, es war ziemlich warm hier oben unter dem Dach. Als er sie so aufreizend daliegen sah, vergaß Tommy all die Nachteile, die es mit sich brachte, eine empfindliche Freundin zu haben. Tatjana hatte einen echt tollen Körper, ohne ein Gramm Fett zu viel, außerdem einen dunklen Teint und lange dunkle Haare. Man konnte sie ohne weiteres für eine Latina halten. An der Schule war sie eine große Nummer und hätte jeden Typen haben können. Tommy hatte lange baggern müssen, bevor sie sich für ihn interessiert hatte. Aber er war auch nicht der Typ, der schnell aufgab, wenn er einmal einen Korb bekam. Ganz im Gegenteil, eine Abfuhr motivierte ihn nur noch mehr. Immerhin war er Thomas Resing, einziger Sohn einer reichen Familie und gut aussehend noch dazu.
«Was ist denn, Süße?», fragte er.
«Was ist das für ein Mist hier auf deinem Rechner?»
Tatjana sah ihn aus ihren mandelförmigen braunen Augen an. Heute trug sie mal wieder ihre extralangen Wimpern. Ihr Augenaufschlag löste ein Kribbeln in seinem Bauch aus. Die Mimik jedoch machte es sofort wieder zunichte.
Sie war angewidert.
Tommy ließ sich neben sie aufs Bett sinken und warf einen Blick auf den Laptop. Bis zuletzt hatte er gehofft, dass sie nicht alles entdeckt hatte, was dieser Anima Moribunda ihm zugespielt hatte. Diese Hoffnung wurde jetzt zerstört. Auf dem Bildschirm war das Gesicht einer toten Frau zu sehen. In der linken Wange klaffte eine eklige Wunde, durch die der Kieferknochen weiß hervorstach. Die Augen waren noch oben verdreht, die Zunge hing aus dem Mund.
«Ach, das …», Tommy versuchte sich in Gleichgültigkeit. Er legte Tatjana eine Hand auf den unteren Rücken und fuhr mit den Fingern an den Muskeln rechts und links der Wirbelsäule entlang. Er wusste ja, wie sehr sie das mochte. Normalerweise schnurrte sie dabei immer wie ein Kätzchen.
Jetzt aber nicht.
«Da sind noch mehr von diesen Bildern. So etwas schaust du dir also an, wenn du allein bist?»
«Nein, das war Zufall, dass ich darauf gestoßen bin. Ich war auf der Suche nach einem alten Film und hab diese Fotos gefunden. Ich hab sie aber nur ganz kurz angeschaut. Ehrlich.»
«Und was für einen Film hast du gesucht?» Es klang nicht so, als glaubte sie ihm. Sie waren seit einem halben Jahr zusammen, und Tatjana kannte ihn mittlerweile ziemlich genau. Sie wusste von seiner Leidenschaft für Horror. Was sie nicht wusste, war, wie sehr er sich wünschte, mal jemanden real sterben zu sehen. Nicht immer nur nachgestellt wie in diesen amerikanischen Filmen.
«Gesichter des Todes», sagte Tommy, weil ihm dieser Film spontan einfiel. Den alten Schinken von 1978 kannte er in- und auswendig, nichts davon konnte ihn noch wirklich flashen.
«Der ist doch verboten», empörte sich Tatjana.
Tommy ließ seine Hand an der Seite ihres Brustkorbs entlang- und einen Finger unter den Träger ihres BH gleiten.
«Da irrst du dich, der war in Deutschland nie verboten. Komm, mach das Bild doch weg, ich kann mir gerade was Besseres vorstellen.»
Schwungvoll schlug Tatjana den Deckel des Laptops zu und drehte sich auf den Rücken.
«Ich werde nie verstehen, warum du dir so einen Dreck anschaust.»
Sie klang traurig.
«Ich weiß auch nicht, einfach so aus Spaß.»
Tommy legte einen Hand auf ihren Bauch. Er war warm und die Muskulatur unter der Haut hart vom Schwimmtraining.
«Es ist doch kein Spaß, wenn Menschen sterben. Stell dir vor, du stirbst und jemand filmt dich dabei. Würdest du das lustig finden?»
Tommy schüttelte Kopf. «Das ist doch alles nur Fiktion, nicht real.»
Dies war sein letztes, ultimatives Argument, gegen das Tatjana kaum etwas sagen konnte. Und es war gelogen. Er war ja auf der Suche nach realistischem Material. Nach so genannten Snuff-Videos, von denen es hieß, sie seien bloß eine Legende. Aber im Netz kursierten immer wieder die wildesten Gerüchte in einschlägigen Foren. Irgendjemand hatte immer irgendetwas gesehen, aber niemand konnte oder wollte eine genaue Adresse nennen.
Vielleicht war Tommy bei diesem Anima Moribunda jetzt aber