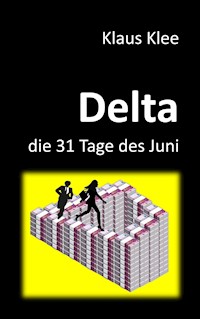
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Universitätsprofessor Erich Pregl und die Chemikerin Katrin Kohn, ein ehemaliges Fotomodell, haben eigentlich nichts gemeinsam. Doch nach dem dritten Mordanschlag beginnen sie umzudenken. Sie stoßen auf eine Verschwörung, deren Ausmaße sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht ausgemalt hätten. Schritt für Schritt klären sich auch einige ungelöste Fragen aus der Vergangenheit von Erich und seiner verstorbenen Ehefrau. Damit beginnt eine spannende Schnitzeljagd quer durch Europa und ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem keineswegs immer klar ist, wer gerade die Katze und wer die Maus ist. Eine rasante Thriller-Novelle von Klaus Klee mit verblüffenden Entwicklungen, unkonventionellen Lösungen und einer Prise Humor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Klee, Delta - die 31 Tage des Juni
2. Auflage, Dezember 2018
Bildnachweis: Titelbild: Bilder, die mit Lizenz von Shutterstock.com verwendet werden; Bild-Komposition: © Klaus Klee. Illustrationen: Klaus Klee
Alle in diesem Werk erwähnten Personen und Organisationen und die hierin beschriebenen Handlungen sind völlig frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen, mit bestehenden Firmen oder Organisationen ist rein zufällig. Jeder Bezug zu konkreten Situationen in der Politik oder Finanzwelt ist nicht gewollt.
Beim Schreiben dieses Buches kamen keine Tiere zu Schaden.
Das Lesen der einzelnen Kapitel dieses Buches erfolgt auf eigene Gefahr. Jede Haftung für direkte oder indirekt körperliche oder psychische Schäden wird kategorisch ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss schließt auch insbesondere das Kapitel 30 („Erkenntnisse“) ein.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Die einfache Frage
Kapitel 2: Die schwierige Antwort
Kapitel 3: Der Rat der Mutter
Kapitel 4: Die Ausfahrt
Kapitel 5: Der Unfall
Kapitel 6: Das Frühstück
Kapitel 7: Die Suche nach der Nachricht
Kapitel 8: Die Hintergrund-Information
Kapitel 9: Die Recherche vor Ort
Kapitel 10: Fahrt nach Hamburg
Kapitel 11: Die freiwillige Wartezeit in
Kapitel 12: Die unfreiwillige Wartezeit in
Kapitel 13: In Hamburg
Kapitel 14: Zurück nach Österreich
Kapitel 15: Der Wellness-Aufenthalt
Kapitel 16: Der erste Versuch
Kapitel 17: Der arbeitsame Samstag
Kapitel 18: Die Zwischenstation
Kapitel 19: Die Herbergsuche
Kapitel 20: Die Lieferung – Im Westen
Kapitel 21: Aus vier mach zwei
Kapitel 22: Die Planung
Kapitel 23: Die gefährliche Drohung
Kapitel 24: Zurück zur Quelle
Kapitel 25: Neustart
Kapitel 26: Die verschlüsselte
Kapitel 27: Der gefälschte Report
Kapitel 28: Ein Tag vergeht
Kapitel 29: Pluria schlägt zu
Kapitel 30: Erkenntnisse
Kapitel 31: Die Nachrichten
Kapitel 1. Die einfache Frage
Do, 30. Mai
„Warum bloß … “, denkt Erich. „Sie hat doch einen intelligenten Eindruck vermittelt … So dumm kann doch niemand sein … Wo ist da der Fehler? … Warum schreibt sie denn sowas? … Und vor allem, warum zum Kuckuck muss ich das da jetzt lesen?“
Erich, mit vollem Namen und Titeln Univ. Prof. Dr. Erich Pregl, nimmt sich gerne Zeit, auch um im Selbstgespräch über Entscheidungen und Ereignisse zu nachzudenken.
Und im Moment ärgert er sich gerade – über die Arbeit einer Studentin und über sich selbst.
Erich sitzt vor einem Stapel Papier und streicht wild mit einem grünen Faserschreiber in dem Manuskript herum. Das Schöne an Ausdrucken ist, dass man darin einfach Notizen machen kann. Immer wieder sprechen ihn Kollegen darauf an und empfehlen, das digital auf einem Tablet zu erledigen. Erich erklärt ihnen dann, dass er es für Verschwendung hält, jedes Mal ein neues iPad zu kaufen, wenn er wieder mal wo rumstreichen oder die Seiten einfach zerknüllen muss. „Aber“, so seine Haltung, „sobald die Studenten keine Fehler mehr in ihren Arbeiten machen, werde ich diese gerne auf Tablets lesen.“
Sein Blick schweift über die Ausstattung seines Büros - seine alte Ledercouch und die zwei Polstersessel, die er im Auktionshaus ersteigert hat. Er beginnt, auf die große Espresso-Maschine zu starren.
Erich zwingt sich, sich wieder dem Auszug aus der Master Thesis zuzuwenden. Dabei ist die Frage der Arbeit doch eigentlich einfach gestellt: „Wieviel Geld gibt es auf der Welt? Und wer besitzt es?“ Natürlich kann man sowas nicht als Titel einer wissenschaftlichen Arbeit verwenden – es klingt zu banal.
Katrin Kohn – so der Name der Studentin, die sich gerade zwar die Bewunderung für ihr Aussehen sichert, aber auch einigen Ärger über ihre Arbeit zuzieht – hat deshalb als Titel gewählt: „Die lokale Verteilung von Barreserven im internationalen Vergleich – eine historische Betrachtung der zwischenstaatlichen und finanzmarkttechnischen Geldzu- und -abflüsse des 20. und 21. Jahrhunderts“.
Er legt den Zettelhaufen wieder akribisch zusammen, und sein Blick fällt auf den – wie Erich es bezeichnet – „sehr akademischen“ Titel. „Komisch, damals als wir die Aufgabenstellung besprachen, wirkte sie eigentlich ziemlich intelligent.“
In den letzten Wochen ist Erich oft länger im Büro geblieben. Und auch heute hat er den Eindruck, dass er wieder der letzte ist, der nach Hause geht.
Als er so dasitzt und die Kuriositäten und Antiquitäten in seinem Büro begutachtet, fällt wieder sein Blick wieder auf das Manuskript seiner Studentin.
Katrin hat ihm mitgeteilt, dass sie mit ihrer Recherche begonnen habe und bei einem ersten Plausibilitätscheck die Zahlen nicht zusammenpassten. Und zwar gehe es nicht um eine kleine Abweichung sondern einen Unterschied, der durchaus eine Signifikanz im internationalen Finanzmarkt habe.
Erich nimmt sein Notebook zur Hand und beginnt einen Brief an Katrin zu tippen. „Sehr geehrte Frau Kohn! Bitte prüfen Sie nochmal Ihre Quellen und schreiben Sie mir eine Zusammenfassung des Problems. Ich hoffe, es ist Ihnen möglich die Quintessenz und vor allem das Problem, das Sie bewegt, auf einer Seite zusammenzufassen. Im Nachgang sollten wir uns zusammensetzen und den Inhalt durchgehen.“
„Ist das vielleicht ein sehr später Aprilscherz?“, denkt er, als sein Blick auf den großen Wandkalender fällt. „Nein, das kann es nicht sein. Das wäre ein schlechter Scherz.“
Also beschließt er, den Ausdruck einzupacken.
Ein prüfender Blick noch – wie jeden Abend – auf seine Liste, was er sich für heute vorgenommen hat. Erich ist zufrieden – für heute ist er fertig. Der Terminkalender für morgen weist keine Termine auf, für die er noch etwas vorbereiten müsste. Hier kommt eine seiner Regeln zur Anwendung: „Regel 4: Alles wird spätestens einen Tag vor der Deadline fertig.“ Erich atmet einmal kurz durch und beschließt, den Arbeitstag im Büro zu beenden.
Erich packt seine lederne Aktentasche zusammen. Darin verschwinden sein Notebook und der Stapel Papier, den er gerade ausgedruckt hat.
Die Flure sind menschenleer, als er das Gebäude verlässt. Lediglich in einem kleinen Büro scheint noch Licht zu brennen.
Quer über den Hof verläuft der Fußweg zur Parkgarage. Der Architekt hat ursprünglich gar keine Wege geplant, sondern nach einem Jahr geschaut, wo die ausgetretenen Spuren verlaufen sind. Dort hat er dann letztendlich Wege angelegt. Erich verwendet die Geschichte immer als Beispiel für Optimierungsmethoden. Nur leider macht ihm gerade die Bauwirtschaft einen Strich durch die Rechnung. Der optimierte Fußweg ist leider durch einige Baustellengeräte, Container und einen Kran versperrt. Und der Umweg durch die aufgewühlte Wiese – oder das was davon übrig ist – ist alles andere als malerisch … und schon gar nicht vorteilhaft für die Schuhsohlen.
Auch wenn Erich Sinn für Reinlichkeit – wie er es nennt – nicht komplett verkümmert ist, so ist ihm Putzen schon seit jeher ein Dorn im Auge.
„Da wird Isabella wieder schimpfen“, denkt Erich. „Aber was soll‘s, ich habe eine Ausrede.“ Isabella ist der gute Geist in seinem Haus und sorgt dafür, dass alles halbwegs sauber bleibt und die Wäsche gebügelt ist.
In seinem Haus am Stadtrand von Wien ist es ihm im Moment ohnehin zu leer. Seine Frau ist vor über 10 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen und seine Tochter – mittlerweile auch erwachsen – hat vor kurzem begonnen in London zu studieren. Am meisten geht es bei Erich zuhause noch rund, wenn jeden Donnerstagnachmittag seine Putzfrau Isabella vorbeikommt und fürchterlich schimpft, wie er es alleine schaffe, in einer Woche ein Haus so verkommen zu lassen, wie sonst nur eine Horde wildgewordener Paviane.
Erich geht in die Tiefgarage der Universität, wo er sein Auto geparkt hat - ein Tesla Model S, ein luxuriöses Elektroauto und der laut Erich vermutlich coolste fahrbare Untersatz, den er jemals besessen hat. Aber Erich vertritt die Meinung, dass Autofahren auch Spaß machen darf. Und so hat er die Investition getätigt, an der er sich seit einiger Zeit erfreut. Erich steigt in das Auto und gleitet auf leisen Sohlen aus der Garage. Zügig geht es im Spätabendverkehr nach Hause. Bei den roten Ampeln kostet Erich die Beschleunigung aus. Er würde ja gerne den verdutzten Blick der Autofahrer sehen, die neben ihm stehen, wenn er bei Grün davonzieht. Aber das geht nur, wenn er nicht so schnell wegstartet – und dann schauen sie ja nicht verdutzt. „Ein Dilemma …“, denkt Erich.
Zuhause wirft Erich die Schlüssel auf die Garderobe, geht in den Keller und zieht seine Sportkleidung an. Nach einer halben Stunde im Fitness-Raum geht er kurz duschen.
In der Küche findet er etwas Knäckebrot und Salami, die er rasch in sich hineinstopft. Dann begibt sich Erich zu Bett. Er überlegt noch kurz, was an diesem Tag gut und schlecht gelaufen ist, grübelt nochmal über die Diskrepanzen in der von ihm kontrollierten Diplomarbeit, kommt aber nicht besonders weit mit seinen Gedanken, weil ihn der Schlaf rasch einholt.
Kapitel 2. Die schwierige Antwort
Fr, 31. Mai
Am nächsten Vormittag hält er die Vorlesung zur Geschichte der Programmiersprachen, diesmal geht es um die Entwicklung von C, eine der historisch wohl bedeutungsvollsten Programmiersprachen, um einem Computer die gewünschten Aktionen zu entlocken.
Erich erwartet, dass seine Studenten ein paar Definitionen im Schlaf beherrschen. Daher stellt er auch jede Woche an einen Studenten im Auditorium die Frage: „Was ist eine Programmiersprache?“ Am Anfang jedes Kurses hört er immer noch zögerliche Antworten, aber gegen Ende des Semesters kommt es dann schon von allen wie aus der Pistole geschossen. „Eine Programmiersprache ist eine formale Sprache zur Formulierung von Datenstrukturen und Algorithmen, die von einem Computer ausgeführt werden können.“ „Und was heißt das?“ legt Erich nach und zeigt blitzschnell auf einen anderen Studenten. „Eine Programmiersprache ist eine künstlich geschaffene Sprache, die so einfach ist, dass sogar ein Blechtrottel sie versteht, der nur mit 0 und 1 umgehen kann.“
„Sehr gut. Und daraus erkennen wir, dass Programmieren eigentlich eine ganz einfache Sache ist. Hören Sie auf wie ein Mensch zu denken, sondern denken Sie wie ein Computer.“
Wie immer bei diesem Thema erklärt Erich, dass man eine Programmiersprache braucht, um eine neue Programmiersprache zu entwickeln. Und wie immer kommt dann die Frage nach dem Henne-Ei-Problem. Wie macht man das am Anfang? Und was ist, wenn da ein Fehler drinnen ist?
Hier holt Erich dann ein Bild aus seiner Anekdoten-Sammlung: „Nebst den Verschwörungstheorien zur Mondlandung gibt es auch die Theorie, dass in den ersten Programmiersprachen ein Geheimdienst eine Hintertür eingebaut hat. Und weil man daraus später andere Programmiersprachen und viele Programme entwickelt hat, pflanzt sich die Hintertür immer wieder fort, sodass sie bis heute existiert. Nur eine Handvoll Leute wissen, wie sie funktioniert – die können damit aber einen Großteil aller Computer kontrollieren, wenn sie es nur wollen.
Das ist – laut einer weiteren Verschwörungstheorie – auch der Grund, warum das Internet erschaffen worden ist. Es ist ja ursprünglich eine militärische Erfindung der USA, aber so richtig kann man diese Hintertüren nur ausnutzen, wenn man sich auch mit Russland und den anderen Ländern – und letztendlich mit allen anderen Computern – verbinden kann. Daher ist das Internet breit beworben und für den Massenmarkt zur Verfügung gestellt worden. Und nachdem auch viele Firewalls und Sicherheitswerkzeuge auf Programmiersprachen beruhen, kann man solche Zugriffe auch nicht entdecken.
„Aber das ist ja nur eine wilde Spekulation. Schließlich haben schon viele Leute den Code dieser Programmierumgebungen und Betriebssysteme gelesen, sodass diese Theorie sehr unwahrscheinlich ist“, stellt Erich fest.
Es klopft. Jemand im hinteren Drittel des Hörsaals hat die Sprechpause wahrgenommen, um auf den Tisch zu klopfen und die Hand zu heben. Der Hörsaal ist so groß und gut gefüllt, dass es Erich schwer fällt, zu erkennen, um wen es sich handelt. Umso mehr verdutzt ist er, als eine weiblich Stimme fragt: „Haben Sie schon mal den Quell-Code gelesen?“
„Nein, natürlich nicht“, entgegnet Erich.
„Aha …“ Kurze Pause. „Kennen Sie jemand, der den Quell-Code gelesen hat?“ fragt die Studentin nach.
„Nein, eigentlich nicht“, antwortet Erich zunehmend irritiert.
„Aha …“
Ein Raunen geht durch den Raum. Die Studenten scheint die Diskussion zu amüsieren.
„Aber trotzdem, das kann nicht sein, das ist Blödsinn“, entgegnet Erich. „Wenden wir uns zum Abschluss etwas anderem zu.“
Lachen im Hörsaal. Erich räusperte sich.
„Ich habe Ihnen hier einen typischen Vertreter einer älteren Rechnergeneration mitgebracht. Einen Commodore C64 der ersten Generation, auch Brotkasten genannt.“
„Wer weiß, warum er Brotkasten heißt?“ fragt Erich, während er sich hinter seinem Tisch bückt, um das Schaustück aus seiner mitgebrachten Kiste zu holen.
„Weil er ausschaut wie ein Brotkasten?“, kam die zaghafte Antwort aus dem Publikum.
„Fast“, meint Erich und klappt sein Schaustück auf, darin liegt in Butterbrotpapier eingewickelt ein Jausenbrot, „und weil die heutige Stunde schon zu Ende ist, wünsche ich Ihnen Mahlzeit! Wir sehen uns nächste Woche wieder zur selben Zeit.“
Wildes Klopfen auf den Tischen signalisiert, dass sich die Studenten auch diesmal wieder amüsiert haben.
Erich packt alles zusammen und schreitet sein Jausenbrot verspeisend aus dem Hörsaal.
Nachmittags, kurz vor zwei Uhr schaut Erich in sein E-Mail Postfach. Darin findet er auch eine E-Mail von Katrin Kohn. „Sie ist schnell“, denkt Erich. „Mal schauen, ob sie auch Köpfchen hat.“
„Sehr geehrter Herr Professor!“ beginnt die E-Mail. „Anbei sende ich Ihnen wie gewünscht eine Zusammenfassung der Analyse-Ergebnisse und eine Auflistung der dabei festgestellten Ungereimtheiten. Ich habe mir erlaubt, mich hierfür einer Online-Cloud zu bedienen.“
„Ein äußerst charmanter Genitiv in einer eleganten Infinitiv-Konstruktion“, analysiert Erich. „Die Dame hat Stil.“
„Falls Sie noch keinen Cloudbox Account haben“, geht es im E-Mail-Text weiter, „müssen Sie sich nur mit Ihrer E-Mail-Adresse registrieren. Das ist alles gratis. Mit freundlichen Grüßen, Katrin Kohn“
Erich grummelt etwas vor sich hin, als er an seinem Computer versucht, herauszufinden, wie man einen Cloudbox Account anlegt. Sein Prinzip ist eigentlich: „Nur meine Cloud ist eine gute Cloud. Alles was in anderen Clouds liegt, wird sicher irgendwann einmal geklaut.“
„Naja, was soll‘s.“ Erich klickt sich durch die Anmelde-Maske. „Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen habe ich gelesen“, murmelt Erich. „Na klar doch, was sonst“, meint Erich sarkastisch und macht ein Häkchen vor diese Frage. „Die zweigrößte Lüge im Internet. Gleich nach: Ja, ich bin über 18 Jahre.“
Nach der Anmeldung kann er das Dokument von Katrin auf seinen PC herunterladen.
Erich beginnt das Dokument zu überfliegen, als es plötzlich an der Tür klopft – doch ehe er noch „herein“ sagen kann, schaut schon seine Sekretärin Ruth Lessner rein. „Ich möchte ja nicht stören, aber Sie sollten aufbrechen. Sie haben jetzt einen Termin beim Dekan, um den neuen Lehrplan zu besprechen.“
„Der ist doch erst um vier?“
„Grammatikalisch korrekt muss das lauten: … wäre erst um vier gewesen. – Konjunktiv Irrealis der Vergangenheit“, entgegnet Ruth Lessner. Auch Ruth weiß mittlerweile um den Grammatik- und Syntax-Fetischismus von Erich, sodass sie ihn damit manchmal auch etwas veralbert.
Erich wirft ihr einen fragenden Blick zu, und seine Sekretärin erklärt: „Die Sekretärin des Dekans hat mich gerade angerufen, ob Sie den Termin vorverlegen können, weil der Dekan heute früher weg muss.“
„Ach so, ja klar, kein Problem.“
„Ja, das habe ich ihr auch gesagt“, entgegnet Ruth Lessner.
„Schön, dass Sie meine Prioritäten so gut verwalten“, bedankt sich Erich mit der nötigen Portion Ironie. In alter Gewohnheit wie bei allen anderen studentischen Werken, druckt er die Zusammenstellung von Katrin aus, legt seine Checkliste für Diplomarbeiten aus der Schublade dazu und steckt alles in eine Klarsichthülle.
Danach macht er sich auf den Weg zu Alexander Kolwitsch, seines Zeichens Dekan der Universität, um mit diesem über den neuen Studienplan zu sprechen. Nach fast zwei Stunden klappt Alexander die Mappe mit einem lauten Klatschen zu. „So … und jetzt zu den wirklich wichtigen Dingen. Du hast dir ein neues Auto gekauft, erzählt man sich am ganzen Campus. Wann darf ich es ausprobieren?“
Erich grinst. Offensichtlich hat sein zaghafter Versuch, seine neue Investition geheim zu halten, nicht funktioniert.
„Aha, wer hat denn gepetzt?“ fragt Erich.
„Also mir hat es der lange Franz aus der Mikroökonomie erzählt. Wo er es her hat, keine Ahnung. Aber es stimmt also? Du hast dir wirklich einen Tesla gekauft?“.
„Ja, die Gerüchte stimmen. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Er fährt sich sehr angenehm“, erklärt Erich selbst auch ein bisschen stolz. „Jetzt muss ich es nur schaffen, unser Rechenzentrum zu überzeugen, mir ein bisschen Strom abzutreten. Dann könnte ich sogar hier mein Auto laden und es wäre noch günstiger im Betrieb“, scherzt Erich weiter.
„Nichts da, sonst muss ich einen Stromzähler kaufen und installieren lassen. Und dann die Kosten auf dich abwälzen, und du weißt, was das für ein Aufwand gewesen ist, die privaten Telefonkosten weiter zu verrechnen.“
„Na gut, nicht tanken während der Arbeit …“ seufzt Erich.
„Aber wenn du willst können wir zu mir nach Gloggnitz fahren. Dort gebe ich dir und deinem Auto eine Runde aus“, scherzt der Dekan. „Wer möchte den Apfelsaft? Und wer den Drehstrom? Passt Dir Sonntag?“
„Ja, mach ich gerne“. Erich freut sich auf den Besuch bei Alexander. Dessen Frau ist eine ausgezeichnete Köchin. Und die Aussicht von der Terrasse sucht bei schönem Wetter ihresgleichen – beinahe postkartenkitschig. „Da kann ich das Auto auch ein bisschen einfahren und mal selbst kennenlernen, damit ich dir dann erklären kann, wofür all die Felder am Touchpad sind.“
„Stimmt, da fällt mir ein, du solltest doch endlich mal wieder auf Urlaub gehen. Ich weiß nicht, wann du zuletzt weg warst. Du brauchst sicher dringend mal eine Abwechslung.“ Der Dekan stupst ihn mit dem Ellbogen in die Seite. „Wann war dein letzter Urlaub?“
„Ach geh, das ist noch gar nicht so lange her. Das war vor 2 Monaten, da war ich in England auf Urlaub.“ Erich lehnt sich zurück und seufzt.
Alexander lächelt wissend und zieht die Augenbrauen hoch. „Urlaub? Meines Wissens hast du an einem verlängerten Wochenende deiner Tochter geholfen, in ihre Londoner Wohnung zu übersiedeln. Was ist daran Urlaub, wenn die einzige Tochter auszieht – und dann gleich ins Ausland? Wenn man bedenkt, dass dort die englischen Jungs sicher nur auf hübsche Österreicherinnen warten – du bist ja nicht mal mit dem vorigen Freund deiner Tochter klargekommen.“
„Das war ein verrückter Musiker, der nicht mal Genitiv und Dativ unterscheiden konnte – geschweige denn wusste, was die beiden Wörter heißen“. Erich schüttelt sich theatralisch. „Ich zitiere: ‚Genitiv habe ich vor Jahren in einem Konzert live gesehen. Phil Collins ist einfach geil.‘ Ich weiß nicht, was meine Tochter an dem Typen gefunden hat.“
Alexander fährt unberührt weiter fort in seiner Aufzählung: „Wenn man jede Menge Hausrat mit einem kleinen Lastwagen quer durch die Länder karrt, am Ende der Strecke durch ein Land, in dem die Leute nicht mal auf der richtigen Seite fahren können, um dort dann …“
„He, Moment!“ unterbricht ihn Erich. „Das Links-Fahren ist eine tolle Übung für die Konzentration und die kleinen grauen Zellen – besonders mit einem Auto vom Kontinent. Das hat etwas Esoterisches.“
„… um dort dann vermutlich festzustellen, dass die Wohnung eine Bruchbude ist.“
„Also Bruchbude würde ich es nicht nennen. Es ist nur eine Untermiete; und ob der beschränkten Wohnsituation lautet der Fachausdruck dafür eher Wohnklo. Aber lass es gut sein. Du hast ja Recht. Das war kein Urlaub, und mit dem neuen Auto sollte ich wirklich mal einen kleinen Urlaub machen. Du wirst schon sehen, irgendwann habe ich endlich einen Weg entlang aller Steckdosen von Wien nach Lissabon gefunden und dann fahre ich plötzlich weg. Also zumindest bis Salzburg oder so.“
„So weit reicht eine Akku-Tankfüllung oder dein Verlängerungskabel?“ hakt Alexander grinsend nach.
„Pfff, Banause.“
„Na gut, dann sagen wir, du meldest dich einfach, wenn du unterwegs bist, und wir werden es gemeinsam auf Herz und Nieren testen. Jetzt muss ich aber zu meinem nächsten Termin, sonst schauen sie mich dort schief an. Ich will dich ja nicht hinausschmeißen, aber da das mein Büro ist, erlaube ich mir, es zuzusperren, wenn ich gehe. Und es wäre vermutlich einfacher für dich, wenn du mitkommst, anstatt zu versuchen das Schloss von innen zu knacken.“ Alexander drängt zum Aufbruch.
„Da hast du sicher Recht. Ich wäre vermutlich ein denkbar schlechter Ein- und Ausbrecher.“ Erich geht wieder in sein eigenes Büro zurück.
„So, das war’s für heute“, murmelt Erich leise, während er sich auf den Heimweg macht.
Flugs fährt er wieder nach Hause, stöbert wie immer im Kühlschrank und macht es sich dann mit zwei Wurstbroten vor dem Fernseher gemütlich, geht aber dann in seine Bibliothek. Hier stapeln sich – teilweise fein säuberlich nach Themen geordnet, teilweise etwas chaotisch – tausende Bücher. Erich fährt mit dem Finger entlang der Buchrücken des Noch-Lesen-Stapels. Bei einer dicken Schwarte bleibt er hängen. „Oben-unten-drinnen. Hmmm, das sind fast tausend Seiten.“ Er zieht es heraus, und bläst nach alter Gewohnheit über die Oberkante, um sicherzugehen, dass da kein Staub ist. „Zeit für ein neues Buch. Bei der Dicke brauche ich wohl sicher bis in den Herbst.“
Erich holt sich noch ein Glas Rotwein aus dem Weinkeller, dreht die Leselampe auf macht es sich auf einem alten Fauteuil gemütlich. Nach vierzig Seiten legt er ein Lesezeichen in das Buch und klappt es zu.
„Ah, ein Roadmovie in Buchform“, überlegt er. „Die Hauptfiguren sind eigentlich ganz interessant. Ich bin schon gespannt, wenn es dann wirklich losgeht. – Aber ein bisschen unrealistisch. Wer verbringt schon sein Leben oder einen Teil davon als Roadmovie?“
Erich legt das Buch zu seiner Aktentasche und verschwindet im Schlafzimmer.
Kapitel 3. Der Rat der Mutter
Sa, 1. Juni
Wie jedes zweite Wochenende verbringt Erich den Samstagnachmittag bei seiner Mutter.
„Und? Wann stellst du mir endlich mal wieder eine neue Freundin vor?“, fragt diese ganz neugierig. „Ich glaube, du hast lange genug getrauert.“
„Weißt du, das ist gar nicht so einfach. Also nicht, dass ich viel Zeit mit Suchen verbringe, aber ich glaube, das wird nichts. Da bin ich wahrscheinlich früher ein Tattergreis, bevor ich eine neue Freundin finde, die auch nur annähernd an Daniela rankommt.“
„Deine Tochter braucht eine Mutter – das kann ich dir als Mutter sagen.“
„Meine Tochter – deine Enkeltochter – ist erwachsen und studiert mittlerweile im Ausland. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt eine Mutter braucht. Bei den Lebenserhaltungskosten in London braucht sie einen gut betuchten Freund, am besten irgendeinen superreichen Oligarchen – möglichst einen unbekannten. Nur die gibt es leider nicht wie Sand am Meer. Und außerdem ist sie in den nächsten sechs Wochen ohnhin irgendwo auf einer Studienreise fernab dessen, was Du Zivilisation nennst.“
„Du lenkst ab – und übrigens verwendest du wieder mal die falschen Fachausdrücke. Du weißt, dass die Bezeichnung Oligarch für einen reichen Mann aus dem Osten schlichtweg falsch ist.“
„Ja, ich weiß, dass Oligarchie die Herrschaft der Wenigen bedeutet“, seufzt Erich. „Aber du als passionierte und pensionierte Lehrerin für Latein und Altgriechisch bist wahrscheinlich eine der wenigen, die das so sieht. – Und die alten Griechen selbst sind seit vielen Jahren ausgestorben.“
Erichs Mutter holt tief Luft, doch bevor sie noch etwas erwidern kann, wechselt Erich das Thema und beendet die Diskussion: „Wie gesagt, es ist ohnehin unwahrscheinlich. So etwas wie heimliche Superreiche gibt es in Österreich ohnehin nicht. Zumindest kenne ich keine.“
Kapitel 4. Die Ausfahrt
So, 2. Juni
Am Sonntag besucht Erich am Nachmittag Alexander und seine Frau. Gemeinsam fahren sie mit dem Tesla von Erich herum.
„Und wo ist da jetzt die Batterie?“, fragt Alexander, als er sieht, dass sowohl vorne als auch hinten ein Kofferraum zur Verfügung steht.
„Das Auto ist die Batterie. Überall darunter sind Laptop-Akkus verbaut.“
„Und das beunruhigt dich nicht? Das sind doch jede Menge Akkus. Man hört doch immer, dass die manchmal explodieren.“
Erich sieht kein Risiko. „Nein, das kann nicht passieren. Die sind so gut verbaut und geschützt. Angeblich ist das auch bei einem Unfall oder Aufprall noch sicher.“
Nach einer ausgiebigen Jause fährt Erich wieder nach Hause.
Kapitel 5. Der Unfall
Mo, 3. Juni
Am nächsten Tag kontrolliert Erich seine Aktentasche und entdeckt dabei wieder das Manuskript von Katrin. Er zieht es vorsichtig heraus und schlägt es bei seiner Markierung vom Vortag auf. Mit neuem Elan beginnt er weiterzulesen, um jetzt mit Sicherheit festzustellen: „Da kann definitiv etwas nicht stimmen.“
Mittlerweile ist sein Ehrgeiz geweckt. Es reizt ihn, herauszufinden, wo der Fehler liegt. „Hier ist offensichtlich irgendwas mit diesen Zuordnungen falsch. Soviel Geld kann gar nicht fehlen, wie sie hier errechnet hat … und schon gar nicht kann es unbemerkt verschwinden“, überlegt er laut.
Erich kramt sein Notebook heraus und schickt eine E-Mail an Katrin: „Danke für die Erklärungen. Ich muss Ihnen Recht geben. Ich erkenne die erwähnte Diskrepanz. Können wir uns heute um 17:30 nach meiner Vorlesung in meinem Büro treffen, um die Auflösung des Knotens und die nächsten Schritte gemeinsam zu besprechen?“
Er spricht mit sich selbst: „S – S – S – S ... Senden – schließen – shut-down - schwupp.“ Er klappt das Gerät zu und verstaut es in seiner Aktentasche.
Erich geht in die Garage, zieht den Ladestecker aus seinem Tesla und nimmt im Auto Platz. Er atmet einmal kurz durch und genießt den Duft nach neuem Auto. Dann öffnet er das Tor und fährt oder – wie Erich es auszudrücken pflegt – gleitet in Richtung Universität.
Der Tag selbst vergeht wie im Flug. Mittags schafft Erich es, endlich wieder einmal die Mensa aufzusuchen. Auch wenn das kein Hauben-Lokal ist, so geht er doch gerne hierher essen. Meistens trifft man Kollegen – Professoren beziehungsweise Assistenten – oder Studenten aus höheren Semestern, mit denen man etwas über die Tagespolitik, die Wirtschaft oder neue technische Spielereien fachsimpeln kann. Und wenn nicht, so kann man doch gut, günstig und relativ zügig essen.
Beim Eingang entdeckt er Alexander, der gerade nachdenklich die Video-Kameras im Bereich der Essensausgabe betrachtet, und spricht ihn an. „Na, Herr Dekan ... Verzeihung ... Eure Spektabilität! Hast du die Dinger angeschafft, damit sie dir beim Kalorien zählen helfen?“, fragt Erich.
„Hallo Erich! Schön wär‘s“, antwortet Alexander. „Das wäre mal eine sinnvolle Verwendung. Ich könnte so eine App gebrauchen – vor allem, wenn sie dann auch gleich die Größe der Portion festlegt, die ich noch essen darf. Zumindest würde meine Frau das gutheißen – natürlich nur unter der Voraussetzung, sie zählt die richtigen Einheiten: nicht Kalorien, sondern Joule.“
Erich schmunzelt und betrachtet demonstrativ Alexanders Bauch, der zumindest als sehr wohlgenährt tituliert werden kann. „Ich weiß, das Essen macht wieder Spaß: Seit wir nicht mehr Kalorien sondern Joule zählen, dürfen wir viermal mehr davon in uns reinstopfen.“
Alexander erklärt: „Aber Spaß beiseite! Die Kameras wurden von der Mensa-Verwaltung angeschafft und haben nichts mit der Universität oder irgendwelchen Experimenten zu tun. Angeblich damit niemand vergisst, sein Essen zu bezahlen.“
„Und dann?“, fragt Erich weiter. „Wie plant ihr die Leute zu identifizieren?“
„Wir gar nicht. Wie gesagt: das ist die Mensa-Verwaltung. Sie wollen die Gesichter nicht öffentlich publizieren, sondern vermutlich die Bilder den Leuten an der Kassa geben. Dann können die sie identifizieren, wenn sie wieder kommen.“
„Ein typischer Fall von Denkste“, schmunzelt Erich.
„Denkste? Warum denn?“
„Naja, die Leute die grundsätzlich nicht zahlen, kommen auch nicht an der Kassa vorbei. Wie soll man sie dort erwischen?“
„Du hast Recht, vielleicht verfolgen sie sie auch mit anderen Kameras weiter ... und spätestens an der Mensa-Grenze ist dann Schluss. Aber mit ein paar guten Hackern kann man sicher einzelne Leute quer durch Wien verfolgen“, vermutet Alexander, während sie sich mit ihrem Essen an einen freien Tisch setzen.
„Nicht nur durch Wien, durch alle Metropolen, über alle Flughäfen, alle Bahnhöfe und mit ein bisschen Geschick um die ganze Welt“, ist sich Erich sicher.
„Und wie kann man dem entgehen?“
„Da gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder man findet dich nicht oder man sucht dich nicht: also aussteigen oder dahinscheiden.“
„Danke, aber beides finde ich nicht erstrebenswert“, winkt Alexander ab.
Erich zuckt mit den Schultern und isst weiter sein Schnitzel. „Wie du meinst.“
Nach der Verabschiedung von Alexander verbringt Erich den Nachmittag mit der Vorbereitung einer seiner Vorlesungen, die er für das nächste Semester neu überarbeiten möchte: Wirtschaftskriminalität. Sein Freund Polizeioberst Sklodowski und er haben nämlich festgestellt, dass sich die Kriminalität in den letzten Jahren so stark geändert hat, dass die bisherige Vorlesung, die sie immer gemeinsam im Wintersemester abhalten, nicht mehr zeitgemäß ist.
Einerseits werden die Kriminellen und die Exekutive immer besser. Das führt dazu, dass die Kleinen und Neulinge in der Branche es oftmals mit alten Ideen versuchen, die die Polizei längst kennt. Daher werden sie schnell erwischt. Die Großen und Erfahrenen andererseits, also das organisierte Verbrechen, Polit- und Finanz-Insider, Firmen- und Scheinfirmen-Geflechte oder alteingesessene „Abgaben-Optimierungsnetzwerke“ liefern sich jedoch ein hartes Duell mit den Strafverfolgungsbehörden und kommen oft straflos davon – entweder am Rande der Legalität oder, weil sie durch ihr gewieftes Vorgehen nicht ertappt werden.
Erich ärgert sich bei der Gelegenheit wieder einmal, dass reiche Leute es vermeiden, Steuern zu zahlen, während die armen keine Chance haben und auch noch die Volkswirtschaft miterhalten müssen. „Irgendwann werde ich denen mal die Meinung geigen“, denkt er für sich. „Irgendwann ist aber nicht heute.“
Nach seiner Nachmittagsvorlesung eilt Erich in sein Büro zurück. An der Tür wartet bereits Katrin und grüßt. „Grüß Gott, Herr Professor! Danke, dass Sie so kurzfristig Zeit haben.“
„Gerne! Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich.“ Erich ist gut gelaunt. „Bitte kommen Sie weiter, Frau Kollegin!“
Katrin betritt das Büro. Erich folgt ihr und schließt die Tür. „Nehmen Sie Platz! Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten?“ Zügig strebt Erich zu seiner Espresso-Maschine. Aus dem Augenwinkel erkennt er, wie Katrin die Jacke ablegt, aus ihrem Rucksack eine dicke Mappe herausholt und auf einem Fauteuil Platz nimmt. „Wirklich sehr hübsch“, denkt er, „aber sie scheint wohl schon etwas länger zu studieren... Erich, zusammenreißen und sachlich bleiben!“, fordert er sich selbst auf.
„Nein, danke, ich bin eine Tee-Trinkerin“, entgegnet Katrin.
„Was, wie, … ach so. Damit kann ich leider nicht dienen.“ Erich wirkt kurz als ob er gegen eine unsichtbare Wand gelaufen wäre. Selten lehnt jemand seinen Kaffee, auf den er so stolz ist, ab. „Und meine Sekretärin ist leider nicht mehr da. Die wüsste, wie man Tee kocht“, erklärt er. „Sie erlauben trotzdem?“ Erich bereitet für sich einen Espresso zu und nimmt auf der Couch Platz.
Katrin wartet geduldig, bis Erich an seinem Kaffee genippt hat.
Erich fällt gleich mit der Tür ins Haus: „So, Kaffee ist angeboten, das war genug des Smalltalks. Wie geht es Ihnen mit der Aufgabenstellung der Diplomarbeit – Entschuldigung, ich meine natürlich Master Thesis? Ich lese, Sie kommen nicht weiter. Ich muss zugeben, dass ich aus der Zusammenfassung auch nicht schlau werde. Wo liegt denn das Problem?“
Katrin, die es sich gerade etwas gemütlich gemacht hat, setzt sich plötzlich gerade hin, als ob sie unvermutet ihren Namen gehört hätte. Kurze Pause. „Ich dachte, Sie hätten die Lösung. Zumindest habe ich Ihre Mail so interpretiert.“
„Nein, nicht dass ich wüsste“, bremst sie Erich. „Ich bin genauso schlau wie Sie … also zumindest in diesem Thema“, setzt er nach. „Die Lösung müssen Sie schon finden. Schließlich ist es Ihre Arbeit. Aber ich helfe Ihnen gerne dabei.“
„Aha, ich sollte aufhören zwischen den Zeilen zu lesen“. Katrin wirkt plötzlich wieder um fünf Zentimeter kleiner.
Sie beginnt, Erich die Ungereimtheiten zu schildern: „Die Fragen ‚Wieviel Geld gibt es auf der Welt? Und wer besitzt es?‘ oder wie besprochen ‚Die lokale Verteilung von Barreserven im internationalen Vergleich – eine historische Betrachtung der zwischenstaatlichen und finanzmarkttechnischen Geldzu- und -abflüsse des 20. und 21. Jahrhunderts‘ wären eigentlich gar nicht so schwierig. Alle Staaten haben Nationalbanken, die diese Informationen regelmäßig berichten. Alle Banken haben ihre Jahresberichte. Und man sollte doch meinen, dass das in Summe zusammenpasst. Der eine gibt es, der andere nimmt es. Fertig. Aber unterm Strich passt es eben nicht. Unterm Strich, wenn man alle Abweichungen zusammenzählt: Das Delta ist zu groß.“
Erich begutachtet die Zahlen und blickt einige Zeit auf die Gesamt-Differenz Delta am Ende der Aufstellung. „Haben Sie die Ausgabe von neuem Geld berücksichtigt?“ fragt er.
„Selbstverständlich. Und die Vernichtung von Geld und einen Schwund bzw. Verlust im Alltag hochgerechnet. Und die Geldfälschung sogar auch noch.“ Katrin seufzt leicht. „Alles … wirklich alles, wo Geld mehr oder weniger wird, ist berücksichtigt. Ich habe sogar kurz bei der Polizei und Interpol nachgeforscht, wie viel Geld durch Bankraube und bei Überfällen abhanden kommt – im Vergleich zur Diskrepanz ganz wenig.“
„Und ein einfacher Rechenfehler im Computer wegen der Größe der Zahlen – aus welchen Gründen auch immer?“
„Nein, ist es nicht – das habe ich geprüft. Und wir sind bei weitem noch nicht in den Dimensionen am Rande der Mathematik, wo die Summe aller natürlichen Zahlen bis zur Unendlichkeit minus ein Zwölftel beträgt.“
„Ja, es gibt auch verhaltenskreative Zahlen. Leider sind wir hier nicht in der String-Theorie oder der theoretischen Physik, wo wir uns solche Kunstgriffe erlauben können.“
Katrin witzelt: „Erst mal die wirklich schwierigen Mathematik-Probleme der Geld-Transaktionen lösen. Danach kann ich die mathematischen Grundlagen der Stringtheorie mit links wiederlegen, wenn ich ein bisschen Zeit habe.“
Erich versucht weiter, die Zahlen in Katrins Manuskript zu verstehen. „Also eigentlich müsste es doch ausreichen, wenn man sich jeweils ein Jahr anschaut. Auch wenn man nur ein Land getrennt ansieht“, grübelt er. „Aber sie haben Recht, irgendwo ist immer noch ein Fehler. Die Geldbewegungen stimmen nicht – besonders über die Landesgrenzen, aber auch in einigen Ländern. Es sieht so aus, als ob hier irgendwo Geld in der Rechnung versiegt – und zwar in wirklich großen Mengen.“
„Und bevor Sie fragen: Ich weiß, dass ‚one billion US dollar‘ auf Deutsch eine Milliarde US Dollar entspricht – und ‚one trillion‘ einer Billion. Und genau deshalb habe ich alles diesbezüglich nochmal kontrolliert und nachgerechnet.“
Erich hat gerade Luft geholt, um genau diesen Grund als die Erklärung schlechthin zu präsentieren. Er macht den Mund langsam wieder zu.
Die Zeit vergeht wie im Fluge, während die beiden Zahlen wälzen, alle Möglichkeiten auf dem Whiteboard skizzieren, löschen und erneut die Daten analysieren.
Zwei weitere Stunden vergehen rasch.
Erich ist in seinem Element, er genießt die Diskussion sichtlich. Seine ursprüngliche Einschätzung von Katrin als dummer Blondine, die nicht mal ein paar Zahlen zusammenzählen kann, schwindet rasch.
Im Moment macht es Erich Spaß: eine hübsche Frau, lange Zahlenreihen und ein kniffliges Rätsel. „Was will man mehr?“, denkt er mit einem leichten Lächeln auf den Lippen – vermutlich ein bisschen zu laut.
„Wie bitte?“ Katrin versteht ihn zwar nicht wirklich, aber als sie nachfragt, merkt Erich, dass seine Gedanken plötzlich etwas abgeschweift waren. „Ach nichts“, beeilt er sich nachzusetzen. „Mir fällt dazu gerade ein Zitat aus „The Adventure of the Beryl Coronet“ ein.
Doch Katrin nimmt das Thema einfach auf und setzt fort: "Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag." Sie lächelt: „Ich habe in meiner Jugend auch mit Begeisterung Detektiv-Romane und natürlich besonders gerne Sherlock Holmes gelesen.“
Schlussendlich stehen sie vor dem Whiteboard, linker Hand eine leere Spalte mit der Überschrift „Mögliche Erklärungen“, rechter Hand viele Punkte unter „Ausgeschlossen“ zusammengefasst.
„Ich schlage vor, wir lassen es mal für heute gut sein.“ Erich seufzt und digitalisiert den Inhalt durch ein paar Klicks auf seinem Notebook. Katrin zückt ihr Smartphone und macht auch noch ein Foto damit. „Du sollst immer eine Datensicherung machen“, meint Katrin. „Genau“, pflichtet ihr Erich zu, „Regel 7: Du sollst ein Backup machen.“
„Was denn für eine Regel?“ Katrin dreht sich verblüfft um, während sie ihr Telefon wieder in ihrem Rucksack verschwinden lässt.
„Das ist eine lange Geschichte. Ich habe im Lauf der Zeit ein paar einfache Regeln erarbeitet, mit denen das Leben deutlich einfacher ist - für mich selbst und auch für meine Mitmenschen. Die meisten Leute, die mit mir an einem Projekt oder ähnlichem gearbeitet haben, haben sie mittlerweile auch schon mitbekommen. Manche Kollegen und Freunde haben sich sogar mit einer eigenen Regel verewigt.“
„Ah, steht ‚Du sollst dich nicht täuschen.‘ schon auf Ihrer Liste?“
„Nein, aber wenn es sich als sinnvoll herausstellt, werde ich die Regel gerne aufnehmen.“
Erich prüft seinen Terminkalender in seinem Smartphone und schlägt vor: „Lassen wir unsere kleinen grauen Zellen das Ganze etwas verarbeiten. Vielleicht fällt einem von uns ja in der Zwischenzeit eine Lösung ein. Wie wäre es mit einem Folgetermin am Donnerstag? Um 13:00 Uhr? Dann können wir uns den ganzen Nachmittag dem Thema widmen. Es wäre doch gelacht, wenn wir den Grund für das Delta nicht finden.“
„13:00 Uhr ist sehr gut.“ Katrin bestätigt den Termin sogleich auf ihrem Smartphone, als Erich ihn aussendet. „Und wenn Ihnen in der Zwischenzeit eine Idee kommt, können sie mich gerne anrufen.“ Bevor sich die Gelegenheit ergibt, hier etwas falsch zu verstehen, setzt Katrin nach „… und mir die Lösung verraten.“ Katrin reicht Erich eine Visitenkarte, die Erich sogleich durch seinen Visitenkarten-Scanner laufen lässt.
Verblüfft schaut Erich zu Katrin: „Diplom-Ingenieurin?“
„Ja, Diplom-Ingenieurin. Ich habe vor Wirtschaftsinformatik schon mal Technische Chemie studiert. Aber das ist eine lange Geschichte. Die meisten Leute, die mit mir an einem Projekt oder ähnlichem gearbeitet haben, lernen sie auch kennen.“ Katrin schmunzelt.
Erich packt seine Aktentasche, wirft einen kurzen Blick auf seine To-Do-Liste. „Alles erledigt für heute. Ich vermute, Sie machen sich auch auf den Heimweg?“
Katrin nickt. „Ja, ich habe heute keine Late-Night-Vorlesung.“
Gemeinsam gehen sie durch die mittlerweile leeren Gänge zielstrebig dem Ausgang zu.
Als sie hinausgehen, wirft Erich einen prüfenden Blick auf das Schuhwerk von Katrin. „Passen Sie auf, dass Sie mit den hohen Absätzen nicht in der Erde versinken. Eine Sauerei, diese Baustelle. Und dann lassen sie noch ihr Zeug hier überall herumstehen und -hängen.“
Er deutet auf die Glasfassade gegenüber und senkrecht nach oben. Dort sieht man die Spiegelung des Krans und die Kreissäge, die von diesem herabhängt.
Erich hat den Satz noch kaum vollendet, als er ein leises „Twängg“ hört und plötzlich von Katrin zur Seite gestoßen wird. Erich stolpert und stürzt. Nur Sekundenbruchteile später knallt es neben ihnen.
Als der Lärm verstummt richtet sich Erich auf. Er sitzt auf der Erde und blickt verdutzt um sich.
Einige Meter entfernt rappelt sich gerade Katrin auf. Im Gegensatz zu Erich ist sie nicht auf Erde gelandet, sondern mitten in einer großen Wasser- und Schlammlacke. Sie streicht sich mit einer Hand langsam durch das Gesicht und versucht danach, den gröbsten Schmutz aus dem Dekolleté zu entfernen. Beides verschmiert sie aber nur noch mehr.
„Was war denn das?“ Erich findet langsam wieder Worte.
Sichtlich aufgeregt stammelt Katrin: „Die Kette ist gerissen ... die, an der die Kreissäge gehangen ist ... Und die Maschine ist auf uns zugefallen. ... Keine Zeit für Erklärungen ... und noch weniger für langes Nachdenken ... Ich habe einfach nur reagiert ... Ich musste Sie so fest weggestoßen ... und damit auch mich.“
Erich ist mittlerweile aufgestanden. Er geht um den Haufen Schrott und reicht Katrin die Hand zum Aufstehen. „Danke sehr, ich glaube Sie haben uns beiden das Leben gerettet.“ Dabei merkt Erich, dass Katrin etwas zittert. Und vermutlich liegt das nicht an der Temperatur oder an der nass gewordenen Kleidung. Auch er spürt den Adrenalinschub.
Katrin fasst sich und nimmt den Dank mit zurückhaltender Bescheidenheit hin. „Nicht der Rede wert. Das war die klassische Physik, die uns gerettet hat. Actio est reactio – wie wir nicht Latein sprechenden Naturwissenschaftler zu sagen pflegen.“
„Was ist denn hier los? Und was hat das Chaos hier mit Aktien zu tun?“ Die sonore Stimme des Portiers lässt beide zusammenfahren. „Ist jemand verletzt? … Ah, Herr Professor, Sie sind es. Was machen Sie denn da?“ Die beiden drehen sich um. Prüfend beginnen sie an sich herunterzuschauen, als Katrin plötzlich mit der Hand auf den Oberarm von Erich zeigt. „Sie bluten da ja.“ Anscheinend hat sich ein Teil, möglicherweise das Sägeblatt oder ein anderes Bruchstück, beim Aufprall in ein Geschoss verwandelt und eine blutende Schnittwunde hinterlassen.
Der Portier nimmt sein Funkgerät und verständigt einen Kollegen vom Wachpersonal, „Ja, es gab hier einen Unfall, wir haben einen Verletzten. Bitte verständige Polizei und Notarzt!“
Es dauert nicht lange, und im Innenhof des Universitätsgebäudes stehen ein Polizeiwagen und ein Notarztwagen. Nach Beurteilung der Situation schickt der Notarzt den mittlerweile auch eingetroffenen Rettungswagen wieder weg. Während er die Wunde von Erich untersucht, säubert und wieder zusammennäht, nimmt ein Polizeibeamter den Unfallhergang auf.
In der Zwischenzeit sammeln sich, angelockt vom Lärms und der Präsenz der Einsatzfahrzeuge, sogar ein paar Schaulustige. Einige fotografieren mit ihren Mobiltelefonen und versuchen zu erfahren, was genau passiert ist. Die Polizei ist jedoch bemüht, diese Leute zum Weitergehen zu bewegen.
Zwei Polizisten sichern und dokumentieren in der Zwischenzeit alle Beweise, einer fotografiert die Einzelteile der Kreissäge und der abgerissenen Kette. Der zweite Polizist äußert sich überzeugt, dass es sich um eine produktionsbedingte Schwachstelle handelt, sodass die Kette – obwohl noch relativ neu – doch einfach durchgebrochen ist. Das Bruchstück selbst kann jedoch nicht gefunden werden.
Er notiert noch die Kontaktdaten aller Beteiligten und erstellt ein Protokoll des Unfallhergangs. „Ich denke, dass wir das relativ rasch zu den Akten geben können. Für mich ist das eine klare Sache: Unfall. Das gibt wohl eine Anzeige für die Baufirma.“
Erich bietet Katrin sein Sakko an. „Damit Sie nicht frieren und sich auf dem Heimweg nicht verkühlen. Oder darf ich Sie mit dem Auto nach Hause bringen? Oder noch besser zum Abendessen einladen? Schließlich haben Sie mir das Leben gerettet.“
Katrin schaut ihn mit großen Augen an, sodass Erich nachsetzt: „Ich denke, ich schulde Ihnen mehr als ein einfaches ‚Danke-Schön‘.“
Katrin winkt dankend ab. „Danke, ich muss ablehnen. Ich habe heute Abend schon was vor.“
„Und einfach mal zu einem ausgedehnten Frühstück?“
„Darüber können wir reden.“ Katrin lächelt mittlerweile wieder.
„Gut, morgen Früh im Café Grünspan? Das ist am Elisabethplatz. Acht Uhr?“, schlägt Erich vor.
„Ist neun Uhr auch noch möglich? Ich bin kein Frühaufsteher“, versucht Katrin ihn etwas zu bremsen.
„Sehr gut. Dann treffen wir uns um neun Uhr dort. Schönen Abend.“ Erich schüttelt Katrin noch die Hand und begibt sich in Richtung Garage, und Katrin geht zum Hauptausgang.
Beim Auto angekommen fällt Erich plötzlich auf, dass er gar kein Sakko mehr dabei hat. Er lächelt. Schon lange hat er keiner Frau mehr ein Sakko angeboten. „Erich, lass den Blödsinn!“, sagt er leise zu sich, „Regel Nr. 24: Du darfst dir nichts mit deinen Studentinnen anfangen.“ Innerlich denkt er jedoch den Gedanken weiter: „Blöde Regel eigentlich.“
Fröhlich pfeifend steigt er in den Wagen und fährt wieder auf leisen Elektrosohlen nach Hause.
Kapitel 6. Das Frühstück
Di, 4. Juni
Erich wacht etwas früher auf als sonst. Da er nicht wieder einschlafen kann, steht er auf und beginnt den Tag in seinem Fitness-Center im Keller, gefolgt von einer langen Dusche.
Genüsslich steht er unter dem sanften warmen Wasser der Regendusche, das den Körper hinabrinnt. Vorsichtig achtet er darauf, den Verband an seinem Arm nicht nass zu machen, und streckt diesen steil nach oben. Er prüft den Verband und drückt aus reiner Neugier mit dem Daumen darauf, um sogleich zusammenzuzucken.
Erich beginnt sich anzuziehen und steckt zwei Stück Toastbrot in den Toaster. Nachdem die Brote fertig sind, streicht er Butter und Honig darauf. Erich bezeichnet sich selbst als Frühstücksfetischist. Er kann nicht mit leerem Magen außer Haus gehen, selbst wenn er direkt zu einem Frühstückstermin eilt. Ein prüfender Blick auf die Uhr zeigt ihm, dass es langsam Zeit wird aufzubrechen. Also klemmt er seine Aktentasche unter den Arm, kontrolliert, ob alle Türen und Fenster verschlossen sind, und geht in den Keller.
Bevor er in sein Auto steigt, schaltet er noch die Alarmanlage des Hauses scharf. Dann gleitet er aus der Garage. Das Navigationssystem führt ihn zum Café Grünspan. Wirklich notwendig wäre die digitale Navigation nicht, Erich ist schon oft dort gewesen und weiß genau, wie er dorthin fährt. Er nützt einfach jede Gelegenheit, sich mit den elektronischen Helferleins seines Autos vertraut zu machen.
Unterwegs klingelt das Handy. „Ja, Mama, was gibt es denn, dass du so früh anrufst?“
Erichs Mutter ist eine zutiefst neugierige und dynamische Person. Auch wenn sie längst in Pension ist, wird Erich weiterhin ihr kleiner Sohn bleiben. Sie ist etwas aufgebracht. „Ich habe gerade in der Tablette gelesen, dass du gestern einen Unfall hattest? Warum erzählst du mir nichts? Muss man dir alles aus der Nase ziehen?“ Sie bezeichnet das Tablet auch nach Jahren der Verwendung immer noch als Tablette.
Erich ist verblüfft. „Im Tablet? In den Online-Nachrichten – wen interessiert das denn? Aber keine Angst, es ist nichts passiert, nur ein kleiner Kratzer. Ich muss aber jetzt aufhören, weil ich hier einparken muss. Ich melde mich am Abend nach deinem Bauchtanz-Training und erzähl dir mehr.“
Die Parkplatzsuche gestaltet sich wie immer in der Innenstadt etwas schwierig. Insbesondere die Breite seines neuen Autos macht Erich etwas zu schaffen. „Wer rechnet denn damit, dass das Ding die Breite eines LKW hat“, grummelt er vor sich hin, findet jedoch dann doch eine geeignete Parklücke.
Zehn Minuten vor neun Uhr betritt er das Kaffeehaus - eines der letzten klassischen Wiener Kaffeehäuser, keines dieser modernen Szene-Lokale oder Fastfood-Tempel, die sich Kaffee an die Fahnen geheftet haben.
Er schließt die Eingangstür und atmet durch. Langsam saugen seine Lungen das Flair der vergangenen Jahrhunderte auf. Die bisherige Hektik bleibt vor der Tür.
Ein runder Tisch in der rechten hinteren Ecke ist frei. Erich setzt sich. Der Ober kommt zum Tisch, tut noch ein bisschen mit seinem Tuch so, als ob er Brösel entfernt, und fragt nach den Wünschen.
Erich braucht keine Speisekarte, um zu wissen, was er möchte. Er ordert ein Kaiser-Frühstück für zwei Personen, einen Melange für sich selbst und weist den Ober an, mit einer Auswahl an Tee-Sorten nochmal vorbeizukommen, wenn sein Gast eingetroffen ist.
In der Zwischenzeit kramt Erich sein Mobiltelefon heraus und versucht nachzuvollziehen, was seine Mutter wohl gemeint haben kann. Gleich auf der ersten Seite im Chronik-Teil einer Online-Tageszeitung sieht er groß ein Foto von sich und Katrin. Offensichtlich hat es einer der Schaulustigen aufgenommen. Dafür, dass er keinen Pressefotografen gesehen hat, ist die Qualität verblüffend gut. Aber was ihn noch mehr erstaunt, ist die Überschrift dazu: „Ex-Miss Austria rettet Professor das Leben.“
„Eine ehemalige Schönheitskönigin? Das hätte ich jetzt nicht vermutet“, grübelt er, um sich gleich darauf selbst in Gedanken zu korrigieren: „Naja, sie sieht schon toll aus, wirkt aber eigentlich recht natürlich. So gar nicht wie eine Beauty Queen.“
Auf jeden Fall ist Erich damit klar, warum die Presse darüber berichtet. Ein Universitätsprofessor interessiert niemanden, aber eine ehemalige Miss Austria, die jemandem das Leben rettet, lässt sich sicher besser als Story vermarkten.
Erich blättert weiter zum Wirtschaftsteil, mit dem er sonst immer die Zeitung beginnt. Hier bleibt er bei einem kurzen Nachruf hängen:
Der Journalist Hannes Klein ist beim Schwimmen vor der griechischen Küste ertrunken. Seine akribisch recherchierten aber doch pointierten und spitzzüngigen Artikel hat Erich immer gerne gelesen.
Die Zeitung veröffentlicht seinen letzten Artikel – den „Unvollendeten“, in dem er auf die derzeitige Rettungspolitik für hochverschuldete Staaten und Banken eingeht. Er schlussfolgert, dass die Unterstützungszahlungen von internationaler oder nationaler Seite in ein Fass ohne Boden gelangen, bei dem nicht klar ist, wo das herauskommt, was man oben reinwirft. Besonders die Hilfsgelder für Griechenland wirkten sich kaum positiv aus. Im letzten Abschnitt wollte er das noch genauer ausführen und auch den Ursachen auf den Grund gehen. Doch den zu schreiben, hat er nicht mehr geschafft. Genau hier prangt der Nachruf auf Hannes Klein. Der Chefredakteur hat noch ergänzt, dass die Artikelserie möglichst bald weitergeführt werden soll, aber natürlich niemand so einfach in die großen Fußstapfen eines Hannes Klein treten kann.
Pünktlich um 9 Uhr öffnet sich die Tür. Katrin kommt herein. Erich winkt ihr zu. Sie antwortet mit einem dezenten Lächeln und einem kleinen Nicken als Bestätigung.
Als sie sich dem Tisch nähert, liegt Erichs Tablet noch auf dem Tisch. „Guten Morgen, ich sehe, Sie haben die Nachrichten auch gelesen.“
Erich erhebt sich kurz und reicht die Hand. „Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, meine Mutter hat mich darauf hingewiesen.“
In diesem Moment kommt der Kellner mit einem Roll-Wagen und beginnt aufzutischen, dass sich die Balken biegen. Erich meint: „Ich habe mir erlaubt ein bisschen was zu bestellen. Ihren Tee müssen sie aber selber aussuchen“, und deutet auf eine große Holzkiste mit unzähligen Teesorten.
„Wir sind stolz darauf, die größte Auswahl an erlesenen Spitzentees in Wien anbieten zu können“, ergänzt der Oberkellner.





























