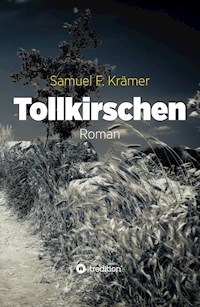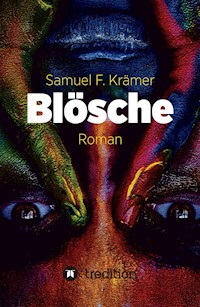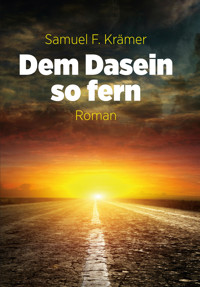
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Bergdorf fernab der weltlichen Stumpfsinnigkeit. Ein Wald voller Geheimnisse. Ein Wirtshaus voller Bücher. Eine illustre Gästeschar. – Mehr Zutaten braucht es nicht für einen aufwühlenden, beklemmenden Endzeitroman, der die Grenzen des Vorstellbaren auf der breiten Strasse des Lebens überschreitet, die voller Schlaglöcher ist und geradewegs ins Dunkel führt – oder vielleicht doch ins Licht. – Um herauszufinden, warum im Waldhüttener Wald, dem unbekannte Kräfte grossen Schaden zufügen, immer wieder Menschen verschwinden, begeben sich die Protagonisten der Geschichte auf eine abenteuerliche Reise, die sie durch Raum und Zeit führen wird, um schliesslich zur Einsicht zu kommen, dass nichts ist, wie es zu sein scheint. Höchst virtuos und auf unterhaltsame, packende Weise behandelt der Autor die grossen metaphysischen Fragen und zeigt auf, dass alles absurd und am Ende nichts von Bedeutung ist, dass die Geschichte der Menschheit vor allem eine Geschichte der Dummheit ist und sie dem Untergang geweiht ist. Die anfängliche Idylle und Harmonie vermögen nicht darüber hinwegzutäuschen, dass die Zivilisation kläglich scheitern wird, weil sie schon vor langer Zeit falsch abgebogen ist und jeglichen Fatalismus rechtfertigt, um die Erde, ihr kleines Raumschiff, mit gutem Gewissen gegen die Wand zu fahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1078
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Samuel F. Krämer
Dem Dasein so fern
Dem Ende so nah
Für meine Mutter
und meine Geschwister
© 2024 Samuel F. Krämer
Website: www.tollkirschen.ch
Coverdesign, Satz & Layout: Samuel F. Krämer
Coverbild vorne: krivosheevV, iStock
Coverbild Rückseite: PepeLaguarda, iStock
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschliesslich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung «Impressumservice», Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
«Eine neue Art von Denken ist notwendig,wenn die Menschheit weiterleben will.»
Albert Einstein (1879-1955), Physiker
1. Teil
Churchill liess kräftig einen fahren. So kräftig, dass er hernach die Luft anhielt und ernsthaft darüber nachdachte, ob er aufstehen, sein gemütliches Plätzchen verlassen und nach draussen an die frische Luft gehen sollte. Ein solcher Kraftakt widerstrebte ihm aber gehörig und er liess die Vernunft obsiegen. Eigentlich liess er die Vernunft immer obsiegen. Abgesehen davon, wie hätte er rauskommen sollen. Türen öffnen konnte er nicht. Und sein Herrchen war im Keller und hantierte mit leeren Flaschen rum. Gut, er hätte für Radau sorgen können, so richtig losbellen. Bis sein Herrchen nach oben gekommen wäre und ihm die Tür geöffnet hätte. Aber auch das widerstrebte ihm. Es war ja kein Notfall. Und schliesslich war er eine Englische Bulldogge. Und Englische Bulldoggen bellen nicht wild drauflos. Nein, so was ziemt sich nicht für einen Hund wie Churchill. Für einen englischen Hund. Er war gut erzogen. Wenn man von den gelegentlichen Winden, die er fahren liess, absah, war Churchill ein beinahe perfekter Hund. Nicht für jedermann. Bestimmt nicht. Aber für Menschen wie sein Herrchen war er das. Sie beide passten hervorragend zusammen.
Churchills Herrchen war immer noch im Keller zugange, als die Eingangstür geöffnet wurde – genau im selben Moment, als Churchill erneut ordentlich einen fahren liess. Der Hund hob den Kopf, rümpfte die platte Nase, öffnete die Riesenschnauze und fuhr seine unendlich lange Zunge aus. Er grinste wie ein böser Clown, fing an zu hecheln und erhob sich von seinem Plätzchen. Endlich auf allen vieren, schüttelte er sich unbeholfen, bevor er krummbeinig zur Tür trottete, die ihm der verhasste Gast offenhielt.
«Raus mit dir, du furzende Missgeburt», sagte Adam Ambühl lächelnd.
«Schnauze, du stinkender Mensch», dachte der Hund Churchill und hätte diesem Tier ohne Eigenschaften am liebsten in die linke Wade gebissen. Oder in die rechte.
Churchill mochte den Typen nicht, der Adam Ambühl hiess und jeden Morgen um zehn Uhr seinen Fuss ins Lokal setzte. Darum ging er jeweils nach draussen, sobald der ungeliebte Mensch die Gaststube betrat. Für beide hatte es keinen Platz – und die Vernunft obsiegte abermals. Dieser Mensch roch fürchterlich. Ja er stank richtiggehend. Mehr als andere. Zumindest für eine Kreatur mit sehr ausgeprägtem Riechorgan. Für einen Hund wie Churchill. Der Kerl roch nach vielem: nach Knoblauch, nach Salbei, nach Mottenkugeln, nach Schweiss, Pisse, Scheisse und Sperma, nach Zigaretten und Stumpen und hin und wieder nach einer Zigarre, nach billiger Seife und anderen Toilettenartikeln. Churchill roch Adams stinkende Füsse beim Vorbeidackeln so intensiv, dass er beinahe umgekippt wäre. Er hielt die Luft an, bis die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen war. Was waren schon Hundefürze im Vergleich zu dieser olfaktorischen Drangsal menschlichen Ursprungs? Nichts! Für Churchill war dieser Kerl ein Musterbeispiel des schlechten Menschen an sich: verkommen, allen Lastern ergeben, von bösartigem Charakter und roher Sinnesart. Dabei war Adam Ambühl ein netter, umgänglicher und hilfsbereiter Kerl. Mit seiner Einschätzung lag Churchill definitiv falsch.
Churchill machte es sich draussen unter der Sitzbank an der Hausmauer bequem und schloss die Augen. Es lohnte sich nicht, die Augen offenzuhalten. Erstens, weil es nichts zu sehen gab, und zweitens, weil er sowieso schlecht sah. Churchill setzte auf Ohren und Nase. Er hörte den ungeliebten Gast nach seinem Herrchen rufen.
«Dieser Scheisskerl», dachte Churchill, «glaubt doch tatsächlich, ich sei einem Gruselkabinett entlaufen. Da täuscht sich dieser stinkende Haufen Fleisch auf zwei Beinen aber gewaltig. Weder entstamme ich einem Gruselmärchen, noch komme ich von einem andern Stern. Vielmehr wurde ich hineingeworfen in diese Welt, in dieses Dorf voller Irrer. Ein Dorf, das wie kein anderes steht für das monströse Panoptikum einer verrückten Dorfgemeinschaft. Eine Horde miefender Individuen, die nicht kapieren und noch weniger wahrhaben wollen, dass die Welt sie vergessen hat.»
Churchill grunzte wie ein Schwein. Vielleicht war es auch ein Lachen. Und furzte abermals.
«Verdammte Blähungen!», dachte der Hund. «Kein Wunder bei dem Frass, den ich gestern bekommen hab!»
Schwere, kräftige, überzüchtete Hunde wie Churchill pupsen bestimmt häufiger als normale Hunde. Vor allem im fortgeschrittenen Alter. Churchill war ein besonders schwerer Hund seiner Rasse. Zu seinen besten Zeiten brachte er es auf knapp vierzig Kilogramm. Da überlegt man es sich gut, ob man einen Schritt tun soll oder nicht. Ob Churchill wusste, dass er mit seinen zehn Jahren sozusagen auf der Schwelle des Todes stand, ist nicht bekannt. Aber das war ihm egal. Vielleicht wissen Hunde gar nicht, wie alt sie sind. Oder aber alte Hunde werden wie viele Menschen dement und wissen nicht, dass sie ein Hund sind.
«Blödsinn!», dachte Churchill. «Wir Hunde sind nicht so unverschämt und werden älter, als es uns zusteht. Das tun nur Menschen!»
Churchill döste ein und träumte. Er war zusammen mit anderen Hunden auf der Jagd. Entschlossen, furchtlos und bereit, bis zum Tod zu kämpfen. Wie eine richtige Bulldogge eben. Wie ein richtiger Held. Nicht dass Churchill einer jener Kraftkerle war, die andern und sich selbst ständig etwas beweisen müssen. Nein, so einer war Churchill zu keiner Zeit, zumal er wusste, dass Heldentum ein Euphemismus für Dummheit ist. In seinen Träumen aber war Churchill durchaus und gerne ein Held und er verglich sich zuweilen mit den mythologischen Helden, diesen kraftstrotzenden Figuren, die Übergrosses vollbrachten. Das waren noch richtige Kerle, keine Schmalspurhelden, wie sie heute überall herumlungern. Keine infantilen, grossmäuligen Idioten wie Donald Trump und seinesgleichen, die sich für Hulk halten und bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihren Gegenspielern kindische verbale Auswürfe um die Ohren schleudern, ohne jemals zu kapieren, dass sie als psychopathische Populisten zum Scheitern verurteilt sind. Ihre eruptive Engstirnigkeit wird nicht nur ihnen selbst zum Verhängnis, sondern reisst alles andere mit in den Abgrund. Churchill grunzte. Der klassische Held ist schon lange von der Bildfläche verschwunden. Was übrig blieb, ist kaum der Rede wert: ein auf Lebensgrösse geschrumpfter Held. So einer kann jeder sein. Sogar der miefende Adam Ambühl. Eigentlich hatte jeder Bürger von Waldhütten das Zeug zum Schrumpfhelden. Jeder konnte auf seine Art ein verhinderter Held sein, jetzt, wo vom Patriarchat nichts mehr übrig geblieben ist ausser Sexismus und Misogynie. Auf der Stierenjagd aber stimmte die Welt noch. Da wurde der männliche Heroismus ausgelebt. Ja. Das gefiel Churchill.
Viele Gäste im Dorfkrug wollten auch Helden sein und versuchten, meist vergeblich, ihre verlorengegangene Männlichkeit durch fragwürdige Handlungen immer wieder zu bestätigen. Sie fühlten sich zu vorgerückter Stunde als Helden, nur weil sie ein Bier nach dem andern hinter die Binde gekippt hatten.
«So einer ist auch Adam Ambühl», dachte Churchill und grunzte. «Ein heldenhafter einsamer Trinker, der schon lange am Zustand der Welt verzweifelt, weil er an ihr tragisch gescheitert ist.»
Auf der Jagd erwachten Churchills schlummernde Leidenschaften. Erstaunlich, wie sich seine phlegmatische Veranlagung in Erregung, ja Rausch wandelte. Churchill grunzte. Oder war es ein Schnarchen? Egal. Er war auf der Jagd nach Stieren. So wie es schon seine Vorfahren getan haben. Ja, er und seine Brüder und Schwestern hatten es schon immer im Blut: das Jagen – Churchill liebte diese diffuse, instinkthafte Realität, die geprägt ist von Wechselbeziehungen, in denen alles, was lebt, ja die ganze Landschaft in all ihren Facetten und verborgene, übernatürliche Kräfte am Räuberischen der Natur teilhaben. Ja. Da fühlte sich Churchill zu Hause, geborgen, da wurde seine Lust zur Dominanz befriedigt. – Wenn auch nur in seinen Träumen.
Eine Fliege, die sich auf Churchills eingedrückte Nase setzte, riss den Hund aus seinem Traum. Er öffnete die Augen und sah gerade noch etwas Schwarzes, das aus seinem Gesichtsfeld schwirrte. Und er sah noch etwas. Er fokussierte und die Katze der Nachbarin schälte sich aus der verschwommenen Umgegend heraus. Die getigerte Katze stand keine zwei Meter vor ihm und starrte ihn an. Sie starrte ihn mit stechenden Augen an.
«Warum zum Teufel starrt mich das Viech an?», fragte sich Churchill, so wie er sich jedesmal fragte, wenn die Katze vor ihm stand. «Und warum zum Teufel hab ich das Mistvieh nicht gerochen?»
Ja. Warum konnte der Hund die Katze nicht riechen? – Auch das fragte sich Churchill jedesmal, wenn die Katze sich vor ihm platzierte, als würde gleich etwas Aufregendes passieren. Wahrscheinlich lag es daran, dass der Wind für Churchill jeweils ungünstig blies und er immer noch den Geruch der stinkenden Füsse des ungeliebten Gasts in der Nase hatte. Vielleicht auch noch den seiner Fürze. – Die Katze starrte ihn an wie eine Jahrmarktsattraktion. Churchill grunzte. Jetzt begann sie ihre Pfötchen zu lecken. Die Vorderpfötchen. Die Katze hiess Sherlock und machte auf ihren täglichen Streifzügen durch den Ort regelmässig Halt vor dem Dorfkrug. Sherlock wusste natürlich, dass Churchill ein vernünftiger Hund war und niemals auch nur in Betracht zog, ihm, dem getigerten Kater, hinterherzujagen. Sie tolerierten einander mit stoischer Gelassenheit. Mehr noch, irgendwie waren sie sogar befreundet. Und sollte es diese schwerfällige Kreatur dennoch einmal wagen, dem Kater hinterherzujagen, hätte sie sowieso keine Chance.
«Wenigstens hat das Viech einen englischen Namen», dachte Churchill und grunzte schon wieder.
Sherlock sass da und putzte sich die Vorderpfoten. Er wartete, wollte zusammen mit seinem dicken Kumpel eine Runde durchs Dorf drehen. Das machten die beiden regelmässig. Aber heute hatte Churchill keine Lust. Sherlock hielt inne mit Pfötchenlecken und miaute. Er begann zu schnurren und machte rechtsumkehrt. Churchill liess einen fahren und grunzte. Er wusste natürlich, dass die Katze wiederkommen würde. Und dann würde er sie begleiten, vorausgesetzt, sein Verdauungsapparat hätte sich bis dann beruhigt.
Churchill öffnete die Augen erst wieder, als die Kirchenglocke elf schlug. Sherlock war verschwunden. Die Sonne hatte merklich an Kraft gewonnen und der ganze Vorplatz mit seinen fünf Gartentischen wurde jetzt von ihrem Licht ausgeleuchtet. Der dicke Hund zuckte zusammen, als die Tür zum Dorfkrug ruckartig von innen geöffnet wurde und der verhasste Gast mit ausholenden Schritten heraustrat und den Kopf ins Genick legte.
«Der Kerl riecht schlimmer als ein Kneipenboden», dachte Churchill und grunzte.
Adam Ambühl stand da und glotzte in den Himmel, auch wenn es dort oben nichts zu sehen gab. Churchill wusste zwar nicht, warum Adam seinen Blick ständig gen Himmel richtete, aber inzwischen wusste er, warum Adam den Dorfkrug immer um elf Uhr verliess. Adam wollte auf keinen Fall verpassen, wie Eva die Strasse herunterkam und sich mit wackelndem Hintern dem Dorfkrug näherte. Eva war die Serviertochter im Dorfkrug. Und sie war so was wie die Geliebte seines Herrchens. Also war sie auch so was wie das Frauchen von Churchill. Er mochte sie. Und sie mochte ihn. Ihr Dienst begann kurz nach elf. Das Klacken ihrer Stöckelschuhe konnte man schon hören, bevor sie um die Ecke bog. Das war das Zeichen für Adam, seinen Blick vom Himmel zu lösen und auf die fesche Eva zu richten. Je mehr sie sich ihm näherte, umso intensiver zuckte es in seiner Leistengegend. Kein Wunder, Eva war geballte Erotik. Es fehlte nicht viel, und es hätte ihm die Netzhaut von den Augen gelöst.
«Adam, du bist ein geiler, stinkender Bock», dachte Churchill.
Adam war egal, was der fette Hund dachte. Grinsend stand er da, den lüsternen Blick auf Eva gerichtet.
«Hallo Adam, gefällt dir, was du siehst?»
«Ach Eva», antwortete Adam, «du bringst mich jeden Tag von Neuem um den Verstand.»
«Adam, dass du es liebst, auf meinen Hintern zu starren, ist in Ordnung. Solange es dabei bleibt.»
Eva drehte für Adam eine Extrarunde und wackelte noch anzüglicher mit ihrem Klassearsch. Sie stöckelte zur Sitzbank, unter welcher Churchill lag, bückte sich elegant und strich mit sanften Fingern über die eingedrückte Nase des Hundes. Adam Ambühl erstarrte.
«Hallo mein Dicker, Zeit aufzustehen.»
Nachdem sie das Lokal betreten hatte, verspürte Adam für einen Augenblick die Glückseligkeit, nach der alle Menschen streben, bevor er den Blick erneut gen Himmel richtete.
«Armselige Kreatur», dachte Churchill.
Adam Ambühl hätte genauso gut im Dorfkrug drinnen, am Tresen, auf Eva warten können und sich an ihr sattsehen. Warum er das nicht tat, war Churchill ein Rätsel. Der stinkende Adam war überhaupt ein rätselhafter Mensch. Aber da war er nicht der Einzige in Waldhütten. In diesem Dorf lebten schon immer eine Menge rätselhafter Menschen. Und Verrückte. Verrückte hatte es auch schon immer. Nachdem Adam den lichtblauen Himmel noch eine Zeitlang mit entrückten Blicken durchbohrt hatte, zückte er sein Smartphone und knipste ein paar Bilder.
Churchill konnte hören, wie Adam fotografierte und fragte sich gleichzeitig, was um alles in der Welt es hier, vor dem Dorfkrug, zu fotografieren gab. Das einzige Sujet, für das es sich gelohnt hätte, machte sich gerade in diesem Moment hinter der Theke an die Arbeit. Und ihn selber, diese stattliche Kreatur, konnte Adam nicht mal sehen, geschweige denn fotografieren. Er lag verborgen unter der Sitzbank an der Hausmauer. Ob der Kerl den Himmel ablichtete, fragte sich Churchill. Oder die Gartentische und -stühle? Oder vielleicht die Umgegend? Churchill wusste es nicht und grunzte. Sein Magen hatte sich beruhigt. Seine Lebensgeister erwachten allmählich.
Adam Ambühl steckte das Smartphone wieder ein und machte sich auf den Nachhauseweg, die ganze Zeit wie Hans Guck-in-die-Luft gen Himmel starrend. Adam starrte nicht etwa in den Himmel, weil dieser für Gott steht oder dessen Unermesslichkeit. Auch betrachtete er das Firmament nicht als riesige, umgekehrte blaue Schüssel, wie es immer noch viele tun. Nein, für Adam stand der Himmel für unbeschränkte Freiheit und gleichzeitig für eine unheimliche Leere. Diese azurblaue Unendlichkeit hatte es ihm angetan. Und natürlich die Wolken. Er konnte stundenlang zu Hause im Garten sitzen und sich mit Wolkenschauen beschäftigen. Er sah in diesen flüchtigen Gebilden Drachen und Tiere, Gesichter und geometrische Formen, aber vor allem Engel. Mit seinem Smartphone der neusten Generation machte er eindrückliche Bilder von Himmel und Wolken. Adam wusste, dass er für verrückt gehalten wurde. Aber das war ihm egal.
Adam Ambühl bog forschen Schritts um die Ecke, wobei er hämisch grinste und mindestens die halbe Menschheit zum Teufel wünschte. Die meisten Einwohner von Waldhütten waren einhellig der Meinung, dass er seit dem Verschwinden seiner Frau vor zwei Jahren langsam aber sicher zu einem tadellos funktionierenden Soziopathen mit einem ausgeprägten Hang zum Nihilismus moutiert hätte. Früher sei er anders gewesen. Früher, als seine Frau noch mit ihm zusammenlebte. Auf die Meinung anderer gab Adam Ambühl nichts. Die konnten von ihm halten, was sie wollten. Das war ihm scheissegal. Denn auch sie lagen mit ihrer Einschätzung falsch.
Bis heute konnte er sich nicht erklären, warum seine Frau abgehauen war. Es mangelte ihnen weder an gelungener Kommunikation noch an erfülltem Sexleben. Und sie waren noch weit davon entfernt, stumpfsinnig nebeneinander her zu existieren. Ihre Ehe funktionierte. Eines Tages war sie auf einmal weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Sie hatte nichts mitgenommen und auch keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Mit dem Verschwinden seiner Frau verschwand auch ein Teil von Adams Persönlichkeit. Als hätte sie einige seiner Charakterzüge einfach mitgenommen. Über die Gründe für das Verschwinden von Adams Frau kursierten schon bald die wildesten Gerüchte im Dorf. Viele meinten, sie sei verschwunden, weil sie die Schnauze voll hatte von Adam, vom Eheleben und von Waldhütten. Andere sagten, sie sei mit einem andern Mann durchgebrannt. Wieder andere vermuteten, sie habe sich im Wald verirrt oder sei ins Wasser gegangen. Einen Grossteil des Waldes hatte Adam über Monate hindurch penibel durchforstet. Keine Spur von seiner Frau. Die umliegenden Seelein und Weiher wurden von Tauchern abgesucht. Auch sie fanden nichts. Vielleicht verschwand sie im Hexenmoor. Es war zum verrückt werden. Und es dauerte nicht lange und man verdächtigte ihn, Adam Ambühl, mit dem Verschwinden seiner Frau etwas zu tun zu haben. Er hätte sie sozusagen einfach entsorgt, irgendwo im Wald verscharrt. Blödsinn! Dafür gab es absolut keinen Grund. Adam liebte seine Frau. Sie hatten es gut zusammen. Niemals hätte der eine dem andern etwas antun können. Niemals. Und wenn seine Frau etwas nicht war, dann suizidgefährdet. Sie strotzte vor Lebensfreude. Plante für die Zukunft.
Zugegeben, der Wald war gross. Man konnte sich leicht verirren, wenn man sich nicht auskannte. Adam wusste nur zu gut, dass sich der Wald nahm, was er wollte. Aber seine Frau? Auf keinen Fall. Seine Frau liebte den Wald. Sie tat ihm nie etwas zuleide. Sie verbrachte viel Zeit im Wald und kannte sich recht gut aus. Vielleicht stürzte sie dennoch in eine Klamm, wo sie elendiglich verreckte. Wo sie von wilden Tieren bis auf die Knochen gefressen wurde. Man konnte nur Mutmassungen anstellen.
Adams Frau wurde bis zum heutigen Tag nicht gefunden. Adam wusste nicht, ob ihn dieser Umstand beruhigte oder beunruhigte. Solange sie nicht gefunden wurde, verhiess das nichts anderes, als dass sie noch am Leben sein könnte. Das war ermutigend. Ermutigend dahingehend, dass sie wieder auftauchen könnte. Vielleicht. Eines Tages. Oder wäre es besser, man hätte ihre sterblichen Überreste im Wald gefunden und den Fall endlich abschliessen können?
«Scheissdilemma!», dachte Adam und hielt plötzlich inne.
Inzwischen stand er lächelnd unter dem Baldachin gewölbter Äste, den die Baumallee aus imposanten Bergulmen in Jahrhunderten hervorgebracht hatte. Zwischen den hochgewachsenen Bäumen hindurchschauend, hatte Adam eine interessante Wolkenformation erblickt, in der er das Antlitz seiner verschwundenen Frau zu erkennen meinte. Er zückte das Smartphone und machte ein paar Schnappschüsse.
«Himmel und Wolken werden mir helfen, Antworten zu finden», war sich Adam gewiss und marschierte weiter Richtung Dorfrand, wo sein Zuhause stand, wo der Wald an sein Grundstück grenzte, wo die Welt aufhörte und gleichzeitig begann.
Der Wald rund um Waldhütten war tief und gross und die Berge hinter dem Wald waren mächtig und steil. Sie flössten dem Betrachter Ehrfurcht ein, hielten ihm vor Augen, wie unbedeutend und klein er war. Jeder Baum des Waldes war ein Wunder. Adam konnte den Wald wachsen hören, wenn er über den weichen, moosbewachsenen Boden lustwandelte. Adam liebte den Wald. Unzählige Bäume und möglichst wenige Menschen machen jeden Wald schön. Der Wald rund um Waldhütten war besonders schön. Er war irgendwie anders als andere Wälder. Dachten zumindest Adam und die meisten übrigen Bewohner von Waldhütten. Für sie war der Wald schon immer so unergründlich wie sie selber.
Adam Ambühl machte sich selten Gedanken über Heroismus und was davon übrig blieb. Er war davon überzeugt, dass er schon lange zum Mann geworden war. Er musste sich nicht mehr beweisen gegenüber andern, indem er mit heldenhaften Taten auf sich aufmerksam zu machen versuchte. Das hat er lange genug gegenüber seiner Frau getan, weil Frauen von ihren Männern erwarten, dass sie sich heldenhaft benehmen. Und dass sie dazu vor allem ihren Kopf und ihr Herz einschalten. Typen wie Manager, Sportverrückte, Kampftrinker, Politiker, Fussballer, Autoraser und andere verunsicherte Mannsbilder widerten ihn an. Alle wollten Helden sein, schafften es aber nicht.
«Alles Idioten», dachte Adam und legte den Kopf abermals ins Genick. Auch für Adam war die Zeit der Helden vorbei. «Heutzutage braucht es keine keulenschwingenden Kraftprotze mehr», dachte Adam süffisant. «Die sieht man höchstens noch im Fernsehen. Oder an Sportveranstaltungen. Der Mann von heute kann kein klassischer Held mehr sein, vielmehr braucht es Kerle, die mit Empathie und Teamgeist mehr Menschlichkeit in die Welt bringen, in eine Welt, die langsam aber sicher aus den Fugen geräht.»
Auf der Höhe, wo die Bergulmen-Allee endete, setzte sich Adam auf die Bank, die von der Gemeinde erst vergangene Woche aufgestellt worden war. Von hier aus konnte er sein Zuhause sehen. Umgeben von hohen Bäumen machte es eine ausgesprochen gute Falle. Er hätte das Haus schon viele Male verkaufen können. Aber er wollte nicht. Das Haus hatte er von den Eltern übernommen. Die Hypothek war schon lange abbezahlt. Auch seiner Frau hatte es gefallen. Leidenschaftlich kümmerte sie sich um Haus und Garten. Allerlei Blumen schmückten die Fassaden. Den Garten hatte sie so angelegt, dass Biodiversität eine Chance hatte. Zweifellos liebte sie Haus und Garten mehr als ihren Mann. Aber das kapierte Adam erst, nachdem sie verschwunden war. Was er immer noch nicht kapierte, waren die Gründe für ihr Verschwinden.
Adams Haus entsprach wie viele Häuser in Waldhütten dem im Alpenraum verbreiteten ländlichen Haustyp des Chalets. Es war komplett aus Holz gefertigt. Es war gross. Viel zu gross für einen alleinstehenden älteren Herrn. Hier hätte zu jeder Zeit eine kinderreiche Familie wohnen können. Etliche Zimmer blieben ungenutzt. Kurz vor ihrem Verschwinden sprach Adams Frau immer wieder davon, dass man die Zimmer vermieten sollte. Sie sprach begeistert von Bed and Breakfast. Und dass man diese wunderbare Aussicht den Touristen nicht vorenthalten dürfe. Ganz abgesehen vom Geld, das man sich dazuverdienen könnte. Adam war nicht begeistert von dieser Idee, liess seine Frau die nötigen Vorbereitungen aber trotzdem angehen. Die Aussicht war tatsächlich grandios: Von erhöhter Lage aus überblickte man das ganze Dorf. Waldhütten wurde auf einem Plateau errichtet, elfhundert Meter über Meer. Umgeben von dichtem Wald und steilen Berghängen lag es da wie ein Spiegelei auf Spinat. Es gab nur eine Zufahrtsstrasse von Süden her. Sie führte kurvenreich auf das Plateau. Man konnte Waldhütten nur in Richtung Süden verlassen. Auf den anderen drei Seiten ragten steile Felswände empor, die ein Durchkommen unmöglich machten, es sei denn, man war ein geübter Bergsteiger. Die Einwohner von Waldhütten waren einhellig der Meinung, dass die umliegenden Berge sie nicht nur beschützten, sondern vielmehr Wohnstätte vieler möglicher übernatürlicher Kräfte waren. Seit Generationen reflektierten die Berge für sie das mythische Ziel heiligen Strebens und – was viel wichtiger war – den Höhepunkt der Selbsterkenntnis.
Der Wald erstreckte sich auf drei Seiten über Kilometer hin steinalt und unbewegt zu den schroffen Felswänden, die das Plateau umgaben wie ein Sicherheitswall. Man hätte meinen können, eine höhere Macht hätte aus irgendwelchen Gründen durch Aufschüttung aus Erde und Steinen das Dorf Waldhütten und seinen Wald vor dem Rest der Welt abschirmen wollen. Als wollte man die Welt aussperren mit ihren Unzulänglichkeiten. Oder als wollte man der Welt Waldhütten und seine Bewohner vorenthalten. Wie auch immer: Den Einwohnern von Waldhütten war das egal. Was sie wollten, war Ruhe. Sie wollten seit Menschengedenken nichts als ihre Ruhe. Sie wollten unter sich sein. Sie wollten keine Touristen, auch wenn der Wald rund um Waldhütten und die imposanten Felsen durchaus als Touristenmagneten taugten. Ausser Adams Frau vielleicht. Sie war die Erste – und Letzte –, die von so was wie Bed and Breakfast schwärmte. Ständig sprach sie davon, mehr Touristen nach Waldhütten zu holen. Alle rümpften die Nase und brummelten Unverständliches in die Bärte.
Immer wieder fanden Wander- und Bergsteigergruppen den Weg nach Waldhütten, parkierten ihre Kleinbusse oder SUVs mitten im Dorf und schlugen sich ins nahegelegene Gehölz. Es war vor ungefähr vier Jahren, als eine Dreiergruppe, zwei Männer und eine Frau, zu einer zweitägigen Wanderung aufbrach und nicht mehr zurückkehrte.
«Der Wald nimmt sich, was er will», betonte Adam Ambühl immer wieder, wenn am Stammtisch im Dorfkrug die Rede von den verschwundenen Wanderern war. Dabei dachte er, wen wunderts, natürlich an seine Frau, auch wenn er sich nicht vorstellen konnte, dass sich der Wald gerade seine Frau genommen hatte. Trotzdem, der Wald war ein riesenhafter Organismus mit einem gesunden Appetit. Viele Einwohner von Waldhütten beteiligten sich damals an den intensiven Suchaktionen. Sie kannten den Wald besser als alle andern, fanden aber nicht den geringsten Hinweis auf die verschwundenen Touristen. Man hat die Vermissten nie gefunden. Wie Adams Frau waren sie wie vom Erdboden verschluckt.
Vor seinem Haus setzte sich Adam auf die Bank und liess die Seele baumeln. So gelassen wie jetzt war er nicht immer. Während der Zeit kurz nach dem Verschwinden seiner Frau war er ständig unruhig und angespannt. Erst mit der Zeit hatte er zurückgefunden zum tiefen Urvertrauen in die Welt, das ihm abhandengekommen war. Erst allmählich wurde er sich bewusst, dass er sich nicht um Dinge kümmern sollte, über die er nicht verfügen konnte. Er musste wieder lernen zu akzeptieren, was das Schicksal für ihn bereithielt, um die verlorengegangene Seelenruhe wiederzuerlangen. Adam lächelte und schaute zum Himmel empor. Er war zufrieden mit sich. Zufrieden und auch ein bisschen stolz. In Zeiten der Digitalisierung, wo Algorithmen das Leben bestimmen und Zeit völlig falsch genutzt wird, ist es alles andere als selbstverständlich, dass man zu innerer Ruhe findet und den Müssiggang pflegt.
«Alles geht zu schnell», dachte Adam. «Alle wollen immer mehr. Alle wollen immer weiter weg in Urlaub. Keiner hat mehr für irgendwas Geduld. Der Mensch ist selber schuld. Bis er endlich kapiert, dass das Leben selbst kaum Anlass zur Gelassenheit bietet, ist es zu spät. Es herrschen schlechte Zeiten, was das Wohlbefinden des Menschen anbelangt.»
Adam hatte gut lachen, er war ja in einem Alter, in dem nicht mehr alles auf dem Spiel steht und es einem leichter fällt, gelassen zu sein. In seinem Alter konnte er sich guten Gewissens in Gewohnheiten zurückziehen. Auf keinen Fall wollte er wieder jung sein. Nein, auf keinen Fall. Er war glücklich und zufrieden.
«Was man vom modernen Menschen nicht behaupten kann», dachte Adam. «Der ist ständig unzufrieden, kauft Dinge, die er nicht braucht und fliegt alle paar Wochen mit Billigflug-Airlines in den Urlaub, weil er meint, dort endlich glücklich zu werden. Glaubt doch tatsächlich, dass alles im Leben gut wird. Dass ich nicht lache! Der sollte die Rosabrille endlich durch eine Klarsichtbrille ersetzen. Vielleicht würde er dann besser sehen und realistischer denken. – Alles unzufriedene Idioten, die Glück völlig falsch definieren. Die glauben tatsächlich, sie seien frei und merken nicht, dass sie sich mehr und mehr einengen. Unglaublich!»
Diese beängstigende und lähmende Enge hatte Adam Ambühl durchbrochen, als er wieder damit anfing, gelassener zu sein.
«Vielleicht fällt es einem leichter gelassen zu sein, wenn man in Waldhütten lebt, fernab der weltlichen Stumpfsinnigkeit», sinnierte Adam weiter.
Beim Gedanken daran, dass die meisten Menschen nach Dingen trachten, die sie zuvor niemals vermisst haben, musste Adam Ambühl erneut lächeln.
Die Sonne brannte hernieder. Es war viel zu heiss für die Jahreszeit. Mehrere Flugzeuge hinterliessen Kondensstreifen auf dem Himmelsdach. Während Adam die wenigen Wolken am Himmel studierte, versuchte er, sich die Cloud vorzustellen, die ihm als Speicherplatz diente. Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge flogen von Blüte zu Blüte und labten sich am begehrten Nektar. In Adam Ambühls Garten hatte es eine Menge Blumen. Dafür hatte seine Frau gesorgt. Adam brauchte nichts zu tun ausser den Rasen hin und wieder zu mähen und ein wenig zu jäten. Von Frühling bis Herbst blühten allerlei Blumengewächse und Ziersträucher. Jahr für Jahr. Das Lachen der Natur offenbarte sich in Adams Garten auf eindrückliche Weise. Sogar seine Nachbarinnen beneideten ihn darum. Die Witwe Bösiger schwärmte jedesmal, wenn sie einander begegneten, von der Blumenpracht in seinem Garten. Die Witwe Bachthaler, die das Haus westlich von Adams Chalet bewohnte, schaute das ganze Jahr über voller Neid in seinen Garten. In Waldhütten hatte es viele Witwen.
«Frauen werden in der Regel älter als ihre Männer. Kein Wunder», dachte Adam und grinste.
Keine von Adam Ambühls verwitweten Nachbarinnen – und auch die meisten übrigen in Waldhütten – war vorbereitet auf ein Leben ohne Ehemann. Sie wurden von ihren Männern einfach zurückgelassen, völlig unvorbereitet. Sie hatten keine Ahnung von der Welt. Sie wussten nicht einmal, wie sie funktioniert. Ein Leben lang waren sie Ehefrauen, die nicht zu arbeiten brauchten. Sie kümmerten sich um Haus und Garten, ihre Männer und Kinder. Bis zu dem Tag, als sie alleingelassen wurden und ihnen noch viele Jahre einer einsamen Existenz bevorstanden. Beinahe alle Witwen in Waldhütten hatten Kinder, die schon vor langer Zeit weggezogen waren und höchstens ein-, vielleicht zweimal im Jahr zu Besuch kamen. Im Gegensatz zu Adam Ambühl leuchtete für die alten Frauen nun der Stern an ihrem Himmelszelt in Gestalt der Tochter oder des Sohns, die sie nur selten sahen. Aber immerhin leuchtete noch etwas. Adam Ambühl blieb nichts als Ungewissheit und viel Zeit. Viel Zeit, die er damit verbrachte, die Mysterien des Lebens zu akzeptieren. Das fiel ihm nicht gerade leicht, zumal er kein tiefgläubiger Mensch war. Trotzdem war er drauf und dran, die weibliche Logik zu entschlüsseln und sie endlich zu verstehen.
Von den alten, alleinstehenden Weibern in Waldhütten hatte die eine oder andere schon kurz nach dem Verschwinden von Adams Frau ein Auge auf ihn geworfen. Es mangelte nicht an Avancen ihm gegenüber. Sie brachten ihm selbst gemachten Kuchen, luden ihn zu sich zum Essen ein oder baten ihn um einen kleinen Gefallen. Als gutmütiger, rechtschaffener Mensch half Adam gerne aus. Er hatte schon immer ein gutes Händchen für Arbeiten oder Reparaturen im oder am Haus. Und er kapierte natürlich sofort, wenn der angebliche Mangel oder Schaden gar keiner war, sondern nur ein Vorwand, um ihn, Adam Ambühl, ins Haus zu locken. Diese Masche hatte die Witwe Bösiger am besten drauf. Ständig gab es in ihrem Haus etwas zu reparieren. Und bei Adam drängte sich schon bald der Verdacht auf, dass die Witwe Bösiger verantwortlich war für die meisten der Schäden in ihrem Haushalt, dass sie willentlich herbeigeführt wurden. Jedesmal standen Kaffee und Süssgebäck bereit, wenn Adam das Haus betrat und den Schaden begutachtete, den er in Nullkommanichts behoben hatte.
«Was würde ich nur ohne Sie machen, Herr Ambühl», sagte die Bösiger am Tag zuvor, während sich Adam an den Tisch setzte.
«Ach Frau Bösiger, gäbe es mich nicht, würde es jemand anderes für Sie tun.»
«Ich wüsste nicht, wen sonst ich um Hilfe bitten könnte, Herr Ambühl.»
«Ein paar Männer hat es ja noch in Waldhütten. Sie würden bestimmt jemanden finden.»
«Schon möglich», seufzte Frau Bösiger. «Auf jeden Fall bin ich froh, dass Sie da sind und mir noch ein paar Jahre erhalten bleiben. Sie glauben gar nicht, wie schwer es für mich ist, seit mein Mann nicht mehr da ist.»
«Kann ich mir gut vorstellen, Frau Bösiger.»
«Natürlich können Sie das, Herr Ambühl. Sie befinden sich ja in einer vergleichbaren Situation. Sie vermissen Ihre Frau. Das kann man Ihnen ansehen. Aber Sie sind ein Mann. Und ich bin eine Frau.»
Frau Bösiger setzte sich auch an den Tisch. Ihr Mann war im selben Jahr verstorben, als Adam Ambühls Frau verschwand. Der Bösiger hatte sich wie jeden Abend vor den Fernseher gesetzt, wo er schon bald eingenickt war und nicht wieder erwachte. Herzversagen. Mit gerade mal sechzig Jahren verliess der Bösiger diese Welt. Ohne Anzeichen einer Schwäche, ohne Vorankündigung. Schon bald munkelte man, der Bösiger sei gestorben, weil er sich auf RTL zu viele stumpfsinnige Sendungen angeschaut habe.
«Der Tod ist gewiss, Frau Bösiger, nur die Stunde nicht.»
Frau Bösiger erhob sich vom Tisch und schnäuzte die Nase.
«Falls Sie Hunger haben, kann ich gerne was herrichten», sagte Frau Bösiger.
«Nur keine Umstände, die Kekse reichen völlig.»
«Haben Sie das von der alten Bachthaler gehört?», fragte die Witwe Bösiger.
«Nein. Was denn?»
«Die zieht weg. Geht runter ins Tal in eine Alterswohnung. Das Haus wird ihr zu viel. Verständlich – ohne Mann.»
«Und was geschieht mit dem Haus?», wollte Adam wissen.
«Was weiss ich. Vielleicht übernehmen es die Kinder und gebrauchen es als Ferienhaus. Würde mich nicht wundern, wenn sie es an Touristen vermieten. Immer mehr Leute aus den Städten suchen die Ruhe. Und wenn wir hier in Waldhütten etwas haben, dann ist es Ruhe.»
Die Vorstellung, neben einer Art Pension zu wohnen, gefiel Adam gar nicht.
«Oder sie verkaufen es», sagte Adam. «Die jungen Leute aus der Stadt haben ständig zu wenig Geld.»
«Hoffen wir es», sagte Frau Bösiger.
«Wie alt ist die Bachthaler?», wollte Adam wissen.
«Letzten November ist sie achtzig geworden.»
«Früher oder später müssen wir alle das geliebte Heim verlassen», sagte Adam.
«Auf keinen Fall werde ich von hier wegziehen», protestierte die Witwe Bösiger energisch. «Ich bin hier geboren und werde hier sterben. Nichts und niemand bringt mich von hier weg. Nicht einmal Gottes Wille.»
Frau Bösiger senkte den Kopf und schnäuzte die Nase.
«Herr Ambühl, wir Alten müssen zusammenhalten. So lange es geht. Und wir müssen hier bleiben, hier oben in Waldhütten. Frau Bachthaler wird nicht die Letzte sein, die zum Sterben runter ins Tal zieht.»
«Bestimmt nicht», bestätigte Adam.
«Unserem Dorf gehen die Einwohner aus, Herr Ambühl. Die Alten sterben weg, die Jungen ziehen weg.»
«Traurig, aber wahr, Frau Bösiger. Und Neuzuzüger kommen auch immer weniger.»
«Vielleicht muss es so sein», werweisste die Witwe Bösiger. «Vielleicht ist es Gottes Wille, dass immer mehr Bergdörfern die Einwohner ausgehen.»
«Das bezweifle ich. Gott kümmert sich nicht um solche Dinge. Der hat uns Menschen schon lange im Stich gelassen.»
«Glauben Sie, Herr Ambühl? – Genügt es denn nicht, wenn man von Ehemann und Kindern im Stich gelassen wird? Dass sich von allen liebgewonnenen Menschen einer nach dem andern für immer verabschiedet?»
«Offenbar nicht, Frau Bösiger.»
«Herr Ambühl, was wir hier in Waldhütten dringend brauchen, ist so was wie eine Altersresidenz. Dann müsste die Bachthaler nicht ins Tal runter. Wir Alten könnten bis zum Ende hier oben bleiben.»
«Das ganze Dorf verkommt allmählich zu einem Altersheim, Frau Bösiger.»
Adam Ambühl erhob sich und machte Anstalten zu gehen. Er bedankte sich für Kaffee und Kekse. Die Witwe Bösiger drückte ihm mit beiden Händen die rechte Hand, als wollte sie ihn zurückhalten und nicht gehen lassen.
«Und wir brauchen wieder einen Arzt hier oben», sagte Frau Bösiger. «Wegen jeder Kleinigkeit runter ins Tal zu fahren, ist Blödsinn. Wir brauchen wieder einen Arzt in Waldhütten, so wie früher.»
«Ja, Frau Bösiger, früher war alles besser.»
«Das können Sie laut sagen», antwortete Frau Bösiger, «früher war wirklich alles besser.»
Adam Ambühl verliess das Haus der Witwe Bösiger und eilte nach Hause. Die Natur rief: Es war höchste Zeit für das grosse Geschäft. Während Adam Ambühl auf der Schüssel sass, dachte er über das, was die alte Bösiger soeben gesagt hatte, nach und kam zum Schluss, dass sie völlig recht hatte: Dörfer wie Waldhütten waren unweigerlich dem Niedergang geweiht. Und nicht nur das. Nach ein paar Gedanken mehr wurde er sich bewusst, dass alles dem Niedergang geweiht ist. Alles. Waldhütten, die Menschheit, die Erde, die Sonne, das Universum – einfach alles. «Wenn der Mensch so weitermacht, ist er weg, bevor irgendwas anderes weg ist», sinnierte er und fragte sich im selben Augenblick, ob das schlimm wäre. «Wäre es denn schlimm, wenn es die Menschheit in, sagen wir, zweihundert Jahren nicht mehr gäbe?» Adam betrachtete sich, während er die Hände wusch, im Spiegel und beantwortete die Frage gleich selber: «Nein, bestimmt nicht! Wir Menschen legen es ja richtig darauf an. Wir wollen uns den Garaus machen. Jawoll! Und das Verrückte ist, dass es die wenigsten kümmert. Den meisten ist es scheissegal, ob es ein paar Grad wärmer wird, ob Gletscher und Eis an den Polen schmelzen und Küstenregionen überflutet werden. Hauptsache mit der technologischen Entwicklung gehts voran. Jawoll! Existenzielle Risiken hin oder her, Fortschritt und Wachstum sind wichtig. Ja, ein Hoch auf das Wirtschaftswachstum auf Teufel komm raus! Ohne Wachstum geht sowieso nichts mehr! Blöd nur, dass der Planet Erde nicht mitwächst. Scheissegal! Und ein Hoch auf die Globalisierung. Und natürlich auf die ganze Scheissdigitalisierung mit ihren superschlauen künstlichen Intelligenzen. Genau diesen wird der Mensch zum Opfer fallen. Ja, so siehts aus mit der unbequemen Realität. Vorher würden aber noch ein paar Hundert Millionen Klimaflüchtlinge eine neue Heimat suchen. Blöd nur, dass sie die nicht finden werden, weil sie niemand reinlassen wird. Scheiss drauf! Und dann sind da noch diese Bakterien, multiresistent, denen kein Antibiotikum gewachsen ist. Bioterrorismus. Und was ist mit dem Permafrost? Milzbrand und Co.? Möchte gar nicht wissen, was da alles zum Vorschein kommt. Und die Meere! Auch sie sind zu klein, als dass der Mensch sie nicht zerstören kann. Immerhin liefern sie einen Grossteil des Sauerstoffs in der Atmosphäre. Aber nicht mehr lange, wenn wir weiterhin unseren Müll in ihnen entsorgen. Wir wollen es so. Zunächst werden die Menschen verblöden und dann krepieren. Bravo! Eine Welt ohne Menschen könnte in mehrerer Hinsicht eine bessere sein. Und dem Universum ist es sowieso scheissegal, ob es Menschen gibt oder nicht. Wir sind ja nicht die Krönung der Schöpfung. Nein. Höchstens eine zufällig entstandene Lebensform auf einem kleinen, unbedeutenden Planeten am Rande einer unwichtigen Galaxie. Die Existenz von Leben ist ein höchst überschätztes Phänomen.» Adam Ambühl zwinkerte seinem Spiegelbild zu und grinste. «Und wenn es den Menschen nicht mehr gibt, kann er auch keinen Schaden mehr anrichten. Denn das ist das Einzige, was er wirklich kann. Der Mensch ist ein Risikofaktor, und deswegen muss er weg. Und wenn er erstmal weg ist, muss er auch kein Leid mehr ertragen. Das ist der Vorteil der Nicht-Existenz.»
Es war Zeit für den Waldspaziergang. Adam ging jeden Tag in den Wald, ausser eine höhere Macht hinderte ihn daran. Der Wald rund um Waldhütten war für Adam Ambühl genauso Zuhause wie sein schmuckes Chalet. Kein Wunder, hatte er doch Zeit seines Lebens als Forstwart gearbeitet. Wie schon sein Vater und Grossvater. Die Ambühls waren Waldarbeiter aus Leidenschaft, seit Generationen. Es kam für sie zu keiner Zeit infrage, einer Arbeit nachzugehen, die nicht in oder um Waldhütten verrichtet werden konnte. Und weil es in Waldhütten keine Landwirtschaft, geschweige denn sonst kaum Arbeit gab, war es naheliegend, sich mit dem Wald und dem, was der Wald hervorbringt, zu beschäftigen: als Forstwart, Förster, Holzhändler, Säger, Schreiner, Zimmermann, Holzbearbeiter, Holzbildhauer, Holzhandwerker usw. Eigentlich hatte sich in Waldhütten schon immer alles um Holz gedreht respektive um den Wald.
Der Waldhüttener Wald war durchzogen von mehreren Urwaldreservaten, wo noch heute zahlreich krumme, knorrige, in den Augen mancher Forstleute minderwertige Bäume wuchsen. Dort konnten sie völlig ungestört emporwachsen, niemand taxierte die Stämme hinsichtlich ihres Vermarktungswerts. Hier war der Wald noch sich selbst überlassen. Hier war die Natur noch einigermassen in Ordnung. Der Waldboden war überzogen von bizzaren Wurzeln, die sich ineinander verknoteten. Überall konnte man eigentümliche, bisweilen gruselige Wuchsformen entdecken. Für Adam Ambühl war immer noch jeder Spaziergang durch die Reservate eine Entdeckungsreise voller Wunder. Er konnte sich nicht sattsehen an seinem Wald.
Natürlich machte sich Adam Ambühl grosse Sorgen um seine Lieblinge. Ihm war klar, dass die Idylle trügte. Das natürliche Gleichgewicht war auch hier im Waldhüttener Wald in existenzieller Weise bedroht. Adam Ambühl war stolz auf sich, seinen Vater und Grossvater. Denn sie waren massgeblich daran beteiligt, dass der Waldhüttener Wald sich mehr und mehr zu einem flächendeckenden Urwaldreservat wandelte. Schon auf rund zwei Dritteln des Waldgebiets durfte kein Holz mehr geschlagen werden. Holz aus dem Ausland war sowieso billiger als heimisches. Man karrte Bäume lieber über ganze Kontinente und verschiffte sie über die Weltmeere, als dass man die lokale Holzindustrie unterstützte. Die einzige Sägerei im Waldhüttener Wald schloss ihre Tore vor gut dreissig Jahren. Viele Männer verloren die Arbeit und waren in der Folge gezwungen, einen Job drunten im Tal zu suchen. Und genau diese stillgelegte Sägerei war das Ziel des heutigen Spaziergangs. Schon seit mehr als einem Jahr war Adam nicht mehr dort. Die meisten Waldhüttener Bürger mieden die alte Sägerei. Sie fürchteten sich davor, zumal im Dorf die Gerüchte gingen, das dort zuweilen Unheimliches passierte. Nicht aber Adam: Er liebte verlassene, geheimnisumwitterte, mitunter gruselige Orte.
Nachdem er den Rucksack gepackt, die Wanderschuhe geschnürt und sich vergewissert hatte, dass der Akku des Smartphones voll war, schlug er sich mit ausholenden Schritten ins nahegelegene Gehölz. Bevor Adam im Wald verschwand, winkte er der Witwe Bösiger zu, die ihrerseits vom rückseitigen Balkon herab ihm zuwinkte. Adam hätte auch die Waldstrasse, die zum alten Sägewerk führte, nehmen können, aber er zog es vor, querfeldein über den weichen Waldboden zu gehen. Kaum schritt er über die ersten moosbewachsenen Wurzeln, klingelte das Smartphone. Adam nahm es hervor, stellte es auf stumm und steckte es wieder ein. Diese beinahe vollkommene Stille im Wald mit einem dämlichen Telefonat zu stören, kam für Adam nicht infrage. Er würde später zurückrufen. Funklöcher hatte es keine im Waldhüttener Wald. Oder aber man hatte bisher noch keine gefunden. Eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Waldhütten so was wie ein vergessener Ort war, dessen geografische Lage alles andere als günstig war. Als Adam Ambühls Frau vor zwei Jahren verschwand, versuchte man als Erstes, ihr Smartphone, das sie immer bei sich trug, zu orten. Vergebens – man konnte es nicht lokalisieren. Ebenso wenig die Smartphones der verschwundenen Wanderer. Man vermutete Funklöcher, verursacht durch elektromagnetische Störungen, und suchte nach ihnen – ohne Erfolg. Guter Empfang war flächendeckend verfügbar, man hätte die Smartphones orten müssen. Hat man aber nicht. Und niemand konnte mit einer plausiblen Erklärung aufwarten. Nicht mal hinzugezogene Fachleute. Das war ziemlich gruselig. So gruselig, dass sich der Wandertourismus im Waldhüttener Wald fortan in Grenzen hielt. Sehr zum Wohlwollen von Adam Ambühl. Auf keinen Fall wollte er mehr Touristen in seinem Wald. Auf keinen Fall.
Ab und an umarmte Adam Ambühl einen der Bäume und verharrte minutenlang in solcher Umklammerung. Adam umarmte Bäume, um ihre Seele kennenzulernen. Und um ein wenig Trost zu finden. Dabei hielt er abwechslungsweise das linke und rechte Ohr an den Stamm, als ob ihm dieser was zuflüstern würde. So spürte er den Atem der Bäume, der auch den Menschen das Leben ermöglicht. Er fühlte die Stärke der Bäume, weil er an ihre Kraft glaubte. Adam Ambühl wusste schon lange, dass Bäume untereinander kommunizieren, dass sie fühlen, dass sie sich sehr sozial verhalten ihren Kindern und alten, schwachen Verwandten gegenüber und dass sie über ein Gedächtnis verfügen.
Adam gelangte auf eine kleine Lichtung, in deren Mitte einer seiner Lieblingsbäume stand: eine stattliche, zirka dreihundertjährige Bergulme. Mehr als dreissig Meter hoch mit einem Stammdurchmesser von knapp zweieinhalb Metern.
«Was für ein Baum», dachte Adam, so wie er jedesmal dachte, wenn er voller Ehrfurcht vor diesem imposanten Holzgewächs stand.
Für Adam waren Bäume schon immer die schönste Verbindung zwischen Erde und Himmel. Er streifte den Rucksack ab und setzte sich auf einen der dicken Wurzelstränge, die den grossen Baum im Boden verankerten. Wie Zehen eines alten Fusses verbanden die knorrigen Wurzeln die Bergulme mit der Erde. Adam schloss die Augen und dachte einen Moment darüber nach, dass der Mensch manches mit dem Baum gemeinsam hat: den aufrechten Rumpf, die Zehen auf der Erde, lange Arme und schmale Finger. – Es war viel zu heiss. Die ständige Hitze setzte nicht nur Adam zu, sondern auch seinen Lieblingen. Der Wald veränderte sich – langsam, aber er veränderte sich. Das Klima spielte schon lange verrückt. Nur interessierte das beinahe keinen, im Gegenteil. – Mit geschlossenen Augen lauschte Adam dem Geflüster der Ulme, die einsam in den Himmel wuchs. Plötzlich hörte er ein lautes Krachen.
«Ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst», dachte Adam und lächelte zufrieden.
Umgestürzte Bäume wurden in natürlichen Wäldern liegen gelassen. So konnten sie in aller Ruhe auf dem feuchten Waldboden vermodern, nachdem sie sich von unsichtbaren Bereichen losgerissen hatten, von Bereichen, die sich möglicherweise wie beim Menschen auch bis jenseits der Grenzen des Bewusstseins erstrecken. Erneutes Krachen liess Adam die Augen öffnen. Ganz in der Nähe stürzte schon wieder ein Baum zu Boden.
«Immer mehr Bäume fallen dem Klimawandel zum Opfer», dachte Adam und erhob sich. Mit zusammengekniffenen Augen starrte er gen Himmel, wo nicht eine Wolkenformation zu sehen war. «Mal schauen, was den Bäumen derart zusetzt», sagte sich Adam und schritt aus in die Richtung, aus welcher er das Krachen zu vernehmen meinte.
Adam hörte und sah durch die Baumwipfel Rabenvögel, wie sie laut krächzend durch den Äther stoben. Irgendwas versetzte die Vögel in Aufruhr. Es mussten ganze Schwärme sein. Keine drei Minuten später erneutes Krachen und Knacken. Es hörte sich an, als ob sich ein Troll oder sonst etwas Grosses zwischen den Bäumen hindurchzwängte. Sehr ungewöhnlich. Dass gleich so viele Bäume umstürzten, konnte sich Adam nicht erklären. Er machte halt und suchte Schutz hinter einer besonders kräftig gewachsenen Fichte, weil er das Gefühl hatte, dass sich ihm etwas näherte. Es krachte und knackte, als würden ganze Stämme der Länge nach gespalten. Plötzlich kehrte Ruhe ein. Vereinzelt waren wieder Vögel zu hören. Adam verharrte noch ein paar Minuten an Ort und Stelle, bevor er vorsichtig über den weichen Waldboden weiterstapfte, bis er beim ersten, arg in Mitleidenschaft gezogenen Baum anlangte.
«Grosser Gott! Was ist nur mit dir passiert?!», fragte Adam entsetzt. Er stand nicht weit von der Fichte, die in der Mitte entzweigebrochen war wie ein Zahnstocher. «Himmelarsch! Wer hat dir das angetan?!»
Adam traute seinen Augen nicht. Die entzweigebrochene Fichte unmittelbar vor ihm war bei Weitem nicht die einzige. Etliche andere Bäume erfuhren dasselbe Schicksal. Kräftige Stämme ragten zirka sieben Meter in die Höhe, auf welcher sie von etwas offenbar mühelos gebrochen wurden. Als ob ein Riese axtschwingend eine Schneise durch den dichten Wald geschlagen hätte. Es war ein trauriger Anblick. Augenblicklich befiel Adam ein Gefühl der Beklemmung. Er fühlte sich auf einmal beobachtet. Ein leichter Schwindel überkam ihn. Nebst den vielen entzweigebrochenen Fichten, die an den Bruchstellen Spuren wie von Bränden aufwiesen, obwohl es mit Bestimmtheit kein Feuer gab, standen Bäume, deren Stämme derart krumm gewachsen schienen, als bestünden sie aus Gummi.
«Ziemlich gruselig», dachte Adam und zückte sein Smartphone. Während er die malträtierten und krumm gewachsenen Bäume fotografierte, hörte er seltsame Windgeräusche, obwohl es windstill war. Er schaute nach oben in die Baumwipfel – nichts bewegte sich. Nicht die Spur eines lauen Lüftchens. Gar nichts.
«Ziemlich gruselig», dachte Adam erneut.
Die Schneise zerbrochener Bäume erstreckte sich über eine Länge von zirka sechzig und über eine Breite von gut fünfzehn Metern. Von Süden nach Norden, wie Adam mithilfe der Kompass-App feststellen konnte. Oder von Norden nach Süden – egal. Die unnatürlich krumm gewachsenen Stämme standen traurig an den Rändern oder ausserhalb der betroffenen Fläche. Alles, was innerhalb gewachsen war, war entzweigebrochen. Fassungslos stand Adam da, während er die genauen Koordinaten auf dem Smartphone abspeicherte. In Gedanken fragte er sich, ob noch mehr solche Ereignisse im Waldhüttener Wald passiert waren. Bisher war ihm noch nichts derartiges aufgefallen. Aber das musste nichts heissen. Er konnte ja nicht überall zur selben Zeit sein. Vielleicht war jemand anderem etwas aufgefallen.
Beim Anblick der malträtierten Bäume musste Adam an das Tunguska-Ereignis denken. Damals fielen in Sibirien einer gewaltigen Explosion ungefähr sechzig Millionen Bäume zum Opfer. Verantwortlich für die unbeschreibliche Katastrophe soll ein Eisenmeteorit gewesen sein. Bis heute kennt man die genaue Ursache nicht.
«Eine Explosion hat es hier zu keiner Zeit gegeben», dachte Adam Ambühl, «die hätte man ohne Zweifel gehört im Dorf. Da wäre wahrscheinlich der ganze Waldhüttener Wald zerstört worden. Und Waldhütten selber auch.» Adam schüttelte den Kopf. «Was sich hier ereignet hat, muss andere Ursachen haben. Man sollte das Ganze mal aus der Vogelperspektive betrachten», dachte Adam. «Oder die Satellitenbilder von Google-Maps anschauen. Die sind zwar nicht aktuell. Aber vielleicht ist früher schon mal was Ähnliches passiert.»
Adam stapfte weiter Richtung alte Sägerei. Nachdem er sich einen Schluck Wasser aus einem gurgelnden Bach gegönnt und eine Handvoll Heidelbeeren gepflückt hatte, setzte er sich auf einen von Flechten überwachsenen Baumstamm, um kurz zu rasten. Nicht dass er erschöpft oder gar müde gewesen wäre, nein, vielmehr war es das rätselhafte Ereignis, das ihn rasten liess. Ausser dem sanften Rauschen des Waldes war nichts zu hören. Er nahm die Stulle aus dem Rucksack und biss genüsslich hinein. Nachdem er sich den Mund abgewischt hatte, erhob er sich und schaute zum Himmel empor. Aus reiner Gewohnheit. Adam klaubte das Taschentuch hervor, wischte den Schweiss von Stirn und Nacken und stapfte weiter. Als er gut dreissig Minuten später bei der alten Sägerei anlangte, stellte er mit Genugtuung fest, dass sich die Natur die verlassenen Gebäude schneller einverleibt haben würde, als man angenommen hatte.
«Schön, wie sich der Wald alles zurückholt», dachte Adam, als er das marode Hauptgebäude durch einen Seiteneingang betrat.
Gegründet wurde die Sägerei Anfang des 19. Jahrhunderts. Über die Jahre wurde sie kontinuierlich ausgebaut und war nicht nur der grösste, sondern auch über Jahrzehnte immer wieder der einzige Arbeitgeber. Voller Ehrfurcht schritt Adam durch die von ansehnlichem Verfall gezeichneten Hallen und Gewölbe, wo immer noch viele interessante Details zu sehen waren und reichlich Inventar herumstand. Alles war überzogen von einer dicken Staubschicht. Der Verputz an den Wänden bröckelte grossflächig ab und akribisch aufeinandergeschichtete Ziegelsteine kamen zum Vorschein. Auf den Werkbänken und riesengrossen Tischen lagen immer noch Hämmer, Zwingen, Hobel, Drechselwerkzeuge, Zangen, Bohrer, Handsägen und manch anderes herum. Vereinzelt standen halbvolle Flaschen und schmutzige Kaffeetassen zwischen rostigen Nägeln und Schrauben. Sägemehlhaufen von beachtlicher Grösse lagen vor riesigen Maschinen, die man schon vor Ewigkeiten abgeschaltet hatte. Mit eindringlicher Emanation demonstrierte der bedauernswerte Zustand der alten Sägerei die Vergänglichkeit alles Irdischen. Hier wurden Schönheit und Zerfall auf einzigartige Weise miteinander verbunden. Erstaunlich war, dass Adam vom allgegenwärtigen Verfall keine Fotos schoss. Lohnenswerte Sujets hatte es zuhauf. Für einen Hobbyfotografen wie ihn wäre die alte Sägerei ein Eldorado gewesen.
Adam kannte die Sägerei in- und auswendig. Nicht nur wegen seiner Arbeit als Forstwart, sondern vielmehr, weil er immer wieder nach seiner Frau oder Spuren von ihr in den verlassenen Räumlichkeiten gesucht hatte. Seine Frau liebte Lost Places, sie verbrachte viele Stunden in der ehemaligen Sägerei. Allein – oder zusammen mit ihrem Ehemann. Eine gemeinsame Leidenschaft. Jedesmal, wenn Adam durch die Hallen und Büros schritt, staunte er, dass vieles dort noch aussah, wie vor Kurzem erst verlassen. Im Maschinenraum lag immer noch bearbeitetes Holz in den Maschinen, in den Werkstätten lagen oder standen begonnene Werkstücke herum. Man hätte meinen können, die Arbeiter machten alle gerade Pause. In einem der Büros stapelten sich ordnerweise Unterlagen auf einem Schreibtisch. Das war das Büro, wo immer noch der lederne Bürostuhl stand, auf dem es Adam und seine Frau viele Male leidenschaftlich getrieben hatten. Adam setzte sich in den Stuhl und schwelgte mit geschlossenen Augen in Erinnerungen. Dabei fummelte er an seinem Gemächt herum. Sonnenstrahlen durchschnitten die stickige Luft und machten Myriaden von Staubpartikeln sichtbar.
«Was für eine Scheisshitze», dachte Adam, als er die Sägerei verliess.
Um sicherzugehen, dass er keinem Trugbild aufgesessen war, nahm er denselben Weg zurück, den er gekommen war. Seine Sinne hatten ihn nicht getäuscht, das arg in Mitleidenschaft gezogene Waldstück war traurige Realität. Für einen kurzen Moment schnürte es Adam die Brust zusammen, es fiel ihm schwer zu atmen. Er schoss noch ein paar Fotos und verliess hernach diesen Ort der Zerstörung.
«Könnte eine Fallböe gewesen sein», meinte einer am Stammtisch im Dorfkrug, als Adam sein Smartphone herumreichte. «Oder ein Minitornado. Oder eine Windhose. Da knicken schon mal Bäume um oder werden Dächer abgedeckt.»
«Schon möglich», antwortete Adam Ambühl und nahm einen kräftigen Schluck aus dem Humpen. «Aber starke Abwinde treten in der Regel nur im Zusammenhang mit Gewittern auf. Und gewittert hat es schon seit Tagen nicht mehr.»
«Trotzdem», sagte der andere, «typisches Schadensbild eines starken Fallwinds.»
Er reichte Adams Smartphone Béla Nachtigal, der sich auch an den Tisch gesetzt hatte. Béla blätterte durch die Bilder und schwieg.
«Auf keinen Fall kommen ein Tornado oder eine Windhose in Frage», stellte Béla schliesslich mit Nachdruck fest. «Und was die Fallböe betrifft: könnte sein. In sehr seltenen Fällen treten sie auch unabhängig von Gewittern auf. – Was hat es mit diesen krumm gewachsenen Baumstämmen auf sich? So wachsen doch keine Bäume! Sehen aus wie aus Gummi, wie geschmolzen.»
Béla reichte das Smartphone Adam, welcher die Hülle zuklappte und es auf den Tisch legte.
«Ziemlich gruselig, meint ihr nicht. Ich war da, als es passierte. Also ganz in der Nähe. Ich hörte komische Geräusche, aber bestimmt nicht die eines Tornados, einer Windhose oder einer Fallböe. Ausser dem Knacken und Krachen waren da nur diese seltsamen Geräusche. Undefinierbare Geräusche. Was mag imstande sein, beinahe ausgewachsene Bäume zu verbiegen wie einen Gummistock? Was meint ihr? Wind? Hitze? Kaum. Da müssen andere Dinge mit im Spiel sein.»
«Vielleicht ein klitzekleiner Meteorit», mutmasste Eva Edelstein, die hinter der Theke mit Trocknungsarbeit beschäftigt war.
«Klitzekleine Meteoriten verdampfen in der Atmosphäre», sagte Béla Nachtigal. «Das müsste schon ein grösserer Brocken sein, um bis auf die Erdoberfläche zu gelangen. Wäre das passiert, sähe es hier aus wie in Tunguska.»
«Ganz meine Worte», sagte Adam Ambühl kopfnickend.
«Tunguska? Was zum Teufel ist Tunguska?», fragte Eva und hielt mit der Trocknungsarbeit inne.
«Das ist eine Gegend in Sibirien», antwortete Béla Nachtigal, ohne Eva anzuschauen. «Da legten sich 1908 nach einem rätselhaften Ereignis im Umkreis von rund dreissig Kilometern Entfernung etwa sechzig Millionen Bäume nieder. Einheimische berichteten von einem himmelweiten Lichtblitz und machten Agdy, ihren Gott des Donners, dafür verantwortlich.»
«Blödsinn!», unterbrach Adam Ambühl. «Nach meinem Dafürhalten war das Ereignis in Tunguska menschengemacht. Irgendwer testete dort wahrscheinlich eine neuartige Waffe. Vielleicht die Chinesen oder die Deutschen. Denen war alles zuzutrauen.»
«Sollte es eine Waffe gewesen sein, dann eine uns Menschen unbekannte», sagte Béla, «Es gab keinen Krater, keine Anzeichen von Feuer – es kann keine uns bekannte Munition gewesen sein.»
«Auf jeden Fall hat es eine gewaltige Druckwelle erzeugt. Vielleicht war es doch ein Meteorit, der in einer Höhe von, was weiss ich, sechs bis acht Kilometern explodiert ist.»
«Vielleicht, ja», bestätigte Béla. «Nur spricht dagegen, dass die elektromagnetischen Kräfte länger wirkten, als sie sollten. Die in Mitleidenschaft gezogene Gegend strahlte viel zu lange.»
«Wir sollten in unserem Wald die elektromagnetischen Werte messen lassen», schlug Adam Ambühl vor.
«Eine der vielen Theorien besagt, dass das Tunguska-Ereignis von etwas Ausserirdischem ausgelöst wurde», sprach Béla weiter. «Oder etwas Extratemporales war dafür verantwortlich. Vielleicht reiste jemand oder etwas durch die Zeit. Das benötigt Unmengen von Energie und kann immensen Schaden hinterlassen.»
Eva Edelstein hinter der Theke schüttelte ungläubig den Kopf, goss sich ein Glas Weissen ein und setzte sich zu den Männern an den Tisch. Alle lächelten sie an, als wäre sie ein Engel, der vom Himmel herabgekommen war, um göttliche Botschaften zu überbringen. Für einen Moment lang herrschte Schweigen am Tisch.
«Der Waldhüttener Wald ist nicht Tunguska», brach Adam Ambühl die Stille. «Es ist unsere Pflicht herauszufinden, was unseren Wald verletzt hat. Vielleicht passiert es wieder. Und wieder. Und wieder. Und am Ende bleibt nichts als zerbrochene und gekrümmte Bäume übrig. Ganz zu schweigen von unserem Dorf! Stellt euch vor, das Ereignis findet in unserem Dorf statt! Möchte gar nicht wissen, was es hier anrichten würde.»
Béla Nachtigal schloss den Dorfkrug kurz nach zwölf. Eva Edelstein machte gut eine Stunde vorher Feierabend. Béla drehte sich einen Joint und verliess das Haus mit Churchill durch den Hintereingang. Béla liebte es genauso wie Churchill, während der Nacht durch das verschlafene Dorf zu spazieren. Es war ungewöhnlich mild. Viel zu warm für die Jahreszeit. Egal. Der Himmel war klar. Die Sterne funkelten. Aus dem nahen Wald waren die Rufe eines Uhus zu hören. Churchill spitzte die Ohren und grunzte. Sein Magen hatte sich beruhigt. Beinahe beschwingt lief er seinem Herrchen hinterher. An jedem Baum der Bergulmenallee schnupperte er intensiv, hob unbeholfen das linke Hinterbein und setzte mit jedem Spritzer Urin seine persönliche Duftnote. Waldhütten war sein Territorium. Auf der letzten Ulme, unter welcher die neue Sitzbank stand, auf der am Vormittag Adam Ambühl gesessen und zum Himmel empor geschaut hatte, sass die Katze Sherlock und starrte mit nachtschwarzen Augen herab. Béla Nachtigal setzte sich auf die Bank und wartete, bis die Katze heruntergeklettert war und neben ihm Platz nahm. Churchill traute seinen Augen nicht und grunzte. Sherlock schmiegte sich an Béla Nachtigal. Churchill fing an zu winseln. Als die Katze auch noch lautstark zu schnurren begann, wurde es Churchill zu viel und er fing an zu bellen. Béla grinste und erhob sich. Sie gingen zu dritt weiter.
«Was für ein Frieden», dachte Béla Nachtigal. «Auch wenn alles den Bach runtergeht, hier in Waldhütten ist die Welt noch in Ordnung.»
Weil die Nacht mild, der Himmel klar und die Ruhe betörend war, entschied sich Béla für den ausgedehnten Nachtspaziergang. Der führte sie mehr oder weniger einmal um das Dorf und dauerte ungefähr fünfundvierzig Minuten. Niemand ausser ihnen war um diese Zeit unterwegs. Man hatte beinahe das Gefühl, das ganze Dorf und mit ihm die Bewohner wären in einen Dornröschenschlaf versunken. Oder es erweckte den Eindruck, das Dorf wäre wie ausgestorben, von Menschen verlassen. Verträumtes Dasein allerorten. Immer wieder blickte Béla in das Dunkel des Waldes und fragte sich jedesmal, welche Geheimnisse sich in ihm verbargen. Bevor sich der Stammtisch im Dorfkrug aufgelöst hatte, beschloss man, die verletzten und krumm gewachsenen Bäume zusammen in Augenschein zu nehmen. Sich quasi vor Ort ein Bild zu machen. Ob sie Antworten finden würden, bezweifelte Béla nach wie vor. Als Béla, Churchill und Sherlock beim Häuschen anlangten, in welchem Eva Edelstein wohnte, überlegte er kurz, ob er klingeln sollte. Es war bislang das erste Haus, das noch Licht hatte. Er liess es aber bleiben und lustwandelte weiter. Churchill hätte nichts gegen eine kleine Rast gehabt. Das konnte man dem Hund ansehen. Er grunzte und trottete seinem Herrchen und der Katze Sherlock hinterher.
Wie bereits erwähnt, führte nur eine Strasse hinauf nach Waldhütten. Erbaut wurde sie vor vielen, vielen Jahren von starken und ehrenhaften Männern, die sich mit ihren Frauen und Kindern von überall aus dem Land herbemühten, weil sie davon gehört hatten, dass das einzigartige Hochplateau mit ihren wenigen Hütten auf besondere Art und Weise beseelt war. Auch wenn andere behaupteten, dass dieser Ort weder beseelt noch geeignet war, sich hier niederzulassen. Die guten und tapferen Männer bauten den von vielen Menschen über die Jahrhunderte ausgetretenen Trampelpfad sukzessive zu einer veritablen Strasse aus. Mit der Zeit fanden immer mehr Menschen den Weg in dieses abgelegene Bergdorf, und die bescheidenen Hütten, die aus Eichenpfählen und Steinmauern errichtet worden waren, wichen allmählich schlichten, schönen Häusern aus Ziegelsteinen und Holz, die künftig noch vielen Generationen als Wohnstatt dienen sollten. Über die Jahre nahm das stetig wachsende Dorf die Träume seiner Bewohner in sich auf und erfreute sich daran, dass sie immer zahlreicher und glücklicher wurden. Aus Wegen und Pfaden wurden Strassen, zunächst naturbelassen, später gab es Kopfsteinpflaster, über das etliche Pferde trabten und vereinzelt Kutschen klapperten. Die breiteste der Strassen war jene, aus der die imposante Bergulmenallee hervorgehen sollte. Auch sonst hatte es schon immer viele Bäume in Waldhütten: Ulmen, Eichen und, nebst anderen, würdevolle Ahornbäume, deren Blätterwerk erfüllt war von vielstimmigem Vogelgesang. Die ummauerten oder heckenumsäumten Gärten hinter den Häusern waren allesamt voller Blumenpracht, auf deren duftenden Blüten der Tau funkelte. Die enge Beziehung unter den Dorfbewohnern war nicht nur typisch, sondern besonders. Diese Beziehung wurde durch die notwendige Zusammenarbeit in der Forstwirtschaft gehörig verstärkt.
Waldhütten entwickelte sich aus einer frühmittelalterlichen Kleinsiedlung zu einem typischen Haufendorf, das durch die Bergulmenallee in eine linke und eine rechte Hälfte geteilt wurde. In Zeiten des Hochmittelalters wurde auch in Waldhütten eifrig Landwirtschaft betrieben. Grossflächig wurde Wald gerodet, um das Land urbar zu machen. Mit der Zeit gewann die Forstwirtschaft aber immer mehr an Bedeutung und schliesslich die Oberhand, sodass man von der Landwirtschaft je länger je mehr abkam und sie schliesslich komplett aufgab. Schon früh verfügte Waldhütten über eine Mühle, eine Schmiede, eine Kirche, einen kleinen Marktplatz und ein Wirtshaus, den Dorfkrug. Die Mühle verschwand als Erstes und machte einer Zimmerei platz, die ihrerseits von einer Tischlerei abgelöst wurde.
Inzwischen war der Mond aufgegangen und dominierte den Himmel. In einem tiefschwarzen Weltraum zwischen Sternenbildern schwebend, demonstrierte er seine nächtliche Vorherrschaft, indem er auf mannigfaltige Weise verzauberte. Béla setzte sich erneut auf eine Sitzbank, legte den Kopf ins Genick und zog genüsslich am Joint. Er starrte in die Nacht, die wie ein fein gewobener Schal die Welt zwischen Abend- und Morgendämmerung umhüllte. Churchill lag zu Bélas Füssen, während Sherlock sich links von ihm auf die Bank gesetzt hatte und die Pfötchen leckte. Die Nacht brachte erholsame Dunkelheit und Ruhe. Nach der sengenden Hitze und dem grellen Licht der Sonne eine höchst willkommene Abwechslung, die einem Linderung vor allem in Form von Stille verschaffte. Béla lauschte der Nacht. Er betrachtete das funkelnde Spiel der Leuchtkäfer am Waldesrand, hörte das geheimnisvolle Geraschel von nachtaktiven Raubtieren. Überall offenbarte die Nacht mit eindringlicher Emanation eine numinose Welt. Wegen der sehr geringen Lichtverschmutzung war der Himmel über Waldhütten voller Sterne, die an die glitzernden Seelen der Toten erinnerten. Béla erkannte die spinnwebengleich verlaufenden Linien der Milchstrasse, die ihm vor Augen führten, wie klein und unbedeutend die Erde und die Menschen erscheinen und an die allgegenwärtige Leere und Einsamkeit gemahnten.
Zurück im Dorfkrug, dackelte Churchill gewohnheitsmässig in die Küche. Er stand wie ein Trottel vor dem Fressnapf, als Béla die gut ausgestattete Küche betrat. Man konnte dem Hund ansehen, dass er sich nicht dazu durchringen konnte, etwas zu fressen. Sein Magen hatte sich zwar beruhigt, aber hundertprozentig wohl fühlte er sich noch nicht. Gemächlich trottete er von der Küche hinüber ins Restaurant und platzierte sich grunzend auf seiner Hundedecke.
Richtig viele Gäste hatte es im Dorfkrug