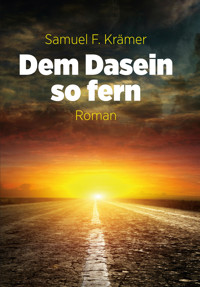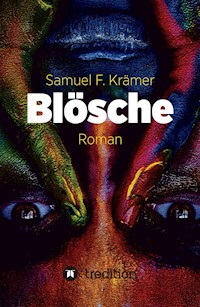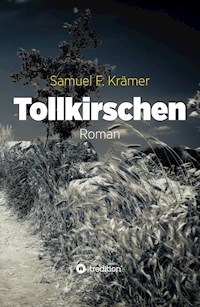
9,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ich nehme den Leser mit auf eine traumwandlerische Reise zu den Oberirdischen, zu den Unterirdischen und zu den Verlorenen. Während bei den Oberirdischen hundert Jahre verstreichen, vergehen bei den Unterirdischen wenige Wochen, und bei den Verlorenen ist die Zeit ihrer metaphysischen Natur beraubt. Ich werde dem Leser den Menschen vorführen, wie er wirklich ist: dumm, habgierig, untreu und deshalb kurzlebig. Dazu reisen wir auf der Landkarte der Zeit zurück ins Jahr 1875 und folgen meinen Ahnen über einen Zeitraum von hundert Jahren durch mehr oder weniger schwierige Zeiten. Wir treffen skurrile Gestalten und begleiten meinen kauzigen, kleinwüchsigen Grossonkel Leopold, der das zweite Gesicht hat und hellsichtig ist vor allem in Dingen, die den Tod betreffen, auf seiner Odyssee mit den Unterirdischen. Die Unterirdischen - eine Horde kiffender, lüsterner Zwerge, die seit jeher darum bemüht sind, die Menschheit mit den neuesten wissenschaftlichen und philosophischen Erkenntnissen zu versorgen. Wir nehmen Teil an deren Mission, die nicht weniger zum Inhalt hat, als ein Buch zu finden, um das universelle Gleichgewicht zwischen Realität, Fiktion und Traum wieder herzustellen. Wir begegnen der kosmischen Keimzelle, einem chthonischen Wesen, das älter als das Universum ist und sich von Zeit ernährt, einem Wesen, welches dem Halbgott Loki, dem grössten aller mythischen Schurken, dabei helfen wird, sich von der mythologischen Fessel zu lösen und in die Wirklichkeit zu fliehen. Wir reisen mit den Kirchberger Erdleuten durch Raum und Zeit, um die Verlorenen zu treffen. Wir verbringen ein paar turbulente Tage in deren Gesellschaft, bevor wir sie auf ihrem letzten Gang begleiten, den sie mit bewundernswerter Ataraxie beschreiten. Ich zeige dem Leser auf unterhaltsame Art, dass die Wirklichkeit, wie er sie kennt, nicht alles ist. Zusammen werden wir die Welt, die gepflastert ist mit Dummheit, abschütteln, um endlich zu erkennen, was sich hinter unserem Dasein versteckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1304
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Samuel F. Krämer
Tollkirschen
Roman
Für meine Eltern
© 2017 Samuel F. Krämer
Umschlaggestaltung: Samuel F. Krämer
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Taschenbuch: 978-3-7439-3079-7
ISBN Hardcover: 978-3-7439-3080-3
ISBN e-Book: 978-3-7439-3081-0
Das Werk, einschliesslich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Den Tod überlistet
Verloren
Kriegsbegeisterung
Lilith
Fleischhauer Hackl
Zwischen den Welten
Spanische Grippe und Fladnitzer Morde
Der Hüter der Ziegen
Nicht schicklich genug
Sonnenschein
Putschversuch
Das Beischlafmonster
Christina heiratet und Leopold verschwindet
Der Koch
Flucht aus Stalingrad
Kirchberger Erdleute
Russische Schweine – verrückter Nazi
La Grande Tour
Brünnerlinge
Das gestohlene Buch
Der Kuhficker
Bruder Hugo
Die kosmische Keimzelle
Der Schürzenjäger
In den carrières von Paris
Die irre Irmgard
Der gemeinsame Nenner
Der Vatikan und das Meer
Flucht in die Wirklichkeit
Fürchtegott Wendehals
Der letzte Gang
Der Aussenseiter
«Dummheit, Irrtum, Sünde, Geiz hausen in unserm Geiste, plagen unsern Leib, und wir füttern unsere liebenswürdigen Gewissensbisse, wie die Bettler ihr Ungeziefer nähren.» Charles Baudelaire
Erstes Kapitel
Den Tod überlistet
Zum ersten Mal, seit ich hier bin, sind schon seit Tagen die Schleusen des Himmels geöffnet. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise hüllt ein hartnäckiger Nebel die eigentümliche Szenerie ein, die sich mir draussen offenbart. Aber jetzt ist ein steter Bindfadenregen hinzugekommen, der mich einerseits mit seinem eintönigen Rauschen beruhigt, mich aber andererseits seit seinem unerwarteten Auftreten in ebensolchem Masse beunruhigt. – Langsam verschwindet der Nebel, und es sind absolut keine Regenwolken zu sehen. Ich kann durch die Regenwand hindurch die kosmische Schwärze erkennen und deutlich die Sterne funkeln sehen.
«Wenn es weiterhin wie aus Kübeln schüttet, ziehe ich den Bau einer zweiten Arche ernsthaft in Betracht», dachte ich lächelnd.
Auch wenn es dazu eigentlich schon zu spät wäre.
***
Zuweilen schränkt ein pulsierendes Skotom mein Gesichtsfeld beträchtlich ein, und ich habe das Gefühl, als schaute ich in den Eingang eines Wurmlochs, zumindest zu Beginn des Prozesses, den mein Hirn völlig unerwartet und zumeist unpässlich einleitet. Als leuchtete eine Aurora borealis vor meinen Augen, oder als tauchte eine Qualle aus den Tiefen meines Bewusstseins langsam an die Oberfläche empor, elegant und anmutig wie ein Engel, um schliesslich an der Innenseite meines Schädels anzustossen, wieder und wieder. Mein Gesichtsfeld ist deutlich eingeschränkt, vor meinen Augen scheint etwas herumzuwabern wie Antimaterie in einem Vakuum. Dieses wabernde Etwas schickt sich unmittelbar nach seinem Erscheinen an, unter Begleitung von plötzlich auftretenden Kopfschmerzen anzuwachsen und schliesslich nach zirka einer halben Stunde mein Gesichtsfeld zu verlassen und sich hinter meinen Augen im Kopf einzunisten, wo es bleibt und sich dezent zurückhält.
Warum nur lösen die Synapsen in meinem Gehirn eine derartige Aktion aus und schränken meine kongenitalen optischen Fähigkeiten durch diese Fehlkontakte so ein, dass ich Dinge sehe, die mir mein Gehirn vorgaukelt zu sehen – das unbekannt Vertraute, aber dennoch nicht Erwünschte – und trotzdem in seiner Art Wunderschöne. Es hilft auch nichts, während dieser Phase eingeschränkter optischer Wahrnehmung die Augen zu schliessen und zu warten, bis es vorüber ist. Ich sehe es auch mit geschlossenen Augen, es ist einfach da, es hat sich in meinem Sehzentrum als etwas manifestiert, das auf seiner Daseinsberechtigung beharrt wie eine Narbe oder eine Tätowierung. Wie dem auch sei, ich habe mit diesem szintillierenden Skotom, wie es im Fachjargon heisst, nun mal zu leben. Aber, und das müsst ihr mir glauben, es gibt Schlimmeres, als ein funkelndes Etwas vor Augen zu haben, das eigentlich gar nicht da ist und flimmert wie ein Stroboskop auf niedriger Betriebsstufe.
Auslöser ist jeweils ein unkontrollierter Blick in einen Punkt gebündelten Lichts, der sich auf der Innenseite meiner Augen festhakt und sich zu einem ruckenden Diamanten ausweitet, welcher ständig seine Farbe wechselt. Das ist mir vor ungefähr fünfundvierzig Minuten widerfahren, weswegen ich gezwungen war, die Niederschrift meiner Geschichte kurz zu unterbrechen und abzuwarten, bis sich mein Gesichtsfeld wieder normalisiert hat. Während dieser physischen Beeinträchtigung habe ich dann kurzerhand beschlossen, meine Geschichte mit der Beschreibung dieses Handicaps zu beginnen, auch wenn es nicht einfach ist, dies in Worte zu fassen. Wenn das Skotom in seinem vermeintlichen Vorhandensein auch wächst und wieder verschwindet, heisst das nicht, dass die damit einhergehenden Kopfschmerzen gleichfalls verschwinden. Im Gegenteil, die sind nur der Auftakt zu einem veritablen Migräneanfall. Die Qualle in meinem Kopf macht mir mit ihrem Erscheinen deutlich, dass ich in absehbarer Zeit unter so heftigen Kopfschmerzen leiden werde, dass meine Gedanken brennen – ein Flächenbrand auf der Gehirnrinde.
Das kann ich nur bestätigen, denn dieser Zustand ist bereits eingetreten. Ich bin bestimmt kein klassischer Migränepatient, der sich während der Schmerzattacken am besten bei völliger Verdunkelung in die Horizontale begibt, nein das bin ich nicht. Ich bin auch jetzt noch durchaus imstande, klar zu denken und meine Gedanken – wie ihr seht – nachträglich zu Papier zu bringen. Vielleicht will mir das Skotom aber nicht nur verraten, dass eine Migräne im Anmarsch ist, sondern noch etwas ganz anderes mitteilen, nämlich etwas, das zu verstehen ich noch nicht befähigt bin. Vielleicht sind es visualisierte Gedanken von der Person, in deren Traum ich mich befinde, und mein Gehirn – oder zumindest einige Gehirnregionen – müssen erst noch lernen, mit einer solchen Information umzugehen. Und die Kopfschmerzen sind bloss eine Folge der Überlastung dieser bestimmten Gehirnregionen. Na ja, das sind natürlich nur Mutmassungen, und vielleicht ein wenig Wunschdenken. Auf alle Fälle werde ich mein Skotom – und das im wahrsten Sinne des Wortes – im Auge behalten.
Ihr könnt es mir glauben oder nicht: Ich bin einer jener Menschen, die einfach ein Buch schreiben müssen, so wie es Menschen gibt, die unbedingt kopfüber an einem Gummiseil von einer Brücke springen müssen. Ob ich dazu fähig bin – zum Schreiben eines Buches –, weiss ich in diesem Moment noch nicht. Wahrscheinlich muss man zum Schreiben geboren sein, das Talent dazu muss einem schon in die Wiege gelegt worden sein. Epigenetisch betrachtet heisst das etwa, dass das Gen, das fürs Schreiben zuständig ist – und ich meine jetzt nicht das Schreiben an und für sich, das man in der Schule lernt, sondern das Schreiben von anspruchsvoller Prosa oder die Dichtkunst – dass also dieses Gen, das eingebettet ist in der Doppelhelix der DNA, aktiviert werden muss. Dafür zuständig sind chemische Stoffe in unserem Körper, welche quasi als on-/off-Schalter fungieren.
Nun, wie dem auch sei, wichtig ist im Moment, dass ich beginne zu schreiben und euch erzähle, was sich in meinem nichtigen Leben zugetragen hat. Ich rate euch: Erwartet nicht zu viel. Ob ich von mir erzähle oder von wem oder was auch immer, spielt keine Rolle. Alle Geschichten gehören zusammen, sie sind ineinander geschachtelt und bilden als Ganzes das Leben, das für die Dauer seiner berechtigten Existenz den universellen Kräften zu trotzen versucht – und das in der Tat mit erstaunlichem Erfolg, denn die Zeit kennt keine Gnade und lässt alles ins Chaos driften.
Zurzeit sitze ich hier an meinem Schreibtisch und muss diese Geschichte zu Papier bringen, weil ich Teil einer Geschichte bin, in der ich eine Geschichte schreibe. Und überhaupt: Schliesslich lebt man, um zu erzählen. Während ich diese Zeilen niederschreibe, hocke ich in meinem Hotelzimmer, das ich seit geraumer Zeit bewohne und wo ich bestimmt noch eine Zeitlang bleiben werde – wie lange, kann ich nicht sagen, vielleicht für immer. Es ist ein sehr angenehmes Zimmer, die Einrichtung entspricht exakt meinen Vorstellungen eines perfekten Hotelzimmers – es ist sehr geräumig und von ansprechender Raumhöhe, der Riemenparkett ist teils mit exklusiven Teppichen belegt und die Möblierung ist in ihrer Gesamtheit sehr geschmackvoll ausgefallen. Die beiden Kreuzstockfenster bieten einen wunderbaren Blick aufs Wasser, schade nur, dass die Sicht meistens durch einen hartnäckigen Nebel getrübt ist. Und dass es jetzt auch noch wie aus Kübeln schüttet, nährt in mir den Verdacht, dass meine Zeit möglicherweise bald abgelaufen ist.
***
Das Erste, das ich zu hören bekam, als ich das Licht dieser wunderbaren Welt erblickte, war das Gespräch zwischen meiner Mutter und der Hebamme, die damals in der Nachbarschaft wohnte und allen werdenden Müttern in unserem Viertel, die zu Hause gebaren, im entscheidenden Moment zur Hand ging.
«Na wenn das mal kein strammer Junge ist», sagte die Geburtshelferin, während sie mich kopfüber an den Füssen hielt. «Wie soll der Kleine denn heissen?»
Erschöpft und schweissnass vor Anstrengung gestand meine Mutter, dass man sich noch für keinen Namen für mich entschieden habe und fragte die Hebamme, welche mich gerade von oben bis unten wusch, wie sie mich nennen würde. Da es heute der 15. August sei und sie ihren eigenen drei Kindern jeweils einen der Namen gab, deren Namenstag gerade war, schlug sie meiner Mutter vor, mich Rupert zu nennen.
So, nun wisst ihr es: Mein Name ist Rupert. Ich wurde am 15. August 1962 zu Hause geboren. Hausgeburten waren damals gang und gäbe. Ich war ein Säugling durchschnittlicher Grösse und schien gesund, nur gab ich partout keinen Laut von mir. Aus diesem Grund wurde ich zur Untersuchung ins Spital gebracht und gründlich durchgecheckt. Aber auch dort blieb ich still. Und so blieb es auch: Bis zu meinem dritten Lebensjahr sollte ich weder schreien noch sonst kaum einen Laut von mir geben, geschweige denn sprechen. Ich war zweifellos ein hoch zufriedener Säugling. Ich bekam regelmässig meine Milch und später meine Nahrung, meine schmutzigen Windeln wurden gewechselt, an Zuneigung und Zärtlichkeiten fehlte es mir nicht. Es bestand absolut kein Grund, mich zu beklagen. Also schwieg ich. Und um meiner Zufriedenheit Ausdruck zu geben, lächelte ich tonlos. So habe ich schon im Säuglingssaal gemerkt, dass man mit Schweigsamkeit mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte als mit Schreien. Alle Neugeborenen ausser mir plärrten, was das Zeug hielt. Dementsprechend genervt waren die Säuglingsschwestern. Ich hingegen bewahrte die Ruhe und lächelte die Schwestern an. So habe ich sie regelrecht um den Finger gewickelt und verschaffte mir dadurch eine Sonderbehandlung. Ich wurde schnell der Liebling auf der ganzen Säuglingsstation. Alle wollten sich in den ersten Tagen meines Lebens um mich kümmern – und ich genoss es. Ich lauschte den Geräuschen, die die Schwestern um mich herum erzeugten, und dem immer wiederkehrenden Geschrei der Säuglinge und machte mir meine Gedanken zu all dem, so weit ich damals dazu imstande war. Auf diese Art wurde ich schon früh ein routinierter Denker, der in seiner Schweigsamkeit einen Weg fand, sich das Leben erträglicher zu machen.
Dann im Alter von sechzehn Monaten fiel meiner Mutter auf, dass ich unregelmässig und für meine Verhältnisse äusserst lautstark zu atmen begann. Sie nahm mich aus dem Bettchen zu sich ins elterliche Ehebett und legte mich neben sie, wo eigentlich mein Vater liegen sollte. Der befand sich aber gerade mal wieder im Ausland und baute für eine Zürcher Firma Anlagen für elektrostatische Gasreinigung. In der Nacht dann wurde das Schnaufen zu einem Röcheln, und ich begann allmählich herumzuzappeln wie ein Fisch an Land. Inzwischen war auch meine Grossmutter mütterlicherseits erwacht und ins Schlafzimmer gekommen.
«Ach du meine Güte! Kind, was ist passiert?», fragte sie aufgeregt.
«Ich glaub, er kriegt keine Luft mehr», schrie meine Mutter.
Sofort packte meine Grossmutter mich an den Füssen wie eine Ratte und klopfte mir auf den Hintern.
«Geh und hol’ Mathilde!»
Zwei Minuten später kam sie mit der netten Nachbarin von nebenan zurück. Kaum hat mich die schlaftrunkene, fettleibige Frau mittleren Alters gesehen, war sie auch schon hellwach, schob meine weinende Mutter zur Seite und fasste mich an den Füssen, wie es kurz zuvor meine Grossmutter getan hatte. Dann holte sie aus und schlug meinen schlaffen, hilflosen kleinen Körper, der inzwischen eine eigenartige Farbe angenommen hatte, wieder und wieder aufs Bett, bis ich von Neuem zu röcheln begann.
Das war meine erste und bislang einzige Nahtoderfahrung. Und ich kann euch eins sagen: Ich habe weder ein gleissendes Licht am Ende des Tunnels gesehen, noch sind mir die Geistwesen verstorbener Verwandter erschienen. Ich hatte weder ausserkörperliche Wahrnehmungen, noch empfand ich Liebe und Wärme. Ich kriegte einfach keine Luft mehr und bin gestorben – typischer Kindstod. An der Pforte zum Himmel sah ich gerade noch den Hintern von Petrus, der sich von mir entfernte und in der himmlischen Diesigkeit verschwand. Dann wurde es still, und wenn ich still sage, dann meine ich auch still. Da waren keine unangenehmen Geräusche, da war gar nichts mehr. Totale Ruhe. Nada. Es war herrlich. Leider hielt dieser elysische Zustand nicht lange an, und schon bald drangen mir das Wimmern und Weinen meiner Mutter und das energische Auf-mich-Einreden Mathildens und meiner Grossmutter an mein Ohr.
«Reiss dich zusammen, Kleiner, komm zurück, deine Zeit ist noch nicht abgelaufen.»
Hätte ich einen wirklich triftigen Grund gehabt, mein Leben hinzugeben, dann hätte ich das auch getan. Aber da war kein Grund, für den sich ein solches Opfer gerechtfertigt hätte. Also kam ich zurück. Nach meiner wundersamen Rettung durch Mathilde wurde ich unverzüglich ins Spital gebracht, wo ich diesmal für längere Zeit bleiben sollte. Denn während ich so dahinschied, hatte sich mein kleiner Körper total verkrampft, und ich sollte noch lange an den Folgen dieses Todeskampfes leiden. Aber auch das nahm ich gelassen hin und genoss erneut die uneingeschränkte Aufmerksamkeit des Pflegepersonals. Dass ich in diesem Zustand weder weinte noch schrie, fanden die Ärzte recht seltsam, kamen dann aber zum Schluss, dass meine Stimmbänder und meine Zunge es mir einfach nicht ermöglichten, mich in irgendwelcher Form zu artikulieren. Nicht nur meine Augen hatten sich derart verdreht, dass ich noch jahrelang fürchterlich schielen sollte, auch meine Zunge hatte sich aufgewickelt wie eine Ringelnatter um einen Ast. Ich blieb ein paar Wochen in der Obhut der Ärzte. Während meines Klinikaufenthalts bekam ich natürlich viel Besuch. Zuweilen waren da so viele Leute im Zimmer, die sich um mein Bettchen scharten wie die Geier um einen Kadaver, dass mir nichts anderes übrig blieb, als auf der Stelle einzuschlafen. So glaubte ich, mich den gierigen Blicken der Besucher entziehen zu können.
Wieder zu Hause, ging es in gleicher Manier weiter: Das ganze Viertel kam mich besuchen. Nebst den Meldungen über das Grubenunglück von Lengede in Deutschland im Rundfunk und im Fernsehen war ich die Sensation im Viertel: Ein kleiner, schweigsamer Junge, der dem Tod ein Schnippchen geschlagen hat. Meine Rettung durch Mathilde wurde der Rettung der eingeschlossenen Bergleute in der Erzgrube Mathilde der Ilsener Hütte in Lengede gleichgesetzt. Nicht nur hatte meine Retterin denselben Namen wie die Erzgrube, aus der am 7. November 1963 nach beinahe zwei Wochen die elf letzten noch lebenden Bergleute gerettet wurden, die durch einen gewaltigen Wasser- und Schlammeinbruch eingeschlossen worden waren, nein, die beiden Rettungen fanden sogar zeitgleich statt. Mathilde, die Nachbarin, setzte grosse Stücke auf diese Gemeinsamkeiten und sprach damals von nichts anderem. Solche Synchronizitäten seien schliesslich nicht alltäglich, meinte sie. Eigentlich ging mir das alles so richtig gegen den Strich. Ich wurde mehr und mehr zu einem Kind der Öffentlichkeit. Und genau das versuchte ich zu vermeiden. Dass Bollwerk, das ich mittels meiner Schweigsamkeit errichtet hatte, drohte mehr und mehr einzustürzen wie die Mauern zu Jericho. Um mir meine gewünschte Ruhe wieder zu verschaffen, musste ich mir eine andere Strategie zurechtlegen.
Während meiner Genesung wurde ich liebevoll umsorgt, nur mit Samthandschuhen angefasst, sowohl von meiner Mutter, meiner Grossmutter wie auch von meinen zwei älteren Geschwistern, soweit die beiden dazu fähig waren. Besonders zu meiner Grossmutter entwickelte ich eine innige Beziehung. Sie kümmerte sich während meiner Rekonvaleszenz rührend um mich. Sie unterstützte meine Mutter tatkräftig bei der Erziehung von uns Kindern und bei der Führung des Haushalts. Sie ersetzte während jener Zeit den Vater, der nicht da war.
Zweites Kapitel
Verloren
Mit einem gerüttelt Mass an Gewissheit, dass er auch am heutigen Tag mancherlei Kurioses hören werde, verliess Philippe nach einer gründlichen Morgentoilette sein Refugium und begab sich forschen Schrittes zu seinem selbst gewählten Arbeitsplatz, an die Rezeption des Hotels auf der Brücke, wie er es nannte, eines Hotels, das es in seiner Art bestimmt nur einmal gab auf dieser Welt – und auf allen anderen möglichen Welten. Obwohl sich Philippe an diesem Morgen fühlte, als hätte man ihm Salz aufs Gehirn gestreut, liess er sich nichts anmerken und benahm sich so, wie es sich für einen erfahrenen Rezeptionisten geziemt – freundlich, aufmerksam, zuvorkommend, diskret und behilflich, um nur ein paar Tugenden zu nennen. Die Glaskörperflüssigkeit in seinen Augen schränkte seine Sicht derart ein, dass er meinte, er tauche in einem trüben Gewässer mit unzähligen kleinen und grösseren Lebewesen bizarrer Formen.
In der Nacht zuvor hatte ihn seine Tugendhaftigkeit mehr und mehr verlassen und das Verlangen nach gutem Wein trat an dessen Stelle. Er und Guillaume, ein wohlhabender Jurist und Weinbauer, der schon seit gut zwei Wochen im Hotel logierte, haben in gar pantagruelischer Manier dem Trunk und der Musse gefrönt, sodass die beiden, nachdem sie wie die Peripatetiker durch das Hotel geschritten, kaum noch im Stande waren, den Weg zu ihren Logis zu finden. Als diskreter, aufmerksamer, verständnisvoller und verschwiegener Ansprechpartner und Vertrauter der Anwesenden hatte Philippe, der sich auch die Aufgaben des Conciergen aufbürdete, immer ein offenes Ohr für alle Anliegen und Bedürfnisse seiner illustren Gästeschar. Nichts blieb ihm verborgen. Philippe kannte die Wünsche seiner Leidensgenossen und war ständig darauf bedacht, diese prompt und effizient zu erfüllen, selbst wenn sie noch so ausgefallen waren, denn gerade das ist im Milieu der Concierges eine Herausforderung und Ehrensache. Er kannte die Angewohnheiten, kleinen Marotten und Interessensgebiete seiner Mitbewohner. Guillaume war ihm sein liebster Gast. Vielmehr war er ihm ein guter Freund, ein Kumpel, zuweilen ein Zechkumpan, und vor allem war Guillaume ein fröhlicher, immer gut gelaunter Zeitgenosse, obwohl er sich – wie auch alle anderen im Hotel – unfreiwillig an diesem Ort befand. Guillaume seinerseits schätzte die Eloquenz, Diskretion und Bescheidenheit des Conciergen Philippe überaus. Ihre Sympathie füreinander beruhte auf Gegenseitigkeit.
Guillaume und Philippe unterhielten sich des Öftern darüber, warum sie beide und alle anderen Gäste sich gerade an diesem Ort eingefunden hätten, und beschlossen, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Die Anwesenden stammten zwar alle aus Paris, schienen aber aus verschiedenen Zeiten zu kommen, was doch sehr seltsam war und die ganze Angelegenheit nicht gerade vereinfachte. Auch wurden alle plötzlich und unerwartet aus ihrem gewohnten Alltag herausgerissen. Sie sahen sich mit einer Welt konfrontiert, die für jeden einzelnen völlig aus den Fugen geraten zu sein schien. Ja es machte gar den Anschein, dass ihre Daseinsberechtigung fortan in Frage gestellt wurde. Zu diesen Gemeinsamkeiten kam noch eine weitere hinzu: Die Umstände, unter welchen die Gäste zum Hotel gefunden hatten. Alle sich im Hotel aufhaltenden Personen beiderlei Geschlechts wollten über eine in ihrem jeweiligen Wohnort über den örtlichen Fluss führende Brücke schreiten, und zwar des Nachts. An ihren Wohnorten kamen sie aber nicht an. Sobald sie die jeweiligen Brücken betreten hatten, näherte sich ihnen eine dichte Nebelbank. Die Luft sättigte sich immer mehr mit Wasser, die Sicht wurde schlechter, und bei einigen machte sich alsdann eine Orientierungslosigkeit breit, die in dieser Situation völlig unbegründet war. Auf einer Brücke konnte man nur in zwei Richtungen gehen, und die Gefahr, sich zu verlaufen, war doch sehr gering, wenn nicht sogar unmöglich.
«Ich schritt einmal mehr über die Pont Neuf», erklärte Guillaume dem Conciergen Philippe, «und ich weiss mit Bestimmtheit, dass der Nordteil der Brücke, auf dem ich mich befand, sieben Steinbogen mit Spannweiten zwischen fünfzehn und neunzehn Metern hat. Dieser Teil der Brücke hat eine ungefähre Länge von hundertzwanzig Metern, was ein Fussgänger nachts und bei dichtem Nebel problemlos in wenigen Minuten schaffen sollte. Ich liess die südliche Spitze der Seine-Insel hinter mir, grüsste im Vorbeigehen unseren guten König Henri IV. auf seinem steinernen Pferd und betrat den südlichen Teil der Pont Neuf, deren fünf Steinbogen sich über eine Länge von ungefähr fünfundsechzig Metern spannen.
Es war kühl und die Luft war feucht. Die Nacht war hereingebrochen. Obwohl es auf der Neuen Brücke keine Häuser hat, konnte ich wegen des dichten Nebels das Wasser der Seine nicht sehen. Aber ich konnte es hören und riechen. Der Nebel wurde noch dichter, mein lieber Philippe, und ich schritt wie ein Blinder wacker voran. In wenigen Minuten würde ich in meinem Stadthaus in der Rue Dauphine sein und mir ein Glas guten Weines gönnen. Aber dem war nicht so, wie Sie sehen, denn ich bin immer noch auf der Pont Neuf, oder wie diese Brücke nun heissen mag. Ich ging weiter und begann die Vorsprünge über den Stützpfeilern zu zählen, von denen es nur deren fünf auf dem südlichen Teil hat. Als ich bei zwölf angelangt war, blieb ich stehen, drehte mich um und ging in entgegengesetzter Richtung auf die Île de la Cité zu, die Vorsprünge erneut zählend. Nachdem ich deren zwanzig gezählt hatte und die Reiterstatue des guten Heinrichs immer noch nirgends zu sehen war, blieb ich wiederum stehen und setzte mich auf die Brüstung eines der Vorsprünge. Der Stein war nass und kalt. Was sollte das alles bedeuten – Himmelsackerment!
Ich wähnte mich schon in einem schlechten Traum und hoffte auf ein baldiges Erwachen. Aber wer nicht schläft, der nicht erwacht. Also blieb ich sitzen und wartete, weil durch Sitzen und Ruhen die Seele des Menschen zur Einsicht kommt. Mir wurde aber lediglich kalt an diesem feuchten Ort und ich machte mich erneut auf den Weg, diesmal wieder in Richtung Rue Dauphine. Der Nebel lag nach wie vor auf dem feuchten Mauergestein wie ein Leichentuch auf dem Entleibten, ich ging schneller und zählte erneut die runden Vorsprünge. Meine Kleider waren inzwischen feucht und ich begann allmählich zu frösteln. Ich weiss nicht mehr, wie lange ich vorangegangen bin und wie viele Vorsprünge ich gezählt habe. Wie ein Maulwurf sich durch dunkles Erdreich wühlt, schritt ich durch die feuchte, schwere Luft, die jetzt nicht mehr den typisch fauligen Seinegeruch hatte, sondern vielmehr nach dem Meere roch. Ich begegnete keiner Menschenseele, keinem streunenden Köter und keiner miauenden Katze. Ich war allein. Allein auf der Brücke, die ich jeden Tag überquerte, in der Gewissheit, dass unsere geliebte Seine unter ihr hindurchfloss. Aber – mein geschätzter Freund – die Brücke hatte sich verändert. Sie schien weder einen Anfang noch ein Ende zu haben. Sie schien ein unbekanntes Meer zu queren. Meine mir so vertraute Pont Neuf war mir auf einmal fremd. Trotzdem ging ich munter weiter und fand schliesslich dieses geheimnisvolle Gebäude, das wie ein aufgetakelter Rahschoner aus dem Nebel auftauchte. Ich war erleichtert und trat ein.»
«Brücken in Paris sollte man des Nachts meiden. Bei mir war es die Pont Marie», entgegnete Philippe, «ich war auf dem Weg von der Île Saint-Louis zum rechten Ufer, das ich nicht erreichen sollte. Es erging mir wie Ihnen, mein lieber Guillaume. Mit dem Unterschied, dass sich mein Schicksal in jener Nacht im Juli des Jahres 1682 änderte, Ihres aber im August des Jahres 1645.»
«Oh, das klingt ja alles äusserst interessant», erwiderte Guillaume, «Zeit scheint an diesem Ort eine andere Rolle zu spielen.»
«In der Tat, mein lieber Guillaume, in der Tat», bestätigte Philippe», Zeit scheint an diesem Ort möglicherweise gar keine Rolle zu spielen. Wir alle, die wir uns hier eingefunden haben, waren ungefähr von gleichem Alter, als wir unserem gewohnten Leben entrissen wurden. Nun sind wir hier, geniessen unseren Aufenthalt und fragen uns, wie und wann wir wieder zurückfinden werden in unser ach so angenehmes Leben. Wenn Sie mich fragen, mein lieber Guillaume, dann geniesse ich meinen Aufenthalt hier, wenn er auch – im Gegensatz zu Ihrem – mit Arbeit verbunden ist. Und mir scheint, dass auch die Übrigen, ob sie arbeiten oder nicht, höchst zufrieden sind mit ihrer Situation.»
«Da bin ich ganz ihrer Meinung, mein Freund, vielleicht sind wir in den elysischen Gefilden, auf der Insel der Seeligen», mutmasste Guillaume mit einem verklärten Blick.
So unterhielten sich die beiden noch lange in der vergangenen Nacht und zechten bis in die Morgenstunden. Denn auch hier, an diesem eigenartigen, zeitlosen Ort folgte der Tag auf die Nacht und die Nacht auf den Tag.
Drittes Kapitel
Kriegsbegeisterung
Meine Grossmutter Christina verliess ihre Heimat Österreich im Jahr 1963 und kam für den Rest ihres Lebens zu uns in die Schweiz. Meine Mutter, die ihrerseits schon im Jahr 1957 in die Schweiz ausgewandert war, um eine Arbeit zu finden, holte ihre Mutter zu sich, um gemeinsam mit matriarchalischer Hand unseren vaterlosen Alltag zu führen. Schon Generationen vorher waren es die Frauen, die den Lauf der Geschichte unserer Familie durch ihren eisernen Willen und ihre Weltoffenheit bestimmen sollten.
So verliebte sich während des Österreichisch-Preussischen Kriegs Christinas Grossmutter, welche damals im Herzogtum Lauenburg lebte, in einen gut aussehenden, feschen Soldaten aus Österreich. Nach der Auflösung des Deutschen Bundes, der durch obgenannten Krieg faktisch schon zerfallen war, löste Christinas Grossmutter die Bande zu ihrer Familie und folgte eben diesem Soldaten in dessen Heimatort Kirchberg an der Raab in der Oststeiermark. Das war im Jahr 1867. Im selben Jahr wurde die Österreichisch-Ungarische Monarchie gegründet. Christinas Grossmutter, inzwischen vierundzwanzig Jahre alt, ehelichte ihren Soldaten und schenkte ihm zwei Töchter, Maria und Magdalena. Die kleine Familie bewirtschaftete ihren eigenen Hof und führte ein zufriedenes, aber entbehrungsreiches Leben.
Bis zur Jahrhundertwende erlebte Österreich-Ungarn sowohl innen- als auch aussenpolitisch eine aktive Zeit. Viele neue Parteien wurden gegründet und Bündnisse sowohl mit Deutschland als auch mit Italien eingegangen, die für den kommenden Ersten Weltkrieg noch ausschlaggebend sein sollten. Magdalena, die Mutter Christinas, lebte zur Zeit des Fin de siècle in Wien. Die Wiener Moderne, die eine Vielzahl von kulturellen und wissenschaftlichen Persönlichkeiten hervorgebracht hatte, war eine Zeit, die bei Magdalena einen bleibenden Eindruck hinterliess. Sie bewegte sich in einer für eine Bauerntochter vom Land beinahe unerreichbaren Gesellschaft, gewann viele Freunde und Freundinnen und verliebte sich bisweilen in einen ungestümen Studenten oder einen Soldaten in schneidiger Uniform.
Sie bekleidete damals eine Stelle als Schreibkraft in der städtischen Verwaltung. Das alles war sehr aufregend, trotzdem führte ein schreckliches Ereignis meine Urgrossmutter zurück in die Steiermark nach Kirchberg an der Raab. Am Silvesterabend des Jahres 1899 wurde nicht nur äusserst ausgiebig gefeiert in Wien, es wurde auch die beste Freundin meiner Urgrossmutter Magdalena vergewaltigt und umgebracht. Man habe gesehen, wie sie sich im Laufe des Abends vom Kreise ihrer Freunde mit ein paar zwielichtigen Gestalten entfernt habe und daraufhin nicht mehr gesehen ward.
Ihre geschändete Leiche wurde zwei Tage später am Ufer der Donau gefunden, sie wurde mehrmals vergewaltigt und, nachdem man sie erdrosselt hatte, in den Fluss geworfen – ihre Mörder wurden niemals gefasst. Magdalena, damals 25-jährig, konnte diese schreckliche Tat weder fassen noch verkraften und beschloss, nicht zuletzt auf Geheiss ihrer Eltern, Wien den Rücken zu kehren und auf das elterliche Gehöft zurückzukehren. Man sprach zu Hause nur selten über diese abscheuliche Tat, und Magdalena fand zurück zu ihrer inneren Ruhe und Ausgeglichenheit. Das neue Jahrhundert hatte für Magdalena denkbar schlecht begonnen und sollte in der Folge noch mehrmals mit dem denkbar Schlechtesten aufwarten. 1904, mit beinahe dreissig Jahren, verliebte sie sich in den Bauern Alois. Sie heirateten ein Jahr später.
Meine Grossmutter Christina wurde im Jahr 1906 geboren. Zwei Jahre später kam ihr Bruder Leopold zur Welt. Im Alter von vier Jahren ass er Tollkirschen und hörte auf zu wachsen. Hätte Leopold nur eine schwarze Tollkirsche mehr gegessen, hätte er nicht nur aufgehört zu wachsen, sondern auch aufgehört zu leben. Die in dem Nachtschattengewächs enthaltenen natürlichen Gifte verursachten nicht nur physische Veränderungen, sondern hinterliessen ihre Spuren auch im Kopfe Leopolds – glücklicherweise nur im Kindesalter. So versuchte er unablässig, seinen Mangel an körperlicher und menschlicher Grösse dadurch zu kompensieren, dass er mit einer aufbrausenden, vorlauten oder gar tobsüchtigen Art durchs Leben ging, genauso wie ein bösartiger Kobold.
Mitunter nannten ihn vor allem die Kinder auch Rumpelstilzchen, weil Leopold durch die Strassen tanzte wie Rumpelstilzchen um sein Feuer und irgendwelche Lieder sang, die niemand kannte, und deren Texte für Unruhe sorgten. Man war sich einig, dass er verrückt war. Er trug ständig Tollkirschen mit sich, die er in seinen Hosentaschen verbarg. Mit diesen giftigen Beeren bewarf er zuweilen alte Leute oder Hunde und Katzen. Am Abend des 27. Juni 1914 sass Leopold zu Hause in der Küche am Esstisch im Herrgottswinkel und bewarf mit seinen Tollkirschen unablässig das gerahmte Bild, das an der Wand über der Küchenkommode hing und den Thronfolger Erzherzog Franz-Ferdinand zeigte.
Am nächsten Tag wurde Franz-Ferdinand bei einem Attentat in Sarajevo getötet. Kaiser Franz Joseph war darob nicht sehr betroffen und fuhr erst einmal nach Bad Ischl auf Sommerfrische. Seinem Neffen und dessen Frau Sophie, die bei dem Attentat auch getötet wurde, weinte er keine Träne nach, schliesslich war dieser nicht Manns genug, standesgemäss zu heiraten. Mit der Zustimmung des Kaisers wurde Serbien das Ultimatum gestellt und somit einer der Grundsteine zum Ersten Weltkrieg gelegt. In Kirchberg an der Raab fürchteten sich die Leute nicht nur vor dem kommenden Krieg, sondern ebenso davor, vom verrückten Leopold mit Tollkirschen beworfen zu werden. Man wurde sich gewahr, dass Leopold seine Wurfgeschosse ausschliesslich auf Menschen und Tiere warf, die im Begriff waren, in nächster Zeit das Zeitliche zu segnen. Als ob das Gift der Tollkirschen in dem Moment von der Frucht auf den Körper überging, in dem sie diesen berührte, und das Opfer unweigerlich dem Tod geweiht war. Leopold hatte das zweite Gesicht.
In der Zeit nach dem Attentat sah man Leopold oft durch die Strassen tanzen und hörte ihn singen, dass die letzten Tage der Menschheit angebrochen seien. Die Bürger von Kirchberg schüttelten einmal mehr den Kopf ob dieses seltsamen Gebarens, wurden aber gleichzeitig von einer Unruhe ergriffen, die sich in ihren Alltag einschlich und sich auf eine Weise festsetzte, die zu erklären niemand imstande war, aber jeder im Dorf unweigerlich mit ihr leben musste. Es war weniger die Furcht vor dem kommenden Krieg, als vielmehr die Angst vor dem Unerklärlichen, die einerseits von Leopold, andererseits von jedem selbst hervorgerufen wurde. Auf die Frage, was er, Leopold, genau damit meinte, wenn er von den letzten Tagen der Menschheit sang, antwortete der Gnom mit einem geistesabwesenden Blick, dass man schon sehen werde, was er meine, und er müsse jetzt überhaupt Tollkirschen sammeln gehen und hätte jetzt keine Zeit, sich zu unterhalten. Für ihn gäbe es bald viel zu tun. Und auf die Frage, was es zu tun gäbe für ihn, antwortete Leopold mit denselben Worten wie auf die vorangegangene Frage und hüpfte wie ein Hutzelmännchen davon.
Die Bürger von Kirchberg wussten sehr wohl, was Leopold tat, wenn er denn etwas zu tun hatte: Er prophezeite den Tod. Ob dieser unangenehmen Gewissheit waren nicht wenige Bürgerinnen und Bürger der Meinung, dass man diesen Troll, der in ihrem Dorf für Unruhe sorgte, endlich aus der Gemeinde jagte. Wenige Tage später kam Leopold mit blutendem Kopf nach Hause.
«Bist du hingefallen?», fragte ihn die Mutter, während sie in der Küche ein Huhn rupfte.
«Sie haben mit Steinen nach mir geworfen.»
Während das Deutsche Reich als Bündnispartner Österreich-Ungarns Russland am 1. August 1914 den Krieg erklärte, und am Abend desselben Tages russische Kavallerie-Abteilungen die ostpreussische Grenze überschritten, nahm Magdalena ihren Sohn Leopold an die rechte und ihre Tochter Christina an die linke Hand, verliess unter Begleitung ihres Mannes Alois das Haus und schritt zügigen – beinahe zackigen – Schrittes den Hang hinauf zur Gendarmerie. Sie erklärte den Bürgern von Kirchberg zwar nicht den Krieg, aber verlangte von den Landjägern unmissverständlich dafür zu sorgen, dass man ihren Sohn nicht mehr mit Steinen bewarf. In was für einer Welt man denn lebe, wenn man sich an einem kleinwüchsigen, wehrlosen, erst sechsjährigen Kind auf eine solche Art und Weise zu schaffen macht. Man werde sich darum kümmern, war die bescheidene Antwort der Landjäger, aber man habe zurzeit Wichtigeres und Dringenderes zu tun, schliesslich sei der Krieg ausgebrochen. Unbefriedigt mit dieser Antwort verliess die Familie die Gendarmerie und machte sich auf den Nachhauseweg, liess Kirche und Schloss hinter sich und erreichte die Sauschwanzerlgasse, ohne auch nur ein Wort gesprochen zu haben.
Kaum waren sie im Haus, begann Magdalena auf Alois einzureden wie Xanthippe auf Sokrates. Und ebenso wie jener athenische Gassen-Dialektiker das Gezeter seiner Gattin über sich ergehen liess, ertrug Alois die Tiraden seiner Frau mit der Gewissheit, dass Magdalena ja nicht von Natur aus zänkisch war wie Xanthippe und sie ihren Redefluss schon nach kurzer Zeit wieder eindämmen und versiegen lassen würde.
So könne es nicht weitergehen mit ihrem Sohn, der Kleine bringe sie alle noch in Teufels Küche, es sei höchste Zeit, endlich etwas zu unternehmen. Sie sollten sich vorstellen, wo das alles noch hinführe, jetzt wo es dann losgehe mit dem Krieg und all den Toten, schrie Magdalena in der Küche herum, während sie begann, das Abendessen zuzubereiten. Die Kinder schwiegen und Alois nickte synkopisch mit dem Kopf, bis die Wut Magdalenas sich allmählich legte, die Lautstärke ihres Geschimpfes sich auf ein erträgliches Mass senkte, das Wehgeschrei zu einem Lamento wurde und schliesslich ganz versiegte. Und da der schweigsame Alois nun das Gefühl hatte, es sei in dieser Situation nicht nur äusserst ratsam etwas zu sagen, sondern er wäre eben genau das seiner Frau schuldig, nämlich etwas zu dieser Sache beizusteuern, und sei es nur ein beruhigendes oder tröstendes Wort, sprach er mit ruhiger Stimme Folgendes: Man müsse eben etwas Geduld haben, und man werde es gemeinsam bestimmt schaffen, eine brauchbare Lösung zu finden. Alle Probleme wären mit der Zeit gelöst worden und würden auch in Zukunft mit ihr gelöst werden. Er solle den Mund halten und vor den Kindern keinen solchen Schmarren reden, war die Antwort Magdalenas, die inzwischen den Tisch gedeckt und das Essen angerichtet hatte. Alois tat wie geheissen und die Familie ass ihr Abendessen, ohne dass ein Wort gesprochen wurde.
Christina war das pure Gegenteil von Leopold: gross gewachsen, attraktiv, ausgeglichen und von sanftem Gemüt. Kein Wunder, sie hatte ja nicht von den Tollkirschen gegessen. Sie beschützte ihren drolligen Bruder vor allzu frechen Kindern oder wies Leute, die sich gar abfällig über Leopold äusserten, in die Schranken. Dieses selbstbewusste, starke Mädchen mit dem seidenen Haar, das ihr offen bis zum Hintern reichte, sollte zu einer reizvollen jungen Frau heranwachsen, die die Aufmerksamkeit der jungen Männer mehr und mehr auf sich zog. Das Rennen machte dann Jahre später der Tischler Josef Pucher aus Hof. Natürlich hätte Christina sich auch für den Grossbauern Bierbichler aus Eichkögl entscheiden können, oder für den Bierbrauer Stössl aus Studenzen, aber sie entschied sich für Josef, diesen sehnigen jungen Mann, der ständig ein Lächeln im Gesicht hatte, und dessen dunkle Augen und leicht umschatteten Augenwinkel seinem Wesen etwas Unnahbares verliehen. Christina näherte sich ihm jetzt erst recht, und obwohl die grosse Schüchternheit Josefs der aufkeimenden Liebe zunächst noch Steine in den Weg legte, gelang es Christina, mit ihrer zärtlichen Art, mit ihrer Geduld und ihrer Unverfrorenheit den jungen Tischler in die Freuden der Liebe einzuführen.
Während zu Beginn des Kriegs wirkungsvolle Propaganda nicht nur in Österreich-Ungarn auf fruchtbaren Boden fiel, sondern auch in Frankreich und vor allem in Deutschland eine grosse Kriegsbegeisterung herrschte, schickten sich Magdalena und ihre beiden Kinder Leopold und Christina an, sich auf eine längere Zeit ohne ihren Ehemann und Vater vorzubereiten. Auch Alois war begeistert von der Idee des Kriegs und hegte wie so viele andere auch den Wunsch nach Wiederherstellung einer intakten Männlichkeit, und man war sich in der Gaststube am Stammtisch einig, dass Juden, Frauen, Schwule und all die Künstler mit ihrer Dekadenz zu viel an Einfluss gewonnen hätten und das dem Wohlbefinden des Volkes abträglich sei, und es nun höchste Zeit wäre, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, indem man sich möglichst zahlreich die Uniform anzöge, sich den Helm aufsetze und mit einem Gewehr bewaffnet in den Krieg zöge, der alles wieder in Ordnung bringen würde. Und als sich Alois von seiner Familie verabschiedete, um für Kaiser und Vaterland zu kämpfen, hing sich Leopold wie eine Klette an des Vaters linkes Bein und schrie unablässig, dass er auch in den Krieg ziehen wolle. Das war für Magdalena zu viel des Guten und sie schalt ihren Mann einen Idioten mit seiner blöden Kriegsbegeisterung, und er solle jetzt losziehen mit seinen ebenso blöden Kriegskumpanen und ihnen gefälligst schreiben, sobald er Zeit dazu fände.
Nachdem Alois seinen Sohn abgeschüttelt hatte, trat er aus dem Haus, wo seine Mitstreiter ihn schon erwarteten, und marschierte mit ihnen Richtung Bahnstation. Leopold seinerseits schlüpfte, klein wie er war, zwischen den Beinen seiner Mutter hindurch, die in der Tür stand, und eilte der johlenden Männerschar hinterher, bis er sie eingeholt hatte und mit ihnen Sprüche skandierte wie Jeder Schuss ein Russ oder Serbien muss sterbien.
Bevor der Zug mit den frohgelaunten Soldaten die Bahnstation verliess, nahm Alois seinen Sohn an der Hand und fragte ihn, ob er niemanden von ihnen mit Tollkirschen bewerfen wolle, schliesslich zögen sie in den Krieg, und die Chance, in einem Krieg das Leben zu verlieren, sei nun mal grösser, als dass einem hier auf dem Land etwas zustösse. Zweifelsohne war Alois trotz allgemeiner Kriegseuphorie doch eine wenig beunruhigt ob seiner unmittelbaren Zukunft und wollte bloss sichergehen, dass er und seine Kumpane diesen Krieg auch unversehrt überstehen würden, und er setzte seiner Frage noch mehr Gewicht auf, indem er seinem Sohn tief in die Augen blickte, so wie nur ein Vater seinem Sohn in die Augen blicken konnte. Er und seine Freunde könnten beruhigt sein, erwiderte Leopold mit einer eigentümlich ernsten Stimme und einem verklärten Blick, sie kämen alle nach dem Krieg nach Hause zurück. Zufrieden mit dieser Antwort lächelte Alois seinen Sohn an, tätschelte dessen Wange und bestieg den Wagon, aus dessen Fenstern sich die johlenden Kumpane von Alois lehnten, nicht ahnend, welche Schrecken und Grausamkeiten der Krieg für sie bereithielt.
Viertes Kapitel
Lilith
Philippe genehmigte sich gerade ein paar in Distelöl und Weissweinessig eingelegte Seeteufelfilets mit frischem Ingwer und Zwiebelringen, als sich Guillaume zu ihm an die Rezeption gesellte und sich nach dessen Befinden erkundigte. Es gänge ihm gut, ein kleiner Kater, aber das sei nicht der Rede wert. Der eingelegte Fisch werde dem Kater den Garaus machen.
«Ich bevorzuge die überaus lobenswerte Wirkung der Beeren des Brechnussbaumes oder eine Tasse Tee aus Melisse und Rosmarin», erwiderte Guillaume mit erhobenem Zeigefinger, «heute allerdings habe ich lediglich eine salzige Brühe zu mir genommen.»
Guillaume machte einen munteren Eindruck. Er trug ein lockeres, an Brust und Ärmeln senkrecht geschlitztes Wams, wadenlange Röhrenhosen, einen etwas abgetragenen Imponiermantel und lederne Stulpenstiefel. In der rechten Hand hielt er salopp einen mit einer wehenden Straussenfeder geschmückten Schlapphut.
«Ich weiss, ich weiss, ich sehe nicht gerade aus wie ein À-la-mode-Kavalier, aber unter den gegebenen Umständen muss man das anziehen, was man bei sich hat. Ich ziehe die Pumphose den Röhrenhosen vor, und diese unbequemen Becherstiefel schmeicheln meinen Füssen in keiner Weise.»
«Oh, Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen, mein lieber Guillaume», sagte Philippe, «zweifelsfrei entsprach diese Mode im Paris des Jahres 1640 genau dem französischen Geschmack des Mannes. Und wir beide wissen nicht, nach wessen Mode man sich hier und heute kleiden soll.»
«Wie dem auch sei», erwiderte Guillaume pikiert, «ich werde jetzt etwas auf der Brücke flanieren und mir ein bisschen frische Luft gönnen.»
Just in diesem Moment gesellte sich Jean-Baptiste zu den beiden, ein eigenartiger Kauz mit spitzer Nase und eng beieinander liegenden Augen.
«Guten morgen meine Herren, wünsche wohl geruht zu haben. Heute scheint mir ideales Wetter für eine kleine Angelpartie zu sein. Die Fische werden bestimmt beissen. Ich hatte heute Nacht Besuch von Lilith. Philippe, wären Sie bitte so nett, mir Angel, Haken und Köder bringen zu lassen, ich warte am Eingang.»
«Oh, Jean-Baptiste hatte Damenbesuch heute Nacht?», fragte Guillaume Philippe, nachdem sich Jean-Baptiste Richtung Eingang begeben hatte. «Lilith, ein seltsamer Name. Ist sie ein neuer Ankömmling, den kennenzulernen ich noch nicht die Gelegenheit hatte?»
«Guillaume», setzte Philippe mit klaren Worten an, während er seinen leeren Teller wegräumte, «was Jean-Baptiste damit sagen wollte, ist, dass Lilith ihn heute nacht den kleinen Tod sterben liess. Und da er der Lustseuche wegen keinen Kontakt zu Frauen pflegt, hält er grosse Stücke auf Lilith und ihre nächtlichen Besuche. Er fühlt sich dann immer sehr ausgeglichen und voller Tatendrang. Heute geht er angeln und ist sich reicher Beute gewiss. Lilith beschert ihm seiner Meinung nach nebst dem nächtlichen Vergnügen auch grossen Erfolg bei seinen Unternehmungen während des darauffolgenden Tages – glaubt er zumindest.»
«Ah ja, das klingt ja sehr interessant», sagte Guillaume und setzte sich seinen Hut auf. «Dann haben wir in diesem Hause auch eine Liebesdienerin.»
«Lilith ist eine kanaanitische Gewitterdämonin und soll erstaunlicherweise laut jüdischen Bibelkommentatoren die erste Frau Adams gewesen sein», fuhr Philippe in seinen Ausführungen fort, während er sich mit seinen Ellenbogen auf der Theke abstützte. «Das ist natürlich die Meinung verschiedener Rabbiner, denen die Diskrepanz zwischen den beiden Schöpfungsmythen einiges Kopfzerbrechen bereitete. Adam und Lilith wurden beide nach dem Abbild Gottes geschaffen, und zwar aus Lehm, jedoch mit dem Unterschied, dass der Lehm, aus dem Lilith geformt wurde, unrein war. Lilith war eine Frau, die wusste, was sie wollte, und das ihren Adam auch spüren liess. So hatte sie es schon bald mächtig satt, immer die passive Rolle zu spielen, wenn sie fleischlich wurden. Sie wollte beim Liebesspiel auch mal des Zepter führen, wollte ihrem Adam zeigen, wo es langgeht. Sie wollte das Fundament ihrer festgefahrenen Liebe durch neue Praktiken ins Wanken bringen. Das passte wiederum dem braven Adam nicht, worüber Lilith sich ärgerte und sie in einem Moment unkontrollierten Zorns den fatalen Fehler machte, den unaussprechlichen Namen Gottes auszurufen, was nun Gott selbst erzürnte und er in seiner Allgerechtigkeit Lilith bestrafte. Sie wurde fortgejagt und in eine Dämonin verwandelt, die die Mannsbilder in ihren Träumen verfolgt und sie, wie gesagt, den kleinen Tod sterben lässt, was unserem lieben Jean-Baptiste heute Nacht widerfahren ist. Was Jean-Baptiste natürlich nicht weiss, ist die Tatsache, dass sich hinter den nächtlichen Heimsuchungen Liliths die Absicht verbirgt, das männliche Geschlecht zeugungsunfähig und dadurch Gottes Werk einen empfindlichen Strich durch die Rechnung zu machen. Adam fühlte sich auf einmal sehr einsam und begann jämmerlich zu klagen, bis Gott in seiner unendlichen Grosszügigkeit Eva aus dessen Rippe erschuf, um dem Gejammer ein Ende zu bereiten. Eva war unterwürfig und wollte beim Liebesspiel auch nicht oben sitzen wie die experimentierfreudige Lilith. Alles nachzulesen im Talmud, mein lieber Guillaume.»
«Ich wusste gar nicht, dass sie sich mit Schöpfungsmythen beschäftigen, mein Freund», erwiderte Guillaume. «Was mich betrifft, so ziehe ich eine Konkubine aus Fleisch und Blut dieser dämonischen Lilith vor. Nun denn, mein lieber Philippe, es ist Zeit für etwas Bewegung.»
Mit diesen Worten verliess er die Rezeption und trat auf die Brücke hinaus. Die Luft war frisch und roch nach Meer. Die Sicht war nach beiden Seiten bis auf ungefähr hundert Meter gut. Dann verschwand die Brücke allmählich im Nebel. Die Temperatur war angenehm. Guillaume entschloss sich, nach links zu gehen. Er zupfte seinen Imponiermantel zurecht, ordnete seine Beinkleider und stolzierte wie ein Gockel davon ins Ungewisse. Als inzwischen erfahrener Nebelschreiter tauchte er erhobenen Hauptes in den grauen Dunst und verschwand allmählich in der Diesigkeit. So schritt er schweigend voran, hielt bisweilen inne und stellte sich an die Brüstung, um einen Blick Richtung Wasser zu werfen. Er konnte an diesem Tage und in diesem Moment keine Strömung erkennen. Es schien sich um ein stehendes Gewässer zu handeln. Das war nicht immer so. An manchen Tagen konnte er trotz der herrschenden Windstille durchaus eine Bewegung des Wassers feststellen – mal in die eine, mal in die andere Richtung. Zuweilen schrie Guillaume seinen Namen in den Nebel hinaus, in der Hoffnung, dass die Nymphe Echo diesen zurückwarf. Bei einem der Vorsprünge über einem der unzähligen Stützpfeiler legte Guillaume eine kleine Rast ein und setzte sich auf die Brüstung. Dann erinnerte er sich gerne an das geruhsame Leben, dass er bis vor Kurzem geführt hatte.
Als erfolgreicher Weinbauer und -händler genoss Guillaume einen sehr guten Ruf. Er besass mehrere stattliche Weingüter auf dem Land, die er von seinem Vater nach dessen Tod übernommen hatte und erfolgreich in der Manier des Verstorbenen weiterführte. Die meiste Zeit über lebte er jedoch in Paris, in der Rue Dauphine, wo er seinen Geschäften nachging. Guillaume wusste so ziemlich alles über Weine, von der Traube bis zum ausgereiften Spitzenwein. Auf seinen Weingütern wählte er jahrelang die Assemblage aus und überwachte die gesamte Vinifikation. Weine waren Guillaumes grosse Leidenschaft. In Paris empfahl er sich als Verkoster an Degustationen oder hielt Vorträge in Önologie. Für ihn hatte das Trinken von Wein eine besondere Bedeutung. Er betrachtete es als eigenständige Philosophie: Wein trinken sei der Inbegriff des Genusses, Wein, das edelste Produkt der Natur, belebe die Sinne und lehre einen die Beherrschung und den richtigen Gebrauch derselben.
Guillaume war schon seit geraumer Zeit nicht mehr auf seinen Gütern. Er liebte es als Kind, mit seinem Vater durch die netten kleinen Dörfer zu wandern, welche zwischen ausgedehnten Wäldern in einer vielgestalteten Landschaft liegen, zwischen sanft gewellten Hügeln und Höhenzügen. Schon als Junge hatte Guillaume bei den anspruchsvollen Arbeiten des Winzers eifrig mitgeholfen. Sein Vater hatte ihm schon damals immer wieder gesagt, dass der Wein kein wohlfeiles Geschenk der Natur sei, sondern vielmehr ein Abbild des Volkes, das ihn hervorbringt. Und nun musste sich Guillaume damit zufriedengeben, zum Zeitvertreib und zur körperlichen und geistigen Erbauung auf einer Steinbrücke zu lustwandeln, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Auf einer Brücke, die zuweilen in dichtestem Nebel lag oder von wabernden Nebelschwaden umhüllt war.
An jenem Tag jedoch war die Sicht ausnahmsweise besser als sonst, sogar die Sonne vermochte hin und wieder durchzuscheinen. Alles in allem herrschte hervorragendes Wetter. Guillaume war zufrieden.
«Ich befinde mich weder in der Unterwelt noch auf der Insel der Seligen», dachte er. «Es gibt keine Sicherheit, ob die Dinge, die ich wahrnehme, tatsächlich existieren. Vielmehr besteht die Möglichkeit, dass ich träume. Ich bin ein Gefangener meiner selbst, ich bin nicht ohne Grund hier, auf dieser Brücke und in diesem Hotel, das beinahe den Anschein macht, als ob es ein Bewusstsein hat. Warum bin ich hier? Das herauszufinden ist ab sofort meine Aufgabe. Anstatt ständig nur müssig zu gehen und sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was das alles zu bedeuten hat, muss ich handeln. Wenn der Mensch erst mal nichts tut und die Arbeit ruht, wächst dessen Elend.»
Mit diesen Gedanken im Kopf setzte Guillaume seinen Spaziergang fort und misstraute fortan seinen Sinneswahrnehmungen. Er war sich gewiss, dass er imstande war zu denken, und das beruhigte ihn ungemein.
Zur selben Zeit unterhielt sich Philippe an der Rezeption mit Bruder Hugo, einem Jakobinermönch aus Paris. Bruder Hugo, Mönch des Ordens der Prediger, lebte bis anhin im Kloster am rechten Seineufer in der Rue du Faubourg Saint-Honoré und kümmerte sich um die Bibliothek mit seinen über dreissigtausend Büchern, die im Dachstuhl der Klosterkirche eingerichtet worden war. Was für Guillaume der Wein war, waren für Bruder Hugo die Bücher. Dass sich Bruder Hugo hier befand, betrachtete er als gottgewollt und nahm es mit stoischer Gelassenheit hin. Gott hatte ihn aus einem bestimmten Grund hierher geschickt.
Im Spätsommer des Jahres 1639 besuchte Bruder Hugo das Ordenskloster in der Rue Saint-Jacques, wo er sich mit seinen Brüdern traf und sich mit ihnen über weltliche und göttliche Themen unterhielt. Während der Frühmesse in der Rue du Faubourg Saint Honoré fiel dann die Abwesenheit Bruder Hugos auf, woraufhin man einen jungen Jakobinermönch in die Rue Saint Jacques schickte, um nach dessen Verbleiben zu fragen. Doch Bruder Hugo blieb verschwunden.
«Beim heiligen Gemächt des Papstes», intonierte Bruder Hugo, während er sich mit erhobenen Armen der Rezeption näherte, «mein lieber Philippe, der Herr sei mit Euch, ich muss Sie um etwas bitten. Ich bin wahrhaftig erstaunt über die Vielfalt und Anzahl der Bücher, die im Lesesaal stehen. Das hier kann kein gottloser Ort sein. Bei Gott dem Allmächtigen, das bestimmt nicht. Sie haben hier eine recht umfangreiche Bibliothek, nur schade, dass die Bücher völlig willkürlich in die Regale gestellt wurden. Wenn es Ihnen recht ist, mein lieber Philippe, dann werde ich Kraft meiner Berufung für etwas Ordnung sorgen. Sie wissen schon, was ich meine: die Griechen zu den Griechen, die Römer zu den Römern usw.»
«Oh, Bruder Hugo, es freut mich zu hören, dass Sie Gefallen an unserer Bibliothek gefunden haben. Aber was kann man schon anderes von einem Mönch erwarten. Machen Sie mit den Büchern, was immer Sie wollen. Vielleicht finden sie in den Büchern eine Antwort auf die Frage, warum wir hier sind.»
«Bei Albertus, dem grössten aller Jakobiner, das werde ich», frohlockte Bruder Hugo, «in Büchern findet man auf alles eine Antwort. Gott wird mir beistehen.»
Mit diesen Worten verabschiedete sich Bruder Hugo von Philippe, der nicht umhin konnte, dem Mönch noch Folgendes mit auf den Weg zu geben: «Den besten Blick auf Gott hat man aus der Hölle, mein lieber Hugo.»
Philippe wunderte sich immer mehr darüber, mit was für einer Gelassenheit er und die übrigen Anwesenden die Tatsache hinnahmen, dass sie sich alle an einem Ort befanden, den zu erklären keiner von ihnen imstande war. Zweifellos machten sich alle Gedanken darüber, und der eine oder der andere würde bestimmt schon bald mit einer Erklärung aufwarten. Vielleicht sollten sie sich alle mal zusammensetzen und nach Gemeinsamkeiten suchen, auf Grund derer sie hier sein könnten. Philippe konnte sich nicht vorstellen, dass sich eine höhere Macht völlig willkürlich Leute aussuchte, diese ihrem gewohnten Alltag entriss und sie hierher geleitetet, an diesen seltsamen, aber auf seine Art durchaus angenehmen Ort. Hier fehlte es den Anwesenden weder an Nahrung, noch an Annehmlichkeiten wie Büchern oder angenehmer Unterhaltung mit gebildeten Leuten. Zudem waren Geschöpfe beiderlei Geschlechts hier. Trotz allem aber waren sie gefangen, gefangen an einem Ort, der aus einem wasserschlossähnlichen Gebäude, einer Brücke, Wasser und Nebel zu bestehen schien.
Während dieser Gedanken blätterte Philippe das Gästebuch durch. Den letzten Eintrag hatte er vor vier Tagen gemacht: Montag, Madame Claudette, Aristokratin aus Paris, in Begleitung ihrer Gesellschafterin, Madame Anjette, Juli 1662. Dass gleich zwei neue Gäste erschienen, war ziemlich ungewöhnlich, zumal die Übrigen ausnahmslos alleine eintrafen. Zurzeit beherbergte das Hotel zehn Gäste, drei Damen und sieben Herren. Eine kleine Gesellschaft von Leuten, die einander bis vor wenigen Wochen noch völlig unbekannt waren. Guillaume überlegte sich gerade, ob es wohl an der Zeit sei umzukehren, als er wahrzunehmen glaubte, jemanden singen zu hören. Leise Worte drangen an seine Ohren, deren Bedeutung er leider nicht verstand. Die Entfernung war eindeutig zu gross, und der Nebel dämpfte die Geräusche zusätzlich. Er beschleunigte seinen Schritt und näherte sich der Quelle des Gesangs, bis er die Stimme Jean-Baptistes zu erkennen meinte. Dass sich der Kerl zum Angeln so weit vom Hotel entfernte, erstaunte Guillaume. Langsam zeichnete sich die undeutlich erkennbare, verschwommene Gestalt von Jean-Babtiste immer klarer vom Nebel ab, und Guillaume trat mit folgenden Worten zu ihm heran: «Hallo mein Freund, hat schon einer angebissen?»
Erschrocken hörte Jean-Baptiste auf mit seinem Gesang und wandte sich zu seinem Besucher. «Bei allen Teufeln der Hölle, haben Sie mich erschreckt, mein Lieber. Um an das begehrte Objekt zu kommen, bedarf es einer Menge Geduld, wie Sie bestimmt wissen. Ich habe schon so viel Zeit ins Angeln investiert, dass ich das Gefühl habe, dass die Zeit der Bach ist, in dem ich angle. Vielleicht bin ich nicht dazu geeignet, zum Angeln, vielleicht muss man fürs Angeln geboren sein so wie man zum Dichten geboren sein muss.»
«Oder in diesem Gewässer gibt es einfach keine Fische», erwiderte Guillaume und lehnte sich ein wenig über die feuchte Brüstung und liess seinen Blick der Angelschnur folgen, welche sich in den über der Wasseroberfläche liegenden Nebelschwaden auflöste.
«Das würde mich aber sehr erstaunen, ist doch das Wasser der Quell allen Lebens.»
Während er dies sprach, holte Jean-Baptiste die Angelschnur ein und schlug Guillaume vor, ihn zurück zum Hotel zu begleiten. Gemächlich schritten die beiden voran und verschwanden allmählich im Nebel, bis nur noch das leise Widerhallen ihrer Schritte zu hören war.
Fünftes Kapitel
Fleischhauer Hackl
Es war eine schöner Herbsttag Ende Oktober. Der Himmel war klar und ungeheuer blau. Vereinzelte Wolken in Zigarrenform huschten von Westen nach Osten und lösten sich allmählich auf. Es waren Zirruswolken, die gutes Wetter versprachen. Die Sonne hatte den Zenit soeben überschritten, es war kurz nach dreizehn Uhr. Der kleine Hof, den Magdalena und Alois bewirtschafteten, war ursprünglich ein Vierseithof. Aber von den beiden Ställen und der Scheune, die zum Wohnhaus gehörten, stand nur noch ein Stall. Und auch die typischen Tore, die die Gebäude verbunden hatten, waren schon vor langer Zeit abgerissen worden. Der übrig gebliebene Stall diente sowohl als Behausung für die drei Kühe, die zwei Schweine und das Federvieh, als auch als Scheune für allerlei Gerätschaften und Dinge, die man nun mal in einer Scheune zu verstauen gewohnt ist. Zugegeben, der Hof war sehr klein, und das, was man mit ihm erwirtschaften konnte, reichte nicht zum Leben. Deshalb ging Alois als gelernter Handwerker auf die Stör, wie es damals allgemein üblich war. So zog er in der Kleinregion Kirchberg an der Raab von Hof zu Hof und verrichtete gegen Bezahlung wichtige Arbeiten. Manchmal, wenn er einen neuen Ofen setzte, Glaser- oder Maurerarbeiten zu verrichten hatte, blieb er mehrere Tage von zu Hause fort. Doch jetzt war Alois schon seit mehreren Wochen weg, und Magdalena und die Kinder hatten keine Ahnung, wo er sich zurzeit befand und wie es um sein Befinden stand. Einzig die Gewissheit, dass er diesen Krieg überlebt, reichte den Daheimgebliebenen nicht. Sie machten sich Sorgen, und zuweilen lastete einen tonnenschwere Melancholie auf ihnen.
An diesem herrlichen Herbsttag sass der kleine Leopold auf der Treppe zum Wohnhaus, welches vollständig aus Holz gebaut war. Das Dach war mit Legschindeln und die Aussenwände mit Zierschindeln aus Holz wetterfest gedeckt. Leopold betrachtete den Himmel und die wenigen Wolken, die vorüberzogen. Ein paar Hühner kratzten mit den Füssen am Boden, mal mit dem linken, mal mit dem rechten, traten dann vorsichtig zurück und betrachteten das Feld der Untersuchungen mit seitlich gebeugtem Kopf und einem Auge. Ihr Interesse galt ausschliesslich dem Boden und nicht dem Himmel, an dem sich im Moment herzlich wenig tat. Auf dem kleinen Misthaufen, der sich mitten auf dem Hof befand, stand der Hahn und blickte verachtungsvoll auf alles herab, was nicht auf dem Misthaufen stand. Leopold hörte die Schweine grunzen, er hörte die Hühner gackern und den Hund bellen, er hörte die Enten quaken, die mit einem völlig problemlosen Gesichtsausdruck auf dem Hof herumwatschelten und rastlos Nahrung in sich hineinschaufelten. Leopold blickte immer noch gen Himmel, als Christina aus dem Haus trat und ihn fragte, wonach er Ausschau halte. Während sie auf die Antwort wartete, setzte sie sich neben ihren Bruder auf die Treppe und schaute auch zum Himmel empor.
«Die Vögel, ich warte auf die Vögel», war die knappe Antwort von Leopold.
Während die beiden schweigend zum Himmel emporschauten, schien die Zeit stillzustehen, und in diesem Augenblick idyllischen Friedens, der auf dem kleinen Hof herrschte, war es schwer zu glauben, dass ganz Europa allmählich in einem Krieg versank.
«Wann kommen sie, die Vögel?», fragte Christina.
«Bald», antwortete Leopold.
Nachdem Christina noch einige Minuten den Himmel erwartungsvoll betrachtet hatte, verlor sie die Geduld und erhob sich, indem sie mit ihrer linken Hand durch das krause Haar ihres Bruders fuhr und sich gleichzeitig auf dessen Kopf ein wenig abstützte, während sie sich aufrichtete.
«Ich muss gehen und Mama den Bottich zum Sauerkraut machen bringen», sagte Christina und begab sich über den Hof zur Scheune, wo die Bottiche und Fässer verstaut waren.
Kurze Zeit später kam sie aus der Scheune zurück auf den Hof, vor sich her rollend den Bottich. Sofort fiel ihr auf, dass die Vögel jetzt da waren. Sie hörte das Schwingen ihrer Flügelschläge und ihr unablässiges Rufen. Es mussten Hunderte Graugänse sein, die in typischer V-Formation auf ihrem Weg in den Süden unterwegs waren. Die geselligen und ruflustigen Entenvögel legen in der Umgebung von Kirchberg gerne eine Rast ein, um auf den abgeernteten Feldern nach Nahrung zu suchen, bevor sie ihren Zug gen Süden fortsetzen. Auch Hühner und Enten und sogar der eingebildete Hahn auf seinem Misthaufen blickten zum Himmel empor, um an diesem Schauspiel teilzuhaben. Leopold sass immer noch auf der Treppe und schaute zum Himmel, die Augen nicht mehr zusammengekniffen. Und auf seinem Gesicht lag ein unscheinbares Lächeln, das seinen Kummer für kurze Zeit verdrängte, und eine Zufriedenheit strahlte von ihm aus, die der Zufriedenheit der wiederkauenden Kühe, die inzwischen an den Zaun getreten waren, in nichts nachstand. Mensch und Tier auf dem Hof schauten zum Himmel empor, als ob Gott selbst sich zeigte und zu seinen Geschöpfen sprach.
Dieses Jahr war der Weisskohl gut gewachsen, die Köpfe waren hart und die Blätter schön gereift. Der Sommer brachte wenig Regen und die Krautwürmer richteten keinen nennenswerten Schaden an. Nach der Ernte wurden die Krautköpfe in die Scheune gebracht und von der Ackererde gereinigt. Bei dieser Arbeit konnte auch Leopold mithelfen und er legte zuweilen einen Eifer an den Tag, dass Magdalena und Christina aus dem Staunen kaum herauskamen. Die losen Blätter wurden gesammelt und als Futter für die Kühe zur besseren Milchleistung in der Scheune gelassen. Dann brachten die drei die Krautköpfe in die Küche, wo die Kinder sie putzten und Magdalena die Köpfe vierteilte, den Kern herausschnitt und sie darauf mit dem Krauthobel schnitzelte. Inzwischen hatte Christina den Bottich gewaschen und an den Tisch gestellt. Das Kraut wurde hineingetan, eingesalzen und verdichtet. Darauf hiess Magdalena ihre Tochter die Füsse zu waschen. Alle paar Lagen musste Christina in den Bottich steigen und die Krautschnitzel treten. Nach Dutzenden von Lagen und emsigen Zusammentretens war der Bottich endlich voll und konnte geschlossen werden. Später würden die Nachbarn helfen, den schweren Holztrog, in dem das Sauerkraut durch wochenlange Gärung reift, in den Keller zu schaffen und in eine dunkle Ecke zu stellen.
Drei Tage später, der Himmel war wiederum wolkenlos und unendlich, waren Magdalena und die Kinder, die auch heute nicht zur Schule zu gehen brauchten, damit beschäftigt, einen kleinen Graben auszuheben. Sie wollten den Futtertrog der Schweine näher zur Scheune versetzen, damit sie den Boden, worauf der in die Erde eigelassene Trog zurzeit stand, anderweitig nutzen konnten. Gebückt standen die drei im Dreck, pickelten und schaufelten, wischten sich ab und an den Schweiss von der Stirn und blickten gedankenlos in die Umgegend. An diesem Nachmittag endlich brachte der Postbote den ersten Brief von Alois. Magdalena wischte sich die Hände an der Schürze und riss dem Boten den Brief regelrecht aus der Hand, bedankte sich bei ihm und hiess die Kinder, die Arbeit niederzulegen und mit ihr in die Küche zu kommen. Sie sollten sich die Hände waschen und sich hinsetzen. Dann setzte sich auch Magdalena und öffnete vorsichtig den Brief, schaute ihren Kindern einige Sekunden tief in die Augen, räusperte sich ein letztes Mal und begann zu lesen.
«Liebe Magdalena, liebe Kinder
Ich hoffe, ihr kommt ohne mich zurecht und macht euch meinetwegen keine Sorgen. Mir geht es gut. Wir waren lange unterwegs und befinden uns in der Nähe von Krakau, wo wir den Russen erwarten. Ihr wisst ja: jeder Schuss ein Russ. Zurzeit sind wir mit dem Ausheben von Gräben beschäftigt. Wir starren vor Dreck, wir schaufeln, pickeln, graben und buddeln seit Tagen, wir machen nichts anderes, als Dreck von einem Ort zum andern zu schaffen.
Die Gräben seien notwendig, sagt unser Vorgesetzter, sie würden guten Schutz vor dem anrückenden Russen bieten. Wie dem auch sei, wir alle haben es gründlich satt, wir wollen endlich ins Feld und dem Russen so richtig in den Hintern treten. Wenn der Russe dann kommt und wir ihm so eins auf die Mütze hauen, dass er wimmernd wie ein Hosenscheisser das Weite sucht, bekomme ich Urlaub und werde euch zu Weihnachten besuchen. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen, meine Lieben, und ich hoffe, dass es euch an nichts fehlt.»