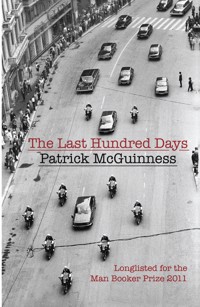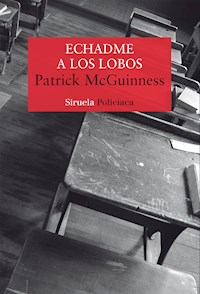Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Oktaven
- Sprache: Deutsch
Die Leiche einer jungen Frau wird am Flussufer gefunden und ein Nachbar, ein pensionierter Lehrer des Chapleton College, verhaftet. Der exzentrische Einzelgänger ist der perfekte Kandidat für eine Hetzjagd der Medien. In der Untersuchungshaft trifft Michael Wolphram auf zwei Polizisten: den umsichtigen Ander und dessen ›Gegenspieler‹ Gary. Ander ist besonders wachsam, denn der Mann auf der anderen Seite des Tisches ist jemand, den er kennt. Jemand, den er seit fast dreißig Jahren nicht mehr gesehen hat. Entschlossen, die Wahrheit herauszufinden, muss Ander sich auch seiner eigenen Geschichte stellen, die Jahrzehnte zurückliegt, aus seiner Zeit als Chapleton-Schüler. Mit dem Schwung eines klassischen Krimis erzählt ›Den Wölfen zum Fraß‹ von der mediengesättigten Gegenwart einerseits und einem tyrannischen, elitären englischen Schulsystem andererseits. Psychologisch scharfsinnig, erschütternd traurig und teilweise urkomisch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick McGuinness
Den Wölfen zum Fraß
Aus dem Englischen von Dieter Fuchs
OKTAVEN
Wenn ich sterbe, werft mich den Wölfen zum Fraß vor – ich bin das gewohnt.
Diogenes
Ein Ort, an dem immer Jetzt ist
Unweit der Schule ist eine Brücke. Um zu den Sportplätzen oder auf die andere Seite der Mündung zu gelangen, müssen die Jungs sie überqueren. Das tun sie drei Mal pro Woche, bei Sonnenschein oder Regen. Es muss ziemlich nass sein, bevor der Nachmittagssport abgesagt wird – oder auch nur das unwichtigste Trainingsspiel. «Zeit für corpore fucking sano», sagt Mr. McCloud, der kettenrauchende, nach Whiskyparfümierte Klassenlehrer, der die Jungs wie Kumpels aus dem Pub behandelt und über historische Figuren spricht, als hätte er sie persönlich gekannt. Er kann einem sagen, wie ihr Atem riecht und was ihnen zwischen den Zähnen hängt; wie sie gehen, wie ihre Fingernägel aussehen.
Die Jungs mögen ihn, obwohl er aufbrausend und unberechenbar ist und bei einem Wutanfall so aussieht, als würde er gleich beißen. Er ist groß und fassförmig und ächzt wie ein altes Akkordeon, wenn er sich bückt, um sich die Schnürsenkel zu binden, oder Kreide aufhebt oder eine Zigarette fallen gelassen hat. Er kann sich nichts merken, verwechselt ihre Namen, kommt immer zu spät und geht wieder früh, aber die Jungs finden, er macht gute Witze, was für sie gleichbedeutend ist mit dreckig. Ein paar ältere Schüler, die Sechzehnjährigen aus der Sechsten, besuchen ihn abends zu Hause, wo sie rauchen, trinken und Filme anschauen. Wenn sie wiederkommen, riechen sie wie Erwachsene.
Alle haben ganz eigene Gründe, um zur Brücke zu gehen: meist, um zu rauchen und den Wodka oder Gin zu trinken, den sie direkt um die Ecke kaufen können; später dann, um Mädchen zu treffen oder einfach die Aussicht zu genießen. Einer der Jungen, heute ein erfolgreicher Unternehmer, sammelt rund um die Brücke oder in den Vorsprüngen und Einbuchtungen der Klippen die Seiten aus Pornoheften, die aus vorbeifahrenden Autos geworfen oder von den Hecken-Onanierern zurückgelassen wurden. Wenn er nicht richtig Glück hat, sind sie feucht und vom Tau aufgeweicht, deshalb nimmt er sie erst mal mit und trocknet sie auf der Schulheizung, um sie anschließend verkaufen zu können. Es gibt eine Preisliste: ganze Seiten sind teuer, für zerfetzte oder ausgerissene Stücke gibt es Nachlass. Man kann sie aber auch mieten.
Wir sind nur unweit des Hafens, von wo die Schiffe, deren Nebelhörner man beim richtigen Wind hört, ihre Tonnen an Containern über den Ärmelkanal schleppen. Es ist eine wasserreiche Grafschaft, mit Nebenflüssen geädert und von Meeresarmen oder Mündungen zerfranst. Ihre Kalkküste wird von den Wellen abgetragen, und ihre Flüsse ergießen sich ins Meer; eine Grafschaft der Brücken, Kais und Viadukte, und man kann fast nirgendwo hingehen, ohne mit der Tatsache von Wasser konfrontiert zu sein. Manchmal, bei Hochwasser, scheinen die Brücken ihren Fluss eher zu kämmen, als zu überqueren. McCloud hat mit ihnen einmal einen Ausflug zu den Medway-Viadukten gemacht, wo der Zug- und Autoverkehr den Fluss dreireihig überquert und bald ein Tunnel nach Frankreich entsteht, der, wie McCloud ihnen erklärt, die Fähren überflüssig machen wird.
Die Brücke verbindet die beiden Hälften der Stadt – eine Seite vornehm, geordnet und wohlhabend, die andere voller Sozialbauten, Industriegebiete und ramschiger Einkaufszentren. Es gibt B&Bs für die Reisenden, die ihre Fähre verpasst haben, sowie Pubs für diejenigen, die zu früh ankommen. «Zwei Städte, durch eine Brücke getrennt», witzelt McCloud bei jeder Überquerung: «Die Pässe dabei, Jungs? Und hoffentlich ausreichend geimpft? Wir betreten jetzt den dunklen Kontinent …»
Man kann fast nicht anders, als hinunterzuschauen: in den braunen Schlamm der Mündung, den glitzernden Perlmuttkies und den Schlick, den Abzugsgraben mit rieselndem Wasser, so schmal wie der Regen, der in einen Gulli rinnt. In der Sonne wölbt und wellt sich der Schlamm. Er braucht nicht viel Licht, um lebendig auszusehen. Und anziehend – ein Kissen aus glänzender, brauner Seide. Man ist versucht, zu springen.
Der Schüler ist begeistert von dem Geruch, der da aufsteigt und vom Wind hochgetragen wird. Es ist der Geruch von Mündungen: auf der einen Seite die Abzugskanäle; auf der anderen das offene Meer. Eigentlich müssten sie gegeneinander ankämpfen, aber hier scheinen sie so gut zu harmonieren wie ein süßsaures Gericht: eines ist Verstopfung, Fäulnis und Stillstand, das andere Entkommen, Freiheit und Bewegung. Er sagt den Rosenkranz an Hafennamen auf – Zeebrugge, Ostende, Calais, Cherbourg, Dieppe, Rotterdam …
Und man kann springen. Man kann springen, wann immer man will. Meist ist es eher die Neugier und nicht die Trauer, die einen hinunterschauen und plötzlich den Wunsch verspüren lässt, dabei den Verstand vorausschickt und sich vorstellt, wie es ist zu fallen – zu fallen und immer weiter zu fallen. Der Schüler ist wie hypnotisiert von der Aussicht, von ihrer Vollkommenheit. Nicht viele Dinge fühlen sich so vollkommen an wie das, was er beim Hinuntersehen erblickt. Nicht das Sterben als solches ist anziehend – so unglücklich ist er dann auch wieder nicht, selbst wenn er sich gern überlegt, wie unglücklich genau er dazu denn sein müsste: in welcher Dosierung, die Unglücksmilliliter um Unglücksmilliliter die Skala der Trostlosigkeitsspritze emporklettert, Grad um Grad am Sorgenthermometer … Nein, nicht das Sterben, sondern seine hypothetische Natur. Es ist die Vorstellung von einem selbst danach, die einen anzieht; wie man aufsteigt, sich vom eigenen Körper ablöst wie eine Füllfeder, die sich vom geschriebenen Buchstaben auf dem Blatt erhebt, und dann nach unten auf seine Hülle blickt, die man verlassen hat, sowie auf die Menschen in der Ferne. Wobei man eigentlich selbst in der Ferne ist: man ist jetzt die Ferne – tot ist man zu ihr geworden.
Er stellt sich den Tod als eine dieser Luftaufnahmen in Kriegsfilmen vor, wie sie in der Schule manchmal gezeigt werden und wo ein paar Soldaten zurückgelassen werden, während der Rest mit dem Hubschrauber aufsteigt, und die Soldaten rennen, ohne ihn zu erreichen, und sie rufen, schreien und strecken die Arme nach ihren Kameraden aus, dann berühren sich die Finger und greifen ineinander und halten sich und werden wieder auseinandergerissen; und der Hubschrauber hebt ab, wackelig erst, aber schnell stabil, und zieht weg, unentschlossen oder gar widerstrebend, und die Soldaten werden kleiner und von den Gegnern eingeholt oder niedergemäht, und jeder wird klein wie ein Punkt und verschwindet; dann sieht man nur noch Dschungel und daraufhin den Himmel.
Dazu gibt es natürlich noch den Vorteil, nicht mehr dieses Biest von Körper mit sich herumschleppen zu müssen, nicht mehr gefesselt zu sein an dieses brennende Tier, das man ist.
Es gibt die Legende einer Frau aus der viktorianischen Zeit, die von der Brücke sprang und überlebte, um, wie man sagt, davon zu erzählen, weil ihr langes Kleid sich aufbauschte und zu einem Reifrockfallschirm wurde. Sie war sitzengelassen worden, war unglücklich verliebt. Aber wenn der Selbstmord ein Gegenteil hat, dann widerfuhr ihr genau das: sie überlebte, lernte jemand anderen kennen, heiratete, bekam drei Kinder und wurde steinalt.
Heute, weiß der Junge, würde man den Sturz kaum überleben, denn 1.) würde einen die Geschwindigkeit, mit der man aufs Wasser prallt, sofort töten; 2.) würde einem schon lange davor aus Angst das Herz zerplatzen, so wie Haselmäuse innerlich bersten, wenn man sie hochhebt; und 3.) würde man so tief im Schlamm versinken, dass man erstickt. Es ist das Bild von der Frau, an das der Junge denkt, wenn er mit seinen Freunden nach unten sieht und zerknüllte Blätter, Bonbonpapierchen, Taschentücher oder Münzen über die Brüstung wirft und ihre Flugdauer schätzt.
Aus wenigen Metern Höhe ist Wasser sehr gastfreundlich. Es öffnet sich und lässt dich eintreten. Ab etwa zwanzig ist es wie Fels. Es wird dich zerschmettern, als seist du auf einen Steinboden gefallen. Das haben sie in Physik gelernt.
Der Gedanke an einen Sturz ist auch aus dem Grund so verlockend, dass es so furchtbar einfach ist: die Brüstung ist nur wenig höher als eins zwanzig. Für die meisten Jungs heißt das gerade mal schulterhoch. Ein kleiner Sprung, bei dem man sich am hölzernen Handlauf festhält, und man wäre oben und drüber, drüber und runter, runter und tot. Vielleicht würde sich der Sturz endlos anfühlen, nur wären es natürlich nur ein paar Sekunden. Bei der Rückkehr zur Geburt, besagt der Mythos, sehen Sterbende ihr Leben in umgekehrter Richtung ablaufen. Man würde gern wissen, ob die gleiche Geschichte rückwärts erzählt überhaupt noch die gleiche Geschichte ist.
Damals, dort im Damals auf der Brücke, denkt man, dass es ein paar Sekunden und ein ganzes Leben braucht, bis man den Mündungsschlick erreicht; den kühlen, glänzenden, stundenglasfeinen Sand. Vielleicht könnte man beim nächsten Mal ein paar Dinge verändern, wer weiß? Korrekturen vornehmen.
Der Junge nimmt manchmal seine Innenschau, die wie alles an ihm trainiert werden muss, und macht einen Spaziergang dorthin. Nur ist sie wahrscheinlich der einzige Teil von ihm, der an dieser sportlastigen Schule tatsächlich trainiert wird. Immer ist jemand auf der Brücke, und obwohl sie für ihn ein Ort extremer Einsamkeit ist, wird ihm erst Jahre später klar, dass er dort nie wirklich alleine war. Es gab immer andere, manchmal auch ein halbes Dutzend, die alle das Gleiche machten: hinaus- und drüber- und runterschauen. Einmal hat er gesehen, wie sich jemand mit Kuli die Nummer der Telefonseelsorge auf die Hand schrieb, die an beiden Enden der Brücke angebracht ist. Im Moment beugt sich der Junge nur vor und lässt die Arme baumeln, das Geländer fest in die Achseln gedrückt. Seine Großmutter ist Schneiderin und hat ihm die Schuluniform genäht. Er muss an das Maßnehmen für Jackett und Hose denken, weil der Wind ganz ähnlich an seiner Kleidung zupft. Bei ihm wird für eine Luft-Uniform maßgenommen, damit er für den rasanten Sturz gut eingepackt ist.
Jahre später geht er wieder einmal zur Brücke. Die Nummer der Telefonseelsorge war früher eine örtliche, jetzt steht da eine mit 0845 – wie bei Versicherungen, Mobilfunkanbietern, Telefonmarketing. Die Brüstung ist unverändert, wurde aber um ein Drahtgitter erhöht, das einen Meter zwanzig dazugibt und sich oben einwärts biegt. Zum Springen würde man jetzt eine Leiter brauchen.
In der Zeit zurückzugehen, ist wie in ein altes Foto einzutreten. Er stellt es sich in Sepia vor; so verblichen wie eine alte Postkarte. Aber es ist eine Postkarte seines eigenen Lebens: die dickliche Luft, das schwere Schulmobiliar, der Gelatineglanz der Dinge, die man durch einen Sirup aus Zeit und Tränen erkennt. Wenn er jetzt in das Foto eintauchen oder mit seinen Fingern über die Oberfläche gleiten würde, hätte es die Konsistenz von Sahne und nicht die Härte des Wassers unter der Brücke. Er denkt an die Holztische mit ihren – schon damals – längst nicht mehr benutzten Tintenfässern, rundum mit schwarz-blauen Klecksen übersät. Mit Kompassnadeln eingeritzte Pimmel und Sexwörter, die in die Oberfläche eingeprägt wurden, durch den Lack und tief in die Fleischmasse des Holzes hinein. Das alles wirkt heute leicht prähistorisch, so weit entfernt und urzeitlich wie ein Bison auf einer Höhlenwand. Man kann die Tische auf eBay kaufen – mit echten Graffitis, versichern die Verkäufer, um ihnen Authentizität zu verleihen.
Mit all diesen Tonnen aus Eisen und Stahl wirkt die Brücke so fein gearbeitet wie Spitzenstoff; die Seile straff wie Harfensaiten. Manchmal hört man den Wind an ihnen zupfen und hat den Eindruck, das sei ein Lied. Es ist das Lied der Luft, das genauso klingt wie das Geräusch des Fallens. Der Junge denkt, dass er das Lied gern bis zu Ende hören würde, dass er sich einen langen, langen Sturz wünscht, um es wieder und immer wieder zu hören und niemals unten aufzuschlagen.
20. Dezember
«Meine Kindheit?» Er wirkt amüsiert.
«So etwas gab es bei mir nicht. Für mich war das mehr eine kindheitlich inszenierte Minderjährigkeit. Ich meine, ich hatte durchaus Spielsachen, aber mein Umgang damit war eher verwalterisch – nicht wie ein Kind, mehr wie ein Museumsmitarbeiter. Ich habe sie poliert, betrachtet und weggeräumt. Ich habe sie aufgestapelt, in Ordnung gehalten und vor mir ausgebreitet. Aber habe ich wirklich damit gespielt? Eher nicht.»
Er verstummt und sieht sich um, als würde er die Farbgestaltung des Raums überprüfen: graue Eierschale mit einem Glanz von Schweiß.
«Außerdem hatte ich natürlich Schachteln.»
Gary versucht, ihn zu stoppen, aber er ist bereits fertig. Unser Timing ist schlecht; alles läuft aus dem Ruder.
Gary: «Ihre Kindheit ist uns scheißegal, Sie trauriger Clown. Uns interessiert dieses arme Mädchen – wie Sie sie umgebracht haben und was mit der Leiche passiert ist!»
Die Leiche oder ihre Leiche? Und warum der Unterschied? Warum stelle ich mir diese kleinlichen Fragen, so randläufig wie das dünne Ende eines Türstoppers: Es beginnt bei der Grammatik – ihre oder die – und endet mit einem dicken Keil aus Dunkelheit. Mittlerweile ist es einfach die Leiche. Was auch immer ihre ihre war, gibt es nicht mehr.
«Gary. Lass ihn ausreden.»
«Sie haben doch nach meiner Kindheit gefragt, oder? Es war in der Frage, wenn nicht sogar die Frage selbst.»
Wir antworten nicht, deshalb macht er befriedigt und in leicht spöttischem Ton weiter: «Es gibt ein Foto von mir, wie ich die Unterseite eines dieser Fahrgeräte betrachte, die es manchmal vor Supermärkten gibt. In einem Badeort, vermutlich im namentlich passenden Gravesend. Wo genau, spielt ja wohl keine Rolle, auch nicht für mich. Jedenfalls habe ich das Geld reingesteckt, mich hingekniet und dem Mechanismus zugesehen, also wie sich die Wellen drehen, die Zahnräder greifen … Unterwagen nennt man das wohl – ein lustiger Begriff, erinnert irgendwie an diese Carry On-Filmkomödien … Ich habe mit der Idee des Spielens gespielt, aber richtig gespielt habe ich nie. Heißt das, ich habe auch mit der Idee von Spielzeug gespielt? Gut möglich.»
«Heeerrr-gott», stöhnt Gary durch seine zusammengepressten Zähne.
Mr. Wolphram sieht zur Decke, atmet ein, realisiert die Abgestandenheit der Luft, atmet wieder aus und spricht weiter: «Ich habe nie darüber nachgedacht. Nur weil Sie diejenigen sind, die hier die Fragen stellen, heißt das noch lange nicht, dass ich die Antworten habe.»
Zentral bei einem Verhör ist, dem Verdächtigen Zeit zu lassen und ihm ein unbegrenztes, offenes Gelände aus Schweigen zu geben, auf dem er nervös werden kann. Nur macht er genau das mit uns. Starrt uns der Reihe nach an: mich, Gary und den irritierten Beamten, der hinter uns die Tür bewacht. Dann, als er ausgestarrt hat: «Aber warum fragen Sie?»
Warum frage ich? Vielleicht, weil ich etwas über meine eigene Kindheit wissen wollte. Weil dieser Mann, den wir hier verhören, ohne es zu wissen oder sich daran zu erinnern, Teil davon war.
*
Mr. Wolphram, mit kaltem Glanz auf einer derart weißen Haut, dass sie fast bläulich wirkte; das Leuchten einer Ader tief unten im Fleisch. Marmor. Oder Salz. Ja: das Blau von Salz in einem Salzbergwerk. Riesige Augen, annähernd schwarz (nicht dass ich sie nicht sehen könnte, so hell, wie es hier ist, nur lassen sie die exakte Abstufung ihres dunklen Farbtons nicht erkennen): geradeaus gerichtet, ironisch. Er blinzelt so gut wie nie. Das hier ist kein Spiel, aber trotzdem spielt er. Geben wir ihm zu viel Leine, führt er uns im Kreis herum; nehmen wir ihn zu eng, wird er die enge Zügelführung lieben. Sobald es Regeln gibt, wird alles zum Spiel.
Er spricht in langen, flüssigen und perfekt gebauten Sätzen. Grammatikalisch makellos, schöpft er aus einem inneren Thesaurus, alles ist mit etwas anderem abgetönt, jede Farbe geht direkt in die nächste über. Das ist wie ein edler Farbkatalog: kein Schwarz, kein Weiß, kein Rot, kein Blau – nur eine Abfolge von Zwischendingen mit doppelläufiger Bezeichnung.
Und diese Stimme: Wenn deine Albträume einmal als Hörbuch herauskommen, ist er der Erzähler.
Er hat Farbe an den Händen. Das bemerke ich erst jetzt, obwohl ich es war, der seine Fingerabdrücke genommen hat. Später, wenn wir die Proben zur Analyse schicken, werden wir den Namen der Farbe erfahren: Mole’s Breath, ein dunkles, behagliches Grau.
Jede Gefühlsregung untergräbt, korrigiert, durchmischt er mit etwas anderem. Aber mit was? Mit etwas Emotionslosem. Weiß er zu viel, um Gefühle zu haben? Ist es das? Hat er keine Gefühle oder kennt er sie so genau, dass er sie gar nicht mehr empfindet? Kindheitlich inszenierte Minderjährigkeit … wo kommt solch eine Formulierung her? Davon, dass man die Bezeichnungen für Dinge lernt, bevor man die Dinge selbst kennt.
Spielt es letzten Endes eine Rolle, in welcher Reihenfolge man sie lernt?
Die Luft hier drin ist stickig. Gary schwitzt und verliert sowohl die Geduld als auch Gewicht.
Erkennt er mich? Ich habe mich kaum verändert, und so lange ist es eigentlich gar nicht her.
Oder vielleicht doch, in Uhr-und-Kalender-Zeit gemessen. Aber misst man es in … was? Innen-Zeit? Herz-und-Blut-Zeit? Futterstoff-des-Lebens-Zeit? … dann war es im Grunde gestern. Beim Futterstoff unseres Lebens ist alles immer gestern.
Er ist unverändert. Er hat diese gepökelte Gleichheit, wie manche Lehrer sie über Jahrzehnte bewahren: Zwiebelhaut, fast schon durchsichtig, wie feuchtes Zigarettenpapier. Sein Haar ist so aschgrau wie vor dreißig Jahren; glatt und glänzend, mit Strähnen bis zu den Augenbrauen und so dünn, dass die Form seines Schädels hervortritt. So er denn gealtert ist, dann anderswo als hier, anderswo als im Gesicht. Auch was er anhat, ist immer noch gleich: vielleicht ist das sogar derselbe Anzug, dieselbe rote Krawatte zu demselben schwarzen Hemd. Seine Handgelenke ruhen auf dem Tischrand, und es sieht aus, als würde er zwischen Daumen und Zeigefingern etwas winzig Kleines zerreiben.
Mit im Raum ist eine Art Therapeutin oder Psychologin, die äußerst professionell wirkt und bürokratisch die Stirn runzelt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ihm zusieht oder uns.
*
Er setzte Kultur wie ein Schnappmesser ein. Daran erinnere ich mich. Ein Stoß mit der Klinge reichte aus. Man spürte keinen Schmerz, bis das Blut sichtbar wurde. Nur tat es noch immer nicht weh, erst wenn man merkte, dass dieses Blut dein eigenes war. Er nahm sich jemanden vor, egal wen, schlitzte ihn auf, und für den Rest der Stunde war derjenige wie ein verwundeter Hai, von anderen Räubern über Meilen und Stunden hinaus gerochen. Genauso war das – Blut, das rauchartig ins Wasser drang.
Seine Launen waren wie Feuer hinter einer Eiswand.
Das habe ich ihnen dann später erzählt.
*
Die Schlagzeilen bringen an diesem Morgen das Übliche: auf einem Flug nach Dubai explodieren die Brustimplantate einer Fußballergattin; ein mitteilsames TV-Sternchen versteigert auf Twitter ihr Schweigen; etwas Realityshow-Artiges, bei dem iPhone- und iPad-süchtige Teenager nach Derbyshire gekarrt werden und bei irgendwelchen Amish People leben. Leichte Kost, Boulevard-Geblubber: nachrichtenlose Nachrichten.
Im Windschatten all dessen: die selbsternannte ‹Qualitätsberichterstattung›. Gary weiß, dass es so etwas wie Windschatten nicht mehr gibt, dass wir alle der gleichen steifen Brise ausgesetzt sind. Er mokiert sich über einen Kommentar der Times zur Problematik, was man bloß mit den Kindern macht, wenn die Nanny ihre Familie in Osteuropa besucht.
«Wieder so ein Artikel von einer pferdegesichtigen Wohlstandstussi namens Camilla oder Imogen, die sich über Putzfrauengehälter in West London und steigende Privatschulgebühren auslässt. Auf welchem Planeten leben diese Menschen?»
«Planet Die-da?», frage ich lahm, um einen Dialog zumindest anzudeuten.
Es wird ein langer, trauriger, anstrengender Tag werden und wir müssen ihn durch ein gutes Miteinander gleitfähig halten.
«Alles ist Planet Die-da, Prof … Soweit das Auge reicht – Planet Die-da.»
Es gibt eine Pause, dann ein Schweigen, als Gary versucht – versucht und nicht schafft –, einen lapidaren Abschluss zu finden.
Weihnachten steht vor der Tür, und Weihnachten ist eine gewaltvolle Zeit. Nicht die Gewalt der Polizeithriller oder Fernsehkommissare. Keine Poirots oder Miss Marples am Start. Ist auch nicht notwendig. Es ist die dunkle, stumpfe Gewalt der Normalität. Sie ist nicht schillernd und auch nicht kompliziert – weder bei Ergründung der Motive, noch beim Fassen der Täter. Niemand wird hier Columbo rufen. Sie ist einfach da, diese aussickernde Alltagsdunkelheit, die sich sammelt, zunimmt und zum Rand hochsteigt, bis sie eines Tages überfließt.
Sie ist unser Geheimleben, sonst nichts: und manchmal schwappt sie über den Rand und zieht uns dann mit nach unten. Die schmale blaue Linie nennt man uns. Nur glaube ich, wir sind mehr wie ein Meniskus: Wir sammeln den Überschuss für einen Moment, halten ihn, während er anschwillt und sich zum Himmel wölbt; er bebt, dehnt sich, schiebt sich drüber und stürzt in die Tiefe.
Jetzt im Moment stürzt er. Ist er gestürzt.
Zwei Mal häusliche Gewalt, Brandstiftung, diverse Einbrüche. Ein geplünderter Ein-Pfund-Shop. Selbst die Diebe setzen ihre Fantasien jetzt niedrig an, schneiden ihren Ehrgeiz auf asketisches Beutegut zu. Black-Friday-Tumulte in Supermärkten. Flachbildschirmhysterie, Anstürme auf Haushaltsgeräte. Die Technik bringt uns auf Umwegen zum Tierdasein zurück.
Außerdem ist da noch, unterhalb der Polizeiarbeit, unterhalb der Gerichte, als unsichtbare Kanalisation des Systems, die Gewalt gegen Frauen. Besonders an Weihnachten. Das ist der Puls, der Beat, den man wie die Bässe aus einem Auto oder Keller hört und nie recht orten kann. Oder der schon aufgehört oder sich woanders hinverlagert hat, wenn man eintrifft. Ehefrau, Tochter, Freundin, das wiederholte Prügeln, die ‹Ausnahme›, die immer wieder passiert, zwanzig Jahre ‹Ausnahmen›, die hämmernde Grausamkeit der Worte; Frauen mit ausgebranntem Nervenkostüm und der Gemütsverfassung überlasteter Stromkreise, verängstigt, durch Schläge weich gemacht, bis ihr Fleisch so zart wie ein Kalbsbraten ist. Gary und ich sind so oft damit konfrontiert, dass wir denken, das hier ist auch so ein Fall. Ist er aber nicht.
Als der Anruf eingeht, ziehe ich durch fünf Kästchen auf dem Kalender einen Strich. Das ist mein bevorstehender Urlaub. Wenn der näherrückt, werde ich immer nervös. Es braucht nur einen einzigen Fall, ein Verbrechen abseits der Norm, und schon ist er verschwunden – verschoben, sagen sie dazu –, an einen leuchtenden Punkt am Horizont, den ich nie erreichen werde. Ich weiß schon jetzt, dass er unerreichbar ist. Wenn jemand schon am Klingelton merkt, um was für eine Art von Anruf es sich handelt, dann ich. Dieser sagt mir, dass sich alles ändert.
Martinshorn ist nicht nötig, heißt es. Wir wissen, was das bedeutet: das Martinshorn signalisiert mit seinem Gedröhne Zeit, signalisiert, dass Zeit vorhanden ist. Aber wir sind trotzdem schnell, Gary und ich. Er fährt. Ich sehe mir die vorbeihuschenden Schaufenster an, die teure Schule auf dem Hügel, den Zoo, den sie vor Jahren dichtgemacht haben und wo ich immer noch glaube, das Gejapse der Robben zu hören und ihren Fisch zu riechen. Dann die Brücke in Richtung Peripherie mit ihren stillstehenden Baukränen und den kreditbefeuerten Wohnungen, die jetzt kreditzerbröselt eingefroren sind. Die Designerläden, die zu Ein-Pfund-Shops abgesunken sind. Dann das, was Gary ‹Brexit-Land› nennt. «Genau wie New York», sagt er. «Das ist nicht nur ein Ort, sondern eine Gemütsverfassung.»
Er stößt ein trockenes, gelbliches Lachen aus und singt zur Melodie von Soft Cells «Bedsitter» die Worte «Brexit Land my only home». Ich weiß nicht, woher er den Song kennt und wann er ihn gehört hat, denn er war ja fast noch ein Baby, als er damals herauskam. Im Gegensatz zu mir – ich habe die Single gekauft, obwohl ich sie nicht einmal abspielen konnte. Und auch da war ich spät dran – als ich sie gebraucht kaufte und schon jemand anderer seinen Namen auf die Hülle geschrieben und das Vinyl verkratzt hatte.
Man hört sie manchmal in Top of the Pops-Wiederholungen aus den Achtzigern oder in diesen Varieté-Shows, wo die Moderatoren herausgeschnitten wurden, weil sie in Ungnade gefallen oder tot oder im Gefängnis sind. «Sendung ohne Ansager», sagt meine Nichte dazu. Sie erkennt, dass da einmal etwas war zwischen den Songs, den Bands – nämlich der Glamour, das Showbiz und die witzigen Sprüche. Nur dass sie das natürlich nicht genau weiß. Aber Marieke hat ein Ohr für Dinge, die fehlen. Deshalb liebt sie auch den Zoo so sehr, den leeren, gespenstischen Zoo. Die Tiere, die noch als Geister hinter den zugenagelten Zäunen sind. Aus dem gleichen Grund geht sie auch gern zu Mrs. Snow. Wegen dem, was fehlt. «Stille ist nicht still», sagt sie, «sondern ein Summen: hör doch mal …»
Dann folgt etwas Grünfläche, bevor das Einzugsgebiet anfängt und wir einen Ort erreichen, den das Navi ‹Unbekannte Straße› nennt. Wir wissen, dass wir da sind, weil wir einen Krankenwagen, ein Polizeiauto und zwei Zivilfahrzeuge, Fords, erkennen. Alles wirkt entspannt, nicht-dringlich. Man riecht förmlich das zu spät. Es raucht jemand, den ich noch nicht sehen kann, und der Zigarettengeruch kommt in vereinzelten, dünnen Schwaden über eine erstaunlich große Distanz zu uns. In den Brombeerbüschen winden sich von Dornen zerfetzte Plastiktüten. Die Brombeeren selbst hängen seit Monaten ungepflückt herum: waren sie anfangs hart wie Knöpfe, haben sie jetzt die Farbe von Spinnwebfäden und sind ganz vertrocknet, verschrumpelt und dick mit Schimmel überzogen. Die Leute, die hierherkommen, pflücken kein Obst.
Wir werden hingehen, also gleich, denn noch befinden wir uns zwischen dem Moment, in dem das Geschehene geschehen ist, und dem, in dem es eine Tatsache wird. Ich spüre, wie diese Ereignisse verschmelzen wollen, bin aber noch getrennt von der Entdeckung, die wir gleich machen werden, und möchte diesen kurzen Gang ausdehnen und alles von mir fernhalten. Ich rede mir ein, so besser denken zu können: man kann nicht lange zwischen zwei Zeitformen leben, also mach das beste draus.
Dann das:
Zwei Beamte nehmen die Aussage einer Frau auf, die einen Hund an der Drahtseilleine hat. Seine Schnauze zeigt die Straße hinunter; was immer er gefunden hat – er will es noch einmal sehen, will da noch mal hin.
«Warum sind es immer die mit Hunden, die sie finden?», fragt Gary. «Das ist so ein beschissenes Klischee.»
Ich antworte nicht.
«Immerhin keine Dogger.»
Er geht um den Wagen herum und macht meine Tür auf. Das ist nicht unterwürfig oder eine Frage des Ranges. Es liegt nur daran, dass ich gar nicht ganz da bin.
«Die Nackten sind ja morgens nicht so unterwegs.»
Gary pinkelt an den Wagen, bevor wir losgehen.
«Wir wollen doch nicht den Tatort verunreinigen», knurrt er. Ich kann den Kaffee in seinem Urin riechen, dabei ist noch nicht mal Frühstückszeit.
Ich kenne diese Straße. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich kenne sie.
Wir ignorieren die Aussage erst mal. Alles zur rechten Zeit, denke ich. Zur gegebenen Zeit, meine ich, denn recht ist momentan gar nichts an ihr: Zuspätkommen hat den einzigen Vorteil, alles in einer selbstgewählten Reihenfolge aufzunehmen. Zumindest den haben wir. Als Trost der Besiegten. Wir kümmern uns bald um sie und ihren Hund, dann kommt die Presse dran. Zuerst vermutlich Lynne Forester, die Gary Mad Lynne nennt. Wenn es tatsächlich sie ist, die da draußen herumsteht, wie wir befürchten, da draußen zwischen den Bäumen. So etwas wie zu spät gibt es für Lynne nicht.
Funde wie dieser laufen meist so ab: Hund bewegt sich frei; Hund haut ab; eine von tausend Fährten zieht ihn ins Unterholz; Hund kommt nicht, wenn gerufen; Besitzer findet Hund beim Beschnüffeln von … was?
Werden wir gleich sehen.
Ich bleibe etwas zurück, kenne aber den Weg.
Es ist ein nasskalter Morgen Ende Dezember, und die LED-Strahler sind an. Wir können sie vor uns sehen, zusammen mit einem hell leuchtenden Zelt und ein paar weißgekleideten Figuren. Blitzlichter, Polizeiabsperrung.
«Die Grotte vom Weihnachtsmann», sagt Gary, und ich weiß, dass ich lachen sollte, um die Dinge am Laufen zu halten. Der Witz ist auch besser als die, die er sonst so macht, deshalb lächle ich und merke, wie er mich ansieht, um meine Reaktion zu überprüfen. Lächeln ist besser – so denkt er, ich würde mir das Lachen verkneifen. Mein verzwungenes Lächeln sieht für ihn wie ein unterdrücktes Lachen aus. Das wird reichen, um uns über die nächsten paar Stunden zu retten. Der Heiterkeitstank ist wieder voll. Wir werden ihn brauchen.
Er misstraut mir als behäbigem, geradlinigem Uni-Absolventen. Ich misstraue ihm als einem grenzwertigen Rassisten frisch weg von der Casting-Agentur: ein dicker, unverhohlener Sexist, der verarbeitetes Hühnerwasser schwitzt und nach Fett riecht. Wäre er ein Pub, würde man ihn den Hipstern und Touristen als definitiv retro anpreisen, vielleicht auch als Vintage-, auf keinen Fall aber als Gastro-. Aber wir denken beide, dass wir dem jeweiligen Klischee entsprechen – Casting-Material eben. Nur dass er einer Polizeiserie aus den Siebzigern entsprungen ist, in der sie ständig qualmen und Verdächtigen erst mal eine verpassen, im Dienst trinken, den Schreibkram verachten und zu Frauen ‹Puppe› sagen. Das alles findet Gary großartig. Das ist genau sein Ding. Erlerntes Verhalten nennt man das wohl, und weil er jünger ist als ich, kennt er es nur aus dem Fernsehen. Ich bezeichne es als Garys erlerntes Ich – vom Standpunkt meines eigenen erlernten Ichs aus.
«Sie wurde mehr als nur umgebracht», sagt jemand. «Sie ist mehr als nur tot.»
Die leichenbezogene Sachlage, ja, aber kein dummes Gewitzel. Diese hier hat etwas Besonderes. Ich erkenne das an der Eintönigkeit, am Sog in Richtung Trauer. Wir alle wissen Bescheid.
Jemand beugt sich über die Leiche. Ich kann nur die Füße sehen, aber es ist eine sie: ein Bein gestreckt, das andere in einer zierlichen Tanzbewegung nach hinten geklappt und dort festgefroren. Charleston. Totes Ensemble-Mädchen, aus einem Dreißigerjahre-Musical hierher transportiert, eine Leiche aus einem Fluss. Nie zweimal derselbe Fluss, denke ich, ohne zu wissen, warum, und dann flüstere ich es: Nie zweimal derselbe Fluss. Zunehmend formuliere ich die Gedanken, die mir in den Kopf kommen. Ein kundiger Lippenleser wüsste genau, was ich denke.
Der Fluss, also der echte, ist nicht weit entfernt. Die Überschwemmung hat nachgelassen, aber das Wasser fließt immer noch schnell und mit Wucht, und das Geröll im Flussbett lässt ihn schäumen und spritzen. Er klingt wie eine Autobahn. Die M25, die gegen ihre Ufer schäumt.
«Ich bestätige noch nichts und benutze auch keine Namen, aber auf der Basis, dass sie es ist, könnt ihr jetzt loslegen.»
Das kenne ich. Ich habe es an der Uni gelernt: man kann jemanden nur schwer identifizieren, wenn er tot ist. In den Anfangstagen der Totenfotografie hängte man die Bilder jüngst Verstorbener aus, und die Leute sahen sich das an, als würden sie windowshoppen oder im Wettbüro Pferde und Quoten prüfen. Manche Leichenhäuser öffneten die Türen, und man konnte die Toten besichtigen. Ganze Familien zogen in Sonntagskleidern los, um Leichen zu bestaunen. Das war wie Tinder für Verblichene; wischen, wischen, anhalten, wischen, zu den Favoriten hinzufügen, blockieren, Nachricht schreiben … Aber viele konnten ihre geliebten Angehörigen tot gar nicht identifizieren. Das lag nicht am Körper selbst, sondern am fehlenden Leben, das ihn anders aussehen ließ. Wie könnte man es sonst erklären?
Bei meinem ersten Fall – einem Unfall mit Fahrerflucht – stand der Vater bei der Leiche und betrachtete sie aufmerksam. Wir hatten ihn einbestellt, um sie zu identifizieren. Er schüttelte den Kopf und sagte, das sei nicht sein Sohn. Wir wussten, dass er es war, mussten ihm aber vorschriftsmäßig glauben, uns bei ihm entschuldigen und so tun, als würden wir wieder zu der Vermisstenliste zurückkehren, auf der wir ihn ursprünglich entdeckt hatten. Später rief er dann an und bestätigte, er sei es doch, wobei er meinte, diese Bestätigung sei für ihn wie das Kippen eines Schalters, seines Aus-Schalters. Das hätte er nicht können. «Der Knopf zwischen dem Wahr-Machen und dem Unwahr-Halten», sagte er. Genau dort leben Geister: nicht an tatsächlichen Orten, etwa auf Friedhöfen oder in einem Haus, in dem es spukt. Sie existieren in der Zeit, die es braucht, bis die äußerliche Tatsache eines Todes bei uns innere Gewissheit wird. Indem wir ihr Verschwinden bestätigen, befreien wir uns selbst und dazu auch noch die Verstorbenen.
Aber wer weiß, was die Toten mit ihrer Freiheit machen? Wo gehen sie hin?
Niemand sagt etwas. Einer der Constables schreibt etwas in sein Notizbuch, aber nur, um die Hände beschäftigt zu halten und nicht hinsehen zu müssen.
Sie ist merkwürdig verdreht und gewandet … schreibe ich – gewandet? Ich komme mir wie ein Idiot vor, streiche das Wort durch und schreibe stattdessen: Man hat versucht, sie in Plastiksäcke einzuwickeln. Ich streiche noch einmal durch und schreibe Mülltüten. Ich weiß nicht, warum ich so euphemisiere und zum offiziellen Fachjargon neige; ich rede hier nur mit mir selbst, notiere es für mich.
Gewandet? Du lieber Gott …
Später denke ich, dass das vermutlich der Versuch war, sie so weich wie möglich auf ein Lager aus Worten zu betten, weil ich bereits wusste, was mit ihr geschehen würde, sobald die Zeitungen Wind davon bekämen. «Wie eine kaputte Puppe im Müllsack!», würde Lynne Forester später schreiben. Mad Lynne hatte sie gar nicht gesehen, auch nicht die Fotos, und trotzdem gab sie das so an die Zeitungsleser im ganzen Land weiter. Sie hatte nicht vor, ihre Kundschaft mit Formulierungen wie gewandet zu verwirren.
«Hier war ich schon mal», erkläre ich ihnen.
Gary, der bereits neben mir kniet, blickt ruckartig auf. Er hat verstanden, was ich sagen will, im Gegensatz zu den anderen. Gary ist äußerst intuitiv; er spürt Gefühle und einen Tonartwechsel in Stimmungen. Das passt nicht zu seinem Selbstbild, deshalb tut jeder so, als hätte er es nicht bemerkt.
Ich hätte es ihm trotzdem vorher sagen sollen.
«Jeder von uns war hier schon mal», sagt der Pathologe, ohne aufzublicken oder sich umzudrehen. «Jeder Tod anders, aber trotzdem gleich.»
«Nein, ich meine hier. An diesem Ort. Hier war ich schon.»
Jetzt sehen alle zu mir. Ich werde es später erklären.
*
Es ist merkwürdig, dass wir Spuken für etwas durch und durch Menschliches halten: gesellschaftlich verankert, wenngleich unangenehm oder gar beängstigend. Die Spukenden sind immer noch Versionen von uns und nur auf die andere Seite gewechselt. Geister sind domestizierte Wesen, wie Hunde oder Katzen, denn wir haben sie erfunden (vielleicht denken sie dasselbe von uns), um unser Verhalten zu kopieren, das sie dann tatsächlich wiederholen (Wiederholung ist bei Geistern wichtig: wie Haustiere oder Kinder brauchen sie routinemäßige Abläufe), langsam und oft auch erstaunlich genau. Sie sind gespenstische Wiederholungen unserer Spielbegegnungen, ob gewonnen oder verloren, und wir hängen ihnen etwas von uns selbst an, das wir nicht so gern sehen: die Unfähigkeit, weiter zu gehen, die Begierde nach Rückkehr. Wir suchen letztendlich sie heim. Nichts wäre ihnen lieber, als verschwinden zu dürfen.
Deshalb kann man auch an keinem Ort spuken, an dem man noch nicht gewesen ist, also nicht richtig, und obwohl es Geister gab, die sich in andere Geschichten verirrt haben, in sozusagen fremde Spukerscheinungen, wirken sie dort fast schon komisch, wie Schauspieler, die ins falsche Stück gestolpert sind.
Genau aus diesem Grund war ich als Kind enttäuscht von Geistern: wie konstruiert sie wirkten, wie aus all dem gebastelt, was sie zurückgelassen haben – wie sehr sie letztendlich aus uns bestanden. Es war unser fehlender Anspruch an Geister, der mich enttäuschte; mit all dem, was wir über das Unbekannte wissen, konnten wir sie zu nichts Besserem machen als zu Gefäßen der eigenen, ungelösten Probleme. Von mir aus hätten sie sich etwas entfernen, mehr von uns ablösen können, aber nein: sie wurden von den Mustern eingeengt, die im Grunde die unsrigen waren. Eine verschenkte Gelegenheit, dachte ich; für uns in unseren Fantasien und für sie in ihrer imaginierten Wirklichkeit.
Das liegt daran, dass Spuken nur eine andere Art der Zugehörigkeit ist. Für manche von uns die einzig mögliche.
Meine Geister sind Orte. Dieser ist einer davon: eine Übergangs-Strauchlandschaft, ein Navi-anonymisierter Zwischenbereich, eingerahmt von Schulsportplätzen und einem braunen Fluss, dessen Ufer voller Schlamm und dazu noch Plastiktüten, Farbeimern und alten Reifen ist. Die Kent Downs sind ein paar Meilen entfernt, ein ‹Gebiet von außerordentlicher natürlicher Schönheit›, grünstes, sauberstes Bilderbuch-England. Orte wie dieser sind ihre hässlichen Cousins, ihre Schattenseite. Ein paar kaputte Elektrogeräte leuchten weiß im Gehölz, und direkt dahinter gurgelt der Fluss mit etwas, das wie eine Kühlschranktür aussieht. Nicht viel weiter, flussaufwärts und hinter Bäumen, die so dicht stehen, dass sie sogar blätterlos den Blick versperren, liegt die Brücke.
Wilde Müllkippen haben etwas Besonderes an sich; diese langsame, bedrückende und heimliche Ansammlung von Überresten unseres Alltags. Zunächst wird ein Stück Randgebiet eingeweiht, sei es bescheiden mit einem alten Fernseher oder pompöser mit einer Gefrierkombination; und dann, als würden Eisensplitter zum Magnet streben, folgt alles andere. Die Menschen wissen Bescheid und fühlen sich angezogen; nach Einbruch der Dunkelheit, in Scham gehüllt und mit ausgeschalteten Scheinwerfern kommen sie mit Autos und Lieferwagen angerollt und laden ihren Müll ab. Es ist ein Nicht-Ort – also was soll’s? Nur entsteht mit der Zeit eine Art Schauraum, ein Walmart des Dschungels, ein futuristischer Einkaufskomplex, aus dem die Zukunft verschwunden ist. Er verrottet nicht, baut sich nicht biologisch ab, kompostiert nicht, erodiert nicht. Die Erde weist alles zurück: die Kühlschrankgase, die Batteriesäure, die mitteldichten Faserplatten, das Swinger-Kunstledersofa und die dreckige, von rostigen Federn durchbohrte Matratze.
Ein Nicht-Ort, ja. Aber kein Ort zum Sterben, kein Ort, um tot aufgefunden zu werden.
Ich selbst lebe in der Gegenwart. Dort esse und trinke ich, schlafe und erwache ich, beziehe ich mein Gehalt und gehe mit meiner Nichte in den Park oder Einkaufen. Mein Zuhause ist aber die Vergangenheit. Die meisten machen da immer wieder einen Tagesausflug hin – eine Stunde oder Minute des Sinnierens, ein altes Foto hier, ein alter Song oder Geruch da, dann schnell wieder zurück ins Leben, wie wir es zu leben glauben: vorwärtsgerichtet.
Das liegt daran, dass die meisten Leute Erinnerungstouristen sind. Nur ich bin dorthin übersiedelt, und wenn ich einmal das Hier und Jetzt besuche, komme ich mir vor wie ein Fremder – von der Immergleichheit des alten Landes so irritiert wie von den Veränderungen, die in meiner Abwesenheit stattgefunden haben.