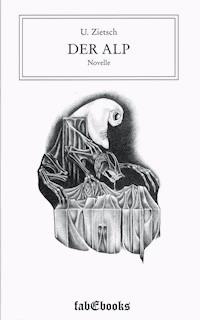
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fabylon
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fantasy
- Sprache: Deutsch
Der Alp endet niemals. Er umgibt uns im Schlafen wie im Wachen, er umschlingt und erdrückt uns, er frisst uns auf. Und dann ist es immer noch nicht zu Ende … Möglicherweise kann man aus dem Alptraum erwachen, am Ende aller Leiden, am Ende dieses Buches, wenn die letzte Seite umgeblättert ist. Die Entscheidung liegt nur bei uns selbst, ob wir es wagen … Ein unbequemes Buch, das uns mit uns selbst konfrontiert. Bewusst neutral gehalten, erscheint als Autorenvorname nur ein "U.", denn die vier Parabeln sind in der Ich-Form gehalten, und als Ich erlebt der Leser die metaphorischen Geschichten selbst und erfährt hautnah, was mit jemandem geschieht, der anders ist als die anderen. Eine unserer größten Ängste ist es, abseits zu stehen, am Rande der Normalität, der Gesellschaft, des Lebens. Was geschieht mit uns, wenn wir unverschuldet in eine solche Situation geraten und hilflos ausgeliefert sind? Können wir fliehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
U. Zietsch
Der ALP
Novellen
fabEbooks
Über die Autorin
Uschi Zietsch wurde 1961 in München geboren. Sie ist verheiratet und lebt seit Jahren als Schriftstellerin und Verlegerin mit ihrem Mann und vielen Tieren auf einem kleinen Hof im bayerischen Allgäu.
Ihre erste Veröffentlichung war 1986 der Fantasy-Roman »Sternwolke und Eiszauber« (auch als fabEbook erhältlich) im Heyne-Verlag. Darauf folgten bis heute kontinuierlich über einhundert Veröffentlichungen in den Bereichen der Science Fiction, Fantasy, Kinderbücher, TV-Serien und vielen mehr. Unter dem Künstlernamen »Susan Schwartz« schrieb sie jahrelang als Teamautorin bei »Perry Rhodan«, »Maddrax« und anderen Heftserien mit. Für die exklusiv bei BS-Editionen (Bertelsmann) erschienenen sehr erfolgreichen und beliebten Urban-Fantasy-Serien »Elfenzeit« und »Schattenlord« zeichnete sie für das gesamte Konzept und die Exposés verantwortlich und schrieb die meisten Romane.
Darüber hinaus gibt Uschi Zietsch Schreibseminare und ist Mit-Verlegerin des Fabylon-Verlags.
2008 erhielt sie den Literaturpreis von amnesty international für ihre Kurzgeschichte »Aische« zum Thema »Menschenrechte«.
Weitere fabEbooks von Uschi Zietsch:
HADES
Der Traum der Wintersonne
Sternwolke und Eiszauber
Der Stern der Götter
Die Chroniken von Waldsee Trilogie
Nauraka (Waldsee 4)
Fyrgar (Waldsee 5)
Der wahre Schatz (Story aus Waldsee)
Drakhim – Die Drachenkrieger
Umschlagbild: Alexander Urbanek
© des eBooks 2013 by fabEbooks
ISBN: 978-3-943570-34-2
Hinweis: Das Luxus-Hardcover (ISBN 978-3-927071-11-0) enthält Illustrationen und eine Überraschung.
Der Alp endet niemals. Er umgibt uns im Schlafen wie im Wachen, er umschlingt und erdrückt uns, er frisst uns auf. Und dann ist es immer noch nicht zu Ende ...
Möglicherweise kann man aus dem Alptraum erwachen, am Ende aller Leiden, am Ende dieses Buches, wenn die letzte Seite umgeblättert ist. Die Entscheidung liegt nur bei uns selbst, ob wir es wagen ...
Ein unbequemes Buch, das uns mit uns selbst konfrontiert. Die vier Parabeln sind in der Ich-Form gehalten, und als Ich erlebt der Leser die metaphorischen Geschichten selbst und erfährt hautnah, was mit jemandem geschieht, der anders ist als die Anderen. Eine unserer größten Ängste ist es, abseits zu stehen, am Rande der Normalität, der Gesellschaft, des Lebens. Was geschieht mit uns, wenn wir unverschuldet in eine solche Situation geraten und hilflos ausgeliefert sind? Können wir fliehen?
1
ICH ERINNERE MICH NOCH GENAU DARAN, dass die größte Angst meiner Kindheit war, blind zu werden. Manchmal stellte ich mir nur vor, wie es wohl sein würde, wenn ich nichts mehr sehen könnte, manchmal aber brach die Angst so stark hervor, dass ich die ganze Wohnung verdunkelte und mit geschlossenen Augen umhertappte, um für den Ernstfall zu üben.
Selbstverständlich gibt es in unserer Welt Wesen, für die Augen nichts bedeuten, weil sie sich auf andere Sinne verlassen, aber ich gehöre zu einer Spezies, die völlig auf ihre Augen fixiert ist. Die wundervollen Farben, die wir sehen können, die Räumlichkeit ... wir sind glücklich, unsere schöne Welt sehen zu können, zu erkennen, wie sie wirklich ist. Andere, die nicht so sind wie wir, behaupten leichthin, dass die Welt ganz anders wäre, weil sie sie nur hören oder fühlen oder schmecken, aber wir können bis zu einer gewissen Grenze hören, fühlen, schmecken und sehen. Wir sind abhängig von unseren Augen, nach dem Aussehen suchen wir unsere Partner, durch Sichtkontakt erledigen wir unsere Arbeit, unterscheiden wir Gut und Böse. Und wir sind glücklich damit. Deshalb hatte ich als Kind so große Angst vor der plötzlichen Blindheit. Selbstverständlich kamen auch bei uns immer mal blinde Kinder auf die Welt, aber sie wussten ja nie, wie die Welt wirklich war, sie hatten nie das echte Bewusstsein erfahren und wussten darum nichts von ihrem Verlust. Diese armen Wesen wurden auf besonderen Farmen gehalten und beschützt, so dass sie immer das Gefühl hatten, noch behütet im warmen Mutterleib zu sein. Aber bei all dieser Angst hatte ich als Kind eine Tatsache übersehen, nämlich dass wir von der Fortbewegung lebten, unterstützt von unseren Augen. Mir war nie bewusst geworden, dass ich als Blinder noch laufen konnte, mich von einem Ort zum nächsten bewegen, und dass mein Tastsinn und mein Orientierungsgefühl die fehlende Sicht so weit ergänzen konnten, dass ich mich ohne Hilfe zurechtfinden konnte. Je länger und öfter ich in der dunklen Wohnung geübt hatte, umso sicherer hatte ich mich gefühlt, und je sicherer ich mich fühlte, umso mehr verlor ich meine Angst, bis ich als Erwachsener nur noch die gesunde Furcht vor der Blindheit hatte, aber sicher war, dass ich mit ein wenig Mut und Ehrgeiz alles bewältigen konnte. Aber leider stimmte das nicht. Meine Beine waren stets so außer Sichtweite, so unauffällig und treu, dass ich nie daran dachte, was geschehen würde, wenn ich sie nicht mehr benutzen konnte. Manche Völker auf unserer Welt leben im Wasser und brauchen keine Beine, manche leben auf dem Land und bewegen sich schlängelnd und rutschend auf dem Boden, manche haben Flügel. Aber das alles verhalf ihnen nicht zu der Intelligenz, wie wir sie haben. Mit unseren mächtigen, sprungkräftigen und ausdauernden Beinen konnten wir uns in rasender Geschwindigkeit überallhin bewegen, wir konnten die Welt mit unseren neugierigen Augen erforschen, und mit unseren vier Tentakelarmen konnten wir uns allmählich die Technik zunutze machen. Unsere Arme sind zwar nicht besonders geschickt oder feinnervig, aber besser als die von allen anderen Völkern, und mit ihrer Hilfe unterstützten wir die Arbeit unserer Beine und Augen. Wir hatten ein Sozialgefüge aufgebaut, das für jeden Einzelnen sorgte, auch wenn er nicht mehr arbeiten konnte. Als ich in die Pubertät kam, glaubte ich auch fest daran, denn man sieht bei uns niemals Kranke oder Arme, alles geht seinen geordneten Gang, und ich fühlte mich wirklich geborgen. Bis zu jenem Tag, an dem ich den Unfall hatte. Mir stets meiner kindlichen Angst vor der Blindheit bewusst tat ich alles, um meine Augen zu schützen, aber die Beine, die geduldigen, nie klagenden Säulen meines Körpers, hatte ich vergessen, weil sie so ein selbstverständlicher Teil von mir waren. So tat ich eines Tages einen Fehltritt, stürzte ab, und als ich auf dem Boden aufprallte, knackste etwas in meinem Rücken, und danach konnte ich meine Beine nicht mehr spüren - nie mehr. Ich war unheilbar krank geworden; dieser Schock traf mich so plötzlich, dass ich wochenlang nahezu im Koma lag. Von einem Augenblick zum nächsten war mein Leben zerstört worden, ohne Vorbereitung auf die grausame Wahrheit musste ich erkennen, dass ich absolut hilflos war und nichts mehr selbst tun konnte. Ich konnte nicht mehr meinen Lebensunterhalt verdienen, ich konnte nicht einmal mehr allein meine Notdurft verrichten. Als ich meine Arme so weit wieder bewegen konnte, dass ich allein essen und trinken konnte, weinte ich vor Glück, und Hoffnung begann sich in mir zu regen, dass auch meine Beine wieder in Ordnung kommen würden. Aber die Ärzte sagten mir schonungslos die Wahrheit. Ich war zeitlebens gelähmt und musste in ein Heim. Meine besorgte Familie war stets um mich und versprach, sich um ein ordentliches Heim für mich zu kümmern, denn dort konnte mir viel besser geholfen werden als zu Hause. Ich bekam plötzlich Angst und kämpfte darum, zu Hause leben zu dürfen, aber ich musste schließlich einsehen, dass das nicht ging. Meine Verwandten waren entweder berufstätig oder noch zu jung, niemand hätte ausreichend für mich sorgen können. Ich brauchte ständige Betreuung, und die konnte ich nur im Heim erhalten. Außerdem, sagten sie, würde ich ja nicht einsam sein, es gäbe Leidensgenossen, und meine Familie hätte ich auch noch. Ich unterschrieb also alle Erklärungen, die meisten bekam ich nicht einmal zu lesen, aber alle waren sehr nett und versicherten mir, sie würden alles nur Erdenkliche tun, damit es mir gut ginge.
Das Heim sah auch tatsächlich sehr schön aus, nicht nur von außen, es war alles sauber und gepflegt, und überall gab es Blumen. Am Anfang kam jede Stunde eine Pflegerin zu mir und fragte nach meinen Wünschen, schob mich im Rollstuhl in den Garten, schüttelte mein Bett auf, machte kleine Scherze, um mich aufzuheitern. Meine Familie konnte ich erst am nächsten Wochenende wieder sehen, aber da alles so neu war, vergingen die Tage wie im Flug. Ich lag nachts noch oft wach, weil ich Angst vor der Zukunft hatte, und weil ich den Verlust meiner Gesundheit beklagte, aber als meine Familie zu Besuch kam, war ich schon etwas getröstet; sie hatten eine Menge zu erzählen, und wir lachten viel, und der Abschied fiel uns schwer. Aber ich wusste ja, dass sie am nächsten Wochenende wieder kommen würden.
Unter der Woche wurde ich weiterhin gut abgelenkt und hatte kaum Zeit nachzudenken; man wurde im Heim nicht auf das Abstellgleis gestellt, sondern bekam kleinere Arbeiten, ›Behinderten-Resozialisation‹ nannten sie es, aber viel kann man ohne Beine ja leider nicht machen. Nach einem Monat kam ein Beamter von der Aufsichtsbehörde vorbei, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen, ich musste wirklich anerkennen, dass ich nicht nur gut betreut wurde, sondern dass das Heim auch strengster Kontrolle unterlag. Der Beamte blieb fast den ganzen Tag, eine oder zwei Stunden war er bei mir, die übrige Zeit inspizierte er die Anlage. Ich begann mich allmählich mit meinem Schicksal abzufinden, die Hoffnung auf ein anderes Leben in besserer Gesundheit hatte ich allerdings noch nicht ganz aufgegeben. Eines Tages kam einer der Ärzte außerhalb der Visite zu mir und erklärte mir, dass ich schon so weit angepasst sei, dass ich umsiedeln könnte. Ich war sehr erstaunt, denn ich dachte, dass das in Wohn- und Schlafbereich aufgeteilte Zimmer mit behindertengerechtem Bad und einer kleinen Küche meine Heimat für die nächsten Jahre wäre. Der Arzt klärte mich lächelnd über meinen Irrtum auf, dies sei natürlich nur die Aufnahmestation mit einem speziellen Anpassungsprogramm an das neue Leben. In diesem Wohntrakt stünde nur eine begrenzte Anzahl von Zimmern zur Verfügung, die dann für andere, neu aufgenommene Kranke wieder geräumt werden müssten. Ich bräuchte mir aber keine Sorgen zu machen, da ich nach hinten umziehen würde, mitten in den Park, dort wäre es noch schöner und ruhiger. Ich fühlte einen Stich in meinem Herzen. Ich hatte schon erste scheue Kontakte zu anderen Behinderten geknüpft, mich ein wenig an das neue Leben gewöhnt, und wurde nun wieder herausgerissen. Ich bat darum, meine Familie verständigen zu dürfen, aber er winkte ab, dass das schon geschehen sei. Ich sollte meine Lieblingsdinge zusammensuchen, denn in den nächsten Stunden würde ich umziehen. Er klopfte mir auf die Schulter und rauschte geschäftig vor sich hinmurmelnd hinaus. Und ließ mich damit allein zurück, verblüfft, verärgert. Hatte er das Recht dazu, einfach so über mich zu bestimmen? Warum hatte mir das keiner am Anfang gesagt, bevor ich hierherkam? Ich konnte zwar meine Beine nicht mehr bewegen, aber mein Verstand war doch noch in Ordnung! Ich verbrachte die Wartezeit damit, mir die verschiedenen Wege einer Beschwerde zu überlegen, und hatte mich entschieden, als meine Lieblingspflegerin hereinkam, gefolgt von drei kräftigen Männern. Alle vier hatten strahlende Laune, lachten und scherzten und plapperten unaufhörlich, dass ich überhaupt nicht zu Wort kam. Sie packten zusammen, schoben mich hin und her, trugen mich wie meine Sachen hierhin und dorthin und verfrachteten mich schließlich auf den Gang hinaus. Die Männer gingen mit meinen Sachen voraus, die Schwester schob mich langsam hinterher und erzählte mir dabei von meinem neuen Heim, und wie wundervoll dort alles sei. Ich fragte sie, ob ich sie dort auch sehen würde, aber sie schüttelte den Kopf. Nein, erklärte sie mir, sie habe nur hier ihren Bereich, wie eine Kellnerin, die ihre fünf Tische hat, fügte sie hinzu und kicherte wie ein junges Mädchen. Aber ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen, das Personal dort wäre mindestens genauso nett wie hier und würde sich auch genauso kümmern. So schwatzte sie fröhlich und aufmunternd, bis wir in dem anderen Haus angekommen waren. Vielleicht war ich zu aufgeregt und noch zu ärgerlich, dass ich mir die Dinge schlimmer einredete als sie waren, aber ich fand, dass dieses Haus keineswegs so sauber und heiter war wie das vordere. Aber ich schwieg, ich hatte mir inzwischen ins Gedächtnis gerufen, dass ich dem Staat nun zur Last fiel, da ich nicht mehr arbeitete und er für mich sorgen musste, und ich durfte mit meinem Schicksal nicht so unzufrieden sein. Es wurde wirklich alles für mich getan, ich konnte kein Paradies erwarten.
Meine neue Behausung war sehr viel kleiner als mein erstes Zimmer, und es war auch nicht so hell. Ich war für einen Moment sehr erschüttert, dass ich hier nun bis an mein Lebensende bleiben sollte. Um mich abzulenken, dirigierte ich die Männer herum, wo sie meine Sachen abstellen sollten, und inspizierte das Bad, in dem es nur eine kleine Dusche gab. Ich schluckte alles hinunter und bemühte mich, nicht daran zu denken. Ich durfte nicht undankbar sein. Und vielleicht konnte mir meine Familie helfen.
Sie kamen mich pünktlich besuchen, wie jedes Wochenende, und äußerten sich sehr entzückt über mein neues Heim, das mitten im Grünen läge, und das Personal sei sehr nett, und überhaupt wäre alles viel schöner. Als ich vorsichtig protestierte, wurde ich ermahnt, nicht ständig herumzuquengeln und anderen die Schuld für meine Behinderung zu geben. Es wäre an der Zeit, mich endlich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen und den Leuten, die es gut mit mir meinten, positiver zu begegnen. Ich versuchte ihnen zu erklären, was ich meinte, aber sie weigerten sich energisch, mir zuzuhören. Sie hätten jetzt lang genug Rücksicht auf mich genommen, aber nun sei es wirklich nötig, wieder normal miteinander umzugehen. Da schwieg ich. Sie schleppten mich dann in den Park hinaus und erzählten mir, was sie schon alles vom Pflegepersonal wussten; sie kannten anscheinend mehr Leute als ich, denn ich hatte bisher erst einen Arzt und eine Pflegerin kennengelernt.





























