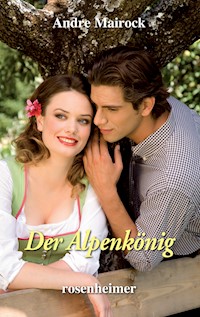
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bruno Schwaiger ist der zweite Sohn vom Falkenhof. Immer wieder riskiert er sein Leben, wenn er Touristen aus Bergnot rettet. Mit der hübschen Luzie von der Kreuzalphütte verbindet ihn eine Begeisterung für die Berge. Doch ihre Liebe hat keine Zukunft: Denn als der Falkenhof an Brunos Bruder übergeben wird und dieser ihn verkaufen möchte, muss Bruno die Hilfe der reichen Wally annehmen, um den Hof zu retten. Wird diese neue Verbindung glücken?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
LESEPROBE zuVollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2002
© 2016 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelfoto: Studio von Sarosdy, Düsseldorf Bearbeitung, Lektorat und Satz: Pro libris Verlagsdienstleistungen, Marbach am Neckar
eISBN 978-3-475-54594-8 (epub)
Worum geht es im Buch?
Andre Mairock
Der Alpenkönig
Bruno Schwaiger ist der zweite Sohn vom Falkenhof. Immer wieder riskiert er sein Leben, wenn er Touristen aus Bergnot rettet. Mit der hübschen Luzie von der Kreuzalphütte verbindet ihn eine Begeisterung für die Berge. Doch ihre Liebe hat keine Zukunft: Denn als der Falkenhof an Brunos Bruder übergeben wird und dieser ihn verkaufen möchte, muss Bruno die Hilfe der reichen Wally annehmen, um den Hof zu retten. Wird diese neue Verbindung glücken?
1
Über das Gebirge zogen weiße Föhnwolken. Wochenlang hatte winterlicher Dunst den gewaltigen Alpengürtel eingehüllt und fast unsichtbar gemacht; nun traten plötzlich die Berge zum Greifen nahe heran.
Föhn! Die Menschen in der Gegend wussten, welche Gefahr das für Unerfahrene und Leichtsinnige bedeuten konnte. Der weiße Tod drohte durch Schneebretter, durch Grundlawinen und durch die entfesselten Fluten der Wildbäche.
Es war am Nachmittag eines Februartages. An der Kreuzalphütte, die hoch am Berg, von einzelnen Wettertannen gegen Wind und Schneegestöber geschützt, auf einer frei hängenden Kanzel lag, stand die Tür offen. Der Hüttenwirt, ein noch junger, stämmiger Bursche, der erst im vergangenen Sommer zusammen mit seiner Schwester aus dem Tannheimertal zugezogen war und die Hütte in Pacht genommen hatte, stand davor und schaute mit unruhiger Miene hinaus.
Am Mittag waren die Skifahrer, die einige Zeit bei ihm zu Gast gewesen waren, abgezogen, denn nach dem Wetterbericht, den sie im Radio gehört hatten, wollten sie lieber ins Tal entkommen, bevor die Pracht der Winterwelt sich unter dem Ansturm des Föhns auflöste.
Der Hüttenwirt war nicht deswegen bekümmert, weil er nun aller Voraussicht nach einige Zeit ohne Gäste sein würde; das hatte er zwischendurch einmal sehr gern, zumal er den ganzen Winter hindurch in dieser Hinsicht nichts zu klagen gehabt hatte.
Aber er ängstigte sich um seine Schwester, die vor einigen Stunden zur Schönbuch-Alm aufgebrochen war. Der Weg dorthin war im Sommer bequem und führte über die Berghöhe hin – mit einem herrlichen Ausblick auf die Lechtaler Felstürme – und dann über das Mädelejoch in ein wildromantisches Hochtal hinein. Aber im Winter, auch wenn man mit den Skiern umzugehen verstand, war der Weg nicht ganz ungefährlich. Er machte sich immer Sorgen, wenn Luzie so unbekümmert in die Winterlandschaft hinausfuhr.
Und heute lag Föhn über den Bergen! Hoffentlich kehrte sie heim, ehe es wirklich gefährlich da draußen wurde!
Er rechnete die Zeit nach und sagte sich, dass sie eigentlich schon zurück sein könnte. Aber sie hatte wohl noch einen Abstecher gemacht und eine zügige Abfahrt gesucht, denn Skifahren war ihre Leidenschaft.
Lange stand Richard Böhmer, der Hüttenwirt von der Kreuzalpspitze, vor der Tür und schaute hinauf zu dem weißen Berg – in Erwartung des jungen Mädchens. Er hörte bereits das Grollen und Glucksen erwachender Wildbäche und vernahm das Rauschen des Windes in den Wettertannen.
Wenn sie doch endlich heimkommen würde! Wie lange mochte es noch dauern, dann würden die ersten Grundlawinen niedergehen?
Da hörte er plötzlich einen Ruf.
Am Steilhang, auf dem Weg, der ins Tal führte, klomm die hünenhafte Gestalt eines jungen Mannes empor. Er schlug mit den Skiern eine Stiege in den Schnee und kletterte behände den Berg herauf.
Ein markantes, frisches Gesicht mit ein paar dicken Schweißperlen auf der Stirn wurde unter der Mütze sichtbar.
»Auf wen wartest du, Richard? Auf mich?«, lachte der junge Mann dem Wirt entgegen.
»Bruno! Dich habe ich heute nicht erwartet bei dem Föhn!«
»Warum nicht? Ich bin doch gleich wieder drunten, wenn es ernst wird!«
»Die Luzie ist zur Schönbuch-Alm gefahren, und sie kommt und kommt einfach nicht heim! Ich fange an, mir Sorgen zu machen, und habe mir gerade überlegt, ob ich nicht nach ihr suchen soll …«
Richards besorgter Miene war anzumerken, wie bitter ernst es ihm dabei war. Bruno konnte nicht umhin, Richards Besorgnis zu teilen. Mit dem Föhnwetter war nicht zu spaßen.
»Soll ich sie suchen gehen?«, schlug er vor.
Richard schien ein Stein vom Herzen zu fallen vor Erleichterung.
»Wenn du das tun könntest, Bruno! Ich wäre dir aufrichtig dankbar! Du bist viel sicherer auf den Brettern als ich selbst und kennst die Gegend viel besser. Gut, dass du gekommen bist! Diese Luzie, das leichtsinnige Mädel! Ich habe ihr noch gesagt, sie soll hierbleiben, aber auf mich hört sie ja nicht.«
Bruno nickte, wandte sich der Berghöhe zu und machte sich umgehend auf den Weg.
Der Falken-Bruno, wie der Bursche allgemein genannt wurde, war der zweite Sohn des Falkenhofers vom Taldorf. Eigentlich hieß er Bruno Schwaiger. Er war ein häufiger Gast in der Kreuzalphütte. Seit die beiden Geschwister aus dem Tannheimertal zugezogen waren und Luzie sich rasch als ebenso begeisterte Freundin von ausgedehnten Bergtouren herausgestellt hatte, waren die beiden schon mehrmals zusammen auf Kletterpartien gewesen. Im Winter dann hatte sich rasch herausgestellt, dass das Mädchen auch auf Skiern eine gute Figur machte und Rücksichtnahme weder erwartete noch nötig hatte, wenn man mit ihr unterwegs war.
Zur Hochachtung und Anerkennung vor ihren sportlichen Fähigkeiten, die sie zu einem Bergkameraden machten, auf den man sich mehr verlassen konnte als auf die meisten Männer, waren inzwischen längst auch andere, unausgesprochene Bande des Gefühls hinzugekommen.
Das wusste Richard, und das wussten auch die Leute vom Dorf. Es war ein offenes Geheimnis, und niemand wunderte sich darüber. Die beiden schienen wie für einander gemacht.
Der Bruno war schon ein Bursche, den es sich zweimal anzusehen lohnte. Seine Geschicklichkeit beim Skifahren war bemerkenswert, ebenso wie beim Bergsteigen. Sein Mut war so groß wie seine Kraft. Dabei war er zwar keineswegs leichtsinnig oder gar tollkühn, doch wo es nötig war, ging er durchaus auch ein Risiko ein.
So ging er auch jetzt ohne zu zögern dem Föhnsturm entgegen, obwohl ihm die Gefahren, die dort drohen konnten, durchaus klar waren. Er kannte sie und hatte sie alle schon einmal bei früheren Gelegenheiten überwunden.
Niemand war weit und breit zu sehen. Kein Einheimischer wäre so verrückt gewesen, sich bei diesen Witterungsverhältnissen ohne Not in den Bergen aufzuhalten, und auch die Urlauber waren alle schon in die Täler geflohen. Selbst das Wild hatte sich verkrochen und in den Bannwäldern Schutz gesucht.
An den Steilhängen klafften schon tiefe Sprünge in der Schneedecke. Die Wälder, die bislang weiß verschneit gewesen waren, wurden wieder tiefschwarz, und die Berge schienen näher zu rücken. Der Wind blies heftig über die Höhe.
Bruno stieg unentwegt weiter und schaute immerzu nach Luzie aus – und er fand schließlich die Spur eines Skifahrers. Dieser Skifahrer war offensichtlich zunächst dorthin unterwegs gewesen, wo er selbst herkam, nämlich zur Kreuzalphütte. Doch dann hatte dieser sich entschieden, statt dessen noch eine weitere steile Anhöhe zu erklimmen, wohl um eine interessantere und längere Abfahrt genießen zu können.
Das war typisch für Luzie! Bruno war sich sicher, dass er nun auf der richtigen Fährte war. Doch was für ein Leichtsinn von dem Mädchen bei diesem Wetter! Er beeilte sich, der Spur so rasch wie möglich zu folgen, und vor Anstrengung brach ihm der Schweiß aus allen Poren. Er musste sich beeilen; das Tageslicht würde bald anfangen zu schwinden. Dann schließlich hatte er die steile Höhe fast ganz erklommen – und jetzt sah er das Mädchen. Luzie stand droben am Kamm und schwang die Stöcke zum Zeichen, dass sie aus irgendeinem Grund nicht weiterkonnte und Hilfe brauchte.
Er hielt die Hände trichterförmig an den Mund. »Ich komme!«, schrie er laut in den Wind. Ein paar Regentropfen schlugen ihm in das erhitzte Gesicht. Der Schnee war nun schwer und klebrig, und nur mühsam kämpfte er sich voran.
Als er näher kam, sah er, was geschehen war. Über den ganzen Hang zog sich ein tiefer Riss. Die Schneemassen waren in Bewegung geraten und drohten abzustürzen; und wenn das geschah, würde die Lawine ihren Weg hinab zum Wald nehmen. Das konnte nun jeden Augenblick geschehen.
Durch die Erde ging ein Beben, und durch die Luft grollte ein Donner. Irgendwo war gerade eine schwere Lawine niedergegangen.
Der Regen wurde stärker.
»Bruno!«, rief das Mädchen.
»Bleib, wo du bist, Luzie!«, schrie er.
Immer näher schob er sich auf der Schneedecke hinauf, die ihm nun immer unsicherer vorkam und zu schwanken schien.
Abermals lief ein Beben durch die Erde, und
Bruno überlief es eiskalt.
Luzie bemerkte es ebenfalls und schloss die Augen. Denn sie glaubte, sie müsste jeden Augenblick sehen, wie der Bursche von den stürzenden Schneemassen verschlungen würde.
Aber es geschah nichts.
»Aufpassen!«, rief er. »Wirf die Skistöcke weg!«
Sie folgte seinem Befehl.
»Fahr direkt auf mich zu! Anders kommst du hier nicht raus! Keine Angst – es wird gutgehen, das verspreche ich dir! Also – abspringen! Los!«
Einen Augenblick zögerte sie noch.
»Los!«, schrie er noch einmal, aber diesmal klang es schroff und ungeduldig.
Da sprang sie ab. Ihr Sprung war keineswegs ungeschickt – aber es geschah, was sie befürchtet hatte und der Grund dafür gewesen war, dass sie so lange hier oben verharrt hatte: die Schneedecke geriet in Bewegung, und hinter ihr erklang ein donnerndes Getöse, als stürze der Berg ein. Die Lawine hatte sich gelöst.
Damit hatte Bruno gerechnet. Mit seinen starken Armen fing er Luzie geschickt auf, schwang sie auf seine Schulter und sauste wie der Wind den steilen Hang hinab.
Sie wussten in diesem Augenblick beide, worum es ging – wenn Bruno jetzt versagte oder gar stürzte, dann waren sie beide verloren. Er musste jetzt schneller sein als die Lawine. Und er musste so rasch wie möglich aus der Bahn herauskommen, die die herabstürzenden Schneemassen nehmen würden.
Nur wenige Minuten dauerte das Spiel mit dem Tod. Den beiden aber schien die Zeit sich während dieser wilden Fahrt ins Endlose auszudehnen, bis Bruno schließlich langsamer wurde und dann anhielt und Luzie auf die Füße stellte.
»Das war knapp!«, sagte er keuchend.
Nicht weit entfernt verhallte schon der Donner der niedersausenden Lawine. Sie hatte ihren Weg genommen und musste nun gerade in ein Kar gestürzt sein. Aber die beiden Menschen waren kurze Zeit im Bereich ihrer Bahn gewesen und ihr nur knapp entronnen.
»Gewonnen, Luzie!«, rief er lachend und zeigte eine Reihe blendend weißer Zähne.
Luzie schwieg; sie vermochte sich noch nicht zu fassen. Da ergriff er ihre Hände. »Luzie, Mädel, was ist denn mit dir? Was schaust du mich so an?«
Jetzt regte es sich in ihrem Gesicht. Ein Lächeln zuckte um ihren Mund. »Bruno, das hätte dir kein Mensch nachmachen können. Ich hatte schon fast mit meinem Leben abgeschlossen, als du gekommen bist. Einen zweiten Skifahrer wie dich gibt es auf der ganzen Welt nicht, einen der so viel Mut und so viel Kraft hat wie du. Du bist … der Alpenkönig!«
»Meinst du?«, fragte Bruno zurück, halb stolz und halb verlegen über ihr überschwängliches Lob. »Das war doch halb so wild, so ein zierliches Ding wie dich auf die Schulter zu nehmen …«
»Und ich sage, diese Lawine hätte jeden anderen als dich unter sich begraben. Dir aber konnte sie nichts anhaben, Alpenkönig!«
Sein Lachen erlosch. Er schaute sie plötzlich ganz ernst an.
»Vielleicht hast du ja Recht, Luzie: Mit dir und für dich bringe ich Dinge zustande, die ich sonst vielleicht auch nicht könnte.«
Sie wurde etwas verlegen und wusste nicht, was sie darauf sagen sollte.
Doch im selben Moment ließ ein donnerndes Rumpeln ganz in der Nähe die beiden erschrocken zusammenfahren. Der Moment der Verzauberung war vorbei, in dem die beiden Sportskameraden vielleicht schon jetzt zu einem Liebespaar hätten werden können.
»Machen wir, dass wir hier fortkommen, Bruno«, sagte Luzie. »Nicht dass die nächste Lawine uns doch noch erwischt!«
Schweigend fuhren sie nun hintereinander talwärts.
Die Kreuzalphütte lag im tiefen Dunkel. Erst als sie schon ganz nahe gekommen waren, erkannten sie, dass die Fensterläden geschlossen waren; durch die Ritzen drang das Lampenlicht.
Die Tür stand jedoch offen. Richard war immer wieder dort aufgetaucht, um nach den beiden Ausschau zu halten. Als er nun endlich zwei Gestalten aus dem Dunkel auftauchen sah, lief er ihnen voller Erleichterung entgegen. Luzie umarmte ihn stürmisch.
»Armer Richard! Hast du dir große Sorgen um mich gemacht? Ich hatte auch Angst. Heute sind wir ihm wirklich begegnet …«
»Von wem sprichst du, Mädel?«
»Vom Bergtod!«, sagte sie versonnen.
»Luzie!«, keuchte Richard entsetzt. »Was ist denn gewesen? Erzähl es mir!«
»Später, Richard! Jetzt bin ich müde.« Sie schnallte die Schneeschuhe ab.
Bruno stand schweigend und unschlüssig abseits.
»Du kommst doch noch mit herein, Bruno?«, sagte Luzie.
Aber Bruno schüttelte den Kopf.
»Ich muss los, wenn ich noch ohne Probleme heimkommen will.«
»Bloß ein paar Minuten!«, bat sie. »Du hast doch sicher auch Hunger? Was hast du zu essen da, Richard?«
»Kässpatzen.«
»Fein. Bruno, ich bitte dich, komm mit herein!«
Da streifte auch er die Skier ab und folgte den Geschwistern ins Haus. Richard schloss die Tür.
Als sie die kleine getäfelte Stube betraten, schlug ihnen dicker Tabaksqualm entgegen, dass man hätte meinen können, an den Tischen säße ein Dutzend rauchende Männer. Aber es war nur ein einziger Gast da, der Jäger-Barthl, ein Mann in vorgerückten Jahren, mit einem dichten ungepflegten Bart, die Tabakspfeife im Mundwinkel, aus der er dicke Rauchwolken gegen die Decke stieß. Auf den offenen, karierten Hemdkragen stützte sich ein mächtiger Kropf, der immer in bedenkliches Schwanken geriet, wenn sein Besitzer einen kräftigen Zug aus seinem Krug nahm.
Ein kurzhaariger Dackel fuhr knurrend unter dem Tisch hervor, aber er zog sich sofort gehorsam wieder zurück, als sein Herr seine brummige Befehlsstimme ertönen ließ.
Voller Freude über die glückliche Wiederkehr der verlorengegangenen Schwester und des Freundes trug der Wirt sogleich ein schmackhaftes Kässpatzengericht auf, das den beiden vortrefflich mundete. Nebenbei erzählte Luzie ihr Erlebnis am Berg.
Allmählich entwickelte sich zwischen den vier Menschen ein recht lebhaftes Gespräch, und auch Bruno vergaß mehr und mehr, dass er doch eigentlich nach Hause gehen wollte, und geriet schließlich in eine geradezu übermütige Laune. Plötzlich nahm er die Gitarre von der Wand, stimmte die Saiten und begann ein Lied zu singen.
Auch Luzie hatte ihre Müdigkeit und die ausgestandene Angst längst vergessen. Ihre tiefblauen Augen sprühten vor Fröhlichkeit.
»Bravo, Bruno!«, rief sie und klatschte in die Hände. »Bitte, noch ein Lied!«
Und Bruno sang.
Der Jäger-Barthl leerte einen Krug Bier nach dem anderen und hatte schon ein wenig über den Durst getrunken. Es gefiel ihm gar zu gut in der heiteren Gesellschaft, so dass auch er nicht an Aufbruch dachte – und nun fing er zum Vergnügen der anderen plötzlich an zu jodeln.
So geschah es, dass niemand bemerkte, dass der Wind immer mehr zunahm und sich schließlich zu einem heftigen Sturm entwickelte. Sie wurden erst darauf aufmerksam, als er einen Fensterladen losriss und mit heftigem Gepolter auf- und zuschlug.
Erst jetzt ließ Bruno die Gitarre auf die Knie sinken, und der Jäger-Barthl stellte den Krug auf den Tisch zurück, den er eben an den Mund führen wollte. Erschrocken horchten sie hinaus auf den Sturm – und dann hörten sie den Regen rauschen, so heftig, dass man meinen konnte, das Rauschen und Grollen eines entfesselten Sturzbaches zu hören.
»Sakrament!«, stieß der Jäger-Barthl hervor. »Das wird ein Hochwasser geben!«
Bruno fuhr bei diesen Worten vom Stuhl auf. Mit heißem Erschrecken fiel ihm jetzt ein, dass die Schleuse an der kleinen, mit Wasserkraft betriebenen Säge offen stand. Wenn nun das Hochwasser mit seiner ganzen Kraft in die Säge einbrach, konnte das Werk beschädigt oder ganz zerstört werden.
Die kleine Talsäge, zu der eine roh gezimmerte, fest gefügte Hütte mit einem Wohnstübchen und einer kleinen Schlafkammer gehörte, war ein Bestandteil des Falkenhofes. Sie stand an einem mutwilligen Wildbach, der mit junger, ungehemmter Kraft vom Berg herabstürzte. Wenn dieses Sägewerk auch nur mit altertümlichen Arbeitsvorrichtungen ausgestattet war, so lieferte es doch für die Bauern des Dorfes und auch der näheren Umgebung das ganze Jahr über das nötige Bau- und Schnittholz. Die Arbeit in der Säge war Bruno zugeteilt worden, und nichts in der Welt liebte er so sehr wie diese kleine, idyllische Talsäge.
Hastig zog er deshalb die Mütze über den Kopf und wollte mit einem kurzen Abschiedsgruß zur Tür gehen.
Aber Luzie vertrat ihm den Weg. »Bleib da, Bruno! Du kannst jetzt nicht abfahren!«
»Ich muss heim, Luzie!«
»Es geht nicht mehr, Bruno«, sagte auch Richard, der eben von draußen zurückkam, wo er den Fensterladen wieder befestigt hatte. »Es regnet in Strömen, und der Sturm ist furchtbar!«
Aber es half nichts; Bruno ließ sich nicht aufhalten.
»Der Wildbach wird in kürzester Zeit anschwellen, und ich habe die Schleuse bei der Säge nicht geschlossen. Ich muss daheim sein, bevor das Hochwasser sie ruiniert hat.«
Er stürmte hinaus in die Nacht, wo der Sturm ihm fast die Mütze vom Kopf riss.
Richard und Luzie folgten ihm, aber sie konnten ihn nicht daran hindern, dass er hastig die Skier anschnallte und gleich darauf in der Dunkelheit verschwand.
Sie schauten ihm besorgt nach und hofften, dass er doch noch die Unmöglichkeit der Abfahrt erkennen und zurückkehren würde.
Aber er kam nicht wieder.
»Er ist sehr eigensinnig«, sagte Richard.
Luzie schüttelte den Kopf.
»Nein, Richard, Eigensinn ist das nicht. Er kennt einfach keine Furcht; ich habe es heute erst wieder erlebt. Und er übersteht jede Gefahr mit heiler Haut. Er ist der Alpenkönig!«
Der Bruder schaute sie kopfschüttelnd an.
»Komm!«, sagte er dann.
Sie kehrten in das schützende Haus zurück und horchten aus behaglicher Geborgenheit schaudernd auf das Wüten der entfesselten Naturgewalten.
Nicht jeder hätte es geschafft, durch Nacht und Sturm bei schmelzendem Schnee den Weg ins Tal zu finden. Aber Bruno Schwaiger kannte kein Zaudern. Er musste unbedingt die Schleuse schließen, ehe das ungebändigte Hochwasser durch den Wildbach heranbrauste, und das konnte schneller geschehen, als man sich versah.
Der Weg ins Tal durch den schmelzenden Schnee war nun wirklich gefährlich geworden. Wiederholt stürzte er über Eisschollen. Aber er richtete sich immer wieder auf und fuhr weiter. Endlich kam er schweißgebadet bei der Säge an. Zu seiner großen Verwunderung musste er jedoch feststellen, dass die Schleuse bereits geschlossen war – und doch hätte er schwören können, dass sie offen gestanden hatte, als er zur Kreuzalpspitze aufgebrochen war.
Da sah er oben im Sägestübchen Licht.
War der Vater herübergekommen?
Rasch schnallte Bruno die Skier ab und eilte die schmale Treppe hinauf.
An dem kleinen Tisch in der Ecke saß der alte Falkenhofer, sein Vater. Sinnend blies er den Rauch aus seiner Pfeife vor sich hin und machte ein unzufriedenes Gesicht.
»Guten Abend, Vater! Du bist heute noch herübergekommen?«
»Woher kommst du so spät?«, kam darauf die Frage statt einer Antwort.
»Von der Kreuzalphütte.«
Das Gesicht des Falkenhofers blieb finster.
»Du weißt, dass ich es nicht gern hab, wenn du bei einem solchen Sauwetter in den Bergen herumfährst. Eines Tages wird dir doch noch etwas passieren.«
»Das glaube ich nicht, Vater. Die Berge tun mir nichts!«
»Und die Schleuse vor der Säge hast du auch noch offen gelassen«, sagte der Falkenhofer tadelnd. »Wenn das Hochwasser eingebrochen wäre, hätte es den Antrieb weggerissen.«
»Darum bin ich jetzt so schnell wie möglich von der Hütte zurückgekommen, um dem Hochwasser noch zuvorzukommen. Ich hätte aber wirklich nicht vergessen dürfen, die Schleuse zu schließen, da hast du Recht. Das soll mir nicht noch einmal passieren!«
Der alte Falkenhofer war damit zufrieden gestellt und nickte vor sich hin.
»Dann ist’s gut! Und jetzt setz dich her zu mir, ich hab mit dir ein paar sehr wichtige Dinge zu besprechen. Deswegen bin ich heute auch zu dir gekommen.«
Der Falkenhofer legte die Pfeife weg und strich sich den zähen Bart aus den Mundwinkeln. Die Einleitung zu seiner Rede schien ihm einige Schwierigkeit zu bereiten.
»Bruno«, begann er dann, »sag mal, Bub – und sei aufrichtig –, bist du überhaupt mit deiner Arbeit in der Säge zufrieden? Oder würdest du lieber etwas anderes machen?«
»Was für eine seltsame Frage, Vater! Wie kommst du denn darauf?«
»Ich weiß es eben nicht, deshalb frage ich dich ja. Es ist nun einmal so: Dein Bruder, der Schorsch, wird den Hof übernehmen. Aber auszahlen kann er dich einstweilen noch nicht, dazu ist nicht genügend Geld da. Er wird auf dem Hof auch manches erneuern müssen. Jetzt habe ich mir überlegt, dass du einstweilen die alte Säge übernehmen könntest, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich kann das testamentarisch festlegen, dass sie bei der Hofübergabe aus Schorschs Besitz herausgenommen wird.«
Nun war es heraus, was ihn bedrückte. Er hob den Blick und schaute seinem Sohn ins Gesicht, um die Wirkung seiner Worte zu erkennen.
Aber Bruno zeigte keinerlei Unzufriedenheit; im Gegenteil – sein Gesicht hellte sich auf.
»Damit würdest du mir einen großen Wunsch erfüllen, Vater. Ich habe an der kleinen Säge mehr Freude, als du anscheinend glaubst, und ich möchte mich nicht von ihr trennen.«
»Dann ist’s ja gut!«, sagte der Alte aufatmend. »Ich werde die Talsäge aus dem Besitz, der Schorsch übergeben wird, herausnehmen und dich als Besitzer eintragen lassen.«
Daraufhin stand er auf und knöpfte die Joppe zu. Es bedurfte keiner weiteren Worte mehr zwischen ihnen.
»Ich begleite dich heim, Vater; es ist finster, und der Weg ist schlecht«, sagte Bruno und zog sich ebenfalls seine Jacke nochmals über.
Schweigend gingen sie durch die Nacht. Die Straße war überschwemmt, und unter dem Wasser lag eine schlüpfrige Eiskruste. Dazu kam der Sturm, der die beiden anfiel, sowie sie das Haus verlassen hatten, so dass sie sich seiner Wucht entgegenstemmen mussten. Bruno hielt es für geraten, den alten Vater am Arm zu nehmen und zu führen.
»Morgen Abend will Schorschs Zukünftige mit dem Brautvater kommen, um alles zu besprechen, was vor der Hochzeit und der Hofübergabe nötig ist«, begann der Alte plötzlich. »Es wäre mir recht, wenn du mit dabei wärst.«
»Wenn du es willst, Vater, dann komme ich gerne.«
»Und schau dir die Henriette etwas näher an.«
»Ich kenne sie schon, Vater.«
»Und? Was sagst du?«
»Ehrlich gesagt, ich würde mir eine Falkenhoferin anders vorstellen. Sie hat keine Ahnung von der Arbeit auf einem Bauernhof und wird eine Menge lernen müssen. Aber das macht ja nichts, wenn sie es wirklich lernen will.«
»Glaubst du, sie wird es vielleicht nicht wollen? Das wäre schlimm!«
»Ich weiß es nicht. Sie wirkt auf mich zu städtisch, als dass ich es mir so recht vorstellen könnte. Vielleicht tue ich ihr damit auch Unrecht. Aber wir werden ohnehin nichts daran ändern können, falls es so wäre, Vater. Der Schorsch hat sie ausgesucht und will keine andere. Die Hauptsache ist, dass sie gut miteinander auskommen, alles andere lässt sich notfalls auch mit mehr Angestellten regeln, wenn es gar nicht anders geht.«
»Ja, Bub – hoffen wir, dass Schorsch keinen Fehler gemacht hat, als er gerade die und keine andere haben wollte! Ich habe, ehrlich gesagt, auch ein ungutes Gefühl bei dem Mädchen, deshalb wollte ich deine Meinung wissen.«
Bruno führte seinen Vater bis ans Haus, das dunkel und still in der Nacht lag. In keinem Fenster sah man mehr Licht; alle waren schon zu Bett gegangen. Als sich die Haustür hinter dem Vater geschlossen hatte und in der Stube das Licht aufflammte, kehrte Bruno um und ging wieder auf die Säge zu.
Oft wandte er heute den Blick zurück und hinauf zu dem alten, väterlichen Hof, hinter dem sich das Felsmassiv des Gebirges auftürmte. Der Sturm rauschte durch das Geäst der alten Ahornbäume, die um ein großes Feldkreuz herum aufragten.
Ein Ausdruck grübelnder Nachdenklichkeit überschattete das Gesicht des jungen Falkenhofers. Eine Hochzeit sollte morgen ausgemacht werden. Das sollte eigentlich ein Grund zur Freude sein. Doch sein Vater freute sich nicht. Statt dessen machte er sich Sorgen.
2
Am folgenden Morgen war Bruno Schwaiger schon frühzeitig bei seiner Arbeit in der Säge. Die Bauern hatten mehrere Fuhren Baumstämme angefahren, um Bauholz und Bretter schneiden zu lassen; damit wollten sie die Winterschäden an ihren Häusern und Stadeln beheben, ehe die Arbeit auf den Wiesen und Feldern einsetzte.
Am späten Vormittag kam wie immer die alte Paula, die seit dem Tod der Mutter das Regiment über Haus und Küche im Falkenhof führte, zur Säge herab, um Bruno die Brotzeit zu bringen. Sie brachte auch die kleine Stube in Ordnung und machte sein Bett.
Solange die beiden Söhne Schorsch und Bruno noch klein waren, hatte sie ihnen die Mutter ersetzt – besonders Bruno, dem Jüngeren, den sie von Anfang an in ihr Herz geschlossen hatte.
Trotz ihres Alters schritt sie noch rüstig und aufrecht einher. Ihr kantiges Gesicht verriet Gesundheit, und ihre dürre, zähe Gestalt war von starker Lebenskraft erfüllt. Kein Weg und kein Wetter schreckte sie, keine Arbeit war ihr zu viel oder zu schwer.
Heute trug sie ihre spitze, lange Nase noch einige Zoll höher als sonst. Das war bei ihr ein Zeichen von Trotz und verdrießlicher Auflehnung.
Bruno schaute ihr durch das verstaubte kleine Fenster von der Säge aus entgegen, als sie mit weit ausholenden Schritten auf der überschwemmten Straße herankam.
Dann trat er vor das Tor.
»He, Paula! Warum machst du so ein finsteres Gesicht?«, rief er ihr lachend zu. »Gefällt es dir nicht, dass der Frühling anbrechen will?«
»So ein Sauwetter!«, schimpfte die Paula. »Man sinkt bis an die Knöchel im Matsch ein.«
»Und darüber ärgerst du dich so sehr?«, fragte er zweifelnd und betrachtete erheitert ihr finsteres Gesicht.
Sie gingen hintereinander die schmale Holzstiege zur Stube hinauf.
Paula stellte die Brotzeit auf den Tisch, band eine Schürze um und ging an die Arbeit.
Bruno begann mit dem Essen.
»Die Hochzeit will man heut Abend ausmachen!«, sagte sie plötzlich. In ihrem Gesicht regte sich ein unwilliges Mienenspiel.
»Ich weiß es, Paula. Der Vater war gestern noch bei mir. Er hat gemeint, dass ich dabei sein soll.«
Sie schaute ihn an und stemmte die Hände in die Hüften.
»Wirst du kommen?«
»Vielleicht.«
»Vielleicht? Nein, du musst auf jeden Fall kommen, Bruno!«
»So? Es ist doch aber nicht meine Hochzeit, die ausgemacht wird, Paula!«
»Trotzdem.« Paula suchte ersichtlich nach Worten, um deutlich zu machen, worauf sie hinauswollte, und rang sich schließlich mürrisch den Satz ab: »Ich glaube, das wird etwas werden, wenn die ins Haus kommt!«
»Oho! Hast du so einen Heidenrespekt vor ihr?«, lachte Bruno.
»Den Heidenrespekt werden noch ganz andere vor ihr kriegen! Der Schorsch wird bald nicht mehr recht viel zu sagen haben im Haus, wenn die einmal da ist! Lach jetzt nicht, Bruno. Es ist mein Ernst.«
»Du übertreibst, Paula! Warum meinst du denn, dass es gar so schlimm werden wird?«
Die Alte kam mit geheimnisvoller Miene näher und wollte ihm etwas ins Ohr sagen, aber sie kam nicht mehr dazu.
»Bruno!«, ertönte eine tiefe, laute Männerstimme vom Hof herauf. »He, Bruno!«
Bruno öffnete das Fenster und schaute hinab. Ein Bauer stand dort unten mit einem mit Baumstämmen voll beladenen Bodenschlitten.
Das war der Fallmüller, der im ganzen Dorf als wohlhabendster Bauer der Gegend bekannt war. Doch beliebt war er kaum, neben Geiz und Verschlagenheit wurde ihm auch sein hochfahrendes Wesen zum Vorwurf gemacht. Schon die Art, wie er jetzt laut und ungeduldig den jungen Falkenhofer herausrief, verriet sein rechthaberisches Wesen.
Bruno kannte den Fallmüller und sein Hauswesen gut. Sein Hof lag dem Falkenhof direkt gegenüber, getrennt von ihm durch eine tiefe Mulde, durch die eine Straße führte. Beide Höfe lagen abseits vom Dorf und waren Einödhöfe, deren Grundstücke sich jeweils rings um das Haus erstreckten. Und damit grenzten sie teilweise aneinander.
Auch das Schicksal der Höfe schien sich in einigen Dingen ähnlich entwickelt zu haben: Sowohl der Falkenhofer als auch der Fallmüller hatten frühzeitig ihre Bäuerinnen verloren – und beide waren Witwer geblieben. Während es jedoch auf dem Falkenhof zwei Söhne gab, hatte der Fallmüller nur eine einzige Tochter. Sie war ein paar Jahre jünger als Bruno; doch sie waren noch zusammen in die Schule gegangen. Und während der Falkenhofer durch Nachlassen seiner Kräfte schon jetzt zur Übergabe des Hofes gezwungen wurde, hatte der Fallmüller im selben Alter immer noch eine eiserne Kraft und Gesundheit, als hätte die Zeit überhaupt keine Gewalt über ihn.
Bruno stieg die Treppe hinab, trat auf den Hof hinaus und half dem Mann dabei, die entrindeten Baumstämme vom Schlitten zu rollen.
»Zweizöllig schneiden!«, ordnete der Fallmüller an. »Und übermorgen möchte ich die Bretter abholen. Geht das?«
»Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, geht das schon«, entgegnete Bruno und zeichnete mit einem Rötel die Baumstämme an.
Der Fallmüller blieb noch stehen und schaute ihm dabei zu; er wollte offenbar noch mehr sagen. Dann schob er den Hut aus der Stirn und kratzte sich im Haar.
»Ist es richtig, dass dein Bruder bald heiratet?«, fragte er dann unvermittelt.
»Ja, es ist richtig.«
»Die vom Ostrachtal?«
»Ja.«
Der Fallmüller machte eine Bewegung zu seinem Fahrzeug hin – aber dann wandte er sich noch einmal zu Bruno herum.
»Wenn man weit greift und nicht weiß, wohin man greift, dann greift man gewöhnlich in Dreck, Bruno!«, sagte er in seiner derben Art.
»Was willst du mir damit sagen, Fallmüller?«, warf ihm Bruno noch die Frage hinterher.
Der Fallmüller wendete sein Gefährt und rief, schon im Wegfahren, über seine Schulter hinweg zu Bruno zurück: »Genau das, was du verstanden hast! Also bis übermorgen!«
Bruno schaute dem Fallmüller nach. Dessen Rede wollte ihm nicht gefallen; sie war grob und gehässig gewesen. Freilich – der Fallmüller sah sich durch Schorschs Heirat vielleicht in seinen Plänen enttäuscht. Man hatte einige Zeit lang davon gesprochen, dass seine Tochter Wally eine passende Bäuerin für den Falkenhof sein könnte. Vielleicht hatte der Fallmüller sich mit dem ehrgeizigen Plan getragen, die beiden Einödhöfe zusammenzulegen und ein prächtiges Gut daraus zu machen.
Doch Schorsch hatte sich für eine andere entschieden, die seine künftige Bäuerin werden sollte. Und wenn der Schorsch damit »in Dreck greifen« sollte, dann ging es den Fallmüller ebensowenig an wie andere Menschen.
Die Fallmüller-Wally war schon ein recht tüchtiges und anständiges Mädchen, und hässlich war sie auch nicht. Mancher junge Bursch drehte sich nach ihr um, wenn sie sonntags von der Kirche kam. Aber man konnte schließlich nicht einfach dem Schorsch befehlen, er müsse sie heiraten. Er selbst hätte das an seiner Stelle auch nicht getan – nicht zuletzt auch deshalb, weil der Fallmüller ihr Vater war.
Während Bruno immer noch in Gedanken verloren die Straße hinaufschaute, auf der eben der Fallmüller davongefahren war, tauchte hinter der Säge ein junger Mann auf, der sich durch seine Kleidung und die umgehängte Büchse als Forstmann auswies.
Dieser junge Jäger war Robert Haller, der in den Diensten des staatlichen Forstamtes kurz vor Abschluss seiner dortigen Ausbildung stand. Als leidenschaftlicher Bergsteiger hatte er sich an Bruno angeschlossen, und aus der Bergkameradschaft war mit der Zeit eine Freundschaft erwachsen. Sie führte dazu, dass Robert auch bei der kleinen Theatergruppe des Dorfes Hochwies mitwirkte, der Bruno als eifriger Laienspieler angehörte.
»Bruno!«, rief der Jäger und kam näher.
Bruno wandte sich nach ihm um, und sein Gesicht entspannte sich.
»Ach, du bist’s, Robert! – Wo kommst du denn heute schon so früh her?«
»Von der Kreuzalpspitze. Ich soll dir einen schönen Gruß bestellen.«
»Von wem?«
»Von wem wohl, wenn man von der Kreuzalphütte kommt! Du scheinst gestern wieder einmal ein gewagtes Stück geliefert zu haben.«
»Hat dir die Luzie davon erzählt?«
»Sie hat jedem davon vorgeschwärmt, der bereit war, ihr zuzuhören. Du seist der Alpenkönig, meint sie«, sagte er schmunzelnd.
Auch Brunos Gesicht heiterte sich auf. »Alpenkönig!«, sagte er lächelnd. »Das hat sie zu mir gestern Abend auch schon gesagt. Dabei war die Sache so großartig nun auch wieder nicht.«
»Na, ich hätte es jedenfalls nicht gewagt, einer Lawine vor den Füßen herumtanzen!«
»Ich würde dir das auch nicht raten!«, erwiderte Bruno. »Glaub du bloß nicht, dass ich es getan hätte, wenn ich eine andere Möglichkeit gesehen hätte, mit heiler Haut von dort wegzukommen.«
Robert stieß Bruno in die Seite und zwinkerte ihm zu. »Ich glaube, Bruno – ich glaube, die Luzie hat sich in dich verliebt.«
»Soll das ein Scherz sein, Robert?«, fragte Bruno und gab sich Mühe, sich das freudige Herzklopfen nicht anmerken zu lassen, das ihn bei diesen Worten jäh überfallen hatte. So dicht davor war er gestern gewesen, ihr seine Liebe offen zu gestehen, und doch hatte er wie ein Holzkopf die Gelegenheit wieder verstreichen lassen!
»Keineswegs. Hättest du denn etwas dagegen?«, schmunzelte Robert, der ja schon längst begriffen hatte, dass Bruno und Luzie sich zueinander hingezogen fühlten und vermutlich früher oder später ein Paar werden würden, auch wenn sie immer noch vorgaben, nur kameradschaftlich und in aller Freundschaft miteinander zu verkehren.
Bruno antwortete nicht. Er horchte zur Säge hinunter, in der eben ein Baum aus dem Vollgatter gelaufen war. Es musste ein neuer Stamm eingelegt werden; deshalb ließ er den Freund stehen und lief in die Säge.
»Wir studieren übrigens demnächst ein neues Theaterstück ein«, sagte Robert, als sie wieder beisammen waren. »Heute Abend ist eine Besprechung, und dann beginnen die Proben. Kommst du auch?«
»Nein, ich muss heute Abend heim. Die Hochzeit meines Bruders wird ausgemacht«, entgegnete Bruno.
»Ach so – dann freilich! Aber du spielst doch mit?«
»Ich spiele natürlich mit!«
Von droben rief die Paula, Bruno solle doch endlich seine Brotzeit zu Ende bringen.
»Ich komm schon, Paula!«, rief Bruno hinauf.
Robert Haller klopfte ihm auf die Schulter.
»Mach’s gut, Bruno! Und entschuldige, falls ich dir mit meiner Bemerkung über Luzie zu nahe getreten sein sollte …«
Bruno lachte. »Nein, das bist du auf keinen Fall, Robert.«
»Das hoffe ich doch. Aber das sage ich dir, ihr zwei wäret schon ein schönes Paar – du und die Luzie vom Kreuzalphaus – der Alpenkönig und das goldene Herz!«
Lachend trennten sich die Freunde.
Als der Abend kam, stand im Hofraum des Falkenhofes unter den drei alten Ahornbäumen ein fremdes Auto. Besuch war angekommen – ein sehr wichtiger Besuch.
An dem Tisch im Herrgottswinkel saßen vier Menschen beisammen und erörterten wichtige Dinge. Da war der Falkenhofer und neben ihm sein Sohn Schorsch; den beiden gegenüber saß ein Mädchen in städtischer Kleidung, und neben ihm hatte der Brautvater Platz genommen.
Sie hörten eben schweigend dem alten Bauern zu, der langsam und bedächtig eine Reihe von Gründen aufzählte, die ihn veranlassten, zum Frühjahr den Hof an seinen Sohn zu übergeben. Sein Blick glitt immer wieder forschend über das Gesicht des Mädchens, das sein Sohn heiraten wollte.
Henriette entging diese augenscheinliche Prüfung des alten Bauern keineswegs, und sie ließ sie selbstbewusst über sich ergehen. Ihr Vater war ein bekannter Viehhändler mit einem schönen, modernen, erst wenige Jahre alten Haus im Ostrachtal.
Sie wusste von Schorsch, dass ihr künftiger Schwiegervater Bedenken hatte, weil sie nicht aus einer Bauernfamilie stammte und die Arbeit auf einem Hof wie dem Falkenhof nicht gewohnt war. Henriette war empört gewesen, als Schorsch ihr das erste Mal davon erzählt hatte. Warum sollte sie nicht imstande sein, diese Arbeit zu tun? Aber Schorsch hatte nur gelacht, und so hatte sie schließlich mit eingestimmt und gemeint: »Was ich nicht kann, das kann ich ja lernen, oder? Du musst es mir nur zeigen.«
Und beide waren sich einig gewesen, dass alles sich finden würde, wenn sie nur erst einmal verheiratet waren. Schließlich liebten sie sich, und das war doch die Hauptsache.
Unter dem Tisch tastete das Mädchen verstohlen mit dem Fuß nach dem von Schorsch und blinzelte ihm zu, als sie ihn erreicht hatte und er zu ihr hinübersah. Schorsch, der ohne großes Interesse den beiden Alten zugehört hatte, sah auf, lächelte und blinzelte zurück.
In seiner äußerlichen Erscheinung glich Schorsch sehr seinem Bruder Bruno. Nur sein Haar war dunkler, und seine Gesichtszüge waren weniger markant gezeichnet; er wirkte nachgiebiger und weniger entschlossen.
»Und viel Arbeit gibt es auf dem Hof«, sagte eben der alte Falkenhofer. »Auch die Bäuerin muss fest mit anpacken. Deswegen brauchst du mich jetzt nicht so finster anzuschauen, Henriette; ich will dir damit keineswegs unterstellen, dass du nicht arbeiten kannst, sondern ich wollte nur noch einmal ohne Umschweife betonen, dass ein Berghof kein Platz ist, auf dem man es sich allzu bequem machen kann. Der Hof wird schuldenfrei an euch übergeben, wenn man einmal davon absieht, dass dem Bruno noch sein Anteil ausgezahlt werden muss, und damit habt ihr beide einen günstigen Anfang. Wenn ihr gut wirtschaftet, dann kann eigentlich nichts schief gehen.«
Danach war es eine Weile still. Jeder schien über die Dinge nachzudenken.
»Dann ist doch auch noch eine Säge da«, sagte schließlich der Viehhändler. »Was ist damit?«
»Die Säge wird vom Hof abgetrennt, die übergebe ich dem Bruno«, antwortete der Falkenhofer. »Damit ist auch ein Teil seiner eigenen Erbansprüche schon getilgt. Was den Rest betrifft, so werde ich testamentarisch eine Zahlung in mehreren Teilzahlungen festlegen, beginnend ab dem Jahr meines Todes.«
Darauf erfolgte kein Einspruch.
Nach dem Essen führte Schorsch seine Braut durch das Haus, und sie kamen dabei auch in die Küche.
Paula, die eben das Geschirr spülte, trat ein wenig beiseite, ohne sich in ihrer Arbeit stören zu lassen. Ihr Blick streifte nur zuweilen missbilligend die Braut, die ihrer Ansicht nach kritischer als nötig diesen wichtigen Raum der Hausfrau musterte.
Und die Braut nahm ihre Prüfung offenbar sehr genau. Sie musterte die Wandrahmen, in denen die Töpfe säuberlich nach der Größe eingeordnet waren, sie betrachtete die blinkenden Kupfer- und Messingpfannen, die über dem großen Kachelofen hingen, und es schien ihr kein Gegenstand zu entgehen.
Schorsch beobachtete ihr Gesicht.
»Nun, wie gefällt’s dir bei uns?«, fragte er dann – in der sicheren Meinung, dass hier bestimmt nichts auszusetzen sei.
»Im Großen und Ganzen nicht schlecht«, antwortete sie und schaute dann über den roten Boden hin. »Aber ihr habt ja noch einen alten Steinboden! Sollte man da nicht einen PVC-Boden darüberlegen? Das ist viel schöner und bequemer zum Putzen.«
Sie hatte ihren Blick bereits einem weiteren Mangel zugewandt: »Der Herd hier muss ja schon mindestens dreißig Jahre alt sein, und gespült wird bei euch wohl noch von Hand, oder? Und die Kücheneinrichtung finde ich unpraktisch angeordnet, da muss man ja andauernd hin- und herlaufen, von der Spüle zum Herd und wieder zurück. Wenn beides direkt nebeneinander ist, spart man sich eine Menge Zeit, Schorsch. Daheim, da haben wir eine Einbauküche mit Glaskeramikkochfeld und Dunstabzugshaube, und eine Spülmaschine ist auch integriert, und eine Mikrowelle. Wir haben einen Küchenspezialisten alle Einzelteile der Küche nach ergonomischen Gesichtspunkten optimieren lassen.«
Da verließ die alte Paula die Küche. Sie musste es tun, denn sonst hätte sie Henriette etwas an den Kopf werfen müssen. Ergonomische Gesichtspunkte! Da hörte sich doch alles auf!
Als sie durch den langen breiten Hausflur schritt, um sich irgendein Geschäft zu suchen, das sie in möglichst sichere Entfernung von der Frevlerin brachte, die gerade ihr Heiligtum, die Küche des Hofes, so entweiht hatte, kam eben Bruno herein.
»Wo sind sie, Paula?«, fragte er. »Ich habe das Auto schon gesehen.«
»Sie sind gerade in der Küche – sie und der Schorsch. Kritisieren tut sie. Der alte Steinboden ist ihr nicht fein genug. Eine neue Küche mit ärgernomischen Gesichtspunkten von einem optimistischen Küchenspezialisten will sie haben, das überspannte Frauenzimmer!« Ihre Stimme, anfangs leise, wurde immer lauter und erregter, während sie sprach.
»Pst! Paula!«
»Es ist doch wahr!«, schimpfte die alte Frau, die maßlos darüber gekränkt war, dass ihre Küche so bekrittelt worden war. »Weißt du, wie lange ich in dieser Küche schon koche? Ich war immer zufrieden damit, und jetzt kommt die da daher und sagt, unsere Küche sei unpraktisch. Eine Spülmaschine will sie haben, und eine Dunstabzugshaube, und was weiß ich noch alles!«
»Ist ja gut, Paula! Sei bloß still!«
Bruno ließ sie stehen und ging in die Stube. Er begrüßte den Brautvater und setzte sich auf einen Stuhl neben dem eigenen Vater nieder. Gleich darauf kehrte das Brautpaar von seiner Inspektionsreise zurück.
Alle fünf setzten sich um den Tisch unter den Efeuranken des Herrgottswinkels. Die Ansprüche Brunos am väterlichen Erbe wurden besprochen, und man kam überein, dass der Restbetrag, der diesem neben der Säge zustehe, erst nach dem Tode seines Vater fällig und danach in mehreren Teilzahlungen beglichen werden sollte. Der Tag der Hochzeit wurde festgesetzt. Man einigte sich darauf, dass er noch vor Beginn der Fastenzeit sein sollte, und das Brautpaar wollte möglichst rasch den Ortspfarrer aufsuchen, damit alles seinen geregelten Weg gehen konnte.
In den folgenden Wochen ging es im Falkenhof drunter und drüber. Die Maurer hatten Gerüste errichtet und tünchten die altersgrauen Wände. Türen und Fensterläden wurden frisch gestrichen. So wollte es der Brauch: Vor der Übergabe musste der Hof innen und außen erneuert werden.
Gleichzeitig schaffte der alte Falkenhofer seine Habe hinüber in das Pfründhäuschen, wo er seinen Lebensabend verbringen wollte. Er war vernünftig genug, sich schon jetzt zurückzuziehen und dem Sohn die Leitung der Erneuerungsarbeiten zu überlassen. Und Schorsch Schwaiger, der junge Falkenhofer, hatte sich alle Wünsche seiner Braut zu Herzen genommen und suchte ihnen nach Möglichkeit gerecht zu werden. Auch die Küche wurde von Grund auf nach ihren Wünschen modernisiert, und der Küchenspezialist, von dem sie bei der Besichtigung des Hofes gesprochen hatte, kam tatsächlich dabei zum Einsatz.
Doch der alte Bauer stand während all dieser Betriebsamkeit oft am Fenster seiner Austragsstube und schaute versonnen über die Berge hin, die bereits einen neuen Frühling ankündigten. Er sah, wie das erste Grün auf den schneefreien Hängen zu sprießen begann, er sah den Krokus und den Enzian blühen, er sah das Erwachen der Natur. Und wenn er in sonnigen Stunden das Fenster öffnete, dann hörte er das Rauschen und Gurgeln der Wildbäche.
All das hatte er sein Leben lang gesehen – und doch war nun alles anders: Er hatte die Verantwortung für seinen Hof an seinen Sohn abgegeben. Es war hoch an der Zeit dafür gewesen, denn mit seiner Gesundheit stand es nicht zum Besten. Und dennoch war ihm das Herz schwer.
Bruno Schwaiger war auf dem Weg durch die Höhenklamm hinauf zur Kreuzalphütte. Mit lautem Getöse schoss der übermütige Wildbach über die glatt gewaschenen Felsbänke.
Bruno stand eine Weile nahe am Grat und schaute gedankenverloren auf das wilde, schäumende Wasser hinab. Es ging ihm dieser Tage viel durch den Kopf. Der Umzug des Vaters bereitete ihm Kummer. Freilich war es unumgänglich, dass die Alten Platz machen mussten für die Jungen – aber es tat Bruno halt weh, den Vater so ungern und bekümmert von der Arbeit scheiden zu sehen.
Auch über seinen Bruder und dessen Frau, die neue Bäuerin, dachte er nach. Es war offensichtlich, wie verliebt die beiden ineinander waren, und er konnte Henriette auch nicht absprechen, dass sie sich bisher Mühe gab, alles, was sie als Bäuerin zu tun hatte, gut und richtig zu machen.
Dennoch, sie war in vieler Hinsicht ihrer Aufgabe kaum gewachsen. Dass sie Paula schon gleich zu Anfang so bitter gekränkt hatte, machte die Sache nicht besser. Denn Paula war nachtragend, und auch wenn sie Henriette nicht offen widersprach, so hätte sie der jungen, unerfahrenen Bäuerin so manchen dummen Schnitzer ersparen können. Doch das tat sie nicht, denn es bereitete ihr Genugtuung, wenn die Gegnerin bei einem handfesten Fehler ertappt wurde.
Henriette hatte durchaus gemerkt, dass die alte Haushälterin nicht gut auf sie zu sprechen war. Doch sie unternahm keinen Versuch, mit ihr ins Reine zu kommen, sondern gab sich alle Mühe, ihrer Feindin bei jeder Gelegenheit klar zu machen, wer von beiden auf dem Hof das Sagen hatte. Dabei hätte sie den Rat der erfahrenen alten Frau so bitter nötig gehabt. Doch ihr Stolz verbot Henriette, das zuzugeben, und so schwelte der Groll der beiden unausgesprochen weiter, zum Schaden für den Hof und alle, die dort lebten.
Bruno vermied es inzwischen, den Hof aufzusuchen, denn meist konnte man die Spannung, die dort herrschte, förmlich mit Händen greifen. Seinen einzigen Versuch, zwischen Henriette und Paula zu vermitteln, hatten beide Frauen ihm übel genommen, deshalb zog er es vor, sich so weit wie möglich aus ihrem Streit herauszuhalten.
Trotz aller Bemühungen, beiden in seinem Urteil Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, konnte er nicht umhin, Paulas Klagen im Geiste Recht zu geben. Henriette war seiner Meinung nach ein verzogenes junges Ding, das im väterlichen Haushalt weitgehende Narrenfreiheit gehabt und kaum Verantwortung getragen hatte. In ihrer Rolle als Bäuerin wirkte sie wie ein Kind, das ein neues Spiel ausprobierte. Noch hatte der Falkenhof als Spielzeug für sie den Reiz nicht verloren. Was aber, wenn sie eines Tages keine Lust mehr auf dieses Spiel hatte?
Von der gegenüberliegenden Höhe ertönte plötzlich ein lautes, in seinen Ohren höhnisch klingendes Gelächter, als hätten böse Geister Bruno bei seinen Gedanken belauscht und amüsierten sich nun über die Zustände auf dem Falkenhof.
Bruno blickte auf, um nach dem Spötter Ausschau zu halten, und nach einigen Augenblicken entdeckte er eine Gestalt, deren Aussehen den Vorstellungen von einem bösen Berggeist nicht allzu weit entfernt war. Sie stand vor dem so genannten »Wilden Männle«, einem gezackten, grotesk geformten Felskopf, an den sich etliche Sagen um wegen böser Taten verzauberte Menschen knüpften. Das war der Geyer-Franz, ein Sonderling, der einsam in einer abgelegenen, halb zerfallenen Berghütte hauste. Der Geyer-Franz galt als harmlos, doch sein seltsames Benehmen und dazu sein verlottertes Aussehen schreckten die Leute ab. Er war ein noch junger Mann um die Dreißig, doch er ließ sich selten im Dorf sehen.
Es hieß, sein Vater sei ein gefährlicher Wilderer gewesen, der auf frischer Tat ertappt und erschossen worden sei, als der Franz noch ein kleiner Junge gewesen war. Die Mutter hatte ihn alleine großgezogen, doch der Gram hatte sie verbittert und menschenscheu gemacht und dann später, wie es im Dorf hieß, frühzeitig ins Grab gebracht.
So war es kein Wunder, dass auch der Franz ein sonderbarer Zeitgenosse war. Er züchtete Bergziegen, und davon ernährte er sich, so gut es eben ging. Seine Hütte lag hinter den Wäldern auf einer steinigen Bergwiese, und von den Menschen im Dorf wollte er so wenig wissen wie sie selbst von ihm. Und der wollte sich über ihn lustig machen? In Bruno stieg der Zorn auf.
»Was hast du da zu lachen, du Depp?«, schrie er laut, um das Rauschen des Wildbaches zu übertönen.
Der Geyer-Franz wich sofort von der Höhe zurück und verschwand.
Bruno ging weiter und schämte sich plötzlich seines Zornes gegen den anderen.
Warum sollte der Mann dort nicht lachen dürfen, nur weil Bruno selbst so düster zumute war? Schließlich hatte der Geyer-Franz keine Ahnung von Brunos Sorgen und freute sich wahrscheinlich nur über den Frühling.
Immerhin lenkten diese Überlegungen Bruno von seinem Grübeln über die missliche Lage auf dem Falkenhof ab. Wie oft war er dem Geyer-Franz schon begegnet auf seinen Bergfahrten – bei jeder Tag- und Nachtzeit schon. Doch sie hatten sich gegenseitig nie beachtet. Was mochte im Kopf dieses sonderbaren Menschen vorgehen?
Bruno nahm sich vor, sich nicht noch einmal von seiner gereizten Stimmung zu solch ungerechtem Zorn hinreißen zu lassen.
Für die Bewohner der Kreuzalphütte war die Zeit der Schneeschmelze eine einsame Angelegenheit. Das Gebirge war in dieser Zeit so unwegsam, dass sich kaum ein Mensch bei ihnen einfand, höchstens einmal der Jäger-Barthl, wenn er seinen Dienstgang durch das Revier machte.
Luzie beschäftigte sich in diesen Tagen mit allerlei Dingen des Haushaltes, zu denen sie zu anderen Zeiten nicht kam. Die kleine Gaststube wurde in eine Näh- und Flickstube verwandelt.
Aber ihre Arbeit war von einer merkwürdigen Unruhe begleitet. Immer wieder suchte ihr Blick das Fenster, um hinauszuschauen auf den schmalen Weg, der ins Tal führte.
Sie wartete auf Bruno. Er war lange nicht mehr gekommen, und sie begriff erst jetzt so richtig, wie sehr ihr seine Gesellschaft fehlte.
Es verging ein Tag nach dem anderen, doch Bruno kam nicht. Aber als er dann endlich doch auftauchte, sah sie ihn gar nicht kommen; plötzlich und unvermutet trat er in die Stube.
»Grüß dich Gott, Luzie!«, ertönte seine Stimme hinter ihr.
Sie sprang in freudiger Überraschung auf und drehte sich zu ihm um. »Bruno!«
Der Besucher schmunzelte über ihre offensichtliche Freude über sein Auftauchen. »Hast du denn auf mich gewartet?«
Luzie nickte. »Und wie! Du bist schon eine Ewigkeit nicht mehr bei uns gewesen!«
Sie rückte einen Stuhl für ihn zurecht.
»Mein Vater hat meinem Bruder den Hof übergeben, und der hat geheiratet. Es gab eine Menge zu tun, auch für mich«, sagte er.
Er erzählte ihr, was sich seit ihrem letzten Zusammensein alles zugetragen hatte, aber es blieb ihr nicht verborgen, dass in dieser Sache irgend etwas nicht stimmte. Mit feinem Gespür hörte sie einen verborgenen Kummer heraus.
»Ist etwas nicht in Ordnung?«, fragte sie, als er schließlich schwieg. »Mir scheint, es gibt bei dieser Sache etwas, das dich bedrückt, Bruno.«
»Das mag schon sein. Es geht einem manchmal etwas gegen den Strich.« Er machte eine fahrige Bewegung, als hätte er es satt, darüber zu sprechen. »Und was treibt ihr hier auf der Hütte? Es ist wohl recht einsam geworden?«, fragte er ablenkend.
Da fing auch sie an zu erzählen von ihrem Tun und Treiben an den einsamen Tagen. Sie wusste von ein paar Hänseleien zwischen dem Jäger-Barthl und dem jungen Robert Haller zu berichten, die als Einzige zur Kreuzalphütte gekommen waren. Der Jäger-Barthl betreute ein umfangreiches Waldgebiet in den Bergen, das in Gemeindebesitz und an einen privaten Jagdherren verpachtet war, daran angrenzend befand sich der Staatswald, für den andere Leute, Staatsbedienstete, zuständig waren, darunter der junge Auszubildende Robert Haller. Wenn die beiden zusammentrafen, die gewissermaßen Konkurrenten in ihrem Gewerbe waren, dann kam es jedes Mal zu scherzhaften Sticheleien, doch Robert Haller konterte Barthls bissige Bemerkungen meist so schlagfertig, dass der Barthl oft am Ende einen hochroten Kopf bekam und seinen jungen Widersacher einen Grünling und Angeber nannte.
Je länger Bruno ihr zuhörte, desto mehr fühlte er, wie seine Sorgen von ihm abfielen. Wie gut tat es doch, endlich einmal wieder bei Luzie in der Hütte zu sitzen, ohne pausenlos über die Probleme des Falkenhofs nachzudenken! Er musste zusehen, dass er öfter Gelegenheit bekam, diese Gedanken von sich abzuschütteln.
»Schade, dass ich gleich wieder heimkehren muss, Luzie«, sagte er mit ehrlichem Bedauern.
»Ja, das ist schade«, erwiderte sie.
Er überlegte einen Moment und sagte dann: »Wenn das Wetter am Sonntag schön ist, dann könnten wir einen Ausflug hinüber zur Geißalpe machen. Sie ist wieder bewirtschaftet. Hast du Lust?«
»Gern!«, antwortete sie mit freudiger Zustimmung.
»Also – sag dem Richard einen schönen Gruß! Bis zum Sonntag! Ich werde dich hier abholen.«
Rasch drückte er ihr die Hand, und ehe sie ihm vor die Tür hinaus folgen konnte, sprang er schon über die Felsblöcke den Hang hinab.
3
Im Wirtshaus des Gebirgsdorfes Hochwies saßen vier Männer in der kleinen, überheizten Gaststube in gemütlicher Unterhaltung beisammen, während draußen die Abenddämmerung langsam in die Nacht überging. Bald sollte im großen Nebenraum, der je nach Bedarf für Hochzeiten und andere Feste oder zum Theaterspiel genutzt werden konnte, die Probe für das neue Theaterstück beginnen.
Da war der schweigsame, nachdenkliche Manzen-Max mit seinen ergrauenden, widerspenstigen Locken. Er war hauptamtlicher Holzwart für die Gemeindewälder von Hochwies und spielte leidenschaftlich gern Theater. Neben ihm saß der finster wirkende Hessen-Michl, ein Schreinermeister, der auf der Bühne so trefflich den Typ des gallenbitteren Grantlbauers darzustellen wusste, der je nach Inhalt des Theaterstücks Tochter oder Sohn, seiner Frau oder auch den Nachbarn das Leben sauer machte. Der Dritte war der Baulen-Xaver, von Beruf Schuster; er verfügte über ein ausgeprägtes komisches Talent und war so zu einer beliebten und unentbehrlichen Bühnengestalt geworden. Das Wort führte Vinzenz Stadler, ein pensionierter Zollinspektor mit einem wohlgerundeten Bäuchlein, einer polierten Totalglatze und kleinen beweglichen Augen hinter breitumrandeten Brillengläsern. Er hatte nach seiner Pensionierung Hochwies zu seiner Wahlheimat erkoren und sich auf einem Hügel hinter dem Dorf ein schmuckes Haus gebaut. Da er ein großer Freund des Laienspiels war, hatte es sich ganz von selbst ergeben, dass er zum Spielleiter der Hochwieser Theatergruppe wurde, und er versah dieses Ehrenamt mit ebenso viel Eifer wie Freude.
Diese vier Männer fanden sich jeweils schon eine gute Stunde vor Beginn der Theaterproben ein; sie hatten das Bedürfnis, vorher noch einen Krug Bier zu trinken und nebenbei die kleinen Ereignisse im Dorf zu besprechen.
Es gab wie so häufig nicht viele Neuigkeiten in Hochwies, und vor allem keine wirklich aufregenden, denn die Leute von Hochwies waren ein friedliches Völkchen. Und doch fanden die vier Männer immer genügend Stoff zu gemütlicher Unterhaltung.
Augenblicklich war es die Hochzeit im Falkenhof, über die man reden konnte. Viele waren davon überrascht worden, denn man hatte eigentlich damit gerechnet, dass der Falken-Schorsch die Wally, die Tochter des Fallmüllers, heiraten würde. Und nun hatte der junge Bauer seine Braut von auswärts geholt.
Das war immerhin ein Anlass zu lebhaften Diskussionen.
»Es hätte mich eigentlich auch gewundert, wenn der junge Falkenhofer dieses schüchterne Mauerblümchen geheiratet hätte!«, spottete der Baulen-Xaver. »Und außerdem ist es nicht gerade verlockend, den Fallmüller zum Schwiegervater zu kriegen.«
»Aber das Geld hätte er doch sicher brauchen können«, entgegnete der berechnende Hessen-Michel. »Ich hätte mir das an seiner Stelle schon gründlich überlegt. Und dass er sich ausgerechnet eine von so weit her gesucht hat! Gibt es denn bei uns kein Mädchen, das als Falkenhoferin geeignet wäre?«
Und so gingen die Meinungen eine Weile hin und her, bis dann der Zollinspektor die Diskussion beendete:
»Wenn der Nachbar die Nachbarin heiratet, der Sohn des Oberbauern die Tochter des Unterbauern – wenn also die Jungen alle nur über die Straße heiraten, wie es in Hochwies seit eh und je so häufig der Fall ist –‚ dann kann es mit der Zeit keine gesunden Nachkommen mehr geben. Inzucht nennt man das, und was das bedeutet, weiß jeder von uns. Es gehört wieder mal frisches Blut ins Dorf! Deshalb kann ich dem Schorsch nur Recht geben, wenn er sich eine Frau nimmt, die nicht von hier stammt. Schließlich will er auch einmal gesunde Kinder haben.«
Nach diesen aus voller Überzeugung gesprochenen Worten griff Herr Stadler nach seinem Krug und nahm einen kräftigen Schluck.
Wer wollte ihm da noch widersprechen? Es war so, wie Herr Stadler gesagt hatte, zur Hälfte waren die Dorfbewohner untereinander verschwägert und verwandt.
Der heitere Baulen-Xaver glaubte schließlich, Herrn Stadler doch eine Entgegnung schuldig zu sein.
»Aber von einer Frau aus dem eigenen Dorf weiß man genug, um sich sicher sein zu können, was sie kann«, gab er zu bedenken. »Nach allem, was man hört, lässt sich die neue Falkenhoferin nicht besonders gut an, und eine eingebildete Gans soll sie auch noch sein. Ich sage euch, dem Falkenhof stehen keine guten Zeiten bevor mit einer solchen Bäuerin. Wie das Sprichwort sagt: Wenn der Teufel nicht anders an einen Mann herankommt, dann steckt er sich hinter …«
Er brach mitten im Satz ab, als jemand ihm kräftig gegen das Schienbein stieß, und er begriff, dass dieser ihn zum Schweigen zu bringen versuchte. Ein Blick auf die offen stehende Tür zeigte dem Xaver, dass Bruno, der plötzlich erschienen war, bereits alles, was er gesagt, mit angehört hatte. Verlegen rutschte er auf seinem Stuhl hin und her.
Bruno kam näher und trat an den Tisch. Er schaute dem Xaver ins Gesicht.
»Sprich es ruhig aus«, sagte er. »Wenn der Teufel nicht anders an einen Mann herankommt, dann steckt er sich hinter ein hübsches Frauenzimmer! Das wolltest du doch sagen – oder nicht?«
Die Unterhaltung drohte ungemütlich zu werden.
»Das sind eure Familienangelegenheiten und gehen andere nichts an«, sagte der Zollinspektor, um den drohenden Streit abzuwenden. »Wir wollen mit der Probe anfangen.«
Vom Gang her hörte man Stimmen und das Auflachen der Mädchen, und auf der Stiege, die zum Saal hinaufführte, ertönte ein Gepolter. Die Theatergruppe war im Anmarsch, und die vier Männer tranken ihre Krüge leer. Bruno stand noch da und grübelte vor sich hin. Da fühlte er eine Hand auf seiner Schulter. Es war Herr Stadler.
»Lass es gut sein, Bruno! Wenn irgendwo geheiratet wird, gibt es immer Geschwätz unter den Leuten«, sagte er beschwichtigend. »Was im Falkenhof geschieht, geht allein euch an! Die Hauptsache wird sein, dass du bleibst, was du bis heute bist: ein wackerer Bursche, ein Falke, der sein Nest verteidigt, wenn es sein muss. Komm, wir wollen zur Probe gehen.«
Trotz der aufmunternden Rede des Zollinspektors konnte sich Bruno nicht aus seinen bekümmerten Gedanken lösen. Gerade diese freundlichen Worte hatten ihm erneut gezeigt, dass nicht nur er sich Gedanken über die Zukunft des Falkenhofes machte; auch andere, fremde Leute, die es nicht näher anging, redeten über die neue Bäuerin, und sie wussten über sie nichts Gutes zu sagen. Würde sie jemals eine Frau werden können, wie sie der Falkenhof brauchte?
Bruno riss sich zusammen, als er merkte, dass den anderen seine Zerstreutheit aufzufallen begann, denn sonst fanden ja die Theaterproben stets seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Nun, da er sich wieder in der Gewalt hatte, begann er, Spaß an seiner Rolle zu bekommen, und die Probe, die sich bis dahin unlustig dahingeschleppt hatte, nahm jetzt endlich den Verlauf, auf den der Zollinspektor gehofft hatte.
Als die Probe schließlich beendet war, blieben einige der jungen Spieler noch in dem Theatersaal zurück. Bruno wechselte ein paar freundliche Worte mit seiner Partnerin, der Tochter des Zollinspektors. Luise Stadler, die modisch gekleidet war und mit ihrem braun gelockten Bubikopf gut aussah, und er unterhielten sich angeregt, als sich ihnen Robert Haller näherte.
»Nun, Fräulein Stadler, was sagen Sie zu Ihrem Partner? Ist er nicht der geborene Heldenspieler – unser Alpenkönig?«
»Alpenkönig?«
Der junge Forstmann zwinkerte ihr zu. »So hat ihn ein hübsches Mädchen genannt, und die Bewusste wird wohl wissen, warum.«
Als er unmittelbar danach die Tochter des Zollinspektors fragte, ob er sie heimbegleiten dürfe, ging Bruno ein Licht auf, wieso Robert in ihrem Beisein auf Luzie angespielt hatte. Er wollte ihn damit vorsorglich als Konkurrenten um die Gunst der Zollinspektorstochter ausschalten! Bruno schmunzelte, als er den Theatersaal verließ und seinen Heimweg antrat.
Mit raschen Schritten ging er durch die Gassen des Dorfes auf die Landstraße. Der föhnige Wind trieb schwarze Wolken über den Himmel. Sie verdeckten zuweilen den Mond, der über den Bergen stand, und dann wurde es immer ganz dunkel.
Erst als Bruno an dem Kreuzweg stand, wo eine Straße rechts zum Falkenhof, eine andere links zum Hof des Fallmüllers hinaufführte, fiel ihm auf, dass er, ohne es selbst zu merken, den falschen Weg genommen hatte. Was wollte er jetzt noch in der Nacht im Falkenhof? Dort lagen die Leute ja längst in den Betten; kein Licht war mehr zu sehen. Nur droben beim Fallmüller waren noch ein paar Fenster beleuchtet.
Er schüttelte den Kopf über seine Gedankenlosigkeit und wollte sich gerade auf den Heimweg machen, da hörte er auf einmal von der Auffahrt des Fallmüllers her eilige Schritte. Oder täuschte er sich?
Nein, die Schritte kamen schnell näher. War das etwa die Wally? Um diese Zeit?
Da tauchte auch schon aus der Dunkelheit eine Gestalt auf und wollte an ihm vorbeilaufen.
»Wally!«, rief er.
Sie schrak heftig zusammen, denn offensichtlich hatte sie ihn im Dunkeln und in ihrer augenscheinlichen Eile gar nicht bemerkt.
»Ich bin’s – der Bruno«, sagte er rasch. »Ist etwas passiert, dass du mitten in der Nacht ins Dorf läufst?«
»Ich muss Hilfe holen; eine Kuh ist beim Kalben, aber es dauert schon fast zwei Stunden, und es geht nicht vorwärts. Mein Vater und ich kommen alleine nicht zurecht damit. Der Tierarzt ist nicht zu erreichen, er ist wegen eines Notfalls unterwegs.«
Aufgeregt wollte sie weitereilen.
Einen Augenblick zögerte er. ›Was geht mich der Fallmüller und sein Stall an?‹, dachte er. ›Der Kerl wird sich bedanken, wenn gerade vom Falkenhof jemand zu ihm kommt.‹ Aber dann dachte er an das leidende Tier, dem es egal sein konnte, ob dem Fallmüller ein anderer Helfer lieber gewesen wäre. Er hatte schon mehrmals in schwierigen Fällen erfolgreiche Geburtshilfe geleistet.
»Wally!«, rief er. »Bleib da! Ich werde euch helfen.«
»Du?«, antwortete sie staunend.
»Glaubst du, dass ich es nicht kann?«
Nein, das glaube sie nicht, sie könne nur nicht fassen, dass ausgerechnet er ihr seine Hilfe anbot. Der Fallmüller und die Falkenhofleute wären doch seit eh und je nicht gut aufeinander zu sprechen.
Gemeinsam hasteten sie nun die Anhöhe zum Haus hinauf.
»Es ist lange her, Wally, dass ich diesen Weg gegangen bin«, sagte er beim Laufen. »Damals waren wir noch Kinder. Aber was können wir beide dafür, wenn sich unsere Väter streiten?«
Sie sagte nichts, aber er fühlte, wie peinlich ihr diese Bemerkung war.
»Weißt du noch, Wally, wie wir uns jeden Morgen unten am Kreuzweg getroffen haben und dann in die Schule gelaufen sind?«
Sie nickte.
»Einmal bin ich im Winter auf dem Teich eingebrochen. Ich wäre damals ertrunken, wenn du mich nicht herausgeholt hättest«, sagte sie.
»Und daran denkst du immer noch?«
»Ich werde es nie vergessen!«
Sie kamen bei dem Einödhof an. Aus den Stallfenstern flackerte Licht.





























