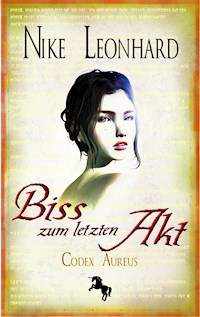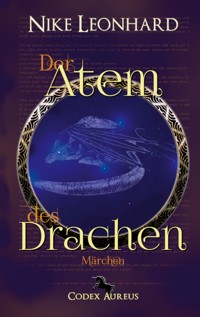
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Märchen sind seit jeher fantastischer Erzählstoff. In allen Kulturen berichten sie von den Nöten und Hoffnungen der Menschen. Poetisch und spannend erzählen sie von der Sehnsucht nach Liebe, einem glücklichen Leben, Freiheit und Gerechtigkeit. Vor allem aber versichern sie uns, dass Güte und Edelmut eines Tages belohnt werden. Der Atem des Drachen ist eine Sammlung neuer Märchen. Sie handeln von klugen Frauen und sensiblen Männern, von Nixen, Feen - und einem Drachen. Es geht um Armut, Freundschaft, Liebe und Katastrophen; vor allem aber um Zusammenhalt und Solidarität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Sieben ist eine magische Zahl. Nicht minder magisch sind die sieben, in diesem Band zusammengefassten Märchen. Unter anderem geht es um eine Fee in Gefangenschaft, einen Fischer in Nöten und den Sohn eines Schuhmachers, der sich aufmacht, einen Drachen zu besiegen. Jedes einzelne dieser sieben Märchen beweist so poetisch wie spannend, dass die Gattung noch längst nicht auserzählt ist.
Die Autorin
Kopfkinobetreiberin, Großstadtpflanze, Zeitreisende durch das Mittelalter – Nike Leonhard ist in vielen Welten zuhause und schreibt darüber. Dabei gehört ihre Leidenschaft den Kurzformaten und der Fantastik. Die Novellen, Märchen, Erzählungen und Kurzgeschichten der in Hamburg geborenen Autorin erscheinen vorwiegend in der Edition Codex Aureus, die sie selber herausgibt.
Nike Leonhard lebt mit Mann, zwei Kindern und Hund in Frankfurt am Main.
Der Codex Aureus
Kurztrips in die Fantastik. Während der Roman eine lange Reise ist, bietet der Codex Aureus mit jeder Ausgabe einen Kurzurlaub vom hektischen Alltagsgeschehen. Die hier erscheinenden Erzählungen, Legenden und Novellen sind optimal, um an einem Wochenende oder während einer längeren Bahn- oder Flugreise gelesen zu werden. Mehr über den Codex Aureus und seine Herausgeberin unter www.nikeleonhard.wordpress.com
Märchen lehren uns nicht, dass es Drachen gibt. Märchen lehren uns, dass man Drachen besiegen kann. (frei nach Neil Gaiman)
Menschen, die die Existenz von Drachen verleugnen, werden oft von Drachen gefressen. Von innen. (Ursula K. Le Guin)
Inhaltsverzeichnis
Ein paar Worte zu den Inhalten (Content Notes)
Der Segen der Fee
Der Fischer und die Nixe
Die Flut
Der Atem des Drachen
Prinzessin Furiosa
Dunkelschön oder: Die verschwundene Kiste
Wolkenschafe
Liste der Content Notes
Ein paar Worte zu den Inhalten
Ein Kennzeichen von Märchen ist, dass am Ende immer die epische Gerechtigkeit siegt. Die Guten werden belohnt, das Böse bestraft. Dazwischen kann es ziemlich düster werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Grundstimmung oder der Leseeindruck düster ist.
Um eine selbstbestimmte Entscheidung zu ermöglichen, welchen Leseeindrücke man sich aussetzen möchte, sind den einzelnen Märchen Content Notes vorangestellt, also Informationen über die Inhalte.
Gleichzeitig soll aber auch niemand gezwungen werden, sich schon vorher mit Inhalten auseinander zusetzen, weil auch das belasten oder zu einer Verfälschung der Leseerwartung führen kann. Daher sind die Inhalte durch Symbole verschlüsselt. Sie haben mit dem Märchen selber nichts zu tun, können also nicht spoilern. Außerdem betreffen sie nicht nur negative, sondern auch neutrale oder positive Aspekte wie zum Beispiel gegenseitig Hilfe oder ein Happy End. Die einzelnen Symbole sind zu Bildern kombiniert und den jeweiligen Märchen als Schmuckseite vorangestellt.
Ich hoffe, auf diese Weise allen, die Content Notes für unsinnig halten, eine Möglichkeit gegeben zu haben, sie zu ignorieren. Alle anderen finden am Ende des Buches eine Liste der Inhaltsinformationen und der dazugehörenden Symbole.
Nike Leonhard
Der Segen der Fee
ES WAR EINMAL EIN MANN, der hatte eine Fee gefangen. Er steckte sie in einen eisernen Vogelkäfig und drohte, sie erst freizulassen, wenn sie ihm drei Wünsche erfüllt habe.
»So ist das nicht gedacht«, protestierte die Fee. »Wir erfüllen Wünsche nur aus freiem Willen, nicht unter Zwang.«
Da lachte der Mann und sagte, sie werde sich schon noch wünschen, ihm zu Willen zu sein. Andernfalls werde er sie nämlich in diesem Käfig verschmachten lassen. Er wisse sehr wohl, dass Feen sehr lange ohne Nahrung und Wasser auskämen. »Aber genauso weiß ich, dass euereins kein Eisen verträgt. Es wäre also ein langer und qualvoller Tod und wer weiß, vielleicht helfe ich deiner Entscheidung auf die Sprünge, indem ich dich gelegentlich mit einer Eisennadel pike. Denk‘ drüber nach, ob du nicht doch lieber meine Wünsche erfüllen möchtest.«
Mit diesen Worten warf er ein Tuch über den Käfig und ließ die Fee im Dunkeln allein.
Sie rettete sich auf die hölzerne Vogelschaukel. Aber selbst dort spürte sie die Aura der eisernen Käfigstäbe wie einen kalten Lufthauch. Deshalb war sie beinahe erleichtert, als die Decke endlich wieder beiseite gezogen wurde.
»Hast du es dir überlegt?«, fragte der Mann.
Sein hässliches Gesicht kam so dicht an die Stäbe, dass die Fee ihm ins Auge hätte spucken können, wenn sie gewollt hätte. Aber sie bezweifelte nicht, dass die Drohung mit der Nadel ernst gemeint gewesen war. Daher nickte sie nur ergeben und begann zu erklären, dass sie aber wirklich nur drei Wünsche erfüllen könne. Danach sei ihre Kraft ganz und gar aufgebraucht; und aus dem Käfig heraus ginge es auch nicht, weil das Eisen ihre Magie störe.
Sie solle den Mund halten, fuhr der Mann sie an. Ein Nicken sei vollkommen ausreichend. Wenn sie weiterhin so viel plappere, werde er gleich mit dem Piken beginnen. Die Nadel habe er schon zurechtgelegt.
Die Fee, die keinen Moment daran zweifelte, dass er die Drohung wahrmachen würde, faltete die Hände, senkte den Kopf und nickte schweigend.
»Hörst du zu?«
Die Fee nickte.
»Dann vernimm meinen ersten Wunsch: Ich verlange, dass mir jede Frau zu Willen ist, die mir gefällt. Keine soll mir widerstehen können!«
Die Fee hob den Kopf und sah an ihm hinunter. Sah sein schütter werdendes Haar, die pochende Ader auf seiner Stirn, die verkniffenen Augen, den grausamen Zug um seinen Mund und die groben Hände. Nichts an dem, was sie sah, wirkte sympathisch, einnehmend oder auch nur annehmbar. Trotzdem nickte sie, wenn auch sehr langsam.
Aber ganz offensichtlich war ein Nicken doch zu wenig, ganz gleich, was er vorher gesagt hatte, denn der Mann griff in den Käfig und schüttelte sie. »Was ist jetzt?«
»Das lässt sich machen«, flüsterte die Fee.
»Dann fang an!«
Die Fee schlotterte vor Angst. Aber sie tat ihr Möglichstes. Sie schloss ihre Augen und sammelte sich. Allmählich beruhigte sich ihr Atem. Das Zittern ließ nach. Schimmernder Glanz entströmte ihren Händen. Zuerst war es kaum mehr als ein vages Funkeln, das zwischen ihren Handflächen waberte. Doch das Funkeln nahm zu. Der Glanz wurde stärker und formte sich zu einer Kugel. Als die Kugel etwa die Größe ihres Kopfes hatte, schlug die Fee die Augen wieder auf. »Bereit?«
»Mach schon!«
Da blies die Fee auf die glitzernde Kugel, so dass sich der Schimmer als feiner Staub in der Luft und über dem Mann verteilte. Für einen Moment schien der Mann selber zu leuchten. Dann erlosch der Glanz wieder, als sei nie etwas geschehen.
»Das war‘s?«
Die Fee nickte.
Der Mann grinste. »Dann wollen wir mal sehen, was dein Zauber taugt.« Mit diesen Worten stopfte er sie zurück in den Käfig, warf die Decke darüber und machte sich auf in die Stadt.
Aber es war wie verhext: Ausgerechnet heute begegneten ihm nur hässliche Frauen: grässlich klapperige Bohnen stangen, unförmig knollige Dicke, alte Hutzel weiblein und auf andere Weise Verwachsene. Er traf auf Frauen mit krummen Beinen, Hinkefüßen und Knubbelknien, mit Glubschaugen, Monobraue und schiefen Zähnen. Und die Nasen erst! Nie war ihm aufgefallen, wie viele verschiedene Arten hässlicher Nasen es gab. Es war wie verhext: Obwohl er kreuz und quer durch die Stadt lief, traf er keine Frau, die ihm gefiel.
Dabei schien er ihnen durchaus zu gefallen. Das jedenfalls schloss er aus den Blicken, die sie ihm zuwarfen und die ihn überall hin begleiteten. Aus den Gesten, die an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig ließen. So offen und schamlos, dass er nicht einmal vorgeben konnte sie zu übersehen: all' diese verschmitzten Lächeln, die kokett geneigten Köpfe, das Zwinkern,, die hochgezogenen Brauen, die sich anzüglich spitzenden Münder und nicht zuletzt die flinken Zungenspitzen zwischen den halb geöffneten Lippen. Als eine besonders krummnasige hagere Alte Anstalten machte, ihn anzusprechen, reichte es ihm. Er floh.
Keuchend erreichte er sein Haus, knallte die Tür hinter sich zu und rupfte die Fee erneut aus dem Käfig.
Die Fee, die gerade ein bisschen geschlafen hatte, hörte sich seine mit vielen Flüchen gespickte Geschichte an und gestand, dass da wohl etwas schiefgegangen sei. »Vielleicht habe ich aus Angst ein bisschen übertrieben«, sagte sie. »Aber ich kann es rückgängig machen, wenn Ihr wünscht.«
»Den zweiten Wunsch dafür vergeuden?«, entgegnete der Mann zornig. »Kommt gar nicht in Frage! Ich habe andere Wünsche, die du mir erfüllen musst. Wenn du damit fertig bist, können mich die Weiber kreuzweise.«
Die Fee nickte und fragte nach dem zweiten Wunsch.
»Als Zweites wünsche ich mir eine Kiste, so lang wie ich selber und halb so hoch und ebenso breit, die bis zum Rand mit Gold gefüllt ist.«
Die Fee zog die Brauen ein Stück hoch. »Münzen oder Barren?«
»Mir doch gleich«, knurrte der Mann. »Hauptsache, du versuchst nicht, mich bei der Menge zu betrügen. Sie muss wirklich voll sein. Denn wenn nicht ...« Er lachte hässlich. »Dann war es das mit deinen Flügeln!«
Die Fee fragte gar nicht erst, was er meinte, sondern nickte hastig und schloss die Augen. Wieder konzentrierte sie sich. Wieder floss glänzendes Licht aus ihren Handflächen und formte sich zu einem golden funkelnden Ball. Doch als sie dieses Mal darauf blies, wurde der Staub zu einem langen Band, das sich über den Boden und aus der Tür schlängelte.
»Was hast du getan?«, brüllte der Mann.
»Euren Wunsch erfüllt«, stotterte die Fee. »Seht nur im Keller nach. Ich konnte sie doch nicht hier oben herstellen. Der Boden hätte das Gewicht nicht getragen. Und außerdem: Was hätten die Nachbarn denken sollen?«
Die Nachbarn seien ihm egal, sagte der Mann, stopfte die Fee zurück in den Käfig und stapfte in den Keller.
Tatsächlich stand dort eine Kiste, die zuvor nicht da gewesen war. Genauso lang wie er, halb so hoch und ebenso breit. Die Fee hatte sogar die Umsicht besessen, sie direkt an der Wand erscheinen zu lassen. Dort, wo sie niemandem im Weg war.
Der Mann schlug den Deckel hoch und sah, dass der Inhalt ganz seinem Wunsch entsprach: Die Truhe war bis zum Rand mit Goldbarren gefüllt, jeder etwa so lang wie sein kleiner Finger. Sie lagen hübsch ordentlich geschichtet nebeneinander. Wie Ferkelchen am Gesäuge der Muttersau. Bei ihrem Anblick wurde dem Mann warm ums Herz, auch wenn ihm die Menge jetzt, als er davor stand, fast ein bisschen klein vorkam und er wünschte, er wäre sich selbst gegenüber großzügiger gewesen.
Trotzdem stand fest, dass die Fee seinen Wunsch dieses Mal erfüllt hatte.
Entsprechend gnädig gab er sich, als er sie wieder aus dem Käfig holte. »Ein Wunsch noch«, sagte er. »Dann bist du frei.«
Die Fee nickte und fragte demütig, welcher das sei.
»Gesundheit«, erwiderte der Mann. »Gesundheit bis an mein Lebensende.«
Wieder nickte die Fee. »Das ist machbar.« Sie schloss die Augen. Licht strömte aus ihren Händen, formte sich zur Kugel und verwandelte sich in einen Schwarm goldener Bienen, als sie darauf blies. Summend umkreisten sie den Mann, bevor sie sich in Luft auflösten.
Die Fee schlug die Augen auf. »Fertig. Das war’s«, hauchte sie. »Euer Wunsch ist erfüllt.«
»Woher weiß ich, dass das stimmt?«, verlangte der Mann zu wissen. »Wie soll ich sicher sein, dass du mich nicht betrogen hast? Bienen. Ha! Was haben Bienen mit Gesundh...«
»Ihr werdet mir glauben müssen«, flüsterte die Fee mit ersterbender Stimme. »Denn Eure Macht über mich endet hier. Meine Kraft ist aufgebraucht. Ich gehe.« Die letzten Worte waren nur noch ein Wispern. Als die Fee sie ausgesprochen hatte, zerfiel sie selber zu glitzerndem Staub, der von einem jäh aufkommenden Luftzug aus der Stube getrieben wurde.
Ungläubig starrte der Mann dem Staub hinterher. Er hatte große Lust, zu brüllen und alles kurz und klein zu schlagen. Aber es nützte ja nichts. Die Fee war entkommen, ob sie seinen Wunsch nun erfüllt hatte oder nicht. Also fluchte zwar lange, derb und laut über die verflixte Fee, weil das eben seine Art war. Aber am Ende tröstete ihn der Gedanke, dass ihm immerhin das Gold geblieben war. Alles andere würde sich schon noch finden. Schlimmstenfalls würde er eine neue Fee fangen. Er wusste schließlich, wie.
Drei Wochen genoss er den neu gewonnenen Reichtum. Er stellte einen Diener ein, kaufte neue Kleider und ein Pferd, das er nicht brauchte. Er füllte den Weinkeller mit edlen Tropfen, ließ sich die erlesensten Delikatessen bringen und schlemmte vom Aufstehen bis in die Nacht. Musiker mussten ihm den ganzen Tag lang aufspielen. Nur auf Tänzerinnen verzichtete er, denn aus unerfindlichen Gründen gab weit und breit keine, die auch nur halbwegs ansehnlich gewesen wäre.
In der vierten Woche fand dieses Leben ein jähes Ende. Noch bevor die Sonne ganz aufgegangen war, pochte es an die Vordertür.
Da sein Kopf von zu wenig Schlaf und zu viel Wein benebelt war, dauerte es eine Weile, bis der Mann begriff, dass das Klopfen ihm galt. Verärgert über die Störung hob er den Kopf gerade weit genug aus den Kissen, um dem Störenfried zuzubrüllen, er solle sich zum Teufel scheren.
»Im Namen der Königin!«, schrie es von der Straße zurück. »Wir werden die Tür aufbrechen, wenn du sie nicht sofort aufmachst, Kerl!« Ein wuchtiger Schlag unterstrich die Ernsthaftigkeit der Drohung.
Das brachte den Mann auf die Beine. Auf die Untätigkeit des Dieners fluchend, sprang er aus dem Bett und rannte, nur mit seiner Unterwäsche bekleidet, zur Haustür. Als er sie aufriss, sah er sich dem königlichen Henker und zwei Bütteln gegenüber, die sich ohne Umstände an ihm vorbei in den Hausflur drängten. Ehe der Mann wusste, wie ihm geschah, hatten sie bereits die Kellertür geöffnet. Einer polterte die Treppe hinab, derweil der andere sich in die Haustür stellte und den Ausgang blockierte. Ihr Verhalten ängstigte den Mann. Ganz kleinlaut fragte er den Henker, der inzwischen ebenfalls das Haus betreten hatte, was man von ihm wolle. Er habe sich doch nichts zuschulden kommen lassen.
Der Henker musterte ihn herablassend und schnarrte, er solle sich nicht dumm stellen. »Der Königin ist vor vier Wochen eine Truhe voll Gold aus der Schatzkammer gestohlen worden. Und wir haben einen Tipp bekommen, dass sich genau diese Truhe in deinem Keller befinden soll.«
In diesem Moment rief der Büttel aus dem Keller nach oben, die Kiste sei gefunden.
Dem Mann brach der kalte Schweiß aus, aber noch bevor er etwas zu seiner Verteidigung sagen konnte, hatte man ihn schon gefesselt, geknebelt und in einen wartenden Wagen geschoben.
Noch am gleichen Tag wurde er hingerichtet.
So erfüllte sich auch sein dritter Wunsch, denn er war bis zu seinem Tod wirklich sehr gesund.
Der Fischer und die Nixe
AN DER KÜSTE LEBTE EINST EIN FISCHER, der war jung und fleißig, aber so arm, dass er sich kein Boot leisten konnte. So blieb ihm nur, längs des Strandes zu fischen.
Von morgens früh bis zum Sonnenuntergang stand er bis zu den Knien im Wasser und warf sein Netz aus. Dabei war der Fang oft so gering, dass nur er selbst davon satt wurde und nichts auf den Markt tragen konnte, um es dort zu verkaufen. Trotzdem konnte er sich kein besseres Leben vorstellen. Er liebte das wogende Meer, dessen Rauschen, Glucksen und Raunen ihn bis in die Träume begleitete. Genauso liebte er den weiten Himmel darüber. Sogar die harte Arbeit gefiel ihm. Während er darauf wartete, sein Netz einzuholen, sah er den Wolken nach, die über ihm dahinzogen, lauschte den Schreien der Möwen und fühlte sich gesegnet. Er war frei, niemandes Knecht, umgeben von Schönheit.
So lebte er mehrere Jahre mit sich und der Welt im Reinen, bis eines Tages plötzlich alle Fische aus der Bucht verschwanden. Als sein Netz den ersten Tag leer blieb, zuckte er noch mit den Schultern. Solche Tage gab es. Darauf war er vorbereitet.
Aber auch am nächsten Tag fing er nichts als Tang und leere Muschelschalen. Da gruben sich erste Sorgenfalten in seine Stirn, und als er am dritten immer noch nichts gefangen hatte, verdüsterte sich sein Blick. Seine Vorräte waren praktisch aufgebraucht. So etwas war ihm noch nie widerfahren. Er fragte die anderen Fischer und erfuhr, dass auch sie seit vier Tagen kein Glück gehabt hatten.
»Das kann passieren«, sagte einer der ganz Alten. »Manchmal, wenn es draußen auf dem Meer einen schweren Sturm gegeben hat oder die Meergeister gegen uns sind, bleiben die Fische für drei oder auch vier Tage aus. Bestimmt wird es morgen wieder besser!«
Doch es wurde nicht besser. Auch am fünften und sechsten Tag fing der junge Fischer allen Anstrengungen zum Trotz nicht einmal eine Sprotte. In seiner Not begann er, Tang zu kauen. Der füllte den Magen und betäubte den Hunger wenigstens ein bisschen. Aber er gab keine Kraft für die schwere Arbeit.
Im gleichen Maß, wie seine Kräfte schwanden, wuchs die Verzweiflung des jungen Fischers. Er brauchte richtige Nahrung. Doch das Einzige von Wert, das er besaß, das Einzige, das er gegen etwas zu essen verpfänden konnte, war sein Netz. Seine Lebensgrundlage. Ohne sein Netz würde er nie wieder einen Fisch fangen. Dann wäre es aus mit dem freien Leben. Als die Sonne am Abend des siebten Tages den Horizont berührte, schien dieses Schicksal besiegelt. Obwohl er vor Hunger und Erschöpfung taumelte, hatte der junge Mann wieder keinen einzigen Fisch gefangen. Wenn er auch an diesem Abend nichts Nahrhaftes zu Essen bekam, würde ihm am nächsten Morgen die Kraft fehlen, das schwere Netz noch einmal auszuwerfen.
»Einmal noch«, schwor er sich. Einmal noch wollte er es versuchen, bevor er sich in das Unvermeidliche schickte. Er blickte auf das Meer, das im Licht der untergehenden Sonne wie Blut und flüssiges Gold schimmerte, sandte ein stummes Gebet in den Himmel und warf mit letzter Kraft das Netz.
Schon beim Loslassen erkannte er, dass der Wurf nichts taugte. Seine Arme waren zu schwach und er selbst zu müde, um dem Netz den richtigen Schwung zu geben. Nur halb entfaltet und nur ein kleines Stück von seinen Füßen entfernt klatschte es auf die Wellen. Tränen der Verzweiflung brannten in seinen Augen, als er es wieder einholte. Es war zu spät. Einen weiteren Versuch würde es nicht geben. Schon jetzt war die schnell sinkende Sonne nur noch ein Streif über dem Wasser. Bis er das Netz eingeholt hatte, würde sie ganz versunken sein. Er konnte von Glück sagen, wenn er seine Hütte vor Einbruch der Dunkelheit erreichte, denn mit ihr kamen die Geschöpfe der Nacht. Wehe dem, der dann im Freien war!
Das Netz erwies sich als unerwartet schwer. Der junge Fischer schob es auf die eigene Schwäche, denn zwischen den Maschen lag nur einen Klumpen Tang, der nie und nimmer so schwer sein konnte. Dann bemerkte er die ungewöhnliche Form und im nächsten Moment sah er etwas aufblitzen. Es war nicht der silbrigen Glanz von Fischschuppen, sondern ein goldenes Funkeln. Zuerst glaubte der junge Mann, das schwindende Licht und die tief stehende Sonne würden ihn narren. Doch das Glitzern blieb.
Mit neuer Hoffnung zog der Fischer das Netz an den Strand. Mit zitternden Fingern löste er den unerwarteten Fang aus den Maschen und befreite ihn vom Tang. Als er fertig war, hielt er eine Art Kamm in den Händen. Es schon war zu dunkel, um noch Einzelheiten zu erkennen, nur, dass dieser Kamm groß, langzinkig, schlecht zu fassen und ziemlich schwer war. Für den Fischer schien kein sinnvoller Nutzen damit verbunden; er ärgerte sich, so viel Zeit und Kraft auf einen so nutzlosen Gegenstand verschwendet zu haben. Beinahe hätte er ihn zurück ins Meer geworfen.
Dann besann er sich, dass der Kamm doch einen Nutzen haben würde, wenn es ihm gelang, ihn auf dem Markt gegen ein paar Kupferstücke oder Lebensmittel einzutauschen. Dann hätte er zu essen und konnte sein Netz behalten.
Also ließ er den Kamm in die Tasche fallen, in der er in besseren Zeiten seine Fische heim trug und machte sich auf den Weg zu seiner Hütte. Es war bereits ganz und gar dunkel, als er dort eintraf. Das Feuer im Herd war längst erloschen und ihm fehlte das Holz, um neues zu machen. Aber in der Lampe war noch ein Rest Tran. Der Fischer zündete sie an, zog den Kamm aus der Tasche und legte seinen seltsamen Fang auf den Tisch, um ihn genauer zu betrachten und zu entscheiden, was damit geschehen sollte.
D