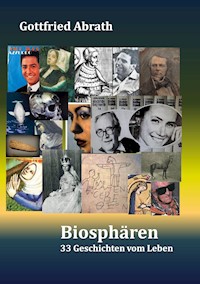Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der mysteriöse Todesfall eines Verlegers im März 1972 bringt den Sprengstoff-Experten Vandenbergh auf die Spur des Nazis Klaus Barbie, der sich unter falschen Namen in Bolivien aufhält. Zunächst begegnet der Polizist in La Paz einem Bekannten aus der Kriegszeit. Nachdem auch dieser unerwartet einem Bombenattentat zum Opfer fällt, versteckt Vandenbergh dessen Adoptivtochter im Bergland. Doch auch dort sind sie nicht sicher. Was sich liest wie ein Krimi, entpuppt sich mehr und mehr als Erinnerung an die letzten Tage des Ernesto Ché Guevara. Das Ganze steigert sich zu einem fulminanten Schluss, in dem der Ché höchstpersönlich sein Ende erlebt. Das Buch knüpft an den ersten Roman des Autors "Die Adoption" an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
für Ché und die Compañeros, die Freunde in América Latina und für Nele in Afrika
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 0
Kapitel 1 Utrecht, Anfang März 1972
Kapitel 2 Mailand, Mitte März 1972
Kapitel 3
Kapitel 4 Mailand, zweite Märzhälfte 1972
Kapitel 5 La Paz, Ende März 1972
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11 La Paz, Anfang April 1972
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17 La Paz, Mitte April 1972
Kapitel 18 La Paz, Mitte April 1972
Kapitel 19
Kapitel 20 La Paz, Ende April 1972
Kapitel 21
Kapitel 22 Hochland-Bolivien, Anfang Mai 1972
Kapitel 23 Bolivien, in den Yungas, 12.Mai 1972
Kapitel 24 La Higuera, Oktober 1967
Kapitel 25 Bolivien, Yungas, Mai 1972
Kapitel 26 Bolivien, westliche Yungas, 6.Juni 1972
Kapitel 27
Kapitel 28 Lima, 10.Juni 1972
Kapitel 29 La Higuera, Bolivien, 9.Oktober 1967
0
Die Augen! Es waren die Augen. Weit geöffnet. Sie ließen ihn lebendig. Sonst schließt man sie, manchmal drückt man sie zu. Ich weiß es nicht, wie man das macht, musste es nie. Komisch, ob es welche gibt, die das gelernt haben, die befugt sind, das zu tun? Darf man das überhaupt?
Bei ihm hatten sie es nicht gemacht. Einer ihrer entscheidenden Fehler. Jedenfalls, was mich betrifft.
Es war nicht schrecklich, diese Augen zu sehen. In sie hinein zu sehen.
Ich habe mir nie vorgestellt, wie es gewesen wäre, wenn man sie zugeklappt hätte. Ich denke jetzt erst darüber nach. Ich denke, er wäre tot gewesen. Geschlossen. Entleert. Wie ein gefällter Baum. Es hätte zu dem Körper gepasst, diesem ausgemergelten, geschundenen, verletzten, durchschossenen Leib, nur mit einer Hose bekleidet, die eher einem Lappen glich, Blutkrusten an den Beinen. Der ungepflegte Bart, diese ganze zottelige, dreckige, vernarbte Existenz, einfach zugeklappt, so hätten sie es doch gerne. Vergessen, alles schnell vergessen.
Vielleicht dachten sie, es würde abschreckend wirken, wenn sie offen blieben. Ein grausiges Bild. Schnell wieder weggucken! Als wollten sie sagen: Willst du auch so enden? So falsch, mit geöffneten Augen?
Damit hatten sie nicht gerechnet. Damit, dass es sich tief eingrub bis in die Seele.
Er sah mich an. Wie ein Mensch.
Müde waren sie, diese Augen.
Ja, müde schon.
Doch wissend, erkennend.
Ich fragte mich, ob er so in den Tod geschaut hat? Und ich sagte mir, immer wieder: Nein, dahin hat er nicht geschaut.
Hat er den Mörder angesehen? Vielleicht, sage ich mir. Aber so als wolle er fragen: Denkst du wirklich, dass du mich töten kannst? Und dann denke ich wieder: Nein, er hat ihn nicht angesehen.
Er hat noch etwas ganz anderes gesehen. So etwas wie den Himmel.
Es schien zu glühen in diesen Augen, die doch tot sein sollten wie der Rest. Etwas von dem ´Venceremos´, das er prägte bevor es zur Hymne wurde. So gewiss. Aufblickend. Zuversichtlich. Als hätte er gewusst, dass er noch nicht gestorben war.
1 Utrecht, Anfang März 1972
Zum letzten Mal! Bald ist alles vorbei. Aus.
Müde schob Kommissar Vandenbergh die Tür zu und schloss ab. Die Bewegung, mit der er den Schlüssel herumdrehte, hatte etwas Endgültiges.
Satt hatte er, was hinter der Tür lag, die elenden Akten, die sich auf seinem Schreibtisch häuften, die Verlogenheit, die daraus hervorquoll und sich bis in sein Innerstes vorgearbeitet hatte und ihn zwang, mitzumachen.
Leise stieg er durch das neonbeleuchtete Treppenhaus hinab. Die Stufen waren frisch gewischt und gaben dem marmorierten Stein den Schein des Neuen. Aber viel zu genau sah Vandenbergh den Staub in den Ecken, die gelben Kanten des Unabwischbaren, die Macken in den Stufen.
Keiner mehr da. Er stellte sich vor, wie sie zu Hause säßen bei ihrem Bier und Schnitzel. Fernsehen. Frau daneben. Kindergeschrei.
Das ist es nicht.
Nicht das, was ich suche.
Er wollte nicht nach Hause. War er nicht eigentlich deshalb jetzt noch hier? Bloß nicht nach Hause in den leeren Käfig.
Draußen schlug ihm ein frischer Wind entgegen. Das Dunkle tat ihm wohl: einfach hineintauchen, niemand erkennt dich, kein Telefon. Nur Wind und Regen.
Er ging den schnurgraden Leidseweg entlang, der zum Kanal führte, dreißig Dienstjahre hinter sich lassend. Genug. Zuviel.
Nach dem Krieg hatte man ihn zum Inspecteur Ambtenaar befördert, dem Rang nach ein Hauptmann. Seine Kontakte zum Widerstand hatten ihm zu einer schnellen Karriere bei der Gemeindepolizei Utrecht verholfen und so war er schließlich Commissaris Hoofdambtenaar geworden, ein hohes Tier. Nächstes Jahr, hatte ihm der Korpschef angekündigt, könne er, wenn van Gelderen in den Ruhestand ginge, sogar Hoofdcommissaris werden und die Schwerter tragen und wer weiß…
Vandenbergh lächelte müde. Schluss mit diesen Spielchen. So kauften sie die Menschen, wickelten sie in Ehre ein wie in Watte, damit man stumpf seinen Dienst tat, funktionierte und bloß nicht auf die Idee käme, das System zu gefährden.
Er hatte mitgemacht, gegen eigene Überzeugung, viel zu lange schon. Und wäre Alda nicht gestorben, hätte er sicher noch weiter funktioniert, das Leben in Frieden fortgesetzt.
Alda. Die Wunde war nicht verheilt.
Damals im Jugendclub. Blond und mit diesen dazu grandios im Kontrast stehenden braunen Augen. Sofort hatte er sich verliebt. Getanzt hatten sie, und da war es völlig geschehen um ihn, ein Strahlen und Lachen! Sie hatte es nicht so ernst genommen, leicht, fröhlich und auf Sommerurlaub. Den Brief, den er mit angefüllter Leidenschaft schrieb, beantwortete sie nicht. Da hatte er gespart damals vor dem Krieg, in den bescheidenen Zeiten, bis er sich die Bahnkarte nach Ijmuiden hatte leisten können. Sie staunte nicht schlecht, als er vor der Tür stand, ein wenig verlegen jetzt: „Nun ja, komm rein!“
Und die Eltern hatten ihn mit strengem Blick und festem Handdruck begrüßt, echte Calvinisten. Mehr als ein kleiner Spaziergang zum Hafen war nicht drin gewesen. Verklemmter Abschied. Eine enttäuschte Rückfahrt mit unlöschbarer Liebestraurigkeit. Irgendwann hatte er die Sache begraben in der Wunde seines 18jährigen Herzens. Aber da kam dann ihr Briefchen mit der vagen Andeutung, ob man sich nicht wiedersehen könne. Er solle noch einmal kommen, länger. Sie wolle die Eltern bereden, dass er in der Dachkammer übernachten dürfe. Irgendetwas war bei ihr angekommen von seiner Sehnsucht.
Was für Zeiten! Und nun war sie weg, raus aus seinem Leben, die lange Linie der gemeinsamen Jahre abgerissen.
War es Regen, waren es Tränen? Vandenbergh lief weiter, eiliger, als könne er seiner Trauer entkommen.
Harmlos sei das neue Mittel, viel wirksamer als das bisherige. Natürlich auch teurer. Aber besser, geradezu einmalig. Alda hatte sich darauf verlassen und es hatte sie umgebracht. Davon war er überzeugt. Heftige allergische Reaktionen am Anfang. Herzrasen, Übelkeit. Sie hatten es auf eine Grippe zurückgeführt, nicht auf das Medikament. „Nodestil“. Innerhalb kürzester Zeit war Alda von den heftigsten Fieberschüben geplagt und blieb heiß und lahm liegen, nur noch liegen. Jetzt riet der Arzt, die Pillen nicht mehr zu nehmen. Doch der ganze Kreislauf war derangiert, das Herz spielte einfach verrückt, krampfhaft hielt sich Alda an ihm fest die heißen Nächte hindurch. Er redete ihr zu, konnte nichts als Schweiß abtupfen, Umschläge machen, warten.
Nie, niemals hätte er geglaubt, dass seine Alda, dieses lebenslustige Geschöpf, so mitten herausgerissen würde, bis er erkannte: sie wird es nicht schaffen. Das war völlig inakzeptabel, unmöglich erschienen, unnötig und unpassend. Aber die Uhr lief ab. Und Alda selbst spürte das.
„Bleib stark, Nes! Du musst stark bleiben! Lass mich gehen, ich kann nicht mehr!“
„Nein Alda, sag das nicht, bleib bei mir!“
„Nes!? Die Kraft geht weg. Ich brauch jetzt Ruhe. Und wir haben doch schön gelebt, nicht wahr!?“
„Ach Alda, halt aus! Was soll mein Leben denn ohne dich?“
„Nes, Nes, ich hab mein Leben gelebt und du musst noch leben! Wer weiß, wozu?“
Das Sprechen war ihr schwer gefallen, stückhaft kamen die Worte. Aber sie hatte noch gelächelt gegen alle Schwäche und auf irgendeine Art dem Tod getrotzt.
In seinen Armen war sie eingeschlafen, ganz ruhig und geborgen, ein heißes, lebensmüdes Elend. Die Erinnerung an die letzte Geborgenheit tröstete in all dem Unfassbaren.
Zwei Jahre waren seitdem vergangen. Er hatte sich nicht an die Einsamkeit gewöhnen können. Schon gar nicht in der kleinen Wohnung, die Alda immer mit so viel Wärme zu erfüllen gewusst hatte. Immer länger war er im Büro geblieben, so müde er auch war. Ein Zuhause gab es nicht mehr, nur noch ein Bett, in das er todmüde sank und eine Kaffeemaschine, die ihn morgens auf Trapp brachte. Alles Andere Staub, verlorene Dinge ohne Sinn.
Sicher, man musste den Schein wahren, Anzüge und Uniform in Schuss halten. Das erledigte eine Nachbarin gegen ein Taschengeld.
Aber für wen sollte er korrekt scheinen?
Er hatte versucht, etwas gegen den Pharmakonzern zu unternehmen, jedes Mittel dazu voll ausgeschöpft. Seine Briefe hatten sie mit dem freundlich unverbindlichen Hinweis beantwortet, dass in dem Beipackzettel die möglichen Folgewirkungen klar genannt seien. Ein sehr bedauerlicher Einzelfall, möglicherweise ärztliche Fehlentscheidungen etc.
Als er hartnäckiger geworden war und auch einen regionalen Radiosender eingeschaltet hatte, war der Korpschef zu ihm ins Büro gekommen und hatte ihn in seiner etwas umständlichen Art gebeten, von weiteren Schritten abzusehen. Er sei ja da doch befangen und nicht objektiv genug. Und schließlich sei das kein Kriminaldelikt sondern ein Fall für die Gesundheitsbehörde.
Er hatte beigegeben, zunächst. Warum eigentlich? Im Laufe der nächsten Zeit fühlte er eindeutig, dass er es so nicht lassen dürfte, Aldas wegen. Aber er war verstummt, hatte brav seinen Dienst getan, die Wut in sich hineingefressen, wie wahnsinnig Sport getrieben bis er so weit war, sich selbst Schmerzen zuzufügen. Als er eines Nachts jäh erwachte, weil ein eingeklemmter Nerv ihn quälte, wusste er, dass es so nicht weitergehen konnte. Das Thema ließ sich nicht verdrängen. Jetzt würde er die Sache auf seine Weise in die Hand nehmen. Und dieser Plan reifte in langen schlaflosen Nächten.
Vandenbergh beschleunigte seine Schritte. Er kam in den Bereich der Lagerhallen, wo um diese Zeit kaum noch jemand war.
Eine leichte Bewegung am Schuppen rechts ließ ihn anhalten. Da lag jemand am Boden. Vorsichtig näherte er sich. Dann sah er, dass es ein junges Mädchen war, zugekifft bis oben hin. Sie lag buchstäblich im Dreck, ein Bein in einer Pfütze.
Die merkt es nicht mal. Ziemlich hoffnungsloser Fall.
Vandenbergh beugte sich zu ihr herunter und rüttelte sie leicht am Arm.
„He, Kleine, das ist kein guter Platz zum Schlafen!“
Das Mädchen stöhnte nur, drehte sich halb um und sah ihn mit glasig-blauen Augen an:
„Ché!“
„Wie?“
„Ach, lass mich schlafen. Mmmhheh. Der Traum war so gut, ehh.“
Es war ziemlich zwecklos. Vandenbergh sah sich um. Eine Plane lag zusammengefaltet in der Nähe. Er zog das Mädchen aus der Pfütze und breitete die Plane notdürftig über sie.
„Gehst du?“
„Was soll ich auch hier?“
„Denk dran!“
„An was?“
„Hab ich doch schon gesagt, ehh!“
Das Mädchen drehte sich weg.
Beim Weitergehen fragte er sich, was sie wohl gemeint hatte. Es hing wohl mit ihren Träumen zusammen.
Wie auch immer, er musste jetzt seinem Plan folgen. Er würde Keesdamm tief hineinreiten, so tief, dass er verurteilt werden würde. Die Machenschaften dieses ekelhaften Konzerns werden ans Licht kommen.
Er hatte nicht gewusst, welches Machtimperium sie aufgebaut hatten. In so gut wie alle Branchen hatten sie sich eingekauft und setzten Milliarden um. EZZ war nach eigenem Bekunden in allen Kontinenten der Erde aktiv und so mächtig, dass es ganze Regierungen ins Wanken bringen konnte, besonders die kleineren Entwicklungsländer, aber auch die Wirtschaft von Chile, wo der Sozialist Allende mit der Verstaatlichung der Schlüsselindustrie drohte. Man bestach hohe Beamte mit siebenstelligen Summen und die amerikanische Regierung verhinderte ordentliche Verfahren. Im Aufsichtsrat saß ein CIA-Mann. All das war schon halboffiziell in verschiedenen Nachrichtenmagazinen nachzulesen, wo gleichzeitig ganzseitige Anzeigen von EZZ erschienen.
Von Armaturen aus dem Sauerland bis zur Hotelkette, von der Elektroindustrie bis zur Lebensmittelbranche hatten sie überall ihre Finger drin. Und eben auch in der Pharmazie.
Erschreckend, wo man überall das Firmenzeichen entdeckte, klein aber zackig „EZZ“ auf den Radios, den Fernschreibern, den Brötchentüten.
Und mittendrin Keesdamm als Leiter der West-Europazentrale. Nicht irgendwo weit weg. Nein, ausgerechnet hier in Utrecht, der Heimatstadt.
Vandenbergh erinnerte sich zu gut an den Tag, als Keesdamm ihn abgewimmelt hatte durch seinen Anwalt. Gleich mit drastischen Drohungen und natürlich den besten Verbindungen.
Aber sie hatten sich in dem Polizisten getäuscht.
Vielleicht war ihnen das sogar bewusst geworden, denn sie versuchten ihn danach mit einer besonders perversen Methode fertig zu machen. Auf seinem Konto waren kurze Zeit später 10.000 Gulden gelandet, die bar eingezahlt worden waren. Damit wollten sie ihn zum Schweigen zu bringen. Und sie hatten damit das beste Druckmittel, das sich denken ließ.
Natürlich hatte er dem Korpschef sofort Meldung gemacht und das Geld auf den Tisch gelegt. Wie erstaunt und ungläubig hatte dieser ihn angesehen!
Das zeigte, dass sie ihn nicht kannten. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass jemand kein Interesse an ihrem Geld hatte.
Er war in die Kanaalstraße eingebogen. Aus einem kleinen Café scholl ziemlich laut Musik auf die Straße: „Am Tag, als Conny Cramer starb…“
Merkwürdig, gerade diese Worte. Wer würde ihm nachweinen? Den Song hörte man in letzter Zeit aber auch an jeder Ecke. Es hatte was mit der Drogenszene zu tun. Aber echte Anteilnahme kaufte er dem Schlager nicht ab. „Daas war ein schwerer Taaag“.
Er dachte an das Mädchen am Leidseweg. Die Nächte waren noch zu kalt. Und er wünschte sich mit einem Mal heftig, dass sie es schaffen würde rauszukommen aus dem Dreck.
Die Junkies in der Bar schienen sich an dem Lied regelrecht hochzuziehen. Armeschwenkend tanzte da einer und sang laut mit.
Er musste sich jetzt konzentrieren. Sein Dossier über die EZZ und Keesdamm lag sicher im Tresor des Präsidiums. Nach seinem Tod würden sie es entdecken. Neben genau recherchierten Details über die Korruptionspraxis des Konzerns wird man auch die Abschrift eines wissenschaftlichen Gutachtens finden, dass Nodestil als Arzneimittel für den Markt als noch nicht genug erprobt beschreibt und erhebliche Risiken für bestimmte Patientengruppen feststellt.
Das hatte er nach mühevoller Suche den Akten des Gesundheitsministeriums entnommen. Er hatte ziemlichen Druck machen müssen, um überhaupt Einsicht zu bekommen. Auch da war vermutlich Korruption im Spiel und die Unterlagen waren wahrscheinlich ganz bewusst völlig verkehrt abgeheftet.
Das würde ihnen am meisten zusetzen, weil dann sogar Prozesse gegen das Pharmaunternehmen zu erwarten waren. Man hatte ja gesehen, welche Wellen das Verfahren gegen die Contergan-Firma geschlagen hatte. Das wirkte sich dann auf alle Produkte sehr negativ aus.
Das war also geklärt.
Der Mercedes von Keesdamm stand wie immer auf seinem Platz hinter dem Gebäude. Man konnte ihn von der Straße aus sehen. Die Eingangshalle war hell beleuchtet. Vandenbergh ging seitlich am Gebäude vorbei und erreichte den Hinterhof. Es handelte sich um eine gartenähnliche Anlage, um die kreisförmig herum eine Straße gebaut war. Ziemlich aufwändig.
Der Hof war leer. Er musste vorsichtig sein, denn auch am Hinterausgang, den Keesdamm benutzte, saß ein Wachmann.
Wenige Lichter brannten noch in dem großen Gebäude. Vom Hinterausgang beleuchtete ein Außenlicht die parkenden Fahrzeuge.
Blöd! Daran hatte er nicht gedacht, als er tagsüber die Lage erkundet hatte.
Er hielt im Schatten des Hauses inne. Jetzt oder nie! Er musste ohne Zögern handeln. Es war noch Zeit, bis Keesdamm raus käme. Aber bis dahin musste er auf dem Dach des Hochhauses stehen.
Wie um seine Befürchtungen zu bestätigen, öffnete sich gerade jetzt die Tür und zwei Männer erschienen an der Treppe. Zum Glück waren sie ziemlich in ein angeregtes Gespräch vertieft. Sie blieben oben stehen, hatten wohl nur ein wenig Frischluft schnappen wollen.
Vandenbergh, der für seine Ruhe bekannt war, hatte jetzt Mühe, gelassen zu bleiben. Endlich verschwanden die beiden wieder im Gebäude.
Ihm kam zu Gute, dass das Heck des Wagens im Schatten stand. Nun ging alles sehr schnell. Vandenbergh wusste, wie man das Schloss des Kofferraums aufbekam. Er hatte den Draht vorher zurechtgebogen. Dabei vermied er, dass der Deckel ganz aufging. Das war nicht nötig. Aus der Manteltasche holte er den Fetzen des Stricks und drückte ihn vorne unter die Matte. Der Wagen müsste schon zwischenzeitlich in die Reinigung, um solche Kleinigkeiten zu entfernen. Aber sie würden ausreichen, um den Verdacht auf Keesdamm zu werfen.
Mit einem leisen Schnappen klappte der Kofferraum wieder zu. Schnellen Schrittes verschwand Vandenbergh aus dem Hinterhof.
Und was, wenn ihn irgendjemand bemerkt hatte? Sie würden nichts weiter finden, es fehlte nichts. Viele Male war er jedes Detail durchgegangen. Aber er wusste auch, dass es in der Realität immer anders kam als geplant.
Nun der nächste Schritt. Er hatte das Hochhaus ausgewählt, weil es in der Nähe der EZZ-Zentrale lag. Nicht gerade direkt daneben, aber nah genug, um einen Zusammenhang zu vermuten. Außerdem war das Haus zugänglich und er wusste, wie man auf das Dach kam.
Vandenbergh zögerte. Noch könnte er in das Leben zurückkehren. Einfach weitermachen. Aber gerade dieser Gedanke erschreckte ihn. Er ging schneller, lief seinem Ziel entgegen.
Etwas ungepflegt. Warum setzten sie überhaupt ein Wohnhaus mitten in dies Büroviertel? Nun ja. Unten im Flur die aufgereihten Briefkästen. Es mussten anscheinend mindestens 50 Mietparteien hier wohnen.
Vandenbergh benutzte das Treppenhaus. Alte Gewohnheit. Langsam erstieg er Stock um Stock. Immer zwei Wendungen, Ausgang links mit der großen Zahl. Und weiter. Bei der 7 musste er verschnaufen.
Außer Kontrolle, sagte er sich selbst, als er auf den Treppenstufen saß. Saß da noch einen Moment vor dem Ende. Grübelnd, prüfend, antriebslos.
Aber innerlich gab es keinen Zweifel an dem Vorhaben. Wie hatte er sich mit dem Gedanken angespornt, dass es seine beste Rache sein würde an den Machenschaften dieser Leute. Für Alda!, hatte er sich gesagt.
Kein Zweifel daran. Aber war der Weg richtig? Dieses Leben zu beenden, das ihm so viel bedeutet hatte? Die Kostbarkeit Leben, das mal gewesen war? Wie hatte er im Krieg ums Überleben gekämpft! Oft für andere. Aber auch für sich und Alda. Und wie waren ihnen die ärmlichen Jahre danach so egal gewesen. Hauptsache Leben! So hatten sie es sich oft gesagt.
Vandenbergh riss sich gewaltsam hoch und stieg die letzten fünf Stockwerke rauf. Seine Schritte waren mit einem Mal schwer geworden. War er lebensmüde? Irgendwie schon sehr lange.
Als er auf das Flachdach trat, schlug ihm ein frischer Seewind entgegen. Schön und voll Erinnerungen. Nicht so frisch, wie er gedacht hatte, nein mit einem Hauch dieser unglaublichen Lindigkeit, die den großen Durchbruch des Frühlings ahnen lässt.
Er legte sich den Strick um die Handgelenke und zog heftig zu. Hatte er alles bedacht? Würde die Spur wirklich zu Keesdamm führen und seinem Imperium?
Zuerst würden sie darüber stolpern, dass er gefesselt gewesen war. Unübersehbare Spuren an Händen und Knöcheln. Sie würden Reste der Fesseln auf dem Dach finden. Dann das belastende Dossier im Tresor des Präsidiums. Das musste einfach reichen, um zu einer Durchsuchung zu führen, bei dem sie diesen Fetzen Strick mit seinem Blut finden würden, wenn sie sich nicht völlig dämlich anstellten. Aber er kannte ja die Leute. Genau und gewissenhaft würden sie jeder kleinen Spur nachgehen, zumal wenn ein Kollege umgekommen war. Vielleicht würde man von höherer Stelle versuchen, die Selbstmordtheorie aufrecht zu erhalten, damit die Wogen nicht zu hoch schlügen. Aber dazu waren die Beweise zu eindeutig. Zu eindeutig. Er selbst hätte darüber gegrübelt. Aber wo sich einmal Eindeutigkeit entfaltete, setzte sie sich in aller Regel durch.
Er rieb seine Handgelenke länger als nötig in den Fesseln. Kleine Fasern davon trennte er ab und klemmte sie zwischen die Kieselsteine, mit denen das Flachdach belegt war. Die großen Stücke mussten verschwinden. Zu auffällig. Er öffnete ein Lüftungsrohr und warf sie hinein. Irgendwo in der Tiefe kamen sie auf.
Es war alles getan. Fehlte nur der letzte Schritt. Vandenbergh stand am Rand des Daches.
Von hier aus konnte er den Mercedes Keesdamms sehen. Pünktlich wie der war, musste es bald soweit sein. Und dann noch 10 Minuten. Auf alle Fälle war zu verhindern, dass er ein Alibi hätte. Er fuhr immer allein. Eigentlich unvorsichtig in den Zeiten linker Anschläge.
Seine Frau war heute auswärts. Sie hatte ihren Damenabend wie jeden Donnerstag. Seine Ankunftszeit würde sie nicht bestätigen können.
Wo blieb er? Es musste jeden Moment soweit sein. Die Zeit schien zu stehen.
Bei einer intensiven Erwartung eines Auftretens wirkt die tatsächliche Erscheinung schockierend, weil sie stets plötzlich eintritt, was sonst nicht bemerkt wird. Ehe Vandenbergh sich darüber besinnen konnte, war die Limousine aus dem Hof gefahren und in die nächste Straße abgetaucht.
Vandenbergh schaute auf die Uhr. 10 Minuten, schneller wäre es nicht zu schaffen mit einem Gefesselten hier raufzukommen.
10 Minuten noch leben. Er sah über die nächtliche Stadt. Die Grachten und gebogenen Gassen. Alte und neue Häuser. Dort hinten das Präsidium. Und da, im Dunkeln Woerden, wo er einmal Dienst getan hatte im Krieg. Verrückte Zeiten waren das gewesen. Dahinter Gouda, Den Haag, das Meer.
Man ahnte die See, der Wind trug die Gischt. Er liebte das Rauschen, wie eine ferne Sehnsucht hatte es ihn immer wieder angezogen. Mit Alda, dann allein. Weit war er am Strand gewandert, immer weiter, das Rauschen am Ohr. Eingehen in diese Tiefe, eintauchen in das Große, Einswerden mit allem. Würde es so sein an der anderen Seite? Viel lieber würde er Alda begegnen, diesem lieben vermissten Gefährten. Mit ihr wieder lachen und schmusen und noch mehr, viel mehr. Wäre das auch da? Das konnte man nicht denken.
Wohin geht der Geist, all die Gedanken, das, was man Seele nennt, danach? Nimmt er, der alles geschaffen haben soll, das Innere wieder zu sich, das so deutlich aus den Leibern sich entfernt hat? Was wissen wir schon vom Kosmos und seiner Weite! Grad bis zum Mond können wir Expeditionen unternehmen.
Selten hatte er solche Gedanken gehabt. Immer hatte er sich ganz auf die Bewältigung des Hier und Jetzt geworfen.
Aber eins wusste er durch Alda: die Verbindung mit denen, die schon dort sind, reißt nicht völlig ab. Sie bleiben existent in einer anderen Dimension. Sind nicht greifbar, aber auch nicht fort.
Die Zeit neigte sich dem Ende zu.
Vandenbergh trat nah an die Kante.
Beim Heruntersehen schwindelte ihn etwas. Zum Glück sah man im Dunkeln nicht viel. Sich hineinwerfen in das Leere, die Finsternis.
Dann sah er sich dort liegen, zerschmettert.
Schlagartig stand sie ihm überdeutlich vor Augen.
Nicht Alda, nein. Dieses Mädchen von vorhin. Wie sie dalag. Das Elend. Hätte sie forttragen sollen, ins Warme, sie bergen. Ich war zu beschäftigt, zu fixiert.
´Denken Sie dran´, hatte sie gesagt. Woran denken? Er konnte sich nicht erinnern. Sie hatte was gesagt zu Beginn, so typisch wie die Freaks eben.
Und da fiel es ihm ein. Der wusste, wofür er lebte. Auch wofür er starb.
Hatte sie das gemeint? Egal, nun dachte er daran.
Und konnte den letzten Schritt nicht tun, konnte nicht. Wie gelähmt stand er. Ungeahnte Zeit. Bis er erschöpft zu Boden sank.
2 Mailand, Mitte März 1972
Tonio Bocacelli wusste, dass ihm kaum Zeit blieb. In spätestens einer halben Stunde musste die Sache gelaufen sein. Der kleine Weg entlang der Hochspannungsmasten, der in der ersten Dämmerung noch ganz verlassen lag, gewann nun langsam an Konturen. Er diente den Arbeitern der Kunststofffabrik als Abkürzung.
Er fummelte an dem Kästchen herum, das den Zeitzünder verbarg. Mist, warum hatte er das Ding nicht schon unten scharf gemacht? Hier oben brauchte er immer eine Hand, um sich festzuhalten. Ihm fiel ein, dass er gedacht hatte, dass er so Zeit sparen könnte. Ein Verleger ist eben kein Techniker.
Endlich hatte er den Draht angeschraubt und wolltte nun nur noch das Kästchen und den Sprengstoff passend an einer Nahtstelle des Mastes befestigen. Die Zeit verrann unerbittlich. In spätestens 6 Minuten musste er weit weg sein.
Nervös zog er einen Draht aus der Hosentasche. Gut. Und nun ein paar Meter rüber klettern mit dem Ding unterm Arm. Dort, weiter oben an der Ecke, wo eine zusätzliche Metallplatte die Stahlträger zusammenhielt, würde es die beste Wirkung erzielen und den Mast abknicken. Er befand sich etwa 15 Meter über dem Boden und hangelte sich an kleinen Bügeln weiter, die nicht sehr vertrauenserweckend wirkten.
„Schneller, du musst viel schneller sein!“
Endlich war er an der Stelle. Und die Zeit hätte auch gereicht. Doch der Draht zum Befestigen war weg. Verzweifelt wurde Tonio klar, dass ihm nur noch wenige Alternativen blieben. Er könnte alles abbrechen. Doch fast unerträglich schien ihm jetzt ein Versagen. Er brauchte endlich das Erfolgsgefühl nach seinem Ausstieg aus dem bürgerlichen Leben. Endlich das innere Wissen, den richtigen Weg gegangen zu sein, ja okay, das Machtgefühl über die Metropole, sie lahmlegen zu können mit diesem Akt. Lahmlegen die eigene korrupte Vergangenheit.
Es war einen Versuch wert gewesen, die ganze Sache mit der Bibliothek und dem Verlag. Zur Bildung des Volkes, Teilhabe an den Geschehnissen der Welt. Wie hatten sie über Jahre geschuftet und geackert! Die Gesellschaft verändern durch Bücher, geistiges Gegenüber zu politischen Tatsachen. Natürlich hat man sich auch selber etwas aufgebaut, die kleinen Annehmlichkeiten eben. Aber irgendwann hatte ihn alles nur angekotzt, er hatte sich wie ein Verräter gefühlt in all der Dekadenz, die ihn umgab. Wenn er die bolivianischen Tagebücher las, war ein unstillbares Heimweh über ihn gekommen. Es war so rein, so echt, was da stand, so aufrecht. Und was hatte er getan? Okay, kein Gewinn durch die Übersetzung, jede Lire abgeführt. Er konnte sich