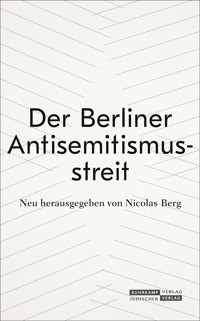
Der Berliner Antisemitismusstreit E-Book
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jüdischer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Sommer 1965 erschien Der Berliner Antisemitismusstreit, eine Sammlung von Dokumenten, Reden, offenen Briefen aus den Jahren 1879/80 über die Frage nach der Zugehörigkeit der Juden zur deutschen Nation. Herausgeber war Walter Boehlich (1921-2006), der legendäre Lektor des Suhrkamp Verlags, der einen kritischen Blick auf Heinrich von Treitschke, den Wortführer der Agitation, warf und auf die eigene Gegenwart Mitte der sechziger Jahre. Zur Zeit der Auschwitz-Prozesse in Frankfurt und gegen die landläufigen Vorurteile dokumentierte Boehlich den Antisemitismus nicht als Einstellung der »dummen Kerle« (August Bebel). Dieses Buch zeigt vielmehr, dass die Anfeindungen gegen die Juden im späten 19. Jahrhundert längst zu einer Sache der gebildeten Leute geworden war – der Universitätsgelehrten, Theologen und Intellektuellen. Ihre Sprache der Agitation mobilisierte die Vorurteile, Feindbilder, Verschwörungserklärungen und den Hass der Vielen. Der Berliner Antisemitismusstreit führt auch die Ressentiments vor Augen, das »Vokabular dieser Kultur« (Shulamit Volkov), das Demagogen bis heute für ihre judenfeindlichen Zerrbilder verwenden, wie der Herausgeber der Neuausgabe eindrucksvoll zeigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 821
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Der Berliner Antisemitismusstreit
Eine Textsammlung von Walter Boehlich
Neu herausgegeben von Nicolas Berg
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Jüdischer Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe 2023
© Jüdischer Verlag GmbH, Berlin, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
eISBN 978-3-633-77315-2
www.suhrkamp.de
Der Berliner Antisemitismusstreit
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
I. Einführung
Nicolas Berg
:
Der Berliner Antisemitismusstreit – Eine Neubetrachtung
Ein anderer kritischer Theoretiker im Frankfurt der
1960
er Jahre
Der Gegenwartsindex des Buches: Kritik der beschwiegenen
NS
-Zeit
Zur Rezeption von »Der Berliner Antisemitismusstreit«
Von der Gewalt der Sprache: Zu diesem Band
Dank
II. Ereignis- und Diskursgeschichte
Heinrich von Treitschke
:
Unsere Aussichten
(November
1879
)
Manuel Joël
:
Offener Brief an Herrn Professor Heinrich von Treitschke
(November
1879
)
Heinrich Graetz
:
Erwiderung an Herrn von Treitschke
(Dezember
1879
)
Heinrich von Treitschke
:
Herr Graetz und sein Judenthum
(Dezember
1879
)
Heinrich Graetz
:
Mein letztes Wort an Professor von Treitschke
(Dezember
1879
)
Harry Breßlau
:
Zur Judenfrage. Sendschreiben an Herrn Professor Dr. Heinrich von Treitschke
(Dezember
1879
)
Moritz Lazarus
:
Was heißt ›National‹? Ein Vortrag
(Januar
1880
)
Anhang über Ein- und Auswanderung der Juden in Preußen.
Heinrich von Treitschke
:
Noch einige Bemerkungen zur Judenfrage
(Januar
1880
)
Harry Breßlau
:
Nachwort zur zweiten Auflage
(Januar
1880
)
Wilhelm Endner
:
Zur Judenfrage. Offene Antwort auf das offene Sendschreiben des Herrn Dr. Harry Breßlau an Herrn von Treitschke
(Januar
1880
)
Vorwort
Nachwort
Hermann Cohen
:
Ein Bekenntniß in der Judenfrage
(Januar
1880
)
Ludwig Bamberger
:
Deutschthum und Judenthum
(Januar
1880
)
H. Naudh (d.i. Heinrich Nordmann)
:
Professoren über Israel. Von Treitschke und Bresslau
(Januar
1880
)
Erklärung (November
1880
)
Heinrich von Treitschke
:
Zuschrift an die Post
(November
1880
)
Heinrich von Treitschke
:
Antwort auf eine studentische Huldigung
(November
1880
)
Theodor Mommsen
:
Brief an die Nationalzeitung
(November
1880
)
Heinrich von Treitschke
:
Eine Erwiderung
(November
1880
)
Theodor Mommsen
:
Auch ein Wort über unser Judenthum
(Dezember
1880
)
Heinrich von Treitschke
:
Zur inneren Lage am Jahresschlusse
(Dezember
1880
)
Heinrich von Treitschke
:
Erwiderung an Herrn Th. Mommsen
(Dezember
1880
)
Theodor Mommsen
:
Nachwort zur dritten Auflage
(Dezember
1880
)
Heinrich von Treitschke
:
Die jüdische Einwanderung in Deutschland
(Januar
1881
)
Berthold Auerbach
:
Briefe an seinen Freund Jakob Auerbach
(Auszüge,
1875
-
1881
)
Levin Goldschmidt
:
Brief an Heinrich von Treitschke
(Mai
1881
)
III. Nachwort
Walter Boehlich
:
Der Berliner Antisemitismusstreit
(
1965
/
1988
)
Dank und Nachbemerkungen
IV. Quellen und ausgewählte Forschungsliteratur
Abkürzungsverzeichnis
Quellen, Quellensammlungen und Texte vor
1945
Lexika und Nachschlagewerke
Überblicksdarstellungen und Forschungsliteratur (ab
1945
)
Anmerkungen
Der Berliner Antisemitismusstreit – Eine Neubetrachtung
Fußnoten
Informationen zum Buch
I. Einführung
Nicolas Berg
Der Berliner Antisemitismusstreit – Eine Neubetrachtung
Diese Textsammlung zum modernen Antisemitismus in Deutschland, die hier – über ein halbes Jahrhundert nach ihrem Erstdruck1 – unter ihrem eingeführten Titel neu aufgelegt wird, ist zum Standardwerk, ja, zu einem Klassiker der Historiographie geworden.2 Ihr Titel gilt als Fachterminus in den Geschichts- und Sozialwissenschaften; mit der Bezeichnung Berliner Antisemitismusstreit wurden und werden – ohne dass die Angabe einer Jahreszahl nötig wäre – Ort und Zeit eines Schlüsselereignisses der deutschen und jüdischen Geschichte auf den Begriff gebracht: Der publizistische Angriff auf die Juden im November 1879 durch Heinrich von Treitschke, den berühmten Historiker und Nachfolger Leopold von Rankes an der Berliner Universität. Zu den Ereignissen der folgenden Monate, die seinerzeit – und auch noch im 20. Jahrhundert – »Treitschkes Federkrieg«, »Treitschkes Judenfrage«,3 »Judenstreit«4 oder einfach »Judenhetze«5 genannt wurden,6 gehören die vielen Entgegnungen jüdischer Gelehrter, Schriftsteller, Politiker und Rabbiner, die den Artikel »Unsere Aussichten« in den Preußischen Jahrbüchern entsetzt lasen und die judenfeindlichen Auslassungen bestürzt zurückwiesen. Darauf reagierte Treitschke seinerseits mit scharfen Repliken, und er fasste zudem seine in rascher Folge entstandenen Beiträge in einem Separatdruck mit dem Titel Ein Wort über unser Judenthum (1880) zusammen, der mehrere Auflagen erhielt, in andere Sprachen übersetzt wurde und wiederum neue Antworten provozierte.7 Die jüdischen Kritiker Treitschkes waren, so die Historikerin Shulamit Volkov, »fassungslos«.8 Sie antworteten ihm im Bewusstsein, Zeugen und Adressaten eines völlig neuen Tons der Anfeindungen geworden zu sein. Exemplarisch sei der Ausruf »Das also müssen wir noch erleben!« zitiert, den Berthold Auerbach im Herbst 1880 in einem Brief äußerte;9 auch der Eingangssatz von Hermann Cohens Ein Bekenntniß in der Judenfrage (1880), mit dem der Marburger Philosoph seine Antwort auf die publizistischen Zumutungen Treitschkes einleitete, vermittelt diese Erschütterung: »Es ist also doch wieder dahin gekommen, daß wir bekennen müssen.«10 Für die meisten der jüdischen Kommentatoren, ob im damaligen Streit selbst oder im Rückblick auf das Ereignis in den Jahrzehnten um 1900 und noch in der Weimarer Republik, wirkten die wiederkehrenden Gesten und Akte der Judenfeindschaft in der Regel wie etwas Überlebtes, wie ein Relikt aus anderen Zeiten; sie waren kränkend, aber zugleich waren sie in ihrer stereotypen Machart auch »einfach langweilig« geworden, wie dies etwa der 1871 geborene jüdische Historiker Gustav Mayer, der im Studium selbst Vorlesungen bei Treitschke gehört hatte, in seinen Memoiren pointiert formuliert hat. Er gestand, er habe sich immer »nur widerwillig« entschließen können, »Schriften pro und contra zu lesen«; lange Zeit habe er, so Mayer im Rückblick auf die Zeit seines Studiums, »die Ritualmordprozesse in Konitz und Xanten oder die Wahl des Rektors Ahlwardt in den Reichstag« und andere antisemitische Ereignisse als »letzte Zuckungen mittelalterlicher Verirrung« betrachtet; sie waren »für mich lediglich Überreste der Vergangenheit, die das Fortschreiten der Zivilisation bald auf den Schutthaufen der Geschichte kehren würde«.11
Mit Treitschkes Artikel änderte sich das. Seine Ausfälle wogen auch deshalb so schwer, weil er Universitätsprofessor und dazu noch Historiker war und mit seiner akademischen oder »gebildeten« Judenfeindlichkeit der studentischen Jugend und dem Bildungsbürgertum das neue Register eines »intellektuellen Antisemitismus« (Eva Reichmann12) anbot und seine Ausfälle nicht auf der Straße oder von der Kanzel, sondern vom Katheder aus verbreitete. Mit diesem Artikel Treitschkes wurde der »Universitätsantisemitismus«13 begründet oder doch wesentlich gefördert und dort verankert. Auf jeden Fall traten mit Treitschkes Essay neue Kategorien der Anfeindung, eine andere Selbstbegründung dieser Feindseligkeit und auch eine andere Sprache in die Welt, die zuvor eine andere – sozusagen anstößige – Aura gehabt hatte. Der Schriftsteller Berthold Auerbach schrieb treffend, durch Treitschke habe »eine niedrige Sache eine gewisse Erhöhung gewonnen«14, und so sahen es die meisten Zeitgenossen. Auf einmal wurde dem Hass auf die jüdische Minderheit eine neue Dimension zuteil, eine Legitimation, die wie von der höheren Warte der Wissenschaft her erfolgte. Zuvor hatten in der Regel – eine Ausnahme war der populäre Berliner Hofprediger Adolf Stoecker, der zeitgleich die antijüdische Stimmung parteipolitisch anheizte – kaum bekannte Agitatoren antijüdische Pamphlete verfasst oder Hetzreden gegen Juden gehalten, in denen sie religiöse Vorurteile schürten oder schlicht und einfach soziale Ressentiments verbreiteten. Mit dem Text Treitschkes war eine Aufwertung des zuvor anrüchigen Geschreis erfolgt: Seine Agitation übernahm die »alte Misère« (Ludwig Bamberger) und entwickelte zugleich neue Vorurteile und Ressentiments, die auch Treitschke nicht kaschierte, sondern im Gegenteil geradezu lustvoll verbreitete; doch erlangten sie bei ihm ein zusätzliches Gewicht, weil sie nun Teil einer nationalpatriotischen Haltung wurden. Auf einmal glichen sie einem Bekenntnis zur Nation und veränderten auf diese Weise ihren Status, ihren »Sinn«, wenn man einmal immanent argumentiert: Antisemitismus wurde zum integralen Teil von »Deutschtum«, jenem von Treitschke so ostentativ beschworenen Wert, der ihm zufolge seine Wurzeln nicht in höherer Bildung, sondern im Volk, im »Instinkt der Massen«15 habe. Diesen neu begründeten Hass gegen die Juden zeichnete Treitschke also in ein kollektives Selbstbild der Deutschen ein; er wurde zusammen mit »kirchlichem Sinn« und »religiösem Ernst«16 zum Teil »nationaler Gesittung«17, Ausdruck »germanischen Wesens«,18 und er gesellte sich zu den vermeintlich deutschen Tugenden wie »Arbeitsfreudigkeit« oder »Ehre«.19 Die Anfeindungen trug Treitschke zudem in einem dringlichen Ton der Gefahr und in einer autoritativen Haltung der Deutung vor; sie erschienen nicht als Selbstzweck oder als Werturteil, sondern er formte sie zu einem säkularen Geschichtsbild der Gebildeten, dessen antiliberale Ideologie er im Ton einer Warnung und in der Haltung des Selbstschutzes oder gar der Notwehr verbreitete.20 Damit aber war Judenfeindlichkeit zu etwas ganz anderem geworden.21 Aus der immer schon gehässigen Doktrin eines religiösen Dogmas, einer sozialen Gruppierung oder einer politischen Parteiung hatte sie sich in die Verschwörungserzählung einer nationalen Bewegung verwandelt, die den Verdacht gegen Juden beförderte und ihnen Machenschaften unterstellte, durch die hinter den Kulissen die deutsche Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft gesteuert würden. Mit dieser Ideologie, nach der das vermeintlich Eigene gegen das angeblich Andere, Fremde zu verteidigen war, kämpfte man nun nicht mehr nur für seinen christlichen Glauben oder etwaige materielle Interessen; mit ihr hielt man jetzt ein »nationales Identitätspostulat«22 hoch, ein Kollektivbild von sich selbst als Volk. Treitschke machte »die deutsche Judenfrage«23 mit einer solchen Vehemenz zum Thema, als sei gerade sie für die Deutschen das größte Problem der Zeit. So sprach aus ihm die Weltanschauung, die auch das Ziel seiner volkspädagogischen Publizistik und Geschichtspredigten war: die auf diese Weise gesetzte Behauptung einer kulturellen »Kluft zwischen abendländischem und semitischem Wesen«, ja, eines Gegensatzes von Deutschtum und »Semitenthum«.24 In dieser dichotomen Konstruktion zweier weltanschaulicher Entitäten verbreitete Treitschke ein zur deutschen Selbstwahrnehmung exakt spiegelbildlich aufgebautes Gegenbild der Juden.25 Er beschimpfte sie nicht nur, sondern er »erklärte« sie auch – und im Kontrast zu ihnen zugleich auch die Deutschen. Diese Antinomie zweier vermeintlich unveränderlicher Kollektive, die der Soziologe Norbert Elias später die »Dualität des nationalstaatlichen Normenkanons«26 nannte, wurde von Treitschke auch mit Formeln und Redensarten zur Kritik der Moderne und ihrer Schattenseiten ausgeschmückt, die er ebenfalls aus der vermeintlich »colossale[n] Macht«27 der Juden ableitete und mit der er allenthalben »den Einbruch des Judenthums in das deutsche Leben«28 beklagte. Mit Treitschke wurde der obsessive »Haß gegen dies fremde Wesen« zusammen mit dem angstschürenden Warnruf vor dem »Gespenst der jüdischen Dominanz« (Peter Longerich)29 nun anders sagbar als zuvor und mit sowohl völkisch-nationalen als auch kultur- und identitätspolitischen Argumenten zum integralen Teil des Selbstbilds der Deutschen, einer Ab- und Ausgrenzungs-Weltanschauung, die für Juden keinen Platz mehr bot. Es ist diese zur gesellschaftlichen Macht gewordene Sagbarkeit antisemitischer Ungeheuerlichkeit, die vor allem mit dem Namen Treitschkes verknüpft bleibt. Sie wird auch in jener bekannten Sentenz von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer zur Erkenntnis, die in ihrer Dialektik der Aufklärung – ohne den Namen Treitschkes zu nennen – die neue Haltung, die mit ihm begann, voller Sarkasmus wie folgt beschrieben: »Aber es gibt keine Antisemiten mehr. Sie waren zuletzt Liberale, die ihre antiliberale Meinung sagen wollten.«30
Die Ereignisse und Einsprüche, die dieser Essay Treitschkes auslöste, heißen also seit 1965 in der Forschung »Berliner Antisemitismusstreit«, eine Wendung, die im deutschen Original auch Eingang ins Englische gefunden hat (wenn es dort nicht – analog dazu – »The Berlin Antisemitism Dispute« heißt31). Die zweibändige, wissenschaftlich kommentierte Edition im Verlag K.G. Saur, die 2003 vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin auf den Weg gebracht wurde und auf mehr als 900 Seiten die Anzahl der Quellen verfünffachte, wählte aus guten Gründen denselben Titel der Ausgabe von 1965 und setzte ihn, halb als Zitat, halb als Hommage, in Anführungszeichen.32 In beiden Editionen umfasst der dokumentierte Ereigniszusammenhang neben Treitschkes Radikalisierungen, die er als Selbstverteidigung betrachtete und ohne Konzession oder gar Rücknahme, dagegen mit trotzigen Überbietungen, vortrug, auch den sich einstellenden Beifall der völkischen Rechten, aus deren Reihen er Zuspruch erhielt – mit Parolen und Schlussfolgerungen, die er selbst nicht vertreten hatte. Die bekannteste Intervention im Verlauf des Streits, der Einspruch des Althistorikers Theodor Mommsen, war der Höhepunkt des Streits und bildete zugleich seinen Abschluss. Als Universitätskollege sprach Mommsen im Namen desselben Fachs und für dieselbe Institution, als er im Dezember 1880, ein Jahr nachdem Treitschke den Streit entfesselt hatte, als einziger nichtjüdischer Gelehrter von Rang die Autorität seines Namens einsetzte, um den politischen Liberalismus zu verteidigen und dabei auch den jüdischen Deutschen öffentlich beizustehen.33
Ein anderer kritischer Theoretiker im Frankfurt der 1960er Jahre
Die Erstausgabe dieser Quellenanthologie erschien als sechster Band einer neu konzipierten Reihe, der Sammlung Insel, die seit Sommer 1965 mit hohen Erwartungen vom Suhrkamp Verlag (er hatte den Insel-Verlag kurz zuvor übernommen) auf den Weg gebracht wurde. Mit der Buchreihe sollte der herkömmliche Kanon der deutschsprachigen politischen Kultur und Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts erweitert und »die Möglichkeit einer republikanischen Gegengeschichte« erschlossen werden.34 Das Reihenkonzept formulierte die Revision des Traditionsbegriffs und zielte auf eine Neu- oder Wiederentdeckung vergessener Autoren: ideengeschichtliche und kulturpolitische Positionen eines vorherrschenden preußisch-protestantischen Selbst- und Geschichtsverständnisses, das gänzlich auf Staat und Nation zentriert war, standen auf dem Prüfstand; demgegenüber sollten die in der Sammlung Insel erschienenen Bände einem breiten Lesepublikum die Texte eines demokratischeren, »besseren Deutschlands« zugänglich machen.35 Die ersten Bände der Reihe waren neben Bertolt Brecht und Walter Benjamins Briefsammlung »Deutsche Menschen« (zuerst 1936 in der Schweiz unter Pseudonym erschienen) Texten von Georg Büchner, Denis Diderot, dem Volksaufklärer der Goethezeit Johann Peter Hebel, einem Roman des 48er-Revolutionärs Georg Weerth und Karl Marx’ Essay »Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte« gewidmet. Zu ihren Herausgebern gehörten Hans Blumenberg (Bd. 1), Hans Magnus Enzensberger (Bd. 3), Ernst Bloch (Bd. 7), der Verleger Siegfried Unseld selbst (Bd. 2 und 8), Herbert Marcuse (Bd. 9) und Theodor W. Adorno (Bd. 10). Hans Mayer gab eine Textauswahl von Jean Paul heraus (Bd. 13) und Karl Markus Michel stellte ein politisches Lehrbuch mit einer Textauswahl aus Kleist, Moses Hess und dem französischen Philosophen und Reiseschriftsteller Constantin François Volney zusammen (Bd. 15). Aus der Zeit bis August 1965 sind im Archiv des Verlags mehrere Vorschlagslisten überliefert, auf der Suhrkamp-Autoren und -Berater weitere Ideen für die Reihe zusammentrugen; diese Vorschläge wurden natürlich nicht allesamt verwirklicht, aber sie lassen die Grundidee der Sammlung Insel als eine der großen frühen Verlagsunternehmungen erkennen. Adorno etwa empfahl das Vorhaben, »Große Verfolgungen: Waldenser, Kreuzzüge etc.« zu dokumentieren (als Bearbeiter wurde hier der Name von Max Horkheimer angegeben); außerdem stehen in der von Adorno genannten möglichen Buch- und Editionsliste Projekte mit den Arbeitstiteln »Die andere Romantik: Dokumentation über aufklärerische, revolutionäre und nonkonformistische Tendenzen in der frühen Romantik« und »Der junge Hegel als politischer Kritiker«; Adorno führte auch die folgenden Vorschläge auf: »Dokumentation über den aufkommenden Nationalismus seit Fichte und Kleist«, »Die Emanzipation der Frau: Schein und Realität« sowie »Nietzsche: Auswahl seiner Kritik der deutschen Ideologie«.36 Walter Jens schlug für die Sammlung Insel vor, den Briefwechsel zwischen Mendelssohn und Lessing und die Schulschriften Herders herauszubringen; und der Adorno-Schüler Hermann Schweppenhäuser steuerte die Ideen »Grosse Atheisten«, »Opposition der Vorklassik und Klassik«, »Opposition des Vormärz«, »Revolutionäre und reaktionäre Klassik« sowie »Utopien« bei.37 Ein anderer Schüler von Adorno, Rolf Tiedemann, gab die Namen des Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi und des Sprachkritikers Carl Gustav Jochmann zu Protokoll; Enzensberger nannte die französischen Aufklärer und Schriftsteller Voltaire, Victor Hugo, Honoré de Balzac und Anatole France; Walser eine Edition mit Briefen von Gustav Landauer.38 Auf der Liste standen – ohne Namensnennung derjenigen, die die Idee einbrachten – auch der Vorschlag, Theodor Mommsens politische Schriften zu edieren, sowie die Namen Johann Gottfried Seume, Jakob Michael Reinhold Lenz, Ludwig Börne und Heinrich Heine. Mit seiner Einschätzung, dass die Sammlung Insel einen »Kontrapunkt« zur vormaligen »bürgerlichen Schöngeistigkeit der repräsentativen Insel-Bücherei« etablieren wollte, lag der Rezensent Heinrich Vormweg im Oktober 1968, als er die Reihe als Ganzes besprach, sicherlich nicht weit entfernt von der Intention des Verlags.39
Dies war, aus einer verlegerischen Perspektive betrachtet, der intellektuelle Anspruch und der politisch-publizistische Kontext des sechsten Bandes: Der Berliner Antisemitismusstreit bot den Lesern eine Art nachgeholte Lektion. Die zweiundzwanzig voraussetzungsvollen Quellentexte aus dem Kaiserreich verhandelten die Frage nach den antisemitischen Traditionen im gebildeten Milieu der Universität, und dies in der Reihennachbarschaft von Büchern, die allesamt einen anderen, kritischen Blick auf das späte 18., das 19. und das frühe 20. Jahrhundert warfen. Der sechste Band repräsentierte die Zielsetzung der Reihe in idealtypischer Weise, denn in ihm wurde beides zugleich Thema: Er forderte die Leserinnen und Leser mit Nachdruck auf, antiliberale, nationalistische und – mit diesen verbunden – antisemitische Traditionen der herkömmlichen nationalen Geschichtsschreibung in Deutschland kritisch zu rekapitulieren. Zugleich holte er hier auch die Stimmen Gelehrter in die Gegenwart, die nach dem Holocaust in einer breiteren Öffentlichkeit nicht mehr bekannt waren und die diesen so belasteten deutschen Traditionen bereits als Zeitgenossen intellektuellen und politischen Widerstand entgegengesetzt hatten: Manuel Joël, Heinrich Graetz, Harry Bresslau, Ludwig Bamberger und Hermann Cohen. Ihre einhellige Warnung vor Treitschkes Feier des Nationalstaats, die er mit antisemitischen Schmähungen verband, ließ sich im Rückblick als weitsichtige Diagnose lesen, wie auch diejenigen der nichtjüdischen Verteidiger des liberalen Deutschlands, für die Theodor Mommsen steht. Diese jüdischen Gelehrten und liberalen Protestanten wandten sich nach der Reichseinigung von 1870/71 gegen eine politisch-ideologische Überhöhung des neuen Machtstaats und gegen den Versuch, Juden aus ihm auszugrenzen. Es waren Stimmen, die im Gegensatz zum Nationalpatriotismus, den Treitschke zur Norm erhoben und propagiert hatte, einen Verfassungspatriotismus avant la lettre entwarfen und einen anderen, weltbürgerlich verstandenen Begriff der Nation verteidigten. Ein solcher war in den 1870er Jahren zu einer Minderheitenposition geworden.40 Zwar konnten die Kritiker Treitschkes die Wirkung seiner Agitation seinerzeit nicht aufhalten; aber ihre Worte konnten nun, in der Bundesrepublik, in einer erneuerten Perspektive als vorbildhaft gelesen werden. So liegt das intellektuelle Zentrum des Bandes in dieser dialektischen Zusammengehörigkeit von Warnung auf der einen Seite und der Suche nach neuen Vorbildern auf der anderen.
Verantwortlich für Idee, Konzept und Ausführung des Bandes war der am 16. September 1921 in Breslau geborene Lektor, Übersetzer und Kritiker Walter Boehlich, für den eigentlich keine der genannten Berufsbezeichnungen ganz passt, weil er immer alles zugleich und stets mehr als nur das war.41 Öffentlich gewürdigt wurde immer wieder Boehlichs Haltung als solche, seine Rolle als »Republikkritiker«,42 als Vermittler und als einer der intellektuellen und kulturellen Übersetzer im weitesten Sinne des Wortes. So nannte ihn die Neue Zürcher Zeitung respektvoll eine »intellektuelle Eminenz«, einen Polemiker von hohen Graden, von umfassender Belesenheit und »intellektueller Schärfe«, dessen »Anteil an der ›Suhrkamp-Kultur‹, an der literarischen Wiedereinbürgerung der unter den Nazis verfolgten jüdischen Schriftsteller und Denker« groß gewesen sei.43Der Tagesspiegel und die Frankfurter Rundschau charakterisierten ihn als »eine der letzten genuinen Literatenfiguren« und »eine der großen intellektuellen Gestalten der alten Bundesrepublik«.44 Auch die Süddeutsche Zeitung, die für ihren Nachruf den Titel »Der Aufständische« wählte, schrieb über die disziplinär nicht festgelegte Bildung Boehlichs in einem markanten Bild, dass dieser sich zeit seines Lebens geweigert habe, »dem Dreieck aus Literatur, Philosophie und Geschichte jemals eine Spitze abzubrechen«.45 Die Jüdische Zeitung fasste ihr Porträt auf treffende Art und Weise wie folgt zusammen: »Walter Boehlich […] hat Büchern gedient: er hat sie übersetzt, lektoriert und kritisiert. Auf allen drei Feldern war er hoch geschätzt und außerordentlich gefürchtet.«46
In der Tat ist Boehlichs Bedeutung für die Verlags- und Kulturgeschichte der Bundesrepublik kaum zu überschätzen. Sie ist zwar Kennern seit Langem allgemein bekannt, doch wurde die genaue Rolle, die er in zentralen Debatten bundesdeutscher Selbstverständigung über viele Jahrzehnte hinweg einnahm, lange verkannt,47 spät gewürdigt und erst seit gut zehn Jahren auch mit Forschungsprojekten, Editionen und Publikationen gründlich vermessen. So erschien 2011, herausgegeben von Helmut Peitsch und Helen Thein, eine Auswahl seiner wichtigsten verstreut publizierten Aufsätze, Essays, Studien, Vorworte und Radiofeatures.48 Liest man diese Texte heute im Zusammenhang, so erscheinen einem viele von ihnen immer noch als relevant, als Quelle für die Selbstreflexion der Zeit und nicht selten auch als hellsichtige Vorwegnahme der historiographischen Deutungen jener Zeit; sie haben ihre Frische behalten und ähneln oft dem Bild, das wir von der Bundesrepublik in langer Sicht ausgebildet haben. Boehlichs Grundhaltung der frühen 1960er Jahre drückt sich etwa in einem Brief an Wolf Jobst Siedler aus, zu dessen Konservativismus Walter Boehlich diametral stand, den er aber als Gesprächs- und Briefpartner schätzte und demgegenüber er die Protesthaltung der Linken grundsätzlich verteidigte, weil sie die deutsche Mehrheitsmentalität in Öffentlichkeit und Politik infrage stellte, »die auf der Bewußtseinsstufe von 1900« stehengeblieben sei: »Mir scheint«, so fasste Boehlich seinerzeit seine Einschätzung zum Verhältnis von Politik und politischer Kultur mit sarkastischer Schärfe zusammen, »daß etwas Wesentliches nicht in Ordnung ist, wenn diese Leute [gemeint ist die politische Elite], die unsere Geschicke so trefflich lenken, nicht die geringste Bindung an das besitzen, was uns als Kultur der Zeit erscheint.«49 Helmut Peitsch und Helen Thein legten zusammen mit den Schriften Boehlichs vor gut zehn Jahren auch die Ergebnisse einer ihm gewidmeten Tagung vor.50 Diese Aufsätze zeichneten Boehlichs Rolle in politischen Kontroversen und in literarischen Debatten der Nachkriegszeit und der alten Bundesrepublik detailliert nach. Der Sammelband enthält das Porträt von Boehlichs wertvoller Privatbibliothek, Untersuchungen über seine Arbeit als Kritiker und Übersetzer aus mehreren Sprachen (u.a. aus dem Französischen, Spanischen, Englischen und Dänischen) sowie über seine besondere Rolle in den Aufbaujahren des Suhrkamp Verlags.51 Andere Beiträge beleuchten Boehlichs Interventionen wie Themen der deutschen und deutsch-jüdischen Geschichte, seine intellektuelle und publizistische Pionierrolle bei der öffentlichen Forderung nach der überfälligen Selbstkritik und der allgemeinen Reform der Universitäten und vor allem bei der immer drängender gewordenen Notwendigkeit einer Aufarbeitung ihrer fatalen Rolle in der Nazizeit.52 Markant tönte seine Stimme etwa in der Debatte um die braunen Wurzeln der bundesdeutschen Germanistik, in dieser Frage ergriff Boehlich seit den späten 1940er Jahren mehrfach vehement das Wort, etwa, als er die »von faschistisch auf demokratisch« umgedrehte »Windfahnenliteratur« kritisierte oder als er mit Verve mit einer »unhistorische[n] und unphilologische[n] Form der Literaturforschung abrechnete, die sich in pseudophilosophischer Verschwommenheit« gefiel. Sein wirkungsvollster Artikel aber war 1964 in der Wochenzeitung Die Zeit eine Kritik an der Bonner Universität, als diese den Germanisten Hugo Moser zum Rektor gewählt hatte, der im »Dritten Reich« in NS-Manier vom »Weltjudentum« schwadroniert hatte.53 Vor kurzem wurden auch Boehlichs Kolumnen und Zeitkommentare in der Zeitschrift Titanic in einem Auswahlband publiziert.54 Zuletzt erschien eine umfangreiche Briefedition, für die Christoph Kapp und Wolfgang Schopf etwas über zweihundert Briefe Boehlichs ausgewählt und kommentiert haben, unter anderem an Paul Celan, Martin Walser, Peter Suhrkamp, Ernst Robert Curtius, Gottfried Benn, Hans Magnus Enzensberger, Uwe Johnson, Ingeborg Bachmann, Max Frisch, Samuel Beckett, Gershom Scholem, Peter Szondi, Ernst Bloch, Helmuth Plessner, Hans Mayer und Hilde Domin.55 Christoph Kapp hat zudem eine ganze Reihe von Studien zu Themen aus Boehlichs Leben und zu dessen Werk vorgelegt.56
Aus heutiger Sicht scheint es, als wäre im Deutschland der 1960er Jahre kaum jemand besser dafür geeignet gewesen, die editorische Verantwortung für eine Quellensammlung zum Berliner Antisemitismusstreit und für dessen Deutung zu übernehmen, als Walter Boehlich. Er wehrte sich gegen alles, was die vernebelnde Rhetorik vom »Deutschtum« verteidigte oder fortsetzte, und er wandte sich damit gegen jeglichen politischen wie intellektuellen Nationalismus, die ihm seine Jugend so vergällt hatten. Nichts erschien ihm im akademischen Milieu dringlicher als die Aufgabe der Universität, sich vom »Muff« der Weltanschauungsfächer Germanistik, Romanistik und Geschichte »zu befreien«.57 In einem Brief an den Bonner Historiker Paul Egon Hübinger schreibt Boehlich über seine Studienerfahrungen in der Germanistik: »Ich habe selbst Lehrer gehabt, und gerade in der Germanistik, die die Hitlerei so integer überstanden haben, wie nur denkbar und wünschenswert – sie sind nie auf den Gedanken gekommen, dass vieles von dem, was ihnen unter Hitler unerträglich war, seine Wurzel in der Lehre ihrer eigenen Lehrer hatte, dass sie also, obwohl persönlich integer, ein wenig umlernen müssten. Nein, sie haben, was den Keim der Erkrankung so deutlich in sich trug, unbeirrbar verteidigt, als wäre es das Heilmittel selbst.«58 In einem Schreiben an den Romanisten Michael Nerlich fasste Boehlich die Grundhaltung seines Lebens deshalb so zusammen: Seine Generation, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in ihren Zwanzigern stand, hatte durch die Geschichte die Möglichkeit bekommen, »mit etwas Neuem ganz neu anzufangen«.59 Diesen Neubeginn hat Boehlich sich zur Aufgabe gemacht, aber auf eine aufgeklärte Weise, also gerade nicht als Fiktion einer neuen »Stunde Null«-Ideologie, sondern genau umgekehrt in Form historischer Selbstaufklärung, also eingedenk der Geschichte. Schon Boehlichs eigene Familien- und Herkunftsgeschichte, seine Bildungsbiographie und Sozialisation, hatten ihn skeptisch gegen Kollektivkonstruktionen und nationale Ideologien gemacht. Ende der 1950er Jahre schrieb er an Max Rychner: »Man wird als so vieles geboren. Ich zum Beispiel als Breslauer, Schlesier, Preusse, dann erst Deutscher (die deutsche Staatsbürgerschaft habe ich sogar nie erworben, bin Preusse geblieben, als der große Führer, der die alten Staatsbürgerschaften annullierte und dafür die deutsche einführte, mich, aus bekannten Gründen, ausnahm). Ich habe nie eine Unvereinbarkeit zwischen diesen Teilbürgerschaften erkennen können und muß gestehen, daß es mir leichter fällt, mich für ein künftiges Europa zu begeistern als für das vergangene Schlesien.«60 Mit dieser Grundhaltung als Breslauer und Europäer und mit der Renitenz, auf seinem Recht zu beharren, »ein Individuum zu sein, ohne einer Gruppe zugeschlagen zu werden«, bildete sich Boehlich, der wichtige Jahre der intellektuellen Entwicklung und Entfaltung als Assistent von Ernst Robert Curtius tätig war, zu einem textgenauen Philologen und Universalgelehrten, der sich das hermeneutische Ideal als einen »Weg zu geschichtlichem Sehen«61 vorstellte. Boehlich war zudem immer auch ein politischer Kopf, und er kannte auch das preußisch-protestantische Traditionserbe, das in dieser Debatte in seiner (in der Persönlichkeit von Treitschke personifizierten) aggressiven Einseitigkeit zu rekonstruieren war, nicht nur als einen angelernten historischen Stoff, sondern als Teil seiner eigenen Familiengeschichte. Und auch die andere Tradition, die einer liberalen deutsch-jüdischen Weltläufigkeit, war in seine Biographie eingegangen. Das ideelle Substrat der Dokumente, die Boehlich in Der Berliner Antisemitismusstreit vorlegte, war noch lebendiger Teil seiner individuellen Lebenserfahrung gewesen. Nun gab er die daraus gewonnenen Einsichten dem Gedächtnis der Bundesrepublik in Form von Dokumenten historisch objektiviert und als dringend zu rekapitulierende Lektion zurück, als »halb und halb Aussenstehender« und Sohn einer Ehe, in der beide Traditionen zusammengetroffen waren: die protestantische und die jüdische.62 Sein Vater, der schlesische Schriftsteller Ernst Boehlich, hatte die 1891 geborene Bibliothekarin Edith Josephson geheiratet, die aus einer jüdischen Familie kam, sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts aber protestantisch taufen ließ und dabei umbenannte und den Familiennamen Jansen annahm. Boehlichs Mutter wurde im »Dritten Reich« ungeachtet des Übertritts ihrer Eltern (auch sie selbst waren protestantisch getauft) Anfang Januar 1944 nach Theresienstadt deportiert. Während sie die Befreiung des Lagers am 9. Mai 1945 erlebte, hatte sich ihre Mutter in Hamburg das Leben genommen, als sie den Deportationsbefehl erhielt. Walter Boehlich und sein Zwillingsbruder Wolf waren in den Hitlerjahren in der Terminologie der notorischen »Nürnberger Gesetze« also »Halbjuden« oder sogenannte »eindeutschungsfähige Mischlinge«. Im Frühjahr 1940 wurde Walter aus der Wehrmacht, in die er als 18-Jähriger noch freiwillig eingetreten war, aufgrund seiner familiären Herkunft ausgeschlossen. Walter Boehlich studierte danach als Gasthörer ohne Studienerlaubnis Kunstgeschichte und Germanistik, zuerst in Breslau, nach Kriegsende dann in Hamburg, der Heimatstadt seiner Mutter. Im Rückblick auf sein Leben erkannte Boehlich diese Studienjahre in der »völkisch gewordenen Germanistik« als intellektuellen Wendepunkt, der in ihm den Grundstein seiner lebenslangen Überzeugung gelegt hatte, »daß Literatur nichts primär Nationales ist […]«.63 Als junger Mann begann er schon früh für wissenschaftliche Zeitschriften und Zeitungen zu schreiben, für die Zeitschrift für deutsche Philologie und die Hamburger Akademische Rundschau etwa, ab 1947 im engen Austausch mit Curtius in Bonn dann auch für den Merkur, für die Wochenzeitung Die Zeit, die Süddeutsche Zeitung und auch für das Feuilleton der ihm politisch fernstehenden Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das seinerzeit von Karl Korn geleitet wurde. Eine Universitätskarriere und Assistenzstelle, die ihm von dem deutsch-jüdischen Literaturwissenschaftler und Remigranten Richard Alewyn Ende der 1950er Jahre angeboten worden war,64 lehnte Boehlich ab. Stattdessen war er in den 1950er Jahren mehrere Jahre als Lektor und Deutschlehrer in Aarhus und Madrid tätig. Ab 1957 arbeitete er dann über ein Jahrzehnt als Lektor, Übersetzer und Herausgeber im Suhrkamp Verlag Frankfurt, nach dem Tod von Peter Suhrkamp 1959 mit Siegfried Unseld als Verleger. In dieser Konstellation, halb als Verlagsmitarbeiter, halb als selbständiger Herausgeber und Kritiker, entstand seinerzeit auch der Band mit den Dokumenten aus der Zeit zwischen November 1879 und Januar 1881.
Kaum ein Begriff eignet sich besser dafür, die Arbeit und das berufliche Selbstverständnis von Walter Boehlich zu charakterisieren, als derjenige der »Kritik«. Kritik – das war für ihn ein hohes Ethos, eine moralische Aufgabe im Namen der Gesellschaft, die Übernahme der Verantwortung für den Aufbau und die Verteidigung (des Wünschenswerten) ebenso wie für die Zerstörung und Zersetzung (des haltlos gewordenen Falschen); sie umfasste die Geste der Zustimmung und Aneignung wie die der Zurückweisung und des Widerspruchs, beides aber hatte das Ergebnis einer Prüfung – eben der vorangehenden Kritik – zu sein, niemals ein weltanschauliches Apriori. Kritik war das alles grundierende Fundament, für das die klassische Literatur das Vorbild darstellte; für Boehlich wurde die Haltung der Kritik zur entscheidenden Zutat, die Kultur im emphatischen Sinne überhaupt zu Kultur machte. Kritik war sozusagen Kultur in der antiessentiellen Form des Diskurses, denn nur an einem solchen Kulturbegriff wollte sich Boehlich auch beteiligen. Der falsche, seinerzeit »bürgerlich« genannte Kulturbegriff enthistorisierte die Kunstwerke, er trennte »die Welt des Geistes« von der Politik, nötig sei aber, so Boehlich, gerade das Gegenteil, ein Verständnis beider zusammen aus dem Kontext der Zeit, die sie auch beide hervorbrachte. Kritik war somit das Gegenteil von »Wesenskunde«, sie war eine Begründung im wörtlichen Sinne, ein Akt der Grundlegung und der Prüfung, durch den alles, was Bestand reklamierte, hindurchmusste. Im modernen Sinne war Kritik nicht nur das Milieu, in dem man miteinander über die entscheidenden Dinge sprach und schrieb, sondern auch eine Art von Erkennungszeichen all jener, die Tradition nicht um ihrer selbst verstanden wissen wollten. Und da Kritik der Aufklärung und der Rationalität verschrieben war, erhielt sie auch ihre wesentlichen Bestimmungen durch diese; sie umfasste Selbstkritik und war in Inhalt und Form das Gegenprinzip jenes unheilvollen nationalistischen Wahlspruchs »Right or Wrong – my Country«. Deswegen war Kritik natürlich auch ein politisches Bekenntnis, denn da sie nur mit dem freien Wort und der Unabhängigkeit der Meinungsäußerung das sein und werden konnte, was ihre Aufgabe war, war auch die Opposition zu restaurativen und reaktionären Tendenzen in Politik, Wissenschaft und Kultur der frühen Bundesrepublik nur in einer Form zu haben: in der Kritik des Bestehenden und dem Aufzeigen von verschütteten Traditionslinien, deren Gefahren und Potentiale für die Gegenwart neu zu prüfen und zu formulieren waren. Als Walter Boehlich 1963/64 zur Mitwirkung an der Sendereihe des Hessischen Rundfunks »Sind wir noch das Volk der Dichter und Denker?« eingeladen wurde, sagte er seine Teilnahme mit einem programmatischen Beitrag zu, der »Kritik und Selbstkritik« überschrieben war und der mit folgenden Sentenzen begann: »Kritik in Deutschland hat es schwer, fast so schwer, wie Kritik an Deutschland, und das könnte daran liegen, daß zu oft Kritik in Deutschland mißverstanden wird als Kritik an Deutschland.«65 In einem aufschlussreichen Brief an Peter Szondi, der den Suhrkamp Verlag in jener Zeit immer wieder als Literaturwissenschaftler beriet, hat Walter Boehlich die Dialektik von Historisierung und Kritik in die folgenden Worte gefasst: »Was den kritischen Ton angeht, haben Sie sicher recht; der könnte eindeutiger sein. Freilich glaube ich, daß überall da, wo die Sammlung Insel Dokumente veröffentlichen wird, die Kritik nicht in den Dokumenten selbst, sondern in deren Publikation zu suchen sein wird. Es soll da etwas gezeigt werden, was vergessen, verdrängt oder unbekannt ist, Materialien sozusagen, die ein kritisches Licht auf die deutsche Geschichte, vor allem im neunzehnten Jahrhundert, werfen.«66
Diese Haltung machte Boehlich in den Jahren, in denen Der Berliner Antisemitismusstreit entstand, zu einem inoffiziellen Teilhaber und Mitdenker an dem, was gemeinhin Kritische Theorie genannt wird – mit den damit verbundenen Assoziationen zum vor 1933 in Frankfurt begründeten Institut für Sozialforschung, das in den Nazijahren nach Amerika vertrieben worden war und nach 1945 noch einmal in Frankfurt neu etabliert wurde. Es nahm keine Mitglieder auf und verzeichnete natürlich auch keine Anhänger; aber es bot einen theoretisch-kritischen Denkstil an, dem Walter Boehlich auf seine Weise ebenfalls anhing. Zwar stand er mitunter dem publizistischen Stil einiger Veröffentlichungen der Frankfurter Schule skeptisch gegenüber, aber Adorno nannte er in einer Glosse einmal seinen »Bruder« und die meisten Schriften aus dem Institut und seinem Umfeld verteidigte er, denn bei zentralen Themen und in einigen wichtigen Argumentationen ähnelten seine Überzeugung und Haltung der Kritischen Theorie, mitunter auf fast idealtypische Weise.67 In einem Brief an Richard Alewyn von Anfang November 1968 hat Boehlich seine Nähe zur Kritischen Theorie einmal etwas genauer benannt und sie zustimmend als Ideologiekritik und als eine Form linker Theoriebildung beschrieben, in die begriffs- und sprachkritische Reflexion eingegangen sei. Es gehe nicht, so schrieb er hier, »um die Soziologie des 19. Jahrhunderts, auf die sich heute kein verständiger Mensch mehr beruft, sondern um die neuere Soziologie, diejenige, die über das verfügt, was kritische Theorie genannt wird und von der Mehrheit der anwesenden Germanisten leider als Tautologie empfunden worden ist, eben weil sie das Vokabular nicht kennen und nicht durchschauen. […] Es gibt keine sakrosankten Dogmen der herrschenden Soziologie, aber es gibt ein Begriffsinstrumentarium, das diese entwickelt hat, an dem jede Kritik geübt werden darf und soll, das man aber nicht einfach übersehen darf. […] Ich glaube nicht, daß das von aussen und aus einer Position, die ihre Begriffe aus älteren Schichten holt, möglich ist.«68
Der Gegenwartsindex des Buches: Kritik der beschwiegenen NS-Zeit
Diese lange vergriffene Quellensammlung war 1965 ohne Zweifel eine wissenschaftliche Leistung ersten Ranges. Walter Boehlich hatte aus einem vielstimmigen Geflecht und Gewirr gesellschaftlicher Strukturen und politisch-ideologischer Überzeugungen einzelner Akteure wieder einen historischen Ereigniszusammenhang erkennbar werden lassen, den er im Titel der Edition benannte. In einem Brief an Gershom Scholem von April 1965 gestand er aber, dass ihm das Schreiben des Nachworts Schwierigkeiten gemacht habe, weil in diesem Streit »persönliche Motive und innenpolitische Zusammenhänge so hoffnungslos und nicht immer ganz klar erkennbar in einander verfilzt« gewesen seien.69 Zudem waren »lange Monate des Suchens« nötig, für ein Exemplar der Schlesischen Presse musste er etwa mit der Bibliothek in Wrocław korrespondieren; auch halfen Sammler in Israel mit bibliographischen Angaben und mit Kopien aus.70 Schon die Rechercheleistung war also äußerst aufwändig gewesen. Entscheidend aber war der gedankliche Aufwand, den Boehlich in das Unternehmen dieser Edition einbrachte, denn es war für ihn klar, dass diese Dokumentation eine gesellschaftliche Botschaft enthielt, die er Gershom Scholem gegenüber mit seinem Interesse an »richtige[n] Bücher[n]« charakterisierte, und damit meinte er Bücher, »die von aktuellem Interesse sind«: Der Insel Verlag solle »etwas lebendiger werden«, so Boehlich über das eigene verlegerische Ideal, und so sei der Plan entstanden, der »konservativen Insel-Bücherei eine neue Reihe zur Seite zu stellen, in der man Bücher, richtige Bücher, veröffentlichen kann, die von aktuellerem Interesse sind und die in der Insel-Bücherei untergegangen wären«.71
Das »aktuelle Interesse« ist dem Band tief eingeschrieben. Er war wohl auch deshalb so innovativ und hat so produktiv gewirkt, weil er keine rein historische Dokumentation war, sondern einen klaren Gegenwartsindex aufwies, mit dem sich Boehlich zugleich auch gegen die Art und Weise, wie in der frühen Bundesrepublik mit der Nazizeit umgegangen wurde, wandte. Sein Nachwort deutete die von ihm zusammengestellten Dokumente im Streit um Treitschke als ein negatives ideen- und ideologiegeschichtliches Schlüsselereignis der deutschen und deutsch-jüdischen Geschichte – mit verhängnisvollen Wirkungen im 20. Jahrhundert. Hier heißt es, dass man schon 1880 »die Konsequenzen« des antisemitischen Geschreis gekannt und ausgesprochen habe, »was nach 1933 geschah war nicht überraschend, nicht der plötzliche Ausbruch eines unerwarteten Fiebers«.72 Und in diesem 20. Jahrhundert, vor allem nach 1933, wurde der preußische Historiker für seinen Antisemitismus gerühmt und gepriesen. Die Publizistik der Nazijahre verklärte ihn, häufig zusammen mit Ernst Moritz Arndt, unentwegt als einen »Kämpfer für Deutschlands Einheit und Größe«, als »Seher«, als »größten Redner deutscher Zunge« und als den »Erzieher zur Deutschheit«.73 Und die Huldigungen dieser Art ließen nie die Gelegenheit aus, jegliche Kritik an Treitschke als »Haß der Minderwertigen«, der »Feinde der deutschen Nation, drinnen und draußen«,74 zu denunzieren: »Es waren die Juden, die alles daran setzten, ihn zu verfemen«, so drückte es der NS-Publizist Fritz Zierke aus, weil Treitschke »die zunehmende Macht des Semitentums im geistigen und politischen Leben der Nation« gegeißelt habe.75
Diese Kontinuität von Treitschke zu dessen Verteidigern, vom Kaiserreich zur Nazizeit, war ein weiteres Motiv für Boehlich, sich der Sache anzunehmen, er selbst hatte keinerlei Scheu vor dem Kontinuitätsargument. Er sah im publizistischen Angriff Treitschkes auf die Juden – wie generell in der Tradition des akademischen Antisemitismus – einen radikalen Bruch in der deutschen Geschichte, der den Auftakt oder die Vorstufe für das »Dritte Reich« darstellte.76 So interpretierte er die feindselige Militanz und die aggressive Grundhaltung, die diesem neuen Antisemitismus eigen war, und dessen Schutzbehauptung, er sei defensiv, verteidige sich nur, als eine direkte Parallele zu »den drei Kriegen zwischen 1871 und 1945«, in denen dasselbe Prinzip wirksam gewesen sei.77 Um die Bedeutung des Berliner Antisemitismusstreits anders als die damalige Fachwissenschaft formulieren zu können, musste sich Boehlich folglich aus der geschichtswissenschaftlichen Tradition der deutschen Treitschke-Deutungen heraushalten. Er wusste um seinen Außenseiterstatus und um die Tatsache, dass es viele Historiker »nicht gerne sehen, wenn sich Dilettanten eines Gegenstands annehmen«.78 Es war Boehlich klar, an welcher Stelle er sich von der Zunft unterschied: Sie würden es vorziehen, »Treitschke aus sich selbst zu erklären, nicht aber nach seinen Folgen zu beurteilen«.79 So wandte er sich ausdrücklich gegen das in Wissenschaft und an Universitäten so verbreitete »Hangen an überlieferter Lehre« und gegen die »Scheu vor Ideologiekritik«80 und damit auch gegen die anhaltenden Verteidigungen Treitschkes, wie sie in Öffentlichkeit und Forschung bis weit in die 1960er Jahre und sogar noch darüber hinaus üblich waren. In privaten Äußerungen drückte Boehlich seine Distanz zum Fach Geschichte sogar noch unverblümter aus: »Es gibt Historiker, deren Art, geschichtliche Fakten darzustellen, sie notwendig von der Kritik des Vorgefallenen dispensiert, was wünschenswert nicht sein kann, auch wenn eine ganze Schule sich moralisch und wissenschaftlich integer Glaubender diese Methode für die allein seligmachende hält.«81 Er hielt »unsere Historiker«, wie er in zwei Briefen an den Remigranten und Sozialhistoriker Hans Rosenberg im Spätsommer 1966 schrieb, für »groß im Verdrängen« und »groß im Verschweigen«, es sei »die geschlossenste Zunft überhaupt (innerhalb der Geisteswissenschaften). Wie da einer immer dem anderen seine Unbedenklichkeit und Vortrefflichkeit bezeugt. Das ist nicht lustig.« Boehlich grenzte sich gegen die Mehrheitsmeinung der deutschen Historiker dezidiert ab, denn diese gehe, so schrieb er einmal, »mit der Geschichte nicht anders um als die Mehrheit der Deutschen« und deswegen müsse man sich »an die Minderheit halten«.82 Und er beklagte deshalb auch, dass im Fach »niemand sich die Mühe gegeben« habe, »die linken emigrierten Historiker zurückzubitten«, und so sei »auch für die Nachgeborenen kein guter Boden hier«.83
Nach Kriegsende gehörte Treitschke zu jenen Teilen der umkämpften Tradition, die man sich durch die alliierte Entnazifizierungs- und Reeducation-Politik nicht nehmen lassen wollte. Dass Treitschke ein Vorläufer Hitlers gewesen sein sollte, wie zum Beispiel Saul K. Padover 1934 ganz unverblümt geschrieben hatte, wurde in Deutschland noch Jahre und Jahrzehnte nach 1945 empört zurückgewiesen.84 Trotzig benannte etwa die Münchner Stadtverwaltung noch 1960 eine Straße nach dem Historiker.85 Eine im Jahr 1949 an der Universität Göttingen entstandene Habilitationsschrift, die Treitschkes »Welt- und Geschichtsbild« zu ihrem Untersuchungsgegenstand gewählt hatte, sparte seinen Antisemitismus erstaunlicherweise ganz aus.86 Ihr Autor, Walter Bußmann, sah in ihm Anfang der 1960er Jahre einen »Großen Deutschen«, wie das Lexikon, für das er den Eintrag über ihn verfasste, benannt war.87 Auch der junge Martin Broszat, später einer der führenden Zeithistoriker der Bundesrepublik, zeichnete Anfang der 1950er Jahre in seiner Kölner Dissertation Die antisemitische Bewegung im Wilhelminischen Deutschland88 noch das Bild eines Patrioten, dessen »Entrüstung seines leidenschaftlichen preußisch-deutschen Nationalgefühls über einzelne jüdische Zeitungsschreiber, die Christentum und Patriotismus verspotteten«,89 berechtigt gewesen sei. Beim Antisemitismus handele es sich, so Broszat, zudem nur um »eine Art Randbemerkung«90 im Werk Treitschkes, der insgesamt »kein Judengegner«91 gewesen sei, man könne bei ihm lediglich »[e]in Minimum an Antisemitismus«92 feststellen. Sogar die verdienstvolle Studie, mit der Klemens Felden zehn Jahre später an der Universität Heidelberg mit der Fragestellung promoviert wurde, wie der Antisemitismus in Deutschland im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts »als soziale Norm selbstverständlich und damit [für die Zeitgenossen] gleichsam objektiv geworden war«, wertete weder Adolf Stoecker noch Heinrich von Treitschke als »Antisemiten im vollen Wortsinne« mit der dem hohen Niveau der Studie ansonsten nicht gewachsenen Begründung, der Antisemitismus sei für sie funktional, nicht Selbstzweck gewesen.93 Keine dieser von Bußmann, Broszat und Felden getroffenen Einordnungen trifft den Kern der Sache, teils sind sie in der Sache schlicht falsch oder aber, noch bedrückender, sie gehen von Voraussetzungen und Vorzeichen aus, die Treitschke zustimmen, so vor allem Broszat, wenn er ausführte, dass die antijüdischen Stimmungen, die seit 1873 »latent vorhanden gewesen waren«, nun »durch das Verhalten einiger jüdischer Zeitungsschreiber«94 genährt worden seien.
Boehlich aber entzog sich solchen Deutungen, wie sie an Historischen Seminaren deutscher Universitäten entstanden. Er brach mit dem beschwichtigenden nationalen Treitschke-Bild des frühen und mittleren 20. Jahrhunderts, das nach 1945 fortdauerte, denn für ihn galt das Credo: »Gebildete Barbarei bleibt Barbarei.«95 So forderte er explizit die öffentliche Bereitschaft ein, über die Kontinuität zwischen Kaiserreich und NS-Zeit bzw. über die zwischen dieser und der Gegenwart nachzudenken. Er war ein Außenseiter des Fachs, nahm die zeitgenössischen Stimmen jüdischer Gelehrter als einer der ersten deutschsprachigen Forscher auf dem Gebiet des Antisemitismus ernst, zog englischsprachige Arbeiten und neueste soziologische Studien wie jene von Hans Paul Bahrdt und Iring Fetscher von 1965 oder Alexander Beins sprachkritische Deutung des Antisemitismus, ebenfalls aus dem Jahr 1965, sowie generell die Forschungen des Leo Baeck Instituts in London heran, etwa Studien von Werner E. Mosse, Michael Reuwen und Hans Liebeschütz.96 In seiner Besprechung von Boehlichs Textsammlung war es seinerzeit der Historiker Karl Dietrich Bracher, der den Band und seine Deutung mit dem »vorzüglich klärenden Nachwort« bestärkte und der ihn auch im wissenschaftlichen Zusammenhang zu den englischsprachigen Monographien von Fritz Stern, George L. Mosse und Peter Pulzer situierte, die unmittelbar zuvor erschienen waren und sich alle ebenfalls der Entstehung und Etablierung des politischen Antisemitismus widmeten.97 Es ist auch im historischen Rückblick auf die 1960er Jahre nicht zu hoch gegriffen, Boehlichs Edition zu dieser Gruppe außergewöhnlicher Pionierstudien zu zählen, die alle von jüdischen Gelehrten verfasst wurden, die selbst zwischen 1918 und 1929 in Deutschland oder Österreich geboren wurden, sich in den frühen 1930er Jahren zusammen mit ihren Eltern gerade noch vor den Nazis ins englische oder amerikanische Exil retten konnten und die ihre akademische Ausbildung als Historiker dann in den Aufnahmeländern absolvierten. Zu ihnen wäre noch die Monographie von Georg G. Iggers The German Conception of History (1968) hinzuzuzählen, die wenige Jahre später erschien und sich einem ähnlichen Erkenntnisimpuls verdankt wie die grundlegenden Studien von Stern, Mosse, Pulzer und die Edition Boehlichs.98 Auch Bracher erblickte im damaligen Treitschke-Streit »Vorzeichen« und »erschreckende Parallelen zum Späteren«: Hier habe »das Versagen von Bildung und Universität« begonnen, schrieb er in seiner Besprechung von Boehlichs Buch, und »wie im Deutschland des Obrigkeitsstaates und des Ordnungskultes demokratische Revolution und Republik gescheitert sind, so ereignete sich vor und nach den Morden an Rosa Luxemburg oder Walther Rathenau auch kein deutscher Aufstand der Vernunft wie im Frankreich der Jahrhundertwende, wo die Dreyfus-Affäre die öffentliche Atmosphäre weitgehend von der Pest des Antisemitismus befreit hat«.99
Dieser Hinweis von Bracher auf die Dreyfus-Affäre in Frankreich trifft in der Tat auch eine der Intentionen der Edition, deren Titel von Walter Boehlich seinerzeit zwar betont sachlich gewählt worden war, die aber ganz offensichtlich ein in Deutschland seinerzeit fehlendes »J’accuse!« beklagte und faktisch, mit der Quellensammlung als politischem Akt, symbolisch nachholte. In einem Gespräch mit Gert Mattenklott erwähnte Boehlich Anfang der 1990er Jahre im Rückblick auf die Arbeit an dem Dokumentenband, dass »die Bereitschaft der deutschen Intelligenz, sich zu wehren«, verglichen mit Frankreich, immer geringer gewesen sei: »Das hat mich auch bei meinen Studien über den Antisemitismusstreit im 19. Jahrhundert beschäftigt. Es gab in dem Streit um Treitschkes antisemitische Attacken von 1879 an der Berliner Universität nur einen namhaften Gelehrten, der, ohne Jude zu sein, für die Juden eintrat: Theodor Mommsen […] Zum Unrecht sagen, es ist Unrecht, auch wenn es einen selbst nicht trifft, ist in Deutschland immer schon sehr selten gewesen.«100
So war Der Berliner Antisemitismusstreit keine Handreichung für den Geschichtsunterricht an Universitäten und Schulen allein; er war auch eine Ermutigung zur Zivilcourage und damit eine intellektuelle Intervention in die politische Gegenwart am Ende der Adenauerjahre. Der Band stellte die Dokumente eines weithin in der Gegenwart verdrängten und beschönigten Universitätsantisemitismus – und die kritischen Einsprüche gegen ihn – in dem Moment zur Diskussion, als man in der Bundesrepublik erst langsam damit begann, nach den »historischen Wurzeln des deutschen Antisemitismus« zu fragen, im Grunde genommen erst ab den 1960er Jahren, dem Moment, als erstmals öffentlich und ausführlich über den Holocaust diskutiert wurde, dessen Verbrechen in den Verhandlungen des Jerusalemer Eichmann-Prozesses und im Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main für alle sichtbar geworden waren.101 Boehlich selbst sprach 1966 sehr unmittelbar von dieser ihn bedrängenden Nähe zu den gegenwärtigen Auschwitz-Prozessen und der Frage, wie man aus ihnen Konsequenzen für eine Revision des eigenen Geschichtsbildes gewinnen könne, und er verwendete seinerzeit die so sprechende Wendung vom »Prozeß gegen die deutsche Geschichte«, der intellektuell so wichtig sei wie der juristische gegen überführte NS-Täter:
»Unser Blick für das Geschehene«, so Boehlich, »ist schärfer geworden; er ist das nicht nur, weil der Abstand größer geworden ist, er ist das auch, weil die Folgen unserer Unterlassung denen unter uns, die der Reflexion gänzlich abgeneigt sind, zusehens deutlicher werden. Mit beidem, mit der Distanz und mit den sichtbar gewordenen Folgen der Unterlassung, hängt es zusammen, daß die Zahl derer, die ihre Beobachtungen und Urteile nicht einzig auf die von unerhörten Verbrechen gezeichneten zwölf Jahre beschränken, sondern sie auf weiter Zurückliegendes ausdehnen, immer größer wird. Wir sind aufmerksamer geworden auf die kriminellen Täter unter uns, aber wir werden auch aufmerksam auf die ideologischen Wegbereiter. Wenn wir gesunden wollen, ist es mit Auschwitz-Prozessen nicht getan; es muß dann auch der Prozeß gegen die deutsche Geschichte geführt werden […], über deren Irrwege und Abwege ebenso wie über ihre verheißungsvollen, aber glücklosen Augenblicke wir uns endlich klarwerden müssen.«102
Aus heutiger Sicht liegt die Bedeutung des Bandes neben seinen langjährigen Anstößen für die historische Forschung genau darin: Walter Boehlich blickte mit seiner Quellensammlung auf Vergangenheit und Gegenwart zugleich. Und er gab der Öffentlichkeit das nötige Material an die Hand, um einen »Prozeß gegen die deutsche Geschichte« zu führen, einen selbstkritischen und allgemein erkenntnisfördernden Prozess, in dem die Rollen von Ankläger, Angeklagtem und Richter zusammenfallen mussten, um wirksam zu sein. Dieses Buch war ein historischer Akt der Aufklärung und ein Einspruch in die Erinnerungspolitik der Gegenwart; es machte die Traditionen des Antisemitismus der Gebildeten in einer Zeit zum Thema, als in den Medien ein Nazi-Täterbild dominierte, das von mediokren Handlangern und von Gehilfen des Grauens geprägt war. Heute können wir die Textsammlung Boehlichs von 1965 auch als eine Intervention gegen diesen einseitig gewordenen Täterdiskurs verstehen, von dem sich Lehrer, Schulräte und Universitätsprofessoren leicht distanzieren konnten. Während auf den Anklagebänken der Frankfurter Verhandlungen Altenpfleger, Lastwagenfahrer oder Metzger als das schuldig gewordene Personal der Vernichtung präsentiert wurden, verwies Boehlich mit seinem Band in Form eines dokumentarischen Rückblicks auf die Anfänge des modernen Antisemitismus, wie er von den akademischen Eliten im deutschen Kaiserreich formuliert und popularisiert worden war. Nur so gerieten auch jene ideologischen Vordenker und die Hassprediger in den Blick, die die Ausgrenzung der Juden aus der deutschen Gesellschaft schon Jahrzehnte vor Hitler gefordert hatten. Den Wachleuten in den Konzentrationslagern, die sich durch blinden Diensteifer und beflissene Gehorsamkeit funktional dem NS-System angedient hatten, wurde in Der Berliner Antisemitismusstreit die nicht weniger typische Tradition der intellektuellen und akademischen Vorläufer des Nazismus gegenübergestellt, der Marrs und Glagaus, Stoeckers und Treitschkes, über die Shulamit Volkov geschrieben hat, dass mit ihren Pamphleten in einem kurzen Zeitraum von nur wenigen Jahren »das Vokabular dieser Kultur« samt seines neuen Namens – Antisemitismus – in deutscher Sprache erschaffen worden sei.103
Die Boehlich’sche Quellensammlung war in Bezug auf den historischen Gegenstand engagiert und quellengenau zugleich. Dass sie ein gesellschaftspolitisches Statement in der Gegenwart, in der sie entstand, darstellte, dokumentiert sich über die mit dem Band verbundene doppelte Kontinuitätsfrage. Seine Ausrichtung als historische Edition mit politischer Aktualität, die den Band schon 1965 und nochmals 1988 als Antwort auf den notorischen »Historikerstreit« von 1986/87,104 charakterisierte und die ihm auch heute, unter neuen Vorzeichen, zukommt, war für Verlag und Herausgeber der wichtigste Grund für die Entscheidung, ihn neu aufzulegen, ungeachtet der Tatsache, dass es inzwischen die erwähnte, umfangreichere Sammlung gibt, die 2003 im Auftrag des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin entstand und die auf einem völlig neuen Stand der Forschung basierte, den Boehlich Jahrzehnte zuvor nicht vorgefunden, den er umgekehrt überhaupt erst wesentlich mit dem Buch selbst angestoßen hat. Die Bedeutung der Boehlich’schen Textsammlung sowohl für die Universität als auch für den Schulunterricht und für eine breite interessierte Leserschaft trifft nicht nur für die damaligen Auflagen zu, sondern hat ihre Gültigkeit auch heute nicht eingebüßt; nach wie vor wird die Textsammlung verwendet und zitiert.105 Auch die seinerzeit gewählte Form als preisgünstige Leseausgabe ohne aufwendigen wissenschaftlichen Apparat ist nicht überholt. Diese Edition zählt immer noch, auch nach vielen Jahrzehnten, zu den besten quellenbasierten Einführungen zur Entstehung des modernen Antisemitismus im Deutschland des späten 19. Jahrhunderts. Sie stellt die für die Selbstaufklärung der Bundesrepublik so zentralen Fragen, warum der Antisemitismus im deutschen Kaiserreich so weitreichend Gehör finden konnte, warum er seinerzeit zum Teil der politischen Kultur der Gebildeten wurde, wie er sich radikalisierte und welche Folgen das im 20. Jahrhundert nach sich zog.
Mit Der Berliner Antisemitismusstreit hatte Boehlich aus einem Desiderat ein Buchereignis gemacht. Nicht nur waren die Implikationen, die dieses Buch seinen Leserinnen und Lesern abverlangte, gewichtig; es enthielt auch mehr, als es selbst für sich reklamierte. Eben dieser Horizont machte und macht die Bedeutung der Publikation bis heute aus. Zum einen rekonstruierte sie mit dem Antisemitismus des Kaiserreichs eine der Leerstellen im kollektiven historischen Bewusstsein der Deutschen; zugleich war der Band eine Kritik an der politischen und gesellschaftlichen Weigerung, in den Ministerien, in Verbänden und Vereinen, in Unternehmen und eben auch an Universitäten, die institutionelle Schuld an Ausgrenzung und Raub, an der Vertreibung und schließlich an der Vernichtung der Juden in Deutschland und Europa anzuerkennen und dafür Verantwortung zu übernehmen. So machte Boehlichs Band über Treitschkes Agitation von 1879/80 im Grunde genommen nicht eine, sondern gleich zwei Kontinuitätslinien sichtbar, deren eine von 1879/80 zum Jahr 1933 führte und deren zweite von 1945 in die Gegenwart des Jahres 1965 wies. Es waren aus dieser Sicht zwei Erbschaften, mit denen er als Herausgeber des Buchs und als Mitherausgeber der Reihe, in der es erschien, die deutschen Leser und Leserinnen mit der Gegenwart konfrontierte: Die Frage, welche Traditionslinien die Herrschaft Hitlers ermöglicht haben; und die Frage, welche Konsequenzen die Bundesrepublik daraus eigentlich gezogen hatte oder zu ziehen bereit war. Definitiv handelte es sich bei diesem Buch nicht lediglich um die Darstellung eines in der zeitlichen Ferne einer abgeschlossenen Epoche liegenden Kapitels deutscher Ideologiegeschichte. Boehlich kritisierte in der gärenden Zeit der frühen 1960er Jahren auch die für ihn unerträgliche Diskretion an deutschen Universitäten, den eigenen Sündenfall der »Germanomanie« während der NS-Jahre schlichtweg auszusitzen. In einem Brief an Richard Alewyn, einen seiner Mentoren und Lehrer in der frühen Nachkriegszeit, schrieb er während der Arbeit an dem Band: »Dass die Universitäten nach 1945 nicht so geworden sind wie ich sie gerne sähe, liegt wohl an mir. Man soll wohl nichts Ausserordentliches erwarten.«106 Der gegenwartsbezogene Entstehungsimpuls des Buches war somit auch Ausdruck dieses für die jüngere Generation unabweisbar gewordenen Wunsches, die dunklen Seiten der deutschen Geschichte so darzustellen, wie sie – vor 1933 und dann vor allem bis 1945 – waren: Eine Geschichte der nationalen Selbstüberhöhung, des hypertrophen Stolzes auf die »nationale Gesittung«, auf »germanisches Wesen« und der Abgrenzung von vermeintlich »fremdem Volksthum«107 der Juden (so die Terminologie aus Treitschkes »Unsere Aussichten«). Im Ganzen sprach sich in Boehlichs Buch auch eine tiefe Trauer über die verlorene jüdische Präsenz in der deutschen Gegenwart aus, über fehlende Bildung und Intellektualität und über ein im Kern verarmtes Deutschland. Der Gegenwartsfokus des Bandes verdankte sich auch dieser Trauerarbeit des Herausgebers, der in Briefen und Essays in jener Zeit und auch später das Andenken an die im 20. Jahrhundert von den Deutschen zerstörte jüdische Lebenswelt anmahnte: »Es heißt immer«, so schrieb Boehlich im Januar 1997 an den Historiker Bryan Mark Rigg, »die Zeit heile alle Wunden, während meine Erfahrung mir sagt, dass der Schmerz über die Ermordung der europäischen Juden von Jahr zu Jahr zunimmt.«108 Es ist insgesamt bezeichnend für die persönlichen Überzeugungen und für das berufliche Ethos des Herausgebers, dass er die Forderung nach einer ideologiekritischen Wissenschaftsgeschichte, nicht nur als Apell an andere oder an Institutionen erhob, sondern selbst vornahm: in Form eines Quellenbandes Der Berliner Antisemitismusstreit.
Zur Rezeption von »Der Berliner Antisemitismusstreit«
Publizistisch war Der Berliner Antisemitismusstreit ein bemerkenswerter Erfolg. Der Verlagsvertrag zwischen Insel/Suhrkamp und Walter Boehlich von August 1965 weist die erste Auflage mit 5000 Exemplaren als nicht übermäßig hoch aus;109 die Zweitauflage in Höhe von 4000 Exemplaren folgte zwar wenige Monate später, doch auch beide Auflagen zusammen stellen aufs Ganze gesehen weniger einen Publikums- als einen Achtungs- und Multiplikatorenerfolg dar.110 Die Textsammlung wurde in allen größeren deutschen Zeitungen und Zeitschriften besprochen; zudem fand sie auch außerhalb Deutschlands ein bemerkenswertes Echo, vor allem in Italien, Israel und Frankreich. Das lag in erster Linie daran, dass der Verlag für den Band einen besonders großen Kreis an Vermittlern, Publizisten und Autoren angesprochen hatte. Die Bedeutung, die Suhrkamp dem Buch gab, ist also weniger an der Zahl der gedruckten oder verkauften Exemplare zu bemessen, wohl aber am Verteiler für die Belege, für die fast ein Zehntel der Erstauflage verwendet wurde. Der Verlag verschickte beispielsweise ein Paket der ersten zwölf Bände der Sammlung Insel an einen Verteiler mit ausgewählten Rezensenten und Zeitungen, u.a. an Hellmuth Karasek und Hans Schwab-Felisch. Auch die ersten vierundzwanzig Bände wurden als Reihen-Paket an bekannte Rezensenten, Schriftsteller und Wissenschaftler übermittelt, etwa an Walter Höllerer, Walter Jens, Joachim Kaiser, Hans Mayer, Richard Alewyn, Heinrich Böll, Jürgen Habermas, Alexander Mitscherlich und Peter Szondi. Boehlichs Band wurde insgesamt fast 400 Mal versandt, nicht nur an alle wichtigen deutschsprachigen Tages- und Wochenzeitungen bzw. -zeitschriften, wie Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, Der Spiegel, Frankfurter Rundschau, Christ und Welt, Tagesspiegel, Neue Zürcher Zeitung sowie Neues Österreich u.a., sondern auch an besonders viele Regionalzeitungen wie die Hannoveraner Allgemeine, die Kieler Morgenzeitung, die Schwäbische Donauzeitung, die Badische Zeitung (Freiburg) oder die Offenbach-Post, um nur diese fünf (von insgesamt über fünfzig Zeitungen) zu nennen. Weit gesteckt war auch der Verteiler an die ausländischen Printmedien: Das Buch ging in die Niederlande und nach Belgien, in die Vereinigten Staaten, nach Frankreich und England, an Zeitungen und Zeitschriften in Israel, nach Schweden und Italien. Außerdem wurde es an Zeitungen oder Privatpersonen nach Belgrad, Polen, Südafrika und Rumänien versandt. Die wichtigen Fachzeitschriften (so die Historische Zeitschrift, Das Historisch-politische Buch u.a.) erhielten es, aber auch wichtige allgemeine Kultur- und Literaturjournale (wie Welt der Literatur, Der Monat, Merkur oder Universitas u.a.), sowieso sämtliche Rundfunkstationen, viele Bibliotheken, Hochschulen und auch Buchhandlungen.111 Die Edition Der Berliner Antisemitismusstreit wurde im Spätsommer 1965 auch an den Botschafter Israels, Asher Ben-Natan, verschickt und zusätzlich auch an einen großen Kreis von weiteren Suhrkamp- und Insel-Autoren und an eine lange Reihe von Publizisten, so an Hans Magnus Enzensberger, Martin Walser, Thomas Bernhard, Max Frisch, Arnulf Baring, Joachim C. Fest, Horst Bienek, Peter Hacks, Karl Korn, Curt Hohoff, Friedrich Kemp, Robert Weltsch, Karl Löwith, Elias Canetti, Rudolf Hirsch, Hans Lamm, Werner Kraft, Friedrich Pollock und Karol Sauerland. Außerdem erschien zum Erscheinungsdatum im September 1965 das Nachwort Boehlichs in Der Monat als Vorabdruck.112 Nach einem knappen halben Jahr wurde eine zweite Auflage nötig.113 Mit den Fragen, die der Streit um Treitschkes Antisemitismus bot, war es Walter Boehlich um die größtmögliche Öffentlichkeit zu tun. Später arbeitete er das Buch sogar noch einmal in ein »Dokumentarisches Hörstück« um; es wurde 1982 im dritten Programm des Westdeutschen Rundfunks gesendet.114
Einen Eindruck von der Wirkung, die Der Berliner Antisemitismusstreit in den 1960er Jahren in der intellektuellen Öffentlichkeit hatte, erhält man nicht nur mit Blick auf die Rezensionen. In Privat- und Verlagsbriefen, die Walter Boehlich erhielt, spiegelt sich ein zusätzliches und unmittelbares Echo auf seine Textsammlung wider, das unser Wissen über die Rezeption von Buch und Thema um viele Facetten erweitert. So schrieben ihm etwa Eleonore Sterling, Autorin des 1956 erschienenen Buchs Er ist wie du. Zur Frühgeschichte des Antisemitismus (1815-1850), das von Boehlich in seiner Antwort sehr gelobt wird, und Peter Szondi, der anlässlich einer Vortragsankündigung von Boehlich an der TU in Berlin ein Treffen vorschlägt.115 Mit dem ostdeutschen Historiker Hans Schleier, der selbst an einer historiographischen Studie über Treitschke und Sybel arbeitete, tauschte Boehlich sich über Treitschkes Nachlass und Briefe aus.116 Auch mit dem Bielefelder Historiker Hans-Ulrich Wehler entspann sich ein Briefwechsel. Boehlich und er diskutierten mögliche Bände der neuen Reihe und Boehlich fragte bei ihm sogar konkret an, ob er »einen Band zur politischen Geschichte« der Geschichtswissenschaft herausbringen wolle, was aber Wehler ablehnte, weil er für das Thema »Historiographie« nicht der beste sei und sein eigenes Interesse stärker auf Sozialgeschichte ausgerichtet habe.117 Peter Wapnewski, Germanist und Boehlichs Hamburger Studienfreund, äußerte freundliche Kritik daran, dass in dem Band auf Kommentierungen der Quellen verzichtet worden sei. Und Monika Plessner, die zweite Ehefrau des Soziologen und Remigranten Helmuth Plessner, berichtete Boehlich in einem Brief von November 1966, dass ihr Mann von dem Band ganz begeistert sei und ihn gerne kennenlernen würde.118 Schon im Sommer 1965, also noch vor der Auslieferung, antwortete Boehlich auf die Zuschrift eines Studenten, der die Verlagsankündigung gelesen hatte und für seine Abschlussarbeit über die christlich-konservativen Wurzeln des Antisemitismus um die Einsicht in die Fahnen bat. In seiner Antwort entgegnete Boehlich, der Band selbst habe keinen Fokus auf die Rolle der christlichen Konfessionen gelegt, weder sei in ihm von August Rohling noch von Ignaz von Döllinger die Rede und kaum von Adolf Stoecker. Es sei für ihn aber, so schreibt Boehlich hier, von Belang gewesen, dass überall, im Lager der Katholiken wie bei den Protestanten, bei den Konservativen wie bei den Nationalliberalen, gegen den Liberalismus, gegen Frankreich oder England agitiert worden sei und dieser Antiliberalismus sehr häufig mit Ausfällen gegen die Juden verknüpft war. Die allgemeine »Einheitsideologie«, so Boehlich, habe nach 1870/71 dazu geführt, dass von allen Seiten dem jeweiligen politischen Gegner »das nationale Bewußtsein« abgesprochen wurde, vor allem den Linksliberalen, den Sozialdemokraten und am häufigsten den Juden. Hier zählte Boehlich Treitschke zur Gruppe der »Scheinliberalen«, Leute, »die den Liberalismus mit allen Konsequenzen […] ununterbrochen verdächtigen«, auch in Zeiten, in denen sie sich ihm aus politisch-taktischen Gründen anschlossen.119 In seiner Korrespondenz wird zudem auch deutlich, wie stark der Begriff »Universitätsantisemitismus«, den Boehlich einem Essay von Arthur Rosenberg von 1930 entnommen und in seinem Nachwort verwendet hatte, als anstößig empfunden wurde; im Februar 1966 schrieb Boehlich, »die paar Sätze auf dem Schutzumschlag haben mir viel Ärger eingetragen, weil die Stimmen sich mehren, denen zufolge es einen Universitäts-Antisemitismus nie gegeben habe. Da helfen natürlich keine Argumente.«120
Die von Walter Boehlich erhoffte Einsicht in die Aktualität des Streites um Treitschke wurde in der publizistischen Reaktion auf den Band eingelöst. Kaum eine Besprechung, die diese nicht zur Sprache brachte. »Diese Aufsätze«, so schrieb etwa die Zeitschrift Welt der Bücher





























