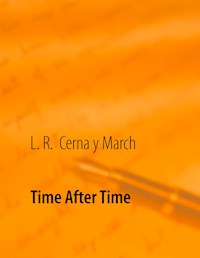Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Das verbotene Buch des 21. Jahrhunderts Anhand der fiktiven Biografie von Grégoire Ricardo gewinnt man einen Einblick in die altamerikanischen Herzopferrituale mit Frankreich als Hauptbühne der Handlung. Grégoire Ricardo ist ein Wiedergeborener, eine Seele auf Wanderschaft, die in unregelmäßigen Abständen zur Erde gelangt, in der Hoffnung Erlösung zu finden und mit dem imperativen Zwang, Gott zu dienen. Er ist nicht auf Rache aus für die Erschaffung des Menschen, er will Gott dienen. Da er aber kein Navigationsgerät besitzt, gerät er manchmal in paradoxe Situationen, um nicht zu sagen sehr schiefen Lagen. Aus der moralischen und ethischen Perspektive eines »normalen« Menschen betrachtet. Aber was ist schon »normal« im Leben? Er muss 40 Mimixcoua besiegen, d.h. er muss 40 Herzopfer dem höchsten Gott ohne Kult darbringen. Er gibt Tonacatecut zum ersten Mal nach langer Zeit Blut und Herzen der besiegten Mimixcoua zu essen und zu trinken, um selbst Erlösung zu finden, was er aber bis zu diesem Moment nicht weiß. Nach 40 Opfern ist er nicht mehr der gefallene Engel und erreicht das Stadium der Erlösung durch Transsubstantiation. Ist dies richtig und gerecht? Der Leser ist bei der Lektüre des Romans herausgefordert. Eine Verführung für jeden Leser, egal welche Entscheidung er trifft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 736
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Personenverzeichnis
Glossar
Kapitel 1
Damit ich die Erinnerung nicht verliere, wenn ich zur Erde komme, muss ich einen passenden Körper innerhalb eines bestimmten Zeitfensters finden und in Besitz nehmen. Dann habe ich vollen Zugriff auf meine gesamte Erfahrung. Dies ist für mich der Fall bei der größten Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn, wenn man den Sternenhimmel von der Erde aus betrachtet. Es ist nicht nur eine Annäherung, sondern es sind drei scheinbare Begegnungen, die in einem knappen Jahr stattzufinden haben, damit die größte Konjunktion mein Zeitfenster freigibt. Eine große Konjunktion reicht hierfür nicht aus, da sie als regelmäßig wiederkehrende, berechenbare 20-jährige Periode in Erscheinung tritt, wohingegen die größte Konjunktion keine Periodizität hat, die eine Voraussage ermöglichen könnte und sehr selten ist. Das außergewöhnliche Zusammentreffen von diesen drei Ereignissen von absolut ungewöhnlichem Ausmaß ruft einen kosmischen Raum-Zeit-Strudel hervor, der mir den vollen Zugriff auf meine gesamte Vergangenheit im neuen Erden-Leben ermöglicht. Die Umlaufzeit des Jupiters beträgt 11,86 Jahre, die des Saturns dagegen 29,46 Jahre, und diese zwei Umlaufzeiten stehen zueinander in etwa im Verhältnis 2:5. Die letzte größte Konjunktion, die ich wahrgenommen habe, war die von 1940/41.
Meine Dimension wird vom Pisba-Prinzip regiert. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Chibcha Sprache und bedeutet, »was uns von vorher und immer gehört«. Er umfasst seit jeher sowohl Zeit als auch Raum in einem bestimmten Koordinatensystem, mit anderen Worten die Totalität des Seins in den sich gegenüberstehenden Dimensionen in einem sie tragenden Medium als Meta-Dimension. Diese Totalität wird in mehreren Seinsebenen aufgeschlüsselt. Unser gesamtes Leben ist darauf ausgerichtet, ein ständiges Gleichgewicht zwischen den Gegensätzen zu schaffen, da es kein absolutes Gut oder Schlecht gibt. Alles hat alles in sich, auch ich. Wir bestehen aus komplementären Gegensätzen und diametral entgegengesetzten Eigenschaften. Wer die eine Eigenschaft besitzt, der ist auch von der gegenteiligen geprägt. Gut ist nur das Ganze im Vergangenen, Gegenwärtigen und Kommenden. Dieser Ausgleich bringt zwangsläufig mit sich die notwendige Systemstabilität im Medium des Raumes und der Zeit. Die formale und inhaltliche Konvergenz zwischen den Dimensionen ist Voraussetzung für die Evolution und muss gewahrt bleiben.
Der passende Körper wurde zur Geburt am 4. April 1941 freigegeben und ich bin ohne Komplikationen am genannten Datum als Grégoire Ricardo Favareille, Sohn des französischen Konsulatsbeamten François Favareille und seiner Frau Marie-Sylvie, geb. Hommey, in Masaya, Nicaragua, geboren. Während des Krieges lebte mein Vater dort im Exil und nach dem Krieg erhielt er wieder seinen Posten im Konsulat. Meine Kindheit verlief unauffällig, wenn man davon absieht, dass ich viersprachig aufwuchs, Französisch, Spanisch, Deutsch und Englisch, hinzu kamen noch Kenntnisse im Nawatischen. Diese Sprachkenntnisse ermöglichten mir später einen entsprechend weiten Aktionsradius.
Französisch, Spanisch, Deutsch und Englisch habe ich mit meinen Eltern ohne Präferenzen gesprochen. Jeder Tag wurde die Sprache gewechselt und konsequent durchgehalten. Bei Nawatisch verhielt es sich anders, da ich jeden Tag seitdem ich sprechen konnte mit meinem Kindermädchen Nawatisch sprach, wenn wir alleine waren, bzw. wenn wir uns alleine fühlten, was oft der Fall war, sonst sprachen wir ein sehr gepflegtes Spanisch miteinander.
Mein Kindermädchen hieß Amalia Rosa Tlacol und war die Tochter unserer Köchin, Amalia del Pilar. Sie war ein liebes Mädchen, das ich sehr gerne mochte. Sie kannte unendlich viele Mythologie-Geschichten aus ihrem Volk, die sie von ihrem Vater gelernt hatte, einem liebenswerten und umsichtigen Nawat-Großmeister, der sich nie in den Vordergrund stellte.
Als Kind lernte ich die gesprochene und geschriebene Sprache spielend und da ich die gesamte Erinnerung meiner Vergangenheit besaß, konnten wir solide Dialoge miteinander führen, wenn wir ungestört waren. Dies war in der Regel der Fall während der obligaten Spaziergänge vormittags und nachmittags. Die übliche Strecke war von unserem Haus zum Park Santa Dalia, direkt vor der gleichnamigen Kirche. Ein schöner Park mit vielen schattenspendenden Bäumen, einer Glorieta in der Mitte und viel Polizei. Dort trafen sich täglich fast alle Kindermädchen der Nachbarschaft und ließen die Kinder miteinander spielen. Dank der anwesenden Polizei ging alles sehr gesittet zu. Der Park war 5 Block von unserem Haus entfernt und der Weg dahin und zurück war unsere übliche Dialogstrecke. Ich war in der glücklichen Lage, ihre starke Sensibilität intuitiv richtig anzusprechen und so half sie mir, das Außergewöhnliche im Gewöhnlichen zu finden. So erfuhr ich von der Etymologie ihres Familiennamens, Tlacol
- »Weiß du woher dein Familienname kommt?« fragte ich sie eines Tages während unseres morgendlichen Spazierganges auf dem Weg zu unserm Park
- »Ja, natürlich« sagte sie als wir die erste Straße überquerten, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass kein Auto kam
- »Worauf wartest du denn, muss ich dir alles aus der Nase ziehen?« forderte ich sie ungeduldig auf und lachte
- »Ungeduldiger Patron! Mein Familienname <Tlacol> ist eine verkürzte Form von <Tlacolteo>, welche von der Mondgöttin und Mutter des Krieges <Tlacolteot> abgeleitet wird« sagte sie mit leiser, unterwürfiger Stimme, die mitnichten zu einem Nebbich gehörte, während sie andere Kindermädchen auf dem Weg begrüßte
- »Also doch, auch eine Patronin wie es im Buche steht« sagte ich mit dem unerzogenen Blick eines dreijährigen
- »Benimm dich! Die Mondgöttin war tatsächlich die Patronin der Gefährtinnen der Krieger, was später der Liebesgöttin Xochiquet von den Mayas angedichtet wurde« sagte sie mit belehrendem Ton, als sie mir meine Wasserflasche überreichte
- »Wieso das denn?« fragte ich neugierig, nachdem ich einen großen Schluck aus der Flasche mit Genuss genommen hatte
- »Einfach dadurch bedingt, dass sie beide sich entschließen mussten, sich selbst zu opfern, um der Sonne Kraft und Leben zu geben, damit sie, die Sonne, ihren gewohnten Lauf beginnen kann« sagte sie stolz auf ihren Vortrag, während ich noch einen zweiten Schluck nahm
- »Du beziehst dich wahrscheinlich auf die bekannte Vorstellung, dass die Sonne am Morgen Macht und Kraft gewinnt…« begann ich zu sagen, als sie mich unterbrach
- »Bis sie im Zenit in die Zone des Maisgottes kommt und mit ihm zusammenfällt, sich nach Westen bewegt und in die Erde eingeht. Hier unterscheidet sich die echt nawatische Überlieferung von den nachfolgenden. Diese versuchen umständlich den Gang der Sonne durch die Unterwelt zu erklären, bis sie rein und strahlend am anderen Morgen wieder entsteht und der Zyklus von neuem beginnt. Mit anderen Worten, umständliche und unzureichende Erklärungsversuche von Halbwissenden« erklärte sie mir abschließend als wir den Park erreichten, wo wir von den anderen Kindern und Kindermädchen stürmisch begrüßt wurde und ausgelassen spielten, bis wir uns von den anderen verabschiedeten und uns auf dem Weg nach Hause machten, den ich nicht mehr wach erlebte, da ich ziemlich schnell todmüde im Kinderwagen einschlief.
Unsere Spaziergänge waren stets kurzweilig und wir besprachen dabei unzählige Themen, meist über nawatische Weltanschauungen und die Sprache. Einmal besprachen wir zum Beispiel den Unterschied zwischen Nemachtiani, Temachtiani und Ueytiani als Bezeichnung für nawatische Meister
- »Mi china, du sagst, dass dein Vater ein Nawat-Großmeister ist. Wie lautet die nawatische Bezeichnung für Großmeister?« fragte ich sie als wir gerade aus dem Hause Richtung Park waren
- »Es gibt 3 Bezeichnungen im Nawatisch für Meister, nämlich <Nemachtiani>, <Temachtiani> und Ueytiani>…« setzt sie an, als ich sie unterbrach
- »Wenn du schon so anfängst, muss ich davon ausgehen, dass diese 3 Formen verschiedene Bedeutungen haben« mit dem Ton eines Klugscheißers
- »Kluges Kind! soll ich sie dir erklären?« fragte sie mich provozierend
- »Schieß mal los! <Nemachtiani> ist wohl die erste Bezeichnung, die du mir erklären sollst« gab ich kategorisch an
- »Gut, <Nemachtiani> ist die Bezeichnung für einen Kleinmeister, einen, der gerade seine ersten Lehrjahre nach dem Studium bei einem Meister anfängt. Auf Spanisch drückt man dies am Besten mit <maestrillo>, auf Deutsch <Referendar> oder ähnlich« sagte sie stolz auf ihre Fremdsprachenkenntnisse
- »Ein frisch gebackener Meister, der Erfahrung sammelt, daher Kleinmeister oder Referendar. Verstanden, weiter…« gab ich kurz und bündig zu Protokoll
- »<Temachtiani> ist ein etablierter und erfahrener Meister, auf Spanisch <maestro> und auf Deutsch <Lehrer>, der in der Regel eine zugewiesene Gemeinde hat« ergänzte sie vorsichtig
- »So etwas wie ein Pfarrer in der katholischen Kirche, ziemlich unabhängig und nur seinem Bischof direkt verantwortlich« formulierte ich um
- »Das ist ein sehr guter Vergleich. Die dritte Bezeichnung <Ueytiani> steht dann, um im Bild zu bleiben, für den Bischof. Auf Spanisch <gran maestro>, <abad> oder schlicht und einfach <superior>, auf Deutsch <Großmeister> in etwa« sagte sie dankbar, dass ich das Gleichnis ins Spiel gebracht hatte
- »Nach deinem Vortrag ist dein Vater ein Ueytiani, weil alle ihn Großmeister nennen, stimmt es oder habe ich recht?« sagte ich in der Überzeugung, der Klassenbeste in der Wüste zu sein
- »Ganz genau, mein Vater ist sehr bescheiden, aber die Bezeichnung Ueytiani wird von ihm akzeptiert. Der Titel Nemachtiani wird von einem Temachtiani verliehen und der Titel Temachtiani wird wiederum von einem Ueytiani verliehen« erklärte sie mir
- »Und wer verleiht den Titel Ueytiani?« fragte ich sofort nach
- »Der Rat der Ueytiani« antwortete sie kurz.
Danach besprachen wir ausführlich über mehrere Wochen die ganze Hierarchie und auch die liturgischen Aspekte, der nawatischen Religion und Tradition in Schrift und Ton, bis ich dies ganz sicher beherrschte.
Weiter Themen waren auch über die verschiedenen Bezeichnungen für Kindermädchen: Ich nannte sie mit Vorliebe <mi china>, <bonne und <nanny> abwechselnd. Amalia Rosa war ein aufgewecktes und wissbegieriges Mädchen, dem ich zwangsläufig etwas Französisch beibrachte. Vokabellernen war Amalia Rosas Stärke. Es bereitete mir großes Vergnügen, mich mit ihr zu unterhalten und habe dann bedauert, als sie kurz vor meiner Einschulung uns verließ, um Köchin zu lernen.
Eingeschult wurde ich in eine Privatschule in Masaya. Später besuchte ich das Jesuiten-Gymnasium in Granada, ca. 20 km Landweg damals von Masaya entfernt, bis zum Ende des zweiten Jahres in der Sekundär-Stufe. Der Schule mit ihrem philosophischen Weg kann ich eine gewisse Beeinflussung meiner Denkweise nicht absprechen.
Jeden Mittwochnachmittag hatten wir auf dem Stundenplan eine philosophische Werkstatt-Doppelstunde, in der wir ein frei gewähltes Thema behandeln konnten. Es war eine raffiniert eingefädelte Falle, die uns gefangen hielt, da sie freiwillig war und nach griechischem Vorbild im Freien stattfand. Mögliche Themen wurden während der Woche in einen Themenkasten auf anonymen Zetteln eingeworfen. Dienstags wurde ein Thema per Los ausgewählt und die Klasse hatte einen Tag Zeit zur Vorbereitung. Mittwochs wurden dann zwei Mannschaften per Los gebildet, eine pro und die andere contra das ausgewählte Thema. Die Mannschaften hießen bei uns aus Tradition Karthago und Rom. Bei zwanzig Schülern waren wir zehn gegen zehn und der Lehre als Schiedsrichter. Es gab eine fünfminütige Einführung durch den Lehrer, jeweils eine zehnminütige Standpunktbestimmung der Karthago- und der Rom-Mannschaft durch den jeweiligen Hauptredner und anschließend eine heftige und lebhafte Diskussion, immer abwechselnd. Natürlich gab es offiziell keine Sieger und Besiegten, aber jeder wusste, welche Mannschaft bei der Sitzung besser abgeschnitten hatte. Die Wahrscheinlichkeit war groß, dass bei einer Themenwiederholung man auf gegensätzlichen Fronten kämpfen musste.
Ein stets wiederkehrendes Thema war der Unterschied zwischen »Glauben und Wissen«. Auch die »Zeit« und »Schuld und Sühne« waren als Thema beliebt und Platos Höhlengleichnis, also »Bildung und Unbildung« war immer gegenwärtig. Der größte Reiz der Stunde bestand darin, dass die Zusammensetzung der Mannschaften immer unterschiedlich war und dass man erst in letzter Minute erfuhr, ob man für oder gegen das Thema war.
Die Jesuitenschule in Granada war etwas abseits von der Stadt gelegen, am Bahnhof vorbei Richtung Cocibolca See. Zwischen Schule und See gab es die Zubringerstraße vom Bahnhof und einen Rund-Schleichweg für Eingeweihte bis zum Hafen der Stadt, der südöstlich gelegen war. Weiter hinter dem Hafen lagen die Isletas, ca. 300 an der Zahl, und die bekannte Anlegestelle, damals noch »Piedras Cagadas« genannt. Später nannte man sie euphemistisch in »Piedras Blancas« um. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Insel Ometepe mit ihrem Vulkan Maderas, der mit einer gleichen Wolkenfauna wie auf dem Mombacho, dem Hausvulkan Granadas, ein einmaliges Vorkommen im Pazifik bildet. Der Nawat/Nahuat Name <ome - tepet> bedeutet eigentlich zwei Berge, denn in Wirklichkeit hat die Insel zwei Vulkane, nämlich Concepción, 1.610 m, und Maderas, 1.346 m, die laut Legende über den Wasserspiegel ragenden Brüste der Ometepe sind. Die Insel hat eine Fläche von ca. 270 km2 und die Form einer Acht. und ist die größte vulkanische Insel der Welt in einem Süßwassersee. In dem Gymnasium gab es interne und externe Schüler. Ich war ein externer Schüler.
Der zweistöckige Hauptbau war zur Seeseite mit einer repräsentativen torlosen Zu- und Ausfahrt zu einem Rondell vor dem Haupteingang angelegt. Auf besagtem Rondell befanden sich die vorgeschriebenen Fahnenmaste, die für die Fahnenzeremonie jeden Montag vor Unterrichtsbeginn in Anwesenheit aller Schüler zu verwenden waren.
Im ersten Stock des Hauptbaus befanden sich die Klausur mit den Zimmern der Priester und einem Durchgang zu einer Loge zur Kapelle und zwei Seitenkorridore mit Bücherregalen.
Im Erdgeschoss waren links und rechts verschiedene Büros, die Procuraduría und verschiedene Klassenzimmer untergebracht.
Über den Haupteingang gelangte man geradeaus in die Kapelle/Festsaal, ein Anbau von ca. 100 m x10 m mit der bereits erwähnten Loge und Seitenkorridoren. Rechts schloss sich ein 50 m Querbau zum Kinosaal und Restaurant an und mittig ein Innenhof mit vielen Standbildern, genannt <Patio de los Ídolos> mit einem Brunnen in der Mitte. Hier verweilte ich oft und studierte eingehend die Standbilder und ihre geheimen Inschriften, wie Amalia Rosa es mir beigebracht hatte, die nur bei einem bestimmten Lichteinfall für Eingeweihte sichtbar waren.
Die Rückseite der Kapelle zu den offenen Spielfeldern hin bildeten das Frontón-Hauptspielfeld und ein Kiosk mit Lagerraum.
Etwa 50 m links von der Kapelle war ein weiterer einstöckiger Anbau von etwa gleicher Länge mit weiteren Räumen, einem Physiklabor und einer Sakristei, danach war ein Lagerraum für Sportgeräte und ein überdachtes Multifunktionssportfeld für Basketball, Volleyball, etc. untergebracht. Dazwischen war eine Wiese. Hier war ein Ausweichquartier für unsere philosophische Werkstatt bei schlechtem Wetter.
Weitere 50 m links von diesem Anbau befand sich der Neubauflügel, etwa 150 m lang mit Schlafsälen für die Mittel- und Unterstufe im ersten Stockwerk. Ein zweites Stockwerk war nur halb so lang und beherbergte die Schlafsäle für die Oberstufe. Hier, im zweiten Stock ging der Neubau in einen Flachdachbau über, mit jeweiligen Riesenterrassen und einer überwältigenden Rundaussicht zum Cocibolca See und Mombacho Vulkan. Im Erdgeschoss befanden sich weitere Klassenräume, ein weiteres Multifunktionssportfeld mit Frontón und Lagerraum für Sportgeräte, das wir auch als Ausweichquartier für unsere philosophische Werkstatt nutzten, wenn der Regen von links fiel.
Richtung Bahnhof folgten die Sportanlagen und am Ende das große Fußballfeld mit Laufbahn und Leichtathletikanlagen und anschließend das Schwimmbad mit Wasserpumpe und Technikraum.
Links auf der anderen Seite der Zubringerstraße waren drei weitere Fußballfelder untergebracht. Parallel zur Zubringerstraße und innerhalb des Geländes gab es eine Privatstraße der Schule, die die verschiedenen Spielfelder begrenzte mit einer abgeschlossenen Toreinfahrt auf der Höhe des letzten Spielfeldes auf der anderen Seite, Richtung Bahnhof, die eine Querverbindung umsäumt von schattenspendenden Bäumen über das gesamte Gelände bis zur Ecke Zoo herstellte, wo die philosophische Werkstatt in der Regel und bei schönem Wetter stattfand, vorzugsweise auf den Stufen der schattigen Übergänge zum großen Fußballfeld. Mittig war eine Königspalmenallee, Roystonea regia, mit 18 Palmen, jede ca. 8 m hoch mit grau-weißem Stamm und der typischen Krone aus etwa 15 Blättern und auffallend satt-grüner Kronenschaft, zum überdachten Multifunktionssportfeld hin, die als normale Straße weiter zum Kinosaal und Zoo führte. Der Zoo befand sich spiegelbildlich auf der anderen Seite der Felder nach dem Kinosaal und vor dem großen Baseballfeld. Der Kinosaal diente auch als drittes Ausweichquartier beim schlechten Wetter für unsere philosophische Werkstatt. Dahinter waren Ställe und Wirtschaftsgebäude mit Bedienstetenunterkünften, die für die Schüler Offlimits waren.
Während der Schulzeit wohnte ich wochentags in Granada bei meinem Onkel Richard Hommey, Bruder meiner Mutter und Jahrgang 1908, ein Tiefbau-Ingenieur, der als Berufsschullehrer in Paris arbeitete und im Rahmen der Entwicklungshilfe nach Nicaragua zur Betreuung mehrerer Projekte gesandt worden war. Seine Frau Marie-Christine, Jahrgang 1910, und die Zwillinge Michel und André, Jahrgang 1936, waren in Paris geblieben, da diese das Abitur bald ablegen sollten. Mutter und Zwillinge verbrachten jedes Jahr die Sommer-Ferien und Weihnachten mit Onkel Richard in Granada, der für den Rest des Jahres ein großes leeres Haus allein bewohnte und der unsere gemeinsame Zeit sehr genoss.
Onkel Richard war sehr gebildet und wusste vieles über die Gegend und Land und Leute zu erzählen, zum Beispiel über die Süßwasserhaifische des Cocibolca Sees und über den Hausvulkan Granadas, den 1.344 m hohen Schichtvulkan Mombacho. Die mystische Wolkenflora des Vulkans und seine Legenden waren Kraftnahrung für meine Fantasien und mein Onkel konnte spannend erzählen über die verlorenen Seelen in den vier Kratern des Vulkans und auch über die unheimliche Fauna der Wolken. Er kannte auch die Legenden und Märchen von der Ciguacoat, von der Prinzessin Oyanka, von dem Sisimique, vom Barco Negro, von der Schlange mit den 3 Haaren, von Ometepet und Nagrando, von der süßen Xali aus Cailahua, von Umanka, von der Mocuana und so weiter und so weiter. Mein Lieblingsmärchen war jedoch das der Cadejos
- »Onkel Richard, erzähle mir nochmals das Märchen des Cadejo« fragte ich fast täglich vor dem Schlafengehen
- »Muss das denn sein?« antwortete er in der Gewissheit, dass es für ihn kein Entrinnen aus diesem Flügelschlag eines Schmetterlings gab
- »Bitte, bitte…« sagte ich jedes Mal in Gebetsmühlenart und gewiss, dass mein Onkel meinem Flehen bereitwillig nachgeben würde
- »Na denn; möchtest du den weißen oder den schwarzen Cadejo hören? Dir ist bekannt, dass die zwei sich nur sehr selten begegnen und dass dann einer von den beiden sterben muss…« fragte er jedes Mal, auch wenn er die vorgeschriebene Reihenfolge kannte
- »Natürlich weiß ich das von dir, du hast es mir schon erzählt. Fang mit dem weißen Cadejo an!« erwiderte ich voller Ungeduld
- »Du weißt, beide sind Nacht-Geister die den Menschen um Mitternacht erscheinen, der weiße Cadejo um die Menschen auf ihrem Weg zu beschützen und der schwarze Cadejo um die Menschen auf ihrem Weg zu töten« und hier schnitten wir beide alberne Grimassen, die unsere vorgespielte Angst ausdrücken sollten
- »Das weiß doch jedes Kind!« sagte ich voller Inbrunst, während ich mich im Schaukelstuhl langsam hochschaukelte
- »Es wird berichtet, dass es um 1800 einen rechtschaffenen Wachmann, José Antonio, gab« begann Onkel Richard in einem Reporterton seinen von mir geschätzten Bericht
- »Er hieß wie das Lied…« fügte ich erwartungsvoll hinzu, das Lied war damals sehr in Mode und wurde oft überall während der August-Festtage gespielt
- »José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar que sea Junio y garúe, me acurrucaré a tu espalda, bajo tu poncho de lino…« trällerte kurz Onkel Richard um meine Erwartungen zu erfüllen
- »Weiter mit der Erzählung, bitte!« flehte ich ihn an
- »Er wohnte in einer Strohhütte nahe Nandaime. Er arbeitete auf einer Farm am Fuße des Mombacho und kam täglich von der Arbeit um Mitternacht nach Hause. Seine Frau und seine kleinen Kinder verbrachten den ganzen Tag alleine auf den Feldern. José Antonio begegnete jeden Tag auf dem Rückweg einem weißen Hund vor seinem Haus. Der Hund sah ihn kommen, schüttelte sich, machte kehrt und verschwand. José Antonio versuchte vergeblich dem Hund zu folgen. Das war unmöglich, er schaffte es nie. Eines Tages, der Hund bewegte sich nicht als José Antonio kam, er blieb ganz stumm und hatte die Augen zu. José Antonio berührte seine Pfote und der Hund öffnete seine Augen. José Antonio erschrak und der Hund sagte zu ihm: »Du brauchst meine Hilfe nicht mehr«. Er fragte ängstlich: »Welche Hilfe?« Der Hund sagte wehleidig »Ich bin ein von oben gesandter Hund. Meine Aufgabe war, dich vor allem Übel zu beschützen; aber du hast mir gezeigt, dass du meine Hilfe nicht brauchst«. Anschließend schloss der weiße Hund die Augen und José Antonio begrub ihn und jedes Mal, wenn er nach Hause kam, dachte er an den Hund« sagte Onkel Richard mit Wehmut
- »Und jetzt bitte den schwarzen Cadejo mit seinen funkelnden roten Augen!« sagte ich mit passender Mimik dazu
- »Es wird berichtet, dass es, auch um 1800, eine aufrichtige Nonne gab, die nachts Bettler mit Lebensmitteln auf der Calzada von Granada versorgte. Auf diese Nonne hatte es der schwarze Cadejo abgesehen, und er versuchte, sie jede Nacht anzugreifen. Die Nonne war aber immer mit Senfkörnern und einem Rosenkranz bewaffnet. Bei erhöhter Gefahr blieb sie auch mitten auf einer Straßen-Kreuzung stehen, ein Kreuzzeichen, das den schwarzen Cadejo in Schach hält, da er die Kreuzung nicht betreten darf…« sagte mein Onkel mit spannungsgeladener Stimme
- »Oh, ja! Erzähle von seinem fürchterlichen Gestank, seiner riesenhaften Gestalt und seinem Klumpfuß!« war meine unausweichliche Aufforderung
- »Er war so groß wie ein Rind und hatte immer einen unersättlichen Hunger auf Menschenfleisch und konnte nur von einem weißen Cadejo oder einem Menschen reinen Herzens getötet werden. Wer sich zu ihm umdreht, verliert den Verstand und den schwarzen Cadejo ansprechen, ruft Wahnsinn hervor. Er frisst mit Vorliebe den verwesten Rumpf eines toten Menschen…«
An dieser Stelle schlief ich stets friedlich ein und hatte süße Träume von kochendem Blut und leckeren Bandwürmern und mein Onkel hatte seine wohl verdiente Ruhe, nachdem er mich ins Bett getragen hatte.
Zu meines Onkels Bekanntenkreis gehörten auch einige Würdenträger der Nawat-Bevölkerung, mit denen er sich regelmäßig traf. Meistens in seinem Haus, da sie dort in Ruhe und ungestört tagen konnten. Sie sprachen immer über die Nawat-Tradition und wie das Nawat-Volk es immer wieder verstanden hat, unbemerkt an den Schaltstellen der herrschenden Kulturen zu gelangen. Anfangs schlich ich mich ins Nebenzimmer ein und lauschte hoch konzentriert, bis mein Onkel eines Abends mich entdeckte und mich offiziell und ernsthaft in die Runde einführte
- »Mein lieber Grégoire Ricardito, was machst du hier zu später Stunde?« fragte mein Onkel sanft aber eine klare Antwort erwartend
- »Lieber Onkel, ich wollte nicht stören, aber all die Themen, die ihr hier behandelt, faszinieren und fesseln mich« antwortete ich demütig und mit zu Boden gesenktem Blick
- »Mal schauen, ob du die Wahrheit sagst. Komm mit, ich werde dich in die Runde vorstellen« sagte er und nahm mich ins Wohnzimmer, wo 3 Würdenträger auf Onkel Richard mit mir, seinem Gefangenen, warteten, nachdem er ihnen signalisiert hatte, dass wahrscheinlich jemand im Nebenzimmer war und er den Eindringling stellen wollte
- »Verehrte Meister, darf ich euch meinen Neffen Grégoire Ricardo, den Eindringling, vorstellen? Dies ist Großmeister Teodoro Nonaua« fing Onkel Richard auf Spanisch an
- »Guten Abend Ueytiani Nonaua, ich freue mich sehr Ihre Bekanntschaft zu machen« sagte ich respektvoll zu ihm auf Nawatisch
- »Es ist eigenartig, dass du sofort die Bezeichnung Ueytiani verwendest. Üblicherweise werden die nawatischen Würdenträger von Außenstehenden Nemachtiani oder Temachtiani genannt« fügte mein Onkel weiter auf Nawatisch mit nachdenklicher Stimme
- »Allein die Tatsache, dass er die Bezeichnung kennt, ist schon verwunderlich und spricht für die Ernsthaftigkeit seines Eindringens« sagte Ueytiani Nonaua wohlwollend und von da an sprachen wir untereinander ausschließlich Nawat
- »Und dieser ist Ueytiani Alejandro Tonacate« fuhr Onkel Richard fort
- »Es ist mir eine große Ehre Sie persönlich kennen zu lernen, Ueytiani Tonacate« sagte ich voller Überzeugung
- »Und der dritte im Bunde ist Ueytiani Casimiro Tecutli« beendete Onkel Richard die Vorstellung
- »Es tut mir Leid, Sie bei Ihren Ausführungen unterbrochen zu haben, Ueytiani Tecutli« sagte ich mit einem Unterton schlechten Gewissens
- »Macht nicht, nachdem du mit der Verwendung eines einzigen Wortes unsere ungeteilte Aufmerksamkeit geweckt hast, kannst du zusammen fassen, was ich vorher versucht habe zu erklären?« fragte er mich direkt
- »Selbstverständlich! Sie erklärten die zentrale Rolle der Herzopfer in der altamerikanischen Tradition, in diesem Kontext haben Sie bewusst vermeiden, die Bezeichnung präkolumbinisch zu verwenden, als wesentlichen Bestandteil der Mythen und Zeremonien und den Leitgedanken, dass die Priester nicht um mehr Sonnenlicht mit ihren Opfern bitten, sondern dass sie mit den Opfern beim Tonacatecut eher eine Schuld in aller Demut begleichen wollen. Tonacatecut ist der oberste Himmelsgott, der nur einen geheimen Kult durch die Ueytiani genießt« sagte ich kurz und bündig
- »Mein lieber Grégoire Ricardo, du hast den Nagel auf dem Kopf genau getroffen« rief Ueytiani Tecutli mit Begeisterung auf, während die anderen zustimmend nickten
- »Wobei hier zu beachten ist, dass in einigen altamerikanischen Sprachen zwischen den Verben <opfern> und <Schuld begleichen> nicht unterschieden wird« fügte Ueytiani Tonacate hinzu
- »Und was ist deine Meinung zum Sonnekult?« fragte mich Onkel Richard
- »Ein Irrtum, entstanden aus Unkenntnis der wahren Nawat-Theologie bei den erobernden Volkern, wie Tolteken, Mayas, Azteken, Inkas und später bei den Spaniern« antwortete ich knapp
- »Würdest du dies präzisieren…« verlangte Ueytiani Nonaua in Erwartung einer ausführlichen Erläuterung meiner knappen Formulierung
- »Es ist bekannt, dass die erobernden Völker die vorgefundenen Riten in ihre Kulten oft unkritisch mit allen möglichen Widersprüchen in ihr Pantheon eingliederten. Die vom Nawat-Volk dem obersten Himmelsgott dargebrachten Opfer wurden leicht als Opferrituale für den Sonnengott interpretiert. Die Menschenopfer wurden dann ein bedeutender Bestandteil der Riten der Altamerikaner und aus einem ausgewählten Opfer wurden Massenopferungen für einen eigentlich falschen Gott, der ihnen somit nicht helfen konnte. Ein Missverständnis, das die Großmeister gewähren ließen, weil sie dadurch ihre wahre Theologie sichtbar für alle gut verstecken konnten« trug ich sachlich vor
- »Eine sehr präzise Einschätzung der tatsächlichen Lage« beschloss Ueytiani Nonaua, der von den anderen uneingeschränkte Zustimmung erhielt
- »Eine eines Großmeisters gebührende Überlegung« ergänzte Ueytiani Tonacate, lachte mich an und legte seinen Arm respektvoll auf meine Schulter
- »Der Vortrag eines primus inter paribus« pflichtete Ueytiani Tecutli bei und rückte hinter mir einen zu mir passenden Stuhl
- »Unglaublich!« sagte Onkel Richard und forderte mich mit der Hand unmerklich auf, dort Platz zu nehmen.
Das Eis war also gebrochen und ich saß im Wohnzimmer mitten unter den Erwachsenen. Ich hörte ihnen zu, fragte sie gezielt nach bestimmten Sachverhalten und erklärte ihnen auch manche Zusammenhänge, die sie bis dato übersehen hatten. Wir blieben beim Hauptthema des Abends, nämlich der rituellen Menschenopferung in den altamerikanischen Religionen. Wir tauschten Erkenntnisse über Mythen und Zeremonien der Altamerikaner. Sie waren an dem Abend so verwundert über meine Erläuterungen und meinen Sachverstand, dass sie spontan beschlossen, mich an den Sitzungen als vollwertiges Mitglied teilnehmen zu lassen. Mein Onkel selbst war am Meisten über den Verlauf des Abends und meine Beherrschung der Nawat-Sprache überrascht, ließ sich aber nichts anmerken und bat mich zusammen mit den anderen Würdenträgern darum, Stillschweigen über unsere Sitzungen zu bewahren.
Wir behandelten in weiteren Sitzungen die Schöpfungsgeschichte, die Erschaffung der Sonne. Eine ganze Sitzung widmeten wir der manipulatorischen Fähigkeit der Großmeister, wie der geheime Kult immer geheim gehalten wurde und wie die anderen Völker bezüglich des wahren Kults in Unwissenheit gelassen wurden. Die falsche Korrespondenz eines Sonnengottes mit der zahllosen Opfergabe, nach dem Motto viel hilft viel bei den Azteken, Mayas, Inkas usw. wurde auch in einer weiteren Sitzung im Detail behandelt. Auch das Töten durch Verzehrung des Herzens im Sinne von Töten durch Zauberei wurde in einer ganzen Sitzung behandelt und die Traditionen der Raubzüge wurden nicht vernachlässigt. Die theoretische Ausbeute in den Sitzungen war bemerkenswert und fruchtbar für alle Teilnehmer, so dass es nicht verwunderlich war, dass wir den Kontakt nach meiner Umsiedlung nach Europa weiterhin per Brief pflegten. Meine Briefe wurden in den Treffen vorgelesen und gaben oft Anlass zu lebhaften Diskussionen. Die große Entfernung war für unsere Ueytiani-Gruppe kein Grund für das Abstellen unseres Dialogs.
Die Wochenenden und Schulferien verbrachte ich hingegen und in der Regel brav bei meinen Eltern in Masaya.
Die Landstraße Masaya-Granada war damals nicht richtig ausgebaut und es gab oft Verkehrsprobleme wegen Verkehrsunfälle, Unwetter, Erdbeben und ähnlicher Katastrophen. Nicht selten mussten wir bei der Bergung von Verletzten und Toten helfen, was mich besonders stimulierte je mehr Wunden und Blut ich sah. Es war ein Hochgenuss die verstümmelten Körper und herumliegenden abgetrennten Körperteile zu sehen und diese barhändig zu sammeln, denn damals war es noch nicht üblich, mit Handschuhen zu arbeiten. Hierbei scherte ich mich keinen Deut um das verfluchte Gewissen des Ewigen, da meine Befriedigung und Ekstase maßlos waren, vor allem , wenn ich mein Taschenmesser mit sehr scharfer Klinge in die Hand nehmen durfte, um bei der Leichenbergung Körperteile zu trennen.
Ein weiterer Zeitvertreib in meiner Kindheit war die Mäusejagd. Ich jagte sie auf vielfältige Art, zerlegte sie nach verschiedenen Mustern und fütterte damit streunende Katzen, die immer aus respektvollem Abstand vor meinem Fenster auf ihr Futter mit ein bisschen pechschwarzem Instinkt warteten. Sie fraßen mit voller Wonne, langsam und majestätisch die zerlegten Teile, die ich chirurgisch akribisch schnitt, damit ihre Schnauze mit dem Genuss des Ewigen beglückt wurde. Nach dem Mahl genoss ich von meinem Fenster aus, wie die Katzen in unaussprechlicher Befriedigung sich in eine unbewegliche Ekstase versetzten, bevor sie lautlos im Dunklen der Nacht verschwanden.
Das elterliche Haus war für all diese Tätigkeiten strategisch günstig gelegen und das Büro meines Vaters befand sich im Nebenhaus. Dort konnte ich mich ziemlich frei und unverdächtig bewegen. Dieser Umstand erlaubte mir, alle einschlägigen Vorschriften und Verfahrensweisen die Ausstellung von Identifikationsdokumenten betreffend genauestens zu erlernen. In dieser Zeit konnte ich einige Blanko-Pässe, einen alten Konsulatsstempel, den ich vor der Vernichtung gerettet habe, und zahlreiche amtliche Vordrucke verschwinden lassen, die ich in weiser Voraussicht aus dem Konsulat unauffällig mitnahm.
Mit dreizehn Jahren wurde ich 1954 von meinem Vater ins Gymnasium nach Frankreich geschickt, wo ich bei Tante Heloïse Lebouche, der Schwester meiner Mutter, Jahrgang 1912, wohnte und wo ich mein Abitur erfolgreich abschloss und meinen französischen Führerschein machte. Den Führerschein in Paris zu machen, war eine Erfahrung fürs Leben und bereicherte mein Schimpf- und Fluchvokabular in ungeahnten Maßen.
Tante Heloïse war geschieden und hatte zwei Töchter, Douce, Jahrgang 1934, und Catharine, Jahrgang 1936, die bereits aus dem Hause waren. Sie hatte eine 6-Zimmer Wohnung im 14. Bezirk nicht weit vom Parc Montsouris in einem gut erhaltenen Patrizierhaus mit hohen Decken und einem repräsentativen Treppenhaus, das ihr gehörte, und nur zwei Blocks von meinem Gymnasium entfernt. Ihre Geschichte ist schnell erzählt: Sie dachte, sie führe eine glückliche Ehe, bis ihr Mann ihr eröffnete, dass er eine Geliebte hätte, mit der er eine Hälfte jeder Woche verbringen wollte; die andere Hälfte würde er wie gehabt mit Tante Heloïse verbringen. Tante Heloïse setzte ihn postwendend vor die Tür und ließ sich scheiden, bevor Bertrand, ihr Mann, Jahrgang 1910, halbwegs realisieren konnte, was passiert war.
Danach war sie unnahbar für die Männer, die sie immer auf Distanz hielt, bis Maurice, Jahrgang 1911, auf der Bildfläche erschien. Sie trafen sich über 2 Jahre lang für ca. 5 Tage in unregelmäßigen Abständen zu einer parenthèse, wie sie das nannte. Sie genoss diese Zeit und lebte auf, bis beide einmal fast richtigen Geschlechtverkehr miteinander hatten. Die Vorzeichen für das darauf folgende Treffen schienen bereits festgelegt, als sie eine abrupte Wendung vollzog. Das entscheidende Telefonat habe ich zufällig mitbekommen
- »Ich bin mit dir einer Meinung bezüglich der unterschiedlichen Logiken die Mann und Frau verwenden: Mann hat einen Ein-/Ausschalter und Frau hat eine Instrumententafel mit unendlich vielen Schaltern. Du sagst, du möchtest mich essen, was fast geschah im Januar, trotz meiner starken Zurückhaltung auf der physischen Ebene, wie du weißt« sagte sie als ich ins Nebenzimmer leise rannte und vorsichtig den Hörer vom zweiten Telefon abnahm
- »Du hast es auch gewollt! Wir hatten Sex miteinander auf eine besondere und genussvolle Art, und ich hatte den Eindruck, du mochtest das, was mir gestattet war, dir zu geben«
- »Du hast mich bei jeder Parenthèse wieder zu einem Frauenleben erweckt, um mich dann für unbestimmte Zeit zu verlassen. Ich lebe wie die Frau eines Matrosen und das in meinem Alter! Du möchtest kommen, du hast bereits meine Zusage für das nächste Treffen im Juni, ich würde dich gerne willkommen heißen, aber all meine Zweifel…«
- »Sein oder nicht sein, Vorwärts und Rückwärts, hü und hott!«
- »Ich bin keine unbeständige Frau… Aber das Leben ist nie eindeutig!«
- »Sei ehrlich zu dir selbst!«
- »Ich weiß, du hast meine Entscheidung respektiert, keinen Sex mit dir zu haben, aber dies war sehr hart für uns beide«
- »Du bist schlimmer als ein Teenager!«
- »Ich möchte nicht deine Liebe, Achtung, Mittäterschaft oder Kultur verlieren, aber ich kann nicht mehr ein Teenager sein und die Qualen der Liebe nochmals erleiden«
- »Nenne das Kind beim Namen! Ich kaufe morgen meine Fahrkarte«
- »Bitte komme nicht im Juni! Verzeihe, dass ich dir und unserer Beziehung den coup fatal einfach so gebe«
- »Du weißt, dies ist dann der Punkt ohne Wiederkehr für uns«
- »Ich weiß, es hat keinen Sinn mehr«
Es war eine zarte und einmalige Beziehung zwischen Tante Heloïse und Maurice, die sie dann aus ihrer Unfähigkeit über den eigenen Schatten zu springen abrupt beendete. Ich entschied, den Vorfall komplett zu ignorieren und hatte dabei ein gutes Gefühl.
Tante Heloïse hatte ein wohl gepflegtes Steckenpferd, das sie von ihrer Mutter geerbt hatte und an dem sie mir ab dem Vorjahr zu meinem Abitur teilnehmen ließ: Den Zirkel Salon 10! Eines Abends unterhielten wir uns wie üblich nach dem Abendessen, als sie beiläufig fragte
- »Grégoire Ricardo, würdest du mich am übernächsten Freitag zu einem Treffen meines Salons begleiten?«
- »Sehr gerne Tante Heloïse, wenn du mir sagst, was das ist und was mich dort erwartet« tastete ich mich vorsichtig an das Thema heran
- »Unser Zirkel heißt Salon 10, weil wir 10 Treffen im Jahr veranstalten, immer freitags, 19:00 bis 24:00 Uhr an einem diskreten Ort mit der nötigen Infrastruktur für die Verpflegung von ca. 200 Personen. Weihnachten und Ostern findet kein Treffen statt, daher 10 und nicht 12 in der Bezeichnung« erklärte sie
- »Salon ist für mich zunächst die Bezeichnung des Empfangszimmers in der großbürgerlichen Wohnkultur, die aber historisch ab dem 17. Jahrhundert betrachtet, die Bedeutung von Empfängen geistreicher Damen und deren intellektuelle, literarische oder politisierende Zirkel annahm« erklärte ich im Ton eines Klassenbesten
- »Sehr gut angemerkt! Unser Zirkel ist eine direkte Nachkommenschaft der Salons von Mme. de Tencin, Mme. de Geoffrin und Mlle. de Lespinasse« gab Tante Heloïse zu Protokoll
- »Meine Güte! Darin verkehrten lauter Berühmtheiten wie die Enzyklopädisten…« staunte ich nicht schlecht und traute meinen Ohren nicht
- »Aber auch D'Alambert, Montesquieu und Voltaire… Unser Zirkel zählt seit 100 Jahren 321 Mitglieder. Die Mitgliedschaft wird nur vererbt…« erklärte sie in einem eindeutig konspirativen Ton
- »Halt! 321 Mitglieder, aber nur 200 Teilnehmer am Treffen, wie das?« wandte ich sofort ein
- »Frau ist nicht verpflichtet, an jedem Treffen teilzunehmen. Frau ist nur verpflichtet, auf die Einladung zu antworten, du kennst die berühmte Abkürzung <uAwg>. Die Einladung gilt jeweils für das Mitglied mit einer Begleitperson und erfahrungsgemäß kommen zu einem Treffen ca. 100 Mitglieder mit Begleitperson und der oder die Ehrengäste« war ihre einleuchtende Erklärung
- »Dies wird eine große Ehre für mich sein. Wenn ich bedenke, dass die Salons stark zur Ausbildung der französischen Sprache beigetragen und geistige Moden entwickelt haben…« sagte ich mich geschmeichelt fühlend
- »Die Précieuses! Wir waren immer Trendsetter, die Avantgarde des Fortschritts. Übrigens, Abendgarderobe ist vorgeschrieben. Also, kann ich dies als deine verbindliche Zusage betrachten?« fragte sie konkret
- »Gerne sage ich verbindlich zu, Tante Heloïse« war meine respektvolle Antwort.
Mein erster Salonbesuch war für mich lehrreich. Das Lokal lag südwestlich vom Paris bei Pont des Sèvres auf einer ausgedehnten Parkanlage und war an dem Abend exklusiv für den Salon geöffnet. Es war ein von 4 Stammlokalen des Salons, alle ziemlich idyllisch in der Pariser Peripherie gelegen. Um 18:00 Uhr war Begrüßung mit Aperitif. Zwei Stunden später gab es Abendessen. Danach um 22:30 Uhr Konzert, einen Auszug aus Rachmaninows 5. Klavierkonzert, gespielt von einem begabten jungen Pianisten, und um 23:30 Uhr einen Abschiedstrunk. Ich kam bei den älteren Semestern gut an und die Damen steckten mir diskret ihre Visitenkarten mit ihren ganz privaten Telefonnummern in die Jackentasche ein.
Schon bei meinem ersten Salonbesuch hatten sich mir zahlreiche Kontaktmöglichkeiten eröffnet, die ich systematisch ausbaute. Mit den älteren Semestern arrangierte ich samstags und sonntags Treffen, die in der Regel 4 bis 5 Stunden dauerten. Da ich noch bei Tante Heloïse wohnte, lag es an den Damen, für geeignete Nestplätze zu sorgen und ich muss sagen, wenn frau die Mittel, Erfahrung und Hunger hat, ist ziemlich alles machbar.
Ich startete meinen ersten Versuch direkt am Sonntag nach dem ersten Salonbesuch. Ich rief Mme. Marie-Odile Petri an, eine attraktive 52-jährige Dame, Mutter von Ellaïs, ein Mädchen in meinem Alter, mit dem ich später eine Beziehung aufbaute, die schon am Telefon vor Verlangen schmolz
- »Guten Morgen Madame Petri, hier Grégoire Ricardo, ich hoffe mein Anruf kommt nicht ungelegen…« fing ich ganz diplomatisch an
- »Ganz und gar nicht, ich freue mich, deine Stimme zu hören. Was gibt's?« fragte sie erwartungsvoll
- »Sie haben am Freitag einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, auch Ihre Telefonnummer, wollen wir uns treffen?« fragte ich sie direkt und konnte hören, wie sie schwer atmete
- »Junger, Junger, du gehst sofort zur Sache. Das gefällt mir! Mach mal einen Vorschlag« erwiderte sie mit sanfter Stimme und schwerem Atem
- »Wie wäre es mit diesem Samstag?« erwiderte ich in verführerischem Ton
- »Ausgezeichnet, lass mich herausfinden, wo wir uns ungestört treffen können. Kann ich dich in einer Stunde zurückrufen?« fragte sie weiterhin unter Atemnot leidend
- »Ich bitte darum« sagte ich, während ich mir ihr Gesicht vorstellte, als ich ihr meine Telefonnummer durchgab
- »Bis dann, also« sagte sie mit einem Seufzer der Zufriedenheit.
Dann rief ich Mme. Margot-Siloé Tridde, Mutter von Baptiste und Margot, eine enge Freundin von Ellaïs, an
- »Guten Tag Madame Tridde, hier Grégoire Ricardo, haben Sie eine Minute Zeit für mich?« fragte ich rhetorisch
- »Für dich immer, was hast du am Herzen?« erwiderte sie mit unschuldigem Ton
- »Nicht direkt am Herzen, etwas tiefer würde ich sagen…« sagte ich mit nicht unschuldigem Ton in meiner Stimme
- »Mann, oh Mann! Du gehst aber ran!« sagte sie angenehm über meine Direktheit überrascht
- »Können wir uns treffen?« war meine kurze Frage
- »Wann?« war ihre kurze melodische Antwort
- »Heute in acht Tagen« war mein Vorschlag
- »Nächster Sonntag ist gut. Wir können uns bei mir treffen, denn ich bin den ganzen Tag allein. Mein Mann und die Kinder kommen erst am Abend von Lyon zurück. Um wie viel Uhr möchtest du kommen?« sagte sie in freudiger Stimmung
- »Zehn Uhr?« fragte ich etwas verführerisch
- »Zehn Uhr ist mir sehr recht. Bis dann« und ich hörte über den Hörer einen sanften Kuss.
Kurz darauf kam der Rückruf von Marie-Odile
- »Petri, hallo Grégoire Ricardo, wir können uns am Samstag zwischen 14 und 19 Uhr bei meiner Freundin treffen. Sie lebt allein und stellt uns ihre Wohnung für diese Zeit zur Verfügung« sagte sie voller Erregung
- »Ausgezeichnet, wie lautet die Adresse?« fragte ich als ich Papier und Stift aus der Schublade holte
- »Boulevard St Michel 650, bei Murgier« sagte sie mit sexy Stimme
- »Habe ich notiert: Boulevard St. Michel 650, bei Murgier; freue ich mich schon darauf, bis dahin« erwiderte ich mit sanfter Stimme
- »Ich mich erst, bis dann also« antwortete sie mit noch süßer Stimme.
Nach dem Treffen mit Marie-Odile und Margot-Siloé stieg der Kurs meiner Aktie in Windeseile hoch, und ich ran bei allen Zirkel-Damen offene Türen ein. Die Damen waren nach außen hin sehr verschwiegen, aber unter sich tauschten sie ungehemmt Informationen über gute und schlechte Lovers aus.
Diese Zeit war eine sexuelle Herausforderung, die meine ganze Hingabe abverlangte. Der höchste Reiz bestand jedoch darin, freitags mit den Töchtern in die Keller-Klubs tanzen zu gehen und auch nach dem obligaten Gang durch die schrillen Szene-Lokale mit ihnen anschließend Sex zu haben. Mit den jüngeren Semestern galt es zu improvisieren, da sie meist noch bei den Eltern wohnten, aber in Paris gab es ja so viele Parkanlagen und eine freie Bank haben wir immer gefunden.
Ich knüpfte so zahlreiche intime Kontakte mit den Mitgliedern und ihrer Töchtern, die mir später sehr nützlich wurden. Mein Bekanntenkreis wurde somit umfangreich und ich verkehrte in allen gängigen Jugendlokalen der Stadt. Die Salonbesuche mit meiner Tante wurden in dieser Zeit eine feste Institution in meinem Leben.
Nach einem letzten Besuch bei meinen Eltern in Masaya kehrte ich 1959 wieder nach Europa zurück und im Anschluss darauf studierte ich Biologie in Heidelberg und absolvierte mein Biologie-Diplom. In Paris bezog ich 1960 eine Wohnung, die gerade in einem unserer Mietshäuser frei wurde. Somit hatte ich bereits einen unabhängigen Wohnsitz in Paris während meines Studiums in Heidelberg, die von meiner Fangemeinde stark frequentiert wurde, immer wenn ich mich in Paris aufhielt.
Heidelberg ist eine typische Universitätsstadt mit vielen Studentenwohnheimen und daher lag es nah, eine Unterkunft in einem Wohnheim zu suchen und zu erhalten. Mein Studentenwohnheim war katholisch und hatte eine eigene studentische Selbstverwaltung und lag in der Keplerstraße mit direktem Durchgang zur St. Raphael-Kirche und Gemeindeeinrichtungen in der Werderstraße. Jeder, der sich im Wohnheim einbringen wollte, war willkommen, dies zu tun.
Meine Institute lagen so günstig zur Keplerstraße, dass ich sie zur Not auch zu Fuß erreichen konnte. In der Regel benutzte ich aber das Fahrrad oder die Straßenbahn, um dorthin zu kommen.
Im Rahmen der Selbstverwaltung war es für mich ein leichtes Spiel, einen neuen Kommilitonen bei der Stadt anzumelden. Schließlich hatte ich Zugang zu allen Formularen und Stempeln und es gab keine strenge Kontrolle der ausgestellten Dokumente. Mit dem entsprechend von mir ausgestellten Alias, Basile Delmond, machte ich den deutschen Führerschein, den ich später in Frankreich in einen französischen umtauschte. Zu unseren Obliegenheiten im Wohnheim gehörte Pförtnerdienst schieben. Ich wurde oft mit einem oder auch mehreren Kommilitonen zum Pförtnerdienst eingeteilt. Nach einer gewissen Zeit schob ich oft Dienst mit Günther Pfannschmitt, Jahrgang 1939, zusammen. Ein Medizinstudent mit bewegtem Liebesleben und einer umfangreichen Medizinbibliothek, der mir etwa vier Semester voraus war.
Günther interessierte sich auch für mein Fach und so kam es, dass wir oft voneinander Bücher ausliehen und viele Fachgespräche miteinander führten. In dieser Zeit belegten wir zusätzlich einige Kurse in Kriminologie und Kriminalbiologie zusammen, die mir den Einblick in die Denkweise der Kriminalen erlaubten. Zu meinem Glück hatte Günther gute Beziehungen in seinem Institut und er ermöglichte mir den Besuch einiger Kurse in Pathologie. Die Sezierkunst war mein Steckenpferd und da ich beim Zerlegen der Leichen und ihrer Teile für anatomische Untersuchungen in kurzer Zeit eine bemerkenswerte Fähigkeit entwickelte, wurde mir meistens diese von den anderen Kommilitonen nicht hochgeschätzte Arbeit gerne überlassen. Ausnahmsweise und nicht zuletzt durch die tatkräftige und aktive Unterstützung Günthers erhielt ich eine HiWi-Stelle im besagten Institut und so hatte ich auch die Möglichkeit, gebrauchtes und ausrangiertes Besteck bei Bedarf vor der Verramschung günstig zu erwerben.
Eines Tages im Sommer 1962 beim Pförtnerdienstschieben im Studentenwohnheim hatte ich den Eindruck, dass bei Günther etwas nicht in Ordnung war
- »Was ist mit dir los?« fragte ich ihn in einem ruhigen Augenblick an der Pforte
- »Nichts« antwortete Günther verlegen
- »Natürlich bedrückt dich etwas, aber wenn du nicht darüber sprechen willst, werde ich nicht weiter fragen« fügte ich hinzu ohne an eine Antwort zu glauben
- »Ich weiß nicht so recht, vielleicht später…« sagte er zögernd
- »In Ordnung, melde dich, wenn du soweit bist. Du weißt, ich habe immer ein offenes Ohr für dich und kann schweigen wie ein Grab« sagte ich kategorisch
- »Ich weiß, ich weiß…« murmelte er voller Überzeugung.
Unser Dienst dauerte 3 Stunden und wir machten fast immer eine Halbzeit-Pause hintereinander, da wir nicht selten die Erfahrung gemacht hatten, dass jemand gerade kam und was von uns wissen wollte, wenn wir zusammen Pause machten. Ich aß also mein mit Fleischkäse und scharfem Senf belegtes Brot, während er den Kamillentee aufgoss und mir von seinem Problem erzählte, besser gesagt, vom Problem seiner jüngsten Schwester, die zwei Jahre jünger als ich war
- »Ich habe gerade heute Nachmittag erfahren, dass meine Schwester Isolde in der sechsten Woche schwanger ist und dass sie am liebsten abtreiben möchte« sagte er, als er unsere Humpen mit Tee auffüllte
- »Und? Wirst du ihr helfen?« fragte ich konkret, nachdem ich einen dicken Brocken Brot mit Tee runtergespült hatte
- »Keine Frage, ich tue alles für meine Schwester, aber dies ist eine delikate Sache und zurzeit hier in Deutschland nicht erlaubt« sagte er voller Überzeugung und neidisch schauend auf mein Brot
- »Erlaubt oder nicht erlaubt, das ist hier Wurscht! Wie kann ich helfen?« war meine schlichte Frage, auf die er nicht direkt einging
- »Die interruptio graviditatis kann man durch Saugkürettage oder durch pharmakologische Anregung oder durch chirurgischen Eingriff vornehmen« rezitierte er in langweiligem Ton aus einem seiner Bücher
- »Du möchtest wahrscheinlich den Eingriff in der achten Woche vornehmen« überlegte ich laut während ich versuchte ein Stück Brotkruste aus dem Zwischenraum meiner dritten und vierten Zähne des rechten Oberkiefers loszuwerden
- »Ganz recht! Vorher muss ich mich in die Materie einlesen. Für den Eingriff selbst brauche ich einen ruhigen Platzt und..« fing er zustimmend an, aber ich ließ ihn nicht zu Ende reden
- »Und meine Hilfe!« fügte ich kategorisch hinzu, nachdem ich erfolgreich den Fremdkörper aus meinem Mund entfernt hatte
- »Würdest du mir wirklich assistieren?« fragte er zweifelnd
- »Natürlich! Keine Frage. Wie ist es mit dem ruhigen Platz?« fragte ich weiter und spülte meinen Mund kräftig mit Tee, bevor ich den ganzen Inhalt mit Genuss hinunterschluckte
- »Meine Eltern haben eine Wochenendhütte im Schwarzwald, genau in Sinzheim-Kartung, die wir benutzen könnten« gab er zu Protokoll amüsiert über meine Künste
- »Ich kenne ein Sinsheim hier in der Nähe« fügte ich mit Erleichterung und fragend hinzu
- »Nein, das ist die falsche Ortschaft, Sinzheim mit Zulu, nicht mit Sierra, kurz nach Baden-Baden« sagte er in belehrendem und wohlwollendem Ton
- »Ich verstehe, Hauptsache, du weißt, wo das liegt, falls dies nicht klappen sollte, können wir nach Paris fahren und meine Wohnung benutzen« bot ich spontan an, nach einem weiteren kräftigen Schluck Tee
- »Vielen Dank, ich hoffe dies wird nicht nötig sein. Jetzt muss ich aber meine Schwester informieren und den Termin festlegen« sagte er mit Erleichterung in den Augen
- »Tue es und gib mir ruhig Bescheid. Noch eine Frage: Hast du das nötige Besteck oder soll ich etwas besorgen oder mitbringen? Zum Beispiel ein Auto besorgen?« war meine letzte geschäftsmäßige Frage während ich die Krümel-Reste meines Vespers in den Mülleimer warf
- »Nein, ich glaube ich habe alles, was wir brauchen, auch einen fahrbaren Untersatz und eine Legende für meine Eltern, damit sie nicht Verdacht schöpfen, wenn wir zu dritt das Wochenende zusammen verbringen« sagte er aus seinem tiefsten Inneren heraus und begann seine Pause während ich mich um ein paar Heimmitbewohner kümmerte, die mit dem Fahrradabstellplatz nicht zurecht kamen.
Der Termin wurde festgelegt und wir haben den Eingriff wie geplant erfolgreich vorgenommen. Auch wenn die Situation für Isolde und mich komisch bis eigenartig war, wir verstanden uns auf Anhieb gut und wickelten das Vorhaben wie echte Profis ab. Ich habe mich anschließend um die Beseitigung des Fötus gekümmert, was mich außerordentlich stimulierte. Nach diesem Ereignis waren die Bindungen zu Günthers Schwester herzlich, auch wenn wir uns nicht so oft sahen. Auf meine Rückkehr nach Paris 1967 trafen wir uns drei traditionell zweimal im Jahr, zu Pfingsten in Frankreich und zu Weihnachten in Deutschland.
In den Folgesemestern belegte ich einige Kurse in Bioingenieurwissenschaft und schloss erfolgreich mein Biologie-Diplom 1966 ab, bevor ich nach Paris wechselte, wo ich meine Promotion ebenfalls mit Erfolg 1970 beendete. Während dieser Zeit pflegte ich den Kontakt zu Tante Heloïse und ihrem Salon, ganz besonders zu den stets sexhungrigen älteren Semestern aus dem Zirkel, die von ihren Ehemännern nicht mehr beachtet wurden. Die anhaltenden Zuwendungen meiner Eltern und die Besitzanteile an der Familieneigentümergesellschaft erlaubten es mir zusätzlich, dem gesellschaftlichen und leeren Treiben von Paris nach Bedarf fernzubleiben und mich ganz meiner Leidenschaft und Planung zu widmen. Mein Pariser Domizil war im 15. Bezirk auf der rue Vasco de Gama, in einem unserer Mietshäuser. Jahrelang verbarg ich erfolgreich meine Neigungen, bis ich mich entschloss, ein solches Leben nicht weiter zu ertragen. Der Zeitpunkt war gekommen, als mein Vater 1970, ein Jahr nach dem Tod meiner Mutter, verstarb. Onkel Richard half mir, den behördlichen Kram in Nicaragua reibungslos und sicher abzuwickeln.
Nach Erledigung der Erbantritt-Formalitäten ließ ich Basile Delmond in eine unserer Dienst-Wohnungen im 5. Bezirk in der rue Monge nah der Uni einziehen, wo ich mich oft zwischen Vorlesungen, Seminaren und Übungen während des Studiums aufhielt. Die Beschaffung der Ersatzpapiere für ihn verlief in der Zwischenzeit so problemlos, dass ich beschloss, Papiere für ein zweites Alias, Pierre Behr, einschließlich Führerschein bei den französischen Behörden zu beantragen, was ich auch erhielt. Pierre teilte sich dann die Wohnung mit Basile. Ich hatte also echte französische Papiere für zwei zusätzlich glaubhafte Identitäten im Gepäck.
In der Uni fand ich einen zu meiner Dissertation passenden Doktor-Vater, einen leidenschaftlichen Jäger, der mir beim Erwerb einer Jagdlizenz oder Permis de Chasser half. Es war schlicht opportun in dieser Konstellation mich so zu verhalten, es war schließlich auch ein mystisches Ritual, das ich von meiner Mäusejagd bereits kannte, für meinen Professor war es jedoch die didaktische Unterscheidung von Erlaubtem und Verbotenem und die Durchsetzung der bürgerlichen Rechte gegenüber überholten königlichen Privilegien.
Die eigentliche Prüfung bestand aus verschiedenen Schießübungen mit einer Mindesttrefferquote: 5 Treffer von 10 Schüssen mit der Flinte auf den Rollhasen. 60 von 100 Ringen beim Schießen mit der Büchse, dabei musste ich 3 Schuss sitzend aufgelegt auf den stehenden Keiler, 4 Schuss stehend auf den Rehbock und 3 Schuss stehend auf den flüchtigen Keiler abgeben. Der Rest war Bürokratie pur, Versicherung abschließen, Gebühren zahlen, sonstige Mindestanforderungen erfüllen usw.
Im letzten Jahr meines Pariser Studiums knüpfte ich mit Hilfe meines Doktor-Vaters Kontakte zu einem renommierten Pariser Institut, das neue Autoren im Fach Biologie für seine Fachzeitschrift suchte. Mein erster Artikel befasste sich mit bestimmten Verfahrensweisen zur Herstellung transgener Pflanzen einer bestimmten Gattung, die, wie es sich herausstellte, ein Stolperstein für eine US-Firma wurde, die 4 Monate später ein Patent im diesem Bereich anmelden wollte. Die Erfindung war durch die Schritte gekennzeichnet, die ich im besagten Artikel bereits ausführlich behandelt hatte. Die Erfindung konnte daher nicht als neu eingestuft werden, da sie bereits zum Stand der Technik gehörte. Durch meine schriftliche Darstellung war die Erfindung vor der Anmeldung zum Patent der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Kurz gesagt, diese Erfindung war zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht neu und der Patentschutz wurde folgerichtig nicht erteilt.
Die Leute vom Institut waren von meinem Stolperstein für die US-Firma sehr angetan, da immer große Befriedigung herrscht, wenn einem Unternehmen mittels wissenschaftlich fundierter Artikel ans Bein gepinkelt werden kann. Die gewerbliche Anwendbarkeit spielt bei Patentanmeldungen eine wesentliche Rolle und ist bereits im Vorfeld mit konkreten Investitionen verbunden. Allein die Kosten für eine weltweite Patentanmeldung sind beträchtlich, daher entwickeln die meisten Unternehmen im Einzelfall eine Anmeldestrategie, um ihre Bedürfnisse optimal zu berücksichtigen, d.h. sie ermitteln die Kosten in einem ausgewogenen Verhältnis zum erwarteten Nutzen, der in diesem Fall nicht eintrat. Daher bedeutet die Nicht-Erteilung eines Patentschutzes stets Verlust für die betroffenen Unternehmen. Somit hatte ich einen guten Einstand im Institut und konnte drei Artikel innerhalb eines Jahres veröffentlichen. Nach der Promotion wurde mir ein Forschungsposten mit zahlreichen Privilegien angeboten, den ich sofort annahm.
Über das Institut hatte ich Zugang zu den verschiedensten Materialien und Drogen und brauchte mich nicht um Copyright-Verletzungen zu kümmern, da im Institut eine eigene Abteilung sich um solche Sachen kümmerte, insbesondere bei angeblichen Erfindungsmeldungen und unberechtigten Patentansprüchen wie im vorliegenden Fall. Plagiate unserer Schriften kamen auch vor und wurden genussvoll von dieser Abteilung an den Pranger gestellt. Wohingegen unsere Schriften kaum nennenswerte Plagiate enthielten.
Meine Recherchen und Kriminologiekenntnisse ergaben, dass ein Kriminalfall ohne Leiche kaum angegangen werden kann und dass ein Verbrechen ohne Motiv und ohne Beziehung zwischen Opfer und Täter, nur zufällig aufgeklärt werden kann, und dass die Suche nach einem bestimmten Täter meistens nach Feststellung seiner Identität ein leichtes Spiel war. Die Verschleierung der eigenen Identität war in meiner Planung folgerichtig Pflicht. Was ich bereits mit der Schaffung zweier Legenden mit echten Papieren, nämlich Basile und Pierre, erledigt hatte.
Ein weiterer Punkt war die Möglichkeit, unauffällig unterzutauchen, sei es in weiteren Unterschlüpfen oder in einem Hauptquartier. Zunächst begab ich mich auf die Suche nach einem passenden Rückzugs-Hauptsitz in Frankreich außerhalb von Paris, wo ich bei Bedarf ungestört an der Beschaffung neuer Identitäten arbeiten konnte und wo ich auch das Material und die bereits erstellten Dokumente sicher aufbewahren konnte, denn Banksafes waren nicht immer sicher.
Die Wahl fiel auf eine kleine Ortschaft ca. 160 km von Paris entfernt, auf der Kreuzung zweier mittelalterlicher Handelsstraßen, die eine von der Champagne zum Loire-Tal und die andere von der Südbourgogne nach Paris. Die Ortschaft namens Beautop mit ihren 190 Einwohner, 80 Häusern und einer Fläche von 1.600 Hektar gehörte zum Département de l’Yonne in der Region Bourgogne. Ich fand ein süßes Knusperhäuschen direkt neben der Kirche. Es war Liebe auf den ersten Blick.
Ich saß an einem sonnigen Winternachmittag des Jahres 1973, genau: am Samstag, 3. November 1973, auf einer Bank vor der Kirche und bewunderte das Haus der Begierde, als ich eine Frauenstimme hinter mir hörte, die fragte
- »Lesen Sie gern?« auf meinen Knien lag das aufgeschlagene Buch Baudelaires »Blumen des Bösen« in einer französischen kritischen Version, »Les Fleurs du mal« lautet der Originaltitel des durchkomponierten Ganzen und die Erstausgabe führte bekanntlich zu einem Gerichtsverfahren und Baudelaires Verurteilung wegen Verletzung der öffentlichen Moral, das der Dame hinter mir den Einstieg in ein Gespräch mit mir ermöglichte
- »Immer wenn ich die Zeit dazu habe« erwiderte ich, als ich mich ihr zudrehte und sah eine ganz verknitterte kleine Dame, warm eingepackt in einen langen unförmigen schwarzen Mantel, auf dem sie einen langen Wollschal trug, auch schwarz. Ihre Mütze steckte tief über die Ohren und man hatte den Eindruck, sie hätte sie wild mit beiden Händen bis zum Anschlag heruntergezogen
- »Sie wollen mir nicht weiß machen, dass Sie Ihre kritische Ausgabe aus Versehen besorgt hätten« sagte sie in vornehm provokanter Haltung, während sie mit dem Finger auf mein Buch zeigte
- »Wer eine kritische Ausgabe sofort erkennt, weiß, was eine kritische Ausgabe bedeutet und lässt sich nicht leichtgläubig in die Irre führen« erwiderte ich kurz, in der Hoffnung das angefangen Gespräch fortsetzen zu dürfen
- »Ganz recht und wenn Sie dies versucht hätten, wäre unser Gespräch hiermit beendet« ergänzte sie, als ob sie meinen Gedanken gelesen hätte
- »Natürlich habe ich das Buch nicht aus Versehen besorgt, sondern aus dem inneren Verlangen mehr über das Werk selbst zu erfahren, das ich bereits kenne, wie Sie trefflich und mit kritischem Verstand angemerkt haben« erläuterte ich zur Bestätigung ihrer Annahme die Beweggründe für den Kauf, was sie lächelnd wie eine Katze, die ihre Beute fest im Griff hat, elegant quittierte.
Diese komische kleine Frau war über 80 und hatte eine klare Stimme mit einem bestimmenden energievollen Ton, der mich herausforderte. Ich stand auf und bot ihr Platz auf der Bank an, die ich mit einer weichen Reisedecke gepolstert hatte und die ich aufschlug, bevor sie Platz nahm, während ich das Buch in meine Aktentasche verschwinden ließ
- »Meine Dame, darf ich Ihnen Platz auf dieser Bank neben mir anbieten?«
- »Gewiss, Baudelaires Anhänger machen mich immer neugierig« antwortete sie, ohne viel über sich zu verraten
- »Ich stelle einfach meine Aktentasche zusammen mit ihrer Reisetasche zwischen uns ab, wenn Sie einverstanden sind« sagte ich und tat dies als sie zustimmend nickte.
Sie war über Baudelaires Leben und die weiteren Umstände des Werks bestens unterrichtet, vermied aber dozierend zu wirken; im Gegenteil, sie wirkte auf mich ganz natürlich. Ihr klarer Blick war durchtränkt von einem starken überzeugenden Willen, der mich in seinen Bann zog. Gleichzeitig fragte ich mich, wie sie es schaffen konnte, unbemerkt so nah an mich heranzukommen. Es dauerte eine Weile bis ich begriff, was sie mir mit ihrem leidenschaftlichen Vortrag wirklich sagen wollte. Sie erwähnte wichtige Leute, die sie im Laufe ihres Lebens getroffen hatte: Politiker, Ärzte, Generäle, Bischöfe, sie nannte Namen, Plätze, Verhaltensweisen, wie sie mithalf, Lebensmittel unter den hungerleidenden Gruppen zu verteilen, alles mit voller Leidenschaft. Sie war glücklich, weil sie in der Lage gewesen war, anderen etwas geben zu können, anderen zu dienen, was wiederum ihrem Leben gerade im hohen Alter einen Sinn gab. Sie war vor etwa einer Stunde aus Orleans zurückgekommen, wo sie ihre Tochter besucht hatte, und hatte eine Weile in der von außen unauffälligen Kirche verbracht, bis sie herauskam und sah wie ich, auf der Bank sitzend, das Haus bewunderte
- »Die Art, wie Sie das Haus betrachtet haben, lässt den Schluss zu, dass Sie an dem Haus interessiert sind…« sagte sie mit einem spannungsgeladenen Unterton voller Rätsel, während sie aus ihrer Handtasche eine Packung Kekse hervorholte und mir welche anbot
- »Ja! Aber ich bin hier fremd und habe keine Ahnung…« erwiderte ich ihre Hilfe erwartend und nahm den von ihr angebotenen Keks dankend an
- »Es macht nichts! Denn ich glaube ich kann Ihnen helfen« sagte sie augenzwinkernd und hoch erfreut über ihren guten Riecher, während sie auf ihren Keks genussvoll biss
- »Kennen Sie die Eigentümer?« fragte ich in der Gewissheit, die Antwort zu kennen und etwas überrascht, über den guten Geschmack des Ingwerkekses
- »Ich kenne die derzeitige Eigentümerin, denn sie ist meine Nachbarin und sie hat die Absicht, nach Fontainebleau zu Ihrem Sohn zu ziehen« sagte sie ohne Umschweife, in der Gewissheit einen dicken Fisch an der Angel zu haben
- »Also ist das Haus zu haben?« fragte ich direkt, in der Gewissheit den richtigen Kontakt neben mir zu haben
- »Ja, gewiss, aber nur unter gewissen Umständen, die noch zu klären sind. Ich kann als Vermittlerin für Sie auftreten…« fügte sie hinzu in Erwartung einer positiven Antwort, während sie etwas verschämt einen weiteren Biss vom Keks nahm
- »Wenn Sie das täten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Beim erfolgreichen Abschluss erhalten Sie selbstverständlich die übliche Provision von mir; hier ist meine Karte« sagte ich und händigte ihr eine meiner Visitenkarten aus, die ich bereits aus der rechten Außentasche meiner Jacke unauffällig geholt hatte.
Wir tauschten Adressen aus und verabredeten uns für den darauf folgenden Samstag, 10. November, in ihrem ebenfalls zweistöckigen Wohnhaus, das direkt neben dem von mir begehrten Haus lag. Dann verpackte ich meine Sachen im Auto und half ihr mit ihrer Reisetasche bis vor ihrem Grundstückseingang, wo wir uns verabschiedeten. Ihr Haus war ein typisches altes Landhaus aus der Gegend mit einem Seitenhaupteingang nach Westen.
Die nette alte Frau hieß Cynthia Chastel und entpuppte sich als eine gut informierte, aber unaufdringliche Nachbarin von hohem Intellekt, die natürlich über fast jedes Gebäude in der Ortschaft etwas zu erzählen wusste. Sie kam mir beim zweiten Treffen sofort aus dem Haus entgegen, als ich die Glocke am Eingang getätigt hatte und erklärte mir die besondere Bewandtnis mit der Glocke
- »Seien Sie mir herzlich willkommen, Herr Favareille. Sie wundern sich sicherlich über die Glocke, sie hat den Vorteil, dass sie mechanisch und ohne elektrischen Strom durch Zug funktioniert und sie ist laut genug, dass ich sie im ganzen Haus höre«
- »Eine durchaus intelligente Lösung« sagte ich in der Überzeugung, dass sie sehr wohl in der Lage war, das Haus gut in Schuss zu halten
- »Bitte folgen Sie mir« sagte sie in einem durchaus freundlichen Ton.
Wir kamen in eine Art Abstellraum mit allen möglichen Utensilien für Haus und Garten, aber auch mit Räum- und Sportgeräten und einer ausgedehnten Garderobe mit einer ebenso großen Schuh- und Stiefelabteilung. Alles in passenden Regalen ordentlich aufgeräumt. Wir überquerten den Raum und kamen durch eine weitere Tür in die gute Stube, einen großen Raum mit Kamin, Sitzecke, Essplatz und Küche. Von der beige gestrichenen Decke hoben sich dunkel gestrichen echte Holzbalken ab. An der Wand hinter dem Essplatz war eine hübsche 4 Meter breite englische Vitrine, die sehr gut mit dem Esstisch und den bequemen Stühlen harmonierte. Die Küche selbst war mit neuesten Geräten ausgestattet, soweit ich sehen konnte, und hatte zusätzlich einen Holzherd, mit dem sie gerne kochte und backte, wie sie mir erzählte. Ich wartete geduldig, bis sie eine intelligente Pause machte und sagte
- »Ich habe mir erlaubt, eine Kleinigkeit aus der Schweiz für Sie mitzubringen« und übergab ihr eine Schachtel Pralinen, auf die sie sich wie ein kleines Kind freute, denn sie liebte Schweizer Pralinen, wie sie sagte
- »Herr Favareille, Sie verwöhnen mich. Woher wissen Sie, dass ich Schweizer Pralinen gerade mag, weil sie nicht zu süß sind« wollte sie wissen
- »Na ja, ich wusste es nicht, ich bin von mir ausgegangen. Diese ist übrigens meine Hausmarke« sagte ich amüsiert über die besitzergreifende Umarmung, mit der sie die Schachtel in Sicherheit hielt.
Erwartungsgemäß führte sie einen ordentlichen Haushalt und überraschte mich mit einer leckeren, gedeckten Apfeltorte, gebacken im besagten Holzofen, und einem mit weichem Wasser zubereiteten Himalaya-Tee. Das Service war schlichtes weißes Porzellan aus Berlin und das Besteck war nicht aus Silber, sondern aus praktischem Cromargan, der bekannten Legierung aus Chrom, Nickel und Stahl der Württembergischen Metallwarenfabrik. Ich war froh, dass ich mich für Schweizer Pralinen anstelle von Blumen als Mitbringsel entschieden hatte.
Wir redeten über die Ortschaft und die Umwelt. So kamen wir zwangsweise zum Thema Kanalisation und der Besonderheit in den ländlichen Gegenden in Frankreich
- »Sie wissen, dass unsere Ortschaft, wie viele kleine Ortschaften in Frankreich, keine Kanalisation hat?« fragte sie als sie mir Tee in meine Tasse einschenkte
- »Nein, das wusste ich nicht, aber ich denke Ihre Ortschaft hat eine passende Lösung gefunden...« antwortete ich während ich meinen Kopf über die Tasse beugte und den köstlichen Geruch des Himalaya-Tees genoss