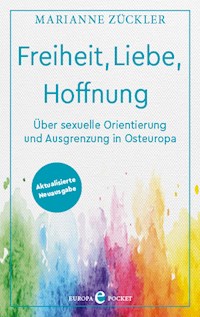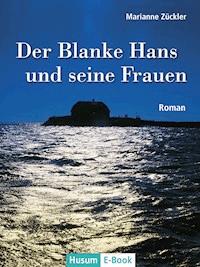
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Die Journalistin Nina bekommt den Auftrag, eine Reportage über Frauenleben auf den Halligen zu machen. Aus ihrem anfänglich geplanten dreitägigen Aufenthalt werden drei Monate. Das magische Eiland und ihre Interviews mit seinen eigenwilligen Halligbewohnern zwingen Nina dazu, aus ihrer üblichen Routine auszusteigen. Der geheimnisvolle, nur schwer zu durchschauende Halligkosmos entwickelt einen Sog, in dem ihr alle lieb gewordenen Selbstgewissheiten entgleiten. Die vielen Lebensgeschichten der Frauen öffnen bei ihr eine lange verschlossene Tür. Die endlose Weite der Natur, nur begrenzt durch den Horizont, lenkt ihre Gedanken in die eigene Vergangenheit und Zukunft. Und dann ist da noch der Blanke Hans, Verkörperung der Sturmflut, mystifizierte unbezwingbare Naturgewalt, die auch für die Leidenschaft steht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ISBN 978-3-89876-792-7 (Vollständige E-Book-Version des 2013 im Husum Verlag erschienenen Originalwerkes mit der ISBN 978-3-89876-762-0) Die Recherche zu diesem Buch wurde durch die Kulturstiftung Schleswig-Holstein gefördert. Lektorat: Dr. Gregor Ohlerich, Obst & Ohlerich, Berlin Umschlaggestaltung unter Verwendung eines Fotos von Günter Pump © 2015 by Husum Druck- und Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG, Husum Gesamtherstellung: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft
Die Geschichte „Der Blanke Hans und seine Frauen“, ihre Handlungsorte und alle auftretenden Personen sind frei erfunden.
Prolog
Im Juli kam meine Redakteurin mit leuchtendem Blick aus dem Urlaub.
„Das ist es.“
Sie legte ein paar Fotos auf den Tisch. Naturaufnahmen. Urlaubsfotos.
Das Übliche: Meer, gigantische Sonnenauf- und -untergänge. Vogelschwärme, grüne Wiesen, dösige Schafe, Gänse mit Plattfüßen.
„Dieser Horizont! Diese Weite! Diese Wolkenschiffe, dieses Licht! Hör mal!“
Aus ihrem Aufnahmegerät kreischten Vogelstimmen.
„Sind das Klänge? Seelenklänge … “
Langsam begann ich mir Sorgen zu machen. Andrea ist nicht nur meine Redakteurin, sondern fast so etwas wie eine Freundin. Wir kennen uns schon ziemlich lange. Entweder hatte sie sich mal wieder unsterblich verliebt, oder –?
„Also, ich habe da oben jemanden kennengelernt.“
Aha, alles klar.
„Er lebt auf einer Hallig mit knapp hundertsechzig Einwohnern und ist der Bürgermeister.“
Der Bürgermeister? – „Darüber will ich etwas haben. Und du bist genau die Richtige.“
Andreas Ton war wieder nüchterne Chefin.
„Ich will etwas haben über die Frauen auf der Hallig.“
Warum nicht, dachte ich, das wird ein kleiner Extraurlaub, die Reportage mache ich mit links.
Drei Monate sollten vergehen, bis ich das Projekt eintakten konnte. An einem schon kühlen Oktobertag erreichte ich in Schlüttsiel in letzter Minute die Fähre. Ich war der einzige Fahrgast. Als ich in der abendlichen Dämmerung das Schiff bestieg, plante ich drei Tage für die Reportage über die Halligfrauen ein, plus ein paar Tage Urlaub.
Ich ahnte nicht, dass ich dabei war, mich auf eine Lebensreise zu begeben.
1. Kapitel
14. Oktober
Mein erster Tag auf der Hallig beginnt mit einem Anruf des Bürgermeisters. Hans B., ein redefreudiger Mensch. Er entschuldigt sich mehrfach dafür, mich gestern Nacht nicht wie versprochen vom Anleger abgeholt zu haben. Ein Rohrbruch. Es gäbe keinen Notdienst, wie in der Stadt. Na klar, denke ich, und es gibt auch keine Taxis, wie in der Stadt.
Als ich gestern Nacht auf dem in tiefster Schwärze liegenden Pier stand und auf ihn wartete, spürte ich Unruhe in mir aufsteigen. Zum Glück schälte sich bald eine bullige Gestalt aus der Dunkelheit, die sich mit einem unverständlichen Gemurmel vorstellte und mich nach einer wortkargen Fahrt an meiner Unterkunft absetzte. Der Schlüssel passte, ich sank ins Bett.
Und ob ich schon wüsste, mit wem ich sprechen wolle? Es sei nicht so leicht, an die Leute heranzukommen. Friesenschädel eben.
Davon hatte ich bereits eine Kostprobe bekommen. Aber Frauen, sagte ich mir, sind in der Regel mitteilungsfreudiger als Männer. Diese Erfahrung stimmte mich optimistisch.
Man duze sich auf der Hallig, erklärt der Bürgermeister, also Hans. Ich stelle mich als Nina vor und rieche, dass meine Bratkartoffeln Farbe annehmen. Das Duzen mache alles einfacher. Und wie unsere Sendung so ankomme? Reichweite und so weiter?
Ich bin jetzt in Eile, wegen der Bratkartoffeln, und verspreche ihm, mich zu melden, wenn ich seine Unterstützung brauche.
Meine Regel Nummer eins bei allen neuen Projekten: erst etwas Ordentliches essen, dabei planen, Stichpunkte machen, To-do-Liste anlegen.
Endlich sitze ich am Tisch, schaue aus dem Fenster in die endlose Wattlandschaft und spieße Bratkartoffeln und Sülze auf. Feinste Halligsülze, bestimmt sündhaft teuer, eben Halligpreise, und sündhaft gut. Draußen kreisen Wattvögel über dem Meer. Ihre Stimmen kommen näher, entfernen sich. Es sieht aus, als trage der Wind sie davon, um sie dann wieder zurück in den feuchten Sand sinken zu lassen. Ich schaue dem Wind bei der Arbeit zu und picke meine Bratkartoffeln. Mir wird ganz wunderlich vor Glück. Die Stille um mich erscheint vollkommen und ich nehme kaum wahr, dass mein Blick sich wie magnetisch angezogen auf den Horizont ausrichtet. Auf den Horizont, der wie eine lange, geduldige Linie am Ende der Welt liegt, sehr fern und ganz nah bei mir.
15. Oktober
Erster Rundgang, den Deich entlang, um die Hallig herum. Kaum Wind. Strahlende Sonne. Dieser Blick bis zum Horizont, einfach fantastisch. Der Deich prima in Schuss. Keine kläffenden Hunde, keine Touristen. Das Wattenmeer endlos. Grandios! Austernfischer und Strandläufer staksen im Watt neben mir her. Über mir die Endlosigkeit des rosa-violetten Himmels. Ich hätte meine Gummistiefel mitnehmen sollen. Aber – für die paar Tage? Wer weiß, ob das Wetter überhaupt stabil bleibt. Lilly könnte es hier gefallen, im Sommer. Muss ja nicht immer Ausland sein. Wir mieten eine Ferienwohnung, lesen, sind am Meer. Finden im Watt alte Tonscherben, Zeugen der ersten Halligbewohner. Den Ort Rungholt, im 14. Jahrhundert untergegangen in einer apokalyptischen Sturmflut des Blanken Hans, soll es tatsächlich gegeben haben. Wir lassen uns einfach treiben und gehen im Watt auf Spurensuche.
Auf der Nachbarwarft lockt das Café „Küstenschwalbe“, ein altes, reetgedecktes Hallighaus. Ich habe Glück, es ist geöffnet. Die Wirtin, Ende dreißig, mit wallendem Haar, eine weiße Schürze um die schmale Taille gebunden, blickt kurz auf, als sie mich sieht. Sie habe eigentlich geschlossen, aber ich könne reinkommen. Sie weist mit einer Kopfbewegung zu einem Tisch, an dem ein einziger Platz eingedeckt ist. Zum Schnacken habe sie keine Zeit, sie müsse die Zimmer für ihre Gäste fertigmachen.
Wusste sie, dass ich komme? Hat sie immer einen Tisch eingedeckt? Hat sie jemand anderes erwartet? Ich sitze verwundert allein in ihrer Stube, umgeben von Fotografien aus der alten Halligwelt. Ein Foto zeigt zwei Frauen in langen, schwarzen Kleidern, die eine klein und schmächtig, die andere groß und knorrig. Sie stehen nebeneinander wie aufgereiht, beide halten Heugabeln in der Hand. Sie scheinen durch die Kamera hindurchzuschauen. Ob sie sich gesträubt haben, sich fotografieren zu lassen? Haben ihre Familien das Foto in Auftrag gegeben? Waren sie verwitwet, unverheiratet? Mägde? Ich hoffe, dass die Wirtin mir etwas über die beiden erzählen kann, und widme mich meinem Himbeerkuchen. Backen kann sie großartig! Ob sie hier geboren ist? Ich werde auf dem Rückweg noch einmal vorbeischauen und sie um ein Gespräch bitten. Bevor ich gehe, zücke ich mein Handy, um ein Foto von den beiden Erntearbeiterinnen zu machen. Ich suche die ganze Wand ab und kann die beiden nicht mehr finden. Meine Augen gleiten von links nach rechts, von oben nach unten – die beiden bleiben verschwunden.
16. Oktober
Heute auf der Schlernwarft: Elf Häuser stehen auf dem künstlich aufgeschütteten Hügel. Alle Warften kommen mir irgendwie grundverschieden vor, obwohl eine der anderen gleicht. Dem muss ich später nachgehen.
Auf der Schlernwarft besuche ich, vermittelt durch das Büro des Bürgermeisters, Greta. Hans B. möchte unbedingt, dass ich mit Greta spreche. Sie ist eine Ureinwohnerin, Anfang achtzig, rüstig und stämmig, mit einem flotten Bob-Haarschnitt. In Jeans und selbst gestricktem Wollpulver steht sie vor ihrem Haus und wartet auf mich.
Zunächst will sie mich nicht hereinlassen. Sie ist schon aufgebracht, bevor ich mich vorgestellt habe. Das ganze Gedöns immer um die Halligmenschen verstehe sie eigentlich nicht. Und jetzt auch noch die Halligfrauen!
Skeptisch hört sie mir zu – und lässt sich dann doch überzeugen, mit mir zu sprechen.
Sie führt mich in ihr kleines Wohnzimmer. Ich darf auf ihrem violettrosa Sofa Platz nehmen, dessen Farbe mich an den Hallighimmel vom Vormittag erinnert. Wie auf einer Wolke sitze ich ihr gegenüber, auf dem Couchtisch zwei Tassen und eine Schale mit Keksen. Auf einer Kommode stehen Bilder von ihren Kindern und Enkelkindern. Das Fenster daneben gibt den Blick frei auf die grünen Fennen vor der Warft und den Hallighafen in der Ferne. „Möchtest du Kaffeesahne oder schwarz?“ In der Tat, man duzt sich. Ich gebe mir einen Ruck und duze zurück. Bei einem so großen Altersunterschied fällt mir das ohne Anlauf schwer.
Mein Mikrofon solle ich wegstecken, das käme nicht in Frage. Irritiert packe ich es wieder weg. Sie beobachtet mich dabei und setzt sich in ihren violettrosa Polstersessel. In unserem Gespräch ist sie der Kapitän, ich bin der Leichtmatrose. Sie hält das Steuer fest in der Hand, und ich halte mich an der Reling fest.
Unter vollen Segeln geht es durch die Jahrzehnte. Ja, sie sei auf der Hallig geboren und habe als Kind den Krieg und die Bomber erlebt. Heute noch würde sie manchmal davon träumen. „Wir konnten uns nirgends verstecken, wenn Tiefflieger kamen, hier ist ja alles platt.“
Und auch nach dem Krieg habe es an allem gefehlt. Früh habe sie mitarbeiten müssen als Kind. Kuhdung klopfen zum Beispiel, damit es für den Winter genug Brennmaterial gab. „In Unterhosen und mit nackten Füßen stampften wir auf dem Kuhdung herum.“
Greta lacht und stampft mit den Füßen auf den Teppichboden. Man sei natürlich auch ausgerutscht und stank nach Kuhschiet! Das sei normal gewesen. „Jeder Bauer hat das hier so gemacht. Und jeder half jedem.“
Sie erzählt von einer Kindheit, die schön war, trotz aller Entbehrungen, trotz bitterer Armut. Die Kinder von heute dagegen – sie verschränkt ihre Arme vor der Brust. Nur Computer spielen und träge im Zimmer herumsitzen. Doch nicht die Kinder seien schuld, sondern die Zeit und ihre schwachen Eltern.
Die alte Halligwelt könne sich heute niemand mehr vorstellen. „Und wen interessiert das noch? Die Politiker? Die jungen Menschen, die hierherkommen und gar nicht wissen, was das ist, ein Leben auf der Hallig?“ Früher habe man, wenn man mit dem Pullover im Zaun hängen blieb, jeden Wollfaden der Mutter nach Hause bringen müssen, sonst habe es was mit dem Stock gegeben. Heute würde man das Nachhaltigkeit nennen. „Auch so ein dämliches Modewort.“
Plötzlich schlägt ihre Stimmung um und sie verschließt sich wie ein Krebs in seinem Schutzpanzer.
Mehr gäbe es nicht über sie zu sagen. Ihre beiden Brüder seien im Krieg gefallen, sie habe als älteste Tochter den Hof übernommen und später mit der Zimmervermietung begonnen. „Meine vier Kinder habe ich nebenbei großgezogen, und aus allen ist etwas geworden“, fügt sie nicht ohne Stolz hinzu. Nein, ihr Mann komme nicht von der Hallig. Und ich könne ruhig schreiben: „Der Krieg hat die Männer kaputt gemacht und ihre Frauen mussten es ein Leben lang richten.“
Nach der Gefangenschaft sei ihr Mann nicht mehr der gewesen, den sie vor dem Krieg auf Föhr kennengelernt habe. Greta schweigt und schaut mich an. Härte und Trauer liegen in ihrem Blick.
Im Krieg ist die Hallig von schwerwiegenden Zerstörungen verschont geblieben. Die großen Sturmfluten mit ihren schrecklichen Verwüstungen seien weitaus schlimmer für die Halligbewohner gewesen. „Ich wollte trotzdem nie auf dem Festland leben.“
Heute lebt ihre ganze Familie drüben. Auf der Hallig gäbe es für die Kinder und Enkel keine Zukunft mehr. „Ich komme gut alleine zurecht. Das bleibt auch so.“ Stolz reckt sie sich auf und schaut aus dem Fenster in die untergehende Sonne. „Und wenn es so weit ist, komme ich als Radieschen auf unserem Friedhof wieder raus.“ Sie habe schon alles mit dem neuen Pastor abgesprochen. Der sei zwar zu weich, gebe sich aber Mühe.
Ich bin entlassen und stehe schon auf, da erwähnt sie, dass sie viele Jahre im Gemeinderat gewesen ist. Als eine der ersten Frauen. Und sie hat dort auch einiges für die Frauen bewirkt. Den ersten Hallig-Kindergarten hat sie durchgeboxt, gegen einigen Widerstand.
Forschend schaut sie mich an. „Jetzt ist Schluss mit Erzählstunde.“
Ihr Mittagessen steht auf dem Herd und sie hat noch viel zu tun.
Mit einem kräftigen Ruck steht Greta auf. Ich streife hastig meine Regenjacke über. Sie wartet bereits an der Eingangstür auf mich, die schwere, abgearbeitete Hand auf der Klinke. Ich bedanke mich für das Gespräch, und sie schenkt mir ein schmales Lächeln aus Vorbehalt und Wärme.
Irritiert stehe ich wieder im Innenhof der Schlernwarft. Die vielen bunten Gartenzwerge erinnern an eine Laubenpieperkolonie. Ratlos taste ich nach dem Mikrofon in meiner Jackentasche. Vor meinem inneren Auge sehe ich sie auf ihrem Wolkensessel sitzen – die Herrscherin der Schlernwarft.
17. Oktober
Am Abend. Erste Begegnung mit dem Nachbarn.
Meine Heizung ist ausgefallen. Niemanden auf der Hallig wundert das. Alle kennen meine Heizung, so scheint es. Mein Nachbar Bernd, Jahrgang 1965, blond, sommersprossig, leichter Bauchansatz, leiht mir seinen alten Heizlüfter. Er kommt im Jogginganzug, hat einen festen Händedruck und ist recht wortkarg. Meine langjährig erprobte und ausgefeilte Fragetechnik perlt an ihm ab. Ich erfahre aber, dass sich seine Exfrau vor vielen Jahren in die Hallig verliebt hat. Er ist dann mitgegangen und – geblieben. Wenn ich noch etwas bräuchte, solle ich mich melden. Bei Sturm gäbe es kaum Internet, ich könne sein WLAN mitnutzen.
Prima. Das ist Nachbarschaft! Ich schalte den Heizlüfter an und richte das Gebläse so aus, dass die warme Luft meine kalten Füße wärmt.
18. Oktober
Das Wetter ist umgeschlagen. Es regnet und stürmt. Windstärke 8. Das Internet funktioniert nicht, jetzt auch kein Telefon mehr.
Zum Glück geht die Heizung wieder.
Ich fühle mich schlapp. Das muss am Wetter liegen. Ich plane, den Tag zu nutzen, indem ich meine Hallig-Lektüre durcharbeite. Charlotte, die rechte Hand des Bürgermeisters, hat mich großzügig damit eingedeckt. Sie ist wirklich sympathisch, auch ihr Mann Ernst. Ein Halligmann wie aus dem Bilderbuch. Landwirt. Ruhige Ausstrahlung, liebenswürdiges Lächeln, er spricht leise und bedacht. Ein Fels in der Brandung. Beide haben mich für heute auf ihren Hof auf der Mooswarft zum Kaffee eingeladen. Aber bei dem Schietwetter? Charlotte kommt ursprünglich aus Hamburg. Sie hat in Berlin studiert, zeitgleich mit mir. Theoretisch hätten wir uns in den 1980er-Jahren kennenlernen können. Anglistik, Germanistik und Ethnologie. Sie hat ihre Universitätslaufbahn abgebrochen für ein Leben als Mutter und Ehefrau auf der Hallig. Und das in der Hochphase der Frauenbewegung. Wären wir uns damals begegnet, hätte ich einen großen Bogen um sie gemacht. Mutterglück! Kleinfamilienglück! Ob sie ihren Schritt bereut hat? Dörfliches Halligflair am Busen der Natur statt Karriere, kulturelle Vielfalt und Großstadtleben?
19. Oktober
Sonntag. Die Halligbewohner schlafen noch. Das Wetter ist wieder umgeschlagen. Wahnsinn! Wo eben noch graue Nebelsuppe schwappte, leuchtet jetzt ein irrer Regenbogen. Windstille, knapp 20 Grad. Kein Mensch ist unterwegs. Ich starte zu meinem großen Deichrundgang. Unvermittelt taucht neben mir eine Robbe aus den Fluten auf. Eine echte Robbe mit tellergroßen dunklen Augen und einem aparten Schnurrbart. Während der zwei Stunden, die ich auf dem Deich unterwegs bin, taucht sie immer wieder auf. Als wollten wir uns gegenseitig davon überzeugen, dass wir noch auf Kurs sind – ich auf der Hallig, sie im Meer.
Meine nächste Gesprächspartnerin hat es sich kurzfristig anders überlegt und abgesagt. Charlotte sagt, sie verstünde es auch nicht, ich müsse eben Geduld haben. Gerade die älteren Halligbewohnerinnen seien es nicht gewohnt, über sich zu reden. Man brauche Zeit, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Die hat Nerven! Erst ein richtiges Interview, sonst nur Vorgespräche, Geplänkel und Ausflüchte.
Eine Woche ist morgen vorbei, geplant hatte ich drei Tage plus Kurzurlaub. Aber der Termin mit Hannelore, einer älteren Gastwirtin, steht. Vorsorglich schalte ich mein Handy ab, dann kann sie mir nicht absagen.
Auf dem Rückweg zu meiner Warft beginnt es zu regnen. Unter dem Vordach eines Duschhäuschens am Deich finde ich in letzter Minute Schutz vor den niederprasselnden Hagelkörnern. Der Himmel zieht sich rabenschwarz zu. Während ich in die sich auftürmenden Wellen und weiß schäumende Gischt blicke, taucht die Robbe wieder auf. Mit ihren tief dunklen, glänzenden Augen sieht sie mich unverwandt an. Ich denke an die Sagen, die ich zur Vorbereitung gelesen habe. In Robben hat man auch die Inkarnation von den Frauen gesehen, die der Hexenverfolgung zum Opfer gefallen sind. Hexen, so erzählen es die Sagen, haben ihr Unwesen im Meer getrieben und waren verantwortlich für schwere Unwetter. In Seehunde verwandelt, foppten sie Fischer und Schiffer. Bevor sie ihre Schiffe untergehen ließen, tauchten die Tiere ein letztes Mal vor ihnen auf und gaben sich als Hexen zu erkennen.
Argwöhnisch lasse ich meinen Blick übers Wasser schweifen. Die Robbe ist verschwunden. Taucht sie gleich wieder neben mir auf? Kündigt sie meinen Schiffbruch an, bei dem Versuch, das Leben der Halligfrauen in ein Radiofeature zu gießen? Oder will sie mich an alle meine Schiffbrüche erinnern, die ich erlitten habe, vergessen möchte? Die ich versenkt habe, ganz tief, auf dem Meeresboden.
HANNELORE
„Als Kind habe ich mir geschworen, vor nichts Angst zu haben.
Ich bin mit den Sturmfluten groß geworden und sie haben mich auch stark gemacht.“
Auf der Auenwarft
16 Uhr. Hannelore erwartet mich. Sie begrüßt mich zurückhaltend mit einem knappen, freundlichen „Moin“ und führt mich in eine behagliche kleine Gaststube, in der die Familienfeiern stattfinden. Kurz bleibt sie am Fenster stehen und begutachtet kritisch die Regenwolken am Himmel.
In der Ecke steht ein gusseiserner schwarzer Ofen, daneben ein alter Schaukelstuhl. Die Wände sind mit Delfter Keramikfliesen verkleidet, darauf die klassischen blau-weißen Mühlen-, Schiff- und Leuchtturmmotive. Daneben hängen Schwarzweißfotografien an den Wänden. Sie zeigen die alte Halligwelt und ihre Menschen. In der Mitte des Raumes steht ein langer aufgearbeiteter Bauerntisch mit zwölf friesischen Bauernstühlen. Auf dem Tisch zwei blaue Teebecher, eine Thermoskanne und ein in Leder gebundenes Fotoalbum.
Hannelore schenkt uns friesischen Tee ein, den ich nicht mag, aus Höflichkeit aber nicht ablehne. Sie setzt sich mir gegenüber und beginnt ruhig zu sprechen.
Ich bin 1943 bei Fliegeralarm auf der Wolkensteinwarft geboren. Die Hebamme konnte nicht kommen, sie lebte auf der Farneswarft, also musste es so gehen. Später hat meine Mutter mir erzählt, wie sie unter dem Dröhnen der Bomber bei meiner Geburt geschrien hat. Aber alles ist gut ausgegangen.
Hannelore sieht mit ihren einundsiebzig Jahren sehr attraktiv aus. Eine grazile Frau mit straffem Körper, aufrechter Haltung, funkelndem Blick.
Eigentlich sollte ich Rosa heißen, aber weil das ein jüdischer Name ist, riet der Bürgermeister meinem Vater davon ab. Meine Eltern haben lange über meinen Namen gestritten. Jeder wollte, dass der Name der eigenen Mutter vorne ansteht. Vater hat sich schließlich durchgesetzt.
Hannelore schlägt das lederne Fotoalbum auf. Während sie umblättert, beobachte ich ihre ruhigen Bewegungen. Beim Betrachten eines Bildes hält sie inne.
Das sind meine Eltern, meine drei Brüder und das bin ich! Nach meiner Taufe.
Unter der kleinen Schwarzweißfotografie steht: „Hannelores Taufe, Juni 1943“. Vor der kleinen Halligkirche steht die sechsköpfige Familie, aufgereiht wie eine Perlenschnur. Die Mutter, schwarz gekleidet, hält das Kind auf den Armen, ihr Blick ist ernst. Daneben stehen der stolze Vater im dunklen Anzug und die drei Brüder Werner, Jaspar und Sönke. Unwirsch schauen sie den Betrachter an. Der Mittlere, Jaspar, scheint sich zu genieren. Wegen der zu kurzen Ärmel und Hosenbeine?
Das schwarze Kleid trug meine Mutter noch Jahre später bei feierlichen Anlässen. Sie war eine starke Frau und hat viel durchgestanden. Das waren sie alle hier, stark. Hier muss man stark sein.
Meine Eltern hatten einen kleinen Hof mit Schafen, Rindern und Schweinen. Damals waren die Halligleute noch autark. Wir mussten schon sehr früh bei der Arbeit mithelfen. Vor der Schule haben wir die Kühe gemolken, Wasser aus dem Fething geholt oder aus den Zisternen gepumpt. Nach der Schule ging es dann weiter: Schafe vom Deich holen, auch bei Sturm und Kälte. Das waren alles weite Wege und im Winter sind dir Hände und Füße abgefroren. Zu Hause hieß es dann: „Help jern Modder!“ Ja, Mutter trug – wie die meisten alten Halligfrauen – die Hauptlast für unsere Familie. Es ist immer das Los der Halligfrauen gewesen. Die Männer fuhren zur See und die Frauen hielten monatelang die Stellung auf der Hallig. Urgroßvater und Großvater waren noch Seemänner und Handelskapitäne, sie waren wirklich auf den Weltmeeren unterwegs. Frauen, wie meiner Urgroßmutter und Großmutter, blieb gar keine Wahl, sie mussten allein auf der Hallig klarkommen. Sie hatten die Kinder und Alten zu versorgen und mussten die schwere landwirtschaftliche Arbeit bewältigen. Und es war selbstverständlich, dass sie sich um diejenigen Halligbewohner kümmerten, die niemanden mehr hatten. Es war ein Geben und Nehmen in der alten Halligwelt.
Sind deine Eltern alteingesessene Halligleute gewesen?
Mein Vater schon. Mutter kommt von Langeneß. Mit vierzehn kam sie mit ihren Eltern hierher, zu einem alten Mann auf der Kesselwarft. Er hatte nach einer Familie gesucht, die seine Tiere, sein Land und ihn betreute. Für ein Halligmädchen gab es keine Möglichkeit, etwas Richtiges zu lernen, und so half sie überall auf der Warft mit. Ihre Mutter starb ganz plötzlich, da war sie kaum sechzehn! Das einzige Kleid, das sie besaß, färbte sie schwarz, um an der Trauerfeier teilnehmen zu können. Wer kann sich heute noch vorstellen, in was für ärmlichen Verhältnissen die Menschen hier lebten?
Hannelores fragender Blick. Trotz meiner ausgiebigen Lektüre fällt es mir tatsächlich schwer, das Ausmaß der Armut in dieser unerbittlichen Natur zu begreifen. Die ungeheuere Härte, die ich auf den Fotos in den Gesichtern der alten Halligleute lese, lässt mich instinktiv auf Abstand gehen.
Nach dem Tod ihrer Mutter musste meine Mutter für ihren Vater und den alten Mann sorgen. Von den älteren Halligfrauen lernte sie alles, was man können musste, um hier zu leben. Mit siebzehn hat sie sich in meinen Vater verguckt. Das war Liebe, aber leicht hatte sie es nicht. Meine Großmutter, also ihre Schwiegermutter, war eine echte Friesin. Ich trage zwar ihren Namen, aber mehr auch nicht. Sie hat meine Mutter nie akzeptiert. Sie hat zu ihr gesagt: „Du bist nix. Du hest nichts un du bist nich vun hier!“
Mit kurzen Schlägen auf die Tischkante unterstreicht Hannelore ihre Worte.
„Du bist de Häuslerdochter!“ So waren die Menschen hier eingestellt. Weißt du, was das ist, eine Häuslerstochter? Das waren Arbeiter, die keinen Besitz hatten. Mein Großvater ging über die Hallig und machte alle Arbeiten, die sonst keiner machen wollte. Wer hier Besitz hatte, der holte sich jemanden für die schwere Arbeit von den anderen Halligen.
Mein Blick fällt auf eine Fotografie, sie zeigt Hannelores Großmutter in schwarzer Halligtracht, mit Gehstock. Aufrecht und stolz schaut sie in die Kamera. Man sieht, dass sie eine schöne Frau gewesen sein muss. Neben ihr steht Hannelores Mutter, hochschwanger, in Arbeitskleidung, mit festem Blick.
Meine Eltern setzten sich mit ihrer Liebe durch. Als meine Mutter in das Haus meines Vaters kam, lag meine Großmutter mit schwerer Thrombose im Bett und mein Onkel mit offener TBC im nächsten Lukenbett. Er hatte so einen Spucknapf, damit spielte mein dreijähriger Bruder. Er muss einen Schutzengel gehabt haben, dass er nicht auch krank wurde. Meine Mutter versorgte die beiden Kranken und meinen Bruder. Und dann kam ja noch die tägliche, schwere Arbeit auf dem Hof dazu.
Hannelore schaut mich bewegt an. In ihren Augen steht geschrieben, wie hart es für die Tochter eines armen Häuslers gewesen sein muss, mit einer herrischen, hilfsbedürftigen Schwiegermutter unter einem Dach zu leben.
Das schwere Halligleben machte die Menschen nicht nur stark und zäh, sondern auch unnachgiebig und hart. Hart gegen sich und andere. Mit welcher Selbsthärte muss die junge Frau die Angst gebändigt haben, dass sich ihr Kind an der Tuberkulose anstecken könnte?
Mein Vater verlor bei der Arbeit einen Arm. Es blieb nur noch ein bisschen Gelenk übrig. Ich kenne ihn nur ohne Arm. Abends waren die Männer zu meiner Mutter gekommen und sagten: „Din Mann sin Büx steiht vull vun Bloot.“ Mutter wusste von nichts! Sie hatte die Kühe versorgt, die todkrank mit Maul- und Klauenseuche auf der Weide lagen.
Es dauerte über ein Jahr, bis mein Vater einigermaßen wiederhergestellt war und mitarbeiten konnte. Meine Mutter hat auch diese Zeit durchgestanden und dafür gesorgt, dass unser Leben weiterging. Wie sie das alles ausgehalten und geschafft hat, weiß ich nicht.
Deine Mutter hat dich sehr beeindruckt?
Sie war eine sehr gradlinige Frau. Sie war stark, aber auch ängstlich.
Mit verschränkten Armen schaut mich Hannelore ruhig an.
Wenn du heute an sie denkst, was ist dir besonders in Erinnerung?
Ihre Stimme. Sie hat oft bei der Arbeit gesungen. Ich höre heute noch manchmal ihre helle, warme Stimme.
Und dein Vater?
Mein Vater war hart. Vielleicht hatte er einen weichen Kern, aber den zeigte er selten. Er war aufbrausend, doch wenn er sich umdrehte, war er wieder normal. Er hing sehr an meiner Mutter. Der Verlust eines Arms war für einen Mann aus seiner Generation schlimm. Ich glaube, er hat sich dafür geschämt. Er fühlte sich als Nichtsnutz.
Ich habe das nie so empfunden. Ich habe ihn dafür bewundert, was er trotzdem alles machen konnte. Oft hing ich an seinem Hakenarm und war stolz, wenn er mich zu sich hochzog oder durch die Gegend trug. Er konnte unglaublich viel damit machen. Und was er nicht konnte, das machte meine Mutter für ihn.
Gedankenverloren blättert Hannelore in ihrem Album weiter und hält auf einer Seite inne. Ähnlich wie Hannelores Mutter tat auch meine Mutter vieles, um meinem Vater den Alltag erträglich zu machen. Mein Vater hatte als junger Mann im Krieg ein Bein verloren. Die körperliche Behinderung stand neben der seelischen Kriegswunde.
Oft war er launisch, jähzornig, verlor die Kontrolle. Nachts wachte er schweißgebadet auf und schrie.
(Bewegt) Da schau! Das ist mein Vater, wie er leibte und lebte. Er liebte seine Pferde über alles. Hier siehst du ihn auch mit seinem Hakenarm.
Hannelore zeigt auf eine Schwarzweißfotografie. Aufmerksam schaue ich mir ihren Vater an. Er ist Mitte vierzig, groß, stämmig, mit breiten Schultern. Er steht zwischen zwei kräftigen Arbeitspferden und hält sie am Zaumzeug fest. Ein echter, stolzer Halligfriese? Ein Heros? Er lächelt, sein Blick ist nicht siegesgewiss.
Und das bin ich. Da war ich acht, meine Mutter Anfang vierzig.
Ein zierliches blondes Mädchen schaut mich keck an, auf dem Kopf eine kleine Haartolle. Lebendigkeit und Widerspruchsgeist liegen in Hannelores Blick, als wollte sie sagen: „Ich habe vor nichts und niemandem Angst.“ Neben ihr steht in einer Kittelschürze ihre Mutter. Sie hält Abstand zu ihrer kleinen Tochter. Ihre Haltung ist gebeugt, sie wirkt abgekämpft. In ihrem Gesicht liegt Strenge.
Meine Mutter war damals oft im Krankenhaus auf dem Festland. Ihr ganzer Bauch war voller Narben und Schnitte, da war kein Zentimeter mehr frei.
Vor der geschlossenen Tür zur Gaststube jammert Hannelores Kater. Sie lässt ihn rein und spricht mit ihm.
Wir wuchsen als Kinder wie Halligkraut auf. Für mich waren alle Halligbewohner meine Familie.
Hannelore vergewissert sich mit einem Blick, ob ich ihrem Themenwechsel folge.
Wir hatten einen tollen Lehrer. Er konnte gut mit Kindern umgehen und das Lernen machte bei ihm Spaß. Wir waren damals vierzig Kinder, alle unterschiedlichen Alters, keine leichte Truppe. Er hat uns im Unterricht oft stundenlang Geschichten erzählt. Und wenn er mit den Größeren Kopfrechnen machte, mussten wir Kleinen mitrechnen. Im Winter, wenn mit Petroleum gespart werden musste, saßen wir alle um den Bollerofen und er sang mit uns oder spielte auf seinem Akkordeon. Zu Hause ließ er uns hinterher einen Aufsatz darüber schreiben. Er war streng, trotzdem fühlte man sich bei ihm aufgehoben. Ich habe viel bei ihm gelernt.
Hannelores Gesichtszüge sind plötzlich jung, ihre Worte sprudeln.
Sobald im Winter die Priele zugefroren waren, liefen wir Schlittschuh, bis es dunkel wurde. Das Eis knackte unter unseren Füßen, aber wir hatten keine Angst. Wir waren zusammen und hatten unseren Spaß. Und wenn wir abends spät nach Hause kamen, waren Hände und Füße wie abgestorben und man hätte schreien können vor Schmerzen. Aber wir haben nichts gesagt, sonst hieß es: „Bliev bi’t Huus, hier gifft dat genoch to doon.“
Wehmut liegt in Hannelores Blick.
Meine Kindheit war wirklich ein Abenteuer. Die Sturmfluten waren für mich geheimnisvoll. Ich kann mich noch gut an eine der großen Sturmfluten in den 1950er-Jahren erinnern. Ich war etwa neun und stand in unserer Stalltür. Der Wind heulte und unser Reetdach ging hoch und runter. Ich stand da wie angewurzelt und die Wellen kamen die Warft hochgekrochen, sie wurden höher und höher. Es war grausam.
Hannelore schaut mich ernst an.
Meine Mutter weinte, auch weil meine Brüder noch mit dem Postschiff auf dem Weg zu uns waren. Vater sagte: „Brüllen ännert ok nix!“ Als die Wellen dann in unser Haus kamen und meine Mutter aus Angst schrie, habe ich mir geschworen: Ich will nicht so ängstlich werden wie sie. Ich will stark sein und niemals Angst haben.
Unsere Blicke treffen sich, wir erkennen uns. Auch ich schwor als Kind, nie so ängstlich zu werden wie meine Mutter. Wenn sie unter den jähzornigen Wutausbrüchen meines Vaters weinend flehte, er möge ihr verzeihen, und sie ihn mit „Vati“ ansprach. Er brüllte sie grundlos nieder.
Ich höre heute manchmal noch diesen Wind, der nicht aufhört zu heulen, und sehe den gewaltigen Strudel des Wassers. Diese Bilder vergisst du nicht. Aber Angst hatte ich nie. Als Kind dreht man sich viele Dinge zum Guten. Eine andere Sturmflut kam nachts und früher als erwartet. Meine Eltern und Brüder versuchten noch, ein paar Sachen in Sicherheit zu bringen und auch die Tiere. Später sind sie doch im Wasser umgekommen. Mein Vater hatte mich aus dem Schlaf gerissen und auf den Dachboden getragen. Er hatte mir eingeschärft, seine Aktentasche mit den wichtigen Papieren und Urkunden ganz dicht an meinem Körper zu halten. Als wir dann mit unseren paar Habseligkeiten auf dem Dachboden saßen, in Decken gehüllt, war es mucksmäuschenstill. Selbst meine großen Brüder sagten keinen Pieps. Du hättest eine Stecknadel fallen hören. Alle waren bange, ob unser Haus dem Sturm standhalten und die Tiere überleben würden. Nur ich hatte keine Angst und fing an zu singen: „Wedele, wedele, hinterm Städele hält der Bettelmann Hochzeit.“ Meine Mutter hatte mir das Lied beigebracht. Plötzlich sangen alle mit. Auch mein Vater, der nicht gerne sang.
Ein Lächeln huscht über Hannelores Gesicht.
Das meine ich, wenn ich sage, als Kind versucht man Dinge und Situationen so zu drehen, dass man sie besser aushält. Ich bin mit den Sturmfluten aufgewachsen und es hat mich auch stark gemacht.
Mit welchen Wertvorstellungen bist du aufgewachsen? Gab es so etwas wie eine Halligmoral?
Meine Eltern haben sehr darauf geachtet, dass wir immer zur Kirche gingen. Still sein, ordentlich sein und ehrlich sein. Sie legten Wert darauf, dass wir unsere täglichen Pflichten gewissenhaft erledigten. Und es war ihnen wichtig, dass wir lernten: „Man snackt nich öwer annern.“ Auf der Hallig passiert alles noch viel enger beieinander als auf dem Festland. Durch ein falsches Wort kann man in Teufels Küche geraten.
Kritisch schaut sie mich an, als würde sie überlegen, ob sie mich noch weiter ins Innere des Halligkosmos führen könne.
Meine Eltern waren zwar streng, aber sie ließen mir trotzdem in der Pubertät meine Freiheit. Auf der Schlernwarft war schon damals das Jugendlager. Zu jeder Jahreszeit kamen große Gruppen vom Festland und es waren auch viele Jungs in meinem Alter dabei. Im Sommer gingen wir mit ihnen baden. Meine Mutter hat nur einmal gefragt: „Wie kannst du di unnerstahn un di vör de Jungs in Baadebüx wiesen? Dat heff ik nie nich maakt!“ (Anerkennend) Aber sie hat es mir nie verboten.
Auf der Farneswarft gab es jedes Wochenende Tanz. Das ging bis morgens. Es waren unglaublich tolle Feste! Meine Eltern vertrauten mir, und ihr Vertrauen wollte ich nicht enttäuschen.
Verklärt Hannelore die Vergangenheit, damit sie aushaltbar wird und die alte Halligwelt nicht untergeht?
Bei meinen Brüdern war klar, sie mussten einen Beruf erlernen. Bei den Mädchen hieß es, sie können heiraten und sich anders durchs Leben schlagen. Nach der achten Klasse war für mich Schluss. So war die Einstellung damals hier. Ich wäre gerne auf dem Festland weiter zur Schule gegangen. Aber es war kein Geld da, jeder Groschen wurde umgedreht.
Keine Anklage und kein Hadern. Gleichmut liegt in Hannelores Stimme. Es ist ein Schicksal, das sie mit vielen Frauen in den 1950er-Jahren teilte.
Unsere Mutter wäre gerne Lehrerin geworden, aber ein Studium war nur für den Bruder vorgesehen. Für sie war kein Geld da.
Ich wollte das Leben auf dem Festland kennenlernen und etwas erleben! Und ich hatte Glück. 1961 war eine ältere Dame bei uns zu Besuch, als Pensionsgast. Jedes Jahr kam sie im Sommer und wohnte im Schlafzimmer meiner Eltern. Sie wusste, dass ich von der Hallig wegwollte, und hat meine Eltern so lange bearbeitet, bis sie zustimmten und ich mit ihr nach Wuppertal durfte. Ich wohnte bei ihr und schlief in ihrem Wohnzimmer auf dem Sofa. Sie half mir in der ersten Zeit sehr, mich in der Stadt zurechtzufinden. Ich war vorher nicht oft auf dem Festland gewesen und kannte das Leben dort nicht! In einem Café fand ich schnell eine Arbeit und stand hinter dem Kuchentresen. Die Arbeit machte mir Spaß. Aber mein Traumberuf war, Sekretärin zu werden. Schon als Kind wollte ich in einem schönen Büro arbeiten, Schreibmaschine schreiben und Steno lernen. Das stellte ich mir toll vor. Also suchte ich nach Möglichkeiten. In einem kleinen Verlag fand ich dann eine Arbeit. (Lebhaft) Ich stellte mich wohl nicht ganz dusselig an, mein Chef bot mir an, einen Steno- und Schreibmaschinenkurs zu belegen. Auf einmal lag mein Traum in greifbarer Nähe, ich brauchte nur zuzugreifen.
Hannelore schaut mich gleichmütig an. Ich stelle mir die junge Frau vor, die genug Mut besitzt, in die Fremde zu gehen, um ihren Traum wahrzumachen.
Das war im Winter 1962, kurz vor der großen Sturmflut. Damals wohnte ich bei einer Zimmerwirtin auf dem Dachboden, in einer kleinen Kammer mit Pappwänden. Ich war fürchterlich erkältet, und sie schickte mich zum Arzt. Nachdem er mich untersucht hatte, schaute er mich mit großen Augen an.
„Sie kommen von der Hallig? Haben Sie schon etwas von Ihrer Familie gehört?“ (Bewegt) Ich wusste überhaupt nicht, wovon er sprach. „Die Leute sitzen auf ihren Dächern und auf Sylt sausen die Häuser ins Meer. Das ist die größte Sturmflut aller Zeiten!“
Er hatte noch nicht ausgesprochen, da war ich schon raus! Ich rannte nach Hause zu meiner Zimmerwirtin. Wir saßen in ihrem Wohnzimmer vor dem Fernseher und ich sah, wie dieses riesige Hotel auf Sylt ins Meer stürzte. Mir war klar, wenn es so aussah, war bei uns auf der Hallig alles verloren. Ich wusste, ich muss zurück.
Hannelore schweigt und schaut aus dem Fenster. Gleißendes Licht fällt in ihre Gaststube. Was mag damals in ihr vorgegangen sein? Ich sehe Hannelore vor mir, wie sie auf dem Sofa sitzt, vor dem Fernseher, und alles nur halb mitbekommt. – Hannelore räuspert sich. Mit ruhiger Stimme fährt sie fort.
Im Verlag waren alle sehr verständnisvoll und hilfsbereit. Mein Chef sagte: „Wir kündigen dein Zimmer und organisieren deine Reise, damit du schnell nach Hause kommst. Du schaust, was los ist, und hilfst beim Wiederaufbau. Wenn du dann immer noch möchtest, kannst du im Herbst wieder bei uns anfangen.“ Ich weiß nicht mehr, wie ich zum Bahnhof gekommen bin. Die Züge waren überfüllt und ich hatte nur einen Gedanken: „Hast du noch eine Familie oder hast du keine mehr?“ In Hamburg blieb der Zug stehen. Stundenlang. Dort stand auch alles unter Wasser. Dieses ungewisse Warten war furchtbar. Nach Stunden fuhren wir endlich weiter. In den Bäumen hingen Gardinen, zerbrochene Möbel und was der Sturm sonst noch mit sich gerissen hatte.