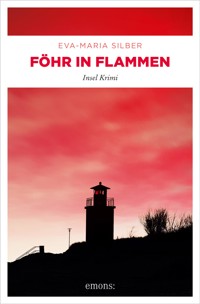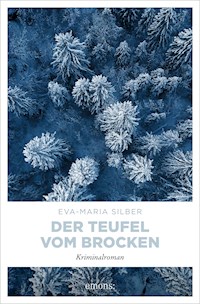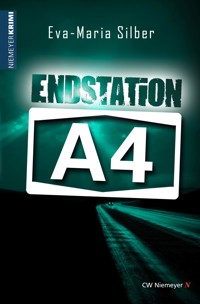3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: between pages by Piper
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
GÜNSTIGER EINFÜHRUNGSPREIS. NUR FÜR KURZE ZEIT! Historischer Kriminalroman um einen wahren Fall Zwei Juristen, eine Journalistin und ein Sergeant im Wettlauf gegen die Zeit. Perfekt für alle True-Crime-Fans »Das Urteil ist rechtmäßig zustande gekommen, aber es spricht nur Recht, nicht die Wahrheit.« Köln 1847: In einem abgebrannten Gutshof werden neun Tote gefunden. Alle wurden vor dem Brand erschlagen. Schnell wird die vom Gutsherrn wegen angeblichem Diebstahl rausgeworfene Dienstmagd verdächtigt und angeklagt. Hat sie aus Rache gemeinsam mit ihrem Verlobten die Morde begangen? Im Indizienprozess versuchen Anwalt Dr. Venedey, sein Referendar Bas und die von ihm umschwärmte Redakteurin Mathilde von Tabouillot sie vor dem Todesurteil zu retten. Kann das Quartett rechtzeitig den wahren Mörder entlarven?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Der Blutmensch zu Köln« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Redaktion: Ulla Mothes
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: SZ Photo/Scherl/Bridgeman Images; ullstein bild – United Archives und FinePic®, München
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Grabinschrift
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Vermischte Nachrichten
Kapitel 5
Vermischte Nachrichten
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Vermischte Nachrichten
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Vermischte Nachrichten
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Sonderbeilage
Epilog
Nachwort
Literaturhinweise
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Grabinschrift
†
Es schickt der Tod nicht immer Boten,
Unangemeldet tritt er ein
Und fordert dich in’s Reich der Todten,
D’rum werd’ noch heut in Jesu rein,
Denn an des Lebens kurzer Zeit,
Hängt deiner Seele Seligkeit.
Grabinschrift
Prolog
Der in Phosphor getränkte Kopf eines Streichholzes traf auf die Reibefläche der Zündholzschachtel und explodierte.
Wie ein Kleinkind, das sich aus eigener Kraft auf die Füßchen stellt, seufzend in sich zusammensinkt, wieder aufrichtet, schnauft und dann unbemerkt einen Fuß vor den anderen setzt, hinfällt und sich abermals hochstemmt, bewegte sich das Feuer erst unsicher, bald darauf angespornt durch Luft und Brennspiritus immer kühner vorwärts. Es folgte erst der verschütteten Flüssigkeit. Dann bildete es Ketten aus flammenden Zipfelmützen von klimperklein bis lärchenzapfengroß. Rot, gelb, orange mit durchscheinendem Blau flackerte es, begleitet erst von einem leisen, gleichmäßigen Rauschen. Wie eine Armee, die bezecht in einer Reihe paradierte, marschierten die Flammen auf die Strohballen in der Scheune zu. Sie begannen zu glimmen und zu brennen. Unter Pfeifen und Jauchzen, so als würden die Mützen in die Luft geworfen, reckten sich die Flammen immer höher empor.
Im Wohnhaus explodierte der zweite Streichholzkopf. Auch das kleine, neue Flammenkind tolpatschte herum, fand jedoch nicht minder schnell Halt und sandte wieder die vorwitzigen Zipfelmützen aus, die begierig den Spiritus aufsaugten. Vor den Kammern setzte das Feuer die Hauben ab und schlüpfte durch den Türschlitz, ließ sich vom Brennspiritus in den Raum ziehen, sprang auf den schlichten Bettvorleger, loderte fröhlich auf, erreichte das herunterhängende Federbett, schmiegte sich an, schmatzte nun vor Vergnügen, und verzehrte es lichterloh. Ein Plumeau aus Licht hüllte den Körper ein, der unter ihm lag. Das Rauschen schwoll an, während die Kleidung Feuer fing und die Haut unter sich schmelzen ließ.
Die Flammen richteten sich mannshoch auf, verschlangen Vorhänge, sengten das Holz der Möbel an, brachen es auf. Es knarzte. Gellend platzten die Fensterscheiben. Wie Zunder wirkte die frische Luft. Im ganzen Haus tollte das Feuer herum, lief durch die Flure, trat Türen ein, brüllte orgiastisch, zermalmte Dachsparren, bäumte sich haushoch auf, ließ Funken regnen, die sich nun auch den Schuppen zum Tanzboden auserkoren, bis er unter der feurigen Last zusammenbrach.
Das Feuer ließ nur Rauch, verkohlte Reste und Asche hinter sich zurück. Von ihm selbst würde nichts bleiben, nachdem das letzte Glutnest ausgetreten wäre. Es wird sein, wie wenn es das erste und das zweite kleine Kind, die sich aufrafften und Laufen lernten, nie gegeben hätte.
Nur die kleinen zarten Hände, die beide Streichhölzer entzündet hatten, waren noch da.
Kapitel 1
Es war die Nacht vom 24. auf den 25. August 1847, als auf dem Gut des Jakobus Selm der Feuerruf erscholl.
Mathilde von Tabouillot, die gerade fürs Zubettgehen gekleidet worden war, entdeckte den Feuerschein bei ihrem letzten Blick aus dem Fenster. Zugleich kündigten Wetterleuchten und Donnergrollen ein Gewitter an. Eine riesige Rauchwolke stand über dem Gereonsviertel unweit von der Festungsmauer und breitete sich wegen der Windstille dieses ungewöhnlich warmen Tages nur langsam aus.
Das war ihre Chance. Sofort schlüpfte sie in die gerade erst abgelegte Kleidung, was ihr ohne ihre Zofe schwerfiel angesichts all der unnützen Zierbänder im Rücken. Auf das sonst obligatorische Korsett, das sie allein nicht zugezogen bekam, verzichtete sie. Wenn ihre Mutter das sehen würde, bekäme sie einen ihrer perfekt inszenierten Ohnmachtsanfälle. Diese Gefahr bestand jetzt nicht, sie hatte sich bereits vor Stunden mit Migräne in ihr Schlafzimmer zurückgezogen.
Ihre sonst zu Affenschaukeln gebundenen Zöpfe fasste Mathilde zu einem Dutt auf dem Kopf zusammen. Das musste reichen. Zu guter Letzt schnappte sie sich noch einen Block und ihren guten Bleistift von A. W. Faber, den einzigen Luxus, den sie sich seit der Trennung von ihrem Ehegatten, der diese Bezeichnung nicht verdiente, geleistet hatte. Dann rannte sie die Treppe ihres Elternhauses hinab auf die Straße. Gerade erhellten die ersten Blitze den Himmel über ihr.
Schon von Weitem hörte sie die Rufe der aus allen Himmelsrichtungen herbeigeeilten Nachbarn, die mit ihren Holz- und Ledereimern Wasser aus dem Brunnen heranschafften und am Ende einer Menschenkette in die Flammen schütteten. Kaum angekommen, erkannte Mathilde, dass es zu spät war für den Schöttelshof. Die Scheune, sie stand in lichten Flammen, deren Schein sich in den dichten Rauchwolken widerspiegelte. Tonziegel barsten mit lautem Knall, das Stroh knisterte rot glühend, das Holz knackte beängstigend, bevor es brach. Sie hörte die fast menschlich klingenden Schreie der Pferde, die die Helfer aus dem Stall herauszuholen versucht hatten. Doch waren sie in ihrer Panik einfach zurückgelaufen in ihren Unterstand, als sich zu dem angsterfüllten Lärm der Helfer Donner gesellte, dessen Blitz nur Sekunden zuvor das ganze Anwesen in gleißendes Licht getaucht hatte. Die Nachbarn rannten mit ihren Eimern vom Hof. Nur Augenblicke später setzte eine Sintflut ein, von der Mathilde hoffte, dass sie das Feuer eindämmen würde. Sie selbst brachte sich unter dem Vordach eines etwas abseitsstehenden Verschlages in Sicherheit. Ihre und sicherlich auch aller anderen Anwesenden Hoffnung, dass damit das Schlimmste vorüber sei, wurde zunichte, als der Regen nach nur einem kurzen Schauer nachließ und schließlich gänzlich versiegte.
Eine halbe Stunde später stand von der Scheune nur noch eine Ruine, aus der einzelne Flammen loderten, während die kurz nach ihr eingetroffene Kompanie Pompiers sich mit ihren Feuerspritzen abmühte, das Wohnhaus zu retten. Wenigstens stand das Gemäuer noch. Schwarzer Rauch quoll aus geborstenen Fenstern. Hinter zwei noch intakten war Feuerschein zu sehen. Die Luft war so verrußt, dass Mathilde husten musste, fast glaubte zu ersticken. Dazu kam der Gestank nach verbranntem Fleisch, der übelkeitserregend in der Luft lag. Das vor ihren Mund gepresste Taschentuch half da wenig. Galle schoss Mathilde die Speiseröhre hoch. Doch sie würgte sie wieder herunter und konzentrierte sich auf den Bericht, den sie über das Feuer zu verfassen gedachte, bevor einer ihrer Kollegen aus der Redaktion ihr zuvorkam. Endlich konnte sie ihrem Hauptschriftleiter beweisen, wozu sie allein und als Frau imstande war.
Mathilde trat unter dem Vordach hervor und sah sich um. Irgendwo in der Nähe wieherte ein Pferd panisch, ein Hund hörte nicht auf, wie rasend zu kläffen. Im Garten stand ein unversehrtes Bett, auf dem einige Kleidungsstücke lagen, ein paar Stühle lagen auf dem Blumenbeet verstreut. Sie machte sich weitere Notizen.
»Was ist geschehen?«, fragte sie einen vorbeieilenden jungen Feuerwehrmann in blauem Leibröckchen mit schwarzem Samtkragen, hellen Hosen und schwarzen Helm, der seinen Nacken schützte.
»Alles verbrennt«, würgte der mit heiserer Stimme hervor.
»Wer wohnt hier?« Mathilde hatte nicht vor, ihn so schnell davonkommen zu lassen.
Der Mann betrachtete sie von oben bis unten, etwas, was Mathilde ihm unter normalen Umständen niemals hätte durchgehen lassen. Stattdessen zückte sie aus ihrem Portemonnaie einige Silbergroschen, die sie ihm unter die Nase hielt. Empört trat er einen Schritt zurück und hob die Hand wie zur Abwehr, nicht ohne einen wehmütigen Blick auf die Münzen zu werfen.
»Die Eheleute Selm mit ihren fünf Söhnen, Tochter, zwei Knechten und einer Magd.«
»Konnte sich jemand retten?«
Der Pompier zuckte die Schultern. »Ein Sohn hat überlebt, hat sich zum Nachbarn geflüchtet.«
»Ist das Feuer durch Blitzeinschlag entfacht worden?«
»Es brannte schon vorher, sagen die Nachbarn. Mehr weiß ich nicht.« Und schon war er weg.
In diesem Moment schleppten zwei Feuerwehrmänner eine Leiche aus dem Hauptportal. Mathilde trat so dicht heran, dass sie die Gestalt einer jungen Frau erkennen konnte, deren Gesicht wegen des Rußes und der Brandwunden kaum zu erkennen war. Ihr wurde schlecht.
Von der Seite näherte sich ein junges Mädchen, beugte sich über die Tote und sackte zusammen, immer wieder »Fräulein Josefine« schreiend. Dann begann sie heftig zu zittern.
Der Sous-Chef brüllte nur »Verschwinde«, drängte sie beiseite und rannte in den Hauseingang.
Mathilde tat das fremde Mädchen leid, das von heftigen Weinkrämpfen geschüttelt wurde. Also fasste sie es am Arm und zog es zu dem völlig unbeschädigten Bett im Garten, nicht ohne sich zu wundern, dass irgendwer es als rettenswert erachtet hatte, wo doch so vieles andere verbrannt war. Aus der Nähe bestätigte sich ihre Vermutung, dass das Mädchen höchstens fünfzehn oder sechzehn Jahre alt war, eine Schönheit mit blonden, leicht gelockten Haaren, zartem Teint, großen blauen Augen und vollen Lippen. Das genaue Gegenteil ihrer selbst.
»Kennst du die Familie?«
»Ich war hier die Dienstmagd«, stotterte sie. In ihrer Sprache war ein Dialekteinschlag, den Mathilde nicht zuordnen konnte. Dann brach sie wieder in Tränen aus und rollte sich auf der Matratze zusammen.
Noch bevor Mathilde weiterfragen konnte, erschollen vom Haupthaus laute Rufe. An der Seite standen mehrere Feuerwehrmänner mit aufgespanntem Sprungtuch. Im nächsten Moment wurde ein weiterer Mensch durch ein zerschlagenes Fenster rücklings von zwei Brandbekämpfern in das Tuch geworfen. Kaum hatten sie den Körper aus dem Tuch geholt, brüllten die beiden Pompiers am Fenster etwas und sprangen kurz hintereinander ebenfalls in das Tuch – gefolgt von Flammen, die aus der Fensteröffnung schlugen. Begleitet wurde ihr waghalsiger Sprung von erneuten Donnerschlägen und Blitzen, die das ganze Ausmaß der Schäden beleuchteten. Der eben aus den Flammen geholte Hausbewohner wurde zu der ersten Leiche gezogen und ebenfalls von einem der Feuerwehrmänner mit einem Tuch bedeckt.
Die Magd, die sich wieder aufgerichtet hatte, schluchzte auf.
Mathilde tätschelte tröstend ihre Schulter. Auf das Trösten verstand sie sich nicht, musste sie sich eingestehen. Dann siegte die Neugierde.
»Was ist geschehen?«
»Isch weeß gaar nischd meehr.«
»Was?«
»Ach, Entschuldigung. Ich meine, ich weiß gar nichts mehr.«
»Wo kommst du her?«
»Aus Meißen.«
»Liegt das im preußischen Teil von Sachsen?«
»Nee, meine Familie stammt aus dem Königreich Sachsen.«
»Wie kommt es, dass du dich retten konntest?«
»Der Herr hat mir gekündigt. Ich habe auf meinen Verlobten Heinrich gewartet. Der hat gesagt, er holt mich ab. Aber er kam nicht. Wo ist er nur?« Der Blick ihrer rotgeweinten Augen huschte über das Geschehen am Haus.
»Und dann?«
»Ich, ich weiß es nicht. Ich war durcheinander und hatte Angst, was werden soll. Ich durfte nicht da sein, musste doch weg. Deshalb lag ich wach. In Kleidern lag ich auf dem Bett.« Sie wies auf ihr einfaches schwarzes Wollkleid, das zerknittert war. Neben ihr stand ein schmales Bündel, das wohl alles enthielt, was das Mädchen besaß. Ein Arbeitsbuch lag obenauf.
»Was soll ich denn jetzt machen, wo soll ich hin?« Sie blickte Mathilde an. »Ich hab doch nichts Falsches gemacht … Warum hat er mich entlassen?« Ihr ausgestreckter Finger wies zum inzwischen gelöschten Haupthaus.
Nach einem Moment, in dem ihr Atmen sich beruhigte, fuhr sie fort: »Dann hörte ich das Knistern. Und roch den Rauch. Ich bin aus der Kammer gerannt. Da sah ich es. Ich wollte schreien … die anderen wecken. Ich habe keine Luft gekriegt … nur gehustet. Gegen die Schlafkammertür der Herrschaften hab ich geschlagen. Ganz feste … Keiner hat aufgemacht …«
Sie hielt Mathilde die zarten Hände hin, die vom Schatten sich bildender Blutergüsse verfärbt und geschwollen waren. Zudem war die rechte blutverschmiert. »Ich hab auch versucht, die Tür zu öffnen. Aber das ging nicht, ich weiß nicht, warum.«
Wieder brach sie in Tränen aus.
»Und weiter?«, fragte Mathilde.
»Dann bin ich zurück in meine Kammer. Ich hab mein Bündel genommen, das Fenster aufgemacht und bin rausgeklettert.« Sie schluchzte auf. »Wo bleibt er nur? Und wo kann ich hin, wenn er nicht kommt? Ich hab so ein schlimmes Zeugnis bekommen. Was soll ich nur machen?«
Sie sah Mathilde verzweifelt an, die das Schicksal einfacher Mägde ohne gutes Zeugnis im Gesindedienstbuch kannte: Nur mit größter Mühe würde sie eine akzeptable Stellung finden, eher auf der Straße landen. Im preußischen Köln galt sie, die Untertanin des Königreichs Sachsens, als Ausländerin. Wurde sie zudem wohnsitzlos aufgegriffen, landete sie schlimmstenfalls im überfüllten Gefängnis und anschließend im Arbeitshaus. Mit den Armen gingen die Preußen ebenso unbarmherzig um wie die Franzosen. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wie Mathilde fand, für seine Armut und Hilflosigkeit in ein Gefängnis gesperrt zu werden.
»Kannst du nicht zurück zu deiner Familie?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf.
»Wie heißt du überhaupt?«
»Ida. Ida Irmisch.«
»Wieso kannst du nicht zurück?«
»Nein, unmöglich. Da kann ich nicht mehr hin. Meine Eltern waren so froh, dass ich Arbeit hab. Sind genug Mäuler zu stopfen. Und dann die Schande, nein, das geht nicht. Ich kann nicht zurück.«
Mathilde nahm das Gesindedienstbuch und schlug es auf. Ida musste bereits sechzehn Jahre alt sein. Vorher brauchte man nach der preußischen Gesindeordnung, die das Führen des Arbeitsbuches erst seit einem Jahr vorschrieb, keines. Die Dienstzeit von zwei Jahren, die gestern geendet hatte; der Name ihres Dienstherren Jacobus Selm und die Eigenschaft des Dienstes waren dort aufgeführt. Doch dann stand da noch: Entlassen wegen Diebstahls. Mathilde stockte der Atem. Eine Katastrophe für Ida.
Die junge Frau neben ihr wies mit dem blutigen Zeigefinger auf den Vermerk. »Das war ich nicht, das habe ich nicht gemacht. Ich hab nicht gestohlen.« Wieder flossen Tränen.
Irgendetwas in ihr sagte Mathilde, dass das stimmte. Sie ließ ihren Blick schweifen und dachte nach.
»Du kommst mit mir, wenn ich hier fertig bin«, verkündete sie nach einem Moment. »Zu meinen Eltern. Die können eine neue Dienstmagd dringend brauchen.«
Wovon ihre Eltern, die sie schon öfter mit solchen Hilfsanliegen bedrängt hatte, noch nichts wussten. Aber wie immer, seitdem sie Mathilde mit diesem unsäglichen Weinhändler und hoffentlich bald geschiedenen Ehemann – drauf gespuckt – Alfred von Tabouillot verkuppelt hatten, würden sie auch diesmal ihrer Bitte nachkommen. Nach Mathildes Verständnis von Sühne gehörte sich das so. Ihre Eltern hatten sich schließlich die Heirat bezahlen lassen. Von Tabouillot hatte ihre Schulden getilgt. Sollten sie doch den Hausdiener entlassen, der außer einem eindrucksvollen Auftreten nichts zu bieten hatte und den sie lediglich behielten, damit die Nachbarn nichts von ihrer Lage erfuhren.
Wieder wurden Rufe laut, Pompiers und Nachbarn eilten zu den zugedeckten Leichen vor dem Haupthaus. Inzwischen lagen vier Tote dort, daneben kniete ein Mann in langem Gehrock und einem um den Hals geschlungenen schwarzen Tuch. Er hatte eines der Abdecklaken mithilfe seines Gehstocks gelüftet und betrachtete vornübergebeugt die Leiche darunter. Nun erkannte sie ihn. Der Stadtphysikus war eingetroffen.
Plötzlich richtete er sich hektisch auf, ließ das Laken unachtsam auf die Leiche fallen und eilte zur nächsten Leiche. Der Ablauf wiederholte sich. In der ihn umgebenden Gruppe breitete sich aufgeregtes Murmeln aus.
Mathilde tätschelte Idas Hand, die, in sich zusammengesackt, nichts von dem Tumult mitbekommen hatte. »Warte hier, ich bin gleich zurück«, verkündete sie und eilte zum ehemaligen Wohnhaus.
»Was ist hier los?«, fragte sie den Nächststehenden, der auf seinem Daumen herumkaute. Derweil war der Physikus zum letzten Laken gehastet.
»Alle tot«, brachte der Mann neben ihr heraus. Mathilde schaute auf die Tücher. Das war nichts Neues. Aber irgendetwas musste die Umstehenden in Aufruhr versetzt haben.
Just in diesem Moment erhob sich der Arzt mit derangiertem Halstuch und stellte mit aufgebrachter lauter Stimme fest, sodass alle Umstehenden ihn verstehen konnten: »Die Opfer haben alle Verletzungen, die nichts mit dem Brand zu tun haben. Das war kein Unglück, das war Mord.«
Wie aufs Stichwort schoss aus den Resten des Hausdaches, das eben noch gelöscht schien, eine Feuersäule gen Himmel, und es brach mit einem Donnerhall in sich zusammen.
Kapitel 2
Er bahnte sich den Weg durch eine Menschentraube, die sich an diesem wolkenverhangenen Morgen vor dem Hof der Familie Selm gebildet hatte. Groß und stämmig gebaut, wie er war, spannte die blaue Uniformjacke mit rotem Stehkragen und ebensolchen Ärmelaufschlägen sichtlich, und man machte ihm willig Platz. Drei Kameraden bewachten mit gezogenem Säbel das Eingangstor. So hielten sie nicht nur die Schaulustigen vom Tatort fern, sondern auch Plünderer davon ab, die Trümmer nach Brauchbarem zu durchwühlen.
Vorerst noch, denn die Fledderer würden sich früher oder später doch über den niedergebrannten Hof hermachen.
»Hans Baudewin meldet sich zum Dienst.«
Er salutierte und durfte passieren, in seinem Schlepptau auch der Neuzugang, der erst letzten Monat nach Köln versetzt worden war. Beide schritten durch das Tor.
»Jesses!«, entfuhr es ihm. Er schlug sich die Hand vor den Mund. Auch der Blick des Neuzugangs hatte sich, wie er aus dem Augenwinkel erkennen konnte, in den sechs Leinentüchern verfangen. Unter einigen zeichneten sich Körper ab, andere sahen aus wie kleine Zelte, aus denen verbrannte Extremitäten herauslugten. Sein Kollege schüttelte den Kopf und wendete sich würgend ab.
»Schäng, ich kann das nicht.«
Als ob es ihm besser erginge!
»Geh sichern. Werden ja immer mehr da draußen.«
Seine Arbeit, die er seit dem Unfall vor sieben Jahren verrichtete, war nicht sonderlich anstrengend. Es war die Ausnahme, dass er auf Kirchweihfesten dazwischenzugehen hatte, wenn zu viele Fäuste oder gar Feuerwerkskörper flogen. Selten auch, dass freche Jungspunde, die ihn und seinen Kollegen neckten, ein paar aufs Maul brauchten. Dann sorgte er mit dem nötigen Wumms für Ordnung.
Seine Älteste nannte ihn seit dem Besuch in einem Stockpuppentheater Schnäuzerkowski. Dabei war er kein in die Rheinprovinz befehligter Preuße. Er kam nicht aus Berlin, sondern vom Buttermarkt, einen Steinwurf von Groß St. Martin entfernt – da, wo es letztes Jahr auf der Kirmes so richtig gerumst hatte und sie sogar fünfzig Soldaten aus dem 28. Infanterieregiment zu Hilfe rufen mussten. Da wäre er jetzt am liebsten hingelaufen. Zurück zum Anfang. Zurück zu den Kindertagen. Und anschließend nicht in die Lehre beim Hufschmied. Keine mit dem Schmiedehammer zerschlagene Hand, die Mariele seither seine bekloppte Hand nennt. Kein Einschleimen danach bei seinem Schwager in der Stadtverwaltung. Kein Klüngel, um eine Arbeit zu bekommen. Kein Dasein als Sergeant, der unter der Woche Aufenthaltskarten von Ausländern prüfte, illegale Bordelle aushob oder an manchen Wochenenden Übermütige auf Volksfesten vermöbelte. Vor allem wäre ihm das hier erspart geblieben: Leichen wegschaffen und zum Stadtphysikus karren.
»Halten Sie nicht Maulaffen feil! Es müssen noch drei Leichen aus den Trümmern geborgen werden«, blaffte ihn ein älterer Herr an, der sich knapp als Dr. Quincus vorstellte. Er war also schon da, der Leichenbeschauer.
»Wenn Sie mir verraten, wo«, rutschte es Schäng heraus.
»Nun werden Sie mal nicht gleich frech. Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren.«
»Worüber genau?«
»Na, lassen wir es gut sein. An die Arbeit! Folgen Sie mir.«
Der für den Anlass zu gut gekleidete Mediziner eilte voraus zur heruntergebrannten Scheune. Mit jedem Schritt, der ihn näher heranführte, wurde Schäng flauer im Magen. Das Dach war teilweise eingestürzt. Schindeln bedeckten den Boden, aber nicht den ersten Leichnam.
»Eine Recognition ist nicht möglich. Die Gesichtszüge sind verkohlt, aber man erkennt die Todesursache deutlich. Sehen Sie die Zerschmetterung der vorderen Schädelpartie und der Schädelkalotte? Das sind eindeutige Belege für eine Einwirkung stumpfer Gewalt. Ich tippe auf Hammer oder Axt als Tatwaffe. Ausschließen kann man schon jetzt, dass er von herabfallenden Ziegeln erschlagen wurde. Beachten Sie die Spurenlage! Nehmen Sie das auch zu Protokoll!«
»Ich soll hier nur wegräumen.«
»Ach, sind Sie noch einer von denen, die nicht lesen und schreiben können. Ist das nicht aber inzwischen Einstellungsvoraussetzung?«
Schäng hielt mit Mühe an sich. Ihm war danach, diesem aufgeblasenen Zieraffen entgegenzuschleudern, dass er ihm das Protokoll fehlerfrei auf den Arsch brennen könne, wenn er es darauf anlegte, aber er hielt die Klappe. Er hatte sich schon mal eine Ermahnung wegen ungebührlichen Verhaltens gegenüber Weisungsbefugten eingefangen, und die reichte ihm.
»Nun gut, die beiden armen Teufel dort hinten nehmen Sie gleich weg und bringen sie zu den anderen. Aber passen Sie auf! Ich brauche beide am Stück.«
Schäng stutzte.
»Da vorne auf dem Brunnenrand liegen Laken. Heben Sie die Leiche hier vorsichtig darauf und ziehen Sie sie zu den anderen. Aber zuerst zeige ich ihnen noch die weiteren Opfer, die zu bergen sind. Haben Sie eigentlich keinen Kollegen, der Ihnen helfen kann? Na ja, andererseits sind Sie ja ’ne staatse Kääl, wie man hier so sagt.«
Wieder eilte Dr. Quincus voraus, wieder ging Schäng zögerlich hinterher. Den Anblick des Leichnams bekam er nicht aus dem Kopf. Er fürchtete sich vor der nächsten bleibenden Erinnerung.
Der Arzt steuerte auf den hinteren Scheunenbereich zu. Dort stand noch eine völlig verrußte gemauerte Wand.
»Stolpern Sie nicht über den Arm, den so ein Trottel von Pompier wohl mit einer Dachstrebe verwechselt und abgerissen hat. Die dazugehörige Hand fehlt noch. Haben Sie ein Auge darauf.«
Schäng stieg die Kotze hoch. Nur mit Mühe schluckte er sie herunter.
»Kommen Sie! Nur keine Müdigkeit vorschützen!«
Wer war dieser Mann? Ein Stüpp im feinen Zwirn? Wenn Schäng eines sicher wusste, dann, dass er sich heute Abend im Brauhaus den Kopp mit Kölsch zuschütten würde, bis er den Spuk abgeschüttelt hatte. Koste es, was es wolle. Musste er halt nebenbei ein paar mehr Silbergroschen verdienen.
»Nun kommen Sie schon!«, drängte der menschgewordene Schrecken.
Schäng wappnete sich innerlich, folgte widerwillig und erschrak bis ins Mark.
In dem, was einmal die Knechtekammer am Ende der Scheune gewesen sein musste, in deren leer gähnender Türöffnung er stehen zu bleiben hatte, lagen nur noch Reste eines Menschen. Der Körper war heruntergebrannt wie eine Kerze, die an beiden Enden angezündet worden war. Es war aber nicht der Geruch von Wachs, der ihm in die Nase stieg, sondern es roch süßlich nach aufgeplatzten Bratwürsten. Schäng würgte mit Mühe die ihm hochkommende Pampe von drei Bissen Brot herunter, für die es zum Frühstück nur gereicht hatte.
»Wir können nur aus dem Umstand, dass der Leichnam hier gefunden worden ist, folgern, dass es sich um einen Mann handelt. Sie müssen ganz besonders vorsichtig sein. Es ist eine Kunst, bei so was die Todesursache festzustellen. Es kommt auf jedes Detail an.«
Schäng sah sich in Gedanken auf dem Absatz umdrehen und aus dem Gebäude rennen. Aber die Blöße würde er sich nicht geben. Den Begriff der Vorwärtsverteidigung hatte er bei dem Einsatz mit den Soldaten aufgeschnappt, als die auf alle und jeden eindroschen, die nicht schnell genug vom Ort des Geschehens weggelaufen waren. Er musste hier raus.
»Wo ist die dritte Leiche?«
Der Stadtphysikus blickte ihn überrascht an.
»Na, Sie stecken ja ganz schön was weg. Sie scheint man für heikle Aufgaben gebrauchen zu können. Wie heißen Sie?«
Warum wollte er das wissen?
»Hans Baudewin.«
»Gut, mein lieber Baudewin, dann gehen wir weiter. Dort vorne liegen auch noch Reste von dem, was mal ein Mann gewesen sein dürfte.«
Ein paar Schritte später deutete dieser Quincus mit beiden Zeigefingern auf einen ebenfalls bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Körper. Die Reste einer Samtweste und der Geschlechtsteile waren noch erkennbar.
»Mit wem soll ich anfangen?« Schäng verteidigte weiter nach vorn.
»Holen Sie die Laken! Ich helfe Ihnen mit denen hier. Die wollen behutsam angefasst werden. Da brauchen Sie ein zweites Paar Hände.«
Umso besser. In Nullkommanix war Schäng draußen.
Die nächste Viertelstunde konzentrierte er sich darauf, immer ein paar Zentimeter über alles hinwegzusehen, was er anzufassen, aufzuheben und auf die Laken zu legen hatte. Als alle sterblichen Überreste geborgen waren und der Stadtphysikus nach dem Planwagen rief, lenkte Schäng, der neben all diesen Laken stand, seine Aufmerksamkeit auf die anderen Figuren, die den Ort des Schreckens bevölkerten. Er hatte sie bisher nur am Rande wahrgenommen. Feuerwehrleute, die Schutt wegräumten und verschiedene Dinge zusammentrugen. Dinge, die offenbar zur Aufklärung des Geschehens wichtig waren: ein altes Beil mit einer gut sieben Zoll langen Scheide und einem anderthalb Zoll breitem Rücken, zwei Dosen Brennspiritus. Das hatte eben jemand an ihm vorbei aus der Knechtekammer getragen, als der Arzt und er die Überreste der Brandleiche bedachtsam wie einen Säugling in das Leinentuch gewickelt hatten. Dann waren da noch eine silberne Zylinderuhr und ein Taler, die neben das Beil gelegt worden waren. Schäng hatte auch hier aus dem Augenwinkel gesehen, dass ein Pompier beides unter einem Ziegel in der Scheune gefunden hatte, während er selbst das erschlagene männliche Opfer allein auf das Laken gehoben hatte. Was die Feuerwehrmänner sonst noch in der Brandstätte gefunden hatten, konnte er nicht erkennen.
Ein gellender Schuss ließ Schäng aufschrecken. Am Hoftor brach Tumult aus.
»Auseinander«, brüllte eine kräftige Tenorstimme. Schäng erkannte, dass gut zwei Dutzend Soldaten, vermutlich aus der Dominikaner-Kaserne, angerückt waren, um die Sergeanten am Tor zu unterstützen. Die Menge stob auseinander, als ein zweiter Schuss fiel. Durch die Rinne fuhr ein zweispänniger Pferdekarren mit bogenförmigem Planendach, gezogen von zwei Ardennern, in den Hof. Der Kutscher lenkte die Rösser an den Leichnamen vorbei, aber nur so weit, dass der Planwagen wie ein Sichtschutz zwischen den Neugierigen in der Gereonsmühlengasse und den Toten stand.
Der Kutscher sprang ab und blickte auf die vielen Laken. »Do leeven Jott«, murmelte er.
»Was an dem Gott soll lieb sein?!«, raunte ein Feuerwehrmann Schäng zu.
Aus irgendeiner Ecke tauchte der Stadtphysikus auf. Mit einem Kohlestift nummerierte er die Laken.
»So, Baudewin, die Nummern eins bis vier kommen nach unten, da ist die Todesursache klar. Die mit den Nummern fünf bis sieben legen Sie darüber. Da ist zumindest genug Mensch übrig für die Untersuchung. Die letzten beiden, also die Nummern acht und neun legen Sie obenauf, damit die durch den Druck der anderen nicht zerbröseln.«
Dann wandte sich der Stadtphysikus an den Kutscher.
»Ich habe angewiesen, dass die Leichenschau im Bürgerhospital stattfindet. Der Wundarzt, der mich hierher begleitet hatte, ist bereits nach dort unterwegs. Hier konnte er nichts mehr ausrichten. Er erwartet Sie.«
Schäng atmete tief durch.
»Baudewin, Sie begleiten die Kutsche. Ich lasse Ihren Vorgesetzten informieren.«
Er würde auch das noch überstehen, dachte Schäng. Dann war es geschafft.
»Ach, noch eins«, setzte Dr. Quincus nach, »Sie sind mir persönlich dafür verantwortlich, dass die Fracht ordentlich abgeladen wird. Und zwar so, wie sie hier liegen. Nebeneinander. Sie warten auf mich. Ich gebe Ihnen dann weitere Weisung.«
Verdammte Driss! Vorwärtsverteidigung konnte nach hinten losgehen.
Der Kutscher schien das Gemüt eines Fleischerhundes zu haben. Er griff nach den Lakenecken, als seien es die Zipfel von Mehlsäcken. Schäng war überzeugt, nur der Hinweis von Dr. Quincus, es mit zerbrechlicher Fracht zu tun zu haben, hielt ihn davon ab, die Leichen über die Schulter zu wuppen und auf die Ladefläche zu stemmen. Brummelig ließ er sich von Schäng helfen. Beide hievten die toten Körper auf ein Bohlenbrett und schoben sie auf die Ladefläche. Schäng sprang Leiche für Leiche auf den Wagen, um die Opfer entgegenzunehmen und so anzuordnen, wie ihm aufgetragen worden war. Für eine Schrecksekunde waren ihm die Lichter ausgegangen, als vom Totenstapel ein loser Arm heruntergerutscht war und dabei sein Gesicht gestreift hatte. Es fühlte sich schlimmer an als das Streicheln seines Rückens mit dem Gürtel des Vaters, bevor er ausholte und auf ihn einschlug. Noch mal und noch mal, bis die Unartigkeit des mittleren von drei Söhnen wiedergutgeprügelt war. Der Arm hingegen fiel auf die Ladefläche, ohne erneut auszuholen, und Schäng taumelte.
»Rinn domet!« Der Kutscher reichte Schäng einen Flachmann und bedeutete ihm, einen kräftigen Schluck in sich hineinzukippen. Der schüttelte den Kopf.
»Dat es kein Schabau. Dat es Millezing.«
Wenn der bis in den kleinen Zeh erschrockene Schäng das auch nur allzu gern geglaubt hätte, so war er doch sicher, dass in dem Flachmann Schnaps und nicht etwa Medizin war. Er lehnte wieder ab. Der Kutscher beharrte darauf, dass es Heilwasser sei. Als er schließlich erklärte, es handele sich um Klosterfrau Melissengeist, war Schäng endlich überzeugt. Das hochprozentige Zeug gab es in der Apotheke zu kaufen. So war es sicher kein Dienstvergehen, sich auf den flauen Magen ein paar Tröpfchen zu genehmigen. Er spülte die schauerliche Berührung und die Erinnerung an die Striemen hinunter. Die Tröpfchen hätten drei Esslöffel gefüllt.
»Jeht et widder?«, fragte der Kutscher.
Schäng nickte. Die Mixtur weckte nicht nur kranke Lebensgeister, sondern knallte auch ganz schön im Kopf. Das Klosterfräulein, das vor vier Jahren mit viel Brimborium auf Melaten beerdigt worden war, war vermutlich ein Schlitzohr. Ihr Kosmetikum wurde als Allheilmittel gefeiert. Und vorn auf dem Fläschlein war sogar mit königlicher Genehmigung das mittlere Wappen Preußens.
Warum es ihr noch kein Kölsch-Brauer nachgemacht hatte, Hopfen als Heilkraut anpries und sein Bier als Medizin verkaufte?
Schäng schüttelte sich.
»Danke!«
Der Kutscher murmelte etwas, dann schlug er Schäng auf die Schulter und stieg auf den Kutschbock. Der Planwagen setzte sich in Bewegung.
Schäng zupfte seine Uniform zurecht und holte zu den Gäulen auf.
Irgendwer brüllte irgendwas. Die Menschenmenge am Tor teilte sich. Sicher steuerte der Kutscher die besondere Fracht in die Gereonsmühlengasse, um von dort in den Gereonswall einzubiegen. Der Neuzugang, der eben stritzen gegangen war, hatte sich wortlos angeschlossen und sicherte die rechte Seite. Das Militär verhinderte, dass die Schaulustigen der Kutsche nachliefen.
Mittag war inzwischen vorüber. Ein fein gewobener Wolkenteppich mit Mottenlöchern schwebte über der Stadt. Die Sonne konnte immer wieder ihre Nase durchstecken und ihre Strahlen auf die Stadt schnupfen. Die letzten paar Jahre hatte sie es nicht so gut gemeint. Hinter mehrlagigen, dicken Teppichen hatte sie sich zurückgezogen und den Regenwolken dabei zugesehen, wie sie mit ihren Wassermengen die Ernte ertränkt hatten. Was der Regen nicht besorgen konnte, erledigte das Rheinhochwasser im März 1845. Was der Strom und sein Schlamm nicht zerstört hatten, schaffte die Kartoffelfäule. Und was der Schimmel an den Knollen nicht vermocht hatte, vollstreckte nun die Teuerungsrate. Lebensmittel waren für viele schier unerschwinglich. Die Folgen entgingen Schäng nicht. So viele zu frühe Tode, so viele vom Hunger Aufgezehrte. Er sah auch heute ein paar von der Not gezeichnete Kinder am Wegesrand. Hohle Wangen, dürre Leiber, in geflickten Hosen und mit nackten Füßen. Bläck Fööss, echote es in seinem Kopf, der versuchte, seine Gedanken im Melissengeist bunt zu baden. Aber sie waren trotzdem noch da, die Pänz, die Unkraut ausstachen und nur aufblickten, um die Passanten zu mustern, ob sich betteln lohnte. Als er sie ansah und sich ihre Blicke trafen, liefen sie weg. Er war hier draußen in seinem Revier Preuße, nicht die gefühlige Schrankwand mit den vielen Schubladen, wo immer noch eine Sorge hineinpasste. Damit zog Mariele, seine Frau ihn immer auf.
Wortlos zogen sie am Gereonstor vorbei, das in seiner Kindheit noch zugemauert gewesen war. Die Erzählungen über das alte Stadtgefängnis, das dort untergebracht war, hatte Schängs Großvater gern als kleine Schauergeschichte zur Nacht zum Besten gegeben. Der schmiedeeiserne Beschlag der Kutschenräder klackerte über das Kopfsteinpflaster. Zu laut, um von der Geräuschkulisse Kölns übertönt zu werden. Irgendwie war die Stadt leiser geworden. Auch ihr hörte man die Not an. Das jahrelange Wachsen und Herausputzen hatte aufgehört. Die Baukrise und Kreditklemme, die der anhaltenden Teuerung gefolgt waren, trieben die Hände der Handwerker und Tagelöhner in deren Hosentaschen, weil sie nichts zu tun hatten. So manchen hielt nur sein krummer Sinn am Leben. Er machte lange Finger. Nur am Dom klopfte und hämmerte es noch gelegentlich. Er sollte endlich fertigwerden. Schäng lachte laut auf. Der Melissengeist wirkte. Fast vergessen schien die grausliche Fracht, bis auf einmal eine Frau hysterisch aufschrie.
»D’r schwatze Dud es zoröck.«
Schäng schaute sich nach der Stimme um. Eine knorrige Alte mit strahlend weißer Kittelschürze stocherte mit ihrem Stecken in der Luft herum, zeigte auf die Kutsche und kreischte wieder: »D’r schwatze Dud es zoröck.«
Der schwarze Tod war nicht zurück. Mit Pocken und Cholera waren sie allerdings genug gestraft. Noch ehe Schäng sich zurechtlegen konnte, wie er ein solches panikverbreitendes Gerücht unterbinden könnte, ranzte der Kutscher sie an. »Kauf dir e Brill! Dat sin de Verbrannten vum Schöttelshof, Zilla.«
Die alte Frau schwieg. Schäng drehte sich noch mal nach ihr um und sah, dass sie einen Rosenkranz zwischen den Fingern bewegte. Sie murmelte etwas. Vermutlich das Glaubensbekenntnis.
Schäng betete auch, aber mit ganz diesseitigem Bezug. Vor seinem geistigen Auge erschien ein Eimer kaltes Wasser, in den er seinen Kopf stecken konnte. Seine Haare klebten unter der Pickelhaube. Die weiße Hose war rußverschmiert, die roten Ärmelaufschläge ebenfalls. Mariele würde die Pimpernellen kriegen.
Inzwischen marschierten sie den Friesenwall lang am Friesentor vorbei. Über die Seitenstraßen mussten die Schaulustigen zu ihnen aufgeschlossen haben. Oder waren das andere, vom Gekeife der Alten angelockte Neugierige? Die meisten zogen die Schiebermütze vom Kopf, als die Kutsche sie erreichte. Immer mehr Fenster in den Häusern öffneten sich. Dreifensterhäuser rahmten windschiefe Fachwerkhäuser ein. Gekälkte Fassaden, verputzte Fassaden, rohe Backsteinfassaden. Aus allen reckten sich Köpfe. Die Blicke versuchten, unter die Plane zu schlüpfen. Unbeirrt von den Zuschauern ließen die Gäule grünlich-braune Äpfel fallen. Der Geruch stieg in Schängs Nase. Er fand es geradezu wohltuend nach dem Gestank verbrannten Fleisches.
Sie bogen in die Breite Straße ein.
Aus dem Nichts stellten sich ihnen plötzlich fünf, sechs junge Männer in den Weg. Alle eine Schlagkeule in der Hand. Einer steuerte sofort auf den Bock zu, sprang auf, packte den Kutscher am Kragen und riss ihm die Zügel aus der Hand.
»Muss ja wertvoll sein, was du da geladen hast, wenn zwei Sergeanten dich begleiten. Lass doch mal sehen.«
Driss. Auch das noch. Dass die Muffe vor ihm und den paar Polizisten, die Köln hatte, gering war, bewies jede Kirmes aufs Neue. Der Neuzugang hatte schon den Säbel gezogen und hielt noch die drei anderen Räuber in Schach. Jetzt musste Schäng schnell sein. Er schoss auf den jungen Kerl zu, der sich ganz außen auf seiner Seite aufgebaut hatte, nahm ihn mit dem linken Arm in den Würgegriff und schleifte ihn ans Ende der Kutsche. Noch hatte er das Überraschungsmoment auf seiner Seite, die anderen beiden Angreifer verharrten baff.
»Isch ries üch, wat do drop es«, brüllte er in breitestem Kölsch. Und er würde ihnen tatsächlich zeigen, was auf der Ladefläche war. Nur so hatte er eine Chance, sie in die Flucht zu schlagen. An eine Verhaftung war nicht zu denken. Wie sollten sie beide diese Jungspunde ohne Verstärkung arretieren, mit Umweg zum Revier bringen, und gleichzeitig den Leichenzug bewachen, der unterwegs noch andere Idioten anlocken könnte?
Er griff mit der freien rechten Hand nach dem abgetrennten, verbrannten Arm. Dann zerrte er den Räuber wieder nach vorn und zeigte wahrhaftig, was auf der Ladefläche war.
»Leichen klauen, ihr Clowns? Das Fleisch kriegt ihr aber nur auf Melaten quitt.«
Der Jüngling in Schängs Umklammerung würgte. Dem auf dem Kutschbock reichte er den Arm an. »Nimm. Ja, nimm schon! Hinten ist noch mehr von der Beute. Halbe Köpfe. Verkohlte Klöten.«
Der junge Räuber machte große Augen, ließ vom Kutscher ab. Der Neuzugang nutzte den Moment, zog ihn vom Bock herab, drängte ihn gegen die Kutsche und hielt ihm den Säbel vor die Kehle. Mit seiner freien Hand stieß er den Kopf heftig gegen den Holzrand des Planwagens. Der Kerl ging in die Knie. Der Neuzugang zog ihn am Kragen hoch und trat dem Taumelnden so fest in den Hintern, dass er stolpernd in seine Bande flog.
Schäng ließ den Arm fallen und pfefferte seinen Fang vor das hintere Kutschrad. Dann verpasste er ihm eine Backpfeife, dass es im Kiefer des Nichtsnutzes knirschend nachhallte. Der Knabe heulte auf.
»Zisch ab, du Pfeife! Geh bei der Mama knaatschen!«
Die jungen Männer verdufteten so schnell, wie sie aufgetaucht waren.
»Und ihr«, keifte Schäng die umstehenden Schaulustigen an, »wenn euch demnächst einer beraubt, glotz ich auch bloß. Tach.«
Nachdem er den Arm wieder auf die Ladefläche gelegt hatte, setze sich der Planwagen erneut in Bewegung. Jedoch erst, als der Kutscher seinen zweiten Flachmann an beide Sergeanten heruntergereicht hatte.
Schäng war es inzwischen eins, wenn er angeschickert am Ziel eintraf. Hauptsache, er kam an. Und die Leichen waren wohlbehalten. Konnte man das so sagen? Egal.
Er atmete auf, als er den Neumarkt sah. Das Hospital lag nicht weit dahinter.
Kapitel 3
In seinem Kopf herrschte Aschermittwoch. Schäng war gestern Abend abgestürzt in ein Fass Kölsch, und hatte sich herausgetrunken. Ein stechender Schmerz an den Schläfen plagte ihn. Er hatte das Gefühl, als hingen die Steinmetze von der Dombauhütte an seiner Turmspitze. Der Versuch, die Bilder der Toten herunterzuspülen und dann im Pissoir zu lassen, hatte nicht geklappt. In der kurzen Nacht waren sie ihm im Traum erschienen: lebensgroße Stockpuppen, die brennend um ihn herumtanzten und dabei zu Stockbrot verschrumpelten. Mariele hatte ihn aus dem Traum gerüttelt, weil er um sich geschlagen hatte.
Der hier, der schlief wie ein Toter. Schäng saß am Bett des einzig überlebenden Mitglieds der Familie Selm. Man hatte ausgerechnet ihn wieder an den Ort des Geschehens beordert. Johann Selm, den er bewachen sollte, war bei Familie Ziethen im Nachbarhaus untergekommen.
Der Geruch, der von dem reglosen Körper vor ihm ausging, war gottserbärmlich. Der Schlafende stank, als hätte auch er Karneval hinter sich; als wäre er nach tagelanger Kneipentour sturztrunken heimgekehrt, in sein Bett gefallen, die mit Schweiß und Tabakrauch vollgesogenen Klamotten noch am Leib, und hätte sich dann bekotzt, ohne darüber wach zu werden. Dabei war sein Nachtgewand sauber. Um den Kopf war ein Verband gewickelt, auch um den rechten Unterarm, der aus dem Nachthemd herauslugte. Ob er noch mehr Verletzungen davongetragen hatte, konnte Schäng nicht erkennen. Das Hemd war durchnässt. Der junge Mann schwitzte stark, so ruhig er auch dalag. Doch all das konnte nicht verbergen, dass er mit seinen feinen und regelmäßigen Gesichtszügen und dem lockigen Haar sicherlich die Blicke der Frauen auf sich zog.
Schäng hätte dem armen Tropf gewünscht, dass es wirklich nur der Fastelovend gewesen wäre, der ihn in den Zustand versetzt hätte. Aber der hier, der würde, wenn er wach wurde, noch nicht mal einen Kater haben. Der würde aufwachen und hätte niemanden mehr, schoss es Schäng durch den Kopf. Die Vorstellung, wie sich das anfühlen musste, hatte die Schieber in Schängs Tränenkanälen angehoben. Er war im Brass mit diesen unzuverlässigen Schiebern und rieb sich die Augen. Irgendetwas, das nach Kneipe roch, dünstete der Schlafende aus. Und wenn er stöhnte, wie jetzt, stieg saurer Atem in Schängs Nase. Er stand auf und rückte den Hocker, auf dem er gesessen hatte, ans offene Fenster.
Wieder blickte er auf den jungen Mann, in dessen Gesichtszügen noch der Junge zu erkennen war, so kindlich, so unbekümmert, wie Johann Selm noch vor wenigen Jahren gewesen sein könnte.
Warum musste er das arme Menschenkind bewachen? Nahmen die hohen Herren vom Öffentlichen Ministerium an, die Täter kehrten zurück, um die ganze Familie auszulöschen?
Schäng fand das bestuß und fasste sich unwillkürlich an den Kopf. Also, was sollte er hier? Wenn er bei der Arbeit hätte sitzen wollen, wäre er Weber geworden. Er lauschte den Glockenschlägen von St. Gereon. Eine Stunde verging, dann zwei. Jede nächste dauerte länger als die vorangegangene. Schäng fürchtete schon, die Zeit könne aus Versehen stehenbleiben. Johann Selm schlief immer noch tief und fest. Wieder blickte Schäng sich in der Kammer um. Er könnte inzwischen die Maserung der Holztüre nachzeichnen, wenn man ihn dazu aufforderte, auch die Risse im Putz der Wände. Wie hatte sich das einzige überlebende Mitglied der Familie Selm nur hierhin schleppen können, verletzt wie er war, fragte sich Schäng beim Anblick des Bewusstlosen. Man hätte sein Klopfen gegen die Haustür kaum gehört, so hatte die alte Ziethen Schäng verzällt.
»Ach Gott, unser Haus brennt«, habe der junge Selm nur noch geraunt. Dann sei er in diese tiefe Ohnmacht gesunken. Daraus war er nun seit zwei Tagen nicht erwacht.
Endlich hörte der Sergeant vor der Tür Schritte und Stimmen. Schon öffnete sie sich, und der Instructionsrichter Dr. Lindlar trat ein. Schäng kannte ihn, weil er ihm schon so einige Beschuldigte zur Einvernahme hatte vorführen müssen. Offenbar leitete er auch dieses Ermittlungsverfahren. Direkt auf dem Fuße folgte dem Richter der Stadtphysikus Dr. Quincus, der Schäng kurz zunickte, als er ihn erkannte, sowie ein Gerichtsschreiber.
Alle drei traten an das einfache Bettgestell und begutachteten den dort Liegenden.
»Hm«, machte Dr. Lindlar an Dr. Quincus gewandt, »meinen Sie, er kann uns hören?«
Der Arzt trat näher heran und beugte sich über Johann Selm. Schäng wusste, was der sehen würde: ein stark gerötetes Gesicht, die Kiefer fest aufeinandergepresst, hielt der junge Mann die Augen vor der Welt verschlossen. Schäng verstand das – bei den Aussichten, die ihn erwarteten.
Dr. Quincus schien entschlossen, ihn zu wecken.
Erst rüttelte der Arzt am Arm des Patienten, dann stieß er mit dem Zeigefinger dagegen, als Selm keine Reaktion zeigte. Er rührte sich dennoch nicht. Dann zog der Arzt seine Taschenuhr heraus und umfasste Johanns Handgelenk.
Derweil trat der Instructionsrichter an die kleine, Kommode an der Seitenwand des Raumes, auf der die Kleidung des Johann Selm lag. Auch auf die hatte Schäng lange genug geglotzt. Der Richter winkte den Gerichtsdiener heran, und Schäng hörte ihn diktieren: »Ein gestreiftes baumwollenes Oberhemd, eine wollene Jacke, lederne Tragbänder und eine mit einer Litze um den Hals zu schlingende silberne Cylinderuhr.«
Er fasste in die Taschen der Jacke und zog deren Inhalt heraus. »Zwei Taschenmesser und ein ledernes Portemonnaie, welches« – er ließ Münzen in seine Hand gleiten und zählte sie – »dreizehn Taler enthält.«
Dann ergriff er das Hemd, besah es genauer und diktierte weiter: »Auf dem Hemd befinden sich hinten große Flecken. Dem äußeren Anschein nach handelt es sich um Blut.«
Er wandte sich wieder Dr. Quincus zu, der gerade verkündete: »Der Puls schlägt etwa fünfundfünfzig Mal pro Minute.« Dann zog der Arzt Johanns Augenlider hoch. »Die Augen sind starr und ausdruckslos, aber sie reagieren auf Licht, wenngleich schwächer als im Normalzustand. Hm! Wann und in welchem Zustand wurde er denn gefunden?«
»In der Brandnacht«, berichtete Dr. Lindlar. »Anscheinend hatte er sich bis vor dieses Haus geschleppt. Er war nur kurz noch bei Bewusstsein, dann fiel er in diese Ohnmacht. Man trug ihn herein. Schließlich kannte man ihn aus der direkten Nachbarschaft. Der Schöttelshof ist nur gute vierhundert Schritte entfernt. Der sofort herbeigerufene Arzt, Ihr Kollege Dr. Benrath, fand den Johann auf einer Bank liegend vor. Er war nicht ansprechbar. Man zog ihm die Oberkleider aus und versorgte die Rückenwunden. Messerstiche, vermutete Ihr Kollege. Bei der Untersuchung stellte der Arzt Stichwunden im Rücken und am Schulterblatt, eine im Bauchraum und eine am Arm fest, die er versorgte. Dann setzte er in der Schläfengegend Blutegel, indes ohne sichtliche Einwirkung auf seinen Zustand. Können Sie, verehrter Dr. Quincus, etwas zu den Verletzungen sagen?«
Der Stadtphysikus nickte und untersuchte Johann genauer, taste ihn ab, nahm den Verband von der Armwunde, hob den Verletzten an der Schulter an, sodass er dessen Rücken begutachten konnte, und zog die Decke von den Beinen weg. Zum Vorschein kamen schmutzige, geflickte Beinkleider aus Leder und Strümpfe, die zerrissen und völlig verdreckt waren. An der linken Hosenseite war ein größerer Fleck wie von abgewischtem Blut, wie Schäng erkannte.
Nun nahm sich der Arzt den Kopf vor. »Am Hinterkopf befindet sich eine etwas erhabene Stelle von geringem Umfange, jedoch ohne eine Spur von Sugillation, also eine Beule ohne Bluterguss.«
Schäng sah, wie Dr. Quincus die Stelle abtastete. »Sagten Sie nicht, dass er ohnmächtig vor dem Hause zusammengebrochen ist?«, fragte er den Instructionsrichter. Der nickte nach einem kurzen Blick in die mitgebrachten Unterlagen.
»Nun, vermutlich ist die Verletzung entstanden, als der Patient ohnmächtig auf dem Boden niedergeschlagen ist.«
»Was meinen Sie, wann wird er ansprechbar sein?«, fragte Dr. Lindlar.
»Sie sehen ja selbst, dass der junge Mann auf nichts reagiert, auch auf Berührung nicht. Ich kann nicht vorhersagen, wann er aufwacht.«
»Haben Sie alles mitgeschrieben?«, fragte Dr. Lindlar den Gerichtsdiener, der bestätigend nickte und sich von seinem Stuhl hinter einem Tischchen am Fenster erhob.
Plötzlich ertönten vom Bett ein Stöhnen und ein Schmerzenslaut. Alle fuhren herum. Dr. Quincus eilte zu dem Patienten, der sich in willkürlichen Schlingerbewegungen von einer Seite zur anderen wand. Schäng konnte erkennen, dass Johann die Augen weit aufgerissen hatte, ebenso den Mund.
»Ruhig, ruhig.« Der Arzt versuchte, Johann zu besänftigen, der nun mit den Fäusten in die Luft stieß, als ringe er mit einem Angreifer. Nur langsam beruhigte sich die Atmung des Patienten, und sein Blick wurde klarer.
»Wo, wo bin ich?« Er blickte panisch zwischen Richter und Arzt hin und her.
»Können Sie sich denn nicht erinnern?«, fragte Dr. Lindlar.
Johann schüttelte den Kopf. »Doch«, er richtete sich auf und schnappte nach Luft, »unser Hof, er brennt!«
Der Instructionsrichter schob sich an Dr. Quincus vorbei näher an das Bett heran.
»Können Sie uns sagen, was geschah?«
»Lassen Sie den Mann doch erst einmal zu sich kommen«, fuhr der Arzt dazwischen und zwängte sich wieder an das Bett. Erneut umfasste er Johanns Handgelenk und zückte mit der freien Hand seine Uhr.
»Wie lange liege ich hier schon? Und wo sind meine Eltern? Wo meine Brüder? Meine Schwester?« Seine Atmung wurde immer hektischer.
Der Arzt ließ die Uhr sinken und legte die ergriffene Hand zurück auf das Bett.