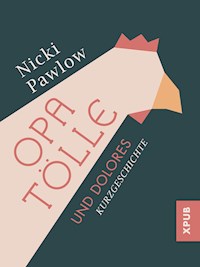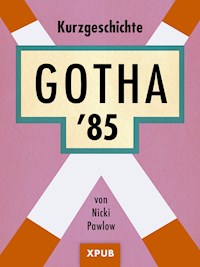Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Wantscho liebt es im Schwarzen Meer zu schwimmen. Im Wasser fühlt er sich stark und unbezwingbar. Dem Wasser ist es egal, dass sein linkes Bein versehrt ist - im Wasser ist die Seele frei." Anfang der 1960er Jahre zieht der junge Bulgare als Psychiater in die DDR, um sein Glück zu finden. Er trifft auf Rose, ein unbekümmertes, abenteuerlustiges Mädchen aus Sachsen-Anhalt. Nach der Liebesheirat folgt sie Wantscho nach Bulgarien. Doch lange hält es Rose in dem armen, rückständigen Land nicht aus. Das Paar kehrt in die DDR zurück, Tochter Nelli kommt zur Welt. In Thüringen schaffen sie sich inmitten der Unfreiheit des DDR-Systems ihre eigene kleine, fast heile Welt. Fast heil, denn Wantschos Jähzorn, seine Schwermut, sein Hang zum Alkohol trüben das Glück. Als der bulgarische Arzt im SED-Regime auch noch politisch unter Druck gerät, begibt sich die Familie auf eine waghalsige Flucht. Der Neubeginn im Westen ist vielversprechend. Doch können Wantscho, Rose und Nelli die Dämonen der Vergangenheit abschütteln? Jahrzehnte später begibt sich Tochter Nelli auf Spurensuche: Was für ein Mensch war ihr Vater eigentlich, vor dem sie zeitlebens Angst hatte, den sie zugleich so sehr liebte? Ein Buch über Heimatverlust und Neuanfang, Verdrängen und Erinnern, Zwietracht und Versöhnung und über die Macht der Gefühle. Ein großer, drei Generationen umspannender Familienroman
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 754
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen Vater (1930–2007),
für meine Mutter
Und für K. E. Lerner
Zum Andenken an Iwan Wladislawow (1930–2003)
und Dr. med. Wolfgang Dreßke (1930–2012)
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Epilog
Nachwort
Prolog
Das Bett haben sie mitten ins Zimmer gerückt. Du liegst auf der Seite, mit dem Gesicht zur Wand. Deine Wangen sind eingefallen, dein Mund steht offen, das weiße Haar klebt an deiner feuchten Stirn.
»Hallo, Papa«, sage ich und gebe dir einen Kuss auf die Wange. Sie fühlt sich kühl an. Ich streiche dir die Haare zurück.
Mein Vater sieht mich an. Verständnislos. Verwundert.
»Ich bin’s Papa«, sage ich. »Dein Kind-Kind.«
Seit ich selber Kinder habe, nennt er mich so: Kind-Kind.
Ich nehme seine Hand, mit deren Zeige- und Mittelfinger er sich an der Kabelschnur des Piepers festhält. Mit einem Mal kommt mir diese Hand, die mich einst streichelte, die mich einst schlug, so klein vor. Wie die Hand eines Kindes.
Zweimal öffnet und schließt Papa die Augenlider. Sein Atem geht schwer, die Lunge rasselt. Manchmal holt er tief Luft, es klingt wie ein Seufzen.
»Weißt du, wer ich bin, Papa?«
Jetzt verzieht er den Mund zu einem Grinsen. Als wolle er sagen: Bist wohl bekloppt! Natürlich weiß ich, wer du bist!
Du bist hier gegen deinen Willen, Papa. Aus Kurzzeit- wurde Langzeitpflege. Und du haktest dich fest, an diesem winzigen Zimmer, dem kleinsten des Heims. Zwei Meter breit ist es und vier Meter lang. Du wolltest nicht mehr raus, aus diesem kleinsten Zimmer. Als hättest du so die Gewissheit, dass dein Aufenthalt nur ein vorübergehender ist. Kein endgültiger.
Da das Bett seit einigen Tagen mitten im Zimmer steht, kann ich nicht wie sonst den wuchtigen Stuhl an das Kopfende rücken. Ich gehe raus auf den Flur und bitte die Schwester um einen Hocker. Ich setze mich so hin, dass ich dein Gesicht von Nahem sehen, deine Hand halten kann. Meine Knie stoßen an den Urin-Beutel. Er ist halb gefüllt. Ich schiebe ihn beiseite.
Ich erzähle ein bisschen. Dass wir mit den Kindern die Ostertage an der Elbe verbracht haben, auf dem Waldgrundstück von Steffens Eltern; dass wir dort zwei morsche Birken und eine kranke Tanne gefällt haben; dass unsere kleinen Söhne mit Feuereifer dabei halfen; dass unser Jüngster gestern zum ersten Mal »Hose« gesagt hat. »Es klang wie Osse«, sage ich und muss lachen. Papa zeigt keinerlei Regung. Ich schweige und lausche auf sein Atmen. Noch immer hält er die Augen offen. Ohne zu blinzeln, fixiert er mal die Wand, mal mich. Wenn er mich ansieht, blicken seine Augen durch mich hindurch, auf einen fernen Punkt. Was siehst du, Papa? Wo bist du?
Es klopft. Die Schwester kommt herein.
»Guten Tag, ich bringe das Mittagessen.« Sie stellt das Tablett mit dem abgedeckten Teller und dem Schälchen mit Quarkspeise auf den fahrbaren Beistelltisch.
»Ich kann ihn füttern«, sage ich.
»Das ist schön«, sagt die Schwester und lächelt.
Sie beugt sich über Papa. »Ich drehe Sie jetzt um, Dr. Nikolow.« Dabei betont sie das letzte »o« und verschluckt das »w« des Nachnamens. Sie schlägt das Deckbett zurück, fasst Papa an der linken Schulter und dreht ihn behutsam auf den Rücken. Er stöhnt.
»Tut Ihnen das weh, Dr. Nikolow?«, fragt die Schwester und sieht ihm prüfend ins Gesicht. Er reagiert nicht. Liegt ganz starr.
»Heute früh hat er ›Schwester Ina‹ zu mir gesagt.« Sie zieht das Nachthemd glatt, damit sich keine Falten bilden, die das Wundliegen fördern.
»Er hat gesprochen?«
Die Schwester lächelt und nickt.
»Zu mir hat er seit vier Monaten nichts mehr gesagt.«
»Und er hat sich ganz allein seine Armbanduhr angelegt. Mit dem Verschluss musste ich ihm zwar helfen, aber immerhin.«
Sie streckt vorsichtig Papas Beine. Unter den Fersen sind mit Mullbinden kleine Kissen befestigt. Die Haut dort ist dünn wie Pergament. Das letzte Mal hat es acht Wochen gedauert, bis die offenen Stellen zugeheilt waren. Papa gibt ein leises Ächzen von sich. Sein linkes Bein ist viel kürzer und dünner als sein rechtes. Ein Kinderbein neben einem Männerbein.
Die Schwester fährt die Lehne des Bettes nach oben, bis sich Papa in einer halb liegenden, halb sitzenden Position befindet.
Ich hebe den Deckel vom Teller und augenblicklich duftet es nach Kartoffelsuppe und Maggi.
»Bitte lassen Sie etwas von der Nachspeise übrig«, bittet die Schwester, »für die Tabletten, die ich Ihrem Vater nachher gebe.« Sie verlässt das Zimmer.
Ich nehme eine Serviette aus dem Regal, eine große, aus Zellstoff, wie sie auch in Krankenhäusern benutzt werden, und lege sie Papa unters Kinn.
»Hast du Hunger, Papa? Es gibt Kartoffelsuppe.«
Kaum merklich schüttelt er den Kopf.
»Du musst aber was essen. Die Suppe riecht gut.«
Papa macht ein verdrießliches Gesicht. Hält den Mund geschlossen.
»Du musst was im Magen haben, bevor du die Tabletten nimmst!« Ich tue ein wenig Suppe auf den Löffel und halte ihn Papa unter die Nase. Er sieht mich an und öffnet leicht den Mund. Ich schiebe den Löffel hinein und achte darauf, die Suppe an der Oberlippe abzustreifen. Genauso habe ich die Kinder früher gefüttert.
Nach drei Löffeln macht Papa den Mund nicht mehr auf.
»Du bist schon satt?«
Er bewegt schwach die Lippen, haucht etwas. Ich halte mein Ohr an seinen Mund. Wieder versucht er etwas zu sagen.
»Wasser? Du möchtest trinken?« Ich nehme die Schnabeltasse und fülle Schlückchen für Schlückchen in Papas Mund.
Er isst noch drei Löffel Suppe und etwas von der Quarkspeise.
Danach fallen ihm die Augen zu.
Es klopft.
Papa schlägt die Augen wieder auf.
Die Schwester kommt herein. »Schön, dass Sie heute so viel gegessen haben, Dr. Nikolow.« Sie stellt einen kleinen Plastikbecher mit Tabletten auf den Beistelltisch. »Die gebe ich ihm später«, sagt sie und nimmt das Geschirr mit hinaus. Ihre gute Laune macht mich fertig.
Ich wische Papas Mundwinkel mit einem feuchten Lappen ab. Eigentlich könnte ich ihn jetzt rasieren. Doch warum ihn damit quälen, wenn er schlafen will.
Ich falte die Serviette zusammen und lege sie ins Regal zurück. Setze mich wieder ans Bett und nehme Papas linke Hand. Seine Finger greifen zu und halten mich fest. Die Haut, die sich über seine Knöchel spannt, sieht durchsichtig aus. Ich betrachte die vertraute Narbe in der Kerbe zwischen Daumen und Zeigefinger. Ein kleiner türkischer Halbmond. Hab’ ich dich jemals nach ihrer Geschichte gefragt, Papa?
Mein Vater hält die Augen geschlossen. Er schläft ein. Draußen auf dem Flur wird mit Geschirr geklappert, eine weibliche Stimme ruft nach der Schwester, ein Hund bellt.
Ich fürchte, der Lärm wird dich stören. Doch mein Besuch und das Essen haben dich erschöpft. Du schläfst. Deine Brauen, die du vorhin so finster zusammengezogen hattest, sind nun entspannt. Deine Züge glatt. Dein Gesicht ist ein Gesichtchen, so zart, so klein.
1
Niemand würde heute noch glauben, dass Wantschos Schädel einst das Vorbild für eine Büste von Karl Marx gewesen ist.
Es war im Frühjahr 1962 in Ost-Berlin. Die Mauer stand seit einigen Monaten und Wantscho war zufällig auf eine Künstlerfete bei Rüdiger Kalmhäuser, einem Bildhauer, geraten. Mein Vater war einunddreißig Jahre alt und arbeitete als Psychiater und Neurologe in der Nervenklinik in Bernhausen an der Saale. Seit gut zwei Jahren lebte er in Deutschland. Ihn plagte das Heimweh nach Bulgarien. Er hatte dichtes welliges Haar, von solch tiefer Schwärze, dass es bläulich schimmerte. Er bürstete es sich sorgfältig aus der Stirn. Stets war er elegant gekleidet, immer trug er Anzug und Krawatte. Da er hinkte, benutzte er beim Gehen einen Stock. Ihn begleitete eine junge Frau, ein Mädchen noch, gerade zwanzig geworden: Rose. Mein Vater hatte sein Herz an ein deutsches Mädchen aus Sachsen-Anhalt verloren, eines mit hellblondem Haar und strahlend blauen Augen. Und dieses Mädchen hatte sich bis über beide Ohren in den dunklen melancholischen Bulgaren vom Balkan verliebt, der Arzt war, eine eigene Wohnung mit Telefon und Fernseher besaß und dazu noch einen Škoda, Baujahr 1957. Eine für die damalige Zeit unvorstellbare Anhäufung von Luxusgütern!
Der Bildhauer Rüdiger Kalmhäuser wurde von allen »Rosché« gerufen. Er lehrte an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee. Rosché war ein gut aussehender, großer Mann mit schulterlangen Haaren, dicken Koteletten und wildem Blick. Er trank gern irischen Whisky, den er sich über irgendwelche Kanäle aus dem Westen beschaffte. Er war ein Schwerenöter, ein verrückter Künstler.
»Schürzenjäger!«, nannte Rose ihn, »Frauenfänger!«, und in ihren Augen lag ein Glanz, der allerdings nicht Rosché, sondern Wantscho galt. Der lachte nur. Rosché war mit Christine zusammen, die er nur »Christín« rief. Christín war ein anmutiges Wesen, duldsam, sanft und belastbar bis zur Selbstaufgabe. Eine Muse mit einem langen geflochtenen Zopf, den sie seitlich trug und der ihr bis zur schmalen Taille reichte. Rosché und Christín hatten zwei Kinder und wohnten in einem Häuschen im Grünen, im Norden von Pankow. Doch die meiste Zeit verbrachte Rosché in seinem Atelier in Prenzlauer Berg. Hier arbeitete er bis tief in die Nacht, tagsüber schlief er auf der Couch. Auch mit anderen Frauen. Irgendwann hat er Christín und die Kinder sitzen lassen und ist in den Westen abgehau’n. Er soll heute in der Nähe von Dublin leben. Wegen des Whiskys. Aber das ist vermutlich Unsinn.
Damals jedenfalls, an jenem Abend, an dem Wantscho und Rose bei Rosché und Christín zu Besuch waren, wurde wie immer bei solchen Feten gesoffen, geraucht und lauthals diskutiert, über das Leben, die Liebe und vor allem über die Politik. Als sie die erste Flasche Whisky ausgetrunken hatten, stand Christín auf und schloss das Fenster. Als die Männer die zweite Flasche Whisky zur Hälfte geleert hatten, die Frauen waren bereits auf Kaffee umgestiegen (Westkaffee!), sagte Rosché zu Wantscho: »Genosse Nikolow, ich brauche deinen Kopf!«
Wantscho sah ihn fragend an.
»Du musst mir Modell sitzen!«
»Du machst Witze.«
»Ich soll eine Büste von Marx hauen. Für ein Hochhaus am Alex. Parteiauftrag!«
»Parteiauftrag?« Wantscho runzelte die Stirn. »Was für ein Hochhaus?«
»›Haus des Lehrers‹. H – d – L! Wird gerade gebaut. Von Henselmann.«
»Du bist ja völlig besoffen«, sagte Wantscho.
»Nein, nein«, rief Rosché, »die Büste soll im Foyer stehen, wenn das Haus eingeweiht wird.« Er sprang auf, wankte hinaus, ein kurzes Poltern war zu hören – und kam mit dem großen Flurspiegel zurück. »Du hast den idealen Kopf dafür. Groß und rund. Sieh her, wie mächtig dein Schädel ist!« Er hielt Wantscho den Spiegel vor. »Genau so brauche ich es.«
»Du hast wirklich einen Quadratschädel«, sagte Rose und zerwuschelte zärtlich Wantschos sorgfältig gebürstete Haare.
»Schaut mal, jetzt sieht er tatsächlich aus wie Karl Marx«, rief Christín und alle lachten. Alle außer Rose. Christín stand auf und holte eine neue Schachtel F6. Rosché öffnete eine Flasche Rotwein, der Whisky war alle.
»Was hast du denn, Rosi?«, fragte Rosché. Er sagte absichtlich »Rosi« zu Rose, weil er sie damit zu reizen hoffte.
»Hör mir bloß auf mit Marx und dem ganzen Mist!«
»So schlecht war der gute Karl doch gar nicht«, sagte Wantscho, der damals Mitglied der Kommunistischen Partei Bulgariens war und noch an die Sache glaubte. Doch Rose konnte er nicht überzeugen. Rose mochte keine Genossen und alles, was mit Sozialismus, Kommunismus und dem ganzen politischen Kram zu tun hatte, war ihr zuwider.
»Aber Modell sitzen darf mir der Wantscho schon?«, schmeichelte Rosché. »Auch wenn es um den Kopf von Marx geht?«
Und so kam es. Mein Vater saß Modell für Rosché. Der goss zunächst die Urform der Plastik in Gips, um anschließend aus einem riesigen weißen Alabaster-Block nach dem Vorbild von meines Vaters Schädel eine mächtige Karl-Marx-Büste zu hauen. Und die stand ganze fünfunddreißig Jahre lang im »Haus des Lehrers« am Alexanderplatz in Berlin-Mitte.
Anfang der Achtzigerjahre war ich mal dort und habe sie mir angesehen. Mit einem Tagesvisum besuchte ich Ost-Berlin. Niemand hinderte mich daran, das kastenförmige Hochhaus mit dem umlaufenden Fries zu betreten. Die Büste stand im Foyer, auf einem Sockel, links vom Eingang. Sie wirkte monströs und düster zugleich. Ich ging um sie herum. Stellte mich nah vor sie hin. Ich berührte den Mund, er glich dem meines Vaters. Ich strich über die Augenbrauen, es waren die seinen. Ich befühlte das steinerne Haar. Es war dicht, wellig und aus der Stirn gekämmt. Aber die Stirn? Die war viel zu hoch. Papas Stirn ist flach. Wie die seiner Mutter. Wie meine. Wie die meines ältesten Sohnes. Ich sah Karl Marx ins Gesicht, sein Blick war starr auf etwas in weiter Ferne gerichtet. Und mir fiel wieder ein, wie mein Vater einmal, am 1. Mai 1977, auf der Ehrentribüne gestanden hatte. Wir lebten damals noch in Nordroda in Thüringen und ich, der zwölfjährige Thälmann-Pionier, marschierte mit meinen Schulkameraden an der Tribüne vorbei. Als ich meinen Vater entdeckte, hüpfte ich in die Höhe, rief nach ihm und schwenkte die Winkelemente, die ich zu tragen hatte. Doch mein Vater sah mich nicht, stand reglos und starr auf der Tribüne wie jetzt die Büste hier auf ihrem Sockel.
Ich hatte meine Kamera in der Tasche, doch traute ich mich nicht, ein Foto von der Büste zu machen. Auf einem Schild, das am Sockel angebracht war, stand: »Rüdiger Kalmhäuser (1963)«.
Was ist aus der Büste geworden? Wurde sie nach der Wende zerstört, wie so viele Denkmäler und Symbole der Diktatur? Oder hat sie jemand gerettet? Lagert sie vielleicht irgendwo in einer Scheune, in einem Keller, in einem Garten? Um irgendwann wieder hervorgeholt zu werden? Für Filmarbeiten vielleicht? Oder im Zuge einer Nostalgiewelle?
In meiner Erinnerung erscheint mir die Büste riesig, monumental und kraftvoll. Ich werde sie suchen.
Ich will dich finden, Papa!
Deine Finger umfassen noch immer meine Hand. Du atmest ruhig und gleichmäßig. Ein und aus und ein und aus. »Das Wichtigste ist, dass du Luft holst«, hattest du mir erklärt, als ich klein war und große Angst vorm tiefen Wasser hatte. »Sieh mal, so!« Und dann bist du losgeschwommen. Wie sehr hast du das Schwimmen geliebt. Und das Meer. Weil du im Wasser schwerelos warst, beweglich wie ein Fisch. Und nicht versehrt. Im Wasser war es egal, ob dein linkes Bein gesund und kräftig war oder schmächtig und verkürzt. Du warst ein hervorragender Schwimmer. Oft habe ich dich dabei beobachtet, wie du aufs offene Meer hinausgekrault bist. Gleichmäßig hast du die Arme durchs Wasser gezogen, immer viermal und dann den Kopf nach rechts gedreht, um Luft zu holen. Nichts konnte diesen Rhythmus unterbrechen. Mama und ich blieben am Strand zurück. Du schwammst so weit hinaus, dass dein Kopf bald nur noch ein kleiner schwarzer Punkt am Horizont war. Ich saß aufrecht auf dem Handtuch und guckte. Nach einer Ewigkeit kamst du zurück. Abgekämpft, aber zufrieden.
Ich kann mich an meine Gefühle kaum mehr erinnern. Habe aber noch das Bild vor Augen: Papa humpelt lächelnd auf uns zu und schüttelt seinen Schopf wie ein Hund, der das Wasser loswerden will. Sein Körpergewicht lagert auf dem gesunden rechten Bein, in der Hüfte bildet sich ein Knick, eine Hautfalte. Richtig verwegen sieht mein Vater aus. Glücklich. Ich bin stolz auf ihn. Er hat einen so wohlgeformten Oberkörper und ein so schönes rechtes Bein.
Geschwommen ist Papa nur im Sommer. Im Urlaub. Und Urlaub bedeutet für mich bis heute: Ans Meer fahren! Jeden Sommer meiner Kindheit verbrachten meine Eltern und ich am Schwarzen Meer, in Bulgarien. Dafür mussten wir zweitausend Kilometer überwinden. Von unserer Heimatstadt Nordroda, in Ostdeutschland, bis nach Lom an der Donau, wo meine Großmutter und mein Großvater, Baba Sneza und Djado Christo, wohnten. Überwinden ist das richtige Wort! Die Strecke fuhren wir mit dem Auto. Wir brauchten dafür drei Tage. In den Sechzigerjahren saßen wir in einem weißen Škoda, in den Siebzigern in einem gelben Wartburg. Ohne besonderen Fahrkomfort. Anfangs gab es noch keine Anschnallgurte, keine Nackenstützen und eine Klimaanlage schon gar nicht. Wenigstens hatte der Wartburg dann ein Radio. Immer stank es nach Benzin und nach den Zigaretten, die meine Eltern rauchten. Mir wurde oft schlecht. Die Hitze war unerträglich. Die Fenster durften beim Fahren nicht geöffnet werden, weil Papa Angst hatte, Zug zu bekommen. Wir schwitzten am Tage und froren nachts. Wir schliefen im Auto, um Geld zu sparen, irgendwo am Wegesrand. In einem Wald in der damaligen Tschechoslowakei, in der Nähe des Balatons in Ungarn, neben einem Ziehbrunnen in Rumänien, in den Bergen in Jugoslawien. Ich hinten auf der Rückbank, Mama auf dem runtergeklappten Beifahrersitz, Papa auf dem runtergeklappten Fahrersitz.
Jedes Jahr das Gleiche. Und immer wieder war es ein grandioses Abenteuer. Wir stiegen in das bis unters Wagendach vollgepackte Auto und fuhren nachts los. Rüber in die ČSSR, weiter nach Ungarn, meistens mit einer Sondergenehmigung durch das blockfreie, westlich anmutende Jugoslawien, anstatt durch das bitterarme, trostlose Rumänien, und schließlich rein nach Bulgarien. Bei Baba Sneza und Djado Christo blieben wir eine Woche und fuhren dann weiter ans Meer. Dort erholten wir uns drei lange Wochen in einem Hotel in Warna, Nessebar oder Albena. Auf der Rückreise pausierten wir noch mal ein paar Tage in Lom. Schließlich ging es wieder zurück in die DDR. So war das Jahr um Jahr, Sommer für Sommer. Wir kamen raus aus der Isolation, erlebten was, sahen andere Länder. Wer konnte das drüben schon!
Vorsichtig löse ich deine Finger von meiner Hand und stehe auf. Ich gebe dir einen Kuss auf die Wange, atme deinen unverwechselbaren Geruch und denke, wie jedes Mal in den zurückliegenden Wochen: Vielleicht zum letzten Mal.
»Ich hab’ dich lieb, Papa«, flüstere ich. »Ich komme bald wieder vorbei.«
Auf dem Flur treffe ich die Schwester.
»Entschuldigen Sie«, sagt sie, »ich möchte Sie um etwas bitten.«
Sind die Windeln schon wieder alle? Oder die Unterlagen? Die Tabletten?
»Verstehen Sie mich nicht falsch«, sagt sie und sieht mir direkt ins Gesicht. »Doch erkundigen Sie sich bitte nach einem Bestattungsinstitut und teilen Sie uns die Adresse mit.«
Ich halte die Luft an. »Jetzt schon?« Die Schwester sieht mich freundlich an. »Wir haben von allen Patienten eine solche Adresse. Nur von Ihrem Vater noch nicht.« Sie legt mir die Hand auf den Arm. »Es muss nichts bedeuten, verstehen Sie? Es ist alles möglich. Auch, dass es wieder aufwärtsgeht.«
2
Iwan Christow Nikolow, wurde an einem heißen Augusttag im Jahre 1930 in Lom geboren. Lom ist eine kleine Stadt im Nordwesten Bulgariens und liegt an der Donau. Es war eine schwere Geburt. Achtundvierzig Stunden lag meines Vaters Mutter, Majka Sneza, in den Wehen. Zwei Tage lang mühte sie sich ab, doch das Kindchen wollte und wollte nicht auf die Welt kommen. Sneza wand sich und schrie, sie weinte und betete, lag in ihrem Schweiß. Sie spürte ihre Kräfte schwinden. Als schließlich das Köpfchen zwischen ihren Beinen zum Vorschein kam, sich aber nicht weiterbewegen wollte, entschied der Arzt, das Kind mit der Zange zu holen. Wenig später erblickte ein gesunder Knabe das Licht der Welt, ein zartes feingliedriges Kerlchen mit einem tiefschwarzen, ungewöhnlich dichten Haarschopf. Seine Eltern, Sneza Ilijewa Nikolowa, geborene Petkowa, und Christo Georgiew Nikolow, waren überglücklich, dass ihnen, nach einer Tochter vor zwei Jahren, nun der ersehnte Stammhalter geschenkt worden war. Sie nannten ihren Sohn Iwan und riefen ihn, entsprechend der bulgarischen Tradition, alles nur Denkbare zu verniedlichen, Wantscho.
Sneza dankte dem Herrgott, sprach drei Vaterunser und pries den Popen Kyrill, der sie, während sie das Kind getragen hatte, bei jedem ihrer zwei täglichen Kirchenbesuche gesegnet hatte. Ihr Mann pries einfach den freundlichen Zufall, einen Jungen bekommen zu haben, und die Tatsache, dass das Haus, das er unweit des Donauufers erbaut hatte, noch vor der Geburt fertig geworden war.
Christo hatte früh gelernt, sich auf nichts anderes als auf die Realität zu verlassen. Glauben, hoffen, beten – so seine Überzeugung – brachten nichts ein. Seine Eltern, Majka Nadja und Tatko Georgi, waren einst wohlhabende Großbauern gewesen, bis sie 1920 im Zuge der Reformen des Bauernführers Alexander Stambolijski enteignet und ihre Ländereien umverteilt wurden. Alles Beten hatte damals nichts eingebracht. Christo war fünfzehn gewesen, als die Ländereien beschlagnahmt und ein Großteil des Viehs weggeführt worden waren. Nadja war schreiend zusammengebrochen, Georgi hatten die Schergen zu Pferde mit ihren Reitergerten traktiert, weil er die Ziegen nicht herausrücken wollte. Der Knecht, der ihm zu Hilfe eilte, war gar über den Haufen geritten worden und drei Tage später an seinen Verletzungen gestorben.
Bis zu diesem finsteren Tag hatte Christo ein schönes Leben gehabt. Auf den Feldern, die der Familie gehörten, waren Tabak, Sonnenblumen und Weintrauben angebaut worden. Auf den Wiesen weideten Kühe, Schafe, Ziegen und Esel. Auf dem Hof lebten Georgi und Nadja mit ihren Kindern, mit dem Gesinde, mit Hunden, Katzen, Hühnern und einem Hahn zusammen. Sie stellten Joghurt und Schafskäse her und handelten damit. Ebenso mit Eiern, Milch und Fleisch und allem, was das Getier noch zu bieten hatte. Als Großbauern beschäftigten sie Landarbeiter, die die Trauben lasen und stampften, um daraus Rakija zu brennen und Wein zu keltern. Und im Rosowa Dolina, im Tal der Rosen, besaßen sie riesige Rosenfelder. Jedes Jahr im Mai war Rosenernte und Christo liebte es, Tatko Georgi ins Rosowa Dolina zu begleiten, das windgeschützt zwischen dem Balkangebirge und der Sredna Gora lag, in dem es kilometerweit rot, weiß und rosa leuchtete, wo seit Hunderten von Jahren Rosenpflückerinnen millionenfach Rosenblüten ernteten. Der seifige Geruch, den die Blüten verströmten, hing dann über den Rosenfeldern, er haftete an der Haut, im Haar, in der Kleidung und verlor sich erst wieder Wochen nach der Ernte, wenn aus den Blüten das kostbare ätherische Rosenöl destilliert worden war.
Auch die Rosenfelder gingen der Familie verloren und wurden verstaatlicht. Christo dachte oft sehnsüchtig an die Zugfahrten zurück, die er mit Tatko Georgi ins Tal der Rosen unternommen hatte. Rosen bedeuteten für ihn Kindheit, Glück und Geborgenheit. Die Rose war das Symbol Bulgariens. Und die Frau, die Christos Sohn Wantscho eines Tages heiraten würde, sollte den Namen Rose tragen.
Christos Mutter war die Tochter einfacher Landarbeiter. Ihre Eltern hatten sich auf den Feldern wohlhabender Bauern verdingt. Nadja bereitete es nach der Enteignung, anders als Georgi, keine große Mühe, sich in ihrem neuen, nun wieder ärmlichen Leben zurechtzufinden. Ihnen wurden zehn Hektar Land zugewiesen, die sie bewirtschaften konnten. Sie begannen, Tabak anzubauen. Damit kannte Georgi sich aus. Von dem Vieh hatte man ihnen eine Kuh, zwei Ziegen und einen Esel gelassen. Es gelang, einen kleinen Weinberg am Rande von Lom hinzuzukaufen. So konnten sie ihr Überleben sichern.
Die Machthaber wechselte in den Folgejahren mehrfach: Stambolijski wurde 1923 weggeputscht und ermordet; die neue autoritäre rechtsgerichtete Regierung 1926 von einer demokratischen abgelöst; 1934 kamen diktatorische Kräfte ans Ruder, die schließlich 1936 von einer Königsdiktatur unter Zar Boris III. ersetzt wurden. Trotz dieser politischen Wechselspiele machten die jeweils neuen Regierungen kaum eine Reform rückgängig, die unter Stambolijski erzwungen worden war. Die vom Bauernbund enteigneten Großbauern hofften vergebens auf Wiedergutmachung und die Rückgabe ihrer verlorenen Besitztümer. Auch Georgi und Nadja. Aber die neuen Machthaber sorgten dafür, dass neues Weideland erschlossen und neue Felder angelegt wurden. Hin und wieder kaufte Georgi etwas Land hinzu, wenn er es sich leisten konnte, und die Familie Nikolow gelangte so zu neuem, wenn auch bescheidenem Wohlstand.
Christo brach mit der bäuerlichen Tradition und wurde Lehrer. Während des Studiums lernte er seine zukünftige Frau kennen. Sneza Ilijewa Petkowa war klein und kräftig. Ihr pechschwarzes halblanges Haar, das sie aus der Stirn kämmte, pflegte sie, wie es damals modern war, in Wellen zu legen. Sie entstammte einer bürgerlichen Familie. Der Vater betrieb eine Anwaltskanzlei in Lom, die Mutter repräsentierte und hütete das Haus. Sneza und ihre Schwester wurden streng nach griechisch-orthodoxem Glauben erzogen.
Im März 1928 heirateten Christo und Sneza. Der Brautvater willigte nur widerstrebend ein. Und auch erst nachdem seine Lieblingstochter unter Tränen angedroht hatte, sich über den Willen des Vaters hinwegzusetzen, sollte dieser nicht seine Zustimmung zur Eheschließung geben. Folglich war das Verhältnis zwischen dem jungen Paar und Snezas Eltern nicht gerade innig. Der Vater hätte sich einen Advokaten als Schwiegersohn gewünscht, oder wenigstens einen Kaufmann oder Gelehrten. Und die Mutter rümpfte die Nase über die angeheiratete bäuerliche Verwandtschaft, die noch dazu verarmt war. Sie hielt sich für überaus kultiviert und alles Bäurische war ihr zuwider. Die Tatsache, dass Christo kein einfacher Bauer, sondern Lehrer war, wie ihre Tochter auch, übersah sie geflissentlich.
Das junge Paar zog zu Christos Eltern auf den Hof. Der knurrige alte Georgi mochte seine Schwiegertochter, die zupacken konnte und sich auf ihre Herkunft nichts einbildete. Auch Nadja hatte an Sneza nichts auszusetzen. Und als anderthalb Jahre später Girgina, zärtlich Gintsche genannt, zur Welt kam, passte Baba Nadja tagsüber auf ihr Enkelchen auf, während Christo und Sneza an der Schule im benachbarten Dorf unterrichteten.
Als Georgi wenig später starb, war Sneza erneut schwanger und Christo hatte begonnen, nahe des Donauufers ein Haus zu bauen. Keine Hütte aus Holz, Lehm und Stroh, sondern ein stabiles Haus aus Backsteinen und mit richtigen Ziegeln auf dem Dach. Zwei Zimmer sollte es haben, eine Küche, ein Badezimmer und sogar einen Keller. Als Wantscho auf die Welt kam, wohnte die Familie bereits in dem neuen Haus. Nadja verkaufte Hof und Land und zog zu ihren Kindern. Nur der kleine Weinberg blieb in ihrem Besitz.
Vor dem Haus lag ein kleiner Garten, dahinter ein großer. Hier führte Christo in seiner Freizeit seine bäuerliche Tradition fort. Im Vorgarten zog er Rosen, allerdings mehr zur Zierde. Und im großen Garten gediehen Apfel-, Kirsch- und Pflaumenbäume, in Gemüsebeeten reiften Auberginen und Zucchini, Tomaten und Bohnen, Paprika und Kräuter, der Garten war Christos ganzer Stolz. Um das Haus herum scharrten und pickten Hühner, die nach und nach im Suppentopf oder im Küchenherd landeten, an dem die Frauen die köstlichsten Gerichte zubereiteten. Das Federvieh war oft betrunken und daher leicht mit der Hand zu fangen. Ein Brauereibetrieb lag nicht weit entfernt oben auf dem Berg, und täglich sickerten Rinnsale von Gerstensaft die Straße hinab. Nicht nur die Hühner waren verrückt danach, sondern auch Hunde, Katzen und Vögel. Für die Menschen hier war es alltäglich, betrunkene Tiere auf der Straße umhertorkeln zu sehen, die schließlich irgendwo im Schatten ihren Rausch ausschliefen.
Nur Marco, der Esel, nicht. Er wohnte in einem Holzverschlag hinter dem Haus. Allein hinaus durfte er nicht, er war ein kostbarer Besitz. Allmorgendlich spannte Christo ihn vor den Karren und ließ sich und Sneza ins benachbarte Örtchen bringen, wo die beiden die Dorfkinder in Bulgarisch und Mathematik unterrichteten.
An den Wochenenden fuhr Christo hinaus, um den Weinberg zu bewirtschaften. Aus den roten Trauben kelterte er nach der Ernte im Herbst Wein und Most, aus den weißen brannte er Rakij.
Oft ging er mit Sneza und den Kindern an die Donau. Die Sommer in Lom waren trocken und heiß, das Thermometer kletterte bis auf 40° C. Sie badeten oder saßen im Schatten der Trauerweiden und sahen aufs Wasser, das träge dahinfloss. Auf der anderen Uferseite, die stark bewaldet war, lag Rumänien.
Die Winter hingegen waren eisig und streng. Es konnte bis zu minus 30° C kalt werden. Sobald die Donau zugefroren war, spazierten sie auf dem Eis entlang. Manchmal sahen sie im Ufernebel Wölfe, die aus Rumänien über den zugefrorenen Fluss kamen, in den Nächten war ihr Heulen zu hören.
Als Wantscho noch ein Baby war, hob Baba Nadja ihn oft aus der Wiege und setzte ihn sich auf den Schoß. Mit dem Handteller massierte sie kreisförmig die Schädeldecke des Kleinen, dessen Kopf nach der Zangengeburt die Form eines Eies hatte. Sie hoffte, dass sich dies ändern würde, wenn sie nur lange genug mit sanftem Druck die Fontanelle des Köpfchens reiben würde. Beschwörend murmelte und sang sie vor sich hin: »Babina kuklitschka, Großmutters Püppchen, bekommt ein schönes rundes Köpfchen.« Stundenlang ging das so. Klein-Wantscho schien es zu genießen. Jedenfalls schrie er nicht, sondern schlief meist dabei ein. Baba Nadja wollte den Eierkopf ihres Enkelchens noch vor der griechisch-orthodoxen Taufe in einen Rundkopf verwandeln. Und bekanntlich wurde Wantschos Schädel groß, rund und Modell für eine mächtige Karl-Marx-Büste.
Im Februar 1932 begann Nadja wie jedes Jahr, Martenizi herzustellen, jene kleinen Glücksbringer, die in Bulgarien zum 1. März verschenkt werden. Sie bestehen aus einer weißen und einer roten Quaste, die durch eine rot-weiße Kordel miteinander verbunden sind. Es ist Brauch, sie so lange zu tragen, bis der erste Storch oder die erste Schwalbe gesichtet werden. Erst danach darf der Glücksbringer an einen Baum gebunden und sich etwas gewünscht werden. An jedem befestigte Nadja eine blaue Glasperle, die vor dem »bösen Blick« schützen sollte. Das Rot der Martenizi symbolisiert im Volksglauben Liebe, Sonne, Gesundheit und Kraft; Weiß steht für Reinheit, Unschuld, Fruchtbarkeit und ein langes Leben.
Am frühen Morgen des ersten Märztages, noch bevor die Sonne aufging, steckte Nadja erst Christo und Sneza, dann Gintsche und Wantscho eine Marteniza an den Kragen und beglückwünschte sie alle zum Frühlingsanfang. Da hatte die kleine Gintsche schon Fieber und rote Pusteln im Gesicht. Es grassierten die Masern. Viele waren schon daran gestorben. Eine Impfung gab es damals nicht.
Wantscho wurde in ein anderes Zimmer gebracht, damit er sich nicht ansteckte. Christo wich nicht vom Bett seiner Tochter. Sneza betete unablässig und Nadja suchte rote Kleidungsstücke von Gintsche heraus, ein Kleid, einen Rock, eine Bluse, um sie mit weiteren roten Tüchern draußen in die Sonne zu hängen. Der Aberglaube besagte, dass die Sonne die Kleider mit Energie anreichern und somit heilende Wirkung für denjenigen haben würde, der sie trug. Außerdem hieß es, sie würden böse Geister abschrecken. Doch weder die Martenizi noch die roten Kleider konnten der kleinen Gintsche helfen. Sie starb an einem Montag, genau in dem Augenblick, als ihre Eltern auf dem Eselskarren von der Arbeit nach Hause kamen und am Himmel den ersten Storch sahen. Er flog in Richtung Donau. Christo und Sneza deuteten dies als Zeichen der Hoffnung, lösten schnell die Martenizi, er vom Hemdkragen, sie von der Bluse, liefen in den Garten und hängten sie an einen Kirschbaum. Als sie kurz darauf ans Bett ihrer Tochter kamen, war diese bereits tot. Gestorben kurz vor ihrem dritten Geburtstag. Der Storch hatte die Seele des kleinen Mädchens mit sich genommen. Christo war stumm vor Schmerz, die Frauen weinten und wehklagten, dass es viele Straßen weit zu hören war. Und alle drei waren verrückt vor Angst um den Sohn. Gerade mal acht Monate alt, spürte er doch mit der Feinfühligkeit eines kleinen Kindes sehr genau, dass etwas Schlimmes passiert war. Richtig verstehen konnte er es freilich nicht. Doch er fühlte die Angst und weinte viel in dieser Zeit.
Als wäre nicht genug Unglück über die Familie gekommen, erkrankte auch Wantscho ein halbes Jahr später schwer. Eines Morgens wachte Sneza auf und wunderte sich, dass ihr Söhnchen nicht wie sonst nach ihr rief. Sie eilte zu seinem Bett und fand den Kleinen reglos und still. Mit großen Augen sah er seine Majka ängstlich und fragend an. Sneza hob ihn hoch und bemerkte, dass seine Beinchen sich nicht wie sonst um ihre Taille schlossen, sondern kraftlos herabhingen. Die Furcht griff wie eine Kralle aus Eis nach Snezas Herz und presste es zusammen. Voller Panik rief sie nach Christo. Der spannte in Windeseile Marco vor den Eselskarren. Sie fuhren ins Spital.
Der Arzt diagnostizierte Kinderlähmung. Wantscho war nicht mehr in der Lage, seine Beine, die noch nicht das Laufen gelernt hatten, zu bewegen. Die Lähmung ging vorüber. Doch dann bekam Wantscho hohes Fieber und eine Hirnhautentzündung. Sneza war mit ihren Kräften am Ende. Sie fand auch keinen Trost mehr im Gebet. Der Herrgott hatte sie im Stich gelassen. Tag und Nacht wachte sie am Bett ihres Kindes und beobachtete jeden seiner Atemzüge. Christo war nicht ansprechbar. Insgeheim fragte er sich, wofür er so bestraft wurde. Was hatte er falsch gemacht? Warum passierte das ausgerechnet ihm? Er schleppte sich zur Arbeit und war zugleich erleichtert, dem Krankenhaus, in dem es nach Blut, Schweiß und Sterben roch, zu entkommen. Baba Nadja schwor sich, erst wieder etwas zu essen, wenn ihr babina kuklitschka gesund würde. Sollte ihr geliebtes Püppchen sterben, so wollte auch sie nicht mehr leben. Täglich lief sie in die Kirche, entzündete Kerzen und betete, betete, betete.
Nach zwei Tagen fiel das Fieber und die Lähmung kam zurück. Sie setzte sich im linken Bein fest. Der Arzt sagte, dass das Kind niemals »normal« auf beiden Füßen würde stehen können, dass es dazu verurteilt sei, ein Leben lang zu hinken, dass es niemals würde rennen, tanzen und springen können. Es war für alle ein Schock. Sneza hörte nicht auf zu weinen, Nadja versank im Gebet und in Christos Leben hielt ein Gefühl Einzug, das ihm bisher fremd gewesen war: der Groll. Ein anderer Arzt sagte, sie sollten die Hoffnung nicht aufgeben, man müsse abwarten, wie sich das kranke Bein entwickeln würde. Es würde wahrscheinlich schmächtiger und kürzer bleiben als das gesunde, weil das Kind sich im Wachstum befände. Man müsse das Bein beobachten.
Und Christo beobachtete es. Mit Argusaugen. Tag für Tag. Und je größer sein Sohn wurde, umso mehr wuchs auch sein Groll.
Wantscho überstand die Hirnhautentzündung unbeschadet. Er, der vor der Krankheit bereits krabbeln konnte, lernte von Neuem, sich auf allen vieren vorwärtszubewegen. Geschickt vermied er, das geschwächte Bein zu belasten. Schon bald vermochte er, sich am Tisch, am Stuhl oder am Sofa hochzuziehen. Er richtete sich auf, stand auf beiden Fußsohlen und sah sich voller Stolz um. Baba Nadja klatschte vor Entzücken in die Hände. Sneza weinte vor Glück und übersäte ihr Söhnchen mit Küssen. Alles würde gut werden! Nur Christo traute der Freude nicht, die sein Herz wärmen wollte, der Groll war stärker und prophezeite: Der Kleine streckt sich, doch das kranke Bein bleibt kurz!
Nadja nähte für ihr Püppchen lederne Opanken. In den vorn spitz zulaufenden Schuhen hatte das Kind guten Halt. Sie hielt ihn an den Händchen und führte ihn hierhin und dorthin. Tip machte er mit dem gesunden Beinchen, tap mit dem kranken. Tip, tap, tip, tap. Beim Tap kippte Wantscho anfangs bedrohlich weit nach links und wäre gefallen, hätte ihn die Großmutter nicht festgehalten. Doch es dauerte nicht lange und er humpelte allein umher. Er brauchte keine Krücke, keine Beinschiene, keine orthopädischen Schuhe. Er war gehbehindert, doch er war beweglich und wendig. Eigentlich hatte er doch Glück gehabt. Tausende waren an der Kinderlähmung gestorben, Tausende hatte die grausame Krankheit, gegen die es kein Mittel gab, zu Krüppeln gemacht, doch er, Wantscho, konnte gehen!
Wantscho war vier Jahre alt, als Welina, genannt Lina, geboren wurde. Bis dahin hatte er bei den Eltern geschlafen, nun musste er in das Zimmer nebenan weichen, in dem Nadja sich eingerichtet hatte. Da sie des Nachts laut schnarchte, wollte sie mit dem Kleinen nicht in einem Raum liegen. So schlief Nadja Nacht für Nacht, in Bulgarien nicht unüblich, in der Küche auf dem Sofa.
Je größer Wantscho wurde, umso kürzer und schmächtiger blieb sein linkes Bein. Das Kind entwickelte einen Hängefuß und konnte bald nur mehr auf der linken Zehenspitze auftreten. Christo stellte seinen Sohn immer wieder Ärzten vor. In Lom, in Montana, in Berkowiza. Der Tenor war immer der gleiche: Das Gebrechen sei inoperabel.
Als er eines Tages hörte, dass am Orthopädischen Krankenhaus in Sofia angeblich ein außergewöhnlich erfolgreicher Chirurg praktizierte, setzte er sich mit seinem Sohn kurz entschlossen in die Eisenbahn und reiste in die Hauptstadt. Zu diesem Zeitpunkt war Wantscho fünf Jahre alt. Der Sofioter Chirurg machte Christo Hoffnung. Er riet zu diversen Eingriffen, um den Hängefuß so zu behandeln, dass der Kleine auf der Sohle laufen könnte. Außerdem riet er dazu, das Bein zu richten, sobald der Knabe achtzehn Jahre alt und sein körperliches Wachstum abgeschlossen sei.
Dreimal wurde Wantscho operiert. Danach konnte er mit der linken Fußsohle auftreten, obwohl er dabei immer noch hinkte.
Christo setzte all seine Hoffnung auf die große Operation, die seinen Sohn befähigen würde, wie ein normaler Mensch zu gehen und zu laufen.
Majka Sneza liebte ihr Söhnchen abgöttisch und verzog es mit zärtlicher Inkonsequenz. Auch Baba Nadja verwöhnte ihr Enkelchen. Tatko Christo hingegen war sehr streng mit Wantscho. Er verlangte absoluten Gehorsam und duldete keinerlei Widerspruch. Dabei zog er stets den Sohn der Tochter gegenüber vor. Es bestand kein Zweifel daran, dass für ihn ein Junge mehr galt als ein Mädchen.
Wann immer Wantscho niedergeschlagen war oder Kummer hatte, trösteten die Frauen ihn mit Essen und Trinken. Wantscho liebte es, bei den Frauen in der Küche zu sitzen. Hier war es gemütlich. Hier war er sicher. Sneza servierte ihm eine Tasse heiße Milch mit Bienenhonig, die er so gern mochte und von der er, sobald sie etwas abgekühlt war, die Haut fischte, um sie sich in den Mund zu stecken. Die Frauen ließen ihn vom selbst gemachten Sirup naschen, von Kompotten und Marmeladen, die mit Kirschen schmeckte ihm am besten. Sie tischten Cremetorten, süßes Gebäck und Honigspeisen wie Baklawa und Halwa auf. Wäre es nach Wantscho gegangen, so hätte er sich ausschließlich von Süßem ernährt. Doch die Frauen fütterten ihn auch mit all den herzhaften Gerichten, die sie Tag für Tag zubereiteten: gefüllte Paprikaschoten, Hühnchen mit Reis, Rippchen mit Sauerkraut oder Bohnensuppe.
Wantscho hing sehr an seiner Mutter. Er brachte sie in Verbindung mit wohlschmeckender Süße, milder Wärme, Weichheit und Güte. Ihr musste er nichts beweisen. Sie liebte ihn, wie er war. Ob er nun humpelte oder nicht. Aber Tatko Christo machte es dem Kind schwer. Laufend musste es sich dessen Anerkennung erkämpfen. Nie war etwas gut genug: Die Hände nicht sauber genug gewaschen, das Huhn nicht gut genug gerupft, der Weg nicht ordentlich genug geharkt. Manchmal setzte es auch Schläge. Christo war nicht imstande, seinen Sohn zu stärken. Er machte ihn klein. Sneza versuchte, dies auszugleichen. Immer war sie bemüht, Wantscho seinen körperlichen »Defekt« vergessen zu lassen, sein Selbstbewusstsein zu fördern.
In der Schule wurde Wantscho von seinen Eltern unterrichtet. Schnell entwickelte er sich zum Klassenprimus. Auf seinen Zeugnissen häufte sich die Note 6, in Bulgarien die beste Zensur, wie bei keinem anderen Kind. Da er ohnehin nicht in der Lage war, mit den anderen zu toben, Ball oder Verstecken zu spielen, lernte und las er viel. Trotzdem war Wantscho beliebt. Er hatte Freunde. Sein bester Kamerad, sein Batko, hieß Atanas Borissow Trokow und war zwei Jahre älter. Atanas war der Sohn jüdischer Eltern, die eine Schäferei betrieben, und wohnte nur wenige Straßen entfernt. Er wurde Nasco gerufen und war größer und kräftiger als die anderen Knaben seines Alters. Nasco und Wantscho wurden unzertrennlich und hingen mit inniger Zuneigung aneinander.
Als Wantscho sieben Jahre alt wurde, kaufte Christo seinem Sohn den ersten Gehstock aus Holz. Und jeweils im Frühling eines jeden Jahres fuhren Vater und Sohn nach Sofia in die Orthopädische Klinik. Christo gab viel Geld für die Behandlung aus. Er wollte nichts unversucht lassen, um seinem Sohn ein normales Leben zu ermöglichen. Dahinter stand, dass er den körperlichen Makel nicht akzeptieren konnte. Wie ein Stachel saß er in seinem Fleisch. Die Behinderung seines Kindes war ihm peinlich. Er schämte sich, wenn sein Junge neben ihm herhinkte. Wantscho spürte das und es machte ihn unglücklich. Doch er sprach nie darüber. Er verschloss dieses Leid tief in seinem Herzen.
Ich habe kein einziges Kinder-Foto gefunden, auf dem mein Vater lacht. Nicht ein Bild gibt es, auf dem er ausgelassen und fröhlich ist. Auf einem ist er etwa vier Jahre alt. Er sitzt zwischen Sneza und Christo auf einer Bank. Wie eingekeilt. Im hellen Kleid mit weißem Kragen und dunkler Jacke die Mutter, im feinen Zwirn, mit langem Mantel und Krawatte der Vater. Das Kind trägt einen dunklen Anzug, umklammert einen Stab, an dessen Ende ein Holzwägelchen befestigt ist, das es hinter sich herziehen kann. Vater und Mutter schauen ernst und würdevoll in die Kamera. Das Kind wirkt angespannt. Es sitzt mit hochgezogenen Schultern da, seine Füße reichen noch nicht bis zur Erde hinab, der Blick ist zur Seite gehuscht. Ein Sonntagsbild.
Ein anderes Foto: Die Familie am Fuße einer steinernen Treppe. Die Mutter im selben hellen Kleid, an das dieses Mal ein dunkler Kragen geknöpft ist. Neben ihr, auf der nächsthöheren Stufe, Wantscho, sechs Jahre alt, kurz geschoren, eine Hand in der Hosentasche. Er trägt eine dicke Strumpfhose, darüber eine kurze Hose und eine Anzugjacke. Das linke Bein streckt er ein wenig nach vorn. Es ist jedoch nicht zu erkennen, dass es kürzer ist als das rechte. Auf der obersten Stufe der Vater. Dunkle Hose, helle Anzugjacke, weißes Hemd. Er hält die kleine Lina an der Hand, die wie ihr Bruder kurz geschoren ist. Sie steckt in einem weißen Kleidchen. Im Hintergrund eine prachtvolle Agave, die ihre fleischigen, an den Rändern gezackten Blätter in den Himmel reckt. Auch hier: kein Lächeln in den Gesichtern. Ziemte es sich damals nicht, auf Fotos zu lachen?
Eine weitere Aufnahme. Irgendwo auf dem Land. Christo zwischen seinen Kindern, mit geschultertem Gewehr und Patronengurt um die Taille. Mit der Linken hält er einen Fuchs an den Hinterläufen. Der buschige Schwanz hängt ebenso nach unten wie der Kopf, die Schnauze berührt den Staub. Christo im Anzug mit einem blütenweißen Hemd. Hat er den Fuchs erlegt? Im Hintergrund ein einfaches flaches Lehmhaus, dessen Dach ordentlich mit Schindeln gedeckt ist. Auf der Veranda ein Backofen und Schnüre, an denen gebündelte rote Paprikaschoten und Zwiebeln hängen. Ein lädierter Lattenzaun, dahinter ein spitz zulaufender Heuberg. Rechts neben Christo steht Klein-Lina im blütenweißen Kleidchen und mit kinnlangem Haar. Links vor ihm, jedoch drei Schritte entfernt: Wantscho. Eine Schülermütze auf dem kahlen Kopf. Er sieht aus, als habe er Haltung angenommen. Hände an die Hosennaht, Brust raus! Steh wenigstens gerade, wenn du schon nicht laufen kannst! Zu seinen Füßen ein Jagdhund, der sich an seine Wade schmiegt. Und hier ist es zu sehen: Wantscho steht schief. Sein Gewicht lagert auf dem gesunden rechten Bein, um das linke zu schonen. Ohnehin würde es ihn nicht tragen. Seine kurze Stoffhose wird von Hosenträgern gehalten und bedeckt die Knie. Das kurzärmelige Hemd ist kariert. Wantschos Blick ist fast feindselig. Hat der Vater ihn nicht zum Jagen mitgenommen? Musste er bei den Frauen auf seine Rückkehr warten?
Und dann sind da noch die Klassenfotos aus der Grundschule. Mein Vater, der Achtjährige, inmitten von vierzig anderen Kindern, auf dem Rasen, im Schatten einer mächtigen Platane. Auf dem einen Bild thront über allen die Lehrerin: Sneza; auf dem anderen der Lehrer: Christo.
Auf diesen Fotos wirkt Wantscho selbstbewusster als in früheren Jahren. Sein Blick ist zwar auch ernst, doch zugleich geradlinig, keck und unternehmungslustig. Auf dem einen Bild kniet er mit einigen anderen Schülern in der ersten Reihe. Die Schülermütze auf dem Knie. Das andere Bild zeigt ihn inmitten der anderen sitzend, ein unmerkliches Lächeln im Gesicht.
Zum achten Geburtstag bekam Wantscho von Majka und Tatko eine Geige geschenkt. Der Musiklehrer der Schule hatte Christo und Sneza darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Sohn besonders musikalisch sei. Christo bestellte einen Geigenlehrer namens Angel. Angel war von der außerordentlichen Begabung des Kindes entzückt. Wantscho liebte Musik. Sie bedeutete ihm sehr viel. Und er liebte es zu musizieren. Bereitwillig übte er in jeder freien Minute, machte beharrlich Fingerübungen und strich ausdauernd mit dem Bogen über die vier Saiten, um die richtigen Tönen hervorzulocken. Insgeheim bewunderte er die Zigeuner, die die Geige so virtuos zu spielen verstanden. Wantscho wusste, das Tatko Christo das fahrende Volk von ganzem Herzen hasste. Fast noch mehr als die Türken, die Bulgarien über fünfhundert Jahre lang unterjocht hatten. Zigeuner waren für Christo dreckiges Pack. Parasiten, die alles klauten, was ihnen unter die Finger kam. Vor denen er das Haus verschloss, als würden sie die Pest bringen. Wenn die Zigeuner durch die Straßen zogen, war ihre Musik schon von Weitem zu hören: die Geige, der Schellenkranz, der Kaval, ein kehliger weiblicher Gesang. Dann humpelte Wantscho heimlich zum Fenster, löste, sachte, sachte, ein Stückchen des weißen Seidenpapiers, das sommers vor den Scheiben klebte, um die große Hitze ein wenig abzuhalten, und spähte hinaus. Er wunderte sich, dass die Zigeuner stets fröhlich waren, obwohl sie in einer erbärmlichen Armut lebten, die sie zum Betteln und Hausieren zwang. Er sah den alten Zigeuner mit dem wettergegerbten Gesicht, der die Schar anführte, barfüßig, eine Geige unterm Kinn, der trotz der unerträglichen Hitze einen Mantel aus Katzenfellen übergeworfen hatte. Er sah die Männer, die ihm folgten, zwei Geigen, ein Schellenkranz, ein Kaval. Er sah die Frauen in ihren bunten Röcken, mit den langen schwarzen Haaren und den klimpernden goldenen Armreifen. Einige von ihnen zogen Handkarren, auf denen sich ihr Hab und Gut befand. Er sah die Kinder in löchrigen Hosen und Kleidern, mit schmutzigen Gesichtern. Sie balgten sich, tobten umher, spielten Fangen. Sie waren fröhlich und wild. Wantscho presste die Nase an die Scheibe, um besser sehen zu können. Die Zigeunerkinder hatten etwas, das er nicht hatte. Etwas, das ihm fehlte. Und mit einem Mal begriff er, dass diese Kinder im Gegensatz zu ihm frei waren. Frei wie die Vögel im Wind. So frei, wie er selbst, der achtjährige Junge mit dem geordneten Leben und dem kaputten Bein, niemals sein würde.
Wantscho begann, die Weisen der Zigeuner auf seiner Geige nachzuspielen. Immer dann, wenn er sicher sein konnte, dass Tatko Christo nicht zu Hause war. Er spürte keinen Hass auf die Zigeuner. Warum auch? Sie hatten ihm nichts getan.
Wenn Wantscho Geige übte, lehnte er sich mit der Hüfte an das abgewetzte Sofa in der Küche, auf dem nachts Baba Nadja schlief. So konnte er lange Zeit problemlos stehen und das Gleichgewicht halten. Angel führte ihn an Komponisten heran, von denen Wantscho vorher noch nie etwas gehört hatte. Bald schon spielte er Stücke von Brahms, Mozart und Schubert. Hatte Wantscho ein Stück einmal gespielt, brauchte er keine Noten mehr. Angel sagte zu Christo, sein Sohn habe das absolute Gehör, und er empfahl, den Jungen am Konservatorium anzumelden. Doch Christo wollte davon nichts wissen.
Wantschos Geigenspiel wurde mit der Zeit so virtuos, dass er bei jeder Schulfeier auf der Bühne stand, um vorzuspielen. Außerdem fragten Verwandte, Freunde und Nachbarn an, ob das Kind nicht bei einem Geburtstag, einem Namenstag, einer Taufe spielen könne. Wantscho tat es gern.
Mit zehn Jahren wechselte Wantscho auf das Gymnasium. Seine schulischen Leistungen blieben ausgezeichnet.
Mit zwölf Jahren fasste er sich ein Herz und ließ seine Familie eines Abends wissen, es sei sein sehnlichster Wunsch, Dirigent zu werden. Nein, nicht erster Geiger. Dirigent! Davon träumte er: Vor einem Orchester am Pult stehen, im Zentrum der Aufmerksamkeit, gestenreich mit dem Taktstock die Musiker dirigieren, die jeder seiner Regungen, jedem Wink folgten. Die Musik, die dieser Klangkörper erzeugte, würde durch ihn hindurchdringen, ihn durchlässig machen und unversehrt. Dirigent zu sein, so dachte er, sei das Größte. Das Wahrhaftigste. Es war sein großer Lebenstraum.
»Dirigent!«, bekräftigte Wantscho noch einmal. »Lieber noch als erster Geiger.«
Nadja wischte sich die Augen. Sneza lächelte stolz. Lina klatschte in die Hände. Christo musterte ihn. »So einer wie du«, sagte er dann und wies auf das kaputte Bein seines Sohnes, »kann nicht auf einer Bühne stehen und dirigieren.«
Wantscho erstarrte. Ihm war, als würde etwas in ihm zerbrechen. Etwas sehr Kostbares. Etwas, das hier und jetzt unwiederbringlich verloren ging. Für immer. Die Worte des Vaters nahmen ihm die Luft zum Atmen. Alle Energie entwich aus ihm. Wertlos!, hämmerte es hinter seiner Stirn. Wertlos!
Als Christo bemerkte, wie sehr er seinen Sohn getroffen hatte, fügte er hinzu: »Vielleicht nach der großen Operation. Wenn du richtig laufen und gerade stehen kannst.«
Wantscho wendete sich ab und humpelte hinaus. Sneza folgte ihm. Lina fing zu weinen an und Baba Nadja ergoss eine wüste Schimpftirade über ihren Sohn. Doch Christo zuckte nur mit den Achseln, war sich keiner Schuld bewusst.
Von diesem Tag an rührte Wantscho nie wieder eine Geige an. Er zerriss alle Fotos, auf denen er Geige spielend zu sehen war. Die Mutter weinte. Der Vater schwieg. Wie so oft. Es war ein vernichtendes Schweigen.
3
Draußen in der Welt herrschte Krieg. Hitler wütete in Europa. Sofia war im März 1941 nach langem Zögern schließlich doch dem Dreimächtepakt beigetreten. Deutschland war im Zuge des Balkanfeldzuges in Bulgarien einmarschiert und hatte Jugoslawien und Griechenland überfallen. Die große Mehrheit der Bulgaren begrüßte den Einmarsch der Deutschen enthusiastisch. Denn Hitler hatte ihnen 1940, scheinbar völlig uneigennützig, die südliche Dobrudscha »zurückgeschenkt«, eine Landschaft im Nordosten am Schwarzen Meer, die Bulgarien nach dem Zweiten Balkankrieg als Wiedergutmachung an Rumänien hatte abgeben müssen. Seit Hitler Rumänien gezwungen hatte, die Landschaft wieder herauszurücken, galt er als Beschützer und Heilsbringer, denn die Bulgaren konnten nun endlich wieder ihren Traum vom Großbulgarischen Reich träumen. Als sie 1941 als Dank für den Beitritt zum Dreimächtepakt auch noch das westliche Thrakien und große Teile Makedoniens »geschenkt« bekamen, fand die Begeisterung für die Deutschen kein Ende. Die Bulgaren befanden sich im Glückstaumel. Sie wollten nicht sehen, mit wem sie sich da eingelassen hatten. Der Preis war der Verlust ihrer Neutralität. Das Land befand sich wieder im Krieg.
Auch Christo hielt viel von den braunen Machthabern, die in der Welt wahre Wunder vollbrachten. Sie hatten dafür gesorgt, dass Bulgarien wieder ein Gesicht bekam, nachdem es nach den Balkankriegen und dem Ersten Weltkrieg so verstümmelt worden war. Christo war ein glühender Nationalist. Die Kommunisten lehnte er ab. Er konnte sehr gut damit leben, dass Zar Boris III. das Land regierte.
Die Ideologie der Nazis war Christo, wie fast allen Bulgaren, einerlei. Kaum einer hatte Mein Kampf gelesen. Vor solchen Termini wie »slawischer Untermensch« oder »lebensunwertes Leben« verschloss Christo, wie die überwiegende Mehrheit seiner Landsleute, konsequent Auge und Ohr. Und was die Nazis über die Juden verbreiteten, war doch nicht ernst zu nehmen. Christo hatte nichts gegen Juden. Er hatte jüdische Freunde, Kollegen, Schüler. Und bei aller Deutschfreundlichkeit fand er es richtig, dass sich sein Land der Deportation der bulgarischen Juden widersetzt hatte. Juden waren doch keine Zigeuner! Würden die Deutschen es jedoch schaffen, die Welt von Zigeunern, Türken und Kommunisten zu befreien, Christo hätte dagegen keinerlei Einwände.
Während all der Jahre wartete Christo unbeirrt darauf, dass Wantschos Bein doch noch vollständig korrigiert werden könnte. Wenn erst der Krieg zu Ende ist, dachte er jeden Tag, und hoffte, dass der Chirurg und die Orthopädische Klinik die Bombardierung Sofias heil überstanden haben mochten! Falls nicht, so würde er nach Deutschland reisen. In Berlin praktizierte ein berühmter Chirurg namens Sauerbruch. In der Zeitung hatte Christo von ihm gelesen.
Bisher waren an Wantschos Bein sieben Eingriffe vorgenommen worden. Zwei im Krankenhaus in Lom, fünf weitere in der Uniklinik in Sofia. Immer hatte Christo zu seinem Sohn gesagt: »Ich will nur dein Bestes.« Doch sensibel, wie das Kind war, spürte es, dass der Vater log. Nicht nur seinen Sohn log er an, auch sich selbst. Denn in Wirklichkeit wollte Christo nur sein eigenes Bestes. Er wollte, dass sein Sohn gefälligst normal sein sollte und kein Krüppel. Lieber schlechte Noten, aber dafür normal! Das Kind wusste, dass der Vater es nicht so annehmen konnte, wie es war. Das betrübte Wantscho so tief, dass er phasenweise sehr melancholisch wurde. Dann verwandelte sich der sonst so gesellige Junge, der trotz seines Gebrechens gern mit anderen Kindern spielte, in einen einsilbigen Burschen, der jeden Kontakt scheute. Nicht einmal seine geliebte Majka vermochte ihn dann aufzumuntern. An solchen Tagen stand Wantscho auf, aß, ging zur Schule, lernte, ging schlafen. Doch wirkte er dabei abwesend und sprach kaum ein Wort. Solange er noch Geige gespielt hatte, war dies sein Trost und seine Zuflucht, seine große Leidenschaft gewesen. Eine andere hatte er nicht. Und nachdem sie ihm abhandengekommen war, fühlte er sich oft, als sei ihm das Liebste genommen. Er verbrachte viele Stunden an der Donau. Er saß im Schatten der Weiden und starrte aufs Wasser. Der Einzige, der sich ihm nähern durfte, war sein Batko Nasco. Der hockte sich neben ihn, holte Tabak aus dem ledernen Beutel, den er stets am Gürtel trug, und begann, seine Pfeife zu stopfen. Abwechselnd rauchten die Jungen. Sie brauchten nicht miteinander zu reden. Sie verstanden sich ohne Worte.
Während solcher melancholischer Phasen kam es auch vor, dass Wantscho das Haus gar nicht mehr verließ, mit Lina spielte, der Mutter in der Küche half oder sich um die Tiere kümmerte. Er fütterte Marco, den Esel, und bürstete ihm das Fell. Er streute den Hühnern Körner hin, er lobte die Katze, wenn sie ihm einen gerissenen Vogel oder eine tote Maus vor die Füße legte. Die Füße. Er hasste sein zu kurzes Bein und er hasste seinen verformten Fuß. Niemals würde er sich damit versöhnen. Dabei lief er am Stock behände und flink. Nach dem einfachen Holzstock hatte der Vater nun einen höhenverstellbaren Gehstock aus Metall anfertigen lassen, der noch dazu über einen anatomischen Handgriff verfügte. Er war leicht und unzerbrechlich. Über das untere Ende war ein schwarzer Gummipfropfen gestülpt, so konnte der Stock auf glatter Fläche nicht wegrutschen. Von Zeit zu Zeit musste der abgenutzte Pfropfen gegen einen neuen ausgetauscht werden.
Im September 1944 marschierte die Rote Armee in Bulgarien ein. Sie wurden von der Bevölkerung genauso begeistert begrüßt wie die Deutschen drei Jahre zuvor. Durch einen Staatsstreich kamen die Kommunisten an die Macht. Tausende Bulgaren wandelten sich über Nacht zu Anhängern der neuen Bewegung und traten in die Kommunistische Partei ein. Christo war schockiert. Wantscho hingegen fand es spannend, wohl auch aus Opposition zum Vater. Zum ersten Mal tat der Sohn etwas gegen den Willen des Vaters. Er wurde Mitglied im bulgarischen Komsomol. Und er verschlang die Werke der kommunistischen Denker. Besonders begeisterte ihn Das Kapital von Karl Marx. Stundenlang diskutierte er mit Nasco und den Freunden über »Politische Ökonomie«, »Historischen und Dialektischen Materialismus« und die »Wissenschaftlichkeit des Sozialismus«. Er beeindruckte mit Textstellen, die er auswendig auf Deutsch wiedergab. »Das Sein bestimmt das Bewusstsein.« »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt drauf an, sie zu verändern.« »Der Mensch ist, was er isst.«
In der Schule lernte Wantscho mit Hingabe die deutsche Sprache und er wurde zum Vorsitzenden des Komsomol in Lom gewählt. Sein Selbstbewusstsein wuchs. Er begann, sich von seinem Elternhaus abzunabeln.
Der Tag der großen Operation rückte heran. Ein letztes Mal fuhr Christo mit dem nun achtzehnjährigen Wantscho nach Sofia in die Uniklinik. Für diesen Eingriff hatte Christo viele Jahre lang gespart. Die Operation verlief gut. Die Narbe war zwanzig Zentimeter lang und zog sich vom Oberschenkel über die Kniescheibe bis zum Schienbein hinunter. Sein Sohn werde künftig noch besser auftreten können, ließ der Chirurg ihn wissen. Das Humpeln jedoch könne ihm nicht erspart werden. Christo war, als zöge ihm jemand den Boden unter den Füßen weg. Der Arzt ließ ein Glas Wasser bringen. Er kannte solche Reaktionen von Patienten und Angehörigen.
»Warum werde ich so gestraft!«, murmelte Christo voller Groll.
»Nur wenigen Menschen ist die Stille Feiung vergönnt«, sagte der Arzt beschwichtigend. »Nur ganz selten schafft es der Körper, sich gegen diese Infektion selbst zu immunisieren, ohne dass die Krankheit ausbricht. Danken Sie Gott, dass Ihr Kind am Leben ist.«
Wantscho absolvierte sein Abitur mit 6,0. Er war der beste Schüler in ganz Lom. Als Auszeichnung erhielt er eine Urkunde und fünf rote Nelken. Am selben Tag trat er mit Nasco in die Kommunistische Partei Bulgariens ein.
4
Seltsamerweise weiß ich nicht viel über die Jugendjahre meines Vaters. Es existieren keine Briefe. Es gibt kaum Fotos, die Aufschluss geben könnten über Ereignisse, Stimmungen, Versäumnisse, Freundschaften, Zusammenhänge. Papa hat wenig von sich erzählt. Ich weiß nicht, wann er zum ersten Mal ein Mädchen geküsst hat. Nichts über seine erste große Liebe. Nichts darüber, was er tat, wenn er sich mit seinen Freunden traf. Nichts darüber, welche Aufgaben er als Funktionär in der Kommunistischen Partei hatte. Auch kaum etwas über sein Medizinstudium, das ihn nach Sofia führte.
Immerhin fallen mir ein paar Bruchstücke ein. Bruchstücke, aus denen ich mir ein Mosaik zusammensetze. Ein Mosaik, in dem viele Teile fehlen. Das, was ich weiß, habe ich von den Frauen meiner Familie erfahren. Das meiste von Mama, einiges von Tante Lina, ein wenig von meiner Großmutter, Baba Sneza.
So weiß ich, dass Papa wegen seines kranken Beines nicht tauglich für den Armeedienst war. Es muss ihn, den Achtzehnjährigen, sehr verletzt haben, ausgemustert zu werden. Bulgarische Männer sind Machos, sie definieren sich über ihre Körperlichkeit, ihre Stärke und Kraft. Sie verehren ihre Volkshelden, wie zum Beispiel Wassil Lewski, den »Apostel der Freiheit«, der gegen die Türken kämpfte, die Bulgarien jahrhundertelang beherrscht hatten. Die bulgarischen Männer eint der Hass auf die Türken. Sie verstehen sich als Nachfolger Lewskis, des führenden Revolutionärs der »Nationalen Wiedergeburt« Bulgariens. Der osmanische Sultan Abdülaziz ließ den Freiheitskämpfer 1873 hinrichten. In dieser Tradition wuchsen die bulgarischen Männer heran, Generation um Generation: Es war ehrenhaft, für sein Land zu kämpfen! Einen Beitrag zu leisten. Auch als mein Vater jung war, wurde immer und überall gekämpft: Gegen die kapitalistische Bedrohung, für den Weltfrieden, gegen den Hunger, für den Sozialismus, gegen die Unterdrückung. Und wo konnte Mann am besten kämpfen? Natürlich in der Armee. Alle jungen Männer wollten dahin. Es muss für Papas schwaches Selbstwertgefühl eine zusätzliche Kränkung gewesen sein, keinen Dienst an der Waffe leisten zu können.
Mama erzählte, dass Papa sich während seines Studiums mit Boj ko Mladenoff anfreundete. Bojko, der ein enger Freund wurde, stammte aus Sofia und studierte Zahnmedizin. Er stand auf blonde (in Ermangelung echter blonder auch auf blondierte) Damen, hatte laufend wechselnde Freundinnen und versuchte, so Mama, Wantscho in die Liebe einzuführen. Einmal soll Bojko Papa mit einer jungen Frau, einer rassigen Schönheit, bekannt gemacht haben. Es gab wohl einige Rendezvous am Donauufer. Doch irgendetwas sei dann, so Mama, schiefgegangen. Was genau, wusste auch Bojko nicht. Wantscho habe ihm nichts erzählen wollen. Und er, Bojko, entsinne sich nur noch, dass er ihm geraten habe: »Verlieb dich besser nicht. Nimm es, wie es ist.«
Bojko hatte die Attribute eines Lebemannes: Frauen, die ihm hinterherliefen, ein eigenes Auto, stets genügend Geld. Er gab sich gern mondän. Trug Hut und das Hemd über der Brust offen. Kreuzte mit Ölfarben und Staffelei auf. Konnte allerdings tatsächlich phantastisch zeichnen und malen. Und sogar dichten. Er soff viel. Papa mochte an Bojko all das, was er selbst nicht war. Er bewunderte den extrovertierten, lebenslustigen Freund, der das Leben so leicht nahm, ihm stets nur das Schöne abgewann und das Schlechte einfach ausblendete.
Laut Bojko begann Papa in dieser Zeit, sich elegant zu kleiden und sein schwarzes Haar in Wellen zu legen. Er trug edle Hemden, helle Anzüge, und lederne Schuhe. Er besaß einen weißen Regenmantel und band sich Krawatten um, auch wenn es draußen sehr heiß war. So als wollte er mit seinem äußeren Erscheinungsbild den körperlichen Makel wettmachen.
Papa entschloss sich, Medizin an der Medizinischen Universität in Sofia zu studieren. Er verehrte Albert Schweitzer, zu dem er sich vermutlich auch wegen dessen musikalischer Passion hingezogen fühlte. Papa stellte höchste Ansprüche an sich selbst, die er nicht immer erfüllen konnte. Einmal erzählte er mir von seinem Pathologiekurs. Als die Reihe an ihm war, die Leiche zu sezieren, wurde ihm speiübel. So schnell er konnte, humpelte er aus dem Saal und übergab sich draußen auf dem Gang. Während er dies erzählte, lachte er.