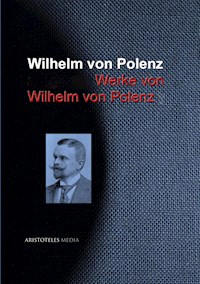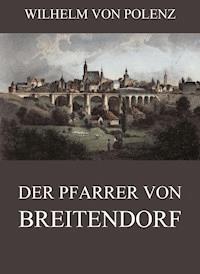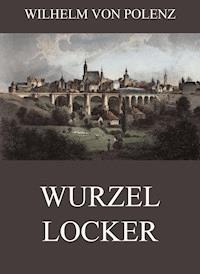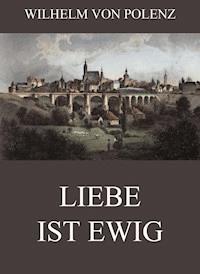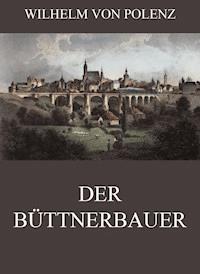
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Polenz' bekanntester Roman ist "Der Büttnerbauer". Darin stellt er die Situation des Bauernstandes seiner Zeit dar. Formal gilt dieser Roman als bedeutendes episches Werk des Naturalismus. Ideologisch dagegen zeigt sich Polenz darin als Vertreter entschieden antisemitischer Anschauungen, die seinerzeit auch in Deutschland an Bedeutung gewannen. Der Familienhof der Hauptfigur kommt in wirtschaftliche Not und verschuldet sich "ausgerechnet" bei einem Juden ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Büttnerbauer
Wilhelm von Polenz
Inhalt:
Wilhelm von Polenz – Biografie und Bibliografie
Der Büttnerbauer
Erstes Buch.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Zweites Buch.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Drittes Buch.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Der Büttnerbauer, W. von Polenz
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849639006
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Wilhelm von Polenz – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 14. Jan. 1861 auf Schloß Ober-Kunewalde (sächs. Oberlausitz), gest. 13. Nov. 1903 in Bautzen. studierte die Rechte in Berlin, Breslau und Leipzig, nahm aber nach zweijähriger Amtstätigkeit als Referendar in Dresden seinen Abschied, um die Verwaltung seines Familienguts zu übernehmen. Als Schriftsteller führte er sich mit dem Roman: »Sühne« (Dresd. 1891, 2 Bde.) ein. Der damals beginnenden jüngstdeutschen Richtung wendete er sich mit der novellistischen Studie: »Die Versuchung« (Dresd. 1891) und mit der Skizzensammlung: »Karline« (Berl. 1894) zu, in der er in Vers und Prosa die Schreibweise zahlreicher modernster Autoren geschickt nachempfand. Seine dramatischen Versuche mit den Schauspielen: »Heinrich von Kleist« (Dresd. 1891), »Preußische Männer« (1893), »Andreas Bockholdt« (Dresd. 1898), »Heimatluft« (1900), »Junker und Fröner« (Berl. 1901), blieben für die Bühne, trotz vereinzelter Aufführungen, belanglos. Dagegen betrat P. sein eigenstes Gebiet mit dem gehaltvollen religiösen Roman: »Der Pfarrer von Breitendorf« (Berl. 1893, 3 Bde.; 3. Aufl. 1904), dem die beachtenswerten Romane: »Der Büttnerbauer« (das. 1895, 10. Aufl. 1906), »Der Grabenhäger« (das. 1898, 2 Bde.; 3. Aufl. 1903), »Thekla Lüdekind. Die Geschichte eines Herzens« (das. 1900, 2 Bde.; 3. Aufl. 1902), »Liebe ist ewig« (das. 1901, 3. Aufl. 1904), »Wurzellocker« (das. 1902) und »Glückliche Menschen« (5. Aufl., das. 1905) folgten. P. schrieb noch die Novellen: »Reinheit« (Berl. 1896), »Wald« (das. 1899) und »Luginsland«, Dorfgeschichten (3. Aufl., das. 1905). Die Eindrücke einer Reise nach Amerika enthält sein interessantes Buch »Das Land der Zukunft« (Berl. 1903, 5. Aufl. 1904). Seine nachgelassenen Gedichte wurden u. d. T. »Erntezeit« (Berl. 1904) veröffentlicht. P. vereinigt als Romanschriftsteller vorzügliche Charakterzeichnung mit anziehender, in lebendigstem Heimatsgefühl wurzelnder Darstellung des Milieus. Vgl. Ilgenstein, Wilhelm v. P. (Berl. 1904).
Der Büttnerbauer
Erstes Buch.
I.
Der Großbauer Traugott Büttner ging mit seinen zwei Söhnen zur Kirche.
Die drei Männer konnten sich sehen lassen. Der Büttnerbauer selbst war ein Sechziger, groß, hager, bartlos, rotbraun im Gesicht, mit graugelbem Haupthaar, das er nach altmodischer Weise lang ins Genick hinab wachsen ließ. Breitspurig und wuchtig trat er mit schwerem Stiefel auf, wie es ihm, dem Besitzer des größten Gutes im Dorfe, zukam. Seine starken, etwas eckigen Gliedmaßen, die sich ausnahmen wie knorrige Eichenäste, waren in einen Rock von dunkelblauer Farbe mit langen Schößen gezwängt. Die engen Ärmel behinderten ihn offenbar in der Freiheit der Bewegung. Dafür war das auch der nämliche Rock, in welchem der Büttnerbauer vor mehr als dreißig Jahren getraut worden war. Daß der Rock inzwischen etwas knapp geworden in den Schultern und über die Brust, störte den Alten nicht, im Gegenteil! diese Gebundenheit und enge Verschnürung des Leibes stimmte so recht zu der Weihe und feierlichen Gemessenheit, die nun einmal zum Sonntagmorgen gehört. – Auf dem langen, straffen Haar trug er einen Zylinder, den das Alter nicht glatter, sondern recht widerhaarig gemacht hatte.
Der Bauer schritt zwischen seinen beiden Söhnen: Karl und Gustav.
Karl, der ältere, war in gleicher Größe mit dem Vater, aber beleibter und fleischiger als dieser. Auch er rasierte sich, nach guter Bauernweise, den ganzen Bart. Seine großen, etwas verschlafenen Augen und die vollen, roten Wangen gaben ihm das Aussehen eines großen, gutgearteten Jungen. Aber wer sich die Fäuste des Mannes näher betrachtete, dem verging wohl die Lust, mit solchem Burschen anzubinden. Heute trug er wie der Alte ein dickleibiges Gesangbuch in der Hand. Auch er war in einen langschößigen Kirchenrock gekleidet und trug einen breitkrämpigen Zylinder auf dem runden Kopfe. Im ganzen war Karl Büttner die wohlgenährtere und um dreißig Jahre jüngere Ausgabe von Traugott Büttner.
Verschieden von den beiden zeigte sich der jüngere Sohn Gustav, Unteroffizier in einem Kürassierregiment. Vielleicht war es die schmucke Uniform, die seine Figur hob, ihm etwas Gewandtes und Nettes gab, daß er sich von den beiden plumpen Bauerngestalten vorteilhaft abhob. Er war etwas kleiner als Vater und Bruder, sehnig, gut gewachsen, mit offenem, einnehmendem Gesichtsausdruck. Gustav wiegte seinen schlanken Oberkörper ersichtlich in dem Bewußtsein, ein hübscher Kerl zu sein, auf den heute die Augen der gesamten Kirchfahrt von Halbenau gerichtet waren. Nicht selten fuhr seine behandschuhte Rechte nach dem blonden Schnurrbart, wie um sich zu vergewissern, daß diese wichtigste aller Manneszierden noch an ihrem Platze sei. Im Heimatdorfe hatte man ihn noch nicht mit den Tressen gesehen. Zum heurigen Osterurlaub zeigte er sich der Gemeinde zum ersten Male in der Unteroffizierswürde.
Gesprochen wurde so gut wie nichts während des Kirchganges. Hin und wieder grüßte mal ein Bekannter durch Kopfnicken. Zum Ostersonntage war ganz Halbenau auf den Beinen. In den kleinen Vorgärten rechts und links der Dorfstraße blühten die ersten Primeln, Narzissen und Leberblümchen.
In der Kirche nahm der Büttnerbauer mit den Söhnen die der Familie angestammten Kirchenplätze ein, auf der ersten Empore, nahe der Kanzel. Die Büttners gehörten zu der alteingesessenen Bauernschaft von Halbenau.
Gustav sah sich während des Gesanges, der mit seinem ausgiebigen Zwischenspiel der Beschaulichkeit reichlichen Spielraum gab, in der kleinen Kirche um. Die Gesichter waren ihm alle bekannt. Hie und da vermißte er unter den älteren Leuten einen oder den anderen, den der Tod wohl abgerufen haben mochte.
Sein Blick schweifte auch gelegentlich nach dem Schiffe hinab, wo die Frauen saßen. Die bunten Kopftücher, Hauben und Hüte erschwerten es, das einzelne Gesicht sofort herauszukennen. Unter den Mädchen und jungen Frauen war manch eine, mit der er zur Schule gegangen, andere kannte er vom Tanzboden her.
Gustav Büttner hatte es bisher geflissentlich vermieden, nach einer bestimmten Stelle im Schiffe zu blicken. Er wußte, daß dort eine saß, die, wenn sie überhaupt in der Kirche war, ihn jetzt ganz sicher beobachtete. Und er wollte sich doch um keinen Preis den Anschein geben, als kümmere ihn das nur im geringsten. – Wenn er dorthin blicken wollte, wo sie ihren Kirchenstand hatte, mußte er den Kopf scharf nach links wenden, denn sie saß seitlings von ihm, beinahe unter der Empore. Bis zum Kanzelvers tat er sich Zwang an, dann aber hielt er es doch nicht länger aus, er mußte wissen, ob Katschners Pauline da sei.
Er beugte sich ein wenig vor, so unauffällig wie möglich. Richtig, dort saß sie! Und natürlich hatte sie gerade auch nach ihm hinaufblicken müssen.
Gustav war errötet. Das ärgerte ihn erst recht. Zu einfältig! Warum mußte er sich auch um das Mädel kümmern! Was ging die ihn jetzt noch an! Wenn man sich um jedes Frauenzimmer kümmern wollte, mit dem man mal was gehabt, da konnte man weit kommen. Überhaupt, Katschners Pauline! – In der Stadt konnte man sich mit so einer gar nicht sehen lassen. In der Kaserne würden sie ihn schön auslachen, wenn er mit der angezogen käme. Nicht viel besser als eine Magd war sie! wochentags womöglich barfuß und mit kurzen Röcken! –
Er nahm eine hochmütige Miene an, im Geiste die ehemalige Geliebte mit den »Fräuleins« vergleichend, deren Bekanntschaft er in den Kneipen und Promenaden der Provinzialhauptstadt gemacht hatte. In der Stadt hatte, weiß Gott, das einfachste Dienstmädel mehr Lebensart, als hier draußen auf dem Dorfe die Frauenzimmer alle zusammen. Er verachtete Katschners Pauline so recht aus Herzensgrunde.
Und einstmals war die dort unten doch sein Ein und Alles gewesen! –
Auf einmal zog durch seinen Kopf die Erinnerung an das Abschiednehmen damals, als er mit den Rekruten weggezogen in die Garnison. Da hatten sie gedacht, das Herz müsse ihnen brechen beim letzten Kusse. Und dann, als er wiederkam, zum ersten Urlaub, nach einjähriger Trennung. – Was er da angestellt hatte vor Glückseligkeit! Und das Mädel! Sie waren ja wie verrückt gewesen, beide. Was er ihr da alles versprochen und zugesagt hatte!
Er versuchte die Gedanken daran zu verscheuchen. Damals war er ja so dumm gewesen, so fürchterlich dumm! Was er da versprochen hatte, konnte gar nicht gelten. Und außerdem hatte sie ihm ja selbst auch nicht die Treue gehalten. – Was ging ihn der Junge an! Überhaupt, wer stand ihm denn dafür, daß das sein Kind sei! Er war ja so lange weggewesen.
Na, mit der war er fertig! Mochten die Leute sagen, was sie wollten! Mochte sie selbst sich beklagen und Briefe schreiben und ihm zu seinem Geburtstage und zu Neujahr Glückwunschkarten schicken – das sollte ihn alles nicht rühren. So dumm! Er hatte ganz andere Damen in der Stadt, seine Damen, die gebildet sprachen und »Hochwalzer« tanzen konnten. Was ging ihn Katschners Pauline an, deren Vater armseliger Stellenbesitzer gewesen war.
Inzwischen hatte der Pastor zu predigen begonnen. Gustav versuchte nun, seine Gedanken auf das Gotteswort zu richten. Er war in der Garnison noch nicht gänzlich verdorben worden. Immer hatte er eine rühmliche Ausnahme vor den Kameraden gemacht, welche das Kirchenkommando meist zu Schlaf oder allerhand Unfug benutzten. Er war vom Elternhause her an gute Zucht gewöhnt, auch in diesen Dingen. Der alte Bauer ging den Seinen mit gutem Beispiele voran; er fehlte kaum einen Sonntag auf seinem Platze und verpaßte kein Wort der Predigt. Auch im Singen stand er noch seinen Mann; freilich mit einer Stimme, die durch das Alter etwas krähend geworden. Karl allerdings, der etwas zur Trägheit neigte, war von einem Kirchenschläfchen nicht abzuhalten. Bald nach dem ersten der drei angekündigten Teile der Predigt sah ihn Gustav bereits sanft vor sich hin nicken.
Nachdem der Gottesdienst vorüber, stand man noch eine geraume Weile vor der Kirchtür. Der Büttnerbauer sah mit Behagen, daß sein Gustav der Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit war. Alte und junge Männer umstanden den Unteroffizier. Der Anblick der Uniform erweckte die Erinnerung an die eigene Dienstzeit oder auch bei den Älteren an die Kriegsjahre. Der Büttnerbauer selbst führte die Denkmünzen der beiden letzten Feldzüge. Auch Karl Büttner hatte seine drei Jahre »weggemacht«, aber bis zur »Charge« hatte es bisher noch kein Büttner gebracht.
Gustav mußte auf viele Fragen Rede und Antwort stehen. Ob er's nicht bald dicke habe, und wann er nach Halbenau zurückkehre, fragte man ihn. Der junge Mann meinte mit dem Selbstbewußtsein, das die Uniform den gewöhnlichen Leuten gibt, vorläufig gefalle es ihm noch so gut bei der Truppe, daß er nicht daran denke, den Pallasch mit der Mistgabel zu vertauschen.
Zwei Frauen kamen auf die Männer zu, eine ältere im bunten Kopftuch und eine jüngere mit einem schwarzen Hut, auf dem rosa Blumen leuchteten. Gustav hatte den Hut schon von der Empore aus wiedererkannt. Vor Jahren, als er noch mit Pauline Katschner gut war, hatte er ihr den Hut in der Garnison gekauft und, als er auf Urlaub nach Hause ging, mitgebracht. – Die ältere Frau war die Witwe Katschner, Paulinens Mutter.
»Guten Tag och, Gustav!« sagte Frau Katschner. »Guten Tag!« erwiderte er stirnrunzelnd, ohne ihr die Hand zu geben. Das Mädchen hatte den Kopf gesenkt und blickte errötend auf ihr Gesangbuch. »No, bist de och wieder mal in Halbenau, Gustav!« meinte die Witwe und lachte dabei, um ihre Verlegenheit zu verbergen. »Ja!« sagte Gustav kühl und fragte einen der jungen Männer irgendetwas Gleichgültiges.
Die Frauen zögerten noch eine Weile, wohl eine Anrede von ihm erwartend. Dann zog das Mädchen, dem das Weinen nahe schien, die Mutter am Rocke: »Kumm ack, Mutter, mir wollen gihn!« – Darauf entfernten sich die beiden Frauen.
»Die kennst du wohl gar nich mehr, Gustav?« fragte einer der jungen Leute mit spöttischem Lächeln den Unteroffizier. Der zuckte die Achseln, wiegte sich in den Hüften und gab sich Mühe, so gleichgültig auszusehen wie nur möglich.
Nun setzte man sich langsam in Bewegung, ein Trupp von zehn, zwölf jungen Männern, meist Schulkameraden Gustavs. Im Kretscham wurde ein Stehbier getrunken und die Zigarren in Brand gesetzt. Dann gings wieder auf die Dorfstraße hinaus. Einer nach dem anderen suchte nun sein Haus auf, denn die Mittagsstunde war herangekommen. Abends wollte man sich auf dem Tanzboden wieder treffen.
Das Büttnersche Bauerngut lag am obersten Ende des Dorfes. Der Bauer und Karl waren bereits vorausgegangen. Gustav wollte in einen Feldweg einbiegen, der ihn in kürzester Frist nach Haus geführt hätte, da hörte er seinen Namen rufen.
Er wandte sich. Katschners Pauline war nur wenige Schritte hinter ihm. Sie keuchte, beinahe atemlos vom schnellen Laufen.
Er nahm eine finstere Miene an und fragte in barschem Tone, was sie von ihm wolle. »Gustav!« rief sie und streckte ihm die Hand entgegen. »Bis doch nicht so! Du tust ja gerade, als kennt'st de mich am Ende gar nich.«
»Ich hab keine Zeit!« sagte er, wandte sich und wollte an ihr vorbei.
Aber sie vertrat ihm den Weg. »Ne, Gustav! Aber, Gustav, bis doch nicht so mit mir!« Sie stand da mit fliegendem Busen und sah ihm voll in die Augen. Er hielt ihren Blick nicht aus, mußte wegsehen.
Sie griff nach seiner Hand und meinte: »Ene Hand hättst de mir immer geben kennen, Gustav!«
Das sei gar keine Manier, ihm so nachzulaufen und ihn am hellen lichten Tage anzureden, sagte er, und sie solle sich wegscheren. Er gab sich alle Mühe, entrüstet zu erscheinen.
Pauline schien keine Furcht vor ihm zu haben. Sie stand dicht vor ihm. Eine Bewegung seines Armes hätte genügt, sie beiseite zu schieben. Aber er hob die Hand nicht.
»Iber Johr und Tog is es nu schon, Gustav, daß mer uns niche gesehn haben! Und geontwortet hast du och nich, suviel ich dir och geschrieben habe. Du tust doch gerade, als wär'ch a schlechtes Madel, Gustav!« – die Augen standen ihr auf einmal ganz voll Tränen.
Heulen! das hatte gerade noch gefehlt! Weibertränen waren für ihn etwas Entsetzliches. Er war ja sowieso schon halb gewonnen durch ihren bloßen Anblick, durch den vertrauten Klang ihrer Stimme. Was für Erinnerungen rief ihm dieses Gesicht zurück! Er hatte so glücklich mit ihr gelebt wie noch mit keiner anderen. Sie war doch seine Erste gewesen. Es lag in dem Gefühle so etwas ganz Besonderes, so etwas wie Heimweh, wie Dankbarkeit für ihre Güte gegen ihn. – Daß sie jetzt weinte, war schlimm! Er kam sich schlecht vor und grausam. Das verdroß ihn. Nun würde er das Mädel schwer wieder los werden, fürchtete er.
Sie wischte sich die Tränen mit einer Ecke ihrer schwarzen Schürze ab und fragte: »Was hast de denn egentlich gegen mich, Gustav? Sag mersch nur a enzigstes Mal, was de hast, daß de so bist! –«
Er kaute an seinem Schnurrbarte mit verdüsterter Miene. Es wäre ein leichtes gewesen, ihr auf den Kopf zuzusagen, sie habe es inzwischen mit einem anderen getrieben. Aber in diesem Augenblick, unter den Blicken ihrer treuen Augen, fühlte er mit einem Male, auf wie schwachen Füßen dieser Verdacht eigentlich stehe. Er hatte ja die ganze Geschichte, die ihm von anderen hinterbracht worden war, nie recht geglaubt. Das war ja nur ein willkommener Vorwand für ihn gewesen, auf gute Art von ihr los zu kommen.
Als sie nun jetzt so vor ihm stand, einen Kopf kleiner als er, frisch und gesund wie ein Apfel, mit ihren guten, großen Augen und den leuchtenden Zähnchen, da befand er sich wieder ganz unter ihrem Banne.
»Ich habe mich su ärgern missen über dich!« sagte sie leise und schluchzte auf einmal auf. Die Tränen saßen sehr locker bei ihr. Zwischen dem Weinen durch konnte sie so lieb und schmeichelnd dreinblicken wie eine zahme Taube. Niemand hatte dem Mädchen diese Künste gelehrt, aber die raffinierteste Kokette hatte keine wirksameren Mittel, das Herz eines Mannes zu bestricken als dieses schlichte Naturkind.
Plötzlich senkte sie den Kopf, errötend und noch leiser als vorher meinte sie: »Willst de dir nich deinen Jungen ansehn, Gustav? Er is nu bald een Jahr!«
Der junge Mann stand unschlüssig, im Innersten bestürzt. Er fühlte sehr deutlich, daß dieser Augenblick für ihn die Entscheidung bedeute. Wenn er ihr jetzt den Willen tat, mit ihr ging und sich den Jungen ansah, dann bekannte er sich zur Vaterschaft. Bisher hatte er das Kind nicht als das seine anerkannt, sich hinter der Ausflucht verschanzend, daß man ja gar nicht wissen könne, von wem es sei.
Pauline hatte den Kopf wieder aufgerichtet und bat ihn mit den Augen. Dann mit ihrer weichen Mädchenstimme: »Ich ha dem Jungen nu schun su viel vun dir vorderzahlt. Er kann noch ne raden. Aber,Papa! das kann er duch schun sagen. – Komm ack, Gustav, sieh der'n wen'gsten a mal an!« –
Sie nahm ihn an der Hand und zog ihn nach der Richtung, wohin sie ihn haben wollte. »Komm ack, Gustav, komm ack mitte!« so ermunterte sie den immer noch Zaudernden.
Er folgte ihr schließlich. Dabei ärgerte er sich über sich selbst, daß er so nachgiebig war. Er verstand sich darin selbst nicht. Es gab in der ganzen Unteroffiziersabteilung keinen schneidigeren Reiter als ihn. »Remonte dressieren«, das war seine Lust. Und dabei konnte er so weich sein, daß ihn der Wachtmeister schon mal einen »nassen Waschlappen« genannt hatte. Das war damals gewesen, als seine Charge, die »Kastanie«, den Spat bekommen und zum Roßschlächter gemußt. Da hatte er geweint wie ein kleines Kind.
Pauline schien sich darauf zu verstehen, ihm beizukommen. Sie konnte, wenn sie wollte, so was recht »Betuliches« haben. Sie tat, als habe es niemals eine Abkühlung zwischen ihnen gegeben. Kein weiteres Wort des Vorwurfes kam über ihre Lippen. Um keinen Preis wollte sie ihn in schlechte Laune versetzen. Ihr Bestreben war, ihn gar nicht erst zur Besinnung kommen zu lassen. Sie erzählte von der Mutter, von ihrem Jungen, allerhand Lustiges und Gutes, brachte ihn so mit kleinen Listen, deren sie sich kaum bewußt wurde, bis vor ihre Tür.
Pauline wohnte mit ihrer Mutter, der Witfrau Katschner, in einer strohgedeckten Fachwerkhütte, einem der kleinsten und unansehnlichsten Anwesen des Ortes. Es war nur eine Gartennahrung, nicht genug zum Leben und zuviel zum Sterben. Die beiden Frauen verdienten sich etwas durch Handweberei. Früher war Pauline zur Arbeit auf das Rittergut gegangen, aber in letzter Zeit hatte sie das aufgegeben.
Pauline hatte ihr eigenes Stübchen nach hinten hinaus. In Gustav rief hier jeder Schritt, den er tat, Erinnerungen wach. Durch dieses niedere Türchen, das er nur gebückt durchschreiten konnte, war er getreten, als sie ihn in einer warmen Julinacht zum ersten Male in ihre Kammer eingelassen. Und wie oft war er seitdem hier aus und ein gegangen! Zu Tag- und Nachtzeiten, ehe er zu den Soldaten ging und auch nachher, wenn er auf Urlaub daheim gewesen war.
In dem kleinen Raume hatte sich wenig verändert während des letzten Jahres. Sauberkeit und peinlichste Ordnung herrschten hier. Er kannte genau den Platz eines jeden Stückes. Dort stand ihr Bett, da das Spind, daneben die Lade. Der Spiegel mit dem Sprung in der Ecke unten links, über den eine Neujahrskarte gesteckt war, hing auch an seinem alten Platze.
Unwillkürlich suchte Gustavs Blick das Zimmer spürend ab. Aber er fand nicht, was er suchte. Pauline folgte seinen Augen und lächelte. Sie wußte schon, wonach er sich umsah. –
Sie ging auf das Bett zu und drückte die bauschigen Kissen etwas nieder. Ganz am oberen Ende, tief versenkt in den Betten, lag etwas Rundliches, Dunkles.
Sie gab ihm ein Zeichen mit den Augen, daß er herantreten solle. Er begriff, daß der Junge schlafe und bemühte sich infolgedessen leise aufzutreten, den Pallasch sorgsam hochhaltend. »Das is er!« flüsterte sie und zupfte glückselig lächelnd an dem Kissen, auf dem der Kopf des Kleinen lag.
Der junge Mann stand mit verlegener Miene vor seinem Jungen. Der Anblick benahm ihn ganz; nicht einmal den Helm abzusetzen, hatte er Zeit gefunden. Hinzublicken wagte er kaum. Das sollte sein Sohn sein! Er hatte ein Kind! – Der Gedanke hatte etwas eigentümlich Bedrückendes, etwas Dumpfes und Beengendes legte sich auf ihn wie eine große, noch unübersehbare Verantwortung.
Sie half ihm, nahm ihm zunächst den Helm ab, rückte das Kind etwas aus den Betten heraus, daß er es besser sehen solle, führte selbst seine große Hand, daß er sein eigenes Fleisch und Blut betasten möchte. Dann fragte sie, sich an ihn schmiegend, wie es ihm gefalle.
Er erwiderte nichts, stand immer noch ratlos, bestürzt vor seinem Sprößling.
Jetzt ging ein Lächeln über die Züge des Kleinen, er bewegte im Schlafe ein paar Finger des winzigen Händchens. Nun erst begriff der Vater, daß es wirklich ein lebendiges Wesen sei, was da lag. Der Gedanke rührte ihn auf einmal in tiefster Seele. – So ein kleines Ding, mit solch winzigen Gliedmaßen, und das lebte doch und war ein zukünftiger Mensch, würde ein Mann sein – sein Sohn! Pauline und er hatten es hervorgebracht; aus seinem und ihrem Gebein stammte dieses neue Wesen. Das ewige Wunder des Werdens trat vor ihn in seiner ganzen unheimlichen Größe. –
Gustav merkte, wie ihm die Tränen in die Augen traten, es würgte ihn im Halse, es kitzelte ihn an der Nase. Er biß die Zähne fest aufeinander und schluckte die Rührung hinunter; weinen wollte er um keinen Preis.
Pauline eilte derweilen geschäftig auf und ab im Zimmer. Sie hatte den schwarzen Hut mit den rosa Blumen abgelegt, die Ärmel ihres Kleides aufgeknöpft und bis an die Ellbogen zurückgeschlagen und eine weiße Schürze vorgesteckt. Ohne Hut sah sie noch hübscher aus. Ihr blondes Haar, von selten schöner Färbung, kam jetzt erst zur Geltung, sie trug es nach Art der Landmädchen, schlicht in der Mitte gescheitelt und hinten zu einem Nest von vielen kleinen Fechten verschlungen. Das schwarze Kleid war ihr Konfirmationskleid. Nur durch Auslassen und Ansetzen hatte sie es zuwege gebracht, daß es ihre frauenhaft entwickelte Fülle auch jetzt noch faßte.
Jetzt eilte sie wieder an das Bett. Sie meinte, der Junge habe nun genug geschlafen, er müsse die Flasche bekommen. Sie weckte den Kleinen, indem sie ihn sanft aus den Kissen hob und ihn auf die Stirn küßte. Das Kind schlug ein Paar große, dunkle Augen auf, sah sich verwundert um und begann sofort zu schreien. Der Vater, der an solche Töne noch nicht gewöhnt war, machte ein ziemlich verdutztes Gesicht hierzu.
Pauline meinte, das sei nicht so schlimm, das Kind habe nur Hunger. Sie nahm eine Blechkanne aus der Röhre. Das Zimmerchen hatte keinen eigenen Ofen, sondern nur eine Kachelwand mit einer Röhre, die vom Nebenzimmer aus erwärmt wurde. In der Blechkanne befand sich ein Fläschchen Milch. Pauline, auf dem einen Arm das Kind, führte die Flasche zum Munde, kostete schnell, stülpte einen Gummizulp über den Flaschenhals. Dann legte sie den Kleinen wieder aufs Bett, dessen Blicke und Hände begierig nach der wohlbekannten Flasche strebten. Nun endlich steckte sie dem Schreihals den Zulp zwischen die Lippen. Sofort verstummte das Gezeter und machte behaglich glucksenden Lauten Platz.
Gustav atmete erleichtert auf. Der ganze Vorgang hatte etwas Beklemmendes für ihn gehabt. Während Pauline voll Wonne und Stolz war, konnte er sich einer gewissen Gedrücktheit nicht erwehren. Mit dem Ausdrucke einer Zärtlichkeit, wie sie nur eine Mutter hat, beugte sich das Mädchen über das kleine Wesen, dessen ganze Kraft und Aufmerksamkeit jetzt auf den Nahrungsquell gerichtet war, und richtete ihm die Kissen.
Erst nachdem der Kleine völlig glücklich zu sein schien, kam Gustav wieder an die Reihe für Pauline. Sie wischte ihm einen Stuhl ab mit ihrer Schürze und bat ihn, sich zu setzen. Er hatte noch immer kein Wort über den Jungen geäußert; jetzt nötigte sie ihn geradezu, sich auszusprechen.
Er meinte, das Kind sehe ja soweit ganz gesund und kräftig aus. Aber das genügte ihrem mütterlichen Stolze nicht. Sie begann ihrerseits das Lob des Jungen zu singen, wie wohlgebildet er sei und stark. Ja, sie behauptete sogar, er sei ein Wunder an Klugheit, und führte dafür einige seiner kleinen Streiche an. Groß sei er für sein Alter wie kein anderes Kind, schon bei der Geburt sei er solch ein Riese gewesen. Und sehr viel Not habe er ihr gemacht beim Kommen, setzte sie etwas leiser mit gesenktem Blicke hinzu. Dann erzählte sie, daß sie ihn bis zum sechsten Monate selbst genährt habe.
Er hörte diesem Berichte von Dingen, die für sie von größter Bedeutung und Wichtigkeit waren, nur mit halbem Ohre zu. Er hatte seine eignen Gedanken bei alledem. Was sollte nun eigentlich werden, fragte er sich. Er hatte sich zu diesem Kinde bekannt. Als anständiger Mensch mußte er nun auch dafür sorgen. Burschen, die ein Kind in die Welt setzen und dann Mädel und Kind im Stiche ließen, hatte er immer für Lumpe gehalten. Einstmals hatte er Paulinen ja auch die Ehe versprochen. Und wenn er sie so ansah, wie sie hier schaltete und waltete, sauber und nett, geschickt, sorgsam und dabei immer freundlich und voll guten Mutes, da konnte ihm der Gedanke einer Heirat schon gefallen. Daß sie ein durch und durch braves Mädel sei, das wußte er ja.
Aber, überhaupt heiraten! Er dachte an das Elend der meisten Unteroffiziersehen. Da hätte man sich ja schütteln mögen bei dem bloßen Gedanken.
Und dann gab es da noch eins: er hätte mit verschiedenen Frauenzimmern in der Garnison brechen müssen. – Das alles machte ihm den Kopf schwer. –
Pauline fing jetzt an, von ihren eigenen Angelegenheiten zu sprechen, sie erzählte, wie einsam und traurig der letzte Winter für sie gewesen sei, die Mutter wochenlang bettlägerig, dazu kein Geld im Hause, kein Mann in der Nähe, der ihnen geholfen hätte. Sie selbst durch die Pflege des Kindes abgehalten, viel zu schaffen. Und zu alledem habe er nichts mehr von sich hören lassen. Was er denn eigentlich gehabt habe gegen sie, verlangte das Mädchen von neuem zu wissen. Er wich der Antwort aus, fragte seinerseits, warum sie denn gar nicht mehr aufs Rittergut zur Arbeit gegangen sei.
Das habe seinen guten Grund, erklärte sie und sprach auf einmal mit gedämpfter Stimme, als fürchte sie, das Kind könne etwas verstehen. Der Eleve dort habe sich Unanständigkeiten gegen sie erlaubt, deshalb sei sie lieber aus der Arbeit fortgeblieben, obgleich sie den Verdienst schwer vermißt hätte.
Gustav horchte auf. Das war ja gerade die Geschichte, über die er gern etwas Genaueres erfahren hätte. Mit diesem Eleven nämlich hatte man ihm das Mädchen verdächtigt. Er forschte weiter: Was hatte sie mit dem Menschen gehabt, wie weit war er gegangen?
Pauline zeigte sich im Innersten erregt, als diese Dinge zur Sprache kamen. Sie sprach in den schärfsten Ausdrücken über den jungen Herrn, der seine Stellung ausgenutzt hatte, ihr in zudringlicher Weise Anträge zu machen. Mehr noch als ihre Worte sagten es ihm ihre Mienen und die ganze Art, in der sie sich äußerte, daß sie ihm treu geblieben sei.
Gustav ließ ihr seine Befriedigung durchblicken, daß nichts an dem Gerede sei. Nun erfuhr sie erst, daß er darum gewußt habe. Deshalb also hatte er mit ihr gegrollt! Wer hatte sie denn nur ihm gegenüber so angeschwärzt?
Er sagte ihr nur, daß er's gehört hätte von »den Leuten«. Daß die Verdächtigung aus seiner eigenen Familie gekommen, welche sein Verhältnis mit Pauline niemals gern gesehen hatte, verschwieg er.
Pauline nahm die Sache ernst. Daß er sie in solch einem Verdachte gehabt und noch dazu so lange und ohne ihr ein Wort davon zu sagen, das kränkte sie. Das Mädchen wurde auf einmal ganz still. Sie empfand die Ungerechtigkeit und Erniedrigung, die in seiner Auffassung lag, wie Frauen solche Dinge empfinden, jäh und leidenschaftlich. Sie machte sich im Hintergrunde des Zimmers zu schaffen, ohne ihn anzusehen.
Ihm war nicht wohl dabei zumute. Er wußte zu gut, wieviel er sich ihr gegenüber vorzuwerfen hatte. – Er blickte verlegen auf seine Stiefelspitzen.
Es entstand eine Pause, während der man nur die leichten Atemzüge des Kindes, das inzwischen mit seiner Flasche fertig geworden war, vernahm.
Plötzlich ging Pauline nach dem Bette. Sie nahm den Kleinen aus dem Kissen. »Du hast den Jungen noch gar niche uf'n Arm gehat, Gustav!« sagte sie, unter Tränen lächelnd, und hielt ihm den Kleinen hin.
Er nahm das Kind in Empfang, wie man ein Paket nimmt. Der Junge blickte mit dem starren, leeren Blicke der kleinen Kinder auf die blanken Treffen am Halse des Vaters.
»Getost is er och schon,« sagte Pauline. »Ich ha dersch ja damals geschrieben, aber du hast nischt geschickt dazu. Der Paster war erscht böse und hat tichtig gebissen uf mich, daß mer sowas passiert wor.«
Gustav war inzwischen ins Reine mit sich gekommen, daß er Kind und Mutter anerkennen wolle.
Der Junge streckte die kleine Hand nach dem Schnurrbart des Vaters, Pauline wehrte dem Händchen sanft. »Se sprechen alle, daß er dir su ähnlich säke, Gustav! Wie aus'n Gesichte geschnitten, sprechen de Leite.« –
Der junge Vater lächelte zum ersten Male sein Ebenbild an. Pauline hatte sich bei ihm eingehängt, ihre Blicke gingen liebend von Gustav zu dem Kleinen. Der Bengel hatte endlich den Schnurrbart des Vaters erwischt und stieß einen schrillen Freudenschrei aus.
So gewährten sie das Bild einer glücklichen Familie.
II.
Gustav Büttner kam heute viel zu spät nach Haus zum Mittagbrot. Die Familie hatte bereits vor einer Weile abgegessen. Der alte Bauer saß in Hemdsärmeln in seiner Ecke und schlummerte. Karl hielt die Tabakspfeife, die er eigentlich nur während des Essens ausgehen ließ, schon wieder im Munde. Die Frauen waren mit Abräumen und Reinigen des Geschirrs beschäftigt.
Die Bäuerin sprach ihre Verwunderung darüber aus, daß Gustav so lange ausgeblieben. In der Schenke sitzen am Sonntag Vormittag, das sei doch sonst nicht seine Art gewesen. – Gustav ließ den Vorwurf ruhig auf sich sitzen. Er wußte wohl warum; seine Leute brauchten gar nicht zu erfahren, was sich inzwischen begeben hatte.
Schweigend nahm er auf der Holzbank, am großen viereckigen Familientische Platz. Dann heftelte er seinen Waffenrock auf, wie um sich Platz zu machen für das Essen. Die Mutter brachte ihm das Aufgewärmte aus der Röhre.
Die Büttnerbäuerin war eine wohlhäbige Fünfzigerin. Ihr Gesicht mochte einstmals recht hübsch gewesen sein, jetzt war es entstellt durch Unterkinn und Zahnlücken. Sie sah freundlich und gutmütig aus. Gustav sah ihr von den Kindern am ähnlichsten. In ihren Bewegungen war sie nicht besonders flink, eher steif und schwerfällig. Der schlimmste Feind der Landleute, das Reißen, suchte sie oftmals heim.
Eine der Töchter wollte ihr behilflich sein, aber sie ließ es sich nicht nehmen, den Sohn selbst zu bedienen. Der Unteroffizier war ihr Lieblingskind. Sie setzte die Schüssel, die noch verdeckt war, vor Gustav hin und stützte die Hände auf die Hüften. »Nu paß aber mal auf, Gust!« rief sie und sah ihm schmunzelnd zu, wie er den schützenden Teller abhob. Es war Schweinefleisch mit Speckklößen und Birnen im Grunde des Topfes zu erblicken. »Gelt, dei Leibfrassen, Gust!« sagte sie und lachte den Sohn an. Sie ließ die Blicke nicht von ihm, während er zulangte und einhieb. Jeden Bissen schien die liebevolle Mutter für ihn mitzuschmecken. Gesprochen wurde nichts. Man hörte das Klappern des Blechlöffels gegen die irdene Schüssel; denn der Unteroffizier ersparte sich den Teller. – In der Ecke schnarchte der alte Bauer, sein Ältester war auf dem besten Wege, ihm nachzufolgen, trotz der Pfeife. Am Ofen, der eine ganze Ecke des Zimmers einnahm, mit seiner Hölle und der breiten Bank, hantierten die jüngeren Frauen an dem dampfendem Aufwaschfaß mit Tellern, Schüsseln und Tüchern.
Der Büttnerbauer besaß zwei Töchter. Die dritte Frauensperson war Karls, des ältesten Sohnes, Frau.
Die Büttnerschen Töchter zeigten sich sehr verschieden in der Erscheinung. Man würde sie kaum für Schwestern angesprochen haben. Toni, die ältere, war ein mittelgroßes, starkes Frauenzimmer mit breitem Rücken. Das runde Gesicht, mit roten Lippen und Wangen, erschien wohl hauptsächlich durch seine Gesundheit und Frische hübsch. Sie stellte mit ihrem drallen Busen und kräftigen Gliedmaßen das Urbild einer Bauernschönheit dar.
Ernestine, die jüngere Schwester, war erst vor kurzem konfirmiert worden. Sie stand noch kaum im Anfange weiblicher Entwickelung. Sie war schlank gewachsen, und ihre Glieder zeigten eine bei der ländlichen Bevölkerung seltene Feinheit. Dabei war sie sehnig und keineswegs kraftlos. Ihren geschmeidigen, flinken Bewegungen nach zu schließen mußte sie äußerst geschickt sein. Die Arbeit flog ihr weit schneller von der Hand als der älteren Schwester.
Der Schlummer des Vaters wurde respektiert; man vermied das allzu laute Klappern mit dem Geschirr. Am wenigsten besorgt um den Schlaf des Alten schien Therese, die Schwiegertochter, zu sein. Sie sprach mit tiefer, rauher, etwas gurgelnder Stimme, wie sie Leuten eigen ist, die Kropfansatz haben. Therese war eine große, hagere Person, mit langer, spitzer Nase, ziemlich blaß, aber von knochig-derbem Wuchse, mit starkem Halse.
Sie ging jetzt daran, die abgewaschenen Teller in das Tellerbrett zu stellen. Als sie an ihrem Gatten vorbeikam, dem der Kopf bereits tief auf die Brust herabgesunken war während ihm die Tabakspfeife zwischen den Schenkeln lag, stieß sie ihn unsanft an. »Ihr Mannsen braucht o ne en halben Tog zu verschlofa; weil wir Weibsen uns abrackern missen. Das wär ane verkehrte Welt. Wach uf, Karle!« –
Karl fuhr auf, sah sich verdutzt um, nahm seine Pfeife auf, die er langsam wieder in Brand setzte, und blinzelte bald von neuem mit den Augenlidern. Seine Ehehälfte ging inzwischen brummend und murrend auf und ab.
Theresens Wut wurde gar nicht durch die Schlafsucht des Gatten erregt, an die sie schon gewöhnt war. Vielmehr ärgerte sie sich darüber, daß Gustav von der Bäuerin mit den besten Bissen bewirtet wurde. Sie war ihrem Schwager überhaupt nicht grün. Der jüngere Sohn werde dem älteren gegenüber von den Alten bevorzugt, fand sie. Sie fühlte wohl auch, daß Gustav ihrem Gatten in vielen Stücken überlegen sei, und das mochte ihre Eifersucht erregen. Ganz erbost flüsterte sie den Schwägerinnen zu – soweit bei ihr von einem Flüstern die Rede sein konnte – »de Mutter stackt's Gustaven wieder zu, vurna und hinta!«
Endlich war Gustav fertig mit Essen. Zur Freude seiner Mutter hatte er reine Wirtschaft gemacht. Sich streckend und gähnend, meinte er, daß es in der Kaserne so was freilich nicht gäbe.
Inzwischen war der alte Bauer erwacht. »War Gustav doe?« fragte er, sich mit leeren Augen umsehend. Als er gehört hatte, daß Gustav bereits abgegessen habe, stand er auf und erklärte, mit ihm hinausgehen zu wollen auf die Felder.
Der junge Mann war gern bereit dazu. Er wußte so wie so nicht, wie er den langen Sonntagnachmittag verbringen solle.
Karl ging mit Vater und Bruder aus dem Zimmer, scheinbar, um mit auf's Feld zu gehen. Aber, er verschwand bald. Er hatte nur die Gelegenheit benutzt, herauszukommen, um auf dem Heuboden, ungestört von seiner Frau, weiter schlafen zu können.
Der Bauernhof bestand aus drei Gebäuden, die ein nach der Südseite zu offenes Viereck bildeten. Das Wohnhaus, ein geräumiger Lehmfachwerkbau, mit eingebauter Holzstube, ehemals mit Stroh gedeckt, war von dem jetzigen Besitzer mit Ziegeldach versehen worden. Mit dem schwarz gestrichenen Gebälk und den weiß abgeputzten Lehmvierecken zwischen den Balken, den unter erhabenen Bogen wie menschliche Augen versteckten Dachsenstern, blickte es sauber, freundlich, altmodisch und gediegen drein. Die Winterverpackung aus Moos, Laub und Waldstreu war noch nicht entfernt worden. Das Haus war wohl versorgt, die Leute, die hier wohnten, das sah man, liebten und schützten ihren Herd.
Unter einem langen und hohen Dache waren Schuppen, Banse und zwei Tennen untergebracht. Ein drittes Gebäude enthielt Pferde-, Kuh- und Schweineställe. Scheune wie Stall wiesen noch die althergebrachte Strohbedachung auf.
Die Gebäude waren alt, aber gut erhalten. Man sah, daß hier Generationen von tüchtigen und fleißigen Wirten gehaust hatten. Jeder Ritz war zugemacht, jedes Loch beizeiten verstopft worden.
In der Mitte des Hofes lag die Düngerstätte mit der Jauchenpumpe daneben. Am Scheunengiebel war ein Taubenhaus eingebaut, welches eine Art von Schlößchen darstellte; die Türen und Fenster des Gebäudes bildeten die Ein- und Ausfluglöcher für die Tauben. Ein Kranz von scharfen, eisernen Stacheln wehrte dem Raubgetier den Zugang. In dem offenen Schuppen sah man Brettwagen, Leiterwagen und andere Fuhrwerke stehen, die Deichseln nach dem Hofe gerichtet. Unter dem vorspringenden Scheunendach waren die Leitern untergebracht. Im Holzstall lag gespaltenes Holz für die Küche, Reisig zum Anfeuern und Scheitholz. Das Kalkloch, der Sandhaufen und der Stein zum Dengeln der Sensen fehlten nicht.
Der Sinn für das Nützliche und Notwendige herrschte hier wie in jedem rechten Bauernhofe vor. Aber auch der Gemütlichkeit und dem Behagen war Rechnung getragen. Ein schmales Gärtchen, von einem Holzstaket eingehegt, lief um die Süd- und Morgenseite des Wohnhauses. Hier zog die Bäuerin neben Gemüsen und nützlichen Kräutern verschiedene Blumensorten, vor allem solche, die sich durch starken Geruch und auffällige Farben auszeichneten. Und um die Pracht voll zu machen, hatte man auf bunten Stäben leuchtende Glaskugeln angebracht. In der Ecke des Gärtchens stand eine aus Brettern zusammengestellte Holzlaube, die sich im Sommer mit bunt blühenden Bohnenranken bezog. Im Grasgarten standen Obstbäume, von denen einzelne, ihrem Umfange nach zu schließen, an hundert Jahr alt sein mochten.
Die Tür des Wohnhauses war besonders schön hergestellt. Drei glatt behauene steinerne Stufen führten hinauf. Die Pfosten und der Träger waren ebenfalls von Granit. Auf einer Platte, die über der Tür angebracht war, stand folgender Spruch eingegraben:
»Wir bauen alle feste,
und sind doch fremde Gäste,
und wo wir sollen ewig sein,
da bauen wir gar wenig ein!«
Gustav und der Bauer schritten vom Hause, ohne daß einer dem anderen ein Wort gesagt oder einen Wink gegeben hätte, geraden Weges nach dem Pferdestalle; denn hier war der Gegenstand des allgemeinen Interesses untergebracht: eine zweijährige braune Stute, die der Bauer vor kurzem gekauft hatte. Zum dritten oder vierten Male schon besuchte der Unteroffizier, der erst am Abend vorher in der Heimat eingetroffen war, das neue Pferd. Er hatte sich die Stute auch schon ins Freie hinausführen lassen, um ihre Gänge zu beobachten; aber ein Urteil über das Pferd hatte er noch immer nicht abgegeben, obgleich er ganz genau wußte, daß der Alte darauf wartete. Gustav sagte auch jetzt noch nichts, obgleich er prüfend mit der Hand über die Sehnen und Flechsen aller vier Beine gefahren war.
Die Büttners waren darin eigentümliche Käuze. Nichts wurde ihnen schwerer, als sich gegen ihresgleichen offen auszusprechen. Oft wurden so die wichtigsten Dinge wochenlang schweigend herumgetragen. Jeder empfand das als eine Last, aber der Mund blieb versiegelt, bis endlich die eherne Notwendigkeit oder irgend ein Zufall die Zungen löste. – Es war fast, als schämten sich die Familienmitglieder, untereinander Dinge zu besprechen, die sie jedem Fremden gegenüber offener und leichteren Herzens geäußert haben würden. Vielleicht, weil jedes die innersten Regungen und Stimmungen des Blutsverwandten zu genau kannte und seine eigenen Gefühle wiederum von ihm gekannt wußte.
Vater und Sohn traten, nachdem man das Pferd genügend geklopft und gestreichelt und ihm die Streu frisch aufgeschüttelt hatte, wieder auf den Hof hinaus. Hier verweilte sich Gustav nicht erst lange. Es hatte sich in der Wirtschaft sonst nichts weiter verändert, seit er das letztemal auf Urlaub gewesen war. Die neu aufgestellten Ferkel und die angebundenen Kälber hatte er schon vor der Kirche mit der Bäuerin besehen. Man schritt nunmehr unverweilt zum Hofe hinaus.
Das Gut bestand aus einem langen, schmalen Streisen, der vom Dorfe nach dem Walde hinauslief.
Am unteren Ende lag das Gehöft. Im Walde, der zu dem Bauerngute gehörte, entsprang ein Wässerchen, das mit ziemlich starkem Gefälle zum Dorfbach hinabeilte. An diesem Bächlein lagen die Wiesen des Büttnerschen Grundstückes. Zwischen den Feldern zog sich der breite Wirtschaftsweg des Bauerngutes, mit alten, tief eingefahrenen Gleisen, holperig und an vielen Stellen von Rasen überwachsen, vom Gehöft nach dem Walde hinauf.
Vater und Sohn gingen langsam, jeder auf einer Seite des Weges für sich. Heute konnte man sich Zeit nehmen, heute gab es keine Arbeit. Gesprochen wurde nichts, weil einer vom anderen erwartete, daß er zuerst etwas sagen solle. Bei den einzelnen Schlägen blieb der alte Bauer stehen und blickte den Sohn von der Seite an, das Urteil des jungen Mannes herausfordernd.
Gustav war nicht etwa gleichgültig gegen das, was er sah. Er war auf dem Lande geboren und aufgewachsen. Er liebte den väterlichen Besitz, von dem er jeden Fußbreit kannte. Der Bauer hatte die Hilfe des jüngeren Sohnes in der Wirtschaft all die Zeit über, wo Gustav bei der Truppe war, aufs empfindlichste vermißt.
Karl, der eigentliche Anerbe des Gutes und Hofes, war nicht halb soviel wert als Arbeiter und Landwirt wie der jüngere Sohn.
Sie hatten bereits mehrere Stücke betrachtet, da blieb der Bauer vor einem Kleeschlage stehen. Er wies auf das Stück, das mit dichtem, dunkelgrünem Rotklee bestanden war.
»Sicken Klee hat's weit und breit kenen. – Haa! – In Halbenau hoat noch kee Pauer su an Klee gebrocht. Und der hoat in Haber gestanda. – Haa! – Do kann sich in April schun der Hoase drine verstacken, in dan Klee!« –
Er stand da, breitbeinig, die Hände auf dem Rücken, und sein altes, ehrliches, rotes Bauerngesicht strahlte vor Stolz. Der Sohn tat ihm den Gefallen, zu erklären, daß er besseren Klee zu Ostern auch noch nicht gesehen habe.
Nachdem man sich genügsam an dieser Pracht geweidet, ging's langsam auf dem Wirtschaftswege weiter. Nun war das Schweigen einmal gebrochen, und Gustav fing an zu erzählen. Im Manöver und bei Felddienstübungen war er viel herumgekommen im Lande. Er hatte die Augen offen gehalten und sich gut gemerkt, was er anderwärts gesehen und kennen gelernt von neuen Dingen. Der alte Bauer bekam von allerhand zweckmäßigen Maschinen und Einrichtungen zu hören, die ihm der Sohn zu beschreiben versuchte. »Bei Leiba, bei Leiba!« rief er ein über das andere Mal erstaunt aus. Die Berichte des Sohnes klangen ihm geradezu unglaublich. Besonders daß es jetzt eine Maschine geben solle, welche die Garben bände, das wollte ihm nicht in den Sinn. Säemaschinen, Dreschmaschinen, das konnte er ja glauben, die hatte er auch schon selbst wohl gesehen, aber eine Maschine, welche die Garben raffte und band! »Da mechte am Ende ener och a Ding erfinden, das die Apern stackt oder de Kihe von selber melken tut. Ne, das glob'ch ne! – dernoa, wenn's suweit käma, da kennten mir Pauern glei gonz eipacken. Si's su schun schlimm genuche mit a Pauern bestellt. Dar Edelmann schind uns, und dar Händler zwickt uns; wenn och noch de Maschinen, und se wullen alles besurgen, dernoa sein mir Pauern glei ganz hin!« –
Gustav lächelte dazu. Er hatte in den letzten Jahren doch manches bäurische Vorurteil abgestreift. Er versuchte es, den Vater zu überzeugen, daß das mit den neuen Erfindungen doch nicht ganz so schlimm sei; im Gegenteil, man müsse dergleichen anwenden und nutzbar zu machen suchen. Der Alte blieb bei seiner Rede. Zwar hörte er dem Jungen ganz gern zu; Gustavs lebhafte und gewandte Art, sich auszudrücken, die er sich in der Stadt angeeignet, machte ihm, der selbst nie die Worte setzen gelernt hatte, im stillen Freude und schmeichelte seinem väterlichen Stolze, aber von seiner ursprünglichen Ansicht ging er nicht ab. Das war alles nichts für den Bauern. Solche Neuerungen waren höchstens dazu erfunden, den Landmann zu verderben.
Sie waren unter solchen Gesprächen an den Wald gelangt. Hier lief die Flur in eine sumpfige Wiese aus, die in unordentlichen Niederwald überging. Dahinter erhoben sich einzelne Kiefern, untermengt mit Wacholdersträuchern, Ginster und Brombeergestrüpp. Der Boden, durch die jährliche Streunutzung völlig entwertet, war nicht mehr imstande, einen gesunden Baumwuchs hervorzubringen. Der Büttnerbauer war, wie die meisten seines Standes, ein schlechter Waldheger.
Der alte Mann wollte nunmehr umkehren. Aber Gustav verlangte noch das »Büschelgewände« zu sehen, da sie einmal so weit draußen seien. Diese Parzelle hatte der Vater des jetzigen Besitzers angekauft und dem Gute einverleibt.
Der Bauer zeigte wenig Lust, den Sohn dieses Stück sehen zu lassen, und mit gutem Grunde. Das Stück lag brach, allerhand Unkraut machte sich darauf breit. Der Bauer schämte sich dessen.
»Was habt Ihr denn dort stehen heuer?« fragte Gustav völlig arglos.
»Ne viel Gescheits! Dar Busch dämmt's Feld zu siehre, und a Zehnter-Rehe san och allendchen druffe; da kann duch nischt ne gruß warn.«
Er verschwieg dabei, daß dieses Gewände seit anderthalb Jahren nicht Pflug und nicht Egge gesehen hatte.
»Will denn der Graf immer noch unseren Wald kofen?« fragte Gustav.
Der Büttnerbauer bekam einen roten Kopf bei dieser Frage.
»Ich sullte an Buusch verkofen!« rief er. »Ne, bei meinen Labzeiten wird suwas ne! 's Gutt bleibt zusommde!« Die Zornader war ihm geschwollen, er sprach heiser.
»Ich meente ock, Vater!« sagte Gustav beschwichtigend. »Uns nutzt der Busch doch nich viel.«
Der Büttnerbauer machte Halt und wandte sich nach dem Walde zu. »Ich verkofe och nich an Fußbreit von Gutte, ich ne! Macht Ihr hernachen, wos der wullt, wenn'ch war tud sein. Vun mir kriegt dar Graf dan Buusch ne! Und wenn er mir nuch su vill läßt bietan. Meenen Buusch kriegt ar ne!« Der Alte ballte die Fäuste, spuckte aus und wandte dem Walde den Rücken zu.
Gustav schwieg wohlweislich. Er hatte den Vater da an einer wunden Stelle berührt. Der Besitzer der benachbarten Herrschaft hatte dem alten Bauer bereits mehr als einmal nahe legen lassen, ihm seinen Wald zu verkaufen. Solche Ankäufe waren in Halbenau und Umgegend nichts Seltenes. Die Herrschaft Saland, die größte weit und breit, ursprünglich nur ein Rittergut, war durch die Regulierung und die Gemeinheitsteilung und später durch Ankauf von Bauerland zu ihrer jetzigen Größe angewachsen. Das Büttnersche Bauerngut lag bereits von drei Seiten umklammert von herrschaftlichem Besitz. Der Büttnerbauer sah mit wachsender Besorgnis dem immer weiteren Vordringen des mächtigen Nachbars zu. Seine Ohnmacht hatte allmählich eine grimmige Wut in ihm erzeugt gegen alles, was mit der Herrschaft Saland in Zusammenhang stand. Verschärft war seine Gehässigkeit noch worden, seit er bei einem Konflikte, den er mit der Herrschaft wegen Übertritts des Damwildes auf seine Felder gehabt, in der Wildschadenersatzklage abschlägig beschieden worden war.
Man schritt den Wiesenpfad hinab, am Bache entlang. Von rechts und links, von den höher gelegenen Feldstücken, drückte das Wasser nach der Bachmulde zu. Das dunkle, allzu üppige Grün verriet die Feuchtigkeit einzelner Flecken. Es gab Stellen, wo der Boden unter dem Tritt des Fußes erzitterte und nachzugeben schien. Der ganze Wiesengrund war versumpft.
Gustav meinte, daß hier Drainage angezeigt sei.
»Wu fullt ak daderzut 's Geld rauskumma, un de Zeit!« rief der Büttnerbauer. »Mir warn a su och schunsten ne fertg! Unserens kann'ch mit su was duch ne abgahn. Drainierchen, das is ganz scheen und ganz gutt for an Rittergutsbesitzer oder anen Ökonomen; aber a Pauer ...«
Er vollendete seine Rede nicht, verfiel in Nachdenken. Die ganze Zeit über hatte er etwas auf dem Herzen dem Sohne gegenüber, aber er scheute das unumwundene Geständnis.
»Es mechten eben a poar Fausten mehr sein für's Gutt!« sagte er schließlich. »Mir sein zu wing Mannsen, Karle und ich, mir zwee alleene. Die Weibsen täten schun zulanga; aber dos federt ne su: Weiberarbeit. Mir zwee, Karle und ich, mir wern de Arbeit ne Herre. A dritter mechte hier sein!« –
Gustav wußte nun schon, worauf der Alte hinaus wollte. Es war die alte Geschichte. Daß er dem Vater fehle bei der Arbeit, wollte er schon glauben. Denn Karl war ja doch nicht zu vergleichen mit ihm, in keiner Weise, das wußte der selbstbewußte junge Mann recht gut. – Der Vater klagte ja nicht zum ersten Male, daß die Wirtschaft zurückgehe, seit Gustav bei der Truppe sei. Aber, das konnte nichts helfen, Gustav war nicht gesonnen, die Tressen aufzugeben für die Stellung eines Knechtes auf dem väterlichen Hofe. Ja, wenn's noch für eigene Rechnung gewesen wäre! Aber für die Familie sich abschinden, für Eltern, Bruder und Schwestern. Für ihn selbst sprang ja dabei gar nichts heraus. Das Gut erbte ja einstmals nicht er, sondern Karl. –
Er erwiderte daher auf die Klage des Vaters in kühlem Tone: »Nehmt Euch doch einen Knecht an, Vater!«
Der Alte blieb stehen und rief mit heftigen Armbewegungen: »An Knacht! Ich sull mer an Knacht onnahma? Ich mecht ock wissen, wu dar rauswachsen sillte. Achzig Toler kriegt a su a Knacht jetzt im Juhre, und's Frassen obendrein. Und do mechte och noch a Weihnachten sen und a Erntescheffel. Mir hon a su schun zu vills Mäuler zu stopfa, hon mir! Wusu kann ich denne, und ich kennte mer an Knacht halen! – Ne, hier mechte ener har, dar zur Familie geherte, dan wer keenen Lohn ne brauchten zahla. So ener mechte hier sen!«
Der Unteroffizier zuckte die Achseln, und der Vater sagte nichts weiter. Der Rückweg wurde schweigend zurückgelegt. In dem Gesichte des Alten zuckte und witterte es, als führe er das Gespräch innerlich weiter. Ehe sie das Haus betraten, hielt er den Sohn am Arme fest und sagte ihm ins Ohr: »Ich will der amal a Briefel weisen, Gustav, das'ch gekriegt ha'. Komm mit mer ei die Stube!« –
Der Büttnerbauer ging voraus in die Wohnstube. Außer der alten Bäuerin war hier nur die Schwiegertochter anwesend. Therese schaukelte ihr Jüngstes, das an einem durch zwei Stricke am Mittelbalken der Holzdecke befestigten Korbe lag, hin und her. Der Bauer begann in einem Schubfache zu kramen. »Woas suchst de denne, Büttner?« fragte die Bäuerin. »'s Briefel von Karl Leberechten.«
»Dos ha'ch verstackt!« rief die alte Frau, und kam aus ihrer Ecke hervorgehumpelt. »Wart ack, wart!« Sie suchte auf der Kommode, dort lag in einem Schächtelchen ein Schlüssel, mit diesem Schlüssel ging sie zum Spind, schloß es auf und entnahm dem obersten Brett ein altes Buch mit vielen Einlagen und Buchzeichen. In dem Buche blätterte sie eine Weile, bis sie endlich auf das gesuchte Schreiben kam. »Doe is er!«
Der Büttnerbauer berührte den Brief wie alles Geschriebene mit besonderer Vorsicht, ja mit einer Art von Scheu. Dann schob er ihn dem Sohne hin: »Lase a mal dos, Gustav!«
Der Briefbogen hatte großes Quartformat und trug rechts oben eine Firma: »C.G. Büttner, Materialwarenhandlung en gros & en detail.« Folgte die Ortsbezeichnung.
Gustav sah nach der Unterschrift. Sein eigener Name stand darunter: Gustav Büttner. Der Briefschreiber war demnach sein ihm gleichaltriger Vetter, Kompagnon im Geschäfte des alten Karl Leberecht Büttner. Gustav hatte Onkel und Vetter ein einziges Mal gesehen in seinem Leben, als sie vor Jahren dem Heimatdorfe einen flüchtigen Besuch von der Stadt aus abgestattet.
Dieser Karl Leberecht war ein um wenige Jahre jüngerer Bruder des Büttnerbauern. Er hatte Halbenau frühzeitig verlassen als ein großer Tunichtgut. Jahrelang war nichts von ihm verlautet. Dann tauchte er plötzlich als verheirateter Mann und Inhaber eines Grünwarengeschäftes in einer mittelgroßen Stadt der Provinz auf. Inzwischen hatte sich sein Geschäft zur »Materialwarenhandlung en gros & en detail« ausgewachsen.
Die beiden Familien, die eine in der Stadt, die andere auf dem Dorfe, hatten so gut wie gar keine Berührungspunkte mehr. Nur bei der Erbschaftsregulierung, vor nunmehr dreißig Jahren, war man einander auf kurze Frist wieder einmal näher getreten. In den letzten Jahrzehnten hatte man nur ganz gelegentlich etwas voneinander gesehen oder gehört.
G. Büttner jun. also schrieb im Namen seines Vaters, daß man die Hypothek, welche von der Erbteilung her noch auf dem Büttnerschen Bauerngute in Halbenau stand, hiermit kündige, und daß man den Eigentümer besagten Bauerngutes ersuche, Zahlung zum Iohannitermine zu leisten. Als Grund der Kündigung war Erweiterung des Geschäftes angegeben.
Der Brief war durchaus in geschäftlichem Stile gehalten und enthielt nichts, was darauf hindeutete, daß Schreiber und Empfänger in naher Blutsverwandtschaft standen.
Vater und Mutter hielten sich hinter dem Sohne, während er las, und blickten ihm über die Schulter.
»Habt Ihr schon was derzu getan, Vater?« meinte Gustav, als er fertig war mit lesen.
»Wie meenst de?« fragte der Alte und sah ihn verständnislos an.
»Ob Ihr schon derzu getan habt wegen an Gelde? Am ersten Juli müßt Ihr zahlen.«
»Siehst de, Moann!« rief die Bäuerin. »Ich ho dersch immer geseut, de mechtest federn und nach an Galde sahn.«
»Ich bin o schun, und ich ha mich befrogt im a Gald. Bei Kaschelernsten bi'ch gewast; der spricht, ar wullt mersch ack gahn, wenn'ch 'n sechsdehalb Prozent versprechen täte.«
»Das sieht dem Kujon ähnlich!« rief Gustav. Sein Onkel Kaschel war der Inhaber des Kretschams von Halbenau. Er war Witwer, ehemals mit einer Schwester des Büttnerbauern verheiratet. Er galt in Halbenau, wo Bargeld ziemlich rar war, für den ersten Kapitalisten.
»Da mechte aber bald Rat werden,« sagte Gustav nachdenklich. »Sonst werdet Ihr verklagt, Vater!«
»Mei Heiland! Siehste's Moann!« rief die Bäuerin. »Ich ho's schun immer geseut iber den Pauer: mir wern noch gepfändt, ho'ch ibern geseut, de werscht's derlaben, Traugott!«
»Nu, dos gleb 'ch do ne von Karl Leberechten!« meinte der Alte; aber sein unsicherer Blick zeigte, daß ihm nicht ganz geheuer zumute sei.
»Die werden wohl nich lange fackeln!« meinte Gustav.
»Siehste, Traugott, siehste! Gustav meent och su!« rief die Bäuerin. »Su is er aber nu, der Vater. Er bedenkt sich, und er bedenkt sich, und er tut nischt derzu. Er werd's nuch soweit bringa, daß se 'n 's Gut wagnahmen kumma.«
Der Büttnerbauer warf seiner Ehehälfte einen finsteren Blick zu. Das Wort hatte ihn getroffen. »Halt de Fresse, Frau!« rief er ihr zu. »Was verstiehst denn du vun a Geschäften!«
Die Bäuerin schien mehr betrübt als beleidigt über diese Worte des Gatten. Sie zog sich schweigend in ihre Ecke zurück. Gustav überlegte eine Weile, welchen Rat er seinem Vater geben solle. Einen Augenblick dachte er daran, dem Vater abermals vorzuschlagen, daß er seinen Wald an die Herrschaft verkaufen möchte. Aber, dann fiel ihm ein, wie dieser Vorschlag den Alten vorhin erbost hatte. Er kannte seinen Vater, den hatte noch niemals jemand von seiner Ansicht abgebracht.
»Ich weiß keenen andern Rat, Vater,« sagte er schließlich. »Ihr müßt in die Stadt. Hier weit und breit is doch keen Mensch mit Gelde, außer Kaschelernsten. In der Stadt, dächt'ch, müßte doch Geld zu bekommen sein.«
»Das ho'ch och schun gedacht!« meinte der Büttnerbauer mit nachdenklicher Miene.
Es trat ein langes Schweigen ein. Man hörte nur das leichte Knarren der Stricke in den Haken und das Knistern des Korbes, in welchem Therese den Säugling hin und her schaukelte. –
Jetzt traten die beiden Mädchen ins Zimmer. Toni war im vollen Staate. Ihre üppigen Formen waren in ein Kleid von greller, blauer Farbe gezwängt, das vorn etwas zu kurz geraten war, und so die plumpen, schwarzen Schuhe sehen ließ. An ihrem Halse blitzte eine Brosche von buntem Glase. Ihr blondes Haar hatte sie stark pomadisiert, so daß es streifenweise ganz braun aussah. Offenbar war sie sehr stolz über den Erfolg ihrer Toilettenkünste. Steif und gezwungen, als sei sie von Holz, bewegte sie sich. Denn die Zugschuhe, der Halskragen und das Korsett waren ihr ungewohnte Dinge. Sie ging einher wie eine Puppe.
Gustav, der in der Stadt seinen Geschmack gebildet hatte, belächelte die Schwester. Heute abend sei Tanz im Kretscham, berichtete Toni dem Bruder. Sie hoffte, daß er sie dahin begleiten würde, darum hatte sie sich auch so besonders herausgeputzt, um vor seinem verwöhnten Auge zu bestehen. – Der alte Bauer, der allen Putz und unnützen Tand nicht leiden mochte, brummte etwas von »Pfingstuchse«! Aber, die Bäuerin nahm die Tochter in Schutz. Am Sonntage wolle solch ein Mädel auch einmal einen Spaß haben, wenn sie sich Wochentags abgerackert habe im Stalle, Hause und auf dem Felde.
Das Abendbrot wurde zeitiger anberaumt, damit die Kinder nichts von dem Vergnügen versäumen sollten.
Gustav begleitete die Schwester zum Kretscham. Unterwegs erzählte ihm Toni, daß Ottilie, die Tochter Kaschelernsts, des Kretschamwirtes, in den letzten Tagen wiederholt und zuletzt heute früh in der Kirche gefragt habe, ob Gustav nicht zum Tanze in den Kretscham kommen werde. Der Unteroffizier konnte sich eines Lachens nicht enthalten, sobald er nur die Cousine erwähnen hörte. Ottilie Kaschel war um einige Jahre älter als er, aber, als die Tochter Kaschelernsts, wohl die beste Partie von Halbenau. Gustav hatte sich in früheren Zeit gelegentlich sein Späßchen mit ihr erlaubt; er wußte ganz gut, daß sie ihn gern mochte, aber der Gedanke an ihre Erscheinung machte ihn lachen. Sie hatten ein Pferd bei der Schwadron, einen alten Schimmel: die »Harmonika«, dürr, überbaut, mit Senkrücken; an den erinnerte ihn seine Cousine Ottilie.
Gustav ließ die Schwester allein in den Kretscham treten. Er sagte, er werde nachkommen. Oben im Saale glänzten schon die Fenster, das Schmettern der Blechmusik, untermischt mit dem dumpfen Stampfen und Schleifen der Tänzer, drang auf die Straße hinaus.
Einige Tage später fuhr der Büttnerbauer im korbgeflochtenen Kälberwägelchen durchs Dorf. Er saß ganz vorn im Wagen, so daß er den Pferdeschwanz beinahe mit den Füßen berührte, auf einem Gebund Heu, hinter ihm lagen eine Anzahl gefüllter Säcke.
Er hatte sich rasiert, was er sonst nur am Sonnabend abend tat, er trug ein reines Hemd, den schwarzen Rock und einen flachen Filzhut – sichere Wahrzeichen, daß es nach der Stadt ging.
Als er am Kretscham von Halbenau vorbeikam, stand dort sein Schwager Ernst Kaschel in der Tür, Zipfelmütze auf dem Kopfe, die Hände unter der Schürze, in der echten Gastwirtspositur.
Der Bauer stellte sich, als sähe er den Gatten seiner verstorbenen Schwester nicht, blickte vielmehr steif geradeaus auf die Landstraße, während er sich dem Kretscham näherte, und gab dem Rappen die Peitschenschmitze zu fühlen, damit er sich in Trab setzen solle.
Der Büttnerbauer war seinem Schwager Kaschel niemals grün gewesen. Das gespannte Verhältnis zwischen den Verwandten stammte von der Erbauseinandersetzung her, die der Bauer nach dem Tode des Vaters mit seinen Geschwistern gehabt hatte.
Aber der Gastwirt ließ den Schwager nicht unangeredet vorüberfahren. »Gun Tag o, Traugott!« rief er dem Bauer zu. Und als dieser auf den Gruß nicht zeichnete, sprang der kleine Mann behende die Stufen vom Kretscham auf die Straße hinab, trotz seiner Holzpantoffeln, und lief auf das Gefährt zu. »Holt a mal, Traugott! Ich ha mit dir zu raden.« –
Der Bauer brachte das alte Tier, das, wenn einmal im Schusse, schwer zu parieren war, durch ein paarmaliges kräftiges Anziehen der Zügel endlich zum stehen und fragte mit wenig erfreuter Miene, was »zum Schwerenschock« jener von ihm wolle.
Der Kretschamwirt lachte; es war dies eine von Ernst Kaschels Eigentümlichkeiten, in allen Lebenslagen zu grinsen. Es gab ihm das etwas Verlegenes, ja geradezu Törichtes und Tölpelhaftes – jedenfalls hatte es der Mann trotz dieser Eigenheit in seinem Leben zu einer gewissen Macht über seine Mitmenschen gebracht.
Kaschelernst, wie er meist genannt wurde, verzog also sein kleines, bartloses Gesicht zu einem Grinsen und fragte, statt zu antworten: »Hast de 's denne so eilig, Traugott! Ich wollt ack freun, wu de su frih an Tage schun hin wolltest?«
»Ei de Stadt, Hafer verlosen,« erwiderte Büttner, ärgerlich über den Aufenthalt und über das verhaßte Lächeln des Schwagers, dessen wahren Sinn er am eigenen Leibe oft genug erfahren hatte. Schon hob er die Peitsche, um den Rappen von neuem anzutreiben. Aber der Wirt hatte das Pferd inzwischen am Kehlriemen gefaßt und kraute es in den Nüstern, so daß der Bauer, wäre er jetzt losgefahren, den Schwager höchst wahrscheinlich über den Haufen gerannt hätte.
Kaschelernst war ein kleines, hiefriches Männchen, mit rötlich glänzendem, dabei magerem Gesicht. Den feuchten, schwimmenden Augen konnte man die Liebhaberei des Wirtes für die Getränke ansehen, die er selbst verschänkte. Mit dem kahlen, spitzen Kopfe, dem fliehenden Kinn und dem Rest von vorspringenden Zähnen in dem bartlosen Munde sah er einer alten Ratte nicht unähnlich. Seine Glatze deckte tagein, tagaus eine gewirkte Zipfelmütze, der Leib war in die Wirtsschürze eingeschnallt, an den Füßen trug er blaue Strümpfe, in denen die Beinkleider verschwanden.
Er ließ ein »Ho, Alter, ho!« vernehmen – was dem Pferde galt – dann wandte er sich mit blödem Lachen an seinen Schwager: »Wo in drei Teifels Namen nimmst denn du dan Hafer her, zum verkefen, jetzt im Frühjuhre?«
»Mir hon gelt allens zusommde gekroatzt uf'n Schittboden, 's is'n immer nuch ane Handvell ibrig fir de Pferde. Ich dachte ock, und ich meente, weil er jetzt on Preis hat, dacht'ch, du verkefst'n, ehbs daß er wieder billig wird, dar Hafer.«
»Ich kennte grode a Zentner a zahne gebrauchen,« meinte der Gastwirt, »wenn er nich zu huch käme.«
»Der Marktpreis stieht ja im Blattel.«