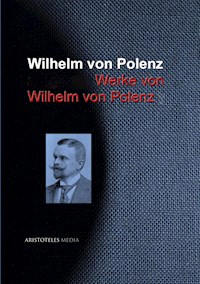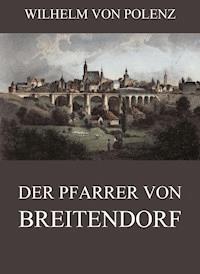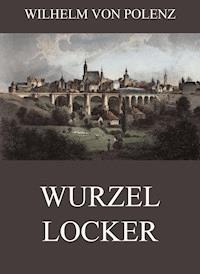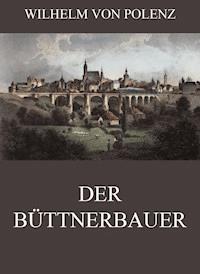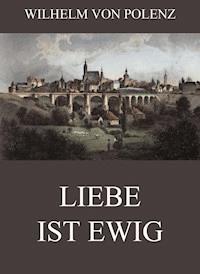
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Weiter in die Breite des Lebens hinein wagt sich Polenz im Roman "Liebe ist ewig".Die engere Heimat, die Provinz liegt hier hinter ihm, der Roman spielt teils in München, teils in Berlin, erzählt die Jugendgeschichte einer künstlerisch begabten Großhändlerstochter Jutta Reimers, die schließlich die Frau eines aus Tirol stammenden Bildhauer heiratet ....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liebe ist ewig
Wilhelm von Polenz
Inhalt:
Wilhelm von Polenz – Biografie und Bibliografie
Liebe ist ewig
I
II
III
i.V.
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
Liebe ist ewig, W. von Polenz
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849639013
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Wilhelm von Polenz – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 14. Jan. 1861 auf Schloß Ober-Kunewalde (sächs. Oberlausitz), gest. 13. Nov. 1903 in Bautzen. studierte die Rechte in Berlin, Breslau und Leipzig, nahm aber nach zweijähriger Amtstätigkeit als Referendar in Dresden seinen Abschied, um die Verwaltung seines Familienguts zu übernehmen. Als Schriftsteller führte er sich mit dem Roman: »Sühne« (Dresd. 1891, 2 Bde.) ein. Der damals beginnenden jüngstdeutschen Richtung wendete er sich mit der novellistischen Studie: »Die Versuchung« (Dresd. 1891) und mit der Skizzensammlung: »Karline« (Berl. 1894) zu, in der er in Vers und Prosa die Schreibweise zahlreicher modernster Autoren geschickt nachempfand. Seine dramatischen Versuche mit den Schauspielen: »Heinrich von Kleist« (Dresd. 1891), »Preußische Männer« (1893), »Andreas Bockholdt« (Dresd. 1898), »Heimatluft« (1900), »Junker und Fröner« (Berl. 1901), blieben für die Bühne, trotz vereinzelter Aufführungen, belanglos. Dagegen betrat P. sein eigenstes Gebiet mit dem gehaltvollen religiösen Roman: »Der Pfarrer von Breitendorf« (Berl. 1893, 3 Bde.; 3. Aufl. 1904), dem die beachtenswerten Romane: »Der Büttnerbauer« (das. 1895, 10. Aufl. 1906), »Der Grabenhäger« (das. 1898, 2 Bde.; 3. Aufl. 1903), »Thekla Lüdekind. Die Geschichte eines Herzens« (das. 1900, 2 Bde.; 3. Aufl. 1902), »Liebe ist ewig« (das. 1901, 3. Aufl. 1904), »Wurzellocker« (das. 1902) und »Glückliche Menschen« (5. Aufl., das. 1905) folgten. P. schrieb noch die Novellen: »Reinheit« (Berl. 1896), »Wald« (das. 1899) und »Luginsland«, Dorfgeschichten (3. Aufl., das. 1905). Die Eindrücke einer Reise nach Amerika enthält sein interessantes Buch »Das Land der Zukunft« (Berl. 1903, 5. Aufl. 1904). Seine nachgelassenen Gedichte wurden u. d. T. »Erntezeit« (Berl. 1904) veröffentlicht. P. vereinigt als Romanschriftsteller vorzügliche Charakterzeichnung mit anziehender, in lebendigstem Heimatsgefühl wurzelnder Darstellung des Milieus. Vgl. Ilgenstein, Wilhelm v. P. (Berl. 1904).
Liebe ist ewig
I
Jutta mußte ihrem Bruder Eberhard wieder einmal bei seinen Experimenten helfen. Das Zimmer glich einem Naturalienkabinett. Auf Schränken standen ausgestopfte Vögel, auf Tischen und Kommoden erblickte man Steine, Erze, Gläser mit Spirituspräparaten, an den Wänden hingen Kästen, hinter deren Glasscheiben Schmetterlinge und Käfer aufgespießt waren. Vom Bücherbrett grinste unheimlich der Totenschädel herab. Der große viereckige Tisch in der Mitte des Zimmers war vollgestellt mit physikalischen Instrumenten; sie waren kostbarer, als man sie für gewöhnlich im Besitze eines siebzehnjährigen Gymnasiasten findet. Es herrschte in dem Raume ein undefinierbarer Geruch, der sich zusammensetzte aus der Ausdünstung ausgestopfter Tiere, kaltem Zigarettenrauch und dem ätzenden Aroma von allerhand Säuren und Essenzen. Eberhard hatte sein Zimmer das »Laboratorium« getauft, und die Hausgenossen waren ihm darin gefolgt, es so zu nennen.
Seine Schwester, um drei Jahre jünger als er, stand dabei, während er an der Induktionsmaschine herumhantierte. Er gab ihr barsche Befehle. Jutta reichte ihm wortlos, was er brauchte. Ihr Auge verfolgte den Fortgang des Experiments mit dem Blicke kühler Gewohnheit; offenbar war ihre Seele nicht dabei.
Eberhard tyrannisierte das Mädchen, ohne Bosheit, aus jenem naiven Selbstbewußtsein des jungen Mannes heraus, das ihm früh schon sagt: du bist auf der Welt, um zu regieren. Zunächst wurde dieses Regiment an der ausgeübt, die sich am wenigsten wehren konnte, an der kleinen Schwester.
Vor einem Jahre noch hatte Eberhard einen über sich gehabt, der ihm seine Faust schwer fühlen ließ: seinen älteren Bruder, Kurt. Aber Kurt war vom Vater nach Südamerika geschickt worden, um die Handelsinteressen, die das Haus Reimers dort hatte, an Ort und Stelle wahrzunehmen.
Seit der ältere Bruder jenseits des großen Wassers war, atmete Eberhard auf. Die fünf Jahre, die Kurt ihm im Alter voraus war, hatten den empfindlichen Knaben schwer gedrückt. Jetzt erst wurde für ihn Raum zur Entfaltung. Bisher war er der Kleine gewesen, der unter dem Schatten eines Größeren heranwuchs; nun endlich war er »junger Herr« geworden, brauchte nicht mehr davor zu zittern, von dem Älteren lächerlich gemacht oder gar bemitleidet zu werden.
Herr Reimers, der Vater dieser Kinder, war viel außer dem Hause. Seine Geschäfte führten ihn von einem Ende Europas zum andern. Er war schon seit einigen Jahren verwitwet.
Wenn er von seinen Reisen nach Haus zurückkehrte, wollte er Behaglichkeit vorfinden und aufgeräumtes Wesen. Jutta und Eberhard wußten das; denn sie waren, wie die meisten Kinder, gute Beobachter. So hatten sie auch gemerkt, daß der Vater den unangenehmen Dingen aus dem Wege ging, und daß man am besten fuhr, wenn man ihm Unerfreuliches nach Möglichkeit verschwieg. Ohne sich verabredet zu haben, richteten die Geschwister ihr Verhalten nach dieser Eigenheit des Vaters ein. Ja, das war eigentlich das einzige, worin sie stillschweigend einig waren.
Wie vielfach in Familien, wo die Mutter fehlt, erschienen die Kinder, was das Äußere anbetraf, ziemlich selbständig und früh gewitzigt. Sie hatten sich mit Fremden einrichten müssen, waren gezwungen gewesen, sich zu verteidigen, ihre Stellung zu behaupten. Sie waren gewohnt, einerseits, sich selbst zu helfen; aber da der Hausstand, in dem sie aufgewachsen, ein großer war, so hatten sie auch die Angewohnheit angenommen, für sich arbeiten zu lassen, die Dienstboten zu befehligen und in Trab zu halten.
Die angejahrte Witwe, welche der Vater angenommen hatte, um die fehlende Hausfrau in der Wirtschaft zu ersetzen, war auch nicht die Person danach, den Kindern Achtung einzuflößen. Frau Hölzl befand sich in steter Sorge, den gutbezahlten Posten bei Herrn Reimers einzubüßen. Ihr vornehmstes Bestreben war, den Hausherrn bei guter Laune zu erhalten. Durch ihr System des Vertuschens aber war sie schnell in Abhängigkeit geraten von den Kindern, die sich die zweifelhafte Lage der Dame zunutze machten.
Da der Vater nur zeitweise zu Hause war und dann allerhand Abhaltung geschäftlicher und geselliger Natur hatte, waren die Kinder viel auf sich selbst angewiesen. Eberhard war Primaner und stand nicht weit von der Abgangsprüfung. Jutta besuchte eine Töchterschule. Sie gingen jedes seinen eigenen Weg, störten einander nicht in ihren Freundschaften, besonderen Liebhabereien und all den Dingen, wo zwischen Knabe und Mädchen von Natur eine Grenze gesetzt ist. Da die Induktionsmaschine aus irgendeinem rätselhaften Grunde heute nicht funktionieren wollte, wurde sie von Eberhard mit einer Verwünschung beiseitegeschoben. Jutta wollte gehen, weil sie glaubte, sie habe nun frei, als er ihr zurief: sie solle ihm helfen beim Mikroskop. Schon hatte er den Kasten mit den Präparaten herbeigeholt und begann, das Instrument einzustellen, als auf der Stiege Schritte ertönten und ein Klopfen an der Tür vernommen wurde.
Ohne das »Herein« abzuwarten, trat ein junger Mann ein, von großer Gestalt, mit rötlichem Haar und unreiner Gesichtsfarbe. Seine Erscheinung wurde nicht gehoben durch den lückenhaften Bartwuchs, der an eine schlecht aufgegangene Saat erinnerte.
Bruno Knorrig schien sich hier zu Haus zu fühlen. Er sprach laut und lachte ohne ersichtlichen Grund schon auf der Schwelle. Seinen Überzieher riß er herunter und warf ihn über die nächste Stuhllehne. Dabei fiel aus der Tasche ein Buch zur Erde. Eberhard hob es auf, wohl mehr aus Neugier, als aus Höflichkeit.
»Ach, laß doch!« rief Bruno und wollte es ihm wegnehmen. »Ich sah's ausliegen, und da's mit drei Mark fünfzig statt für sechs angezeigt war, kaufte ich's. Ich dachte, daß es was für dich wäre. Naturwissenschaftlich, du verstehst!« – – Dabei ein Blick auf das Mädchen.
Jutta runzelte die Stirn, sie verstand die Andeutung.
»Hm, du!« machte Eberhard, in dem Buche blätternd, »für kleine Mädchen allerdings nichts!«
»Wir können's uns auch ein andermal ansehen, dächte ich«, fiel ihm Bruno ins Wort, der um keinen Preis die niedliche Jutta vertreiben wollte.
Aber bei Eberhard hatte die halbe Seite, die er gelesen, bereits gezündet. Er bedeutete die Schwester, daß die Herren allein gelassen zu sein wünschten. Mit einem Blicke des Bedauerns sah Bruno das Mädchen leichtfüßig entschwinden.
Die jungen Männer ahnten nicht, wie gern Jutta von ihnen ging. Aus Bruno Knorrig machte sie sich nichts, sie fand ihn langweilig und lächerlich. Mit früh entwickeltem Blick für dergleichen kritisierte sie seinen Aufzug, seinen Bart, seinen schlechten Teint.
Viel bessere Unterhaltung als in dem verräucherten Laboratorium wußte sie an einer andern Stätte ihrer warten, der ihre kleinen Füße sie jetzt im ungeduldigen Laufe entgegentrugen.
Im Rückhause, durch einen schmalen Hof vom Vordergebäude getrennt, drei Treppen hoch, hatte ein Kunstmaler sein Atelier aufgeschlagen. Herr von Weischach hieß er. Mit ihm war Jutta Reimers befreundet; es verging kaum ein Tag, wo sie ihn nicht auf eine Viertelstunde wenigstens aufgesucht hätte.
Weischach war kein Jüngling mehr. Ehe er sich der Kunst zugewandt hatte, war er Soldat gewesen. Mit dem Titel Oberstleutnant hatte er den Abschied genommen. Die Malerei war von Jugend auf seine Passion gewesen, hatte ihn weit mehr interessiert als der königliche Dienst. Aber Familienrücksichten und das Bewußtsein, daß sein Können nicht ausreiche, um die Existenz darauf zu gründen, hatten ihn abgehalten, den bunten Rock mit dem Malerkittel zu vertauschen. Dann machte er eine kleine Erbschaft, die es ihm ermöglichte, den Traum seines Lebens zu verwirklichen. Eine längere Kunstreise führte ihn nach Italien und Griechenland. Nachdem er sich genügend durch Antike und Renaissance inspiriert glaubte, wählte er München zum Aufenthalt, in dem Glauben, daß, wenn ihm zur Kunstübung noch etwas fehle, es ihm hier durch die Luft gewissermaßen zufliegen müsse. Er hatte sich eine Wohnung mit Atelier gemietet und bemalte eine Leinwand nach der andern. Im Sommer ging er nach Dachau, und im Winter verwandte er die Studien, die er von dort mitbrachte, zu Bildern.
Die Bekanntschaft von Weischach und Jutta war in harmlosester Weise im Hausflur angeknüpft worden. Dem Maler war das Gesicht des Mädchens aufgefallen, und da er für ein Genrebild, welches er plante, einen jugendlichen Kopf brauchte, der gerade diese Mischung von süßer, ahnungsvoller Kindlichkeit und schlummernder Weiblichkeit wiedergäbe, so hatte er Jutta Reimers eines Tages einfach gefragt, ob sie ihm eine Stunde sitzen wolle. Das Mädchen bedachte sich keinen Augenblick, ihm zu folgen.
Mit einer Stunde war es natürlich nicht getan. Jutta fand Gefallen an dem Gemalt-werden. Für sie hatten die Sitzungen, abgesehen von all dem Interessanten, was das Atelier bot, überdies den Reiz des Unerlaubten. Der Vater durfte nicht wissen, wo sie so manche ihrer schulfreien Stunden zubringe. Denn wenn auch Herr Reimers durchaus nicht zu den strengen Vätern gehörte, so lehrte dem jungen Dinge doch eine frühreife Wahrnehmung, daß der Vater, der über manches ein Auge zudrückte, ihren Verkehr im Atelier eines Kunstmalers nicht dulden werde. Da aber Herr Reimers viel von Hause abwesend war, und da er, wenn anwesend, sich auch nicht eingehend darum zu kümmern pflegte, was seine Kinder zu jeder Tagesstunde trieben, so war es Jutta bisher leicht geworden, ihr Geheimnis zu wahren. Eberhard freilich wußte darum; da es aber auch für ihn mancherlei gab, was vor des Vaters Augen versteckt werden mußte, so hatte er allen Grund, die Schwester nicht zu verraten.
Es war heute schon etwas spät geworden. Jutta wußte, daß Weischach auf sie gewartet haben würde. Er war neuerdings wieder mal ganz erfüllt von einem Bilde, zu dem er, wie er sagte, Jutta »die Inspiration« verdanke.
Sie kannte ihn nun schon ziemlich genau in seinen Eigentümlichkeiten. Wenn er einen Einfall hatte, dann war er voll Ungeduld, lief im Atelier auf und ab, zündete sich eine Zigarette an der andern an, dabei heftig sprechend und gestikulierend. »Ich habe einen großartigen Gedanken!« Das wiederholte sich in unzähligen Tonarten. Dann gab er Jutta die zärtlichsten Namen. Sie war seine »Göttin«, seine »gute Fee«, sein »Genius«, seine »Fornarina«. Dann schenkte er ihr Blumen, und sie bekam Pralinés zu essen, soviel sie wollte.
Und ein paar Wochen darauf war all die Herrlichkeit zu Ende. Dann hatte er angefangen zu arbeiten, Sitzung auf Sitzung, hatte mühselig zunächst mit Reißkohle die Umrisse auf die präparierte Leinwand gebracht, die Grundfarbe aufgetragen, sorgfältig die Verhältnisse abgewogen, Lichter aufgesetzt. Hier Licht, dort Schatten verstärkt, durch den Spiegel die Richtigkeit der Zeichnung studiert, radiert, übermalt, das Ganze umgeworfen und von neuem angefangen. Bis er schließlich verzweifelnd die Leinwand wegstellte, mit der bemalten Seite gegen die Wand, um nur nicht sein Machwerk vor Augen zu haben, das er jetzt eine »elende Stümperei« nannte.
Wochenlang konnte Herr von Weischach nach einer solchen Niederlage untätig sitzen, Bücher lesend, die von Kunst handelten, und Zigaretten rauchend. In solchen Zeiten brauchte er Jutta Reimers ganz besonders notwendig; sie sei der »einzige Mensch«, mit dem man ein »vernünftiges Wort« reden könne. Die Unterhaltung war jedoch einseitig. Er hielt weitschweifige Vorträge über Pleinair und Impressionismus, räsonierte auf die Kollegen Kunstmaler und pries seine eigene Malweise als die einzig richtige. Jutta, die nur zum allergeringsten Teile verstand, was er sagte, da er in technischen Ausdrücken schwelgte, vertrieb sich die Zeit, indem sie in Albums blätterte, in Zeitschriften las, Pralinés aß oder mit der großen dreifarbigen Angorakatze spielte, die sich der ehemalige Oberstleutnant als einzige Lebensgefährtin hielt.
Die kleine Jutta hatte heut abend kein gutes Gewissen ihrem Freunde gegenüber. Sie wußte, daß er sie photographieren wolle, und hatte ihm zugesagt, am ersten klaren Tage aufs Atelier zu kommen. Heute nun schien vom frühen Morgen an die Sonne, und da Allerheiligen war, wo die Schule ausfiel, hätte sie auch Zeit gehabt dazu; aber gerade weil sie wußte, daß drüben einer saß, der sehnlichst auf sie wartete, war sie nicht gegangen. Es belustigte sie, sich vorzustellen, wie er herumlief im Atelier, alle zehn Minuten nach der Uhr sah, ärgerlich und nervös.
Ob er ihr wohl Vorwürfe machen würde? Sie mußte sich schnell noch eine Entschuldigung ausdenken: Kirchgang, Besuch einer Freundin, Schularbeiten – damit er nicht allzu böse würde.
Klopfenden Herzens stand das Mädchen vor der Tür, an der man auf einem Messingschild den Namen »von Weischach« las. Sie klingelte nicht, sondern klopfte in verabredeter Weise. Es war eine von Weischachs Eigentümlichkeiten, daß er, wenn er »melancholisch« war, niemanden annehmen wollte, weder Malerkollegen, noch Modelle, noch ehemalige Kameraden. Dann wurde einfach nicht aufgemacht, mochten sie draußen noch so lange klingeln. Nur mit der kleinen Jutta machte er eine Ausnahme; die hatte jederzeit freien Eintritt.
Sie klopfte also in der vorgeschriebenen Weise. Ungesäumt wurde ihr geöffnet. Weischach war's selbst.
»Ich habe so auf dich gewartet, Jutta. Geh' ins Atelier! Ich komme sofort zu dir; will mich nur fertig anziehen.«
Er war – was sie kaum beachtete – ohne Krawatte, hatte den ersten besten Rock über das Frackhemd geworfen.
»Gehst du aus?«
»Ja ja! – Geh' nur ins Atelier!«
Jutta tat, wie ihr geheißen. Im Atelier herrschte bereits Halbdunkel. Sie wußte, wo die Streichhölzer standen und machte Licht. Mucki, die Angorakatze, nahte sich schnurrend, um sich an Jutta zu reiben, falsch-freundlich wie eine Favoritin, die eine andere begrüßt.
Aber Jutta hatte nicht Zeit, sich mit Mucki einzulassen; neugierig sah sie sich um. Hatte er gearbeitet? –
Ein paar Tafeln drehte sie um, es waren Skizzen zu dem Bilde, welches er »Inspiration« nannte, das niemals über den Entwurf herausgekommen war. Dann stieß sie auf ein Selbstporträt. Ganz deutlich war er daraus zu erkennen, seine kahle Stirn, die über den Ohren angegrauten Haare, seine große Nase und der mächtige Bart. Aber das Kostüm war ein anderes; es glich dem eines Eremiten. In der Hand, die vorläufig nur mit Kohle angedeutet war, hielt er eine Harfe.
Erstaunt betrachtete Jutta das Bild. Ärgerlich war sie, ja geradezu beleidigt. Davon hatte er ihr doch gar nichts gesagt. Hinter ihrem Rücken war das geschehen. Ihrer Auffassung nach hatte er kein Recht, ohne ihre Genehmigung ein Werk anzufassen.
Mucki war auf einen Hocker gesprungen, dort saß sie mit gekrümmtem Rücken und eingezogenem Kopfe. Würdevoll ernst blickte sie auf das Bild, mit Überlegenheit in der Miene, als habe auch sie ihr Urteil in diesen Dingen.
Gleich darauf trat Weischach ein, hoch und schlank, die Haltung etwas gebückt. Er war im Gesellschaftsanzuge, das Ordensbändchen im Knopfloche. So glich er freilich dem Selbstporträt, das ihn im härenen Gewande zeigte, nur wenig.
»Kind, warum bist du heut mittag nicht gekommen?« fragte er, und ohne die Antwort abzuwarten: »Ich hatte einen Mann hier mit Kleidern; einen Trödler, der Gewänder besitzt aus dem vorigen Jahrhundert. Das hier ist von ihm.« Er hob einen langen braunen Mantel auf, unter dem eine Harfe lag. »Echte Sachen! Ich will uns beide malen. Dich und mich, als Harfner und Mignon. Großer Gedanke! In dem Stoffe liegt unaussprechliche Stimmung. Natürlich nenne ich das Bild nicht so. Keine Unterschrift, kein Unterstreichen überhaupt ist nötig. Ich nehme einfach mein Gesicht, nur schwach für den Zweck umgemodelt, und deine Züge, Jutta, wie sie sind, und das herrlichste, ergreifendste aller Bilder ist fertig. Schlicht, ohne jede Pose, wie ich mir's immer geträumt habe, das wird ein großes, tiefes, ernstes Werk!«
Die Hände auf dem Rücken gekreuzt, mit langen Schritten storchte er durch das Atelier, redete mit gesenktem, zwischen den eckigen Schultern eingezogenem Haupte in seinen langen Bart hinein.
Jutta war an seine Eigentümlichkeiten gewöhnt, er hielt in ihrer Gegenwart oftmals solche Monologe.
»Mir war es wie Offenbarung, als ich an diesen Stoff geriet. Es ist die Lösung eines Problems für mich. Warum nach Stoffen suchen, sie an den Haaren herbeiziehen wollen! Man kann schließlich doch nur sich selbst geben; alle Großen haben das von jeher getan. Keine Illustration zu Goethe, um Gottes willen! Ich gebe in diesem Bilde mein eigenstes Erlebnis. Der Harfner bin ich, und du Mignon. Aber schließlich verlangt die Kunst ein Medium; hier sollen mir die Gestalten der Dichtung dazu dienen. Ich benutze sie gewissermaßen als Symbole, die jedermann geläufig sind. Dadurch stelle ich von vornherein den Kontakt des Interesses und des Verstehens her zwischen mir und dem Beschauer. Niemand wird sich dem Eindruck entziehen können. ›Das ist der Harfner und Mignon! muß der Ausruf sein. So und nicht anders konnten sie aussehen.‹ Jede kleinste Falte, jedes Härchen muß echt wirken. Bei aller Feinheit der Stimmung will ich ein durchaus realistisches Kunstwerk schaffen.«
Was kümmerte sich Jutta um »Stimmung« und »realistisches Kunstwerk«! – Viel interessanter war ihr das, was er vorhin von einem Kleide angedeutet hatte. Sowie er sie zu Worte kommen ließ, fragte sie ihn danach.
»Ja, wenn du hier gewesen wärest, Jutta, heut mittag, zur Kostümprobe! Levy hatte drei Roben mit. Aber dalassen wollte er keine. Es sind seltene Stücke. Feinstes Nesseltuch, wie es unsere Urgroßmütter getragen haben. Es steckt Stimmung in solchem Fähnchen. – Kannst du mir nicht für morgen eine Stunde fest angeben, Jutta, wo du bestimmt kommst? Es handelt sich ja nur darum, daß Levy dich mal sieht, damit er ungefähr das Maß hat. Die Farbe wähle ich, so wie sie mir ins Bild paßt. Dein Gesicht ist wie ausgesucht für Mignon, besonders Mund und Augen. Eine Nuance älter, wissender, erfahrener muß ich dich halten; mehr Weib gewissermaßen. Im übrigen wird kein Fältchen geändert. Frisieren mußt du dich natürlich auch lassen, dem Stile der Zeit entsprechend. Ich werde eine Person vom Theater bestellen, die das versteht. Du hast ja schönes Haar.«
»Wenn ich es aufmache, geht es mir bis hierher«, sagte Jutta voll Selbstbewußtsein.
Er blickte sie bewundernd an. Es konnte zweifelhaft erscheinen, ob seine Zärtlichkeit allein dem Kinde gelte, das seine Kunst inspirierte. Wie eine Erwachsene behandelte er sie, nicht wie einen Backfisch, der jeden Morgen mit der Büchermappe zur Schule ging. Einer fertigen Dame hätte er nicht achtungsvoller begegnen können.
Jutta saß ihm gegenüber, die Füße kreuzend, die bis zur Wade unter dem halblangen Kleide hervorblickten. Ihre Figur, in der Büste noch kaum angedeutet, hatte jene Herbheit der Form, die man bei schnellwüchsigen Mädchen dieses Alters findet. Das Gesicht schien dem übrigen Körper um mehrere Jahre voraus. Man konnte nicht gut wünschen, daß es sich verändern möchte, so reizend war dieser Kopf mit seiner edlen Schädelform, seiner feingeschnittenen Nase über dem sanften Munde, der freien Stirn, den melancholischen vielsagenden Augen unter langen, dunklen Wimpern.
»Bleib' einen Augenblick so, gerade so, und rühr' dich nicht!« rief er, holte ein Reißbrett herbei, auf das ein Stück rauhes Papier gespannt war. Dann zog er sich einen Hocker heran. Das Brett auf den Knien, suchte er die Umrisse ihres Gesichts, wie sie sich gegen die dunkle Wand hell erleuchtet abhoben, mit wenigen Strichen niederzuzeichnen.
Während sie ihm saß, erwog sie, ob sie morgen, während eines Schultages, es ermöglichen könne, auf längere Zeit zu ihm zu kommen. Erleichtert wurde das Vorhaben dadurch, daß sich der Vater gerade wieder mal auf Geschäftsreisen befand. Vor Frau Hölzl hatte sie keine Angst, und Eberhard würde auch nichts verraten. In der Schule aber mußte man zu einer kleinen Notlüge Zuflucht nehmen: Kopfschmerz oder dergleichen. Es war ja nicht das erstemal! –
Augenzwinkernd, mit schräg gezogener Unterlippe, mühte er sich, die Linien dieses feinen Profils auf das Papier zu bannen. Während er noch darüber war, ging die Vorsaalklingel.
Weischach stieß eine Verwünschung aus. »Gewiß ein Modell. Wenn man sie nicht braucht, überlaufen sie einen.«
Das Klingeln wiederholte sich, dann folgte energisches Klopfen. Seufzend legte Herr von Weischach die Zeichnung weg. Dann ging er hinaus und fragte in scharfem Tone, dem man den alten Offizier anmerkte, wer draußen sei. Jutta hörte durch die offene Tür die Stimme ihres Dienstmädchens.
Resi war da, um »Fräulein Jutta« zu holen. Frau Hölzl lasse sagen, der Herr sei soeben heimgekommen.
Juttas erste Frage war, ob der Vater etwas gemerkt habe. Das Mädchen berichtete: Herr Reimers sei sofort nach seiner Ankunft ins Badezimmer gegangen. Das Essen wäre auf sieben Uhr bestellt: Fräulein Jutta möge um Gottes willen schnell kommen, sonst gehe es nimmer gut aus.
Gott sei Dank, der Vater schien nichts gemerkt zu haben von ihrer Abwesenheit.
Jutta sagte zu Weischach, der peinlich berührt dabeistand, sie könne morgen bestenfalls auf einen kurzen Sprung herüberkommen, um das Weitere mit ihm zu beraten.
Schnell umarmte sie ihren Freund zum Abschied, dann eilte sie mit Resi von dannen.
Weischach begab sich in sein Atelier zurück und betrachtete die eben angefertigte Skizze. Er war nicht zufrieden damit. Zur Entschuldigung konnte ihm dienen, daß er in großer Eile gearbeitet hatte. Seufzend legte er das Blatt zu anderen in eine Mappe.
Sollte er heut abend wirklich noch ausgehen? Er verspürte nicht die geringste Lust dazu. Zwar, er wurde erwartet in einem Hause, das der Sammelpunkt war für Künstler und Gelehrte, wie für Militärs und Staatsmänner. Aber ihm graute, Menschen zu sehen. Sie fragten ihn neuerdings so viel nach seiner Arbeit, ob er nicht mal ausstellen werde, und so weiter. Es kostete ihm solch innere Anstrengung, mit gleichgültiger Miene von der Kunst zu sprechen.
Wie so oft, wenn er in einer Frage sich keinen Rat wußte, rief er Mucki als Orakel an. »Soll ich zu den Riedbergs gehen, Mucki?« fragte er, »wo jeder eine Berühmtheit ist und wo sie so gespreizt schwatzen und sich so ungeheuer klug vorkommen.« Die Katze schnurrte voll Wohlgefühl und schmiegte sich an seine Hand, da er sie im Genick kraulte. Er legte die Katzensprache dahin aus: daß er gebeten werde, zu bleiben.
Die Entscheidung war gefallen. Er beschloß, abzusagen wegen Unwohlseins. Es war nicht mal völlig erlogen, denn er fühlte sich nicht zum besten. Seit Tagen schon machte ihm sein Herz wieder mal zu schaffen.
Weischach drückte auf den Knopf der Leitung, die zu seiner Aufwartefrau führte. Die Person war verheiratet und hatte stets ein oder das andere Kind zur Hand zu einem Botengange. Schnell war die Absage geschrieben und der kleine Bote abgefertigt.
Er warf sich in seinen Sorgenstuhl zurück. Während sein Blick den Rauchwölkchen folgte, die sein Mund formte, suchte der Maler sich ein Bild vor das innere Auge zu stellen von dem Kinde, das eben von ihm gegangen. Daß es so schwer war, festzuhalten und wiederzugeben, was ihn so anzog, wofür er keinen Namen hatte, was viel zu fein und flüchtig war, um sich fassen zu lassen, und das auf die Leinwand zu bringen er sich dennoch unausgesetzt abmühte! Hier hatte er nun mal ein Modell, ein wirkliches echtes, wie es kein Maler vor ihm besessen. Und er stand wie mit gebundenen Händen davor. Nahm ihm vielleicht das Große, was er für das Kind fühlte, die kühle Sicherheit des Künstlers? –
Von jeder sinnlichen Regung konnte er sich in diesem Falle freisprechen. Nie fühlte er sich besser und reiner als in ihrer Gegenwart; wie geweiht kam er sich vor, wenn sie ihm in aller Unschuld die Hand drückte, ihm das Haar vertraulich streichelte, ihm lebhaft um den Hals fiel und ihn herzte. Und er war bemüht, alles, was etwa das Schamgefühl der Vierzehnjährigen hätte verletzen, ihre Arglosigkeit hätte bedrohen können, aus dem Atelier zu entfernen. Jedes Wort, jede seiner Handlungen hätte er Juttas Vater gegenüber verantworten können.
Ganz etwas anderes beunruhigte ihn. Es war das Bewußtsein, daß dieses seltene Glück, dieser einzigartige Verkehr nicht Bestand haben könne. Jeden Tag, den sie älter wurde, verlor er: denn jeder Tag entfernte sie mehr der Kindheit, brachte sie dem Weibe näher. Zitternd sah er, wie sich diese Knospe mehr und mehr zur Blüte erschloß, entzückten Auges und mit Wehmut im Herzen. Einmal mußte der Tag kommen, wo ihre Freundschaft ein Ende finden würde, so oder so. Dann würde sie erkennen, daß er Mann sei. Mußte sie dann nicht vor ihm fliehen? – Eine schwache Hoffnung blieb ihm: vielleicht würde sein Alter ihm ihre Freundschaft wahren. Traurige Alternative! Zum väterlichen Freunde würde er gerade noch taugen; sowie er Größeres verlangte, mußte er lächerlich werden. Mit dem Pessimismus des alternden Mannes, der sich und seine Mängel kennt, sah er den Ausgang voraus, der ihn mit namenloser Bitterkeit erfüllte.
Denn dieses Kind war ihm zum Bedürfnis geworden. Trübe schlichen ihm die einsamen Stunden hin zwischen den kurzen Augenblicken, wo sie bei ihm war. Er lebte auf, wenn er die jugendlich helle Stimme vernahm, wenn er mit ansehen durfte, wie ihre anmutige Gestalt sich frei und sicher zwischen seinen Siebensachen bewegte, als gehöre sie dahin. Dann fühlte er sich wirklich Künstler, wußte, daß seine Augen mehr sähen, seine Nerven feiner empfänden als die anderer Sterblicher.
Solche Anregung war ihm bitter not. Weischachs künstlerische Entwicklung war keine glückliche gewesen. Um zehn Jahre zu spät hatte er sich entschlossen, den königlichen Dienst zu quittieren. Er wußte das selbst ganz gut. Zu gewissen Dingen fehlten ihm Spannkraft und Illusionen. Er war nicht imstande, sich kopfüber in eine Sache zu stürzen, wie es die Jungen taten. An Lebensklugheit und Erfahrung zwar fühlte er sich diesen jungen Stürmern weit überlegen, die jedes Jahr womöglich eine neue Richtung heraufbringen wollten. Aber eines, das mußte er sich sagen, hatten sie vor ihm voraus: Wagemut und Selbstbewußtsein. Sie waren eingebildete Narren, zum Teil sogar Hohlköpfe, er war voll Selbstkritik und kannte seine Grenzen. Gelegentlich konnte auch er aufflammen in Schaffensfreude, sich ganz verlieren an ein Werk. Aber die Stunden solcher gesteigerten Stimmung waren nur kurz; dann kam auch schon als bitterer Nachgeschmack der Zweifel. Weischach besaß nicht das glückliche Temperament vieler seiner Malerkollegen, die alles, was sie schufen, gut fanden. Er genügte sich selbst nie. Wie viele sorgfältig ausgeführte Bilder hatte er schon übermalt! Man lachte bereits über ihn in Bekanntenkreisen. In einem Herrenklub, den er hie und da besuchte, war er in Bild und Versen als männliche Penelope persifliert worden.
Und nun, vor Jahresfrist etwa, als er sich besseren Lichtes wegen ein anderes Atelier mietete, hatte er die kleine Jutta Reimers kennengelernt. Von da ab war in seinem Leben und in seiner Kunst eine neue Epoche angebrochen. War's nicht, als steige die Jugend, die goldene Jugend, noch einmal zu ihm herab in lieblichster Gestalt! Kein Wunder, daß er mit beiden Händen zugriff, sie zu halten! –
Weischach malte sein bestes Bild: Großmutter in der Bibel lesend, daneben die sinnend dreinschauende Enkelin. Für die Greisin hatte er aus Dachau eine gute Studie mitgebracht; Jutta war durch ein buntes Halstuch schnell in ein Bauernkind umgewandelt worden.
Durch diesen Erfolg ermutigt, hatte er sich an ein schwierigeres Problem gewagt. Er wollte den Künstler darstellen in dem Augenblicke, wo sich ihm eine neue Idee beglückend naht. »Inspiration« sollte das Bild heißen. Der Genius war in jugendlicher Gestalt mit Juttas Zügen gedacht. Skizzen dazu waren fertig. Bei der Ausführung jedoch versagte dem Künstler der Mut.
Nun beschäftigte ihn dieses neueste Werk: »Harfner und Mignon«. In den Fingern zuckte es ihm, daran zu arbeiten. Das war sein Stoff, der ihm lag wie kein anderer, der auf ihn gewartet hatte gleichsam.
Und doch zitterte ei bei dem Gedanken, ob er das, was er zum Greifen deutlich vor sich sah, auch in seiner ganzen Größe und Eigenart würde aus sich herausstellen können.
II
Inzwischen kleidete sich Jutta um. Sie legte das Kleid an, das ihr der Vater neulich aus Wien mitgebracht hatte. Er liebte es, die Tochter hübsch angezogen zu sehen.
Jutta sah dem Wiedersehen mit dem Vater voll freudiger Spannung entgegen. Er brachte stets Geschenke mit für die Seinen und erzählte allerhand interessante und schnurrige Erlebnisse. Es kam dem Mädchen vor, als sei alles lebendiger und prächtiger im Hause, sobald er da war. Besonders bei Tisch ging es dann hoch her. Das Essen war besser, es gab Wein von den verschiedensten Sorten. Und wenn sich Jutta auch weiter nichts daraus machte, so liebte sie doch den größeren Zuschnitt des Lebens, die Freude, die Opulenz, die ihr Vater um sich verbreitete.
Als das Gong laut durch das Haus ertönte, war Jutta eben fertig geworden. Sie eilte in das Zimmer ihres Vaters. Dort stand er am Kaminfeuer und ließ sich den Rücken wärmen. Sie flog auf ihn zu, warf sich ihm in die Arme. Der Vater hob sie empor und küßte sie lachend auf Mund und Haar.
Es waren Gäste da: Bruno Knorrig, den Herr Reimers bei seinem Sohne angetroffen, und Vater Knorrig, Reimers' Geschäftskompagnon.
Reimers war Fünfziger von regelmäßigen Gesichtszügen, mit lebhaften Augen, schön gebogener Adlernase und wohlgepflegtem blonden Bart. Sein Kopf fing eben an zu ergrauen. Eine mäßige Korpulenz stand ihm nicht schlecht, da sein kerniges Fleisch nichts von der Aufgedunsenheit fetter Leute zeigte. Es wurde einem behaglich zumute beim Anblick dieser gesunden, kräftigen, wohlproportionierten Männergestalt. Sein schwarzer Anzug kleidete ihn gut, und seine Wäsche war von tadellosem Glanz.
Als eine ganz andere Sorte Mann stellte sich sein Geschäftsteilhaber dar. Knorrig war ein hagerer Geselle von eckigen Gliedmaßen, über denen ein grauer Anzug leblos wie auf einem Kleidergestell hing. Das Auge war klein und phantasielos, der Mund, mit schmalen Lippen und vortretendem Gebiß, unschön. Er stammte aus Nordbayern und stach mit seiner oberfränkischen Nüchternheit stark gegen das gemütliche, leichtlebige Münchnertum ringsum ab. Seit Jahren schon verwitwet, besaß Knorrig nur den einen Sohn, Bruno, der, von Natur auch nicht gerade mit Anmut ausgestattet, neben diesem Vater immer noch als Schönheit hätte gelten können.
Herr Reimers berichtete von dem Erfolge seiner Reise. Seine Worte betrafen Geschäftliches und waren zumeist an den Kompagnon gerichtet: die Aussichten der Kaffeeernte in Südamerika, die Lage des Marktes in den dortigen Plätzen, das voraussichtliche Steigen der Kolonialwarenpreise, Börsenabschlüsse, Schiffsnachrichten, Gründungen, Konjunktur, Handelspolitik. Alle diese Gebiete standen für ein Handelshaus wie Reimers und Knorrig im Vordergrunde des Interesses.
Knorrig senior hörte aufmerksam zu, warf nur hie und da eine kurze Frage ein, oder machte eine trockene Bemerkung.
Gelegentlich unterbrach Reimers auch mal die geschäftliche Unterhaltung, flocht eine Anekdote ein oder eine lustige Schilderung, welche für die jungen Leute berechnet war. Er liebte es nicht, die Kinder mit gelangweilten Gesichtern dasitzen zu sehen; alles um ihn her sollte guter Dinge sein. Gegen Schluß der Tafel wurde ein auserlesener guter Tropfen alten Rheinweins aus dem Keller herausgebracht, dem der Wirt selbst mit sichtlichem Verständnis zusprach.
Reimers stammte vom Rheine. Lebensfreude und leichter Sinn, die nirgends froher gedeihen als an den Ufern unseres schönsten Stromes, waren auch ihm von Geburts wegen eigen. Den Dreißigen nahe, war er als Vertreter eines Kölner Hauses nach München gekommen. Das Leben in der Isarstadt sagte ihm zu. Er heiratete in eine alteingesessene Münchener Kaufmannsfamilie hinein. Der Vater seiner Frau war Inhaber eines großen Kolonialwarengeschäfts.
Sehr bald aber wurde Reimers die Seele des Hauses. Vom Detailhandel im Inlande ging er kühn über zum Import. Er reiste selbst hinaus, studierte an Ort und Stelle die Venezuelanischen Verhältnisse, erwarb Plantagen im Hinterland« und ein Lagerhaus in Caracas. Nachdem er hier alles organisiert hatte, kehrte er nach Hause zurück und erwarb sich eine feine Kundschaft in Deutschland. Seine gute Erscheinung, sein sicheres Auftreten und sein joviales Wesen kamen ihm dabei zustatten. Das Glück war ihm günstig. Bald hatte er aus der rein lokalen Firma seines Schwiegervaters ein weithin angesehenes Haus gemacht.
Schließlich starb der Alte. Er hinterließ außer Frau Reimers nur noch eine Tochter: Frau Habelmeyer. Deren Mann war ein Luftikus gewesen, hatte Bankerott gemacht, wobei das im voraus gezahlte Erbteil seiner Frau zugrunde gegangen war. Daher gingen Geschäft und Vermögen unter Ausschluß der älteren Tochter an Frau Reimers über, die in ihrem Manne eine bessere Wahl getroffen hatte.
Frau Reimers war ihren Vorfahren ähnlich: äußerst gutmütig und harmlos, lebenslustig, ein wenig zur Bequemlichkeit neigend und ziemlich gedankenlos. Ein durchaus unkomplizierter, bequemer Charakter. Das Bild, welches von ihr über ihres Mannes Schreibtisch hing, zeigte sie als eine anmutige Brünette von lebhaften Farben mit einem freundlich lächelnden Puppenkopfe. Sie hatte ihren Gatten sehr bewundert und wirklich geliebt. Urteilslos wie sie war, sah, sie nur Vorzüge an ihm. Ihre Ehe war glücklich gewesen, denn es lag nicht in Reimers' Natur, sich Frauen, gegenüber anders als freundlich und liebenswürdig zu zeigen.
Sie starb zur rechten Zeit für ihr Glück, als die Kinder in das Alter kamen, wo die Gefahr nahe lag, daß sie der Mutter über den Kopf wachsen würden. Auch nahm sie die Illusion ungetrübt ins Grab: ihr Mann sei ein Mustergatte, der ihr jederzeit die Treue gewahrt habe.
Der Witwer heiratete nicht wieder, was die meisten eigentlich von ihm erwartet hatten. Vielmehr nahm er eine entfernte Verwandte seiner Frau, Witwe Hölzl, ins Haus, halb als Wirtschafterin, halb als Anstandsdame.
Reimers hatte als Geschäftsmann im allgemeinen glücklich operiert. Der wirtschaftliche Aufschwung der letzten Jahrzehnte war von ihm geschickt ausgenutzt worden. Der Geschäftskreis seines Hauses hatte sich so stark ausgedehnt, daß er allein die Arbeit nicht mehr zu bewältigen vermochte. Auch hatten es ihm ein paar empfindliche Verluste nahegelegt, die er, allzu Kühnes wagend, erlitten, sich nach jemandem umzusehen, mit dem er Risiko und Verantwortung teilen möchte. Nach einigem Suchen fand er in einem Bamberger Kaufmann die geeignete Persönlichkeit. Knorrig brachte nicht allzuviel Geld mit in das Unternehmen, aber was wichtiger war, praktische Erfahrung, Nüchternheit und tadellose Zuverlässigkeit.
Mit genialem Blicke hatte Reimers erkannt, daß dieser Mann ihn ergänzen werde wie kein zweiter. Was dem einen abging, das besaß der andere. Sie teilten sich den Geschäftskreis nach ihrer entgegengesetzten Veranlagung und ihrem verschiedenen Geschmack in zwei voneinander unabhängige Gebiete. Knorrig übernahm Rechnungswesen, Buchführung, Kontor, Reimers behielt die Vertretung der Firma, die Reisen, das Auswärtige, die Finanzoperationen. Reimers und Knorrig arbeiteten wie zwei Räder eines Apparates, die füreinander zugeschnitten sind. Wenn es hie und da doch Reibungen gab im Organismus, so kamen diese von außen, hingen mit dem Markt, der Konjunktur, der Weltpolitik zusammen, mit deren Auf und Ab jeder Kaufmann schließlich zu rechnen hat.
Es fügte sich ausgezeichnet, daß Reimers' Ältester, Kurt, und Bruno Knorrig im gleichen Alter standen. Gleichzeitig wurde ihnen die Prokura erteilt. Man schickte Kurt Reimers nach Venezuela zur Wahrnehmung der dortigen Interessen des Hauses, während Bruno Knorrig daheim im Kontor Verwendung fand. Es war also Aussicht vorhanden, daß »Reimers und Knorrig« auch in der nächsten Generation in Kompagnie bleiben würden.
Den Nachtischkaffee nahm man im Zimmer des Hausherrn ein. Dort warteten auf der Schreibtischplatte eine größere Anzahl Briefe der Öffnung. Reimers nahm einen heraus, der die Handschrift seines Ältesten zeigte.
Kurt war anerkanntermaßen sein Lieblingssohn, vielleicht weil er ihm in vielen Stücken ähnelte.
Während er den Mokka schlürfte und die ersten Züge aus der eben angezündeten Importe tat, liebäugelte Reimers senior beständig mit dem Briefe, der vor ihm lag. Jutta mußte ihm das Papiermesser vom Schreibtisch holen und durfte den Umschlag aufschneiden, was sie, da der Brief von Kurt kam, als eine Auszeichnung empfand.
Aber während des Lesens verfinsterte sich Reimers' Angesicht. Er tat hastig ein paar Züge aus der Zigarre, stand auf und machte sich Luft in der Westengegend. »Was gibt's denn aus Venezuela?« fragte Knorrig, der seinen Kompagnon beobachtet hatte.
Reimers antwortete nicht.
»Ist etwa wieder mal Revolution ausgebrochen da drüben?«
»Ach was! Darum handelt sich's bei Gott nicht!«
»Sondern – ?«
»Der Junge ist krank geworden.«
»Gefährlich?«
Reimers warf einen unsicheren Blick auf die jungen Leute. Dann sagte er: »Kinder, ihr könnt gehen, wir haben geschäftlich zu sprechen. Und auch Sie, Bruno!« Damit wandte er sich an den jungen Knorrig. »Gehen Sie nur einstweilen mit hinter!«
»Vater, ist Kurt sehr krank?« fragte Jutta mit großen Augen.
»Nein, mein gutes Kind! Da würde er mir doch nicht einen so langen Brief schreiben können. Das Klima scheint ihm nicht zu bekommen. Ich muß dies erst zu Ende lesen. Geht nur jetzt!«
Jutta entfernte sich gehorsam, nachdem sie sich vorher noch vom Vater den Gutenachtkuß geholt. Die beiden Jünglinge folgten ihr.
»Nun, was ist es?« fragte Knorrig, als er sich mit seinem Kompagnon allein sah.
Reimers gab ihm den Brief, und ging, schwer atmend, im Zimmer auf und ab.
Knorrig las und pfiff mit einem Male leise vor sich hin.
»Ich habe den Jungen so gewarnt!« sagte der Vater. »Denn ich kenne diese Mischlingsweiber. In den Häfen dort drängt sich alles zusammen: Neger, Indianer, Quadronen, Mestizen. Das spanische Mut und das Klima dazu! Wie die Giftblumen sind sie, schön und gefährlich. Ich habe Kurt Weisheit gepredigt, mündlich und schriftlich. Nun hat er sich doch nicht genügend in acht genommen!«
»Pech!« sagte Knorrig bloß und gab Reimers den Brief zurück. Er sah sich seinen Kompagnon einen Augenblick spöttisch von der Seite an, als wolle er sagen: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme! –
Dann nahm er wieder seine gewohnte, gleichgültig trockene Miene an, und sagte: »Da werden wir wohl einen anderen Mann zur Ablösung vorschicken müssen.«
Sobald die jungen Leute die Tür hinter sich geschlossen hatten, welche sie von den beiden Vätern trennte, ging eine wilde Jagd los den langen Korridor hinab. Juttas Zimmer lag am anderen Ende. Das Mädchen wußte, daß sie Rettung vor den Jungens nur finden könne, wenn sie sich dort einschloß. Gelang ihr das nicht, dann gab es womöglich eine Katzbalgerei wie neulich abend, die ihrem Kleide und ihrer Frisur sehr schlecht bekommen war. Wenn sich Eberhard als Bruder Vertraulichkeiten herausnahm, so mochte das hingehen, aber von Bruno Knorrig waren ihr solche ganz widerwärtig.
Die jungen Männer stürzten nach, sowie sie Jutta entfliehen sahen, aber das Mädchen war schneller als sie, die Tür fiel ihnen vor der Nase zu und der Riegel wurde von innen vorgeschoben. Mit einem ärgerlichen Fußtritte gegen die Tür entfernte sich Eberhard, den Arm des Freundes nehmend. »Komm, laß das dumme Geschöpf! Ich bestelle Bier auf meine Stube.«
Bald darauf saßen die beiden im Laboratorium, die weit vorgestreckten Füße auf Stühlen, und rauchten Zigarren. Der Tisch, auf welchem die physikalischen Instrumente standen, hatte eine Ecke hergeben müssen für die Maßkrüge.
Der junge Kaufmann und der Primaner waren ein vertrautes Freundespaar. Obgleich Bruno Knorrig um vier Jahre älter war als Eberhard Reimers, hielt er es nicht unter seiner Würde, mit dem frühgeweckten Jüngling umzugehen, für den er eine gewisse Bewunderung hegte. Es zog diesen von Natur trockenen und nüchternen Menschen zu der Familie Reimers hin. Er bewunderte und liebte sie alle: den Vater wie die Kinder. Er fühlte, daß dieser Rasse das gegeben war, was ihm völlig abging: die Anmut.
Eberhards Selbstbewußtsein wurde durch den Umgang mit einem Erwachsenen ungewöhnlich gesteigert. Er blickte auf seine Klassenkameraden verächtlich herab, als auf dumme Jungen, die zu grün waren für ihn. Und weil er mit Bruno über vieles sprach, was gewöhnlich nicht in den Gesichtskreis eines Schülers kommt, gewöhnte er sich ein altkluges Kritisieren und Aburteilen an. Andererseits wurde er durch den durchaus soliden Bruno von mancher Torheit abgehalten, der junge Leute leicht verfallen; vor allem wenn sie, wie er, jederzeit Geld in der Tasche und einen nachsichtigen Vater haben. Trotz seines etwas großsprecherischen Wesens war Eberhard Reimers im Grunde doch ein großes Kind geblieben. Seine Unschuld war unverletzt. Zwischen den beiden wurden heut abend wieder mal die schwierigsten Fragen und Probleme, an denen sich die besten Köpfe umsonst abmühen, spielend gelöst, mit jener glücklich naiven Selbstsicherheit der Jugend, welche niemals zaudert, über alle Verhältnisse und Menschen in absentia zu Gericht zu sitzen. Beide waren sie ihrer Ansicht nach politisch »radikal«, Anhänger der »Evolutionstheorie«, philosophisch dem »Monismus« zugeneigt und religiös »vorurteilsfrei«.
Die Knorrigs waren Protestanten, die Familie Reimers dagegen war konfessionell gemischt. Reimers, von Haus aus evangelisch, hatte seiner aus streng römischer Familie stammenden Frau zuliebe eingewilligt, daß die Töchter katholisch getauft und auferzogen werden dürften: die Söhne sollten, wie er, evangelisch bleiben. So wurde Jutta denn im Glauben ihrer Mutter unterrichtet, während Kurt und Eberhard evangelischen Unterricht genossen.
Eberhard aber hatte sich angewöhnt, den Unterschied der Konfessionen, wie alles, was mit Religion zusammenhing, als »Salat« zu bezeichnen.
Während die Freunde darüber waren, einen Maßkrug nach dem anderen zu leeren und dabei mindestens ebenso viele Welträtsel zu lösen, saß Jutta in ihrem Zimmer mit einer Stickerei beschäftigt. Sie nähte mit bunten Fäden ein phantastisches Tier- und Pflanzenornament auf dunkles Tuch. Das Muster war ihre eigene freie Erfindung. Es sollte eine Decke daraus werden für Herrn von Weischach. Schon lange arbeitete sie daran. Das Geschenk sollte strengstes Geheimnis bleiben. Anfangs hatte ihr die Technik des Stickens, in der niemand sie unterrichtet hatte, einige Schwierigkeiten gemacht, aber nun näherte sich das große Werk, in dem sie das Taschengeld von Monaten niedergelegt hatte, seinem Ende. Es war ein ungewöhnliches Stück, farbenreich, fast bizarr in der Komposition, voll kühner Erfindungsgabe.
Sie lächelte während der Arbeit wiederholt in sich hinein; ein Lächeln, das sie andere niemals würde haben blicken lassen. Ein ahnungsvolles Frauenlächeln, wie es Mütter haben, die von dem Kinde träumen, das unter ihrem Herzen heranwächst. Solche Anwandlungen melden sich manchmal verfrüht: wie ja auch in der Natur der Sommer seine Vorboten weit in den Winter hinein vorausschickt.
Dabei war Jutta noch ganz Kind geblieben. Kindische Vorstellungen beherrschten ihr argloses Gemüt. Von dem Ernste des Lebens, von der Wahrheit, daß wir für uns und unser Tun verantwortlich sind, daß jeder Tag, jede Stunde einen Posten darstellt in der endlichen Gesamtsumme, war ihr noch nicht die entfernteste Ahnung aufgegangen. Wie die Pflanze lebte sie, die ihre Wurzeln dahin streckt, wo leichtes und fruchtbares Erdreich ist, und ihre Blätter dem schmeichelnden Lichte zuneigt.
Es gibt solche Kinder, die mit einem Teile ihres Wesens sich selbst gewissermaßen vorauseilen. Junge Menschen haben noch nicht die Harmonie ihrer Teile errungen. Es bleibt etwas Unausgeglichenes, bis der ganze Mensch die ihm mögliche Form erreicht hat.
So war's mit Jutta Reimers. In vielen Fächern war sie den Mitschülerinnen überlegen, in einigen zählte sie zu den Unbegabten. So war sie auf einmal die Beste im Französischen, seit man angefangen, ein Buch zu lesen, das sie fesselte: vorher hatte sie beliebt, die Lektionen überhaupt nicht zu lernen. Der Lehrer des Deutschen staunte über den originellen Stil ihrer Aufsätze, während die mangelhafte Orthographie und Interpunktion ihn verdrossen. Der Religionsunterricht war erst neuerdings etwas für sie geworden, seit ein Kaplan ihn erteilte, der die Kinder nicht wie sein Vorgänger mit Auswendiglernen von Legenden und Herplappern von Gebeten peinigte, sondern die jungen Seelen einzuführen trachtete in das Wesen der Religion und den Geist der Lehre. Die Mathematik dagegen blieb ihrem Verständnis verschlossen, weil es da nichts gab, was sie mit der Phantasie hätte ergreifen können.
Das Urteil der Lehrerschaft über Jutta Reimers fiel daher sehr widersprechend aus. Manche hielten sie für ein Kind, das überhaupt nicht zu erziehen sei, andere setzten große Hoffnungen auf sie.
Mit ähnlich gemischten Gefühlen blickten die Mitschülerinnen auf Jutta. Manchem Mädchen war sie ein Gegenstand des Neides. Ihre Erscheinung spielte dabei eine Rolle: man hielt sie für kokett, weil sie hübsch war und stets nett gekleidet ging. Sie brachte etwas von Haus aus mit, etwas Gewähltes, Besonderes, das sie unter ein paar Dutzend ihresgleichen unbedingt zur interessantesten machte. Einige bewunderten und liebten Jutta Reimers auch: aber die erlebten Kummer. Dieses Mädchen nahm Geständnisse und Liebeserklärungen der Freundinnen an wie etwas Selbstverständliches, aber sie selbst eröffnete sich niemals. Sie war so gar nicht sentimental, schwelgte nicht wie so manche ihrer Altersgenossinnen in Gefühlen. Niemand konnte sich entsinnen, Jutta Reimers weinen gesehen zu haben. Bei noch so rührenden Szenen im Leben oder in der Dichtung, bei Todesfällen, beim Abgang von Schülerinnen, ja selbst beim Abschied eines allgemein beliebten Lehrers waren von allen Augen ihre allein trocken geblieben.
Es galt daher für ausgemacht, daß sie »kein Gemüt« habe: sie war »hochmütig, hartherzig und egoistisch«. – Allerdings konnte man sich gelegentlich auch wieder dem Zauber ihres Wesens nicht entziehen. Jutta Reimers hatte anerkanntermaßen die besten Einfälle, konnte Geschichten sich ausdenken, daß alle gespannten Ohres lauschten, verstand das Zeichnen und Malen wie ein richtiger Kunstmaler. Es gab kaum eine Begabung, die ihr nicht eigen gewesen wäre.
Über keine Schülerin wurde von den anderen so viel gesprochen wie über Jutta Reimers, und keine machte sich so wenig aus dem Klatsch der Klasse wie sie. Man hegte allerhand Vermutungen; es hieß, Jutta habe ein »Erlebnis« gehabt. Auf dies und jenes wurde geraten, aber Genaues wußte niemand. Sie hatte keine einzige wirklich intime Busenfreundin, aus der man etwas hätte herauslocken können: das war das Schlimme, denn von selbst verriet dieses Mädchen nichts.
Heut abend waren Juttas Gedanken wieder mal, wo sie in der letzten Zeit meistens sich aufzuhalten pflegten, bei ihrem Freunde Weischach.
Jutta führte, seit sie mit diesem Manne bekannt geworden war, eine Art Doppelleben. Der eine nüchterne Teil spielte sich ab in der Schule und im Hause: da war sie ein kleines unbedeutendes Mädchen, mußte ihre Schulaufgaben machen wie jede andere, wurde ermahnt und getadelt von den Lehrern, und von ihrem Bruder angestellt zu allerhand langweiligen Diensten. Ein ganz anderes Dasein, schöner, wichtiger, bedeutungsvoller, spielte sich ab in dem Atelier des Kunstmalers. Dort war sie Königin. Dort wurde sie bewundert, angebetet, kurz, behandelt wie es ihr zukam.
Sie wußte, daß sie für Weischach Großes bedeute, daß er tun würde, was immer sie von ihm verlangen mochte, daß sie Macht über ihn besitze. Macht über einen Menschen, einen Mann! – Wie stolz, das zu denken!
Oftmals weidete sie sich im geheimen an dem Gedanken. Ihre Phantasie schmückte sich die Freundschaft mit ihm wunderlich aus. Manches seiner Worte träumte sie weiter. Er hatte sie seinen »Genius« genannt, seinen »Engel«, seine »Fee«. In solcher Verkleidung sah sie sich selbst nur zu gern.
Als »Inspiration« hatte er sie im Bilde verewigt. Sie würde berühmt werden durch ihn! Er war ein großer Künstler: denn auch ihn vergrößerte sie, schuf ihn um in ihren Träumen zu einer Idealfigur.
Die Entdeckung, daß er ein Selbstporträt malen wolle, war für sie von höchstem Interesse. Mit langem Bart, im wallenden Mantel, eine Harfe in der Hand! Und sie sollte auch auf das Bild kommen. –
Sie sah das Kleid vor sich, das er ihr bestellen wollte, es war licht und mit Steinen über und über besät. Im Haar würde sie einen Schleier tragen, von einem Diadem festgehalten. So wie sie es an der schönen Schauspielerin gesehen, die im Weihnachtsmärchen die gute Fee dargestellt hatte. Vielleicht war es auch dem Kostüm ähnlich, welches Cousine Vally getragen zur letzten Redoute.
Und während ihre Nadel flink Faden um Faden einstach zu dem bunten Muster, welches sie selbst erdacht hatte, malte sie im Geiste ein noch viel herrlicheres Gemälde: sich selbst, bewundert und angestaunt von aller Welt als das schönste, daß außerordentlichste Wesen, das es gab.
III
Während der nächsten Tage war Jutta nicht dazu gekommen, Herrn von Weischach aufzusuchen. Das Bewußtsein, daß ihr Vater jetzt im Hause sei und daß ihr Geheimnis durch ihn möglicherweise entdeckt werden möchte, hielt sie zurück. Dabei hatte sie im geheimen große Sehnsucht nach dem Atelier. Wie mochte es mit dem Kostüm stehen, das er ihr versprochen hatte? Ob es schon in Arbeit war? Sie konnte es kaum erwarten, sich darin zu sehen. Im Unterricht war sie noch unaufmerksamer als gewöhnlich, weil sie beständig an Weischach, das Kostüm und sein Bild dachte.
Endlich fand sich Gelegenheit, hinüberzuspringen. Durch Erkrankung einer Lehrerin war eine Stunde ausgefallen.
Jutta ging, wie sie aus der Schule kam, mit Büchern und Heften unter dem Arm, durch das Vorderhaus schnurstracks nach dem Atelier.
Weischach empfing sie im Malerkittel. Er hatte gearbeitet. Auf der Staffelei stand eine Leinwand. Malstock und die Palette mit frischen Farben waren nicht fern.
»Umarme mich nicht, Kind!« rief er. »Ich bin vollgeschmiert. Leg' ab!« Er reinigte sich schnell die Hände und trat dann vor sie hin, ihre Hand ergreifend. »Bist du es wirklich? Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, dich jemals wiederzusehen.«
Statt der Antwort umarmte sie ihn. Als er dieses feine Köpfchen an seine Brust geschmiegt sah, überkam den alternden Mann tiefe Rührung. So ganz Kind war sie in diesem Augenblicke: wie sein Töchterchen erschien sie ihm. Er küßte ihr Haar ganz leicht, sie sollte es gar nicht merken. Es war das erstemal, daß er es tat. Jutta fand es als das selbstverständlichste Ding der Welt, daß er sie küsse.
Dann ließ sie ihn fahren und rief übermütig: »Fräulein Jubert ist krank. Wir haben kein Französisch. Vielleicht die ganze Woche nicht! Ist das nicht fein?« –
Jetzt bückte sie sich, um Mucki zu streicheln, die träge blinzelnd der Szene zwischen den beiden zugeschaut hatte. »Mucki ist schlechter Laune!« rief das Mädchen. »Wart', ich werde dich munter machen!« Sie nahm die Katze am Fell vom Boden auf und spielte mit ihr wie mit einem Ball. Mucki schien daran nicht viel Gefallen zu finden, sie wollte entweichen, aber Jutta verstand es, das Tier immer wieder einzufangen.
Sein Malerauge weidete sich entzückt an der schlanken Gestalt, den jugendlich flinken Gliedern, deren Grazie, Ebenmaß und Kraft bei der schnellen Bewegung zu voller Geltung kam. Die Aufregung des Spieles rötete ihr Gesicht, das Haar, von dem sie den Hut abgenommen hatte, war in reizende Unordnung geraten. Einer »Mignon« glich sie in diesem Augenblicke nicht, eher einer ausgelassenen »Philine«.
Endlich hatte sich die Katze durch einen schnellen Sprung auf einen hohen Schrank gerettet. Dorthin konnte ihr Jutta nicht folgen. Das Mädchen strich sich das Haar aus dem geröteten Gesicht und warf sich lachend auf den Divan.
In Weischachs durchfurchtem Angesicht witterte es wie Regen und Sonnenschein. Ihm wurde immer bange, wenn er sie so voll Leben, Kraft und Übermut sah: das brachte ihm den Unterschied zwischen ihm und ihr recht zum bitteren Bewußtsein.
Wenn Jutta darauf geachtet hätte, würde sie haben bemerken müssen, wie bleich und abgekommen er war. Aber Kinder haben für das Befinden anderer keinen Blick.
Sie war vor allen Dingen gespannt, zu hören, was aus dem geplanten Bilde geworden sei, ob er nun endlich anfangen würde, sie zu malen.
»Ich bin die letzten drei Tage nicht von der Staffelei gekommen!« sagte er.
»Was hast du gemacht?«
Er zog einen Vorhang von dem großen Fenster und rückte die Staffelei in das rechte Licht. »Was sagst du nun?«
Das Bild, nicht allzu groß, zeigte eine Landschaft mit Figuren: deutscher Wald. An einer Wegekreuzung im Dämmerlicht des Laubdaches ein Mann zu Roß, vor ihm stehend ein Kind. Die Züge des bärtigen Reitersmannes, durch den Schlapphut verdeckt, sind kaum zu erkennen. Der Schatten des Waldes liegt auf ihm; dagegen fällt alles Licht vereinigt auf die Gestalt des Kindes, eines kleinen Mädchens.
Das Bild war noch unfertig, das Pferd und der düstere Reiter vorläufig nur skizziert, voll ausgeführt dagegen die Kindesgestalt. Der Ausdruck des jungen Gesichtes, wie es voll Vertrauen zu dem Fremden aufblickt, war mit Liebe herausgebracht.
»Nun, was sagst du!« rief Weischach ungeduldig, als Jutta ihm allzulange mit der Anerkennung zurückhielt.