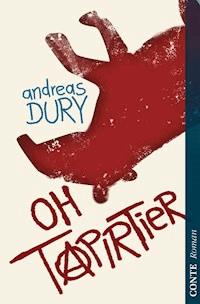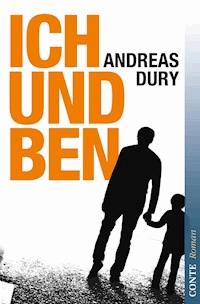Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Informatiker Ludwig Pfahl hat in jahrzehntelanger Eigenbrötelei ein hochkomplexes System entwickelt, das jede Sprache versteht – die gesprochene und die geschriebene, die Sprache der Gesichter und das binäre Flüstern in den Datenwolken. Das Sterben seines Vaters ruft ihn zurück in das Haus seiner Kindheit. In seiner alten Heimat entdeckt er seine Vertrautheit mit der Natur und seine Sehnsucht nach Liebe und familiärer Geborgenheit wieder. Doch KAIRA, der Prototyp seines Computersystems, spielt bereits eine entscheidende Rolle in den Planungen einer geheimen Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission. In einer packenden Erzählung wird dem Leser klar, dass die Maschine, je konkreter sie wird, umso gebieterischer nach der Symbiose mit einer realen Existenz verlangt. Ohne es zu wollen, aber auch ohne sich zu wehren, wird Pfahl in die Rolle eines Priesters gedrängt, der sich der KAIRA opfert und ein Tor aufstößt, durch das eine neue, mächtige und verstörende Wesensart in das Leben der Menschen dringt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eins
Pfahl kam am frühen Nachmittag bei seinem Elternhaus an. Er läutete an der Haustür und als sich nichts rührte, öffnete er sie mit seinem eigenen Schlüssel und betrat das Haus. Es roch nach verbrauchter Luft. Die Vorhänge vor den großen Fenstern im Wohnzimmer waren zugezogen. Es war nichts zu hören.
Er schaute in alle Räume. Im Elternschlafzimmer stand vom Ehebett nur noch eine Hälfte. Es war jetzt das Zimmer seines Vaters mit Schreibtisch, Computer, Regalen. Dafür standen in dem Zimmer, das früher seines gewesen war, ein Bügelbrett, ein Rollcontainer mit einem kleinen Fernsehapparat und eine Campingliege, auf der ungemachtes Bettzeug lag.
Überall waren die Rollläden zu drei Vierteln herabgelassen und die Fenster verschlossen. Er ging zurück in den großen Raum, den sie Diele genannt hatten, in dem immer gegessen worden war und an den sich, getrennt durch ein zwei Meter breites, bis zur Decke reichendes Regal voller Bücher, das Wohnzimmer anschloss. Das schwarze Klavier stand da, wo es immer gestanden hatte: in der Mitte zwischen der Windfangtür und dem hohen Wandheizkörper, dessen Rippen gelblich braun verfärbt waren von dem vielen Zigarettenrauch, der hier jahrzehntelang in die Luft geblasen worden war. Auf dem Klavierdeckel befanden sich eine Kleiderbürste, ein von zwei Stricknadeln durchstoßenes Wollknäuel, ein Kugelschreiber, dessen Clip abgebrochen war, ein handtellergroßer Spiralblock mit Notizen in der Handschrift seiner Mutter und das Telefon. Er zog die grünen Vorhänge von den Fenstern, hebelte die Terrassentür aus der Schließfuge und schwenkte den großen Flügel in den Raum. Kühle, frische Luft zog herein.
Eine leichte Bö fegte über die Terrasse und schüttelte Tropfen aus den Blättern von Rhododendron, Hibiskus und Jasmin. Die 20 m hohe Douglasie bewegte ihre geschwungenen Äste. Die Sonne schien, es war April. Nachdem er eine Weile in der Tür gestanden und hinaus auf die Terrasse geschaut hatte, bei der in den Fugen zwischen den abgesunkenen Betonfeldern Moos und Gräser und Löwenzahn wuchs, ging er zurück ins Haus. Er zog überall die Rollläden nach oben und kippte die Fenster.
Die lange Autofahrt summte noch in seinen Ohren. In der Nacht hatte er wenig geschlafen, weil Annette, von einem Migräneanfall heimgesucht, stundenlang umhergewandert war. Einmal, als sie sich übergeben musste, war Linda aufgewacht und hatte gesehen, wie sie sich brüllend in den blauen Putzeimer ergoss. Die Zehnjährige war in helle Aufregung geraten und Pfahl musste sie trösten und ihr tausendmal versichern, dass die Mama nicht stirbt. In den frühen Morgenstunden, als die Unruhe sich gelegt hatte, war Philipp aus der Stadt zurückgekommen. Er war betrunken gewesen und hatte mit seinen schweren Schuhen rücksichtslos über das Parkett gepoltert.
Pfahl ging in die Küche und öffnete den Kühlschrank. Er fand einen Teller, der mit einer erschlafften Klarsichtfolie abgedeckt war, auf dem sich Wurst- und Käsescheiben befanden. An den Stellen, die unter der Folie hervorschauten, waren sie verledert, hatten sich aufgebogen und verfärbt. Außerdem war da ein angebrochenes Glas Senf und eine Margarineschale mit etwas, das die Farbe von Pflaumenmus hatte und auch eine ähnliche Konsistenz. Als aber die Katze, angelockt vielleicht durch das Geräusch, das er mit dem Öffnen des Kühlschranks hervorgebracht hatte, ihm plötzlich mit aufgerichtetem Schwanz um die Beine strich, kapierte er, dass es pürierte Schweineleber war. Er stellte die Schale auf den Boden und die Katze machte sich darüber her. Er hockte sich neben sie und streichelte sie, während sie fraß. Die Katze war alt.
In diesem Haus hatte es immer Katzen gegeben. Einmal waren es mehr als ein Dutzend gewesen. Ein Teil der Jungen war getötet worden. Sie waren in einen weich ausgepolsterten Schuhkarton gekommen, in den die Mutter einen mit Äther getränkten Wattebausch legte. Sie hatte den Karton dann in den Heizungskeller gebracht und Pfahl wusste nicht, was weiter damit geschehen war. Die Kätzchen, die fürs Weiterleben bestimmt waren, waren ein paar Wochen bei ihnen geblieben und dann verschenkt worden.
Doch diese hier, die da in rasender Gier einen ganzen Margarinebecher pürierter Schweineleber fraß, würde wohl die letzte sein, dachte Pfahl.
Sie war hochbeinig und schlank. Ihr Fell war rot wie das eines Fuchses und hatte ergraute, rötlichbraune, ringförmig um den Leib verlaufende Streifen.
Er ging aus der Küche, durch die Diele, hinaus auf die Terrasse. Er rieb sich das Kinn und bog es gegen die Unterlippe, so dass er die zwei Tage alten Bartstoppeln fühlen konnte. Er drehte wieder um und begab sich ins Zimmer seines Vaters und stand dann ein paar Sekunden vor dem Computer. Es war immer noch der, den er ihm vor fünf Jahren geschenkt hatte. Das war nach der ersten Chemotherapie gewesen. Pfahl war fast eine Woche bei seinen Eltern geblieben, so lange wie selten, seit er zu Hause ausgezogen war. Er hatte seinem Vater gezeigt, wie das mit dem Computer geht, was man damit machen kann. Stundenlang waren sie nebeneinander hier am Schreibtisch gesessen und manchmal war auch seine Mutter hereingekommen, hatte sich hinter sie gestellt und zugeschaut. Viel hatten sie nicht verstanden. Einmal hatte er gesagt, dass der Computer eine Maschine sei, die aus Informationen kleine, feste, handhabbare Dinge macht. Seine Mutter hatte den Kopf geschüttelt und »So ein Quatsch« gemurmelt.
Nun dachte er, wie wichtig diese Vorstellung für ihn war, Informationen in die Hand nehmen zu können wie rieselnden Sand. Und er stellte sich Menschen vor, nackt wie Kinder, die in einem Sandkasten sitzen und mit Schaufel, Eimer und Förmchen Welten erschaffen, die für sie ungeheuer bedeutsam sind.
Er zog den Stuhl unter dem Tisch hervor und ließ sich darauf nieder. Es war totenstill. Es reizte ihn, der Geräusche wegen den Computer einzuschalten, und er stellte sich das Rauschen vor, wenn der Ventilator anlief, das Piepsen beim Testen der Laufwerke, das Tackern der Festplatte und schließlich dann die stark verhallte synthetisch geflötete Fanfare, wie man das damals schick fand in den seligen Zeiten von Windows XP. Er hatte den Finger am Einschaltknopf, aber drückte nicht.
Dass niemand im Haus war, überraschte ihn nicht. Er nahm an, dass seine Mutter mit dem Wagen unterwegs war, um seinen Vater aus der Klinik abzuholen.
Doch das Haus machte den Eindruck, als sei es für längere Zeit verlassen worden. Er fragte sich, ob seine Mutter vielleicht woanders gewohnt haben könnte, in den Tagen, die sein Vater im Krankenhaus verbracht hatte. Aber nein – er hatte sie in der letzten Woche ja mehrmals hier auf dem Festnetz erreicht.
Da kam ihm eine alte Geschichte in den Sinn. Sie spielte Anfang der 50er Jahre und handelte von seiner Mutter, als diese 19 Jahre alt gewesen war und eine Ausbildung zur Volksschullehrerin machte. Das Seminar befand sich 40 km vom elterlichen Bauernhof entfernt in Miltenberg. Es gab weder eine Bus- noch eine Bahnverbindung und der Weg, der mitten durch den Spessart führte, war für Pferdefuhrwerke und Fußgänger gemacht. Mit dem Fahrrad brauchte man gut und gern drei Stunden. Ihr Vater wollte ihr ein Zimmer in der Stadt mieten. Das kam für sie aber überhaupt nicht in Frage, niemals wollte sie auch nur eine Nacht allein, außerhalb des Elternhauses schlafen. Jeden Morgen fuhr sie um 4 Uhr los. Eines Tages im Winter hatte sie einen Unfall. Auf einer vereisten Abfahrt flog sie aus der Kurve und prallte gegen einen Baum. Als sie in der Nacht nicht nach Hause kam, stellte ihr Vater einen Suchtrupp zusammen. Sie fanden sie am frühen Morgen gut 5 km von zu Hause entfernt. Schwer verletzt hatte sie sich und ihr Fahrrad durch den Wald geschleppt. Nun duldeten die Eltern keinen Widerspruch mehr und sie bekam ein möbliertes Zimmer in der Stadt.
Wenige Tage später kam sie wieder nach Hause zurück. Sie war völlig erschöpft. Aber nicht die Fahrt 40 km durch den verschneiten Wald hatte sie ausgelaugt, sondern die Nächte davor, in denen sie keine Minute hatte schlafen können. Sie flehte ihren Vater an, er möge sie doch wieder bei der Familie wohnen lassen, die Angst fresse sie auf, wenn sie nachts allein in einem fremden Zimmer liege. Jeden Abend blockierte sie die Tür, indem sie sämtliche Möbelstücke in einer Reihe von der Tür bis zur gegenüberliegenden Wand aufstellte, und konnte trotzdem kein Auge zutun. Ihr Vater war wütend und ratlos. Aber dann ließ er sie doch wieder zu Hause wohnen und kaufte ihr ein Moped, eine Kreidler K50. Damit war seine jüngste und ängstlichste Tochter weit und breit die erste motorisierte Frau.
Als er jetzt an diese Geschichte dachte, konnte er sich vorstellen, wie seine Mutter in den letzten Tagen gelebt hatte, wie sie die Fenster schloss, die Rollläden herunterließ, die Vorhänge zuzog, die Türen verriegelte und wie sie sich in sich zusammenrollte und weder schlafen noch essen noch sonst etwas tun konnte, nachdem sie ihren Mann ins Krankenhaus gebracht hatte und es klar vor Augen lag, dass er aufbrach zu seiner letzten Etappe auf dem Weg ins Paradies und die Ärzte an ihm ihr letztes Pulver verschossen, dass er sie auf Nimmerwiedersehen verließ.
Er zündete sich eine Zigarette an und als er den ersten Zug genommen hatte, stand er auf und ging hinaus auf die Terrasse. Es ging jetzt ein stetiger Wind. Das Blau des Himmels wurde aufgezehrt von einer Farbe, wie Asche sie hat. Er dachte an den Hagel, durch den er gefahren war, an den Moment, als der schwarze Himmel aufbrach und die Körner auf den Asphalt knallten und splitterten, an seine Windschutzscheibe und auf das Blech prasselten, wie das ganze Auto dröhnte im Gewirr der Spuren am Frankfurter Kreuz, wie die Autobahn plötzlich kochte. Er hatte gezittert vor Angst.
Ein Eichhörnchen sprang über die Wiese, lautlos und leicht, als glitte es auf einer Welle dahin. Pfahl hörte ein Knistern, als es am Stamm der Douglasie in die Höhe schoss, dann war es verschwunden und nur ein jähes Aufschaudern im Nadelwerk markierte einen Augenblick lang die Stelle, wo es in den mächtigen Baum eingedrungen war.
Plötzlich hörte er Geräusche im Haus. Er drehte sich um und sah seine Mutter in der Terrassentür stehen. Mit der einen Hand hielt sie sich am Rahmen fest, die andere hatte den Knauf gepackt und es sah aus, als wolle sie die Tür mit großer Kraft zuwerfen. Sie war mager und der Wind wehte ihr die grauen Haare wie Stroh vors Gesicht. Er schnippte seine Zigarette ins Gebüsch und ging zu ihr hin. Sie trat zurück in die Diele. Hinter ihr stand sein Vater und lächelte verlegen. Er trug einen Frotteebademantel mit längs verlaufenden blauen und roten Streifen. Pfahl hatte noch nie einen anderen an ihm gesehen. Der Mantel stand offen und als der Wind hineinfuhr und die Schöße auseinanderklafften, sah Pfahl, dass sein Vater mit einem hellblau-weiß karierten Flanellschlafanzug bekleidet war, dessen Hosenbeine an den Knien bauschten und schon eine Handbreit darunter endeten. Über den Schienbeinen war die Haut so dünn, dass er die Knochen hindurchscheinen sah. Die nackten Füße steckten in klobigen Ledersandalen. Unschlüssig stand er auf der Türschwelle. Pfahl gab ihm die Hand und streichelte gleichzeitig mit der linken seine Schulter. Er fragte: »Bist du jetzt wieder zu Hause?«
Sein Vater sagte: »Ja, es ist jetzt vorbei. Wir lassen jetzt nichts mehr machen.«
Sie gingen hinein und setzten sich an den Esstisch. Nebenan in der Küche raschelte die Mutter mit Papiertüten und hantierte mit Geschirr und Besteck. Pfahl ging zu ihr. Sie hatte unterwegs eingekauft. Er half ihr, einen Imbiss zu richten. Es gab Aufschnitt, frische Brötchen, Butter, Käse und Honig. Pfahl dachte an die traurigen Vorräte, die er im Kühlschrank gesehen hatte und wusste, dass seine Mutter die ganze Zeit so gut wie nichts gegessen hatte, dass sie sich verzehrt hatte in der Sorge um den Vater.
Als sie am reichlich gedeckten Tisch saßen, rühmte der Vater das Essen und sagte: »Darauf hab ich mich im Krankenhaus die ganze Zeit gefreut.« Er trank Kaffee und belegte sich zwei Brötchen. Er machte das sehr sorgfältig. Pfahl hatte sein erstes schon aufgegessen, da war sein Vater immer noch bei den Vorbereitungen. Währenddessen erzählte er von seinem Zimmergenossen im Krankenhaus.
Das war ein alter Engländer, der jeden Tag Besuch von seiner Frau bekam. Wenn sie ins Zimmer trat, war immer schon die Krankenschwester bei ihr und gemeinsam hievten sie den klapperdürren Mann in den Rollstuhl. Die Frau war selbst auch nur noch ein Hauch, aber mit einer überwältigenden Freundlichkeit in den Augen, ein kleines zierliches Vögelchen. Sie schob ihren Mann aus dem Zimmer, zu den Fahrstühlen hin und wenn er, Pfahls Vater, ans Fenster trat, konnte er sie unten herauskommen sehen. Die Frau schob den Mann zu einem Auto hin. Sie machte die Heckklappe auf und ein Hund sprang heraus. Der Hund war alt. Jedes Mal, wenn er heraussprang, kippten ihm die Vorderbeine weg, und er landete auf der Schnauze. Wenn er sich aber aufgerappelt hatte, wedelte er mit dem Schwanz und stupste sein Herrchen an. Der erhob sich aus seinem Rollstuhl. Unendlich mühsam war das und konnte nur gelingen, weil die Frau ihn nach Kräften unterstützte. Sie führte ihn dann hinter das Gefährt, damit er sich an den Griffen festhalten konnte, schloss die Heckklappe und half dem Hund in den Rollstuhl. Und so begannen sie ihren Spaziergang. Zwei Menschen, die mit winzigen Schritten einen Rollstuhl vor sich herschieben, in dem ein Hund sitzt. Das haben sie jeden Tag gemacht. Eine Runde um den Springbrunnen.
Während Pfahls Vater das erzählte, legte er seinem Sohn zuerst das eine und dann auch noch das andere von ihm zubereitete Brötchen auf den Teller. Pfahl hörte zu und aß. Später läutete es an der Tür. Die Mutter öffnete. Es war ein Nachbar, der mitbekommen hatte, dass Pfahls Vater nach Hause gekommen war. Er fragte, ob er am Abend zum Skatspielen käme. Pfahls Vater meinte: »Eher nicht.« Der Nachbar erkundigte sich nach seinem Gesundheitszustand und fragte, warum er überhaupt im Krankenhaus gewesen sei. Der Vater sagte, dass es wegen seines Bronchialkarzinoms gewesen sei und der Nachbar meinte: »Alles klar. Das braucht seine Zeit, damit ist nicht zu spaßen.« Pfahls Mutter stapelte die Teller übereinander und fragte den Nachbarn, ob er sich setzen wolle. Der lehnte das Angebot ab, blieb aber noch eine Weile so ungünstig in der Nähe der Haustüre stehen, dass Pfahls Vater sich halb auf dem Stuhl umdrehen musste, um ihm ins Gesicht sehen zu können. Er wusste nichts zu sagen und der Nachbar sagte: »Letzte Woche hat ja der Wallner kräftig abgesahnt: ohne Vier und gestandenes Re im Bock.« Endlich ging er. Pfahl und seine Mutter räumten den Tisch ab.
Dann trat er vor die Fensterfront und schaute in den Garten hinaus. Der Wind hatte zugenommen. Der Himmel war grau. Die Büsche bogen sich. Ein schlaffes, faustgroßes Säckchen aus einem gelben Geflecht, das an einer 20 cm langen Schnur unter dem Dachvorstand baumelte, fing an, exzentrisch zu kreiseln. Staub und Blätter erhoben sich in einem jähen Wirbel in die Luft. Dann war der Hagel da. Zuerst so, als würfe jemand ein paar Mal eine Handvoll Reis gegen das Fenster und dann als ein heftiges, scharfes Rauschen, so laut, wie wenn ein Kieslaster seine Ladung abkippt. Die ganze Terrasse schien zu explodieren. Seine Eltern kamen zu ihm und zu dritt standen sie am Fenster und sahen den hüpfenden Eiskugeln zu. Und die Douglasie schwenkte emphatisch ihre Arme.
Pfahl sah sich nach einem Aschenbecher um. Er fand einen auf dem Sims des Kaminofens. Er war aus schwerem, dunkelrotem Glas, in dem Luftblasen eingeschmolzen waren, so groß und so geformt wie Weizenkörner. Es war ein riesiger Aschenbecher. Man hätte mindestens hundert Zigaretten darin ausdrücken können. »Ich mach dir mal deine Inhalation«, sagte Pfahls Mutter. Als sie sich von dem Fenster abwandte, um zurück in die Diele zu gehen, streichelte sie ihrem Mann kurz über den Rücken. Pfahl holte die Zigaretten aus seiner Hemdtasche hervor, stieß eine Kippe heraus und hielt sie seinem Vater hin. Er gab ihm Feuer. Der Vater musste husten. Vom Esstisch her, wo sie dabei war, das Inhalationsgerät aus seinem orangefarbenen Plastikkoffer herauszunehmen, rief die Mutter: »Herbert, musst du sogar jetzt noch rauchen!«
So plötzlich wie der Hagel gekommen war, hörte er auch wieder auf.
Pfahl blieb mit seinem Vater am Fenster stehen. Sie rauchten ihre Zigaretten und sahen, wie die liegengebliebenen Eiskugeln kurz in den Strahlen der wiedererschienenen Sonne aufglitzerten, bevor sie schmolzen. In den Lachen spiegelte sich das Licht so sehr, dass es blendete. Pfahls Mutter hatte den Tank des Inhalationsapparates mit Wasser gefüllt und eingeschaltet. Sie gab einen Kaffeelöffel Salz in das Medikamentenröhrchen und setzte es in den Zerstäuber ein. Der Vater wandte sich um und sagte: »Das hat doch jetzt alles keinen Sinn mehr.« Die Mutter hielt inne und sah ihren Mann an. Sie hatte Tränen in den Augen. »Komm, setz dich her«, sagte sie. Sie steckte das Mundstück auf das Dampfröhrchen. Pfahl hielt seinem Vater den Aschenbecher hin, damit er seine Zigarette hineinwerfen konnte. Der seufzte und ging langsam zu seinem Platz am Esstisch. Mit aufgestützten Ellenbogen saß er vor dem Inhalator und wartete darauf, dass die Verdampfung einsetzte. Nach einiger Zeit begann der Kessel leise zu singen, dann spuckte er ein paar Mal kochend heiß nach dem Vater, der zurückzuckte und sich zur Seite bog und sich dann wieder vorbeugte und seine Lippen um das Mundstück legte und den Dampf, den der Apparat mit einem gleichmäßigen Rauschen von sich gab, tief in seine zerfressene Lunge zog.
Die Mutter fragte: »Wie lange willst du bleiben?«
Pfahl starrte in die blendenden Pfützen. Was sollte er sagen? Sollte er sagen: So lange, bis es vorbei ist?
Jedes Mal, wenn sein Vater ausatmete, versuchte er, so viel Luft wie möglich aus der Lunge zu pressen. Es klang wie das anschwellende Strömen einer Toilettenspülung und endete in einem schäumenden und gurgelnden Hustenkrampf, bei dem sich die Ader an seiner Schläfe in einen fetten Regenwurm verwandelte. »Ich weiß es nicht«, sagte Pfahl, »ich hab einen Schlafsack dabei.«
»Glaubst du, wir haben keine Decken im Haus?«
»Doch, aber ich dachte …«
Sein Vater nahm den Mund vom Inhalator und sah zu ihnen hinüber. Sein Gesicht war nass und rot vom Dampf und von der Anstrengung. Er sah freundlich aus und es schien, als sei er froh, seinen Sohn bei sich zu haben.
»Ich muss mit Annette telefonieren. Es ist ihr nicht gut gegangen heute Morgen.«
»Was hat sie denn?«
»Sie hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Es war ihr schlecht. Sie hat Kopfweh.«
Der Vater wandte sich unschlüssig wieder dem Inhalationsapparat zu. Dampf brandete an sein Gesicht, wölkte über seine zerfurchte Stirn, folgte eine kurze Strecke dem Bogen des unbehaarten Schädels und stieg blasser und unsichtbar werdend zur Decke auf.
Pfahls Mutter erhob sich vom Stuhl. »Herbert, ich glaube, du solltest dich ein wenig ausruhen.« Halb hinter ihm, halb neben ihm stehend griff sie ihm vorsichtig unter den Armen durch und zog ihn hoch. Der Vater ließ es geschehen.
Die beiden gingen wie aneinandergewachsen langsam aus der Diele ins angrenzende Wohnzimmer, vorbei an dem runden Tisch, auf dem die alte, verschossene, mit lang herabhängenden Troddeln verzierte Brokatdecke lag, hinein ins Zimmer des Vaters. Hinter der Schwelle drehte sich seine Mutter noch einmal um, ihre Augen lagen tief und dunkel im Schatten des Jochbeins, sie schloss leise die Tür.
Pfahl ging vors Haus, wo er an der Straße seinen Wagen abgestellt hatte. Er nahm sein Gepäck vom Rücksitz und stellte es auf den Gehsteig. Mit dem Rücken am Wagen lehnend betrachtete er das Haus, in dem er aufgewachsen war, während er das Telefon aus der Tasche zog und seine Berliner Nummer wählte.
»Wie geht es dir?«, fragte er leise, nachdem seine Frau sich gemeldet hatte.
»Besser. Mach dir keine Sorgen. Und bei dir? Wie ist es da so?«
Vor dem Haus hatte früher eine 18 m hohe Fichte gestanden. Bei jedem Sturm hatten seine Eltern gefürchtet, dass sie ihnen aufs Haus stürzte. Vor etwa zehn Jahren war beschlossen worden, sie zu fällen und in einem seltsamen Anflug von Übermut und Abenteuerlust hatten sein Vater und er verabredet, dies selbst zu tun. Annette war im achten Monat mit Linda schwanger gewesen und er hatte sich mit Philipp, der damals neun oder zehn Jahre alt war, eine Woche lang bei seinen Eltern einquartiert. Kaum, dass sie angekommen waren, hatte sein Vater ihnen die Kettensäge gezeigt, die er bei einem Nachbarn ausgeliehen hatte. Weder er noch sein Vater hatten je mit einem solchen Gerät gearbeitet. Es war sehr aufregend gewesen, auch für das Kind. Sie hatten sich auf die Terrasse begeben und das Starten geübt. Irgendwann war der Motor schließlich angesprungen und er hatte die brüllende Säge mit beiden Armen emporgerissen und sie über dem Kopf wie ein monströser Killer geschüttelt. Philipp hatte vor Freude und Schreck gejauchzt. Da war seine Mutter wutentbrannt auf die Terrasse gekommen und hatte sie zusammengestaucht wegen des Lärms und wegen der Abgase, die durch die offene Terrassentür ins Wohnzimmer nebelten.
Am nächsten Tag hatten sie den Baum gefällt. Als er fiel, riss er das Geländer am Balkon des Nachbarn, der ihnen die Kettensäge ausgeliehen hatte, aus der Verankerung und anschließend schlug er noch dessen Briefkasten von der Wand. Die ganze Straße hatte über Pfahl und seinen Vater gelacht.
Das war es, was er dachte, während er am Auto lehnte und auf sein Elternhaus sah und mit seiner Frau telefonierte.
»Bist du noch da?«, fragte sie.
»Ja.«
»Wie lange bleibst du?«
»Ich glaube, dass ich so lange bleibe, bis es vorbei ist.«
»Bis was vorbei ist?«
»Bis er tot ist«, sagte er.
Er ging zurück ins Haus. Sein Gepäck stellte er in der Diele neben das Klavier. Er hörte die Schlafzimmertür gehen und sah seine Mutter, wie sie aus dem Zimmer trat, die Tür hinter sich schloss und sich aufs Sofa fallen ließ. Sie stützte die Ellenbogen auf den Couchtisch und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Die Bündchen ihres blassrosa Pullovers rutschen nach unten und die Haare fielen ihr grau wie die Dämmerung vors Profil. Nach einer Weile richtete sie sich auf und sah ihn an. Sie ließ die Hände rechts und links neben sich auf die Sitzfläche fallen, nachdem sie diese kurz mit den Handflächen nach außen in die Luft gehoben hatte. Pfahl wusste nicht, ob es eine distanzierende Geste oder eine im Ansatz abgebrochene, viel größere Bewegung war.
Sie sagte: »Ich hab seit drei Tagen nicht geschlafen. Sei so gut und setz dich hierher. Ich muss mal ins Bett.« Er ging zu ihr hin und fragte: »Und was soll ich tun?«
»Nichts, nur dasitzen. Er hat sein Schlafmittel genommen. Und mach die Tür einen Spalt auf. Dann hörst du ihn atmen.«
Er trat zur Seite, damit sie besser an ihm vorbeikam, und sie ging in das Zimmer, das früher sein Zimmer gewesen war. Sie ließ die Tür offen und er hörte, dass sie sich auf die Liege ins ungemachte Bettzeug sinken ließ und die Schuhe abstreifte, die mit einem dumpfen Laut zu Boden fielen.
Leise öffnete er die Tür zum Zimmer seines Vaters und blieb auf der Schwelle stehen. Das Fenster stand weit offen, der Rollladen war halb heruntergelassen. Die Luft war frisch und kühl. Das milde Dämmerlicht zeichnete alle Konturen weich. Sein Vater lag im Bett, bis zum Kinn unter der Decke, die so exakt über ihn gebreitet war, als figuriere er in der Bettenabteilung eines Möbelhauses. Sein Gesicht war zur Decke gerichtet, die Augen geschlossen. Ein dünner, durchsichtiger Schlauch verlief von einem Ohr unterhalb der Nase vorbei zum anderen. Pfahl schien es wie das Grinsen eines anderen Gesichts im Gesicht seines Vaters. Hinter dem linken Ohr verließ der Schlauch das Gesicht und mündete im Ventil einer großen, fast 1 m hohen blauen Gasflasche, die in einem Flaschenwagen aus weißlackiertem Eisenrohr neben dem Bett stand. Der Atem seines Vaters klang wie das Rauschen in einer Wasserleitung, als müsse die Luft mühsam durch eine enge Röhre gezogen werden, und das Ausatmen begann als befreiender Seufzer und endete in einem schaumigen Röcheln, dessen Unterbrechungen auf einen Hustenreiz hindeuteten, dem nachzugeben seinem Vater die Kraft fehlte. Manchmal setzte die Atmung für ein paar Sekunden aus. Und wenn sie dann wieder begann, war sie im ersten Moment wie dieses jähe Luftschnappen, wenn einem der Schreck in die Glieder fährt.
Er verließ das Zimmer und setzte sich auf das Sofa. Eine Zeit lang hörte er der Atemrassel seines Vaters zu. Beinah schlief er darüber ein.
Er stand auf und zündete sich eine Zigarette an und ging ein wenig hin und her. Eine Weile stand er in der Terrassentür und schaute auf die Bäume. Er trat zurück in den Raum und ging in die Küche, wo er die Unsauberkeit und die Unordnung betrachtete, in die seine Mutter sie hatte versinken lassen.
Er drehte den Wasserhahn über dem Spülbecken auf, hielt seine Zigarette darunter und warf sie in den Mülleimer. Dann zog er den Stuhl, der unter den Küchentisch gerückt war, ein wenig vor, hängte sein Jackett über die Lehne und begann mit der Arbeit. Er tat, was getan werden musste, und dachte dabei an nichts anderes. Essensreste waren von den Tellern zu schieben. Verdorbene Lebensmittel mussten weggeworfen, das Geschirr und Besteck musste abgewaschen werden. Er warf auch die Margarineschale mit den blutigen Resten der zermahlenen Leber in den Müll und brachte ihn nach draußen, zur Mülltonne vor der Haustür. Nachdem er all dies getan hatte, war mehr als eine Stunde vergangen. Er dachte, es sei an der Zeit, nach seinem Vater zu sehen.
Alles war wie vorher. Regungslos lag er da und mit lautem, mühsamem, erschöpftem Röcheln erkämpfte er sich Atemzug für Atemzug.
Er schaute auch nach seiner Mutter. Sie wachte sofort auf, als er über die Schwelle trat und sah ihn eine Sekunde lang erschrocken und verwirrt an. Dann sagte sie: »Dass du mich immer so erschrecken musst.«
Er sagte: »Es ist alles in Ordnung. Ich war gerade bei ihm. Bleib nur liegen, ich wollte nur sehen, ob dir was fehlt.«
»Wieso? Was sollte mir fehlen?«
»Ich weiß nicht. Bleib nur liegen.«
Aber sie wollte aufstehen. Pfahl wäre es lieber gewesen, sie wäre noch eine Weile liegen geblieben und er hätte noch eine Weile allein in den Räumen, in denen er aufgewachsen war, herumgehen und herumstehen können. Er ging von der Tür weg, damit sie sich beim Aufrichten, beim Zurechtrücken der Kleidung und beim Schuhanziehen nicht beobachtet fühlte.
Als sie aus dem Zimmer kam, lehnte Pfahl am Klavier und war dabei, sich eine Zigarette anzuzünden. Sie sagte: »Was in diesem Haus geraucht worden ist: ein Wahnsinn!«
Er sagte: »Zu Hause rauche ich kaum.«
Er steckte die Zigarette zurück in die Packung und drehte sich weg von ihr. Er strich mit der Hand über das Klavier und fragte: »Wann hast du das letzte Mal gespielt?«
Und sie sagte: »Ach!«
Sie ging weiter zum Zimmer seines Vaters. Hinter sich schloss sie die Tür. Pfahl hatte keine Ahnung, was sie da machte und wie lange sie da bleiben würde. Er fragte sich, was er tun sollte, jetzt und in den kommenden Tagen.
Da fiel ihm das Auto ein, das er sich letzte Woche zusammen mit Annette und den Kindern angesehen hatte. Es war ein Mercedes. Pfahl hätte sich nie diesen Wagen ausgesucht. Er war ihm viel zu teuer. Aber Annette wollte ihn. Auch der Verkäufer hatte ihnen zugeraten. Er sagte: »Den müssen Sie doch gar nicht gleich bezahlen. Sie bekommen von der Mercedes-Benz Bank einen Kredit zu einem Zinssatz von 1,2 %. Das ist weniger als die Inflationsrate. Da bekommen Sie im Prinzip sogar noch was raus.«
Er schien eine Vorliebe für Fragen der Finanzierung zu haben, denn kaum, dass Annette auch nur das geringste Interesse gezeigt hatte, begann er über den Zusammenhang von Zinssatz und Inflationsrate zu reden. Und einmal, auf irgendeinen Einwand Annettes hin, hatte er mit einer Begeisterung und einer Leidenschaft in der Stimme gesagt: »Aber wir brauchen die Inflation! Ohne Inflation kein Fortschritt. Kein Leben ohne Inflation!« Nun versuchte Pfahl sich vorzustellen, wie das Geld es machte, dass einfach das Über-sie-hinweg-Wehen der Zeit den Dingen ihren Wert nahm und es kam ihm vor, als sähe er zum ersten Mal das Wesen des Geldes: ein wimmelnder Ameisenstaat, der von allem, was es gab, jedes Jahr 2 % überflüssig machte. Er dachte auch an das Auto. Er stellte sich vor, wie er damit über die Autobahn brauste und es fröstelte ihn.
Er war hinaus auf die Terrasse gegangen und da, wo der steile, grasbewachsene Hang hinunter auf die Wiese führte, rutschte er aus und fiel hin. Durch den Sturz in einen Zustand plötzlicher Klarheit versetzt, erblickte er in der verwilderten Buchsbaumhecke, die das Grundstück seiner Eltern zum Bachlauf hin begrenzte, das Gesicht eines Eichhörnchens. Er sah es mit einer solchen Deutlichkeit, dass es ihm übermäßig groß erschien: wie der Kopf eines ausgewachsenen Katers. Es grauste ihm vor diesem Tier. Hatte es gewollt, dass er stürzte?
Nun hatte er seine Hose dreckig gemacht, seine schöne, hellbeige Leinenhose, die er angezogen hatte, um angenehm gekleidet vor seinen Eltern zu erscheinen. Nasses Gras und Erde hatten sich braungrün in das Gewebe über seinem Knie gerieben. Er rappelte sich auf und drehte sich um. Er sah seine Mutter bei der Tür.
Steif und schlotternd zugleich, wie eine Marionette, hob sie einen Fuß über die Schwelle, dann den nächsten, dann stand sie im Freien. Sie schwankte. Pfahl kraxelte den Abhang hinauf, lief zu ihr hin und schlang seine Arme um sie und legte seinen Kopf auf ihre Schulter. Mit einer Handfläche an ihrem Hinterkopf zog er sie zu sich heran, dass ihre Wangen sich berührten. Sie war hölzern und kalt und wimmerte. Eine Weile standen sie umschlungen da. Dann führte er sie ins Haus zurück. Er setzte sie auf dem Sofa nieder und ging weiter und betrat das Zimmer des Toten.
Nach ein paar Minuten kam er wieder heraus und setzte sich neben sie aufs Sofa. Er legte einen Arm um ihre Schulter. Bald stand sie mühevoll auf und ging nun ihrerseits für eine gewisse Zeit in das Zimmer. Sie kam zurück und setzte sich aufs Sofa.
»Jetzt sind wir allein«, sagte Pfahl.
»Du ja nicht«, entgegnete seine Mutter. Er sagte eine Zeit lang nichts, dann sagte er: »Wir lassen dich nicht allein.«
Einmal gingen sie auch zu zweit in das Zimmer und standen, ohne ein Wort zu sagen, vor dem Bett.
Als die Dämmerung hereinbrach, machten sie lange kein Licht. Schließlich stand Pfahl auf, tastete sich zum Lichtschalter und das Wohnzimmer erstrahlte in einer ihm sofort unrichtig erscheinenden Helligkeit. Er sagte: »Ich hol ein paar Kerzen.« Er machte auch Licht in der Diele und in der Küche. Im Küchenschrank und im Schränkchen über der Garderobe fand er halb heruntergebrannte Adventskranzkerzen und ein paar Teelichter. Er setzte alle Kerzen auf einen flachen Teller, zündete sie an und brachte sie ins Wohnzimmer, wo er sie vor seiner Mutter auf dem Tischchen abstellte. Er schaltete das Licht im Wohnzimmer wieder aus und ging in die Diele.
Er rief zu Hause an. Philipp war am Apparat. Pfahl sagte: »Der Opa ist gerade gestorben.« Er ließ dem Jungen Zeit, etwas zu sagen, aber dem fiel nichts ein. Er hörte, wie Annette im Hintergrund rief: »Ist es der Papa?« Sie hatte den Hörer schon übernommen, bevor er sich von Philipp verabschieden konnte.
Dann fragte sie: »Ist es vorbei?«
Er sagte: »Ich glaube, er hat einfach aufgehört zu atmen. Ich glaube, er hat das am Schluss gar nicht mehr mitgekriegt.«
Sie fragte, wann sie mit den Kindern nachkommen solle. »Vielleicht nicht sofort«, meinte er, »ich ruf dich morgen wieder an.«
Er ging in die Küche und begann mit der Zubereitung eines Abendbrots. Er kochte Eier und Pfefferminztee, legte Wurst und Käse auf eine Platte, deckte den Tisch und dachte darüber nach, was jetzt getan werden musste. Ein Arzt, fiel ihm ein, wegen des Totenscheins. Das war alles, was noch zu erledigen war. Sie würden essen, dachte Pfahl, und dabei auf den Arzt warten. Er ging ins Wohnzimmer und setzte sich neben seine Mutter aufs Sofa. Er streichelte ihren Rücken. Dann sagte er: »Komm, wir essen was.«
Nach kurzem Zögern stand sie seufzend auf und folgte ihm an den Tisch. Er goss Tee in die Tassen und legte seiner Mutter und dann sich selbst eins von den Brötchen, die vom Nachmittag übriggeblieben waren, auf den Teller. Er schnitt sein Brötchen in zwei Hälften, beschmierte beide mit Butter und legte zwei Scheiben Bierschinken auf die eine. Er nahm eine Essiggurke aus dem Glas und schnitt sie in Streifen. Die legte er auf die Wurst und setzte die zweite Brötchenhälfte darüber. Er nahm das Brötchen mit beiden Händen, drückte es ein wenig und biss hinein. Er fühlte, wie seine Zähne die Gurkenstreifen durchtrennten und es gefiel ihm das saftige, krachende Geräusch, das damit einherging. Noch während er kaute, sagte er: »Wir sollten Dr. Reuss anrufen.«
Seine Mutter war gerade dabei, die Tasse vorsichtig an den Mund zu heben. Sie setzte sie wieder zurück und fragte: »Warum?«
»Wegen dem Totenschein«, sagte er.
»Wir machen das morgen. Jetzt ist es zu spät.«
Pfahl sah auf die Uhr. »Es ist noch nicht mal halb elf.«
»Und warum hat das nicht Zeit bis morgen?«
»Keine Ahnung. Aber dann hätten wir’s hinter uns.«
»Was hätten wir dann hinter uns?«
»Na ja, die Sache mit dem Totenschein.«
»Und dann?«
Pfahl wollte noch etwas sagen, aber seine Mutter unterbrach ihn und sagte: »Ich will es nicht!«
Er klopfte ein Ei auf und pellte die Schale herunter. Er legte auch seiner Mutter ein Ei neben den Teller. Er biss von seinem ab und stellte es dann, nackt wie es war, in den Eierbecher. Er streute Salz auf die Stelle, an der er es angebissen hatte und gab mit der Pfeffermühle ein paar grobe Pfeffersplitter hinzu. Seine Mutter, die noch gar nichts gegessen und nur einen kleinen Schluck Tee getrunken hatte, schob, wie von einem jähen Widerwillen gepackt, den Teller von sich, stand auf, strich ihrem Sohn übers Haar und sagte: »Schlaf gut, Ludwig. Es muss ja alles weitergehen.« Sie ging in das Zimmer, das früher sein Zimmer gewesen war, und die Campingliege quietschte und knarzte, als sie sich darauf niederließ. Pfahl aß in Ruhe zu Ende. Dann räumte er den Tisch ab, spülte und rollte schließlich seinen Schlafsack auf dem Sofa aus, zog sich bis auf Unterhose und Unterhemd aus und kroch hinein.
Es war eine unruhige Nacht. Wenn er einschlief, träumte er, er läge in einem Haus ohne Dach, durch das der Wind wehte, und wenn er wach lag, spürte er, wie etwas dieses Haus verließ und für immer entschwand. Erst am Morgen schlief er tief und fest.
Als er aufwachte, schien die Sonne. Die hohen Fenster vor der Terrasse lagen noch halb im Schatten. Außer dem Vogelgezwitscher war nichts zu hören. Er stand auf, um nach seiner Mutter zu sehen. Die Liege war leer. Es fehlte auch das Bettzeug. Er ging ins Zimmer seines Vaters, und da lag sie auf dem Bettvorleger.
Sie erwachte sofort, als er über die Schwelle trat. Er blieb stehen und sagte: »Ach, da bist du. Hast du schlafen können?« Sie schaute ihn eine Sekunde lang verwirrt an. Dann warf sie die Decke von sich und stand auf. Sie machte das so, als müsse sie es neu lernen. Sie drehte sich auf den Bauch und stemmte sich dann auf Knie und Hände. So verharrte sie ein paar Sekunden. Dann setzte sie das Gesäß auf die Fersen, richtete ihren Oberkörper auf und ließ die Arme hängen. Und schließlich griff sie mit der linken Hand die Bettkante, legte das rechte Bein ein wenig zur Seite und wuchtete sich in die aufrechte Haltung. Sie war ganz und gar angezogen. Nur Schuhe hatte sie keine an.
Er sagte: »Ich mach Frühstück.«
Er brachte das an den Tisch, was vom Abendbrot übriggeblieben war. Wurst und Käse, das gekochte Ei, Butter, Marmelade und die letzten drei von den Brötchen, die seine Eltern gestern, als sie vom Krankenhaus kamen, mitgebracht hatten. Er hörte Wasser in den Leitungen rauschen und wusste, dass seine Mutter im Elternbadezimmer war. Vor vielen Jahren hatten sie sich den Luxus geleistet, den hinteren Teil zu einem hübschen, kleinen Badezimmer umzubauen. So konnten sie direkt aus dem Bett unter die Dusche gehen, ohne kalte Flure durchqueren zu müssen. Doch kurz nachdem sein Vater in Rente gegangen war, wollte er seine Frau nachts nicht mehr bei sich haben. Sie hatten ihn angerufen und ihn gebeten, ihnen zu helfen, aus dem Schlafzimmer ein Zimmer für den Vater zu machen. Zu dritt hatten sie das Bett halbiert, einen Schreibtisch hereingetragen und einen Drehstuhl. Ein Teppich wurde vom Dachboden geholt und Regalschienen an die Wand gedübelt. Am Ende war es ein Zimmer, wie Studenten es bewohnen.
Beim Abschied, als er wieder nach Hause fuhr, hatte seine Mutter ihm unter vier Augen erzählt, wie sehr es sie in Frage stellte und wie sehr es sie ängstigte, dass sein Vater sie nun aus dem Zimmer heraushaben wollte.
Nun hatte sie erstmals wieder darin geschlafen.
Er kochte starken Kaffee und setzte sich zu einer ersten Tasse an den Tisch. Nach einer Weile kam seine Mutter hinzu.
Pfahl goss ihr Kaffee in die Tasse. Er rückte das Milchkännchen und die Zuckerdose in ihre Nähe. Dann fragte er: »Wie geht es dir?« Sie stieß einen freudlosen, verächtlichen Lacher hervor, hob die dampfende Tasse an den Mund und trank einen Schluck. Dann sagte sie: »Es ist schrecklich.«
Sie stellte die Tasse zurück auf die Untertasse, streichelte mit der linken Hand das heiße Porzellan und sagte: »Und es wird nie aufhören.«
Sie starrte in die Luft und er wartete, ob sie noch etwas sagen würde. Aber sie blieb still. Er zeigte auf das Ei, das auf dem Tisch lag und fragte: »Willst du dein Ei nicht?«
Sie schüttelte den Kopf und er nahm es und schlug es auf der Tischkante auf.
Sie sagte: »Wenn einer tot ist, ist er immer und ewig tot. Da gibt es nie eine Pause.«
In einer hektischen, flattrigen Bewegung ergriff sie mit der einen Hand das Messer, mit der anderen das Brötchen und stach hinein. Im nächsten Augenblick ließ sie es auf den Teller fallen, als habe ein Ekel sie erfasst. Sie schüttelte den Kopf und sagte: »Es gibt da so einen Spruch.« Sie hielt inne. Ihre Augen waren rot. Tränen liefen ihr über die Jochbeine. Dann sagte sie es: »Zeit heilt Wunden.«
Wieder brachte sie diesen verächtlichen, hässlichen Lacher hervor. Dabei bebten ihre Lippen. Sie sah ihn herausfordernd an und fragte: »Und wenn ich das nicht will?«
Er murmelte: »Dann musst du eben die Zeit anhalten.«
Sie starrte ihn an und rief: »All die Jahre! Wie soll ich die denn anhalten?« Sie schlug die Hände vors Gesicht. Er legte das Ei aus der Hand und ging um den Tisch herum. Er beugte sich zu ihr herunter und nahm sie in den Arm. Er drückte ihren Kopf an seine Brust. Er spürte, wie all die Jahre sich über sie ergossen und gleichzeitig aus ihr herausquollen wie ein Ozean. Sie weinte und schluchzte laut.
Nach einer Weile richtete er sich auf und sagte: »Komm, Mama, iss mal was. Du hast seit gestern nichts mehr gegessen.« Er machte ihr ein Brötchen und setzte sich wieder auf seinen Platz. Sie aß und wurde ruhiger dabei.
Die Sonne war gewandert. Mehr als zur Hälfte hatte sich der Schatten des Hauses schon von der Terrasse zurückgezogen. Es sah aus, als könnte es ein freundlicher Tag werden. Pfahl ging hinaus und sah auf die Wiese, in der hinten rechts der Schuppen stand. Ein paar Meter daneben, wo das Grundstück in die Bachaue überging, wuchs ein großes, grünes Büschel. Es waren die Schwerter der Lilien, auf die seine Mutter jedes Jahr wartete. Dann zählte sie die orange leuchtenden Blüten auf ihren langen, im Wind sich wiegenden Stängeln und wusste immer auch, wie viele es im Jahr davor gewesen waren. Doch jetzt im April waren erst die schwertförmigen Blätter zu sehen und sie standen da wie der Schopf eines Riesen, der sich an dieser Stelle bis über die Stirn in die Erde eingegraben hatte.
Die Treppe war schon lange keiner mehr hinuntergegangen. Von rechts und links streckten ihm Brombeeren, Hartriegel und eine Hundsrose ihre Ruten in den Weg. Unten im Schuppen fand er zwei blaue, rau und milchig gewordene Plastikstühle, die er auf die Terrasse brachte. Er ging wieder ins Haus. Seine Mutter saß noch am Tisch. Die Hände an der Tischkante, den Oberkörper leicht nach vorn geneigt saß sie da, als sei sie gerade im Begriff gewesen, aufzustehen, und da habe ein plötzlicher Einfall sie überrascht. Er sagte: »Ich hab Stühle auf die Terrasse gestellt. Es ist schön draußen.«
Sie stand nun auf, nickte ihm freundlich zu und ging an ihm vorbei zum Wohnzimmer hin. Dabei streichelte sie ihm kurz den Arm und während sie sich weiter zum Zimmer seines Vaters bewegte, rief er ihr hinterher: »Wir müssen Onkel Gerhard verständigen und Monika. Wir müssen alles Mögliche erledigen.«
Sie verharrte kurz, stützte sich mit der Hand auf dem Tischchen ab und sagte: »Ich weiß.«
Er schaute ihr hinterher, wie sie in dem Zimmer verschwand, und trat hinaus auf die Terrasse. Er rückte einen der Stühle zurecht, ließ sich darauf nieder. Die Sonne schien ihm warm ins Gesicht. Er dachte daran, was jetzt zu erledigen war. Der Hausarzt müsste angerufen werden, die Verwandten und Freunde sollten Bescheid bekommen und schließlich müsste man auch ein Beerdigungsinstitut bestellen. Er dachte darüber nach, was in der Welt fehlt, wenn einer stirbt. Er fragte sich, ob es eine Substanz in der Welt gibt, die Menschenleben heißt und an welcher Stelle der Welt, dort, wo sie fehlt, ein Loch aufklafft. Und er dachte: Wenn ich die Stelle sehen könnte, könnte ich die Haut der Menschheit sehen und ich sähe die Stelle, wo ein Äußeres in ein Inneres eingedrungen ist.
Dann telefonierte er. Er rief alle Verwandten an und es war eine schwierige Geschichte, längst vergessenen Menschen vom Tod seines Vaters zu berichten. Er verständigte den Hausarzt. Das letzte Gespräch war das mit dem Bestattungsunternehmen. In der Stadt gab es zwei, und das, bei dem Pfahl anrief, hieß Florus.
Florus fragte: »Feuer- oder Erdbestattung?« Und Pfahl, der sich über diese Dinge noch gar keine Gedanken gemacht hatte, sagte: »Herr Florus, es geht hier erst einmal um ganz allgemeine Fragen. Die Einzelheiten können wir später besprechen.«
»Allgemeine Fragen?«
»Ja, ich meine zum Beispiel, wie lange man ihn im Haus behalten darf, ob es da gesetzliche Regelungen gibt.«
»Natürlich gibt es die. Haben Sie schon eine Todesbescheinigung?«
»Nein.«
»Und wann bekommen Sie die?«
»Weiß ich nicht genau. Der Arzt ist unterwegs. Ich denke, spätestens in einer Stunde.«
»Dann können wir ihn heute im Lauf des Nachmittags abholen. Wann wäre es Ihnen denn recht?«
»Muss das denn so schnell gehen?«
»Je früher, umso besser.«
»Und warum?«
»Wann haben Sie gesagt, ist er gestorben? Gestern am frühen Nachmittag?«
»Ja, so gegen drei.«
»Worauf wollen Sie denn dann noch warten?«
Nach dem Gespräch war ausgemacht, dass die Firma Florus den Vater gegen 15 Uhr abholen käme. Pfahl erhob sich von dem Stuhl und rollte die Schultern, als habe er lange an einem Schreibtisch gesessen. Er stemmte die Hände in die Hüften und bog seinen Leib nach hinten. Er fragte sich, was seine Mutter so lange im Zimmer seines Vaters machte, aber er wollte sie nicht stören. In ein paar Stunden würden sie ihn abholen, ihn in einen Leichensack einpacken und auf einer Bahre nach draußen bringen, wo ein schwarzer Kombi mit geöffneter Heckklappe stehen würde.
Als es an der Wohnungstür läutete, erschrak Pfahl, weil er dachte, es sei jetzt schon so weit. In Wirklichkeit war es der Arzt, Dr. Reuss. Er reichte Pfahl, noch vor der Haustür stehend, zur Begrüßung die Hand und fragte: »Der Sohn?« Pfahl nickte und auch Dr. Reuss nickte mehrmals langsam und betrachtete sein Gegenüber von oben bis unten. »Herzliches Beileid«, sagte er und verstärkte den Händedruck und fasste mit seiner Linken fest an Pfahls rechte Schulter. Pfahl schloss die Tür. Sie gingen hinein in die Diele. Reuss fragte: »Ist es schlimm gewesen?« Und Pfahl sagte: »Ich war nicht dabei.« Reuss nickte wieder mehrmals langsam mit dem Kopf, als sei er schwer wie Blei.
»Ist Ihre Mutter im Haus?«
Pfahl nickte. »Sie ist bei ihm.«
Reuss ging voraus und Pfahl folgte ihm zum Zimmer seines Vaters. Vor der Tür blieb der Arzt einen Augenblick stehen, räusperte sich und stieß sie dann entschlossen auf. Er trat in das Dämmerlicht und sagte laut: »Herzliches Beileid, Frau Pfahl.« Die Mutter, die vor dem Bett kniete und ihre Stirn in die Hand ihres Mannes gelegt hatte, fuhr empor, riss die Arme hoch und steckte sich im nächsten Moment die Hände zwischen die Zähne. Reuss eilte zu ihr hin. Er legte beide Arme um sie und zog sie zu sich herauf. Sie schlang ihrerseits die Arme um Reuss und legte weinend ihr Gesicht an seine Schulter.
Voller Widerwillen verließ er das Zimmer und ging auf die Terrasse. Er dachte, der Arzt habe das Erschrecken seiner Mutter bewusst hervorgerufen, um zu dem Erlebnis einer solchen Umarmung zu kommen.
Kurz darauf hörte er Geräusche im Haus. Er drehte sich um und sah, dass sie aus dem Zimmer herauskamen. Reuss hatte einen Arm um die Schulter der Mutter gelegt und setzte sie aufs Sofa. Er zog ein Formular aus seiner Ledermappe und füllte es mit einem dicken schwarzen Kugelschreiber aus, in dessen Clip sich das Licht golden spiegelte.
Pfahl brachte den Arzt zur Tür und kam zurück zu seiner Mutter, die auf dem Sofa sitzen geblieben war. Nach einigem Zögern legte er ein Blatt Papier auf den Tisch, auf dem die Verwandten und Freunde aufgelistet waren, die er vom Tod des Vaters benachrichtigt hatte. Er sagte: »Da hab ich überall angerufen« und wartete, dass seine Mutter die Liste durchsah. »Fällt dir sonst noch jemand ein?«
Ohne aufzusehen, sagte sie: »Nein, du hast alles richtig gemacht.«
»Außerdem hab ich mit einem Bestattungsunternehmen telefoniert.«
»Und?«
»Sie holen ihn nachher, um drei holen sie ihn ab.«
»Wer?«
»Florus, die Firma Florus.«
»Warum hast du denn den genommen?«
»War das verkehrt?«
»Du kennst doch den alten Florus und weißt ganz genau, was für einen Ärger wir mit ihm hatten.«
»Nein. Ich hab keine Ahnung.«
»Sag bloß, du weißt nicht mehr die Geschichte mit den beiden Türen im Keller. Dein Vater wollte vor Gericht gehen damals.«
Pfahl erinnerte sich dunkel.
»Es gibt noch einen anderen«, sagte er. »Ich sag Florus ab und wir nehmen den anderen.«
»Nein, du tust jetzt gar nichts. Wir nehmen das jetzt so hin. Am Schluss macht er uns wieder Ärger.«
Draußen erhob sich vom Nachbargrundstück her das Brummen eines elektrischen Rasenmähers. Die Mutter setzte ihre Hände rechts und links neben sich aufs Sofa und stemmte sich hoch. »Lass mich mal bitte aufstehen«, sagte sie. Pfahl rückte nach außen, damit sie zwischen dem Tischchen und dem Sofa vorbeikam. Sie stellte sich in die offene Terrassentür und schaute nach draußen. »Hast du dir …«, begann er zögernd, »ich meine, habt ihr mal …«
»Er will nicht verbrannt werden, falls du das meinst«, unterbrach sie ihn. Er war überrascht, wie schnell sie zur Sache kam und sagte: »Und außerdem, es gibt da noch jede Menge andere Sachen, die geklärt werden müssen.«
»Ich weiß.« Sie drehte sich zu ihm um. »Aber bitte verschon mich heute damit.« Sie ging hinaus und ließ sich auf einem der in der Sonne stehenden Stühle nieder. Pfahl ärgerte sich, dass sie ihn so hängenließ. In spätestens einer Stunde würde Florus unter anderem wissen müssen, was für einen Sarg sie wollten. Sollte er nun einfach, ohne sich mit ihr zu beraten, einen aussuchen? Es nervte ihn, dass er, anstatt sich der Trauer um den Vater hingeben zu können, sich mit solchen Gedanken herumschlagen musste.
Als er sich an den Esstisch gesetzt und eine Zigarette angezündet hatte, läutete das Telefon. Es war Florus. Er teilte mit, dass er den Termin um 15 Uhr nicht einhalten könne. Sein Geselle habe sich verletzt und würde für ein paar Tage ausfallen. Pfahl witterte die Gelegenheit, ihn loszuwerden. Er sagte: »Na gut, da kann man nichts machen. Wir werden schon einen anderen finden.«
»Nein, nein«, entgegnete er schnell, »wir machen das. Ich habe meine Tochter angerufen. Sie wird mir helfen. Sie wohnt in Frankfurt. Sie ist vor zehn Minuten losgefahren. Wir können dann, wenn es Ihnen recht ist, zwischen halb fünf und fünf bei Ihnen sein.«
»Machen Sie sich doch keine Umstände, Herr Florus. Wie gesagt, wir finden schon einen anderen.«
»Sie ist schon unterwegs.«
»Ihre Tochter? Kann die Ihnen überhaupt helfen?«
»Aber natürlich. Sie hat das schon hundertmal gemacht.«
Pfahl wusste nicht, was er noch sagen sollte.
Dann sagte Florus: »Übrigens. Die Sache mit der Todesbescheinigung. Haben Sie die inzwischen?«
Pfahl blies hörbar Luft durch die Lippen und Florus sagte: »Ich meine, dann könnten Sie ja zwischenzeitlich mal vorbeikommen, dann kann ich Ihnen ein Angebot machen und wir können dann alles in die Wege leiten.« Nachdem Pfahl ein paar Sekunden lang geschwiegen hatte, sagte Florus: »Herr Pfahl, es geht nicht nur um den Sarg und diese Dinge. Da gibt es auch jede Menge Formalitäten. Viele wissen das nicht. Aber ich möchte mich Ihnen nicht aufdrängen.«
»Nein, nein«, sagte Pfahl. Dann sagte er: »Okay, ich bin dann in einer halben Stunde bei Ihnen.«