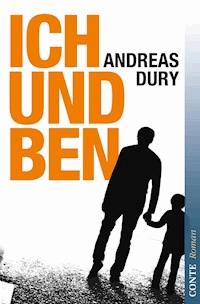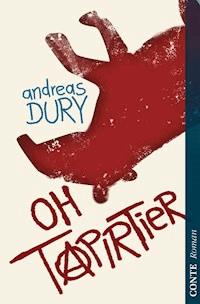
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Die Frau streute die Fotos vor mir auf den Tisch und sagte: "Diese Waffe. Haben Sie die gebaut?" Mit einer gewissen Genugtuung bejahte ich. "Was haben Sie damit bezweckt?" Ich sagte: "Keine Ahnung. Männer machen manchmal solche Sachen."" Zehn heiße Tage im Juni 2007. Am Rande des G8-Gipfels in Heiligendamm wird ein Polizeihubschrauber abgeschossen. Fünf Polizisten sterben. Die Täter werden im Antiglobalisierungslager vermutet. Frank Schütz macht sich auf die Suche nach Leo Fetzner. Mit ihm hatte er vor Jahren die DK1 gebaut, eben jene kuriose Kanone, die nun in der Tagesschau als Tatwaffe präsentiert wird. Fetzner ist die Schlüsselfiguer, sein ehemaliger Uniprof, Freund und Rivale. Er hatte Frank seinerzeit zur Tapiraktion verleitet. Die Ereignisse kippen das fragile Gleichgewicht seines Lebens. Mit der Polizei auf den Fersen macht er sich auf die Reise in die Vergangenheit: die Ereignisse an der Startbahn West, die Jahre als Student und Autonomer in Berlin, die unerfüllte Liebe zu Eva, Fetzners Frau. Zehn Tage, die alles verändern werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kapitel 1Freitag, 8. Juni 2007
Hubschrauber sind wie Tiere. Besonders, wenn das Motorengeräusch ausgeblendet ist. Der Hubschrauber sieht aus, als handle es sich um ein flugfähiges Tier, vielleicht um eine schrecklich große Libelle. Und in diesem Film gibt es keinen Ton. Kein Sprecher mischt seine Stimme in diese Bilder, die in schlechter Qualität, vielleicht mit einer Handykamera aufgenommen, über den Bildschirm flimmern. Die Erinnerung springt sofort zu Nine/Eleven, dem elften September 2001, als zu Beginn der Nachrichtensendungen noch vor der ersten Meldung ein Amateurvideo abgespielt wurde, das jeden Kommentar übertraf. Aber das hier sind nicht die Twin Towers. Das ist die deutsche Ostseeküste, Heiligendamm oder irgendein Ort in der Nähe. Das braucht den Fernsehzuschauern niemand mehr zu sagen. Seit Tagen sieht man diese Gegend jeden Abend, man ist schon daran gewöhnt und weiß sofort: Beim Gipfeltreffen der acht mächtigsten Staatsmänner der Welt ist etwas passiert.
Dabei ist zunächst nur ein Gutshof zu sehen, davor ein Hubschrauber mit laufendem Rotor. Staub wirbelt auf, die Büsche, die den Landeplatz einrahmen, biegen sich weg vom Zentrum des Sturms. Langsam hebt er ab, nach unten geneigt der dicke Kopf mit der schönen runden Glasfront, die sich bis in den Fußraum wölbt, sodass der Pilot nach unten sehen kann. Einen Moment lang scheint er in der Luft stehen bleiben zu wollen, ein paar Meter erst vom Boden weg, aber dann kippt er zur Seite und sein kraftvoller Rotor wuchtet ihn, rasch höher steigend, in eine Kurve und in die Richtung, in die gerade eben noch sein Schwanz gezeigt hat. Der Hubschrauber fliegt mit leicht gesenktem Kopf auf die Kamera zu. Dann geschieht es. Man kann nicht erkennen, was. Es ist, wie wenn ein Stier vom Bolzenschuss getroffen wird. Da gibt es nichts zu erkennen, außer der Tatsache, dass es aus und vorbei ist. Genau so ergeht es diesem Hubschrauber. Er stürzt ab. Es dauert keine zwei Sekunden, bis er auf dem Boden aufkommt. Der sich weiter drehende Rotor sorgt dafür, dass er wie ein Knallfrosch noch ein paar Sprünge macht, bevor sich seine Kontur in einem rasch auflodernden und stark rußenden Feuer verliert.
Nun erst setzt die Stimme eines Kommentators ein und man hört, dass es kein gefährlicher Einsatz gewesen sei, zu dem fünf Männer – ein Pilot, ein Dolmetscher und drei hohe Polizeioffiziere – in diesem fast nostalgisch anmutenden Fluggerät aufbrachen. Es sollte ein letzter Rundflug über den Einsatzort sein.
Es war ein Freitag. Immer wieder brachten sie diesen Film und immer mehr Fakten wurden den Fernsehzuschauern bekannt gegeben. Der Ort, an dem das Unglück geschah, hieß Linstow. Dort waren während der Zeit des Gipfeltreffens in einem ehemaligen Gutshof, den man nach der Wende zu einem Hotel umgebaut hatte, Sicherheitskräfte einquartiert. Bei dem Hubschrauber handelte es sich um eine BO 105. Früher war sie überall im Einsatz, beim ADAC, beim Bundesgrenzschutz, bei der Bundeswehr. Ihre militärische Version soll ein Exportschlager gewesen sein. Aber diese hier, die da vor einem umgebauten Gutshof in Linstow in Flammen aufgeht und brennend über die Wiese hüpft, immer wieder, dürfte eine der letzten gewesen sein, die sie bei der Polizei noch gehabt hatten.
Ich verbrachte den Abend allein vor dem Fernseher und trank Wein. Ich konnte mich gar nicht satt sehen an diesem Film und je öfter ich ihn sah, desto besser konnte ich mich an mein Hubschrauberquartett erinnern. Ich hätte den Hubschraubertyp auch ohne die Unterrichtung durch die Kommentatoren erkannt. Damals, in meiner Kindheit, war er noch ganz neu. Jetzt war seine Zeit um, er wurde ausgemustert und durch den Nachfolger ersetzt, den EC 135. Ich erinnerte mich gerne an die BO 105, die mir fast wieder so ans Herz wuchs wie damals, obwohl sie gegen die großen Stecher, beispielsweise die Chinook mit ihren zwei Rotoren und fast achttausend PS, nie eine Chance gehabt hatte.
Ich versuchte, mich in die Situation hineinzuversetzen. In die Ruhe nach der tagelangen Aufregung. Der amerikanische und der russische Präsident waren hier gewesen, bei uns, in Heiligendamm, in diesem auch unter historischen Gesichtspunkten einzigartigen Badeort. Es hatte Krawalle gegeben, Polizeieinsätze, Verhaftungen. Die Welt als Ganze betreffende Appelle waren von diesem Gipfeltreffen in die eigenen und in die subordinierten Staaten ausgesandt worden. Aber nun waren die Politiker nach Hause, die Heerscharen der Einsatzkräfte in ihre Unterkünfte zurückgekehrt und hinter dem Zaun, im Inneren der Sicherheitszone, hatten die Aufräumarbeiten begonnen. Wahrscheinlich wäre es ein eindrucksvolles Bild gewesen, das der Deutsche seinen ausländischen Kollegen zu bieten gehabt hätte, als er sie zu jenem Rundflug einlud: das in der Sonne blinkende Metall der Sperranlagen, die Gischt hinter den patrouillierenden Schnellbooten, die wie Tierbauten aus der Landschaft herausgewachsenen Checkpoints und vor allem das ganze schöne und vornehme Ambiente dieses einzigartigen Badeorts, an dem vier Tage lang die Oberhäupter der acht mächtigsten Staaten die Ordnung der Erde diskutiert hatten.
Wie schon bei der Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006 hatten die Deutschen unter Beweis gestellt, dass eine lockere und entspannte Atmosphäre mit größtmöglicher Sicherheit vereinbar war. Um auf dies noch einmal hinweisen zu können, hatte vermutlich der deutsche Polizeioffizier seinen russischen und amerikanischen Kollegen in die gute, alte BO 105 eingeladen.
Übrigens stürzte sie viel schneller ab, als ich mir das vorgestellt hätte. Es gab keinen Moment, in dem ich glaubte, sie würde sich noch einmal fangen und mit irgendeinem Manöver doch noch in der Luft halten. Als ehemaliger Hubschrauberquartettspieler wusste ich, dass die BO 105 die erste derartige Maschine war, mit der man Loopings fliegen konnte. Aber hier, in diesem Film, zeigte sie nicht die geringste Spur dieser Wendigkeit. Im Gegenteil: Man hätte denken können, sie sei zum Abstürzen gebaut, so umstandslos, so entschlossen, so ganz ohne zu zögern brachte sie die schätzungsweise fünfzig, sechzig Meter hinter sich, um auf der Erde zu zerschellen. Wer von den Insassen jetzt noch lebte, dem machte das auflodernde Kerosin den Garaus.
Ich weiß nicht, ob es zum Wesen aller Menschen gehört, eine gewisse Befriedigung zu empfinden, wenn die öffentliche Ordnung an einem Punkt gestört und verletzt wird, der einen selbst nicht betrifft. Mich erschütterte es jedenfalls nicht besonders, dass dieser Hubschrauber auf so spektakuläre Weise seinen Dienst einstellte. Wenn man bedenkt, dass bei dieser Aktion fünf Menschen ihr Leben verloren, mag man versucht sein, zu denken, ich sei ein kaltblütiger Bursche. Aber das würde ich ohne mit der Wimper zu zucken und ohne die geringste Heuchelei weit von mir weisen.
Allerdings hatte ich zu dieser Zeit nicht viel Veranlassung, mich übermäßig mit der Ordnung zu identifizieren, die hier einen Schaden genommen hatte. Ehrlich gesagt genoss ich sogar die Genugtuung, die sich spontan bei mir einstellte. Sie war wie eine kleine hinterhältige Rache für die Frustration, in die in letzter Zeit alle meine Versuche gemündet hatten, so etwas wie Ruhe und Zufriedenheit in mein Dasein zu bringen.
Ich war vor ziemlich genau drei Jahren hierher gezogen, um neu anzufangen. Vorher hatte ich in Saarbrücken gelebt und es ist eine lange Geschichte, warum ich dort nicht hatte bleiben können. Kurz gesagt war ich fortgegangen, weil ich es nicht gewagt hatte, einer Frau – Eva – meine Liebe zu gestehen. Sie war mit meinem besten Freund verheiratet, und den aus dem Feld zu schlagen traute ich mich nicht. Ob mein Rückzug aus Feigheit geschah oder aus Respekt vor dem hohen Gut der Freundschaft, konnte ich nicht sicher entscheiden, aber meistens neigte ich dazu, mich für einen Feigling zu halten. Warum ich hierher gezogen war und nicht in irgendeine andere Stadt, lag einzig und allein daran, dass ich hier eine Arbeit gefunden hatte. Doch als ich gerade anfing, ein bisschen Fuß zu fassen, wurde die Firma verkauft und ich war den Job wieder los. Danach fand ich lange keine neue Stelle. Ich kam ziemlich herunter. Ich soff wie ein Loch und verlor völlig den Glauben an mich, sodass es mir wie ein Wunder erschien, als ich endlich wieder einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde und der Chef am Ende sagte: »Na gut, dann wollen wir es mal miteinander versuchen.«
Die Firma war nicht groß. Da war Otterbach, der Chef, dann Markward, Frau Binswanger und Elwert. Sie hatten alle privates Kapital in der GmbH stecken.
Ich fing Mitte Juli an und es war in meiner zweiten oder dritten Woche, da hielt mir Otterbach einen Stapel Visitenkarten unter die Nase, auf denen unter der Firmenanschrift mein Name stand und darunter Developer. Außerdem legte er mir eine Folie mit dem Firmenlogo auf den Tisch.
Es war heiß und still. Alle waren mit ihren Aufgaben beschäftigt. Die Fenster standen offen und davor parkten unsere Autos. Auf allen klebte dieses Firmenlogo nur auf meinem nicht und auch nicht auf dem Auto, das der Chef fuhr. Er fuhr nämlich den Wagen seiner Frau. Alle wussten, dass er sich einen neuen kaufen wollte, aber niemand wusste, was für einen. Den letzten hatte er bei Tempo zweihundertdreißig gegen eine Leitplanke gesetzt.
Otterbach stand neben mir und ich hatte den Eindruck, dass er auf etwas wartete. Ich betrachtete die Visitenkarten und fragte mich, was ich damit anfangen sollte. Schließlich sagte er: »Na los, auf was warten Sie noch?«
Ich sagte: »Keine Ahnung. Auf nichts.«
Der Chef schaute mich an, strafend und nachsichtig zugleich. »Wollen Sie sich das Logo nicht aufs Auto kleben?«
»Ist das für mich?«
»Nein, für Ihr Auto.«
»Ja, aber es ist doch mein Auto.«
Otterbachs Augen verengten sich. Er musterte mich.
Ich sagte: »Ich meine, es ist doch kein Firmenwagen.«
Otterbach schaute mich weiter an, als hätte ich nun die Chance, mich zu korrigieren. Aber dann lächelte er und sagte ganz entspannt: »Sie können es sich ja überlegen.«
Später am Tag kam er wieder zu mir und sagte: »Ich weiß, Ihr Auto ist kein Firmenwagen, aber vielleicht reicht Ihre Loyalität so weit, dass Sie mich in die Werkstatt fahren könnten. Mein neues Auto ist nämlich abholbereit.« Dabei grinste er und boxte mir kumpelhaft gegen die Schulter. Den Wagen hatte er sich von weiß Gott woher besorgt und in der Werkstatt war er durchgecheckt worden.
Der Werkstattleiter hieß Lüppert. Otterbach begrüßte ihn mit Handschlag. Lüppert lobte den Wagen. »Viel zu schade für die Straße«, sagte er.
Otterbach fragte, ob alles in Ordnung sei.
Lüppert sagte: »Alles top. Wir haben die Kompression gemessen. Der ist wie neu. Nur die Reifen waren abgefahren. Das ist alles.« Der Mann setzte sich an den Computer und sagte: »Ich hab Ihnen einen Sonderpreis gemacht.«
Otterbach wartete, bis die Rechnung aus dem Drucker kam. Er zog sie heraus, überflog sie, legte seinen Finger auf die Zeile mit den Reifen und sagte: »Das da können Sie streichen. Ansonsten bin ich einverstanden. Korrigieren Sie das und schicken Sie die Rechnung an die Firma.«
Lüppert schaute ihn von unten her mit einem schiefen Lächeln an und fragte: »Wie meinen Sie das?«
»Ich hab keine Reifen bestellt«, antwortete Otterbach.
Lüppert stand von seinem Stuhl auf und atmete ganz tief ein und aus, als hätte er eine Zeitlang die Luft angehalten. Er sagte: »Das sind Michelin Pilot Primacy. Absolute Spitzenreifen. Die stehen mit fast fünfhundert Euro in der Liste und ich gebe sie Ihnen für dreihundertfünf.«
Otterbach ging mit großen Schritten in den Ausstellungsraum, wo der weinrote, frisch gewaschene 850er BMW stand. Lüppert schaute mich ratlos an. Ich zuckte mit den Schultern. Lüppert war groß, ein Bär von einem Mann, aber ein alter Bär. Ich schätzte ihn auf mindestens sechzig. Vor ihm auf dem Schreibtisch stand der Kolben eines Lastwagenmotors und der war voll mit ausgedrückten Zigaretten. Er atmete schwer, als er sich hinter dem Tisch hervorarbeitete und Otterbach in den Raum folgte, in dem außer dem BMW noch ein zu einem Abschleppwagen umgebauter Golf und ein Motorrad aus den 1920er Jahren standen. Otterbach kniete vor seinem Wagen und befühlte die Scheinwerferklappen. Er war ganz verzückt.
Lüppert sagte: »Ihre Reifen waren abgefahren. Haben Sie mich verstanden? Kriminell abgefahren.«
Otterbach richtete sich auf, drehte sich zu dem Mann und sagte: »Das ist mir scheißegal. Tatsache ist, dass ich nicht erteilte Aufträge nicht bezahle. Das gehört zu meinen Prinzipien. Ich bin Geschäftsmann.«
»Ich bin auch Geschäftsmann«, entgegnete Lüppert, »und mich haben die Reifen auch was gekostet.«
»Na und? Dann machen Sie die alten halt wieder drauf.«
»Das geht nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil sie nicht mehr da sind.«
»Das ist aber ein Riesenpech.«
»Aber wieso denn?«
»Weil Sie mir dann mein Eigentum nicht mehr zurückgeben können.«
»Wollen Sie mich auf den Arm nehmen oder was? Die hab ich dem Kerl mitgegeben, der bei uns immer die Altreifen abholt. Der kommt zwei Mal im Monat. Und heute Morgen war er da. Da hab ich ihm die Reifen mitgegeben. Wie gesagt, die waren total abgefahren. Was soll ich die bei mir im Hof rumliegen lassen?«
»Das macht die Sache für Sie nicht leichter«, seufzte Otterbach.
»Wie meinen Sie das?«, fragte Lüppert.
»Tja«, sagte Otterbach, »ich nehme an, die Tatsache, dass Sie mir soeben vier nagelneue Reifen geschenkt haben, wird nicht zu den Dingen gehören, an die Sie sich später gerne erinnern.«
Lüpperts Atem ging pfeifend wie bei einem Asthmatiker.
Otterbach setzte sich in den Wagen und sagte: »Machen Sie mal das Tor auf. Ich will sehen, wie er läuft.«
Der alte Mann ging ohne Zögern zu der Schalterleiste neben dem Rolltor und fuhr es nach oben. Dabei sagte er: »Herr Otterbach, meiner Meinung nach kann das so nicht gehen.«
Otterbach, der inzwischen den Motor gestartet hatte und die zwölf Zylinder mit verhaltenen Gasstößen auf ihre Aufgabe vorbereitete, meinte: »Wissen Sie, mit Meinungen ist das so wie mit Arschbacken: Jeder hat seine eigenen.« Die neuen Reifen quietschten auf dem polierten Granit, Staub und kleine Steinchen wirbelten in die Halle herein, als Otterbach auf dem gekiesten Hof stark beschleunigte und sich in den Verkehr auf der Bundesstraße hineindrängte.
Dann war ich allein mit dem alten Mann. Er war bleich wie Papier und der Schweiß stand ihm auf der Oberlippe. Ich hätte mich am liebsten so schnell wie möglich davongemacht, aber ich dachte, ich könne ihn jetzt nicht allein lassen. Seine Augen waren rot wie bei einem Kaninchen. Und das war seltsam in dem bleichen Gesicht. Ich dachte: Vielleicht passiert ihm was. Vielleicht stirbt er.
Plötzlich sagte er: »Verpiss dich, du Scheißkerl!«, drehte sich um und verschwand hinter einer Eisentür, die er mit solcher Wucht zuschlug, dass irgendetwas kaputt ging. Ich hörte einen Aufschlag, ein Klirren und dann ging noch viel mehr kaputt. Ich hörte ihn brüllen. Meine Knie waren ganz weich, als ich in die Firma zurückfuhr.
Dort stand mitten auf dem Parkplatz der 850er. Die Kollegen waren nach draußen gekommen, um ihn anzusehen. Die Türen waren weit geöffnet, Otterbach saß auf dem Fahrersitz und hatte das linke Bein nach draußen gestellt. Als ich näher kam, lachten alle laut auf. Ich dachte zuerst, sie lachten über mich, aber dann hörte ich, dass Otterbach gerade die Geschichte mit den Reifen erzählt hatte. Als er mich sah, sagte er: »Stimmt’s, Schütz? So war es doch. Oder hab ich übertrieben?«
Ich hatte zwar fast nichts von seiner Story mitbekommen, wollte sie mir aber auf keinen Fall wiederholen lassen. Deshalb nickte ich bloß. Otterbach legte den Kopf schief. Er sah mir genau in die Augen.
Dann stieg er aus und stellte sich neben die Tür, den Oberkörper leicht nach vorn geneigt, die Hand am Türgriff: »Steigen Sie ein«, sagte er, »so gut haben Sie noch nie gesessen.«
Ich stieg ein. Die Sitzflächen waren aus rotem, die hochgezogenen Flanken aus schwarzem Leder. Ich fasste das Lenkrad mit beiden Händen und versuchte mit den Füßen an die Pedale zu kommen. Das Armaturenbrett bestand aus Wurzelholz. Alles war unheimlich solide. Der Wagen kam mir vor wie eine Einzelanfertigung.
Draußen redete Otterbach: »Seinerzeit der einzige Zwölfzylinder aus deutscher Serienproduktion. Normalerweise wurde er bei zweihundertfünfzig Stundenkilometern abgeregelt, aber der da, der fährt dreihundertvier.« Er steckte den Kopf ins Wageninnere und fragte: »Na?«
»Schon toll«, sagte ich.
Die anderen standen dicht um das Auto herum und schauten herein. Ich stieg aus, weil ich dachte, jeder dürfe jetzt einmal Platz nehmen. Aber Otterbach drängte sie weg und drückte mit seinem Hintern die Tür zu. Er klatschte fröhlich in die Hände und sagte: »So, Mädels und Jungs, jetzt aber mal wieder an die Arbeit.« Er streckte seine Faust in die Luft und alle gingen an ihm vorbei und boxten mit ihrer Faust dagegen. Ich fand das zwar ziemlich affig, dachte aber, dass ich es auch tun müsste. Doch als ich an die Reihe kam, öffnete Otterbach seine Hand und sagte: »Sie nicht. Sie fahren mit.«
Die anderen, die schon dabei waren, in das Gebäude zu trotten, blieben stehen und drehten sich um. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich mit dem Chef nun fahren sollte. Otterbach reckte sein Kinn in die Luft und fragte: »Er weiß es noch gar nicht?«
Die Kollegen zuckten mit den Schultern. Entweder wusste niemand etwas von der bevorstehenden Fahrt, oder niemand wusste, dass man mich hätte informieren sollen. Eine Zeitlang standen alle herum, ohne etwas zu sagen.
Endlich sagte Otterbach: »Sie sind doch unser Linux-Experte. Oder?«
Ich sagte: »Na, ja.«
Otterbach grinste: »Oder haben Sie nur angegeben?«
Ich erinnerte mich an mein Vorstellungsgespräch und da hatten wir kurz auch über Linux gesprochen.
»Okay«, sagte der Chef, »Ich will die Kooperation mit Sieber. Wir alle wollen die Kooperation mit Sieber.«
Er sah zu den Kollegen hin. Die schauten auf den Boden und nickten.
»Sie doch auch«, sagte Otterbach.
Ich fragte: »Sieber in München?«
Die Kollegen nickten wieder und ich dachte, wahrscheinlich haben sie das alles schon in ihren wöchentlichen Teambesprechungen durchgekaut und bei diesen Sitzungen war ich nicht zugelassen, weil ich noch in der Probezeit war. Alle schauten mich erwartungsvoll an.
Ich sagte: »Aber ich habe jetzt gar nichts dabei.«
Otterbach stützte sich mit dem Ellenbogen auf das niedrige Dach des Sportwagens. Ich stand genau zwischen ihm und den Kollegen.
»Was fehlt Ihnen denn?«, fragte er und sein Blick war schmal, weil er gegen die Sonne gerichtet war.
»Wäsche«, sagte ich, »Waschzeug. Frische Klamotten.«
»Ach was. In fünf Stunden sind wir dort.« Und dann fügte er hinzu: »Und Sie werden doch nicht innerhalb der nächsten fünf Stunden anfangen wollen zu stinken.«
Alle lachten. Es war ein gutmütiges Lachen. Ich fühlte, dass ich zu ihnen gehören wollte und dass es mir gut tat, dass sie Erwartungen in mich setzten.
Als wir davonbrausten, hatte ich einen Moment lang das Bedürfnis, den Kollegen zu winken, wenigstens meine Hand aus dem Fenster zu heben, aber ich fand den Knopf nicht, mit dem man die Scheibe herunterlassen konnte. Im Außenspiegel sah ich, wie sie uns hinterher schauten und sich langsam in das Gebäude verdrückten.
Wir hatten ein paar Kilometer auf der Landstraße, bevor es auf die Autobahn ging. Am Wegrand blühten Kornblume und Wicke und Goldrute.
Ich dachte, fünf Stunden mit Otterbach im Auto, hoffentlich überstehe ich das. Ich wusste nicht, was ich mit ihm reden sollte. Zum Glück war das auch nicht nötig, denn sobald wir die Autobahn erreicht hatten, begann er das Auto zu testen. Er fuhr wahnsinnig schnell, er probierte alle Knöpfe aus. Ich war noch nie in einem Wagen dieser Klasse unterwegs gewesen, schon gar nicht mit einem Möchtegern-Rennfahrer wie Otterbach am Steuer, und mir ging das Ganze unheimlich auf die Nerven. Bis hinunter zum Viernheimer Dreieck ging das so, dann beruhigte ihn vielleicht die offene Weite der Rheinebene, über der sich ein blauer Himmel wölbte. Links von uns hob sich der dunkle Odenwald aus der Fläche und nach Westen hin konnte man über die ganze Ebene schauen, bis zu den Hängen der Haardt.
Otterbach schien sich über etwas Gedanken zu machen. Unvermittelt fing er an zu sprechen: »Dieses Jahr rechne ich mit einem Umsatz von siebenhundertfünfzigtausend. Mein nächstes Ziel ist die Million. Der hier«, er klopfte auf das Lenkrad des nahezu geräuschlos durch die Landschaft ziehenden Wagens, »ist natürlich auch nur ein Provisorium. Wenn ich die Million habe, dann lege ich mir einen Neunelfer zu. Deswegen auch die Kooperation mit Sieber – davon verspreche ich mir mindestens hunderttausend.« Er sah zu mir herüber und ich erblickte einen Glanz in seinem Gesicht, der ein helles Licht auf alles warf, was er vor sich sah. Er schlug mir mit der Hand auf die Schulter und ließ sie dort liegen, griff ein, zwei Mal fest in mein Schultergelenk hinein. »Sie sind der richtige Mann. Sie bringen mir die Hunderttausend.«
Ich lächelte unsicher.
Otterbach griff noch mal zu. »Man muss sich Ziele setzen!«
Ich nickte.
Endlich nahm Otterbach seine Hand wieder herunter. Nach einer Weile fragte er: »Und was für Ziele haben Sie?«
Die Autobahn hatte sich inzwischen ostwärts vom Rhein entfernt, und links unten im Tal konnte man einen Teil des Hockenheimrings sehen. Otterbach machte mich darauf aufmerksam. Es schien ihm etwas zu bedeuten, diese berühmte Rennstrecke in seiner Nähe zu wissen. Dann wiederholte er seine Frage. Vor Kurzem hätte ich keine Probleme gehabt, sie zu beantworten. Da hatte ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als endlich wieder eine Arbeit zu finden. Und jetzt hatte ich Arbeit. Ich verdiente wieder etwas. Ich hatte Kollegen und von morgens bis abends etwas zu tun.
Ich sah mein Gesicht verzerrt und zerdehnt im Spiegel der flachen Windschutzscheibe und bemerkte, dass Otterbach mich anschaute. Und plötzlich geschah dies: Ein Schwarm kleiner Vögel – vielleicht Spatzen, vielleicht Stare – kreuzte die Autobahn und eine Handvoll von ihnen flog zu tief, schaffte es nicht mehr und knallte gegen die Windschutzscheibe. Das gab kaum ein Geräusch. Ein winziges Chaos. Ein kleines Auflodern grauer und brauner und schwarzer Federn, und als Otterbach den Scheibenwischer einschaltete, schob das Wischblatt ein haselnussgroßes, rosa Klümpchen durch mein Gesichtsfeld, wahrscheinlich das Gehirn eines dieser Vögel. Aber auch das war gleich wieder vorbei, als ein scharfer Strahl aus der Scheibenwaschanlage die Arbeit der Wischer unterstützte. Otterbach verzog keine Miene. Er wartete immer noch auf eine Antwort und es sah aus, als würde sich eine Spur von Verachtung in seine Züge mischen. Deshalb sagte ich schnell, obwohl noch der Anblick des Vogelgehirns in meinem Gemüt wühlte: »Zunächst will ich mal zusehen, dass die Sache mit Sieber ins Rollen kommt.«
»Das ist doch Scheiße«, presste er zwischen den Zähnen hervor. »Das sagen Sie nur, weil Sie denken, dass ich es hören will.«
Dann gab er wieder ordentlich Gas. Er katapultierte den Wagen auf die Überholspur. »Wenn Sie wenigstens gesagt hätten, Ihr Ziel sei es, glücklich zu werden. Oder nicht mit einem Arschloch wie mir im Auto sitzen zu müssen.« Er schrie jetzt fast.
Die Autos, an denen wir vorbeirasten, schienen zu stehen und mein Oberschenkel fing an zu zucken.
»Sie haben doch gar keine Ahnung, was Sie bei Sieber erwartet. Oder? Wie wollen Sie da was ins Rollen bringen? Wenn hier jemand was ins Rollen bringt, dann bin ich das. Wie kann es also Ihr Ziel sein?«
Das passierte mir damals öfter, dass ein Muskel in meinem Oberschenkel anfing zu zucken. Normalerweise brauchte ich nur ein, zwei Kniebeugen zu machen, um es abzustellen. Aber hier, in diesem Wagen, der mit über zweihundert Sachen über die Autobahn jagte, konnte ich das nicht tun. Es wollte gar nicht mehr aufhören.
Die Sache mit Sieber wurde eine Riesenpleite. Zumindest für mich. Ein Jahr lang rackerte ich mich ab, arbeitete sechzig Stunden pro Woche, musste jeden Monat zwei Mal in München antanzen und dann wurde die Geschichte abgeblasen. Ich weiß bis heute nicht, warum.
Otterbach sagte: »Schütz, das verstehen Sie nicht. Das ist eine strategische Überlegung.«
Kurz darauf hatte er seinen Porsche und machte den Laden dicht, beziehungsweise verkaufte ihn an Q-Systems und die übernahmen keinen einzigen von uns.
Wenn ich eine Liste hätte mit Leuten, die ich abschlachten wollte, dann käme Otterbach ganz bestimmt darin vor. Natürlich hatte ich keine solche Liste und bin auch gar nicht der Typ, der andere abschlachtet. Aber diesen kleinen Anflug von Genugtuung, als den Bonzen ein Hubschrauber vom Himmel fiel, den wollte ich mir partout nicht übelnehmen und sah mir die halbe Nacht alle möglichen Sondersendungen an, die eine aufs dissonant Katastrophische trainierte Medienmaschinerie stehenden Fußes aus dem Ärmel schüttelte.
In erster Linie ging man von einem technischen Defekt aus und es wurde die Frage erörtert, ob es verantwortbar sei, ausländische Gäste in einem Hubschrauber durch die Gegend zu fliegen, den nicht einmal der ADAC mehr benutzte. Aber auch die Möglichkeit eines Anschlags wurde in Betracht gezogen. Terrorismusexperten kamen zu Wort.
So etwas ist ja ungeheuer interessant, so ein Unfall, von dem noch nicht einmal feststeht, ob er nicht noch etwas viel Interessanteres, nämlich ein Terroranschlag, ist.
Kapitel 2Samstag, 9. Juni 2007
Ich schlief ziemlich lange. Es war schon nach elf, als ich aufwachte. Mein Blut fühlte sich an, als sei es etwas anderes als Blut, als sei es grün oder gelb und entweder zu dick oder zu dünn. Ich sagte mir: »Du darfst nicht so viel saufen.« Das sagte ich mir fast jeden Morgen, aber im Laufe des Tages, wenn es mir dann wieder besser ging, verwandelte sich die Sorge um meine Gesundheit langsam, aber sicher in eine Sorge über den Zustand meiner Getränkevorräte und ich sagte mir: »Spätestens, wenn ich wieder einen Job habe, höre ich auf damit.« Ich war zuversichtlich, dass mir das gelingen würde, denn ich hatte beim Arbeiten immer das Bedürfnis nach einem klaren Kopf. Man kann nicht gut programmieren, wenn man gesoffen hat, und ich war einmal ein gefragter Java-Entwickler gewesen. Ich kannte die Sprache seit dem ersten Beta-Release und bei der Filialverwaltung der Deutschen Telekom, eines der ersten großen Projekte in Deutschland, das mit der Java-Enterprise-Beans-Technologie realisiert worden war, hatte ich maßgeblich mitgearbeitet. Aber das war Schnee von gestern und heute konnte ich es kaum noch glauben, dass es eine Zeit gegeben hatte, in der ich ein bisschen stolz auf meine Fähigkeiten gewesen war. Inzwischen lernten die Studenten das an der Uni, was ich mir vor zehn, fünfzehn Jahren im Selbststudium mühsam erarbeitet hatte, und wenn ich ehrlich sein sollte, war das permanente Bemühen, mit der immer rasanter werdenden Entwicklung der Software-Technologie Schritt zu halten, nicht mehr mein Ding. Vielleicht lag es am Saufen, vielleicht wurde ich auch einfach zu alt für den Job.
Aber es war noch etwas anderes. Selbst wenn ich an meine glorreichen Zeiten in der Projektleitung dachte, wusste ich, dass ich da nicht mehr hin wollte. Ich war ein eitler, empfindlicher, rechthaberischer Streber gewesen und hatte meine Position nur dadurch erreichen und eine Zeitlang erhalten können, dass ich alles immer ein bisschen besser wusste und meine Vorschläge immer ein bisschen smarter waren als die der Kollegen, die ich damals nur als Konkurrenten wahrgenommen hatte. Für eine andere Art, nach oben zu kommen, etwa die Otterbachs, fehlte mir das Talent. Typen wie Otterbach, dachte ich, erwerben ihre Stärke aus der Demütigung anderer und ich wusste, wie einem von einer Sekunde auf die andere das Herz zu Asche verbrennen kann und man zurückbleibt mit unrealisierbaren Racheschwüren und einer ohnmächtigen Wut, deren Ziel man letztlich selber ist. Beide Lebensarten ließen jede Schönheit vermissen und verdienten nichts als Verachtung.
Das waren so meine Gedanken beim Frühstück. Ich überlegte, ob ich Tina anrufen sollte, ließ es aber sein, weil mir einfiel, dass wir sowieso verabredet waren. Es war ziemlich heiß an dem Tag und am liebsten wäre ich in der einigermaßen kühlen Wohnung sitzen geblieben und hätte auf sie gewartet. Doch es musste eingekauft werden. Tina würde bestimmt über Nacht bleiben und ich wollte ihr etwas anbieten können.
Bevor ich nach draußen ging, duschte ich und zog frische Kleider an. Zu meinem Einkaufszentrum war es nicht weit. Zu Fuß weniger als fünf Minuten. Eigentlich fühlte ich mich gar nicht so schlecht. Das Kaufhaus war angenehm klimatisiert und es lief die übliche Dudelmusik, die manchmal durch Werbesprüche unterbrochen wurde. Ich hörte da gar nicht hin. Aber dann hörte ich doch hin. Es kamen Kurznachrichten und sie brachten etwas über den Hubschrauberabsturz, den ich schon fast wieder vergessen hatte.
Es bestünde kein Zweifel, so hieß es, dass der Absturz durch einen gezielten Anschlag herbeigeführt worden sei. Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass die Tat ihren Ursprung im linksterroristischen Umfeld der Globalisierungsgegner habe.
Obwohl ich, ohne Gründe dafür angeben zu können, insgeheim damit gerechnet hatte, überraschte mich, dass sie es so schnell herausgefunden hatten und schon am Tag nach dem Absturz kein Zweifel mehr bestand.
Nachdenklich ging ich zwischen den Regalen hin und her. Ich kaufte in Knoblauch, Chili und Öl eingelegte Früchte. Ich kaufte Ziegenkäse und Parmaschinken. Beim Wein entschied ich mich für einen Riesling aus Epfig, einem kleinen Dorf im Elsass. Dort haben sie neben ihrer romanischen Dorfkirche einen Käfig stehen, in dem die ganzen Totengebeine aufbewahrt sind, für die auf dem Friedhof kein Platz mehr ist. Ich nahm drei Flaschen.
Ich fand es erstaunlich, dass die Globalisierungsgegner nun so extrem gewalttätig geworden waren. Brennende Autos, zerschlagene Fensterscheiben und verletzte Polizisten – das war eigentlich ihr Ding, aber einen Hubschrauber vom Himmel zu holen, in dem fünf Leute sitzen, das war schon eine neue Dimension. Das erinnerte mich an die wilde Zeit Mitte der achtziger Jahre, als aus einer Demonstration heraus plötzlich zwei Polizisten erschossen worden waren. Als ich meinen Wagen zur Kasse schob, fiel mir auf, dass ich viel teurer eingekauft hatte als sonst. Doch besonders eine Sache kam mir fragwürdig vor. Woher wollten sie wissen, dass die Täter aus dem Lager der Globalisierungsgegner kamen? Hatten sie vielleicht schon jemanden verhaftet? Und wieso sprach man plötzlich von einem linksterroristischen Umfeld? Bis gestern hießen diese Leute noch linksextreme Gewalttäter und jetzt sollte also eine linksterroristische Gefahr existieren.
Am frühen Abend kam Tina. Wir küssten uns. Ich roch, dass sie nicht direkt aus der Dusche kam. Ich mochte das. Ich mochte ihren Geruch. Ihr war es, glaube ich, immer ein bisschen peinlich, wenn sie zu riechen war und vielleicht war es das, was ich mochte. Sie roch fast wie ein verschwitztes Kind. Aber ehrlich gesagt wusste ich gar nicht so richtig, wie ein verschwitztes Kind riecht. Ich hatte ja keine Kinder und es war ein aus der Erinnerung, ein aus der Turnhalle meiner Grundschule geschöpfter Geruch. Sie sagte: »Hast du schon gehört? Sie haben einen Hubschrauber abgeschossen.« Ich küsste sie auf den Hals und schob sie zur Treppe hin.
Meine Wohnung hatte die wunderbare Eigenschaft, dass sie aus zwei Teilen bestand. Im dritten Stock hatte ich zwei Zimmer, Küche, Bad und zwei Treppen höher, ganz oben im Dachgeschoss, gab es eine kleine Mansarde. Ich schaute Tina hinterher, wie sie die Stufen nahm, wie ihr Hintern sich unter dem dünnen Stoff ihres Sommerkleides bewegte, und war voller Freude.
In der Küche nahm ich die Speisen aus den Plastikschalen und richtete sie auf verschiedenen Tellern an, ich schnitt das Baguette, ich nahm den Wein aus dem Kühlschrank. Ich lud alles auf mein schönes Tablett aus Zwetschgenholz und trug es nach oben. Tina lag bäuchlings mit dem Kopf am Fußende auf der Liege, die fast das ganze Zimmer ausfüllte. Sie hatte sich ein Kissen untergelegt, das sie mit beiden Armen umfasste und die helle Wölbung ihrer Brüste hoch in den Ausschnitt ihres Kleides presste. Das Kleid war bis zum Ansatz ihrer Pobacken nach oben gerutscht. Der Fernseher lief mit ganz leise gedrehtem Ton. Sie hatte ihre Beine angewinkelt und rieb ihre nackten Füße aneinander, was sich anhörte wie ein Flüstern. Das Fenster stand weit offen, zwischen den Rippen des heruntergelassenen Rollladens fiel das goldene Licht streifenweise in den Raum, und Staubkörnchen tanzten darin. Mit einem kaum wahrnehmbaren Rauschen drehte der Deckenventilator seine Kreise. Ich stand in der halb geöffneten Tür, das Tablett mit den Speisen in den Händen, von denen ein scharfer, würziger Geruch ausging. Tina hatte mich noch nicht bemerkt. Je länger ich auf der Schwelle stehenblieb, umso mehr verblasste meine Lust zu vögeln. Denn plötzlich musste ich daran denken, dass wir keine Kinder haben würden. Ich habe keine Ahnung, wieso ich daran dachte, wir hatten nie über dieses Thema gesprochen, denn da verstand sich alles von selbst. Tina war über das Alter hinaus, in dem man sich über so etwas Gedanken macht. Trotzdem kam es mir in diesem Moment in den Sinn und auch ein Gespräch fiel mir ein, das ich kürzlich mit einem Biologen geführt hatte. Ich hatte mich über die Möglichkeit gewundert, kernloses Obst zu züchten. Die Frucht sei doch nur dazu da, meinte ich, den befruchteten Kern so lange mit Nahrung zu versorgen, bis er seinen Trieb in die Erde gesenkt habe, und ich fragte, wieso eine Pflanze auch dann ihr Obst hervorbringe, wenn da gar nichts sei, wofür sich diese Verausgabung lohne. »Ach«, hatte da der Biologe gesagt, »das sind so Gewohnheiten. Warum sollte die Pflanze plötzlich aufhören, etwas zu tun, woran sie sich Hunderttausende von Jahren gewöhnt hat? Das ist, wie wenn man vergisst, den Strom abzustellen, dann geht die Party endlos weiter.« Damals hatte ich gelacht, aber jetzt machte es mich melancholisch.
Da sah Tina auf und lächelte. Ich ging nun ganz in das Zimmer hinein, setzte das Tablett auf ein dafür vorgesehenes Gestell am Fußende der Liege und legte mich zu ihr. Tina schnappte sich die Fernbedienung und machte lauter. Gerade wurde die Pressekonferenz des Generalbundesanwalts übertragen.
Er saß zwischen einer Frau und einem Mann, die beide erheblich jünger waren als er selbst. Er gab nur ein kurzes Statement ab, in dem er mitteilte, dass er den Fall an sich gezogen habe und dass man von einem terroristischen Anschlag ausgehe. Danach stand er auf und verließ den Saal. Die zahlreich erschienenen Journalisten mussten mit der jungen Frau und dem Mann, die auf dem Podium geblieben waren, vorlieb nehmen. Die Fragen wurden ausweichend und zurückhaltend beantwortet. Aber dann hielt der Mann ein Projektil in die Höhe, eine Stahlkugel von zwölf Millimetern Durchmesser, und hatte auch eine Waffe bei der Hand, ein Katapult, wie er es nannte, wie es in den linksterroristischen Kreisen schon seit Jahren benutzt werde. Er zählte einige besonders schwere Fälle von Körperverletzung an Polizeibeamten auf, die mit einem derartigen Schussapparat verursacht worden waren, und irgendwie machte er um die Kugel und um diese aus Stahl gefertigte Schleuder ein Theater, als ob die »Linksterroristen« nunmehr in den Besitz von Massenvernichtungswaffen gelangt wären.
Einer der Journalisten sagte, das sei ja unglaublich, jeder kenne doch das Amateurvideo von dem Absturz und da sei zwar nicht viel, aber immerhin so viel zu erkennen, dass der Hubschrauber, als er getroffen wurde, an die siebzig Meter Höhe gehabt hätte, und nun müsse man erfahren, dass die deutsche Polizei mit Hubschraubern ausgerüstet sei, die man aus dieser Entfernung mit einer Zwille aus der Luft holen könne. Das sei ja wohl der eigentliche Skandal. Das Journalistenvolk lachte und Tina sagte: »So ein Blödsinn, wenn das ginge, hätten wir damals in Brokdorf Dutzende von denen abgeknallt.« Der junge Mann wurde etwas verlegen und gab zu, dass die kriminaltechnischen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen wären.
Dann aßen wir und tranken. Wir aßen mit Frischkäse gefüllte Pfefferschoten und Artischockenherzen, die mit mildem Essig gewürzt waren. Wir tunkten das helle, weiche Brot in das Öl, in dem Thymian, Oregano und ein Lorbeerblatt schwammen. Wir aßen schwarze, glänzende Oliven und den weißen, in Würfel geschnittenen Schafskäse. Wir leckten uns das Öl von den Fingern. Wir tranken von dem Wein, der aus dem Dorf stammte, in dem neben der romanischen Kirche ein großer Käfig steht, in dem die Totengebeine aufbewahrt sind, für die auf dem Friedhof kein Platz mehr ist.
Kapitel 3Sonntag, 10. Juni 2007
Am nächsten Morgen war Tina lange vor mir aufgewacht. Als ich nach unten kam, hatte sie schon das Frühstück auf meinem kleinen Balkon gerichtet, es gab frische Brötchen und Honig und weich gekochte Eier. Sie pfiff ein Liedchen, hörte aber sofort damit auf, als sie mich bemerkte. Sie schien in einer ausgesprochen guten Laune zu sein.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!