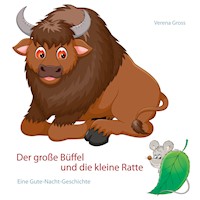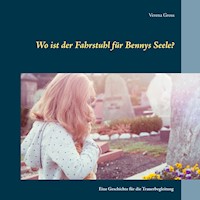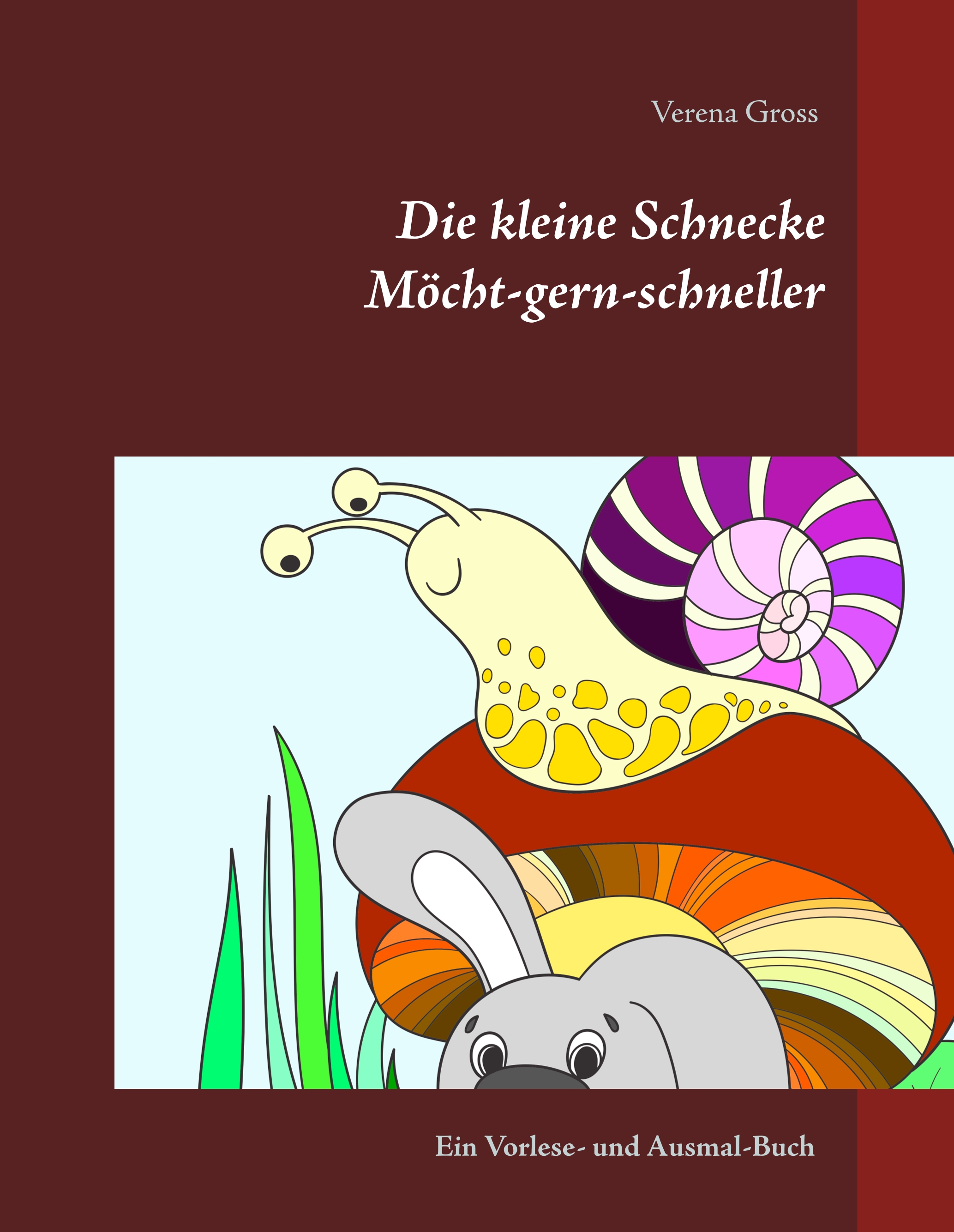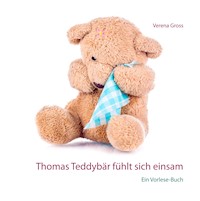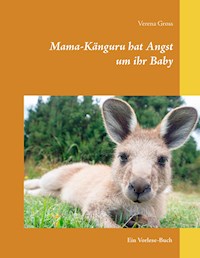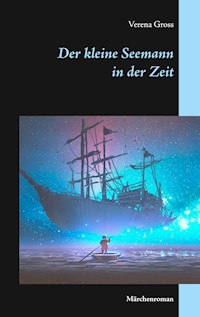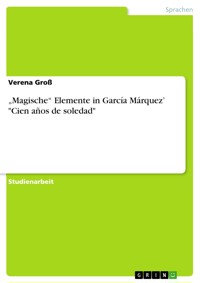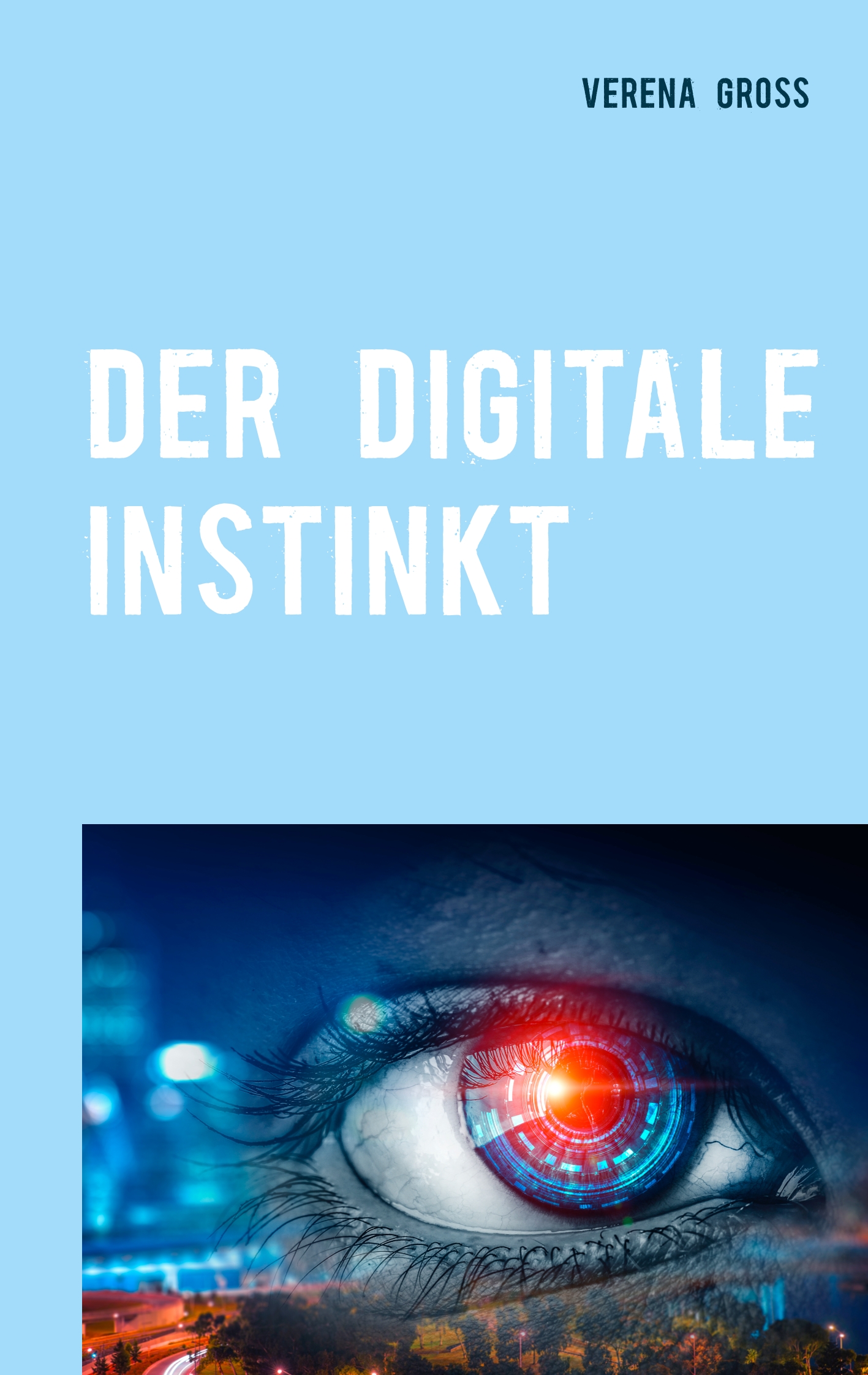
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schließlich schüttelt er verzweifelt den Kopf und lässt seine flache Hand mehrmals leise an das Gestein klatschen. Durstig schlurft er zurück an den Platz, an dem er gesessen hat. Er ist dem Schicksal ausgeliefert. Hilflos, ohnmächtig. Ein Schwächeanfall lässt David zu Boden gehen, entkräftet sinkt sein Kopf an die Wand. Noch einmal fleht er: "Bitte, nicht so!" Dann kehrt die Stille zurück in die Felsspalte. Und mit ihr die pechschwarze Nacht. Die Fahrt zum todkranken Vater wird für den gestressten David und seinen pubertierenden Sohn Simon eine Reise zu sich selbst. In der Einfachheit des Lebens in den Bergen stellt sich David seinen Schuldgefühlen und Simon entdeckt während eines gefährlichen Sturms, dass seine Hyperaktivitätsstörung Ausdruck einer außergewöhnlichen Fähigkeit ist. Wir leben in einer elektrifizierten, technisierten Welt. Was würde geschehen, wenn die Natur - in aller Stille - bereits damit begonnen hätte, unserem Streben nach umfassender Digitalisierung Einhalt zu gebieten? Dieser Roman gibt eine naturwissenschaftlich fundierte, fiktionale Antwort.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für meine Schwester
Birgit
„Das Gegenteil einer richtigen Aussage
ist eine falsche Aussage.
Aber das Gegenteil einer tiefen Wahrheit
mag sehr gut eine andere tiefe Wahrheit sein.”
Niels Bohr
Niels Henrik David Bohr (* 7. Oktober 1885 in Kopenhagen; † 18. November 1962 ebenda) war ein dänischer Physiker. Er erhielt den Nobelpreis für Physik im Jahr 1922 „für seine Verdienste um die Erforschung der Struktur der Atome und der von ihnen ausgehenden Strahlung”.
Inhalt
Prolog
David
Simon
Telegraph Road
„Insolvent in einem halben Jahr!”
Der Bergungsauftrag
Die Kreuzung
Der Geschäftspartner
Theresa
Die Nachricht
Auf dem Heimweg
Ben
Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung
Entladung
Die Fahrt in die Berge
Auf dem Rastplatz
Triumph Bonneville
Hellen
Davids Elternhaus
Das Vater-Sohn-Projekt
Sally
„Warum hast Du das getan?”
Luisa
Hokuspokus
Der Test
Regression
Vater und Tochter
Familie
Refugium
Ein neuer Tag
Elektrosmog
Das erste Mal
Glücksgefühl
Ruhe vor dem Sturm
„Wandle, was der Tod zerbricht”
Initiation
Schicksalsgefährten
Auf dem Friedhof
Hellens Anliegen
Miriam
Vorboten
Blitz und Donner
Einsamkeit
Ohnmacht
Der Blick des Kranichs
Befreit
Elektrosensibilität
Gabe oder Fluch
Der sechste Sinn
Ein richtiger Faradaykäfig
Das Ende der Einsamkeit
Der Gefährte
Epilog
Prolog
Endlich! Nach fast vier Stunden Fahrt liegt die letzte Kreuzung vor ihr. Katharine biegt mit ihrem Auto nach links ab. Nur noch ein paar Grundstücke bis zu dem Haus ihrer Eltern.
Vor neun Monaten war sie ausgezogen. Stolz, wissbegierig und gespannt auf die neuen Freunde an der Universität. Rückblickend erscheint ihr die Zeit wie verflogen. Doch als sie auf das Grundstück ihrer Eltern fährt, fühlen sich die vergangenen Monate auf einmal kurz und lang zugleich an.
Eine freudige Erwartung verscheucht für einen Moment ihre schlechte Laune. Und ihr Vater enttäuscht sie nicht.
Während ihr Auto vor der Garage zum Stehen kommt, öffnet sich die Haustür und David geht freudestrahlend auf sie zu. Kaum ist sie ausgestiegen, steht er schon vor ihr und schließt sie in seine starken Arme: „Kathy! Wir haben dich so vermisst! Schön, dass du da bist.”
Es war nicht leicht, schwerer als erwartet, die Tochter gehen zu lassen, hinaus in ihre eigene Zukunft. Und es fühlt sich tatsächlich an wie ein Geschenk, sie nach all den Monaten endlich wieder umarmen zu können. Er genießt diesen Moment und ergreift sie dann fürsorglich an den Schultern: „Komm herein, mein Schatz. Es ist kalt und du hattest eine lange Fahrt. Du bist bestimmt müde.”
Für einen Augenblick fühlt sich Katharine wieder wie ein kleines Mädchen. Erst jetzt wird ihr bewusst, wie sehr sie diese Umarmung vermisst hat. Sie lächelt ihn an und nickt. Vom Beifahrersitz ihres Autos holt sie einen Rucksack und gibt ihn David. Anschließend holt sie einen Rollkoffer aus dem Kofferraum und folgt ihrem Vater in das Haus.
Im Flur hat sich nichts verändert. Das vertraute Gefühl von zu-Hause-sein mildert ihre Verärgerung etwas. „Ist Mama noch nicht da?”
„Sie kommt später. Sie ist noch bei einem Kunden.” David dreht sich zu ihr. „Willst du dich erst einmal frisch machen?„
Katharine horcht kurz in sich hinein. „Nein. Eigentlich brauche ich erst mal einen Milchkaffee.”
„Na, dann komm.”
Sie lässt ihren Rollkoffer im Flur stehen und begleitet ihren Vater in die Küche. „Ist Simon nicht da?”, fragt sie neugierig, verwundert darüber, dass ihr Bruder sie nicht stürmisch begrüßen kommt.
„Nein. Er ist bei meiner Mutter.”
„Mein Bruder? Bei seiner Oma, auf dem Land? Zu Weihnachten?„ Ungläubig blickt sie ihren Vater an.
„Ja„, nickt David und legt den Rucksack seiner Tochter auf einem Stuhl ab. Dann holt er einen Becher aus dem Küchenschrank und bedeutet ihr mit einer einladenden Geste sich zu setzen. Nachdem er die Espressomaschine eingeschaltet hat, fährt er bedeutungsvoll fort: „Ja. Es ist viel passiert, in den letzten Monaten.„
„Ich hoffe, Besseres als bei mir”, nutzt Katharine die sich bietende Gelegenheit und verleiht ihrer schlechten Laune Ausdruck.
Erst jetzt bemerkt David, dass sie nicht nur erschöpft, sondern auch verärgert ist. Er bringt ihr den Becher mit Milchkaffee und setzt sich neben sie an den Tisch. „Was ist passiert? Gab es Stress auf der Fahrt hierher?”
Kathy lässt sich in ihre Enttäuschung fallen. Sie trinkt ein paar Schluck und fragt ihren Vater unvermittelt: „Wärst du sauer, wenn ich das Studienfach wechsle? Oder ganz aufhöre zu studieren?”
Überrascht blickt David seine Tochter an. Sie haben in den vergangenen Monaten viel über Handy miteinander kommuniziert und Katharine hatte in ihren Textnachrichten immer wieder stolz von ihren guten Noten berichtet. „Aber es läuft doch sehr gut. Oder nicht?”
„Ich hab gestern eine Hausarbeit zurück bekommen. In meinem Lieblingsfach”, versucht sie ihre Frustration in Worte zu fassen: „Ungenügend! Eine 5!” Wütend schüttelt sie mit dem Kopf. „Der Dozent kann es einfach nicht ertragen, wenn man anderer Meinung ist als er.”
Und, um den Beweis der ungerechten Behandlung vorzulegen, öffnet sie ihren Rucksack, greift hinein und zieht einen dünnen Plastikhefter hervor. Erregt schmeißt sie ihn vor sich auf den Tisch.
David betrachtet seine Tochter mitfühlend und versucht den Ernst der Lage einzuschätzen. Dennoch muss er ein Schmunzeln unterdrücken, weil er sich an ähnliche Situationen erinnert: Nachmittage, an denen sein kleines ehrgeiziges Mädchen unzufrieden über eine vermeintlich schlechte Leistung aus der Grundschule kam. Er schaut vor sich auf den Hefter und beschließt, sich genauso zu verhalten wie früher. „Darf ich es lesen? – Oder ist es zu wissenschaftlich für mich?„
„Ich bin im zweiten Semester, Paps”, ermutigt sie ihren Vater und gibt zu: „Ich weiß, dass die Quellenangaben fehlen. Ich hab vor lauter Stress meine vorletzte Version abgegeben. Die, in der die Quellen noch nicht formatiert waren.” Doch dann entrüstet sie sich erneut: „Aber das ist doch kein Grund, auch den Inhalt mit Fünf zu bewerten!”
Sie trinkt den Becher Milchkaffee leer und erhebt sich. „Ich bring dann mal meine Sachen nach oben.”
Als Katharine die Küche verlassen hat, nimmt David den Hefter zur Hand und liest den Titel auf dem Deckblatt: „Der digitale Instinkt„.
Er blickt auf, während er hört, wie seine Tochter mit dem Rollkoffer die Treppe nach oben zu ihrem Zimmer geht. Dann schaut er wieder auf den Hefter, öffnet ihn und beginnt zu lesen.
Der digitale Instinkt
von Katharine Campbell
1. Einleitung
Nach einer stammesgeschichtlichen Entwicklung von 23.000.000 (23 Millionen!) Jahren war der Homo sapiens vor rund 300.000 Jahren zu dem geworden, was wir Menschen heute sind.
Nicht mehr als nur etwa 250 Jahre ist es dagegen her, dass die sogenannte 1. industrielle Revolution den Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft markierte. Als das Symbol dieses Umbruchs gilt die Dampfmaschine, die die Mechanisierung von Handarbeit durch Maschinen und eine Energieumwandlung ungekannten Ausmaßes ermöglichte. Die darauf folgende beschleunigte Entwicklung von Naturwissenschaft, Technik und Produktivität führte zu grundlegenden wirtschaftlichen Veränderungen, die durch den Begriff Kapitalismus umschrieben werden können. Sie wurde begleitet von einer starken Bevölkerungszunahme sowie von einer neuartigen Verschärfung sozialer Missstände.
Auf die „goldenen” 1920er, also die Zeit vor 100 Jahren, wird der Beginn der 2. industriellen Revolution datiert. Sie ist gekennzeichnet durch die Umstellung der Produktion auf die Massenfertigung mit Hilfe von Fließbändern und die sich verbreitende Nutzung der Elektrizität. Als das Symbol dieser zweiten Phase der Industrialisierung betrachte ich „Tin Lizzie”, das Modell T genannte, schwarze Automobil der Ford Motor Company. Und die Auswirkungen der neuen Produktionsverhältnisse auf den Menschen sowie die damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen sind meiner Meinung nach trefflich durch den Film „Moderne Zeiten” von Charles Chaplin veranschaulicht worden. Die wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen dieser Zeit führten zur Nutzung der Atomenergie. Zu den dramatischen Begleiterscheinungen gehörten jedoch ebenfalls Nationalismus und Imperialismus, die im 2. Weltkrieg eskalierten.
Im darauf folgenden „Kalten Krieg” löste der, durch die Sowjetunion in der westlichen Welt verursachte, sogenannte Sputnikschock nicht nur den Eintritt von inzwischen unzähligen Satelliten in die Erdumlaufbahn aus, sondern beschleunigte vor nur etwa 50 Jahren auch den Übergang zur 3. industriellen Revolution. Deren technologische Basis, und ihr Symbol, ist der Mikrochip: ein „integrierter Schaltkreis” genanntes elektronisches Bauteil – aus der Sicht eines Laien ein kleiner Käfer mit einem schwarzen Gehäuse aus Plastik und mit silbernen Beinchen aus Metall. Mit dem Einsatz von Mikroelektronik und Informationstechnik verstärkte sich der Trend, Arbeitsprozesse durch elektronische Datenverarbeitung zu automatisieren und zu rationalisieren. Der Computer begann nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Bereich Anwendung zu finden und sorgte für eine Entwicklung, die den Aufbau weltweiter Kommunikationsnetze ermöglichte.
Mit dem Eintritt in das 21. Jahrhundert brach das „digitale Zeitalter” an und wirkt sich seitdem erneut auf alle Lebensbereiche des Menschen aus. Die Dimension und die Intensität des derzeitigen Wandels in den Wirtschafts-, Produktions- und Arbeitsprozessen sowie die Informationsexplosion veranlasst manche Experten von dem Beginn einer 4. industriellen Revolution zu sprechen. Diese scheint uns in eine globalisierte Welt zu führen, in der sich unter anderem Roboter, Menschen und Haushaltsgeräte durch Sensoren miteinander vernetzen, über das „Internet der Dinge” kommunizieren und technische Assistenzsysteme dem Menschen eigenständige Entscheidungen abnehmen. Der Wert digitaler Güter wird dabei wohl langfristig den klassischer materieller Produkte übersteigen und die Arbeitslosigkeit zunehmen, da selbst die billigste menschliche Arbeitskraft teurer ist als eine Maschine.
Jede der hier kurz skizzierten industriellen Revolutionen führte zu einer tiefgreifenden und dauerhaften Umgestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse sowie der Arbeitsbedingungen und Lebensumstände der Menschen und wurde begleitet von einer starken Bevölkerungszunahme. Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass sich das Leben der Menschen in nur zweieinhalb Jahrhunderten vollkommen verändert hat und dabei immer neue Herausforderungen an unsere intellektuelle und emotionale Anpassungsfähigkeit stellt – während wir uns mit unseren biologischen Instinkten unbestreitbar noch immer in der Steinzeit befinden.
In dieser Hausarbeit werde ich mich mit dem Wesen der 4. industriellen Revolution – der Digitalisierung – beschäftigen sowie mit ihren ungelösten technischen Problemen und den gesellschaftspolitischen Gefahren, die durch sie verursacht werden.
2. Die Herausforderungen der Digitalisierung
Digitalisierung – mit diesem technischen Begriff wird ein fundamentaler Wandel bezeichnet, der seit etwa zwanzig Jahren unser Leben auf globaler, nationaler und individueller Ebene prägt und tief hinein in die Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme wirkt. Das wirklich Neue an diesem Wandel sind die schnell wachsende Menge an Informationen und die dramatische Zunahme an Daten, die zur Verfügung stehen ebenso wie die Geschwindigkeit der Entwicklung der technischen Möglichkeiten zu ihrer Nutzung und Veröffentlichung. Die beschleunigte Digitalisierung der Gegenwart ist eine nicht mehr zu bremsende Realität und Daten sind der unerschöpfliche Rohstoff, der das weltweite Geschäft immer mehr auf Touren bringt. Damit steigert die unüberschaubare und nicht mehr zu kontrollierende Menge an Informationen die Komplexität der Berufs- und Alltagswelten. Und unsere Kompetenzen und traditionellen Methoden, mit deren Verschiedenartigkeit, Unübersichtlichkeit und Widersprüchlichkeit umzugehen und uns zu orientieren, stoßen an ihre Grenzen.
Diese dynamische Komplexität ist das eigentliche Wesen der Digitalisierung. Gerade erst begonnen hat der Prozess, der den Menschen zur Anpassung an die komplizierter werdende Umwelt zwingt, indessen nicht. Da es sich bei der Digitalisierung im Grunde um eine Transformation der menschlichen Kommunikation sowie der zwischen Mensch und Maschine handelt, lässt sie sich auch als eine Weiterentwicklung der Medien interpretieren. Hier können vier Epochen unterschieden werden: nämlich die Produktion von Informationen durch Sprache, unter Verwendung von Schrift, später mittels Buchdruck und nun mit Hilfe von Computern. Mit diesen Medien ließen sich jeweils schneller, mehr und bis dahin unbekannte Arten von Nachrichten verbreiten.
Eine Gesellschaft kann darauf auf zwei Arten reagieren: sie kann die Erweiterung der Kommunikation zulassen oder kontrollieren und einschränken. Tut sie Letzteres nicht, ist der Mensch heutzutage in steigendem Maße gezwungen, sich mit maschinell kommunizierten Informationen auseinanderzusetzen und sich eine Meinung zu bilden, ohne die Quelle und die Qualität der angebotenen Daten überprüfen zu können.
Für den Einzelnen bedeutet Digitalisierung demzufolge nicht nur eine wachsende Komplexität, sondern auch eine zunehmende Intransparenz. Und er oder sie braucht Unterstützung dabei, Informationen zu interpretieren und zu beurteilen – benötigt so etwas wie ein virtuelles Werkzeug, das hilft zu entscheiden, welche Daten interessant und wichtig sind.
Diese Entscheidungshilfe bieten Algorithmen. Das sind systematische Rechenvorschriften und logische Regeln, welche die Informationen filtern und selektieren und so die Unmenge an Daten reduzieren, damit sie für den Menschen nutzbar werden. Allerdings bestimmt derjenige, der die Algorithmen schreibt, direkt darüber, welche Informationen etwa durch sogenannte Suchmaschinen im World Wide Web dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden.
Im Alltag werden wir daher nicht nur immer abhängiger von den „Big Playern”, die derzeit die Märkte für Kurznachrichten, Freundschaftsplattformen und den Einzelhandel via Internet beherrschen, wir werden auch manipulierbarer. So können Algorithmen beispielsweise eingesetzt werden, um unsere Kommunikation zu überwachen oder um Meinungen zu beeinflussen und damit unter Umständen unsere demokratischen Errungenschaften gefährden.
Gefahr droht hier nämlich nicht nur dadurch, dass sich einem Staat durch die Digitalisierung neuartige Möglichkeiten der Überwachung seiner Bevölkerung bieten, sondern insbesondere durch internationale Großkonzerne, deren Investitionsbudgets größer sind als die finanziellen Mittel, die manch kleineres Land zum Beispiel für Forschung und Entwicklung ausgeben kann. Ich denke, es ist keine Dramatisierung zu konstatieren, dass von der vom Internet profitierenden Wirtschaft schon vor Jahren die Machtfrage gestellt worden ist. Und auf dem ökonomisch geprägten Kriegsschauplatz geht es bei der Antwort um nichts weniger als darum, wer seine Zukunftsvorstellungen im Zuge der voranschreitenden Globalisierung durchsetzen kann.
Dabei folgt das Handeln der marktdominierenden Unternehmen, die gegenwärtig die weltweiten Datenströme beherrschen, dem Grundprinzip einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Das ist eine Form der Marktwirtschaft, die sich gerade dadurch auszeichnet, dass ein enger Zusammenhang zwischen Vermögen und politischer Macht besteht. Darüber hinaus wird einzig und allein die Maximierung des Profits angestrebt, ohne ethische, soziale oder Aspekte der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Als Beispiele lassen sich hier fragwürdige Geschäftsbedingungen nennen, die das Erlangen der Rechte an von Nutzern bereit gestellten Informationen beinhalten oder die massenhafte Beschäftigung von rechtlosen Kleinst-Selbstständigen, die vor Ort die Lücke zwischen der virtuellen Internetwirtschaft und der realen Marktschnittstelle etwa bei der Zustellung von materiellen Güter schließen.
Auf der Suche nach profitablen Absatzmärkten herrscht derzeit ein engagiert geführter Wettbewerb um neue Produkte und Dienstleistungen. Und zu den Gewinnern der digitalen Transformation werden neben den „Big Playern” höchstwahrscheinlich bisher unbekannte Geschäftsmodelle zählen, wie beispielsweise die Krypto-Währungen. Die ökonomische und politische Fixierung auf Wachstum durch Digitalisierung hat allerdings längst nicht mehr nur die Dienstleistungsbereiche erfasst, sie hat ebenfalls bei den produzierenden Branchen Einzug gehalten.
In Anlehnung an die Bezeichnung „4. industrielle Revolution” charakterisiert der Begriff „Industrie 4.0” hier jedoch weniger eine Produkt-, als vielmehr eine Systemrevolution. Auf der Basis von intelligenten und digital vernetzten Systemen und mittels moderner Informations- und Kommunikationstechnik soll eine weitestgehend selbstorganisierte industrielle Produktion möglich werden, in der nicht nur einzelne Maschinen, sondern darüber hinaus komplette Fertigungsanlagen und Logistikbereiche wie Lagern oder Transport und schließlich die Produkte selbst direkt miteinander kommunizieren und kooperieren. Durch die angestrebte Vernetzung wird dann nicht mehr nur ein einzelner Produktionsschritt optimiert, sondern eine ganze Wertschöpfungskette: von der Idee eines Produkts über dessen Entwicklung, Fertigung, Nutzung und Wartung bis hin zu seinem Recycling.
Die Vision von einer menschenleeren Fabrik mit maximaler Automatisierung ist nicht neu. Sie prägte schon die 3. industrielle Revolution und die Resultate sind bekannt, wie etwa die Zunahme von kostenintensiven Produktrückrufen. Purer Aktionismus im Sinne eines #WeToo! ersetzt keine nachhaltige Marketingstrategie, auch nicht – oder erst recht nicht – in einer Konsum-Welt der immer kürzer werdenden Produktzyklen.
Ob in der Industrie 4.0 oder für den privaten Haushalt, die technische Basis der digitalen Transformation ist die globale Vernetzung, weshalb der Ausbau leistungsstarker Netzwerke derzeit weltweit voran getrieben wird. Allerdings birgt das Zusammenschalten unzähliger elektronischer Geräte gefährliche Risiken. In großen Versorgungssystemen, wie beispielsweise in Atom- und Wasserkraftwerken, müssen Komponenten verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren, die zum Teil mehrere Jahrzehnte alt sind. Sie erschweren die Einbindung von neuen Netzwerkkomponenten und die Installation moderner Software. Daher öffnet der Ausbau der Kommunikationsnetze hier mögliche Einfallstore für kriminelle Angreifer – weswegen der IT-Sicherheit eine immer wichtiger werdende Bedeutung zukommt.
Hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und an die Sicherheit der eingesetzten Informationstechnik gelten grundsätzlich ebenso für kleinere Systeme, wie in Krankenhäusern oder mittelständischen Unternehmen. Oft verfügen diese jedoch nicht über die finanziellen Mittel oder scheuen Investitionen in die IT-Sicherheit, da kein unmittelbarer Nutzen erkennbar ist. Wenn etwas nicht passiert, ist es schwierig, „dieses Nichts” als Erfolg darzustellen. Doch auch Unternehmen, die bereitwillig in die Sicherheit vor Ort investiert haben, etwa indem sie ihre Programme ausschließlich auf Servern (in der Cloud) von Dienstleistungsfirmen laufen lassen, sind nicht sicher. Werden die Computer dieser Firmen gehackt, dann steht der Betrieb in den Unternehmen still.
Die weltweite Vernetzung von elektronischen Geräten hat verstärkte Abhängigkeiten von internationalen Technologielieferanten und vermehrte (Cyber-)Angriffe auf die digitalen Infrastrukturen von Industrie, Wirtschaft und Verkehr mit sich gebracht. Die Risiken, denen Unternehmen und Bevölkerung auf diesen Gebieten durch Kriminalität, Spionage und Sabotage in steigendem Maße ausgesetzt sind, können derzeit weder abgeschätzt, geschweige denn begrenzt werden. In letzter Konsequenz sind Staat und Gesellschaft von dieser gefährlichen Entwicklung betroffen – und damit jeder einzelne Bürger.
Durch die zunehmende Vernetzung aller Lebensbereiche werden die Menschen mehr und mehr dazu genötigt, digitale Infrastrukturen, Online-Dienstleistungen und Netzwerk-Endgeräte wie PCs, Tablets oder Smartphones zu nutzen, um am Alltagsleben teilhaben zu können. Eine Nutzung, die von technischer Fremdbestimmtheit und von mangelnder Kontrolle geprägt ist.
Zum Einen werden die Endgeräte und insbesondere ihre Betriebssysteme von nur einer Handvoll internationaler Großkonzerne entwickelt und vertrieben. Diese können sehr dynamisch agieren und versuchen, sich so weit wie möglich nationalstaatlichen Regulierungen, zum Beispiel in datenschutzrechtlicher Hinsicht, zu entziehen. Zum Anderen werden die hardware- und softwaretechnischen Schnittstellen der Endgeräte entweder (von vornherein) nicht sachgerecht mit Elementen der IT-Sicherheit ausgestattet oder die Anwendung von Schutzmaßnahmen sind so kompliziert, dass sie durch die einzelnen Nutzer nur unzureichend beherrscht werden.
Die daraus resultierende Gefahr, jederzeit ein Opfer krimineller Aktivitäten zu werden und die Verletzung der Privatsphäre (durch die nicht kontrollierbare Sammlung, Übertragung, Verarbeitung und Speicherung von persönlichen Daten) bedrohen die Souveränität der Bürger und ihr Recht auf Selbstbestimmung – das wohl edelste Privileg, welches das menschliche Leben hervorgebracht hat.
Im Spannungsfeld zwischen individueller Abhängigkeit, technischer Überforderung, digitaler Informationsexplosion und intransparenter Komplexität sorgt der „menschliche Faktor„ jedoch für eine weitere beunruhigende Entwicklung. Die Digitalisierung als Transformation der menschlichen Kommunikation (siehe oben) hat das Alltagsleben, den Umgang der Menschen miteinander, dramatisch verändert und uns nach Ansicht einiger Autoren in eine gesellschaftliche Krise geführt.
In einer komplexen Umwelt benötigen wir als soziale Lebewesen eine Identität stiftende Orientierung, die durch die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und die Identifikation mit deren Werten erreicht werden kann. Die täglich wachsende Menge an für jedermann und jede Frau zugänglichen – sich widersprechenden – Informationen verstärkt dieses Bedürfnis nach Orientierung und Bestätigung. Allerdings ist in Zeiten der Social-Media-Plattformen die Suche nach der eigenen Identität zu einer neuen facettenreichen Herausforderung geworden.
Zwar haben im Zuge der Digitalisierung sehr viel mehr Menschen Zugang zum Internet erhalten, welches bei seiner Entstehung noch als Wissens- und Bildungsnetzwerk sowie als demokratischer Heilsbringer gefeiert wurde. Doch scheint die Identifikation durch Abgrenzung in den Sozialen Medien im Wesentlichen durch destruktive Polarisierung zu funktionieren. Wie lassen sich die Exzesse von Bosheit und Hass, aber auch die hemmungslose Verbreitung von Kinder-Pornos oder Unfall-Schadenfreude-Clips ebenso wie die epidemieartigen Publikationen von „Fake News” und Verschwörungstheorien erklären?
Im vermeintlich anonymen und daher – zumindest kurzfristig – sanktionsfreien Internet sind die Sozialen Medien zu einem Verstärker unserer Ängste und Aggressionen geworden. Die Kommunikations-Netzwerke wirken dabei wie ein mächtiges Echo unserer (geheimen) Wünsche, Träume und Gefühle. Und wie ein Spiegel zeigt es uns eben nicht nur niedliche Katzenbilder, sondern lässt uns auch in die tiefsten Abgründe unserer menschlichen Natur blicken.
Wir sind auf den Kontakt zu anderen Menschen angewiesen und die Kommunikation über das Internet befriedigt unser stärkstes emotionales Bedürfnis: nämlich die Sehnsucht danach, gehört zu werden! Sie ist Teil des menschlichen Strebens, einen möglichst wirksamen Einfluss auf unsere Umwelt nehmen zu können, um die Erfüllung unserer Wünsche und Begierden sicher zu stellen.
Und so haben wir uns in eine elektronisch gesteuerte Dauerschleife der (virtuellen) sozialen Anerkennung begeben, in der wir per Smartphone jederzeit und überall mit einem Klick für die Bestätigung der eigenen Wichtigkeit sorgen, die Verbindung mit ”unserer Gruppe” herstellen und unsere Identität durch die Abgrenzung von anderen Gemeinschaften stärken können.
Im Hinblick auf die gesamte Gesellschaft trägt die Vernetzung damit derzeit eher zu ihrer eigenen Spaltung sowie zur Auflösung sozialer Regeln und Werte bei, anstatt uns zum Wohle aller Menschen miteinander zu verbinden.
3. Resümee
Die noch kaum erforschte gesellschaftliche Wirkungsweise und grenzenlos erscheinende Einflussnahme der Sozialen Netzwerke ist Teil der Digitalisierung. Ebenso wie eine durch die neuen Technologien entfesselte Wirtschaft, deren internationale Großkonzerne von der Politik nicht daran gehindert werden, aus reiner Profitgier massenhaft von Anderen – zum Teil im Laufe von Jahrhunderten – erarbeitete Werte abzuschöpfen. Allerdings lebt das Geschäftsmodell auch von der Habsucht im Kleinen. So müsste beispielsweise jedem Konsumenten einer vermeintlichen Gratis-App mittlerweile bewusst sein, dass er immer mit seinen persönlichen Daten bezahlt und in Wirklichkeit gar kein Kunde, sondern (kostenfreier) Zulieferer des jeweiligen Unternehmens ist.
Angesichts der im Verhältnis zu der Dauer unserer Menschwerdung wirklich nur sehr kurzen Phase, in der wir uns der industriellen Entwicklung unseres Lebens und unserer Umwelt gewidmet haben, hatten wir natürlich nicht ausreichend Zeit, um so etwas wie einen ”digitalen Instinkt” zu entwickeln, der uns vor den Gefahren der Digitalisierung schützen könnte.
Aus biologischer Sicht handelt es sich bei einem Instinkt um einen Trieb, eine angeborene Verhaltensweise, die der Selbsterhaltung sowie der Erhaltung der eigenen Art dient, zum Beispiel der Fluchtinstinkt oder der Brutpflegeinstinkt. Umgangssprachlich bezeichnet der Begriff den intuitiven Affekt eines Menschen, (s)ein sicheres Gefühl für etwas oder einen „sechsten Sinn”.
Die vielleicht größte Schwierigkeit für die Ausbildung einer solchen Sensibilität bildet der Umstand, dass sich eine Bedrohung durch die Nutzung digitaler Technik zumeist gar nicht direkt wahrnehmen lässt. Wenn sich die Nutzer ihrer eigenen (Daten-)Transparenz nicht bewusst sind und sich die möglicherweise folgenschweren Konsequenzen eines Missbrauchs erst langfristig offenbaren, wird der eigene Schutzbedarf selbstverständlich unterschätzt.
Da uns ein digitaler Schutzinstinkt nicht angeboren ist, bleibt die Möglichkeit, ein dementsprechendes Verhalten zu erlernen. Nur zu wissen, wie ein Computer oder ein Smartphone funktioniert, reicht dafür nicht aus. Es gilt, Risiken einschätzen und über das Schutzniveau der eigenen Kommunikation bedarfsgerecht entscheiden und demgemäß handeln zu können. Eine angemessene Medienkompetenz würde außerdem emotionale und soziale Anpassungen an die Herausforderungen der Digitalisierung erfordern und bedürfte einer „Hilfestellung” in Form von unmittelbaren und wirksamen Sanktionen im Falle von unmoralischem oder kriminellem Verhalten.
Um sich in der digitalen Welt, in einer vernetzten Gesellschaft, zurechtzufinden, müssten wir unsere Kinder lehren, mit einem nie gekannten Ausmaß an Vielschichtigkeit umzugehen. Wir müssten ihnen beibringen, ein Bewusstsein für Strukturen zu entwickeln und ihren Blick auf Zusammenhänge zu richten, anstatt sich auf vermeintliche Eindeutigkeiten zu konzentrieren und auf einfache Gewissheiten zu verlassen. Und wir müssten mit ihnen gemeinsam lernen, Verzicht zu üben – zum Wohle des ärmeren Nachbarn auf der anderen Seite des Globus.
Dem entgegen steht schlicht und ergreifend, dass eine Gesellschaft üblicherweise über ein Bildungssystem verfügt, das für ihre Wirtschaft von Nutzen ist ...
Im Laufe der drei vergangenen industriellen Revolutionen konnte nur eine – in verlustreich erkämpften Demokratien – aktiv und nachhaltig gestaltende Politik den ungezügelten Kapitalismus durch die Regulierungen einer sozialen Marktwirtschaft in die Schranken weisen und die negativen Auswirkungen neuer Technologien und Produktionsverhältnisse durch Gesetze in fürsorglichere Bahnen lenken.
Jedoch allein angesichts der immer weiter wachsenden Weltbevölkerung sehe ich – wenn ich mir derzeit die Zukunft unseres Planeten vorstelle – das folgende Bild vor mir:
Eine nicht enden wollende Schlange von miteinander vernetzten Lemmingen mit 3D-Brillen auf den Augen, die vor dem Raubtier-Kapitalismus in eine digital animierte Spiel-Welt fliehen und dabei auf einen, die Verbindung zum Internet herstellenden, riesigen Gas-Ballon zulaufen, der ein „Thumbs up”-Emblem trägt und sich still und sanft gen Himmel bewegt – um den Weg in den realen Abgrund freizugeben.
Und das Spiel, dem die Lemminge ihr Leben verschrieben haben (ohne den kleinen mausartigen Nagetieren damit zu nahe treten zu wollen), heißt: „Wie ich meine Seele verkaufe” ...
Beeindruckt lässt David den Hefter mit der Hausarbeit seiner Tochter vor sich auf den Tisch sinken. Durch die Vielzahl an Informationen fühlt er sich etwas verwirrt. Aber eines spürt er ganz deutlich: Stolz.
Tief atmet er ein und hebt den Hefter noch einmal vor die Augen, um den mit roter Farbe handgeschriebenen Text unter der Hausarbeit zu lesen:
Die Quellenangaben fehlen!!! Keine Ich-Form!! Polemisch und einseitig, unbelegbare Behauptungen (Industrielle Revolutionen und deren Technik überfordern den Menschen, obwohl er sie selbst erschaffen hat). Negative, wenn auch kreative, Imaginationen, die mit wissenschaftlicher Auseinandersetzung nichts zu tun haben. Bitte melden Sie sich bis Ende des Semesters zur mündlichen Nachprüfung an!
Traurigkeit ergreift David. Nicht wegen der angeblich ungenügenden Leistung seiner Tochter. Auch nicht aus Mitgefühl für ihren Zorn. Sondern über Kathys pessimistische Weltsicht und die Einsamkeit, die in ihrem abschließenden Bild der Hausarbeit zum Ausdruck kommt: Ihr Blick auf die nur in einer virtuellen Welt lebenden Mitmenschen, die als Lemminge ungeschützt auf einen todbringenden Abgrund zulaufen.
Er ist froh über die gemeinsame Zeit, die die kommenden Weihnachtsfeiertage ihnen schenken werden und trifft eine Entscheidung für ihre Gestaltung.
Da hört er Katharine die Treppe herunter kommen. Er schließt den Hefter und legt ihn vor sich auf den Tisch. Als sie die Küche betritt, fragt sie neugierig: „Hatte mein Bruder ein Coming Out?”
Überrascht blickt David seine Tochter an: „Simon? Wie kommst du darauf?”
„Über seinem Bett hängt ein Baldachin. Wie für eine Prinzessin”, lacht sie.
„Nein”, antwortet er ernsthaft. ”Mit dem Netz schläft der Junge besser und hat weniger Kopfschmerzen.”
„Ist das so ne Art von Psychomaßnahme?”
„Nein”, antwortet ihr Vater nachdenklich und wechselt das Thema.
„Ich finde deine Hausarbeit wirklich sehr beeindruckend! So vielschichtig! Man merkt, dass da sehr viel Arbeit drinsteckt. Glaubst du denn, das wird ein Problem, mit der mündlichen Prüfung?”
„Der Dozent arbeitet bei Big G.”
Er versteht den Zusammenhang nicht und schaut sie fragend an. Also ergänzt Katharine sarkastisch: „Wenn ich ihm erzähle, dass die Sozialen Medien der Garant unserer Demokratie sind und selbstfahrende Autos oder unter die Haut des Menschen implantierte GPS-Chips die Erfüllung unserer Bestimmung, gibt es bestimmt keine Probleme.”
„Ich verstehe”, lächelt David.
Seine Tochter wird ernst. „Du hast mich auf eine wirklich gute Uni geschickt. Ich weiß, was das kostet und ich danke dir dafür. Aber dieses arrogante, elitäre Gehabe meiner Kommilitonen ...”
Sie macht eine kurze Pause und fährt dann frustriert fort: „Alle machen mit, freiwillig oder gezwungenermaßen, weil wir keine andere Wahl mehr haben, als mitzumachen. Die Wirtschaftsbosse und die Politiker beschäftigen sich nur mit dem Erhalt ihrer Macht und geben den kleinen Leuten gerade soviel, dass die nicht rebellieren. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele meiner Kommilitonen sich mit dem herrschenden System identifizieren! Das kommt mir vor wie beim Goldrausch: es geht nur noch um Startups und die neuesten technischen Spielzeuge. Dass die sich alle selbst ausbeuten, in dem Wahn, reich und berühmt zu werden ...” Missbilligend schüttelt sie den Kopf.
„Nicht alle machen mit”, versucht David in ruhigem Ton dagegen zu halten und fragt interessiert: „Siehst du die Zukunft wirklich so negativ wie in deinem Bild mit den Lemmingen?”
„Du bist doch alt! Entschuldige. Aber du müsstest das doch genauso sehen! Du weißt doch viel besser, wie es früher war – ohne Google und Facebook und Amazon.”
Widersprechend hebt er die Augenbrauen. „Na ja. Weil ich älter bin, habe ich vielleicht mehr Geduld – aber auch Hoffnung. Muss ich doch auch, um meiner Kinder willen.”
Dann kommt David zum Wesentlichen: „Eigentlich wollten Mama und ich dich entscheiden lassen, ob wir zu Simon und meiner Mutter aufs Land fahren, um dort Weihnachten zu feiern. Oder ob wir drei hier bleiben. Aber jetzt möchte ich dich doch bitten, morgen früh mit uns dorthin zu fahren. Ich bin mir sicher, es würde dir gut tun. Dein Bruder wird sich sehr freuen, dich zu sehen. Und du würdest besser verstehen, was ich dir alles zu erzählen habe. Dort könntest du dir auch einen eigenen Eindruck verschaffen.”
„Ist soviel passiert in der Zeit, in der ich weg war?”, fragt Katharine erstaunt.
„Ja, das ist es!”, nickt ihr Vater vielsagend.
1. David
Von seiner inneren Uhr geweckt, öffnet David die Augen. Im Halbdunkel des Schlafzimmers wandert sein Blick zu der rotglühenden Anzeige des Weckers auf dem Nachttisch. 5:58 Uhr, zwei Minuten bevor das lautstarke Fiepen Theresa aufwecken würde. 5:59 Uhr. David langt zum Wecker und schaltet die Alarmfunktion rechtzeitig aus. Er setzt sich auf und schaut fürsorglich nach seiner neben ihm liegenden Frau. Dann streift er die Bettdecke ab und steht leise auf.
David, Anfang fünfzig, ein Mann von großer kräftiger Statur mit einem kleinen Bauchansatz und kurzen graumelierten Haaren, trägt eine bequeme Unterhose und ein weißes T-Shirt. Er geht zu einem Stuhl, auf dem seine ordentlich zusammengelegte Kleidung liegt und zieht sich an. Socken, Jeans und ein gebügeltes Sweatshirt mit dem Aufdruck der Adresse seines Autohandels. Er schlüpft in die vor dem Stuhl stehenden Hausschuhe, holt sein Handy vom Nachttisch und steckt es in eine Hosentasche. Noch einmal wirft er einen wohlwollenden Blick auf seine schlafende Frau und verlässt das Zimmer.
Er betritt das gegenüberliegende Badezimmer und betätigt den Lichtschalter. Die Neonröhre über dem Waschbecken beginnt zu flackern. David tritt vor das Becken, betrachtet die Leuchte mit gerunzelter Stirn und wartet kurz ab, ob das Flackern aufhört. Als das nicht geschieht, klopft er einige Male mit der flachen Hand gegen die Leuchte und hält erneut inne. Doch die Neonröhre flackert weiter. Wieder klopft er dagegen, bis sie schließlich anhaltend leuchtet und den Raum erhellt.
Wie die Möblierung des Schlafzimmers zeugt auch die Einrichtung des Bades von einem gehobenen Lebensstandard, nicht luxuriös, aber wohl situiert. David öffnet den Wasserhahn und lässt Wasser in das Waschbecken fließen. Von der Ablage darüber nimmt er einen Elektrorasierer, schaltet ihn ein und fängt an, sich mit Blick in den Spiegel zu rasieren. Der brummende Lärm seines Rasierers wird so laut, dass er das plätschernde Geräusch des Wassers übertönt. Er rasiert sich zuende, schaltet den Apparat aus, reinigt ihn und legt ihn wieder zurück. Anschließend greift er nach seiner elektrischen Zahnbürste und beginnt sich die Zähne zu putzen. Auch das mechanische Summen der Bürste drängt das Rauschen des Wassers in den Hintergrund.
Nachdem David seine Zähne fertig geputzt hat, legt er die Zahnpastatube und die gesäuberte Bürste zurück, wäscht sich das Gesicht und reinigt das Innere des Waschbeckens, indem er mit der Hand das fließende Wasser darin verteilt. Dann schließt er den Wasserhahn und greift nach einem Handtuch, um sich Gesicht und Hände abzutrocknen. Er hängt das Handtuch ordentlich zurück und kämmt sich die Haare. Zuletzt nimmt er seine neben dem Waschbecken liegende digitale Armbanduhr, bindet sie um und wirft einen prüfenden Blick auf das Becken, bevor er zur Tür geht, das Licht ausschaltet und das Badezimmer verlässt.
Durch das großzügig geschnittene, sehr ordentliche Haus kommt David zur Küche. Auch hier ist die Einrichtung modern und erscheint fast wie aus einem Katalog, etwas unpersönlich, ganz nach dem Geschmack seiner Frau Theresa. Er betritt den aufgeräumten und sehr sauberen Raum, nimmt sich eine Tasse aus einem Wandschrank, geht zu einer großen Espressomaschine und schaltet sie ein. Während die Maschine ihre ratternde, gurgelnde und fauchende Arbeit verrichtet, deckt er den Frühstückstisch für zwei Personen.
Danach holt er die gefüllte Tasse, setzt sich an einen nicht gedeckten leeren Platz des Tisches und beginnt seinen Kaffee zu trinken. Er holt das Handy hervor und prüft seinen elektronischen Terminkalender. Als er damit fertig ist, steckt er das Handy wieder ein, trinkt noch einen Schluck und schaut eine Zeitlang zufrieden durch das Fenster hinaus in den grünen Garten. Schließlich blickt er auf seine Armbanduhr, trinkt den Kaffee aus, stellt die Tasse in die Geschirrspülmaschine und geht zurück zum Schlafzimmer.
Leise betritt er das Zimmer und geht zu der Seite des Bettes, auf der seine Frau noch zugedeckt liegt. Theresa ist ein femininer Typ, Ende vierzig, mit gepflegter Erscheinung und schulterlangen, braun gefärbten Haaren. Sie hat mit geschlossenen Augen vor sich hin gedöst, ist aber schon wach. Als David sich zu ihr auf die Bettkante setzt, öffnet sie die Augen. Ernst blickt sie ihren Mann an und wartet dessen Verabschiedung ab.
Mit gedämpfter Stimme spricht er sie an: „Ich mach mich jetzt auf den Weg. Soll ich für heut Abend irgendwas einkaufen?”
Theresa antwortet noch etwas schläfrig: „Ich weiß nicht, wann ich komme. Die Vertriebsschulung kann länger dauern. Vielleicht esse ich auch mit den Kollegen.”
Sie deckt sich ein wenig ab und legt ihre Arme auf die Decke. Das Oberteil ihres modischen Nachthemds kommt zum Vorschein. Ihre Stimme verändert sich. In angespanntem Tonfall ergänzt sie: „Kannst du bitte Simon wecken und ihm sagen, dass er heut morgen nicht wieder so viel Stress machen soll. Ich muss pünktlich los.”
Mit einem kurzen Kopfnicken beruhigt David seine Frau: „Mach ich.” Er beugt sich hinunter und gibt ihr einen sanften Kuss auf den Mund: „Bis heut Abend.”
„Bis heut Abend.” Mit nach wie vor ernstem Blick schaut Theresa ihrem Mann hinterher, als er das Schlafzimmer verlässt.
2. Simon
Bevor er die Tür zum Zimmer seines dreizehnjährigen Sohnes öffnet, fällt Davids Blick wieder einmal auf das daran befestigte, selbst gemalte Schild: „Zutritt verboten – außer für Kathy!!!”. Simon, von schlanker Statur und eher klein für sein Alter, liegt schlafend in seinem Bett. David geht zu ihm, setzt sich auf die Bettkante und betrachtet ihn einen kostbaren Moment lang.
Die Einrichtung des Zimmers spiegelt die Interessen des Jungen wieder. An den Wänden hängen Poster von Figuren aus Online-Rollenspielen wie „World Of Warcraft” und anderen Adventure-and-Fantasy-Games sowie ein Poster der Fussball-Nationalmannschaft und ein großes Foto seiner eigenen Schul-Mannschaft. In einem Regal stehen einige Fußballturnier-Pokale und Action-Figuren. Das neueste Modell einer Spielekonsole liegt auf dem Fußboden vor einem Flachbildfernseher und auf dem Schreibtisch steht ein PC mit Flachbildschirm, Tastatur und Maus. Ein Headset hängt an der Schreibtischlampe.
Im Gegensatz zu dem Rest des Hauses herrscht in diesem Zimmer eine lebendige Unordnung. Kleidungsstücke, Jeans, Socken und ein buntes Sweatshirt, liegen verstreut auf dem Fußboden herum, ebenso wie jeweils ein Paar Fußballschuhe und Stutzen neben einer offenen Sporttasche.
Auf dem Nachttisch neben dem Bett steht ein Bilderrahmen mit einem wenige Monate alten Foto von Simon und seiner neunzehn Jahre alten Schwester Katharine. Sie trägt eine Jacke sowie eine Baseballkappe mit der Aufschrift ihrer Universität und hat einen Gruß für ihren Bruder auf das Foto geschrieben. Vor dem Bilderrahmen liegt eine tragbare Spielkonsole.
David streicht seinem Sohn zärtlich mit einer Hand über den Kopf und beginnt ihn danach sachte an einer Schulter zu rütteln: ”Aufwachen. Zeit zum Aufstehen.”
Schläfrig dreht sich Simon zur Seite, weg von der rüttelnden Hand des Vaters und gibt mürrische Laute von sich.
Etwas lauter als zuvor mahnt dieser: „Na komm. Es ist Zeit.”
Der Junge dreht sich zurück und blinzelt ihn verschlafen an. „Ich will heut nicht zur Schule.”
Davids Tonfall bleibt freundlich: „Das ist nichts Neues, Kumpel. Nützt aber nichts.”
Einen Moment lang scheint Simon zu überlegen. „Aber ich hab Kopfschmerzen.”
„Das wundert mich nicht, wenn du den ganzen Abend vor dem Bildschirm hängst.”
Er startet noch einen letzten Versuch. „Wir haben heut den halben Tag lang nur Microsoft-Office-Kram.”
David muss lächeln: „Na, dann bist du doch eigentlich in deinem Element.”
„Nein!”
Sein Ton wird etwas ernster: „Mama muss heut ganz pünktlich los. Hilfst du ihr beim Frühstück machen?”
„Ich hab keinen Hunger.”
„Dann hilf ihr bitte, ihr Frühstück zu machen.”
„Nein!”, antwortet Simon in einer Mischung aus Müdigkeit und Trotz und zieht sich die Decke über den Kopf.
David wartet ab, bis er einen Einfall hat, wie er dem störrischen Verhalten begegnen könnte. Er sucht sich über Simons Kopf eine Stelle an der Kante der Bettdecke, die locker genug erscheint und zieht die Decke soweit herunter, dass dessen Augen zum Vorschein kommen. Sein Sohn lässt es zu und blickt ihn abwartend an. „Ich verlass mich auf dich, Kumpel.”
Simon schweigt herausfordernd.
„Wollen wir heut Abend wieder grillen? Was meinst du?” David lässt die Decke los.
Der Junge zieht sie sich wieder über den Kopf und dreht sich erneut zur Seite: „Ist mir egal.”
Er betrachtet die Bettdecke unter der sein Sohn liegt und streichelt noch einmal, über der Decke, mit einer Hand dessen Kopf.
Darunter schüttelt sich Simon kurz: „Lass das!”
Nach einem nachdenklichen, gütigen Blick auf die Bettdecke nimmt David die Digitaluhr vom Nachttisch und prüft die eingestellte Weckzeit. Er erhebt sich und stellt den Wecker, weit entfernt vom Bett, auf den Kleiderschrank.
Simon hat die Bettdecke etwas angehoben und beobachtet ihn. Nicht wirklich böse protestiert er: „Das ist gemein! Jetzt muss ich aufstehen, wenn er tutet.”
Er beobachtet, wie sein Vater zum Fenster geht, die Gardinen aufzieht und einen Fensterflügel öffnet. „Das ist zu hell! Mach die Gardinen wieder zu!”
Noch einmal kommt David zu seinem Sohn, beugt sich über ihn und legt eine Hand an dessen Rücken: „Ich freu mich auf heut Abend. Dann machst du mich schlau über deinen Office-Kram.”
Simon versucht die Hand, die er über der Bettdecke an seinem Rücken spürt, abzuschütteln. „Nein!”
Gutmütig schaut David auf die Bettdecke. „Machs gut. Bis heut Abend.”
Doch mehr als ein mürrisches Brummen erhält er nicht zum Abschied. Er richtet sich auf und verlässt nach einem letzten Blick auf den unter der Decke liegenden Jungen das Zimmer – in der Hoffnung, dass sein Sohn den Bogen heute nicht überspannen wird.