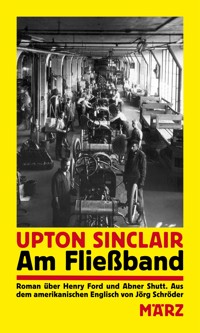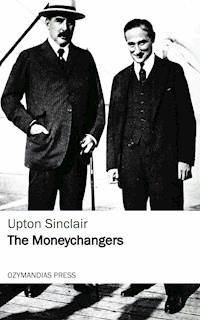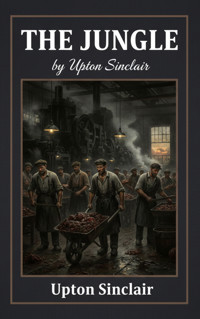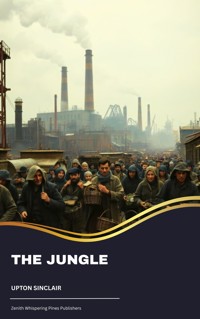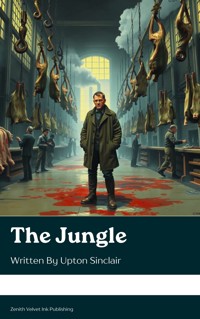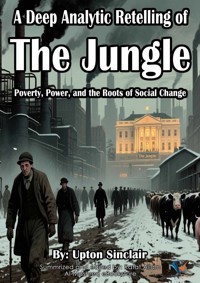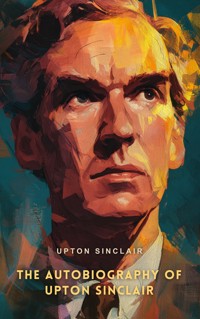12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der litauische Einwanderer Jurgis Rudkus kommt mit seiner Verlobten um 1900 nach Amerika, ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wie viele andere findet auch er Arbeit in den Schlachthöfen Chicagos, doch die Hygiene- und Sicherheitsstandards sind so niedrig, die Anforderungen so hoch und die Bezahlung so erbärmlich, dass die Immigranten kaum eine Chance auf ein vernünftiges Leben haben. Nachdem seine Familie durch mehrere Tragödien zerstört wird und ihre Existenz verliert, ist er gezwungen, auf illegalen Wegen Geld zu verdienen. Nach und nach erkennt er die Notwendigkeit, für Reformen und ein besseres Leben zu kämpfen. Der Dschungel gehört zu den wichtigsten Romanen der Literatur des 20. Jahrhunderts. Ein zeitloses, atemberaubend spannendes Leseerlebnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Amerika um 1900: Wie viele andere findet der litauische Einwanderer Jurgis Rudkus Arbeit in den Schlachthöfen Chicagos. Doch die Hygiene- und Sicherheitsstandards sind so niedrig und die Bezahlung so erbärmlich, dass die Immigranten kaum eine Chance haben. Nach und nach erkennt Jurgis, dass er für ein besseres Leben kämpfen muss.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Upton Beall Sinclair (1878–1968) war ein sozialkritischer Schriftsteller, der in den USA und dem deutschsprachigen Raum populär war. Er engagierte sich zeitlebens politisch und gilt als einer der Wegbereiter des Enthüllungsjournalismus.
Zur Webseite von Upton Sinclair.
Ingeborg Gronke, geboren 1922, arbeitete als Übersetzerin aus dem Englischen.
Zur Webseite von Ingeborg Gronke.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Upton Sinclair
Der Dschungel
Roman
Aus dem Englischen von Ingeborg Gronke
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Erstausgabe erschien 1906 unter dem Titel The Jungle.
Originaltitel: The Jungle (1906)
© 2013 by Europa Verlag AG, Zürich
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Blick von der Madison Street in die State Street, Chicago. Undatiertes Photochrom um 1900. (ullstein-histopics)
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-31107-7
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.07.2024, 06:27h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER DSCHUNGEL
1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. Kapitel25. Kapitel26. Kapitel27. Kapitel28. Kapitel29. Kapitel30. Kapitel31. KapitelNachwortNachwort zum NachwortWichtige DatenAnmerkungen
Mehr über dieses Buch
Über Upton Sinclair
Über Ingeborg Gronke
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema USA
Zum Thema Tier
1. Kapitel
Um vier Uhr war der festliche Akt vorüber, und die Wagen rollten an. Den ganzen Weg war ein Schwarm von Menschen mitgelaufen, und zwar dank dem überschwänglichen Temperament von Marija Berczynskas. Das große Ereignis lastete schwer auf Marijas breiten Schultern. Ihr oblag die Sorge dafür, dass alles nach Brauch und bester Sitte zuging wie in der alten Heimat. So schoss sie bald hierhin, bald dorthin, stieß jedermann aus dem Weg, schalt und ermahnte in einem fort mit ihrer gewaltigen Stimme und war so eifrig darauf bedacht, den andern Manieren beizubringen, dass sie darüber die eigenen vergaß. Sie hatte die Kirche als Letzte verlassen, wollte im Saal aber als Erste ankommen und hatte deshalb dem Kutscher befohlen, schneller zu fahren. Als dieser jedoch in der Sache einen eigenen Willen bekundete, da hatte Marija das Wagenfenster aufgerissen, sich hinausgelehnt und angefangen, ihm die Meinung zu sagen – zuerst auf Litauisch, was er nicht verstehen konnte, und dann auf Polnisch, was er sehr wohl verstand. Der Kutscher, der vom hohen Bock herab ihr gegenüber im Vorteil war, hatte jedoch nicht nachgegeben und sogar zu widersprechen gewagt. Das Ergebnis war ein hitziger Wortwechsel, der sich über eine halbe Meile hinzog und an jeder Kreuzung der Ashland Avenue ihr Gefolge um einen weiteren Trupp von Straßenjungen vergrößerte.
Das traf sich unglücklich, denn vor der Tür gab es ohnehin schon einen Auflauf. Die Musik hatte eingesetzt, und einen halben Häuserblock weit konnte man bereits das dumpfe Schrummschrumm eines Cellos und das Quietschen zweier Fiedeln hören, die in kunstreicher Höhenakrobatik miteinander wetteiferten. Als Marija den Auflauf gewahrte, brach sie den Disput über die Ahnenreihe ihres Kutschers unvermittelt ab, sprang aus dem fahrenden Wagen mitten in die Menge und bahnte sich einen Weg zum Saal. Einmal drinnen, machte sie kehrt und stieß und schob in entgegengesetzter Richtung. Dabei donnerte sie: »Eik? Eik! Uzdaryk‑durisl«, in einer Lautstärke, dass der Orchesterlärm sich daneben wie Sphärenmusik ausnahm.
»Z. Graiczunas, Pasilinksminimams darzas. Vynas. Sznapsas. Weine und Spirituosen. Gewerkschaftsleitung«, stand auf den Firmenschildern. Dem Leser, der sich vielleicht noch nicht oft in der Sprache des fernen Litauens verständigt hat, wird die Erläuterung willkommen sein, dass die Lokalität das Hinterzimmer einer Kneipe in dem Teil von Chicago war, der einfach »Hinter den Schlachthöfen« genannt wurde. Diese Angabe ist genau und treffend in Bezug auf die äußeren Umstände, doch wie lachhaft unzulänglich wäre sie jedem vorgekommen, der wusste, dass es außerdem um das größte Ereignis im Leben eines der liebenswertesten Geschöpfe Gottes ging: die Hochzeitsfeier und Freuden‑Verklärung der kleinen Ona Lukoszaite!
Da stand sie im Eingang, geleitet von ihrer Cousine Marija, noch ganz atemlos – denn sie hatte sich den Weg durch die Menge erkämpfen müssen – und so strahlend vor Glück, dass ihr Anblick fast wehtat. In ihren Augen schimmerte ein Staunen, ihre Lider zitterten, und ihr sonst so blasses Gesicht glühte. Sie trug ein strahlend weißes Musselinkleid und dazu einen steifen kleinen Schleier, der ihr bis auf die Schultern reichte. Fünf rosa Papierrosen waren in den Schleier geflochten und elf leuchtend grüne Rosenblätter. Sie hatte neue weiße Baumwollhandschuhe an den Händen, die sie aufgeregt ineinanderkrampfte, als sie nun dastand und umherblickte. Es war fast zu viel für sie – man konnte die Qual zu großer Erregung an ihrem Gesicht und am Beben ihrer Gestalt ablesen. Sie war so jung – noch nicht ganz 16 – und klein für ihr Alter, eigentlich noch ein Kind; und in dieser Stunde hatte sie geheiratet – ihren Jurgis geheiratet, Jurgis Rudkus, ihn, mit der weißen Blume im Knopfloch seines neuen schwarzen Anzugs, ihn, mit den mächtigen Schultern und den riesigen Händen.
Ona war blauäugig und blond, Jurgis dagegen hatte große schwarze Augen mit buschigen Brauen und dichtes schwarzes Haar, das sich hinter den Ohren kräuselte – kurz gesagt, sie waren eins von jenen ungleichen und gar nicht möglichen Ehepaaren, mit denen Mutter Natur so häufig alle Propheten, die vorher und die nachher, Lügen zu strafen beliebt. Jurgis konnte ein 250 Pfund schweres Rinderviertel aufheben und in einen Wagen tragen, ohne dass er wankte oder dass es ihm überhaupt irgendetwas ausmachte; jetzt aber stand er abseits in einer Ecke, verängstigt wie ein gejagtes Wild, und musste sich jedes Mal erst mit der Zunge die Lippen anfeuchten, ehe er auf die Glückwünsche seiner Freunde antworten konnte.
Allmählich gelang es, Gaffer und Gäste zu trennen – oder sie jedenfalls so weit zu trennen, dass es für praktische Zwecke ausreichte. Die Eingänge und Ecken waren während des nun beginnenden Festes nie ohne Publikum, und wenn einer dieser Zaungäste nahe genug herankam oder auch nur hungrig genug aussah, bot man ihm einen Stuhl an und lud ihn ein mitzufeiern. Es gehörte zu den Gesetzen der Veselija, dass keiner hungrig ausgehen soll; und wenn sich auch ein Brauch, der in Litauens Wäldern aufgekommen ist, nur schwer auf den Schlachthofbezirk von Chicago mit seiner Viertelmillion Einwohner übertragen lässt, so tat man doch sein Bestes, und die Kinder, die von der Straße hereinkamen, und sogar die Hunde gingen glücklicher wieder hinaus. Das Besondere an dieser Feier war die reizende Zwanglosigkeit. Die Männer behielten den Hut auf oder legten ihn auch ab, wenn sie wollten, und die Jacke vielleicht gleich mit; sie aßen, wann und wo es ihnen gefiel, und wechselten den Platz, sooft sie Lust hatten. Reden und Gesang mussten sein, aber niemand brauchte hinzuhören, wenn ihm nichts daran gelegen war; wollte er indessen selber singen oder eine Rede halten, stand ihm auch das völlig frei. Der dadurch verursachte Lärm störte niemand, ausgenommen vielleicht die Säuglinge, von denen haargenau so viele anwesend waren, wie sämtliche geladenen Gäste zusammen besaßen. Anderswo konnten die Säuglinge ja nicht bleiben; daher hatte es zu den Festvorbereitungen gehört, eine Batterie von Wagen und Wiegen in einer Ecke aufzustellen. In ihnen schliefen die Babys zu dritt oder zu viert oder wachten zusammen, je nachdem. Die Größeren, die schon auf die Tische reichen konnten, stolzierten umher und kauten schmatzend und zufrieden an einem Fleischknochen oder einem Würstchen.
Der Saal misst etwa zehn Meter im Geviert und hat weiß getünchte Wände, die kahl sind bis auf einen Kalender, das Bild eines Rennpferds und einen goldgerahmten Stammbaum. Rechter Hand ist die Tür zur Kneipe, in der ein paar Neugierige herumstehen, in der Ecke dahinter eine Bar mit einem kommandierenden Geist in angeschmutztem Weiß, der seinen schwarzen Schnurrbart steif gewichst und eine sorgsam pomadisierte Locke seitlich an die Stirn geklatscht hat. In der gegenüberliegenden Ecke nehmen zwei Tische mit Schüsseln und kaltem Braten ein Drittel des Raums ein, und ein paar besonders hungrige Gäste kauen bereits. Am Kopf der Tafel, wo die Braut sitzt, prangt eine schneeweiße Torte mit einem wahren Eiffelturm von Zuckerguss, gekrönt von Zuckerrosen und zwei Engeln und üppig besät mit rosa, grünen und gelben Bonbons. Dahinter führt eine Tür zur Küche und gibt bisweilen kurz den Blick frei auf einen dampfumwölkten Kochherd und viele Frauen, alte und junge, die geschäftig umhereilen. In der Ecke zur Linken sind die drei Musikanten auf einem kleinen Podium heldenhaft darum bemüht, sich irgendwie gegen das Stimmengewirr durchzusetzen, ferner die Babys, die das gleiche Ziel verfolgen, und schließlich noch ein offenes Fenster, von dem aus das breite Publikum den Anblick, den Trubel und die Wohlgerüche mitgenießt.
Plötzlich schiebt sich aus dem Dampf eine Wolke näher, und bei genauerem Hinsehen kann man Onas Stiefmutter, Tante Elizabeth, ausmachen – Teta Elzbieta wird sie gerufen –, die eine gewaltige Platte mit Entenbraten hoch in den Händen trägt. Ihr folgt mit vorsichtigen Schritten Kotrina, unter ähnlicher Last wankend, und eine halbe Minute später erscheint Großmutter Majauszkiene mit einer großen gelben Schüssel voll dampfender Kartoffeln, die beinahe so umfangreich ist wie sie selber. So nimmt Zug um Zug das Fest Gestalt an. Schinken gibt es und Sauerkraut, gekochten Reis, Makkaroni, Brühwürste, Berge von Korinthenbrötchen, Schüsseln mit Milch und überschäumende Henkelkrüge voll Bier. Außerdem hat man ja keine zwei Meter hinter sich auch noch die Bar, wo man bestellen kann, was man will, und nichts zu bezahlen braucht. »Eiksz! Graicziau!«, schrillt Marija Berczynskas und langt ebenfalls zu, denn drinnen auf dem Herd steht noch mehr und verdirbt nur, wenn es nicht aufgegessen wird.
Unter Lachen und unaufhörlichen Zurufen, Späßen und Neckereien nehmen so die Gäste ihre Plätze ein. Die jungen Männer, die sich größtenteils an der Tür herumgedrückt haben, raffen sich auf und treten näher, und der verschüchterte Jurgis wird von den Älteren geknufft und ausgezankt, bis er sich schließlich folgsam auf seinem Platz zur Rechten der Braut niederlässt. Die beiden Brautjungfern, die als Zeichen ihrer Würde Papierkränze tragen, setzen sich daneben, und dann folgen alle übrigen Gäste, Alt und Jung, Burschen und Mädchen. Die Feststimmung greift über auf den stattlichen Barmann, der sich zu einem Teller Entenbraten herablässt, und sogar der dicke Polizist – dessen Aufgabe es später am Abend sein wird, den Raufereien ein Ende zu machen – zieht sich einen Stuhl ans untere Tischende. Und die Kinder toben, und die Babys brüllen, und alles lacht und singt und schwatzt, und über all dem ohrenbetäubenden Lärm ruft Cousine Marija den Musikanten zu, was sie spielen sollen.
Die Musikanten – wie soll man es nur anfangen, sie zu beschreiben? Sie sind die ganze Zeit mit dabei und spielen auf in rasendem Wirbel – eigentlich müsste man diese Szene zu Musikbegleitung lesen oder sprechen oder singen. Denn die Musik ist es, die das Fest zu dem macht, was es ist. Die Musik ist es, die aus dem Hinterzimmer einer Kneipe hinter den Schlachthöfen eine Traumwelt zaubert, ein Wunderland, ein Winkelchen auf der Insel der Seligen.
Der kleine Mann, der das Trio leitet, ist ein Begnadeter. Seine Geige ist verstimmt, sein Bogen hat kein Kolophonium, aber er ist dennoch ein Begnadeter. Die Musen haben ihn angerührt. Er spielt, wie von einem Dämon besessen, von einer ganzen Horde Dämonen. Man spürt sie förmlich um ihn herum in der Luft, wo sie ihre Kapriolen schießen und mit ihren unsichtbaren Füßen den Takt stampfen – und das Haar des Kapellmeisters sträubt sich, und die Augäpfel treten aus den Höhlen vor lauter Anstrengung, mit ihnen Schritt zu halten.
Tamoszius Kuszleika heißt er, und das Geigespielen hat er sich allein beigebracht: Ganze Nächte hindurch hat er geübt, nach einem langen Arbeitstag an der Schlachtbank. Er ist in Hemdsärmeln, trägt eine Weste mit verschossenem goldenem Hufeisenmuster und ein rosa gestreiftes Hemd, bei dem man an Pfefferminzlutscher denken muss. Ein Paar Militärhosen, hellblau mit gelben Biesen, geben ihm die Autorität, die dem Leiter einer Kapelle zukommt. Er ist nur etwa einen Meter fünfzig groß, aber trotzdem sind ihm die Hosen gut zwei Handbreit zu kurz. Man fragt sich, wo er sie wohl herhat – oder vielmehr: Man würde sich das fragen, wenn der mitreißende Schwung seiner Anwesenheit einen überhaupt dazu kommen ließe.
Denn ein Begnadeter ist er. Jeder Zoll an ihm ist begnadet: Fast möchte man sagen, jeder Zoll einzeln. Er stampft mit dem Fuß, er schleudert den Kopf zurück, er wippt und wiegt sich hin und her. Sein Gesicht ist klein und verschrumpelt und wirkt unwiderstehlich komisch, und wenn er einen Doppelgriff oder einen Triller ausführt, ziehen seine Brauen sich zusammen, zucken seine Lippen und flattern seine Lider – sogar die Spitzen seines Halstuchs sträuben sich. Alle Augenblicke wendet er sich seinen Gefährten zu, nickt, gestikuliert, winkt leidenschaftlich, jeder Zoll an ihm eine Beschwörung, ein Anflehen im Namen der Musen und ihrer Sendung.
Denn Tamoszius können sie nicht das Wasser reichen, die anderen beiden Musiker. Die zweite Geige ist ein Slowake, ein großer, hagerer Mann mit schwarz umrandeter Brille und dem stummen, geduldigen Blick eines geschundenen Maulesels; er reagiert nur schwach auf die Peitsche und fällt danach immer wieder in seinen alten Trott zurück. Der dritte Mann ist sehr dick, hat eine rote, gefühlvolle Knollennase und spielt mit himmelwärts gerichteten Augen und grenzenloser Sehnsucht im Blick. Er spielt den Basspart auf seinem Cello, und deshalb lässt ihn die ganze Erregung kalt; was auch die Oberstimmen anstellen mögen: er jedenfalls hat die Aufgabe, einen lang anhaltenden, schwermütigen Ton nach dem andern herunterzusägen, von vier Uhr nachmittags bis fast zur gleichen Stunde am nächsten Morgen, und bekommt dafür sein Drittel von der Gesamteinnahme, die einen Dollar pro Stunde beträgt.
Noch keine fünf Minuten ist das Fest im Gange, da springt Tamoszius Kuszleika vor Erregung auf, und ein, zwei Minuten später sieht man ihn näher an die Tische heransteuern. Seine Nasenflügel sind geweitet, und sein Atem geht schnell – seine Dämonen treiben ihn. Durch Nicken und Kopfschütteln und kurze, ruckartige Bewegungen mit der Geige gibt er seinen Mitspielern Zeichen, bis sich endlich die lange Gestalt des zweiten Geigers ebenfalls erhebt. Am Ende rücken sie alle drei Schritt um Schritt auf die Schmausenden zu, wobei Valentinavyczia, der Cellist, sein Instrument immer zwischen zwei Tönen mit einem Bums weiterstößt. Schließlich sind sie alle drei am Fuß der Tafel angelangt, und hier steigt Tamoszius auf einen Schemel.
Nun ist er in seinem Element und beherrscht die Szene. Manche Gäste sind beim Essen, andere lachen und plaudern, aber weit gefehlt wäre es, wenn man glaubte, es sei auch nur einer unter ihnen, der Tamoszius nicht hörte. Seine Töne sind niemals rein, und seine Fiedel brummt bei den tiefen und kratzt und quietscht bei den hohen Tönen, aber das beachten sie nicht, beachten es ebenso wenig wie den Schmutz, den Lärm und die Schäbigkeit ringsum – das ist nun einmal der Stoff, aus dem sie ihr Leben aufbauen müssen, und so müssen sie damit auch ausdrücken, wie ihnen ums Herz ist. Und dies hier ist ihre Aussage: fröhlich und ungestüm oder traurig und klagend oder leidenschaftlich und rebellisch, diese Musik ist ihre Musik, Musik aus der Heimat. Sie streckt die Arme nach ihnen aus, und sie brauchen sich nur hineinfallen zu lassen. Chicago mit seinen Kneipen und seinen Slums zerrinnt, grüne Wiesen und sonnenflimmernde Flüsse, weite Wälder und schneebedeckte Berge werden sichtbar. Landschaften aus der Heimat und Bilder aus der Kindheit ziehen wieder herauf; alte Liebe und Freundschaft erwacht, vergangene Freuden und Sorgen lachen und weinen wieder. Manche lehnen sich zurück und schließen die Augen, andere trommeln auf dem Tisch. Hin und wieder springt einer auf und bittet durch Zuruf um dieses oder jenes Lied, und dann lodert das Feuer in Tamoszius’ Augen heller, dann reißt er die Fiedel hoch, gibt seinen Gefährten einen Wink, und los gehts in wildem Galopp. Die Gesellschaft greift den Refrain auf, und Männer und Frauen singen, dass es nur so dröhnt. Einige springen auf, stampfen mit den Füßen den Takt, heben die Gläser und trinken einander zu. Nicht lange, so kommt jemand auf den Gedanken, ein altes Hochzeitslied zu fordern, das die Schönheit der Braut und die Freuden der Liebe besingt. In der Begeisterung über dieses Meisterwerk schiebt Tamoszius sich seitwärts zwischen die Tische und bahnt sich einen Weg zum oberen Ende, wo die Braut sitzt. Es ist kein Fußbreit Raum zwischen den Stühlen, und Tamoszius ist so klein, dass er die Gäste mit dem Geigenbogen anstößt, sobald er zu den tiefen Tönen hinübergreift, aber dennoch zwängt er sich dazwischen und besteht erbarmungslos darauf, dass seine Gefährten ihm folgen. Es versteht sich, dass die Klänge des Cellos dabei ziemlich erstickt werden, aber schließlich sind die drei doch am Kopfende angelangt, und Tamoszius fasst zur Rechten der Braut Posten und hebt an, in schmelzenden Weisen sein Herz auszuschütten.
Die kleine Ona kann vor Aufregung nichts essen. Zuweilen kostet sie ein Häppchen, wenn Cousine Marija sie mahnend in den Ellbogen kneift, aber meistens sitzt sie nur da und staunt mit immer gleichem, schüchtern verwundertem Blick. Teta Elzbieta umschwirrt sie wie ein Kolibri, und auch die Schwestern flattern immerfort hinter ihr herum und flüstern ihr atemlos etwas zu. Doch Ona scheint sie kaum zu hören – die Musik lockt und lockt, und ihr Gesicht bekommt wieder den entrückten Ausdruck, wie sie dort sitzt und beide Hände an das Herz presst. Dann steigen ihr die Tränen in die Augen, und weil sie sich schämt, sie abzuwischen, und sich ebenso schämt, sie die Wangen hinunterlaufen zu lassen, wendet sie sich ab, schüttelt ein wenig den Kopf und wird ganz rot, als sie merkt, dass Jurgis sie beobachtet. Als schließlich Tamoszius Kuszleika an ihre Seite tritt und seinen Zauberstab über ihr schwingt, sind Onas Wangen purpurrot, und sie sieht aus, als müsste sie aufspringen und davonlaufen.
In diesem kritischen Moment rettet sie jedoch Marija Berczynskas, die plötzlich von den Musen heimgesucht wird. Marija hat ein Lieblingslied, ein Lied vom Scheiden des Geliebten, das möchte sie gern hören, und da die Musikanten es nicht kennen, ist sie aufgestanden und will es ihnen beibringen. Marija ist klein, aber von kräftiger Statur. Sie arbeitet in einer Konservenfabrik und geht den ganzen Tag mit Büchsen Rindfleisch um, die ihre vierzehn Pfund wiegen. Sie hat ein breites, slawisches Gesicht mit vorstehenden roten Wangen. Als sie den Mund auftut, kommt etwas Tragisches, aber man muss unwillkürlich an ein Pferd denken. Sie trägt eine blaue Hemdbluse aus Flanell, deren Ärmel jetzt aufgekrempelt sind und ihre muskulösen Arme freigeben; in der Hand hält sie eine Tranchiergabel, mit der sie auf dem Tisch den Takt klopft. Bei ihrem dröhnenden Gesangsvortrag – von ihrer Stimme wollen wir weiter nichts sagen, als dass sie jeden Winkel im Saal füllt – begleiten die Musikanten sie mühsam Note für Note, sind aber in der Regel einen Ton zurück, und so quälen sie sich Strophe um Strophe durch die Klage eines liebeskranken Schäfers:
»Sudiev’ kvietkeli, tu brangiausis;
Sudiev’ ir laime, man biednam,
Matau – paskyre teip Aukszcziausis,
Jog vargt ant svieto reik vienam!«
Als das Lied verklungen ist, wird es Zeit für die Rede, und der alte Dede Antanas erhebt sich. Großvater Anthony, Jurgis’ Vater, ist noch nicht älter als 60, aber man könnte ihn für 80 halten. Er ist erst seit sechs Monaten in Amerika, und die Umstellung ist ihm nicht gut bekommen. In seinen besten Jahren arbeitete er in einer Baumwollfabrik, aber dann bekam er den Husten und musste aufhören; draußen auf dem Land wurde er gesund, aber jetzt arbeitet er bei Durham im Pökelraum, und da er dort den ganzen Tag kalte, feuchte Luft atmet, ist das Leiden wiedergekommen. Als er nun aufsteht, überkommt ihn ein Hustenanfall, und er hält sich am Stuhl fest und wendet das blasse, ausgezehrte Gesicht ab, bis der Anfall vorüber ist.
Im Allgemeinen ist es bei einer Veselija Brauch, die Rede aus einem Buch auszusuchen und auswendig zu lernen; doch Dede Antanas war in seiner Jugend ein heller Kopf und hat wahrhaftig die Liebesbriefe für alle seine Freunde entworfen. Daher weiß man, dass auch die Glück‑ und Segensrede von ihm ganz persönlich verfasst ist, und sie ist einer der Höhepunkte des Tages. Sogar die Jungen, die im Saal herumtoben, kommen näher und lauschen, und unter den Frauen schluchzen einige und wischen sich mit der Schürze die Augen. Es wird sehr feierlich, denn Antanas Rudkus ist von dem Gedanken besessen, dass er nicht mehr lange bei seinen Kindern weilen wird. Seine Rede rührt alle derart zu Tränen, dass einer der Gäste, Jokubas Szedvilas, der in der Halsted Street einen Delikatessenladen hat und dick und robust ist, sich bewogen fühlt, aufzustehen und zu sagen, so schlimm sei es denn doch wohl nicht; und dann hält er selber eine kleine Rede, in der er Braut und Bräutigam mit Segenswünschen und Glücksverheißungen nur so überhäuft und sich auf Einzelheiten einlässt, die zwar den jungen Männern sehr gefallen, Ona aber heftiger denn je erröten lassen. Jokubas besitzt, was seine Frau wohlgefällig »poetiszka vaidintuve« nennt – eine poetische Ader.
Die meisten Gäste sind jetzt satt, und da auf Förmlichkeit kein Wert gelegt wird, beginnt die Festtafel sich aufzulösen. Von den Männern versammeln sich einige an der Bar, andere schlendern lachend und singend umher; hier und dort bildet sich ein Grüppchen und stimmt in bester Laune ein Lied an, völlig unbekümmert um die andern und um die Musikanten. Alle sind sie mehr oder minder ruhelos – man könnte meinen, sie hätten etwas auf dem Herzen. Und so ist es denn auch. Kaum dass die letzten säumigen Esser ihre Teller leeren dürfen, werden auch schon die Tische samt den Resten in die Ecke geschoben, die Stühle und die Babys aus dem Wege geräumt, und es beginnt die eigentliche Feier des Abends. Tamoszius Kuszleika hat sich mit einer Kanne Bier wieder aufgefrischt und kehrt zu seinem Podium zurück, wo er, hoch aufgerichtet, die Lage prüft. Gebieterisch klopft er an seine Geige, klemmt sie dann sorgsam unters Kinn, holt schwungvoll mit dem Bogen aus, reißt ihn schließlich über die klingenden Saiten, schließt die Augen und entschwebt im Geiste auf den Schwingen eines verträumten Walzers. Sein Gefährte schließt sich an, jedoch mit offenen Augen – er passt sozusagen auf, wohin er tritt, und am Ende hebt auch Valentinavyczia, nachdem er noch ein wenig gezögert und mit dem Fuß den Takt gesucht hat, die Augen zur Decke und beginnt zu sägen: Schrumm! Schrumm! Schrumm!
Schnell ordnet die Gesellschaft sich zu Paaren, und bald ist der ganze Saal in Bewegung. Augenscheinlich weiß niemand, wie man Walzer tanzt, aber das spielt keine Rolle – es ist Musik da, und so tanzen sie eben, jeder, wie es ihm gefällt, geradeso, wie sie vorher gesungen haben. Die meisten haben eine Vorliebe für den Twostep, besonders die jungen Leute, bei denen er in Mode ist. Die Älteren haben noch ihre Tänze aus der Heimat, wunderliche, kunstvolle Figuren, die sie mit würdiger Feierlichkeit ausführen. Manche tanzen überhaupt nichts Bestimmtes, sondern halten sich einfach bei den Händen und überlassen ihren Füßen den Ausdruck ungezügelter Freude an der Bewegung. So machen es zum Beispiel Jokubas Szedvilas und seine Frau Lucija – die beiden mit dem Delikatessenladen, die selbst fast ebenso viel verbrauchen, wie sie verkaufen; zum Tanzen sind sie zu dick, aber sie stehen mitten auf der Tanzfläche, halten sich eng umschlungen, schaukeln langsam von einer Seite zur andern und strahlen wie Posaunenengel – ein Bild zahnloser, schweißtriefender Verzückung.
Von diesen älteren Jahrgängen haben viele an ihrer Kleidung irgendetwas, was an die Heimat erinnert – gestickte Westen oder Mieder, ein buntes Tuch, eine Jacke mit gewaltigen Ärmelaufschlägen und prunkvollen Zierknöpfen. Die Jüngeren vermeiden dergleichen sorgfältig; sie haben größtenteils Englisch gelernt und kleiden sich nach der neuesten Mode. Die Mädchen tragen Konfektionskleider oder Hemdblusen, und manche sehen sehr hübsch aus. Von den jungen Männern könnten manche für Amerikaner gelten, etwa für Büroangestellte, bis auf ihre Gewohnheit, im Zimmer den Hut aufzubehalten. Jedes der jüngeren Paare hat seinen eigenen Tanzstil. Manche halten sich eng umschlungen, andere wahren vorsichtig Abstand. Manche halten die Arme steif vom Körper, andere lassen sie lässig herunterhängen. Manche tanzen hüpfend, manche sanft gleitend, wieder andere schreiten mit gemessener Würde. Es sind ausgelassene Paare da, die wild im Saal umhersausen und dabei jeden aus dem Wege fegen. Es sind nervöse Paare da, die das sehr erschreckt und die »Nustokl Kas yra?« rufen, wenn die anderen an ihnen vorüberstieben. Die Paare bleiben den ganzen Abend zusammen, man sieht sie niemals die Partner wechseln. Alena Jasaityte zum Beispiel tanzt schon stundenlang mit Juozas Raezius, mit dem sie verlobt ist. Alena ist die Schönheit des Abends, und sie wäre sogar tatsächlich schön, wenn sie nicht so stolz wäre. Sie trägt eine weiße Hemdbluse, die sie wohl eine halbe Woche Arbeit als Anstreicherin von Büchsen gekostet haben dürfte. Ihren Rock hält sie beim Tanzen untadelig korrekt mit der Hand gerafft, ganz wie eine große Dame. Juozas ist Rollwagenkutscher bei Durham und verdient gutes Geld. Er möchte gern verwegen aussehen, hat den Hut schief auf eine Seite geklemmt und behält den ganzen Abend eine Zigarette im Mund. Dann ist da Jadvyga Marcinkus, die gleichfalls schön ist, aber bescheiden. Auch Jadvyga streicht Konservenbüchsen an, doch sie hat eine gebrechliche Mutter und drei kleine Schwestern zu versorgen, und darum gibt sie ihr Geld nicht für Hemdblusen aus. Jadvyga ist klein und zart, hat pechschwarze Augen und pechschwarzes Haar, das sie in einem kleinen Knoten auf dem Kopf festgesteckt hat. Sie trägt ein altes weißes Kleid, das sie sich selbst genäht hat und seit fünf Jahren zu jeder Festlichkeit anzieht; die Taille ist hoch angesetzt – fast unter der Achsel und nicht sehr kleidsam, aber das macht Jadvyga nichts aus, denn sie tanzt mit ihrem Mikolas. Sie ist klein, er ist groß und kräftig; sie schmiegt sich in seine Arme, als ob sie sich vor den Blicken der andern verstecken wollte, und lehnt den Kopf an seine Schulter. Er dagegen hält sie fest umschlungen, als ob er sie wegtragen wollte; und so tanzt sie, wird sie die ganze Nacht tanzen, und wenn es nach ihr ginge, würde sie in seligem Entzücken weitertanzen bis in alle Ewigkeit. Wer die beiden sieht, muss vielleicht lächeln; aber das Lächeln würde ihm vergehen, wüsste er die Vorgeschichte. Es ist jetzt schon das fünfte Jahr, dass Jadvyga mit Mikolas verlobt ist, und ihr Herz ist schwer. Sie hätten am liebsten gleich geheiratet, aber Mikolas hat einen Vater, der trinkt, und ist, von ihm abgesehen, der einzige Mann in einer großen Familie. Trotzdem hätten sie es vielleicht geschafft, denn Mikolas ist Facharbeiter – wären nicht schwere Unglücksfälle dazwischengekommen, die ihnen beinahe alle Hoffnung genommen haben. Mikolas ist Knochenausschäler, und das ist ein gefährliches Handwerk, besonders wenn man im Akkord arbeitet und die Aussteuer zum Heiraten verdienen möchte. Die Hände sind glitschig, das Messer ist glitschig, du schuftest wie verrückt, und plötzlich redet dich einer an, oder du triffst auf einen Knochen. Dann rutscht dir die Hand ab ins Messer, und es gibt eine klaffende Wunde. Das kann an sich ganz harmlos sein, aber das Schlimme dabei ist die tödliche Infektionsgefahr. Es mag sein, dass der Schnitt wieder heilt, aber man kann nie wissen. Zweimal in den letzten drei Jahren hat Mikolas mit Blutvergiftung zu Hause gelegen – einmal drei und einmal fast sieben Monate lang. Das letzte Mal verlor er auch noch seine Arbeitsstelle, und das bedeutete, weitere sechs Wochen vor den Toren der Konservenfabrik herumzustehen, im kalten Winter um sechs Uhr früh, und der Schnee lag fußhoch auf der Straße, und noch mehr Schnee lag in der Luft. Es gibt kluge Leute, die können einem anhand der Statistik sagen, dass ein Ausschäler 40 Cent in der Stunde verdient, aber diese Leute haben sich wahrscheinlich noch nie die Hände eines Ausschälers angesehen.
Wenn Tamoszius und seine Gefährten hin und wieder notgedrungen eine Ruhepause einlegen müssen, rühren die Tanzpaare sich nicht vom Fleck und warten geduldig. Sie werden anscheinend überhaupt nicht müde, und wenn sie müde würden, so wäre doch zum Hinsetzen kein Platz. Es dauert sowieso höchstens eine Minute, denn dann macht der Kapellmeister wieder weiter, auch wenn die beiden andern noch so sehr protestieren. Diesmal spielt er etwas ganz anderes, und zwar einen litauischen Tanz. Ein paar Freunde des Twosteps bleiben bei ihrem Schritt, aber die meisten vollführen eine Reihe komplizierter Bewegungen, die eher an Eiskunstlauf erinnern. Höhepunkt ist ein furioses Prestissimo, bei dem die Paare sich an den Händen fassen und wie toll herumwirbeln. Das ist ganz unwiderstehlich, und alle machen mit, bis der Saal ein einziges Gewirr fliegender Röcke und Leiber ist, dass einem schon vom Zuschauen schwindlig wird. Die größte Augenweide aber ist in diesem Moment Tamoszius Kuszleika. Die alte Fiedel quietscht und kreischt Protest, doch Tamoszius kennt keine Gnade. Der Schweiß tritt ihm auf die Stirn, und er beugt sich vornüber wie ein Radrennfahrer in der letzten Runde. Sein Körper bebt und schüttert wie eine durchgegangene Dampflokomotive, und das Ohr kann dem fliehenden Schwall von Tönen nicht mehr folgen. Wo man seinen bogenführenden Arm vermutet, ist nur ein blassblauer Nebel. Mit einem ganz erstaunlichen Lauf kommt er zum Abschluss der Melodie, wirft die Hände hoch und taumelt erschöpft zurück, und mit einem letzten Schrei des Entzückens fliegen die Tänzer auseinander, wirbeln hierhin und dorthin und kommen an der Wand zum Stillstand.
Hiernach gibt es Bier für alle, auch für die Musik, und die Zecher verschnaufen und bereiten sich auf die Acziavimas vor, das große Ereignis des Abends. Die Acziavimas ist eine Zeremonie, die, hat sie erst einmal angefangen, nicht vor drei, vier Stunden zu Ende ist und bei der pausenlos getanzt wird. Die Gäste bilden einen großen Ring, fassen sich an den Händen, und mit dem Aufklingen der Musik bewegen sie sich rundherum im Kreis. In der Mitte steht die Braut, und die Männer treten einer nach dem andern zu ihr in den Kreis und tanzen mit ihr. Jeder tanzt mit ihr mehrere Minuten – solange er mag. Es geht sehr fröhlich zu, man lacht, und man singt, und wenn dann der Gast die Braut freigibt, findet er sich Teta Elzbieta gegenüber, die ihm den Hut hinhält. Dahinein wirft er Geld, einen Dollar oder vielleicht auch fünf, je nach Vermögen und je nachdem, wie viel die Ehre ihm wert ist. Es ist Brauch, dass der Gast für dieses Vergnügen bezahlt, und rechtschaffene Gäste werden dafür sorgen, dass Braut und Bräutigam eine hübsche Summe übrig behalten, mit der sie ihr neues Leben anfangen können.
Himmelangst kann einem werden, wenn man daran denkt, was diese Feier kostet. Es werden bestimmt über 200 Dollar sein, vielleicht sogar 300, und 300 Dollar sind für manchen der Anwesenden mehr als ein Jahresverdienst. Es sind kräftige Männer hier, die vom frühen Morgen bis in die späte Nacht in eiskalten Kellern arbeiten, wo das Wasser zentimeterhoch steht – Männer, die sechs bis sieben Monate im Jahr vom Sonntagnachmittag bis zum nächsten Sonntagmorgen die Sonne nicht zu Gesicht bekommen – und die dennoch keine 300 Dollar im Jahr zusammenbringen können. Es sind Kinder hier, die gerade zwölf und kaum groß genug sind, um auf die Werkbank blicken zu können, Kinder, deren Eltern gelogen haben, um ihnen einen Arbeitsplatz zu verschaffen – und die nicht die Hälfte von 300 Dollar im Jahr verdienen, ja, vielleicht noch nicht ein Drittel davon. Und dann eine derartige Summe auf einmal auszugeben, an einem einzigen Tag des Lebens, auf einer Hochzeitsfeier? (Denn offensichtlich kommt es aufs Gleiche hinaus, ob man diese Summe auf einen Schlag für die eigene Hochzeit ausgibt oder nach und nach auf den Hochzeitsfeiern seiner Freunde.)
Es ist sehr unklug, es ist tragisch – doch ach, es ist so schön? Alles andere haben diese armen Menschen Stück um Stück aufgeben müssen, aber hieran hängen sie mit allen Fasern ihres Herzens – auf die Veselija können sie nicht verzichten? Denn das hieße nicht nur geschlagen werden, sondern sich geschlagen geben, und gerade der Unterschied zwischen beidem hält ja die Welt in Gang. Die Veselija ist ihnen aus alten Zeiten überkommen, und was sie bedeutet, ist dies: Der Mensch mag wohl in der Höhle sitzen und auf die Schatten starren, wenn er nur ein einziges Mal im Leben seine Ketten zerreißen, seine Schwingen rühren und die Sonne sehen kann; wenn er nur ein einziges Mal im Leben Zeugnis ablegen kann, dass das Leben mit all seinen Nöten und Ängsten doch nicht so wichtig ist, sondern nur eine Luftblase auf den Fluten eines Stroms, ein Etwas, mit dem man Fangeball spielen kann wie ein Jongleur mit seinen goldenen Kugeln, etwas, was sich schlürfen lässt wie ein Pokal edlen Rotweins. Wer sich in dieser Weise einmal als Herr des Daseins gefühlt hat, der kann zurückkehren in die Tretmühle und ein Leben lang von der Erinnerung zehren.
Unaufhörlich drehten sich die Paare im Kreise – und überkam sie der Schwindel, so drehten sie sich andersherum. Stunde um Stunde ging das nun schon – die Dunkelheit war hereingebrochen, und zwei blakende Petroleumlampen tauchten den Raum in trübes Licht. Die Musikanten hatten mit der Zeit all ihren Schwung verloren und spielten nur noch eine einzige Melodie, müde und abgekämpft. An die 20 Takte waren es, und wenn sie damit fertig waren, fingen sie wieder von vorn an. Etwa alle zehn Minuten setzten sie ab und ließen sich erschöpft zurückfallen, worauf es unweigerlich zu einer peinlichen, stürmischen Szene kam, die den dicken Polizisten auf seinem Schlummerplätzchen hinter der Tür beunruhigt hochfahren ließ.
Es war jedes Mal Marija Berczynskas. Marija gehörte zu den nimmersatten Seelen, die sich verzweifelt an die Röcke der fliehenden Muse klammern. Den ganzen Tag über war sie in wunderbarer Hochstimmung gewesen; jetzt drohte diese Stimmung zu verfliegen, doch Marija wollte sie festhalten. Ihr Herz rief mit den Worten Fausts: »Verweile doch, du bist so schön!« Ob es nun vom Bier kam, von den lärmenden Stimmen, von der Musik oder vom Herumwirbeln – sie meinte, sie dürfte das Hochgefühl nicht loslassen. So jagte sie ihm denn immer von Neuem nach – aber sobald sie nur halbwegs in Fahrt geriet, wurde sozusagen ihr Sonnenwagen wieder aus der Bahn geschleudert durch die Beschränktheit dieser dreimal verfluchten Musikanten. Jedes Mal stieß Marija ein Wutgeheul aus und fuhr auf sie los, fuchtelte ihnen mit den Fäusten vor dem Gesicht herum und stampfte auf den Boden, puterrot und stammelnd vor Zorn. Vergebens setzte dann der eingeschüchterte Tamoszius zum Sprechen an, um die Schwachheit des Fleisches geltend zu machen, vergebens redete der schnaufende und atemlose Ponas Jokubas auf sie ein, vergebens verlegte Teta Elzbieta sich aufs Bitten. »Szalin!«, kreischte Marija. »Palauk! isz kelio! Wofür bekommt ihr denn euer Geld, ihr Himmelhunde?« Und alsbald spielte die Musik aus purer Angst von Neuem auf, und Marija ging an ihren Platz zurück und machte sich wieder ans Werk.
Die Festesbürde trug jetzt sie allein. Ona blieb zwar durch ihre Aufregung wach, aber sämtliche Frauen und die meisten Männer waren müde – nur Marijas Seele war noch unbesiegt. Sie hielt die Tanzenden in Bewegung – was ursprünglich ein Kreis gewesen war, hatte jetzt die Form einer Birne mit Marija am Stiel; sie zog an einem Ende, schob am andern, rief, stampfte, sang: ein richtiger Vulkan an Energie. Hin und wieder ließ jemand beim Hereinkommen oder Hinausgehen die Tür offen, und die Nachtluft war kühl; im Vorbeitanzen gab dann Marija dem Türgriff einen gekonnten Fußtritt, und bauz!, war die Tür zu. Einmal war dieses Verfahren die Ursache für einen Zwischenfall, dessen unglückliches Opfer Sebastijonas Szedvilas wurde. Der kleine Sebastijonas, drei Jahre alt, war weltvergessen umhergewandert, am Mund – mit der Öffnung nach unten – eine Flasche des Getränks, das sich »Pop« nannte: bonbonfarben, eiskalt und köstlich. Als er gerade durch die Tür wollte, traf sie ihn voll, und das anschließende Gebrüll brachte den Tanz zum Stocken. Manija, die hundertmal am Tage die abscheulichsten Morddrohungen ausstieß und doch keiner Fliege etwas zuleide tun konnte, nahm den kleinen Sebastijonas in die Arme und war drauf und dran, ihn mit ihren Küssen zu ersticken. Die Kapelle durfte ausgiebig Pause machen und sich stärken, während Marija mit ihrem Opfer Frieden schloss, wozu sie den Kleinen auf die Bar setzte, sich neben ihn stellte und ihm einen schäumenden Humpen Bier an die Lippen hielt.
Währenddessen kam es in einer anderen Ecke des Saals zwischen Teta Elzbieta, Dede Antanas und einigen engeren Freunden der Familie zu einer besorgten Unterredung. Es gab Anlass zu Ärger. Die Veselija ist ein Vertrag, ein Vertrag, der zwar unausgesprochen, aber ebendeshalb umso verbindlicher ist. Der Anteil eines jeden war unterschiedlich – doch jeder wusste ganz genau, was sein Anteil war, und gab sich Mühe, noch ein bisschen darüber hinauszugehen. Jetzt aber, seit sie in das neue Land gekommen waren, hatte das alles plötzlich keinen Bestand mehr. Als ob man hier mit der Luft ein schleichendes Gift einatmete, waren alle jungen Männer auf einmal davon angesteckt. Sie kamen in Scharen, stopften sich voll mit gutem Essen, und dann machten sie sich aus dem Staub. Einer warf den Hut eines andern aus dem Fenster, beide gingen hinaus, um ihn wiederzuholen, und keiner ward mehr gesehen. Oder bisweilen rottete sich gleich ein halbes Dutzend zusammen und marschierte geschlossen ab, wobei sie einen auch noch frech anstarrten und sich unverhohlen über einen lustig machten. Andere wieder trieben es noch schlimmer: Sie belagerten die Bar und ließen sich auf Kosten des Gastgebers volllaufen, ohne einen Menschen zu beachten; sie taten so, als hätten sie schon mit der Braut getanzt oder wollten es später noch tun.
Dergleichen spielte sich jetzt gerade ab, und die Familie war vor Bestürzung ratlos. So lange hatten sie sich abgeplagt, so große Auslagen hatten sie gehabt! Ona stand dabei, die Augen vor Schreck geweitet. Diese furchtbaren Rechnungen – wie sie sie verfolgt hatten, wie jeder einzelne Posten ihr bei Tage das Herz schwer gemacht und bei Nacht die Ruhe geraubt hatte! Wie oft hatte sie auf dem Weg zur Arbeit alle aufgezählt und durchgerechnet – 15 Dollar für den Saal, 22 ¼ Dollar für die Enten, zwölf Dollar für die Musik, fünf Dollar die Kirche und dazu noch ein Segen der Jungfrau Maria extra und so weiter ohne Ende! Die schlimmste Rechnung von allen stand noch aus, nämlich die für Bier und Schnaps von Graiczunas. Auf mehr als eine Schätzung ließ sich ein Kneipenwirt im Voraus niemals ein, und hinterher kam er dann kopfkratzend an und sagte, die Schätzung sei zu niedrig gewesen, doch sei das nicht seine Schuld – die Gäste hätten sich gar zu sehr betrunken. Bei ihm durfte man gewiss sein, unbarmherzig übers Ohr gehauen zu werden, selbst wenn man sich einbildete, man wäre der beste seiner unzähligen Freunde. Das erste Fass, aus dem er den Gästen Bier einschenkte, war bestimmt schon vorher halb leer, und das letzte Fass blieb am Ende halb voll; berechnet wurden jedoch zwei volle Fässer. Er verpflichtete sich, eine festgelegte Sorte zu einem festgelegten Preis auszuschenken, und wenn es dann so weit war, trank man mit seinen Freunden doch ein fürchterliches Gesöff, das einfach nicht zu beschreiben war. Man konnte sich zwar beschweren, aber dabei wäre doch weiter nichts herausgekommen als ein verdorbener Abend: und was eine Klage vor Gericht anbelangte, hätte man sich ebenso gut gleich an den Himmel wenden können. Der Kneipenwirt stand mit allen einflussreichen Männern seines Bezirks auf gutem Fuß, und wer erst einmal erfahren hatte, was es hieß, sich mit solchen Leuten anzulegen, der war klug genug, zu zahlen, was verlangt wurde, und den Mund zu halten.
Was die ganze Sache noch peinlicher machte, war, dass es die wenigen, die wirklich ihr Möglichstes getan hatten, besonders hart traf. Da war zum Beispiel der arme alte Ponas Jokubas: Er hatte bereits fünf Dollar gegeben – und wussten nicht alle, dass Jokubas Szedvilas gerade auf seinen Delikatessenladen eine 200‑Dollar‑Hypothek aufgenommen hatte, um die überfällige Miete für mehrere Monate zahlen zu können? Und dann die verschrumpelte alte Poni Aniele – eine Witwe mit drei Kindern und Rheumatismus obendrein, die für die Geschäftsleute in der Haisted Street gegen ein mitleiderregend niedriges Entgelt die Wäsche wusch – Aniele hatte alles gegeben, was ihr ihre Hühner über Monate eingebracht hatten. Sie besaß deren acht, und sie hielt sie in einem Bretterverschlag auf der Hintertreppe. Täglich stöberten Anieles Kinder von früh bis spät auf der Müllkippe nach Futter für diese Hühner, und war dort die Konkurrenz zu stark, konnte man sie in der Haisted Street den Rinnstein absuchen sehen, die Mutter als Schutz hinter sich, damit ihnen niemand das Gefundene wieder abnehmen konnte. In Geldeswert waren für die alte Frau Jukniene diese Hühner gar nicht zu messen – sie wertete sie anders, denn sie gaben ihr das Gefühl, sie bekäme durch sie etwas »für umsonst« und könne hier einmal einer Welt ein Schnippchen schlagen, der sie in anderer Hinsicht so oft unterlag. So bewachte sie die Hühner jede Stunde des Tages und hatte gelernt, in der Nacht zu sehen wie eine Eule, um sie auch dann noch zu bewachen. Eins war ihr vor langer Zeit einmal gestohlen worden, und es verging kein Monat, ohne dass jemand versuchte, ein weiteres zu stehlen. Wollte man solch einen Versuch vereiteln, musste man jeden falschen Alarm in Kauf nehmen. Daraus lässt sich ermessen, welches Opfer die alte Frau Jukniene brachte, und das nur, weil Teta Elzbieta ihr einmal auf ein paar Tage Geld geliehen und sie davor bewahrt hatte, aus ihrem Haus vertrieben zu werden.
Immer mehr Freunde traten hinzu und hörten die Klagen über die schlimme Situation mit an. Es kamen sogar einige Neugierige zuhören, die selbst zu den Schuldigen zählten, und das konnte wirklich die Geduld eines Heiligen auf die Probe stellen. Schließlich kam auch Jurgis, den irgendjemand geholt hatte, und ihm wurde die Geschichte noch einmal berichtet. Jurgis, die großen schwarzen Brauen zusammengezogen, hörte schweigend zu. Ab und zu blitzten seine Augen auf, und er warf einen schnellen Blick auf den Saal. Vielleicht wäre er gern auf ein paar von diesen Burschen mit seinen großen geballten Fäusten losgegangen, aber er war sich bestimmt auch im Klaren, wie wenig ihm das nützen würde. Die Rechnungen würden dadurch nicht kleiner werden, dass er jetzt noch jemand an die Luft setzte, und einen Skandal würde es außerdem geben. Dabei wollte Jurgis jetzt nichts weiter als mit Ona verschwinden und die Welt Welt sein lassen. So öffneten sich seine Fäuste wieder, und er sagte bloß ruhig: »Es ist nicht mehr zu ändern, und das Weinen hat auch keinen Zweck, Teta Elzbieta.« Dann suchten seine Augen Ona, die dicht neben ihm stand, und er sah ihren schreckgeweiteten Blick. »Kleines«, sagte er mit leiser Stimme, »mach dir keine Sorgen. Es ist nicht so schlimm. Irgendwie werden wir sie schon alle bezahlen. Ich werde eben noch mehr arbeiten!« Das sagte Jurgis immer. Ona hatte sich schon daran gewöhnt als an den Ausweg aus allen Schwierigkeiten: »Ich werde eben noch mehr arbeiten!« Das hatte er in Litauen gesagt, als ein Beamter ihm den Pass abgenommen und ein anderer ihn dann eingesperrt hatte, weil er keinen Pass besaß, und die beiden zusammen ihn ein Drittel seiner Habe gekostet hatten. Das nächste Mal hatte er es in New York gesagt, als so ein glattzüngiger Agent sich ihrer angenommen und dann eine enorme Summe dafür verlangt hatte und sie fast nicht wieder fortlassen wollte, obwohl sie ihn bezahlt hatten. Jetzt sagte er es zum dritten Mal, und Ona atmete tief auf; es war doch großartig, einen Ehemann zu haben, ganz wie eine richtige erwachsene Frau, noch dazu einen, der alle Probleme lösen konnte und der so groß und stark war!
Der letzte Schluchzer des kleinen Sebastijonas ist beschwichtigt und die Musik wieder an ihre Pflichten erinnert worden. Die Zeremonie geht weiter – aber es sind nur noch wenige Tänzer übrig, und so findet auch die Geldsammlung bald ein Ende. Der Gemeinschaftstanz ist vorüber, man tanzt wieder in Paaren. Unterdessen jedoch ist Mitternacht vorbei, und die Szene hat sich gewandelt. Die Tanzenden bewegen sich langsam und schwerfällig – die meisten haben tüchtig getrunken, und das Stadium der Beschwingtheit liegt längst hinter ihnen. Sie tanzen in monotonem Rhythmus, Runde um Runde, Stunde um Stunde, die Augen ins Leere gerichtet, als seien sie nur halb bei Bewusstsein und erstarrten mehr und mehr. Die Männer umklammern die Frauen sehr fest, aber es kommt vor, dass sie eine halbe Stunde miteinander tanzen, ohne dass einer den andern ansieht. Einige Paare mögen nicht mehr tanzen; sie haben sich in die Ecken zurückgezogen, wo sie eng umschlungen sitzen. Andere, die noch mehr getrunken haben, torkeln im Saal umher und stoßen überall an. Manche sind zu zweit oder zu dritt und singen: jede Gruppe ihr eigenes Lied. Mit vorgerückter Stunde entwickeln sich die verschiedensten Arten von Trunkenheit, vor allem unter den jüngeren Männern. Ein paar schwanken Arm in Arm umher und flüstern rührseliges Zeug; andere fangen beim kleinsten Anlass Streit an, werden handgemein und müssen auseinandergerissen werden. Der dicke Polizist wird jetzt endgültig wach und tastet nach seinem Knüppel, um sich zu vergewissern, dass der einsatzbereit ist. Er muss rasch sein, denn wenn solche Schlägereien gegen zwei Uhr morgens erst einmal außer Kontrolle geraten, sind sie wie ein Waldbrand, und das kann Alarm für die ganze Polizeiwache bedeuten. Es gilt jetzt, jedem Kampfhahn, den man gewahr wird, sofort eins über den Schädel zu schlagen, ehe der Kampfhähne so viele werden, dass man ihrer nicht mehr Herr werden kann. Um angeschlagene Schädel wird in dieser Gegend hinter den Schlachthöfen nicht viel Aufhebens gemacht, denn Männer, die tagaus, tagein dem Vieh eins über den Schädel schlagen müssen, scheinen sich an so etwas zu gewöhnen und wenden die Praxis gelegentlich auch bei ihren Freunden oder sogar bei der eigenen Familie an. Wir haben daher allen Grund, uns zu gratulieren, dass dank unseren modernen Methoden einige wenige Männer das schmerzhafte, aber notwendige Geschäft des Schädeleinschlagens für die gesamte zivilisierte Welt erledigen können.
In dieser Nacht gibt es keine Schlägerei – vielleicht weil Jurgis ebenfalls aufpasst: sogar noch aufmerksamer als der Polizist. Jurgis hat eine ganze Menge getrunken, wie wohl jeder bei solchem Anlass, wo ohnehin alles bezahlt werden muss, einerlei, ob es genossen wird oder nicht; aber er ist ein sehr ausgeglichener Mensch und verliert nicht so leicht die Selbstbeherrschung. Nur einmal kommt es um ein Haar zu einer Prügelei, und daran ist Marija Berczynskas schuld. Marija ist offensichtlich vor etwa zwei Stunden zu folgendem Schluss gekommen: Auch wenn der Altar in der Ecke mit dem Genius in nicht ganz reinem Weiß die wahre Stätte der Musen nicht ist, so ist er doch jedenfalls der beste Ersatz dafür, der auf Erden erreichbar ist. Und Marija drängt der Rausch zu Taten, als ihr die Geschichte von den Halunken zu Ohren kommt, die sich diese Nacht ums Zahlen gedrückt haben. Spornstreichs begibt sie sich auf den Kriegspfad, nimmt sich nicht einmal die Zeit für einen guten einleitenden Fluch, und als man sie endlich bändigt, hat sie die Rockkragen von zwei Halunken noch in den Fäusten. Zum Glück ist der Polizist Vernunftgründen zugänglich, und so ist es nicht Marija, die hinausgeworfen wird.
Die Musik wird durch den Zwischenfall nur für kurze Zeit unterbrochen. Dann setzt die erbarmungslose Melodie von Neuem ein – dieselbe Melodie, die schon in der vergangenen halben Stunde ohne einen einzigen Wechsel gespielt worden ist. Diesmal ist es ein amerikanisches Lied, eins, das sie auf der Straße aufgeschnappt haben; den Text kennen anscheinend alle – oder zumindest die erste Zeile davon, die sie immer wieder unermüdlich vor sich hinsummen: »In der guten alten Sommerzeit – in der guten alten Sommerzeit! In der guten alten Sommerzeit – in der guten alten Sommerzeit!« Etwas Hypnotisches scheint von dieser Melodie mit der sich endlos wiederholenden Dominante auszugehen. Sie hat jeden betäubt, der sie anhört, und auch die Männer, die sie spielen. Keiner kann von ihr loskommen; er kann nicht einmal daran denken, von ihr loszukommen. Es ist drei Uhr morgens, und sie haben all ihre Freude aus sich herausgetanzt, all ihre Kraft aus sich herausgetanzt, auch die Kraft, die übermäßiges Trinken dem Menschen zu verleihen vermag, und trotzdem kann sich keiner aufraffen, ans Schlussmachen zu denken. Pünktlich um sieben Uhr an diesem selben Montagmorgen werden alle an ihrem Arbeitsplatz bei Durham, Brown oder Jones sein müssen, jeder in seiner Arbeitskleidung. Kommt einer von ihnen auch nur eine Minute zu spät, wird ihm eine Stunde Lohn abgezogen, und kommt er mehrere Minuten zu spät, wird er wahrscheinlich seine Messingmarke zur Wand gekehrt vorfinden. Das bedeutet: Er ist entlassen und kann sich der hungrigen Meute draußen anschließen, die jeden Morgen von sechs bis halb neun Uhr vor den Fabriktoren nach Arbeit ansteht. Es gibt keine Ausnahme von dieser Regel, nicht einmal für die kleine Ona, die um einen freien Tag nach ihrer Hochzeit gebeten hat – um einen unbezahlten freien Tag – und abgewiesen worden ist. Wenn so viele sich darum reißen, auf jede Arbeitsbedingung einzugehen, besteht kein Anlass, sich mit denen abzugeben, die Extrawünsche äußern.
Die kleine Ona ist nahe daran, ohnmächtig zu werden, auch sie ist fast betäubt – durch den schweren Dunst im Saal. Sie hat nicht einen Tropfen getrunken, aber alle Übrigen hier verbrennen förmlich Alkohol, so, wie die Lampen Petroleum verbrennen; ein paar auf dem Stuhl oder dem Fußboden fest eingeschlafene Männer verbreiten einen solchen Alkoholdunst, dass man ihnen nicht nahe kommen kann. Hin und wieder schaut Jurgis Ona hungrig an – er hat längst seine Scheu verloren, aber immerhin sind da die vielen Leute, und er wartet lieber noch und sieht nach der Tür, denn es ist eine Kutsche bestellt. Die Kutsche kommt nicht, und schließlich hält es Jurgis nicht länger aus und geht hinüber zu Ona, die weiß wird und zittert. Er legt ihr ihren Schal um und dann seine eigene Jacke. Sie wohnen nur zwei Querstraßen weiter, und Jurgis pfeift auf die Kutsche.
Ein Abschied ist fast nicht nötig – die Tanzpaare schenken ihnen keine Beachtung, und alle Kinder und die meisten älteren Leute sind vor purer Erschöpfung eingeschlafen. Dede Antanas schläft und ebenso die beiden Szedvils, Mann und Frau, wobei der Mann in Oktaven schnarcht. Nur Teta Elzbieta ist noch da und Marija, die laut schluchzt, und dann ist nur noch schweigende Nacht um sie her mit Sternen, die im Osten schon ein wenig fahl werden. Ohne ein Wort nimmt Jurgis Ona auf seine Arme und schreitet tüchtig aus, und sie lässt mit einem Seufzer den Kopf auf seine Schulter sinken. Als er zu Hause ankommt, ist er nicht sicher, ob sie ohnmächtig ist oder nur schläft, aber als er sie mit einem Arm halten muss, während er die Tür aufschließt, sieht er, dass sie die Augen geöffnet hat.
»Du gehst heute nicht zu Brown, Kleines«, flüstert er, als er mit ihr die Treppe hinaufsteigt, und sie packt erschrocken seinen Arm und stößt hervor: »Nein, nein! Ich trau mich nicht! Es wird uns alles verderben.«
Aber er antwortet wieder: »Überlass das mir, überlass das nur mir. Ich werde eben mehr Geld verdienen – ich werde noch mehr arbeiten!«
2. Kapitel
Jurgis sprach unbekümmert von der Arbeit, denn er war jung. Wenn man ihm erzählte, wie Männer in den Schlachthäusern von Chicago zusammengebrochen waren und was später aus ihnen geworden war – Geschichten, bei denen es einem kalt über den Rücken laufen konnte –, lachte Jurgis nur. Er war ja erst seit vier Monaten dabei, und er war jung und außerdem ein wahrer Hüne. Er war viel zu gesund; er konnte sich nicht einmal vorstellen, wie das wäre, wenn man erledigt war. »Bei euch mag das schon sein«, sagte er, »ihr Silpnas, ihr halben Portionen – aber ich habe ein breites Kreuz.« Jurgis war wie ein Junge, ein Junge vom Lande. Er war der Typ, den die Bosse sich wünschen, der Typ, nach dem sie jammern, wenn sie ihn nicht bekommen. Schickte man ihn irgendwohin, dann lief er gleich im Trab. Hatte er einen Augenblick nichts zu tun, trat er von einem Fuß auf den andern, konnte vor überschüssiger Kraft nicht stillstehen. Arbeitete er in einer Kolonne, war ihm das Tempo nie schnell genug, und man konnte ihn an seiner Ungeduld und Unruhe erkennen. Das war auch der Grund, weshalb die Wahl im entscheidenden Moment auf ihn gefallen war: Zwei Tage nach seiner Ankunft in Chicago hatte Jurgis kaum eine halbe Stunde vor der Zentralen Zeitkontrolle von Brown & Co. gestanden, als ihn schon einer der Bosse herangewinkt hatte. Darauf war er sehr stolz und neigte nun erst recht dazu, die Pessimisten auszulachen. Vergebens erzählten ihm alle, in ebender Menschenmenge, aus der er geholt worden war, hätten Männer schon einen ganzen Monat, ja sogar viele Monate gestanden und wären doch nicht geholt worden. »Stimmt!«, sagte er. »Aber was sind das auch für Männer? Abgetakelte Landstreicher und Tagediebe, Kerle, die ihr ganzes Geld versoffen haben und jetzt neues zum gleichen Zweck haben wollen. Wollt ihr mir weismachen, dass man mich mit diesen Armen« – und dabei ballte er die Fäuste und hob die Arme, sodass man die rollenden Muskeln sehen konnte –, »dass man mich mit diesen Armen jemals hungern lassen wird?«
»Daran merkt man«, antworteten sie ihm, »dass du vom Lande kommst, und zwar von ziemlich weit landein.« Das stimmte auch wirklich, denn Jurgis hatte noch nie eine Großstadt und kaum eine mittelgroße Stadt gesehen, bevor er ausgezogen war, sein Glück in der Welt zu suchen und sich seine Ona zu verdienen. Sein Vater und dessen Vater und alle seine Vorfahren, soweit man nur zurückdenken konnte, hatten in dem Teil Litauens gelebt, der unter dem Namen Brelovicz, der Kaiserforst, bekannt ist. Das ist ein großes Gebiet von mehr als 100 000 Morgen, das seit eh und je ein Jagdreservat des Adels ist. Es gibt dort nur ganz wenige Bauern, und die haben ihre Wirtschaft schon von alters her. Einer davon war Antanas Rudkus, der selbst so wie nach ihm seine Kinder – auf ein paar Morgen Rodung inmitten einer Wildnis aufgewachsen war. Außer Jurgis waren noch ein Sohn da gewesen und eine Schwester. Der Sohn war zur Armee eingezogen worden; das war schon über zehn Jahre her, und man hatte seitdem nichts mehr von ihm gehört. Die Schwester war verheiratet, und ihr Mann hatte den Hof gekauft, als der alte Antanas sich entschloss, mit seinem Sohn mitzugehen.
Vor rund anderthalb Jahren hatte Jurgis Ona kennengelernt, auf einem Pferdemarkt 100 Meilen vom heimatlichen Hof. Jurgis hatte nie ans Heiraten gedacht – er hatte sich darüber lustig gemacht als über eine Falle, mit der man Dumme fängt; aber hier fand er sich auf einmal, ohne dass sie auch nur ein Wort miteinander gesprochen oder sich mehr als ein halbes Dutzend Mal angelächelt hatten, Onas Eltern gegenüber, puterrot vor Verlegenheit und Furcht, und bat sie, ihm Ona als Frau zu verkaufen – für die beiden Pferde seines Vaters, die er eigentlich auf den Markt bringen sollte. Aber Onas Vater erwies sich als hart wie Granit – das Mädchen sei doch noch ein Kind, und er sei ein wohlhabender Mann, und seine Tochter sei auf solche Weise nicht zu haben. So fuhr Jurgis betrübten Herzens nach Hause und quälte sich in jenem Frühjahr und Sommer redlich ab, die ganze Sache zu vergessen. Im Herbst, als die Erntezeit vorbei war, merkte er, dass es nichts half, und er legte die Strecke, die zwischen ihm und Ona lag, in 14 Tagen zu Fuß zurück.
Er traf eine unerwartete Situation an – der Vater des Mädchens war gestorben und sein Besitz an Gläubiger verpfändet worden. Jurgis’ Herz tat einen Sprung, als ihm klar wurde, dass nun der Schatz für ihn erreichbar war. Es waren da Elzbieta Lukoszaite, Teta oder Tante, wie sie genannt wurde, Onas Stiefmutter, und ihre sechs Kinder wie die Orgelpfeifen; außerdem ihr Bruder Jonas, ein verdorrter kleiner Mann, der auf dem Hof gearbeitet hatte. Für Jurgis, der frisch aus den Wäldern kam, waren das bedeutende Persönlichkeiten. Ona konnte lesen und noch manches andere, wovon er nichts verstand. Der Hof war nun verkauft und die ganze Familie dadurch aus der Bahn geworfen – denn alles, was sie auf dieser Welt besaßen, waren etwa 700 Rubel, was in Dollar halb so viel ist. Sie hätten das Dreifache haben können, aber sie hatten klagen müssen, und der Richter hatte gegen sie entschieden; da hatten sie das Übrige drangeben müssen, damit er die Entscheidung rückgängig machte.
Ona hätte nun heiraten und die Familie verlassen können, aber das wollte sie nicht, denn sie hing an Teta Elzbieta. Den Ausweg fand Jonas, der vorschlug, sie sollten alle nach Amerika gehen: Ein Freund von ihm sei dort reich geworden. Er für seinen Teil würde arbeiten gehen, und die Frauen würden arbeiten gehen, und gewiss auch ein paar von den Kindern – irgendwie würden sie schon durchkommen. Jurgis hatte auch schon von Amerika gehört. In jenem Land, so hieß es, könne ein Mann drei Rubel am Tag verdienen; und Jurgis rechnete sich aus, was drei Rubel am Tag bedeuten würden, gemessen an den Preisen, wie sie bei ihm zu Hause üblich waren. Er beschloss, unverzüglich nach Amerika auszuwandern, zu heiraten und obendrein noch ein reicher Mann zu werden. Ob reich, ob arm, so hieß es außerdem, in jenem Land sei der Mensch frei; er brauche nicht in der Armee zu dienen, und er brauche sein Geld nicht an betrügerische Beamte zu zahlen – er könne tun und lassen, was er wolle, und sich für ebenso gut halten wie die anderen. So war Amerika ein Land, von dem Liebende und junge Leute träumten. Konnte einer nur die Kosten für die Überfahrt zusammenbringen, dann hatten alle seine Sorgen ein Ende.