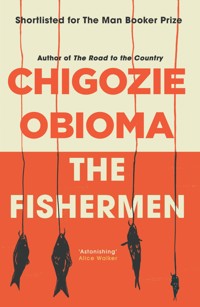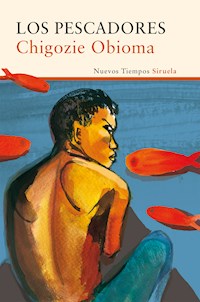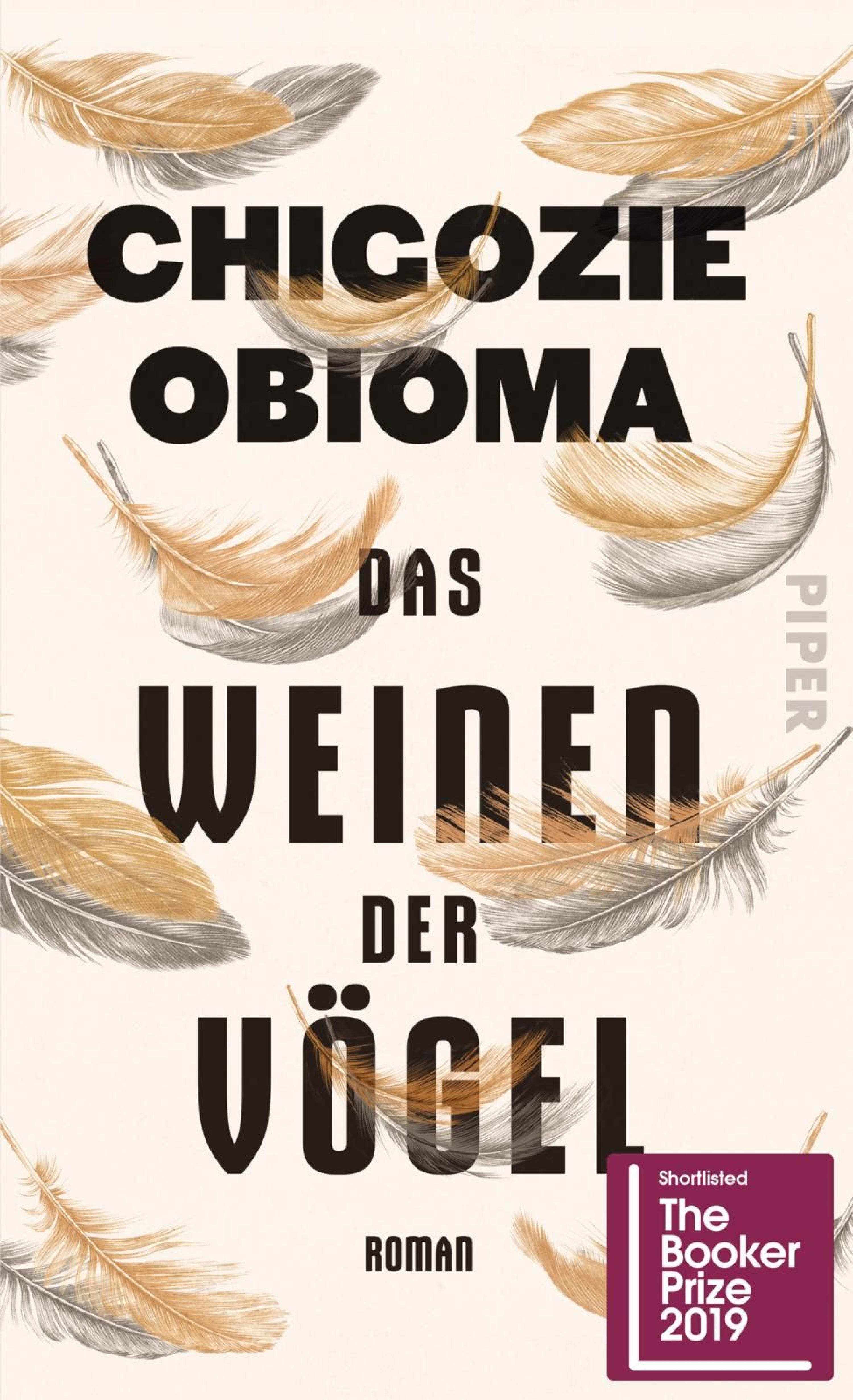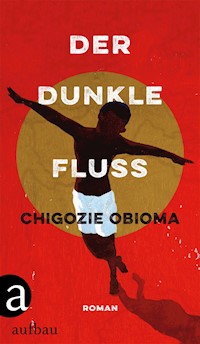
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Schönheit und die Grausamkeit Afrikas.
Benjamin und seinen Brüdern geht es gut. Ihre große Familie lebt in einer Kleinstadt im Westen Nigerias. Als jedoch der Vater, ein strenger Patriarch, versetzt wird, zerbricht die Ordnung der Familie. Die Brüder nutzen die neu gewonnene Freiheit. An einem nahen Fluss, der schon viele Opfer gefordert hat, fangen sie Fische. Sie werden verraten und gezüchtigt. Aus Brüdern werden allmählich Feinde, und einer von ihnen wird zum Mörder ...
Ein faszinierendes Familiendrama und eine sprachmächtige Fabel über das Schicksal Nigerias. Von Afrikas neuem großen Erzähler. Vielfach preisgekrönt, übersetzt in 25 Sprachen.
»Das beste zeitgenössische Buch, das ich in den letzten Jahren gelesen habe. Ein moderner Klassiker.« Maxim Biller im Literarischen Quartett.
»Das erstaunlichste Debüt eines neuen afrikanischen Autors.« Sigrid Löffler, Deutschlandradio.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Informationen zum Buch
Ein großer Roman über die Schönheit und Grausamkeit Afrikas
Benjamin und seine Brüder leben in der Nähe eines gefährlichen Flusses. Als ihr Vater die Familie verlassen muss, verstoßen sie gegen sein Verbot, sich dem Gewässer zu nähern. Die Fische, die sie dort fangen, sind Dämonen.
Ein faszinierendes Familiendrama und eine sprachmächtige Fabel über das Schicksal Nigerias. Von Afrikas neuem großem Erzähler.
»Knisternd vor Lebendigkeit, beladen von Vergänglichkeit, schwindelerregend sowohl im Stil als auch in der elementaren Kraft seiner Geschichte. Nur wenige Romane verdienen das Prädikat ›mythisch‹ – Chigozie Obiomas ›Der dunkle Fluss‹ gehört mit Sicherheit dazu. Ein wahrhaft großartiges Debüt.« Eleanor Catton (Booker-Preis 2013)
»Jeder Satz versetzt einem einen präzisen, tief empfundenen Schlag. Besser geht es nicht. Diesen Namen muss man sich merken.« Alexandra Fuller, Autorin von Unter afrikanischer Sonne
Chigozie Obioma
Der dunkle Fluss
Thriller
Aus dem Englischenvon Nicolai von Schweder-Schreiner
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
1 Fischer
2 Der dunkle Fluss
3 Der Adler
4 Der Python
5 Die Verwandlung
6 Der Verrückte
7 Die Falknerin
8 Die Heuschrecken
9 Der Spatz
10 Der Pilz
11 Die Spinnen
12 Der Spürhund
13 Der Blutegel
14 Der Leviathan
15 Die Kaulquappe
16 Die Hähne
17 Die Motte
18 Die Reiher
Über Chigozie Obioma
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Die Schritte eines Einzelnen verursachen noch keine Panik.
Ibo-Sprichwort
Ich schwimme nicht darin
Ich trinke nicht daraus
Mein Vater schwimmt nicht darin
Meine Mutter trinkt nicht daraus
Meine Brüder schwimmen nicht darin
Meine Schwestern trinken nicht daraus
Sein Wasser verdirbt die Seele
Seine Ufer plagen den Geist
Es ist ein dunkler Fluss, ein langer, dunkler Fluss
Der Niger.
Ibo-Kinderreim
FISCHER
Wir waren Fischer.
Meine Brüder und ich wurden im Januar 1996 Fischer, nachdem unser Vater aus Akure weggezogen war, einer Stadt im Südwesten Nigerias, wo wir unser ganzes Leben zusammen verbracht hatten. Sein Arbeitgeber, die nigerianische Zentralbank, hatte ihn Anfang November des vorigen Jahres nach Yola versetzt, das im Norden lag, einen Kamelritt von mehr als tausend Kilometern entfernt. Ich erinnere mich noch an den Abend, als Vater mit dem Brief nach Hause kam, es war ein Freitag. An jenem Freitagabend und auch den ganzen Samstag lang berieten sich Vater und Mutter flüsternd wie Schreinpriester. Am Sonntagmorgen dann war Mutter nicht mehr dieselbe. Sie lief wie eine nasse Maus mit abgewandtem Blick durchs Haus. An diesem Tag ging sie nicht in die Kirche, sondern blieb zu Hause und wusch und bügelte mit undurchdringlicher, finsterer Miene Vaters Sachen. Keiner von beiden sagte ein Wort zu uns, und wir stellten keine Fragen. Meine Brüder Ikenna, Boja, Obembe und ich glaubten, dass Vater und Mutter so etwas wie die Herzkammern des Hauses waren und sie Stillschweigen bewahrten wie das Herz das Blut. Also bohrten wir besser nicht nach. An Tagen wie diesen verzichteten wir darauf, im Wohnzimmer fernzusehen. Wir saßen in unseren Zimmern, lernten oder taten, als lernten wir, verunsichert, aber ohne Fragen zu stellen. Stattdessen streckten wir unsere Fühler nach jedem nur erdenklichen Hinweis aus.
Gegen Einbruch der Dämmerung fielen dann die ersten Informationsbrocken aus Mutters Selbstgesprächen wie winzige Federn aus einem reich gefiederten Vogel: »Was ist das für ein Job, der einen Mann davon abhält, seine Söhne großzuziehen? Selbst wenn ich sieben Hände hätte, wie soll ich mich allein um die Kinder kümmern?«
Obwohl diese brennenden Fragen an niemand Spezielles gerichtet waren, waren sie sicherlich für Vaters Ohren bestimmt. Er saß allein im Wohnzimmersessel, das Gesicht hinter einer Ausgabe seiner Lieblingszeitung The Guardian verborgen, halb lesend, halb Mutter lauschend. Und obwohl er alles mitbekam, stellte er sich jedes Mal taub, solange das, was er als »feige Worte« bezeichnete, nicht direkt an ihn gerichtet war. Er widmete sich einfach weiter seiner Lektüre und schimpfte oder freute sich zwischendurch über etwas, das er gerade gelesen hatte: »Wenn es einen Funken Gerechtigkeit auf der Welt gibt, wird Abachas Frau, diese Hexe, bald um ihren Mann trauern.« »Wow, Fela ist ein Gott! Meine Güte!« »Reuben Abati sollte gefeuert werden!« Nur um den Eindruck zu erwecken, dass Mutters Klagen vergeblich waren und niemand sie beachtete.
Bevor wir an diesem Abend schlafen gingen, hatte Ikenna, der fast fünfzehn war und auf dessen Meinung wir uns meist verließen, die Vermutung geäußert, Vater würde versetzt. Boja, der ein Jahr jünger war und nicht als ahnungslos dastehen wollte, hatte behauptet, Vater würde wahrscheinlich ins Ausland gehen, in die »westliche Welt«, wie wir oft befürchteten. Obembe, mit seinen elf Jahren zwei Jahre älter als ich, hatte keine Meinung dazu. Genauso wenig wie ich. Aber wir wurden nicht lange auf die Folter gespannt.
Die Antwort kam am nächsten Morgen, als Vater plötzlich in Obembes und meinem Zimmer stand. Er legte die Brille auf den Tisch, eine Geste, mit der er um unsere Aufmerksamkeit bat. »Ich werde von jetzt an in Yola leben, und ich will nicht, dass ihr eurer Mutter Ärger macht.« Bei diesen Worten verzog er das Gesicht, so wie er es immer tat, wenn er uns Angst einjagen wollte. Er sprach langsam, dunkler und lauter als sonst, so dass sich jedes Wort tief in unseren Köpfen einnistete. Damit er, sollten wir ihm nicht gehorchen, uns mit nur einem kurzen Satz eindrücklich an diesen Moment erinnern konnte: »Was habe ich euch gesagt?«
»Ich werde sie regelmäßig anrufen, und sollte mir etwas zu Ohren kommen«, er hob warnend den Zeigefinger, »ich meine, irgendwelche Schandtaten, dann werdet ihr euer blaues Wunder erleben.«
Er sagte das mit so viel Nachdruck, dass die Adern an beiden Schläfen hervortraten. Einmal ausgesprochen, war eine solche Drohung meistens das letzte Wort. Er holte zwei Zwanzig-Naira-Scheine aus der Jackentasche und ließ sie auf unseren Schreibtisch fallen.
»Für euch beide«, sagte er und ging hinaus.
Während Obembe und ich noch auf dem Bett saßen und versuchten, uns einen Reim auf das alles zu machen, hörten wir Mutter vor dem Haus mit ihm sprechen, so laut, als wäre er schon weit weg.
»Eme, denk dran, deine Jungs werden jetzt ohne dich großwerden müssen«, rief sie. »Ich sag’s ja nur.«
Vater startete seinen Peugeot 504. Obembe und ich eilten aus dem Zimmer, aber er fuhr bereits durch das Tor und war weg.
Immer, wenn ich über unsere Geschichte nachdenke, darüber, dass wir nie wieder als die Familie zusammenlebten, die wir immer gewesen waren, wünschte ich – noch heute, zwei Jahrzehnte später –, er wäre damals nicht gegangen, er hätte dieses Versetzungsschreiben nie erhalten. Bevor der Brief kam, war alles in Ordnung gewesen: Vater fuhr jeden Morgen zur Arbeit, und Mutter, die einen Stand auf dem Markt hatte, wo sie frische Lebensmittel verkaufte, kümmerte sich um mich und meine fünf Geschwister. Alles ging seinen natürlichen Gang. Wir dachten nicht an gestern. Zeit spielte keine Rolle damals. In Trockenzeiten hingen tagsüber die Wolken am Himmel, die Luft war voller Staub, und die Sonne schien bis in den Abend hinein. Während der Regenzeit, wenn der sintflutartige Regen sich sechs ununterbrochene Monate lang in pulsierenden Gewitterstürmen entlud, sah es aus, als malte eine Hand unscharfe Bilder in den Himmel. Da alles einem bekannten, klaren Muster folgte, war kein Tag der Erinnerung wert, es zählte allein die Gegenwart und die absehbare Zukunft. Einblicke in die Zukunft kamen meist wie eine Lokomotive auf den Schienen der Hoffnung daher, mit schwarzer Kohle im Herzen und einem elefantösen Tuten. Manchmal erschien sie einem in Träumen oder Fantastereien wie ein Flüstern im Kopf – Ich werde später mal Pilot oder Präsident von Nigeria, ein reicher Mann, mit eigenem Helikopter –, denn die Zukunft war das, was wir aus ihr machten, eine leere Leinwand, auf die sich alles Mögliche projizieren ließ. Das alles war vorbei, als Vater wegzog.
Von nun an lebte er in Yola. Das grüne Telefon, auf dem bis dahin vor allem Mr. Bayo angerufen hatte, Vaters Jugendfreund, der in Kanada lebte, war die einzige Möglichkeit, ihn zu erreichen. Mutter wartete ungeduldig auf seine Anrufe und kreuzte die Tage, an denen sie telefonierten, auf dem Kalender in ihrem Zimmer an. Wenn Vater sich einmal nicht planmäßig meldete und Mutters Geduld erschöpft war, nachdem sie bis nach Mitternacht gewartet hatte, löste sie den Knoten an ihrer Wrappa, holte den zerknitterten Zettel hervor, auf den sie seine Telefonnummer gekritzelt hatte, und wählte sie immer wieder, bis er ranging. Wenn wir noch wach waren, hingen wir um sie herum, lauschten Vaters Stimme und drängten sie, ihn dazu zu bringen, uns mit in die neue Stadt zu nehmen. Doch Vater weigerte sich beharrlich. Yola, erklärte er, sei eine extrem unsichere Stadt, in der es immer schon großangelegte Gewaltaktionen vor allem gegen Angehörige unseres Volkes – der Ibo – gegeben habe. Wir ließen trotzdem nicht locker, bis im März die religiösen Unruhen blutig ausbrachen. Als Vater endlich ans Telefon ging, berichtete er – während man im Hintergrund vereinzelte Schüsse hörte –, wie er nur knapp dem Tod entkommen war, als die Randalierer seinen Bezirk angriffen, und dass im Haus gegenüber eine ganze Familie niedergemetzelt wurde. »Kleine Kinder, abgeschlachtet wie Hühner!«, hatte er gesagt und die Worte »kleine Kinder« auf eine Weise betont, dass kein vernünftiger Mensch es gewagt hätte, ihn noch mal darauf anzusprechen, uns zu sich zu holen.
Vater machte es sich zur Gewohnheit, uns jedes zweite Wochenende in seinem Peugeot 504 zu besuchen. Und so freuten wir uns auf die Samstage, wenn er draußen vor dem Tor hupte, und eilten ihm entgegen, um zu sehen, was er uns diesmal mitgebracht hatte. Während wir uns langsam daran gewöhnten, ihn nur noch alle paar Wochen zu sehen, veränderte sich etwas. Seine hünenhafte, Anstand und Besonnenheit ausstrahlende Gestalt schrumpfte nach und nach auf die Größe einer Erbse. Die von ihm etablierten Richtlinien – Selbstbeherrschung, Gehorsam, Fleiß und die obligatorische Siesta –, die lange Zeit unseren Alltag bestimmten, weichten immer mehr auf. Ein Schleier legte sich über seine scharfen Augen, die, wie wir glaubten, jedes noch so kleine Vergehen bemerkten. Im dritten Monat dann brach sein langer Arm, der oftmals warnend die Peitsche geschwungen hatte, ab wie ein müder Ast. Und wir rissen uns los.
Wir stellten die Bücher ins Regal und machten uns auf, die Welt zu erkunden. Wir wagten uns auf den öffentlichen Fußballplatz, wo die meisten Jungs aus der Nachbarschaft jeden Nachmittag spielten. Ein Rudel Wölfe, das uns nicht gerade willkommen hieß. Obwohl wir keinen von ihnen kannten, bis auf Kayode, der ein paar Straßen weiter wohnte, wussten sie genau, wer wir waren und sogar, wie unsere Eltern hießen. Sie verhöhnten uns und nannten uns trotz Ikennas atemberaubender Dribbelkünste und Obembes Glanzparaden »Amateure«. Außerdem hänselten sie uns, weil unser Vater für die Zentralbank arbeitete und ein reicher Mann sei und wir deswegen privilegiert seien. Sie dachten sich einen Spitznamen für ihn aus: Baba Onile, nach der Hauptfigur in einer bekannten Yoruba-Soap, einem Mann mit sechs Frauen und einundzwanzig Kindern. Vaters Wunsch, viele Kinder zu haben, war bei uns im Viertel zur Legende geworden. Zudem war es der Yoruba-Name der Gottesanbeterin, dieses hässlichen grünen Insekts. Eine solche Beleidigung konnten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Ikenna, dem bewusst war, dass wir in der Unterzahl waren und im Kampf unterlegen wären, bat sie mehrmals, wie es sich für ein christliches Kind geziemte, unsere Eltern nicht weiter zu beleidigen, sie hätten ihnen schließlich nichts getan. Aber sie hörten nicht auf, bis Ikenna sich eines Tages nicht mehr beherrschen konnte und einem von ihnen eine Kopfnuss verpasste. Reflexartig trat ihm sein Gegner in den Bauch und stürzte sich auf ihn. Für kurze Zeit wirbelten ihre Füße über das sandige Spielfeld, bis der Junge Ikenna zu Boden schleuderte und ihm eine Handvoll Sand ins Gesicht warf. Die übrigen Kinder jubelten und halfen ihm auf, und ihre Stimmen verschmolzen zu einem Siegeschor. Mit dem Gefühl, vernichtend geschlagen worden zu sein, kehrten wir an jenem Abend nach Hause zurück und ließen uns nie wieder dort blicken.
Danach hatten wir keine Lust mehr rauszugehen. Auf meine Anregung hin flehten wir Mutter an, uns die Mortal-Kombat-Konsole wiederzugeben, die Vater im Jahr zuvor einkassiert hatte, nachdem Boja – der in der Schule immer als Klassenerster galt – mit der Warnung »Versetzungsgefahr« nach Hause kam. Bei Ikenna war es nicht besser, er war 16. von 40 und hatte ein persönliches Begleitschreiben von Mrs. Bukky, seiner Lehrerin, dabei. Als Vater den Brief vorlas, bekam er einen solchen Wutanfall, dass ich nur die Worte »Herrgott noch mal!« verstand, die er wie einen Refrain wiederholte. Er konfiszierte das Spiel, was bedeutete, dass wir nie wieder vor Erregung herumwirbeln und johlen würden, wenn der unsichtbare Kommentator den Befehl »Finish him« gab und ein Sprite den anderen besiegte, indem er ihn entweder hoch in die Luft kickte oder zu einem bizarren Haufen aus Knochen und Blut zerstückelte, woraufhin auf dem Bildschirm in flammenden Stroboskopbuchstaben das Wort »Fatality!« erschien. Einmal kam Obembe – noch während er sich gerade erleichterte – aus der Toilette angelaufen, nur um im amerikanischen Akzent des Sprechers mitzugrölen: »Das war tödlich!« Später entdeckte Mutter seine Exkrete auf dem Teppich und bestrafte sie ihn.
Frustriert suchten wir schließlich doch noch nach einer körperlichen Betätigung für die Zeit nach der Schule, jetzt, wo wir frei waren. Also trommelten wir die Kinder aus der direkten Umgebung zusammen und spielten mit ihnen Fußball auf dem Feld hinter unserem Grundstück. Neben Kayode war diesmal auch unser Nachbar Igbafe dabei, außerdem sein Cousin Tobi – der halb taub war und unsere Stimmbänder strapazierte, indem er jedes Mal fragte Jo, kini o nso?, Bitte, was hast du gesagt? Tobi hatte riesige Ohren, die so gar nicht zu seinem Körper passten. Er wirkte selten beleidigt – vielleicht, weil er so schlecht hörte und wir eher flüsterten –, wenn wir ihn Eleti Ehoro, der mit den Hasenohren, nannten. Wir rannten kreuz und quer übers Feld, in billigen Trikots und T-Shirts, auf die wir unsere Spielernamen gedruckt hatten. Wir spielten und schossen wie die Irren, so dass der Ball regelmäßig bei den Nachbarn landete und wir zusehen mussten, wie wir ihn wiederbekamen. Häufig kamen wir gerade noch rechtzeitig, um mit anzusehen, wie ein Nachbar den Ball zerfetzte und unserem Flehen, ihn uns zurückzugeben, keinerlei Beachtung schenkte. Dann legten wir jedes Mal zusammen und kauften einen neuen, bis auf Kayode, der keinen einzigen Kobo aufbringen konnte. Er trug meist zerrissene Shorts und lebte mit seinen relativ alten Eltern, den Oberhäuptern der kleinen Christ Apostolic Church, in einem zweistöckigen Rohbau. Da er kein Geld beitragen konnte, betete er für jeden Ball und bat Gott, ihn nicht zu den Nachbarn fliegen zu lassen.
Eines Tages kauften wir einen schönen neuen weißen mit dem Logo der Olympischen Spiele 1996 in Atlanta. Nachdem Kayode sein Gebet aufgesagt hatte, legten wir los, und nach einer knappen Stunde gab Boja einen Schuss ab, der den Ball auf das eingezäunte Grundstück eines Arztes trug, wo er krachend durch ein Fenster schlug und zwei Tauben aus dem Schlaf schreckte, die sich flatternd vom Dach in die Luft erhoben. Wir warteten in sicherer Entfernung, um gegebenenfalls die Flucht ergreifen zu können. Schließlich pirschten Ikenna und Boja sich an, während Kayode niederkniete und Gott um Hilfe bat. Kaum hatten sie das Grundstück erreicht, kam der Arzt, der anscheinend nur auf sie gewartet hatte, aus dem Haus gerannt, so dass wir alle Hals über Kopf die Flucht ergriffen. Als wir abends keuchend und schwitzend nach Hause kamen, hatten wir fürs Erste die Nase vom Fußball voll.
*
In der Woche darauf kam Ikenna von der Schule und platzte mit einer neuen Idee heraus, und so wurden wir Fischer. Es war Ende Januar, denn ich erinnere mich, dass wir am Wochenende Bojas vierzehnten Geburtstag mit selbstgebackenem Kuchen und Softdrinks gefeiert hatten. Sein Geburtstag leitete den »Altersgenossen-Monat« ein, einen Zeitraum von mehreren Wochen, in denen er genauso alt war wie Ikenna, der am 10. April Geburtstag hatte. Solomon, sein Klassenkamerad, hatte ihm vom Fischen vorgeschwärmt, es sei ein tolles Erlebnis und außerdem einträglich, da man die Fische verkaufen konnte. Was Ikenna ebenfalls daran faszinierte, war der Gedanke an eine mögliche Auferstehung des Yoyodon. In dem Aquarium, das früher neben dem Fernseher gestanden hatte, gab es einen wunderschönen Diskusfisch, der in diversen Farben schillerte – Braun, Violett und auch Hellgrün. Vater nannte ihn Yoyodon, denn ungefähr so klang es, als Obembe versuchte, seinen wissenschaftlichen Namen, Symphysodon, auszusprechen. Nachdem Ikenna und Boja die Fische in einem Akt der Barmherzigkeit aus ihrem »schmutzigen Wasser« befreit und es durch sauberes Trinkwasser ersetzt hatten, nahm Vater uns das Aquarium weg.
Als Solomon Ikenna vom Fischen erzählte, schwor er sich, einen neuen Yoyodon zu fangen. Am nächsten Tag zogen Boja und er los und kauften sich jeder eine Angel. Von da an liefen sie jeden Tag nach der Schule den langen, verschlungenen Pfad entlang bis an die Ufer des Omi-Ala, vorbei an einem Gelände hinter unserem Grundstück, auf dem eine Rotte Schweine hauste und es in der Regenzeit schrecklich stank. Sie wurden von Solomon und anderen Jungs aus der Straße begleitet und kehrten mit Eimern voller Fische zurück. Obembe und ich waren begeistert von den kleinen bunten Tieren, aber Ikenna wollte uns erst nicht dabeihaben. Bis er eines Tages sagte: »Kommt mit, wir zeigen euch, wie man fischt!«, also kamen wir mit.
Und so liefen wir alle zusammen zum Fluss, angeführt von Solomon, Ikenna und Boja, die ihre Angeln in Lumpen und alten Wrappas versteckten. Wir anderen – Kayode, Igbafe, Tobi, Obembe und ich – trugen Rucksäcke mit Anglerkleidung, Nylontaschen mit Regenwürmern und toten Kakerlaken, die wir als Köder benutzten, und leere Getränkedosen, in denen wir die Fische und Kaulquappen aufbewahrten. Zusammen wateten wir durch Brennnesseln, die uns gegen die nackten Beine schlugen und weiße Quaddeln auf der Haut hinterließen. Das passte zu dem seltsamen botanischen Namen für das Gras, das bei uns in der Gegend wuchs, Esan, das Yoruba-Wort für Vergeltung oder Rache. Wir liefen im Gänsemarsch hindurch, und wenn das Gras hinter uns lag, rannten wir wie die Verrückten in Richtung Fluss. Dann stellten Solomon, Ikenna und Boja sich ans Ufer und hielten ihre Angeln ins Wasser, so dass die Köder darin verschwanden. Aber obwohl sie es machten wie die Männer früher, die den Fluss von klein auf kannten, fingen sie meist nur ein paar handgroße Stints, manchmal auch braunen Cod, oder, noch seltener, einen Tilapia. Bei uns anderen bestand das Fischen darin, mit Getränkedosen Kaulquappen aus dem Wasser zu schaufeln. Ich fand die Kaulquappen toll, das Glitschige, die übergroßen Köpfe und ihre Unförmigkeit, wie die Miniatur eines Wals. Gespannt beobachtete ich, wie sie an der Wasseroberfläche hingen, und meine Finger färbten sich schwarz, wenn ich die grau glänzende Schicht von ihrer Haut abrieb. Manchmal sammelten wir auch Muscheln oder Gehäuse von toten Gliederfüßlern auf. Oder Schneckenhäuser in Form von Urtieren, Zähne, die, wie wir glaubten, aus längst vergangenen Zeiten stammten und, wie Boja vehement behauptete, einem Dinosaurier gehört hatten, weswegen er sie mit nach Hause nahm, ein Stück Haut einer Kobra, die sich direkt am Fluss gehäutet hatte, und alles, was wir sonst noch interessant fanden.
Nur einmal fingen wir einen Fisch, der groß genug war, um ihn zu verkaufen, ich erinnere mich oft an diesen Tag. Solomon hatte ein Riesending aus dem Wasser gezogen, den größten, den wir je im Omi-Ala gesehen hatten. Ikenna und Solomon brachten ihn auf den Markt und kamen nach einer guten halben Stunde mit fünfzehn Naira zurück. Außer uns vor Freude liefen meine Brüder und ich mit unseren sechs Naira Anteil nach Hause. Von nun an wollten wir mit größerem Ernst an die Sache herangehen und schmiedeten bis spät in die Nacht Pläne.
Mit ungewohntem Eifer machten wir uns ans Werk, als würden wir von einer jubelnden Menge am Ufer angefeuert. Uns störten weder der Geruch des Brackwassers noch die geflügelten Insekten, die jeden Abend in Trauben am Ufer schwirrten. Jeden Tag zogen wir in Lumpen gekleidet mit rostigen Dosen, toten Insekten und Würmern los. Denn trotz aller Schikanen und der dürftigen Erträge bereitete uns das Fischen große Freude.
Wenn ich heute zurückblicke, was ich häufiger tue, seit ich eigene Kinder habe, wird mir klar, dass an einem dieser Tage auf dem Weg zum Fluss sich unser Leben und unsere Welt veränderten. Dies war der Ort, an dem die Zeit plötzlich eine Rolle spielte, an diesem dunklen Fluss, als wir Fischer wurden.
DER DUNKLE FLUSS
Der Omi-Ala war ein grausamer Fluss.
Lange Zeit war er von den Bewohnern Akures vergessen worden, wie eine Mutter, die von ihren Kindern verlassen wird. Früher einmal war er ein klarer Fluss gewesen, der die ersten Siedler mit Fisch und sauberem Trinkwasser versorgte. Wie viele andere Flüsse in Afrika hielten die Menschen den Omi-Ala für einen Gott und beteten ihn an. Sie errichteten Gedenkstätten in seinem Namen und bemühten sich um die Gunst und den Rat Yemayás, Oshas, von Meerjungfrauen und anderen Wassergeistern und Göttern. Das änderte sich, als die Kolonialisten aus Europa kamen und die Bibel einführten und die zu Christen bekehrten Anhänger Omi-Alas sich von ihm abwendeten und ihn fortan als Wiege des Bösen betrachteten.
Und so wurde er zur Quelle düsterer Gerüchte. Unter anderem hieß es, an seinen Ufern würden seltsame Rituale begangen. Die Rede war von Leichen, Tierkadavern und anderen Opfergaben, die auf dem Fluss trieben oder an seinen Ufern lagen. Schließlich hatte man Anfang letzten Jahres die verstümmelte Leiche einer Frau entdeckt, ganz in der Nähe der Stelle, wo wir fischten. Ihr waren lebenswichtige Organe entfernt worden. Als man die Überreste entdeckte, verhängte der Stadtrat eine nächtliche Sperre über den Fluss, und bald schon ließ sich niemand mehr dort blicken. Über die Jahre hatten die Vorfälle sich gemehrt und den Namen Omi-Ala befleckt, so dass allein seine Erwähnung Abscheu hervorrief. Wenig hilfreich war auch, dass sich in der Nähe eine Sekte von zweifelhaftem Ruf angesiedelt hatte. Die Anhänger der Himmlischen Kirche, auch Kirche des Weißen Gewandes genannt, beteten zu Wassergeistern und liefen barfuß. Wir wussten, dass unsere Eltern uns schwer bestrafen würden, sollten sie jemals dahinterkommen, dass wir zum Fluss gingen. Trotzdem machten wir uns keine Gedanken darüber, bis eine Erdnussverkäuferin aus der Nachbarschaft uns auf dem Weg dorthin entdeckte und Mutter davon berichtete. Das war Ende Februar, und wir waren seit fast sechs Wochen am Fischen. An diesem Tag hatte Solomon einen großen Fisch geangelt. Wir sprangen auf, sahen zu, wie er sich am Haken wand, und stimmten das Fischerlied an, das Solomon sich ausgedacht hatte und das wir immer in Momenten wie diesen sangen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!