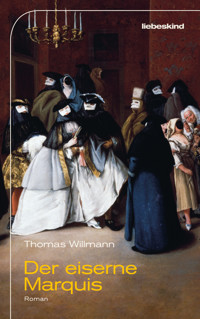
24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlagsbuchhandlung Liebeskind
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wien, im Jahr des Herrn 1753. Ein junger Bursche aus der Provinz tritt als Lehrling in die Dienste des Uhrmachers Servasius Weisz. Er ist überaus begabt, aber seit der Kindheit ein Sonderling. All sein Streben zielt darauf ab, Welt und Leben zu fassen und neu zu erschaffen nach den Gesetzen der Mechanik. Als er sich in die Grafentochter Amalia verliebt, kommt es zu einer furchtbaren Tragödie, die ihn zur Flucht aus Wien zwingt. Er tritt in das Heer des preußischen Königs ein und zieht unter neuem Namen als Jacob Kainer in den Krieg. Im Lazarett macht er die Bekanntschaft eines geheimnisvollen Marquis, der beeindruckt ist von seinen handwerklichen Fähigkeiten. Der Marquis nimmt Jacob mit nach Paris, wo er ihm im Kampf gegen seine fortschreitende Krankheit beistehen soll. Gemeinsam suchen sie in den Schriften der Gelehrten und mit den Mitteln des Experiments nach der Triebfeder des menschlichen Leibes. Doch als ihre wissenschaftlichen Anstrengungen keinen Sieg über die Vergänglichkeit bringen, verschreibt sich der Marquis dunkleren Künsten – und das Schicksal nimmt seinen unerbittlichen Lauf. In seinem lang erwarteten neuen Roman erzählt Thomas Willmann eine packende Geschichte über das Gelingen und Scheitern, Gottes Schöpfung zu rekonstruieren. »Der eiserne Marquis« ist ein außergewöhnliches, kunstvoll erzähltes Epos, das unserer Gegenwart einen Spiegel vorhält, indem es eine längst vergangene Welt zum Leben erweckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1564
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Thomas Willmann
Der eiserne Marquis
Roman
© Verlagsbuchhandlung Liebeskind 2023
Alle Rechte vorbehalten
Covermotiv: akg-images / De Agostini Picture Library
Covergestaltung: Robert Gigler, München
eISBN 978-3-95438-169-2
Für alle,von denen ich lernen durfte
INHALT
PROLOG IN DER SALPÊTRIÈRE
MEIN ERSTES LEBEN
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
MEIN ZWEITES LEBEN
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
EPILOG
DANKSAGUNG
PROLOG IN DER SALPÊTRIÈRE
Kommt her, meine Ratten.
Habt nur Vertrauen! Lasst Euch nieder vor mir, auf diesen Steinen, welche meine Schritte speckig schlurften.
Seid nicht scheu – war ich nicht alleweil gut zu Euch? Bin ich nicht bessere Gesellschaft denn all die greinenden, kreischenden, vor sich hin brabbelnden Frauen dort unten, all die Irren, Huren und Armen? Findet bei mir Ihr nicht bessere Speisung für Euren Hunger nach Kost – und nach etwas Zerstreuung?
Hier, schaut: Ich will Euch ein paar Bröcklein hinstreuen. Schnuppert nur, schnüffelt und leckt, ob sie Euren Sinn zu kitzeln vermögen. Und dann bleibt, denn ich sehne mich nach Publikum und verspreche, Euch mehr aufzutischen.
Ihr wisst, ich bin ein besonderer Fall in diesem Gemäuer des weiblichen Wahns. Der gute Docteur F––– verspricht sich solch außergewöhnliche Erkenntnis von mir, dass er die Ausnahme macht und mich hegt und pflegt in menschenwürdigem Kerkerdasein. Mich lässt er nicht in Fetzen und Kot hier verrotten; mich lässt er von seiner eigenen Tafel verköstigen statt mit ranzigem Brei; mich zu züchtigen hat er den Wärtern verboten. Denn ich bin das Erz, aus welchem er Ruhm und Münze zu schlagen hofft: In der Rue de l’E––– aus der Erde gefördert und solch fantastisches Fiebergestammel von mir gebend, dass mit dessen Beschreibung und Ergründung gewiss bereits Furore zu machen war in der Académie und noch manch Staat zu machen sein wird im Geistesreich der Gelehrten.
Ihr, denen Euch Riegel und Tür den Weg nicht verwehren, da Ihr Euch Eure eigenen Löcher und Gänge scharrt, und die Ihr Äuglein und Ohren in allen Wänden habt – Ihr ward gewiss schon Zeugen, wie brav der gute Docteur und meinerselbst einander abgerichtet haben. Er glaubt, ich sei sein gezähmter Narr, auf Zuruf willfährig Objekt seiner Studien. Ich jedoch füttere ihm stetig dabei eine dünne Brühe, in der nur ein paar Flachsen des Wahren schwimmen. Und die sonst mit solch wohlüberlegtem Unsinn, Widersprüchen versalzen ist, dass der Docteur noch lang daran zu kauen und schlucken haben wird, ohne zu einem gesättigten Schluss zu kommen. Mit anderen Worten: Nicht hat er mir das Antworten beigebracht – sondern ich ihm das unablässige Fragen. Auf dass seine Neugier ihn zwingt, mir weiterhin Kost und Logis zu gewähren. Denn sagt, findet Ihr nicht auch oft es hier weniger ein Gefängnis denn einen bergenden Hort vor der äußeren Welt? Flieht Ihr nicht auch lieber hierher denn hinaus in die Wirrnis?
So kommt und lasst mich Euch die Zeit vertreiben im klammen Dämmerlicht dieses Gemäuers, fern vom Lärm jener Welt. Doch Euch nicht mit Trügerei! Nein, Euch will ich die Wahrheit erzählen. Will weder lügen, noch will ich verschweigen. Ihr sollt meine Beichtväter, sollt meine eifrigen, schlüpfrigen Beichtratten sein. Euch kann ich ja alles anvertrauen – denn ich bin’s gewiss: Ihr haltet stumm …
Seht, ich will Euch sogleich den Beweis meiner Ehrlichkeit geben! Will sogleich das größte und bitterste Pfund meiner Schuld vor Eure bebenden Barthaare schleudern:
Ich habe gemordet.
Ja, vor Euch sitzt ein Mörder – und leugnet es nicht. Oder, genauer, denn lasst mich nicht jetzt schon wortbrüchig werden und halbe Wahrheit nur auftischen: Vor Euch sitzt einer, der zwei Leben hatte. Und im ersten davon zum Mörder ward. Der aber – und drum gestehe ich’s frei, ohne mich um Eure Verdammnis oder Absolution zu scheren – in seinem zweiten die Buße auch tat. Dem in seinem zweiten Leben dann alles genommen, gemordet ward. Dass er nun nichts mehr zu verlieren hat, nichts mehr zu erwarten.
Also kommt her, wenn Ihr mögt, und hört mich an. Lasst Euch nieder auf dem speckigen Stein, oder scharrt Euch ein genehmes Plätzlein, im Staub, da vor mir.
Kommt her, meine Ratten, und lauscht.
Ich will Euch meine Geschichte erzählen.
MEIN ERSTES LEBEN
– 1 –
Jener Mensch, den Ihr heute vor Euch erblickt, kam rechteigentlich zur Welt auf der Bettstatt eines preußischen Feldlazaretts, inmitten des eitrigen Gestanks und Gestöhns der Blessierten, im Jahre des Herrn Siebzehnhundertundsechzig. Ans Licht geholt hat mich da aus langem Dämmer der Marquis von D–––, welchem ich an jenem Tage zum ersten Male begegnete. Ich zählte bei jener, meiner zweiten Geburt bereits zwanzig Lenze.
Ich schlüpfte gleichsam aus einem Kokon, den mir das Schicksal gesponnen hatte aus vielen Fäden. Es kroch ein Selbst hervor, noch knittrig und klamm, welches die Larve seines bisherigen Daseins verflüssigt, aufgelöst, umverwandelt hatte.
Und so lasst mich zunächst Euch erzählen von jenem Verflossenen, jenem mir und Euch heute Fremden. Dessen Namen ich nicht mehr aus der Tiefe der Zeit herausfischen will. Lasst mich erzählen von meinem ersten, meinem Raupen-Leben.
Und lasst mich dazu sogleich anheben mit dem Geständnis einer … nun, wenn nicht Lüge, so doch Ungenauigkeit Euch gegenüber. Einer schmeichelnden Unterschlagung. Möge dies Euch lehren, die Ohren stets gespitzt zu halten und meine Worte nicht zu treugläubig zu verschlingen.
Denn ich muss gestehen: Ich war zwiefacher Mörder. Begann ich mein Leben doch noch vor meinem ersten Schrei damit, dass ich ein anderes Leben raubte. Auch wenn kein Gericht dieser Welt – nein, nicht dieser Welt – mir daraus je einen Strick drehen könnte. Weil freilich ich es blind und unwissend tat – allein durch die Gier, mit welcher ich als kleiner Homunkulus den Leib meiner Mutter von innen aufzehrte.
Wie sollte ich ahnden, dass all das Nährende, welches mich barg und umgab, erschöpflich war? Ich sog und begehrte nur immer mehr, ich tränkte und labte mich in ihrem Schoß, so feist ich nur konnte. Und beteuere meine Unschuld! Beteuere, noch nicht einmal Bewusstsein gehabt zu haben von meinerselbst als Wesen – geschweige denn vom Dasein anderer Menschen. In rotschwarzer Ewigkeit schwamm ich wie eine Kröte, vom Dunkeln nichts wissend, weil mir auch die Erfahrung des Lichtes noch fehlte. Die brütende Wärme nicht fühlend, weil ich noch nie Kälte empfand; und unberührt von jeder Erkenntnis der Zeit und ihres Verrinnens. Noch war mir sämtliches eins und ungeteilt – und allein meines. Ich kann mir nicht zur Anklage machen lassen, keinen Begriff gehabt zu haben, dass mein vermeintliches All nur der Leib war eines zierlichen, gar zu zierlichen Weibes.
Ich habe von meiner Mutter nur ein vages Bild – seinerseits bloß das vom milchigen Auge der Erinnerung verwischte Abbild eines bereits unzulänglichen Originals. Mein Vater bewahrte von seiner verblichenen Gemahlin eine Miniatur, doch hielt er sie in seinem Schreibtisch unter Verschluss. Ob er damit sich den Schmerz ihres ständigen Anblicks ersparen oder ihr Bildnis vor meinen gefräßigen Augen bergen, es allein sich vorbehalten wollte, vermag ich nicht zu sagen. Jedenfalls verschafften mir erst spät diebische Neugier und das erworbene Geschick im Umgang mit Schlössern jeglicher Art die erste, verstohlene Ansicht ihres verblassenden Antlitzes. Und wenn ich die folgenden Jahre immer wieder eine Abwesenheit des Vaters nutzte, um heimlich die Lade zu öffnen und das winzige Oval an den Tagesschein zu holen, welches selbst in meinen kleinen Kinderhänden gänzlich nistend zu bergen war – dann nicht, weil mich beim ersten Blick schon die Empfindung überwältigt hätte, hier nun endlich dem lange vermissten, ungekannt geliebten Menschen, der entbehrten Mutter zu begegnen. Sondern in der Hoffnung – oder soll ich gar sagen: Vermeintlichen Pflicht? –, doch noch irgendeine innige Regung, tiefe Bande des Herzens zu diesem Bildnis zu empfinden.
Denn in Wahrheit schaute ich auf jenes Angesicht und fühlte … nichts. Nichts denn eines gewissen befriedigten Interesses. Und, wenn ich ganz ehrlich bin, eines Bodensatzes bitteren Mitleids, halb schon zu milder Verachtung vergärend. Dieses Antlitz bedeutete mir so wenig wie die austauschbar huldvollen Visagen von Heiligenbildchen. Freilich vermochte ich nicht zu entscheiden, ob dies ein Fehl war meiner mir fremden Mutter – oder des Künstlers, welcher sichtlich nicht gesegnet war mit dem höchsten Talent. Es sprach jedenfalls aus jenem Portrait eine matte Kraftlosigkeit. Eine fahle Frau zeigte es, mit schlaffen Zügen in einem auf plumpe Weise lang gezogenen Gesicht, nachlässig umschlängelt von dunklen Locken. Reine Gleichgültigkeit sah ich da. Welche – wenn sie nicht jene des Malers war, mit seinen flachen Farben und verallgemeinernden Pinselstrichen – keinerlei Wunsch stellte an die Welt. In böseren Stunden dachte ich später, nur so ein Weib habe sich mit meinem Vater vermählen können – und dass er genötigt war, sie abgöttisch zu lieben, weil einzig sie ihn duldete.
Freilich: Wohl diese Duldsamkeit schrieb ihr auch das schwarze Urteil – denn sie war nicht gewachsen meiner Gier, welche mich noch vor jedem Geist, allen Sinnen erfüllte. Und hegte ich also doch eine Empfindung gegen dies Bildnis, dies Weib? Nämlich einen insgeheimen Zorn? Warum war sie zu schwach, sich zu erwehren? Warum bewahrte sie mich nicht davor, zu ihrem Mörder zu werden?
Was am Tage meiner Geburt geschah, das weiß ich nur, weil mein Oheim mir es später erzählte. Oder besser: Ich ihn beständig über Jahre dazu löcherte, ihm mal dieses, mal jenes Mosaiksteinchen entwendend. Mein Vater hat davon zu mir nie gesprochen. Mag also gut sein, dass, wenn ich Euch wiederum davon berichte, als hätte meine Seele dies aus den Himmeln geschaut, bevor sie sich auf Gedeih und Verdammnis in diesen Leib verbannt fand … Mag also gut sein, dass sich dieser Erzählung Traum, Wunsch – und vielleicht gar tiefste Erinnerung meinerselbst – beigemischt haben. Nehmt sie so wahr, wie Ihr wollt.
Jedenfalls scheint meine Mutter eine Ahndung in sich getragen zu haben, dass das Schicksal (oder gar: Ich, ihr werdendes Kind) ihr keine glückliche Niederkunft zu vergönnen gedachte. Sie brachte, erzählte mein Oheim, der heiligen Emerentiana in unserer Kirche fast wöchentlich Modeln dar. Doch trotz all der wächsernen Kröten war ihr die Heilige nicht wohlgesinnt – oder deren bester Wille zu schwach gegen jene Mächtigkeit, welche ich angenommen. Mit jedem meiner neun Monde war meine Mutter am Rest des Leibs schmaler geworden und bleicher. War in die abnehmende Phase ihrer Lebenssichel getreten, in eine Ebbe der Kräfte und Säfte. Doch wo ihr Fleisch sonst magerer und magerer ward, da rundete sich weiter und weiter der Bauch. Da spannte ich Unersättlicher ihn zur grotesk prallen Kugel – ein Zentrum der Gravität, welchem Haupt und Glieder der Mutter lediglich noch anzuhaften schienen. Nur mit äußerster Mühe vermochte ihr Leib, mich zu tragen. Doch als ich ihn ausgezehrt hatte, ihn mir einverleibt, und an die Welt hinausdrängte: Da war mir die Pforte längst zu eng geworden, welche er mir dafür bot.
Im Morgengrauen eines schwülen Spätsommertags hatte ich zuerst kundgetan, dass mir mein Höhlenreich nicht mehr genügte und ich mir Gestade zu erobern strebte, fern dem Blut meiner Mutter. Die Hebamme ward gerufen; doch schon nach dem ersten prüfenden Tasten, dem ersten Warten und Lauschen auf die Wehen war Sorge in ihrem Blick. Der Mutter sprach sie beruhigende Zuversicht zu – doch dem Vater flüsterte sie, er solle sich Beistand holen. Also kam mein Oheim hinzu: Geschwisterlos war seit dem letzten Wüten der Blattern die Mutter, und ihren Eltern hatte der Vater niemals verziehen, dass sie die Verbindung abgelehnt hatten. Ihn der Tochter nicht würdig befanden, bis diese drohte, als alte Jungfer zu enden – und dann war er ihnen grade gut genug. Diesen Schwiegereltern gab er Bescheid mit einem nüchternen, kurzen Billett, erst als alles vorüber war. (Mag sein, dass in ihm wühlte die Scham, er habe nun die Befürchtung erwiesen, ihnen die Tochter ohne Recht und Lohn zu rauben. Mag sein, dass ihn der Vorwurf trieb, diese Tochter habe sich nun seiner und seiner Saat als nicht gewachsen, nicht würdig gezeigt.)
Stunde um Stunde verging, und häufiger ward und heftiger das Stöhnen der Mutter, ihr Winden in Krämpfen, ihr Keuchen im kalten, tranigen Schweiß. Doch nichts geschah. Ich verharrte in ihr – wollte womöglich nicht lassen, bis ich auch den letzten Tropfen an Leben gesaugt, wollte womöglich nicht trennen mich von diesem, meinem ersten Besitz. Oder wusste auch nur, dass jener armselige Spalt, der sich aufzutun bemühte, mir nicht genügte: Mir, der sich nie bescheiden mochte mit dem, was ihm Ordnung, Gott oder Natur zustehen wollten! Stunde um Stunde verfinsterte sich der Hebamme Miene, Stunde um Stunde draußen der Tag. Und gegen Abend rief man den Vater – der Küster war und Schulmeister unseres Orts –, dass er läuten solle die Warnung vor einem nahenden Sturm.
Die stickige Feuchte der Luft war unerträglich geworden. Es fuhr kaum trockener, kühler ein in die Lungen denn aus. Und es stunden an den Kuppen der Hügel Wolken, dräuend voll der Empfindung, dass etwas bersten wollte, jener Tag sich verdichtete, zulief auf eine Entladung. Der Vater sah keinen Grund, seiner Pflicht zu entsagen – er tat dies auch sonst nie –, und glaubte ebenso wenig, dass nach all diesen Stunden nun just jene erreicht sei, da sich etwas entschied. Womöglich war er durchaus froh, dem Hause zu entkommen, dem Gestank, Gestöhne und schmerzvollen Warten. Als er sich den Rock überstreifte, bat die Hebamme ihn nur, unterwegs nach dem Bader zu schicken. Man möge ihn brauchen.
Als mein Vater ins Heim wiederkehrte – nachdem er geläutet hatte jenen Sturm, welcher dann doch vorüberzog, einen unentschieden grauen Himmel zurücklassend, aus dem sich zwei Tage später erst zögerlich kühlende Tropfen pressten; und nachdem er eine Weile noch nachsinnend spaziert war durch und um den Ort … –, als also der Vater zurückkam, war alles vorüber. Tot war seine Frau, und ich auf der Welt.
Als hätte ich nur den Zeitpunkt ersehnt, dass er aus dem Hause war, überfielen meine Mutter die letzten Wehen. Sie kämpfte wohl tapfer um ihr und mein Leben, und es ließ ihr die Amme beinah verantwortungslos lange die Hoffnung. Doch schon begann sich das Laken zu röten – und wollte in der trägen Flut nichts von mir hervorlugen. Bleicher und bleicher ward das Antlitz der Mutter, flacher und flacher ihr Atem, und es wusste die Amme, bald würde ihr zwischen den Beinen das Leben verrinnen. Und sie sah nur noch einen Weg, wenn wohl nicht jenes meiner Mutter, so doch das meinige zu wahren. Sie hieß den Bader, mich nach Art des Römischen Kaisers hervorzuholen.
Ich weiß nicht, ob die Mutter es noch begriff, wozu man da ein Messer zückte. Ob unter all ihrer Pein noch jene neue zu unterscheiden war, als die Klinge ihr die Bauchdecke ritzte, durch Haut, Speck und Muskel fuhr. Ich aber glaube fest, dass mein unfertiges Selbst mit seinen schmächtigen Sinnen durchaus erkannte, wie der Stahl die Himmel aus Fleisch über mir teilte und das erste Licht, den ersten Atem auf mich kommen ließ. Und dass in jenem ersten, noch kaum bewussten Blick sich meine Liebe gründete zum Metall. Zu Instrumenten und zu Eisen und zur scharfen Mechanik – welche mich befreiten aus Dunkelheit und Ertrinken, welche mich enthoben dem Gekröse und Tod.
Denn so ward ich hervorgewühlt aus dem versagenden Leib, strampelte mich los von den Banden an ihn, schnappte die Luft für ein blindes Triumphgebrüll. Und ward noch dem brechenden Blick der Mutter vorgehalten, an ihren Busen gelegt – und wüsste gern, ob ihr letzter, bereits zerbröckelnder Gedanke einer war der Erleichterung, der Liebe zu jenem plärrenden Geschöpf, welchem sie ihr Dasein opferte. Oder ob sie erfasst war von Zorn und Unverstand, dass dies hässliche, ruchlose Menschlein das Recht fand, ihr das Leben zu nehmen. Denn freilich bemühten sich Bader und Kindfrau vergebens, die klaffenden Lappen Fleisch wieder zu schließen, bevor dort in meinem Gefolge auch die Lebensgeister der Mutter entwichen.
So fand der Vater bei seiner Heimkehr seine geliebte Frau leblos, entseelt, ihren erkaltenden Leib mehr schlecht denn recht mit grobem Garn zusammengeflickt – mich aber kregel meine Weltankunft behauptend. Und bereits lauthals schreiend das Verlangen nach jemandem Neuen, mir zu stillen meine unverminderte Gier.
Dazu hatte ich mir freilich den falschen Fleck auf Erden ausgesucht. Wenn etwas heimisch war in jenem kargen, reinlichen Schulmeisterhaus im Örtchen K––– an der T–––, dann war’s die Genügsamkeit. Die Erwartungen an die Welt waren hier so niedrig wie die Stubendecken. Und wenn einer meinte, den Blick höher lenken zu wollen, dann wusste man schon, ihm die entsprechenden Nasenstüber zu versetzen, dass er’s bald bleiben ließ.
Eine Befriedigung jenes Hungers nach mehr, nach Größerem, welchen ich vor allem Denken in mein Leibinnerstes eingepflanzt wusste, sollte ich hier nicht finden. Doch stattdessen immerhin einige frühe, wertvolle Lektionen über die Macht.
Es war der Vater, wie erwähnt, ein Mann der Pflicht. Ihm eignete ein von keiner Versuchung trübbares Gefühl, wo im Strom der ewigen Macht er sich fand, zu finden hatte. Der Quell und Ursprung, der war bei Gott – wo man ihn so wenig zu leugnen wie mit dem Verstand zu fassen hatte. Von dort floss, kaum gemindert, die Macht dem Kaiser zu. Hier nahm sie erstmals Gestalt, das Gefäß eines Leibes an – doch auch er war fern, war in Wien für unsereins kaum erreichbarer, wirklicher denn Gottvater im Himmel. Vom Kaiser aus jedoch, da verästelte sich alle Macht über die Staustufen einer Hierarchie, welche stets benennbar waren nach Amt und Inhaber des Amts. Und in deren sich vom Zentrum ausbreitenden Fluss, nach vielerlei Abzweigung, Ausdünnung, Abflachung sich endlich auch K––– an der T––– fand – und dortselbst dessen Schulmeister, also mein Vater.
Welcher jener besagte Mann der Pflicht war, gleichsam stromauf- wie stromabwärts: Alles Dasein begriff er als Sache der Schuldigkeit. Er war hager und von freudlosen Zügen. (Allemal seit ich ihn kannte – er mag einst anders gewesen sein, bevor ich ihm die Gatttin raubte …) Es diente ihm eine Schläfenbrille als Schild gegen die Welt, einer Verkündung gleich, dass die Dinge sich an- und einzupassen hatten in den Rahmen seiner ihm eigenen, engen Sicht.
Diese Sicht war eben eine des Buchhaltertums: Man schuldete gegen allem, was höher stand. Und es hatte dafür das Niederere die Rechnung einem zu begleichen. Dies Letztere war es in Wahrheit, warum er nach oben duckte und buckelte, warum er kein Jota unerfüllt ließ allen Auftrags von dort: Weil es ihm das Recht gab, dasselbe von all jenen unter ihm strengst mit ebensolcher Fehllosigkeit einzufordern. Es ließ ihn teilhaben an jener Macht und deren Ausübung, ließ ihn herrschen. Und so konnte er auch mich nur behaften mit meiner Schuld, indem er mir gegenüber so klag- wie restlos seine Schuldigkeit erwies. Ich war sein und seiner geliebten Frau Sohn, ergo hatte er mich zu behüten und nähren in seinem einsam gewordenen Heim.
Sobald der Vater in seiner Trauer bereit war, den pragmatischen Fortgang des Lebens zu bedenken – und das war bald, denn der Vater begab sich nur ungern in die Herrschaft seines Sentiments … –, unterbreitete man ihm freilich den Vorschlag, er möge mich in eine Familie geben. So wäre etwa dem Wachszieher erst ein Bub noch im Kindbett gestorben, und gegen einen Beitrag zur Kost sei es der Frau recht egal, ob sie einen anderen Balg an Zitze und Rockzipfel hängen habe. Es wollte davon der Vater nichts wissen. Vergebens ebenfalls alles noch so behutsam eingefädelte Bemühen des Oheims, ihm ein neues Eheweib, oder zumindest mir eine Mutter, durch Heirat ins Haus zu gesellen. Es hätten sich, tüchtig und proper genug, Frauen gefunden, welche sich Schlimmeres wussten denn einem Schulmeister den gesicherten Haushalt und dafür auch das Bett zu besorgen. Allein, der Oheim lud sie und den Vater zur Jause, besah und belauschte die tadellos kalte Konversation, ward Zeuge des förmlichen Abschieds – und empfing vom Vater dann anderntags stets Bescheid, dieser hege den Wunsch nicht nach einem Wiedersehen. Der Oheim tat’s einige Male. Und ließ es dann bleiben.
Nein, der Vater war überzeugt, vor Gott in einsamer Pflicht und Schuld gegen meinerselbst zu stehen. Was jedoch nicht heißen sollte, dass er es ein gerechtes Geschäft fand im emsigen Tauschhandel des Schicksals, die Gemahlin genommen zu wissen für mich unersättlichen Balg. Er verbuchte dies durchaus mit einem erhebenden Gefühl der Beleidigung, der grollenden Enttäuschung über den HERRN, dass dieser doch nachlässiger sei im Abwiegen von Geben und Nehmen denn er seinerselbst, Küster und Schulmeister aus K––– an der T–––, dem niemand nachsagen konnte, dass er mehr verlangte denn opferte. Mich garstiges Bündel Mensch also Tag um Tag in seinem Haus, vor seinen Augen klaglos zu dulden, wo die duldsame Gefährtin dafür nicht mehr war – das diente dem Vater wohl auch als ein steter Beweis in seiner stummen Anklage gegen den Spruch von Gottes Gericht.
So nötig ich dem Vater jedoch als Item war in den Zeilen und Spalten seiner Daseins-Abrechnung – so wenig vermochte er freilich sonst etwas anzufangen mit einem Säugling, welchem es noch an allem Verstand fehlte von Pflicht, Schuld und Sprache. Er bestellte mir eine Amme und vertraute in sie, dass sie alles Nötige tue zu meinem Gedeih und ansonsten dafür Sorge trüge, dass ich nicht weiter störe. Selbst mir begrifflosem Halbwaisen muss sich irgend vermittelt haben, dass dies Weib, welches mich nährte und leidlich hegte, nicht die Mutter war – denn ich erinnere keinerlei Empfindung einer tieferen Zuneigung zu ihr. Sie war mir jene ersten Jahre gleichsam eine eher atmosphärische Gegenwart – ein satter Geruch von Milch (welcher sich später säuern sollte), ein Gebirge aus Fleisch, welches mich tröstend zu bergen vermochte wie strafend auf mich herabzudonnern. Nicht ahndend, wie mir im weiteren Leben das Weibliche so fatal unerreichbar erscheinen mochte, nahm ich jenes erste Frauenzimmer meines Daseins hin als Selbstverständlichkeit. Und vermag nicht, sie Euch im Relief zu geben.
Die meiste Zeit ward ich in Fatschen gewickelt, wand mich als verschnürtes Würmchen in meiner Wiege und bekam, wenn ich irgend Unmut durch Geschrei zum Ausdruck brachte, ein Leinensäcklein voll Mohn zwischen die Lippen geschoben, dass ich mir daraus dasige Ruhe sauge. Ich lernte bald, das nutzlose Strampeln zu lassen, mich zu fügen den Banden aus Stoff und die erzwungene Reglosigkeit meiner kleinen Glieder zu nutzen, stattdessen meinen gerade erst zu vagen Umrissen erwachenden Geist zu exerzieren – ihn auf Wanderung zu schicken durch meinen Leib, durch den mir erfahrbaren Raum um meinerselbst herum. Mehr als wenn man mich krabbeln ließ, wusste ich in beharrlichem Strecken, Pressen und Reiben in und an meinen so weichen wie strengen Fesseln mir die Bewusstwerdung zu erobern jedes Zehen und Fingerchens, der Füße und Hände, Beinchen und Ärmchen. Ich kroch hinein in meinen Leib, streckte und dehnte mein Selbst in ihm aus, bis es ihn füllte. Lange bevor man mir es zugestand und ein Fehl der Beherrschung strafenswert ward, hatte ich insgeheim die Fähigkeit mir erlangt, nur nach Willen mich zu entleeren. Und übte sie gern der Amme zum Fleiß grad, wenn es sie am meisten inkonvenierte – hatte jedoch auch ein Gespür, wann ihre Geduld überreizt war und sie mich in Nässe und Kot würde verharren lassen statt zu säubern und wickeln, sodass ich lieber zurückhielt.
Doch am meisten stöberte, stocherte ich schon damals tief in meinen Eingeweiden nach der Leere in mir, nach dem Unerfüllten, um mich daran zu weiden. Es war damals freilich selten mehr denn bloße Magenleere, welche ich empfand, durchsetzt hie und da mit einem Verlangen nach Aufmerksamkeit. Doch schon dabei durchloderte mich das heilige Brennen der Ungerechtigkeit, das Glühen eines Zorns auf alle Mächte und Menschen, die es wagten, mir vorzuenthalten, was ich begehrte. Und ich empfand ob dieses Zorns eine Lust – die Lust des Gekränkten, der sich durch das ihm widerfahrene Unrecht erhoben fühlt, durch sein Leiden geadelt. Ich fand bald weit größeren Genuss darin, still und vorwurfsvoll mich im verwehrten Begehren, in jenem Zorn zu suhlen, mich in seinem Feuer zu garen denn meinem Unmut brüllend und zappelnd Linderung zu verschaffen.
Ich war ein ruhiges Kind, nicht weil ich genügsam war – sondern weil ich mich übte im Sammeln von Vorwürfen gegen die Welt. Oft lag ich, zur Larve umwickelt, in der kargen, dämmrigen Stube, rechtete mit meiner Verlassenheit, wenn der Vater auf der Schule, die Amme klappernd in der Küche beschäftigt war, lauschte dem Ticken der großen Standuhr und zählte Schlag um Schlag die Zeit, die verrann, bis man endlich kam und meinem Verlangen genüge tat.
Ich fasste zu jener Standuhr meine erste innige Liebe. Sie war ein Erbe – einst des Großvaters teuerstes Stück, ein Luxus selbst hier im Horologenland. Nur entschuldbar für den jeder Prunksucht feindlichen Mann, weil er sie wohlfeil einem befreundeten Uhrmacher abnehmen sollte, welchem ihr Auftraggeber kurz vor der Fertigstellung jäh verstarb. Und wohl auch, weil das mehr denn mannshohe Instrument mit seinem sargdunklen Holz, seinen ehernen Ziffern, auf welche knochendürre Zeiger die geschlagene Stunde spießten, nichts hatte von frivolem Überfluss. Mahnend stund sie, starrte und tönte in die Stube von der strengen Ordnung der Zeit und ihres unbeugsamen Vergehens. Mich aber beruhigte sie – und wenn ich Respekt hatte vor ihr, dann nicht, weil sie mir Furcht einflößte, sondern ob ihrer Verlässlichkeit.
Als ich den Fatschen entwuchs, fand die Amme bald ein besseres Mittel, mich zu bannen und davon abzuhalten, mein Krabbeln durch das Heim gar zu emsig werden zu lassen: Man hockte mich, kaum dass ich wie ein plumper Sack sitzen konnte, vor die Standuhr – und durfte darauf vertrauen, mich selbst Stunden später dort vorzufinden, versunken lauschend dem hölzern nachhallenden Tocken ihres Werks und die kreisenden Schritte der Zeiger verfolgend. Und wenn ich unleidig ward, dann lag Abhilfe nicht fern – denn da war es nur, weil ich verlangte, man solle den Uhrkasten öffnen und mich das gemessene Schwingen des Pendels, das kaum merkliche Sinken der Gewichte an ihren Ketten betrachten lassen.
In anderen Dingen war ich nicht weniger eifrig denn jedes Kind, alles, was meine Neugier erregte, sogleich zu betatschen – manch ungelenk vom Tisch gewischter Teller, totgepatschter Käfer zeugten davon. Die Standuhr jedoch war mir stets auch ohne die Ermahnung des Vaters sakrosankt. Nie hätte ich ihr an den Ketten gezerrt, die Zeiger gebrochen. Nur nah wollte ich ihr sein, möglichst nah.
Oft sprach mir später mein Oheim noch lachend von jener Nacht, da die Amme mein Bettchen verlassen und mich verschwunden fand. Von dem Zetern, Rennen, Suchen, dem bangen Prüfen von Türen und Fenstern – »Grundgütiger, lass nur nicht fahrendes Volk das Kind entführt haben!« –, dem immer verzweifelter werdenden Stöbern in allen Kammern. Bis der Oheim, einmal mehr um Beistand gerufen, bemerkte, dass die Tür zum Uhrkasten einen Spalt offen stand. Er ahndete sogleich, öffnete ganz – und siehe da: Selig schlummerte dort, vom verursachten Trubel gänzlich unberührt, niemand anderes denn meinerselbst; am Boden des Kastens zusammengerollt, das Köpfchen eine Handbreit nur unter dem wuchtigen Messingpendel. In den Daunen des Betts hatte ich wohl keinen Schlaf gefunden und war also unter die Federn und Räder des Uhrwerks, dem Chronometer in den Bauch geschlüpft, hatte mich genistet unter den Schlag seines mechanischen Herzens.
Kaum derart entdeckt, riss man mich aus Schlummer und dem Mutterbauch des Kastens zurück an die Welt und wusste nicht recht, ob man mich eher herzen wollte vor Erleichterung oder züchtigen ob meines unschuldig aller bösen Absicht verübten, Angst einflößenden Streichs. Man entschied sich für beides in etwa gleichen, mir in ihrer Heftigkeit gleich unverständlichen Teilen. Ich, mir keines Vergehens bewusst denn des Verlangens nach Geborgenheit, fühlte mich überfallen, greinte vergeblich und noch ohne Sprache um Hilfe – und lernte meine Lektion. Ich ließ mich vertreiben aus meinem mechanischen Paradies. Aber nicht, ohne einige Nächte darauf noch einmal aus meinem Bettchen zu schleichen – nun mit vorsichtswaltendem Bewusstsein von Sünde und Verbot –, um mit dem vergeblichen Zerren der eignen Händchen bestätigt zu finden, dass der Vater nun jeden Abend vorsorglich die Kastentür zu meinem stundenschlagenden Refugium versperrte.
– 2 –
Im Erteilen dieser wie anderer Lektionen fehlte der Vater nie. »Tu dies nicht; fass jenes nicht an; iss dieses brav auf; beschmutze nicht Deinerselbst, beschmutze nicht jenes; dort gehe nicht hin; hier verharre still«, und was es sonst gab an Verboten und Geboten, welche zu befolgen waren: Er trieb sie mir mit strenger Stimme ins Gemüth – und wo dies nicht fruchtete, mit noch strengerer Hand in den Leib. Doch solang dies ohne wahres Verständnis blieb meinerselbst, ein wortloser Wechsel von Taten und Strafen, Dressur mehr denn wahres Lernen, tat er dies ohne Interesse. Tat’s als bloße Verrichtung – dem Verwalter über ein Kind so notwendig wie dem Herrn eines Hundes das Abrichten des Tieres, doch frei von innerer Beteiligung. Er zeigte meinem unfertigen Selbst die Grenzen der Welt auf mit der strafenden Gleichgültigkeit einer Flamme, in welche das unerfahrene Kind fasst und darauf mit versengten Fingern zurückschreckt.
Das wollte erst anders werden, als ich begann, mir endlich die Sprache zu erobern. Bis dahin war ich nur ein Quell der Störung, welchem man zum Schutze der Ordnung Bewegung, Geschrei, Ausscheidung zu zügeln hatte. Nun aber wandelte ich mich in den Augen des Vaters allmählich in ein Gefäß, welches selbst imstande war, die Ordnung aufzunehmen in sich – sie zu begreifen in ihrer Größe und Sinnhaftigkeit. Kaum nahm mein Gebrabbel erste Gestalt an, schleifte der Vater mich jeden Morgen mit in die Schulstube. Noch war ich zu klein, dort wahrhaft den Lektionen zu folgen – doch kam mir zupass, dass ich besser denn mancher zwei, drei Jahre älterer Bub geübt war im Stillhalten; und ich begaffte mit hämischer Überlegenheit, wenn eines der anderen Kinder die Rute zu spüren bekam, weil es sein Wasser nicht zu halten vermochte, seinen Kittel beschmutzte, wegen Tobens, vorlauten Mundwerks oder bloßer Verstocktheit. Ich verharrte, wo immer man mich auf die grauen, staubtrockenen Dielen hockte, und schaute und lauschte. Ob vorne beim Katheder des Vaters; ob bei den Kleinsten, die in der Ecke von einem der schon Stimmbrüchigen mit herrischem Kieksen Gehorsam beigebracht bekamen und erste lehrreiche Lieder und Reime; ob zwischen den Bänken jener, die schon Fibel und Katechismus paukten; ob neben jenen bleich und ernst Deklinationen und Konjugationen murmelnden Gestalten, in welche mein Vater Stolz und Hoffnung setzte, sie mögen es auf die Lateinschule schaffen und später Kirche und Reich in ehrbaren Ämtern dienen.
Freilich: Ich hatte daheim bereits zur Genüge die Strenge des Vaters erfahren, um mich anders zu benehmen. Doch mehr noch hielt mich brav und still: Dass ich wahrhaft lernen wollte – weil sich mir in jenen engen, kahlen Mauern, wo es wurlte von engem, kahlem Kinderverstand und speichelfädrigen Eifersüchten, zahnlückigen Rangeleien trotz allem eine neue Welt aufzutun begann. Ich erstmals in meiner unbefriedigten Existenz empfand, wahre Macht zu besitzen.
Dem Vater war es nur darum zu tun, in unserem Geist ein Abbild zu formen der einen, heiligen Ordnung der Schöpfung. Doch waren wir und unser Begriff freilich zu stutzig, diese göttliche Größe in ihrer Ganzheit auf einmal zu fassen. Und so blieb ihm nichts, denn sie uns Happen für Happen vorzusetzen und uns damit zu stopfen. Lesen und Schreiben lernte man, um näherzukommen der einen, der Heiligen Schrift; Rechnen zur Erkenntnis der göttlichen Regelmäßigkeit aller Dinge; die Anfangsgründe der Geographie, Historie, Naturkunde zur besseren Bewunderung des Schöpfungswerks. Wenn all dies seinen Nutzen auch hatte in irdischen Tagesgeschäften, war er’s zufrieden, solange es nur diente, getreu der Gesetze von Gott und Kaiser zu leben und den Wohlstand des Reiches zu mehren. Gestand auch zu, dass den Aussichtsreichen – darunter meinerselbst – noch das Französische beigebracht ward, um dem Hofe in dessen geläufigster Sprache zu buckeln.
Mir aber ward bei dieser mühsamen Geistes-Speisung auch jener Bissen gegeben vom Baum der Erkenntnis, welcher – einmal getan, gekaut, geschluckt – alles unwiederbringlich verdirbt. Kaum erst erobert und unterschieden, war es den Dingen und Worten nicht lang vergönnt, in paradiesischer Unschuld und Unteilbarkeit zu existieren. Was Zunge und Ohr selbstverständlich vertraut schien, zerlegte die Schule in Silben, die Silben in Laute, die Laute in jenen verblüffend, enttäuschend geringen Bestand an fünf Vokalen, einundzwanzig Mitlauten nur, aus welchen sich alles an Sprache – und damit an Welt – fügen ließ. Und noch eh ich das Staunen darob verdaut, bekamen Auge und Finger mit strengem Fleiß die Macht eingetrieben, diesen nüchternen Zauber und seine gut zwei Dutzend Elemente auch sichtbar zu machen, in den Strichen und Schlingen der Schrift sicher zu fesseln.
Von da an saß ich oft Stunden daheim und formte und fühlte, schmeckte Buchstabe um Buchstabe in meinem Munde. Ließ das »A« offen, klangvoll gerade entgleiten, das »D« weich an die oberen Milchzähne stoßen; zischte verführender Schlange gleich mal sanft, mal scharf das »S«, stieß verächtlich das »Z« hervor oder hielt es summend wie eine Biene, kitzelnd am Gaumen. Fühlte die Weltspanne, welche ich mit dem geringsten Lautvorrat auftun mochte zwischen »Ja« und »Nein«. Kratzte und malte jene mit all diesen Lauten zu vermählenden Linien und Bögen zunächst in den Staub, dann mit Kreide auf das Schiefertäfelchen, welches mein Vater mir mit einem gewissen, mahnenden Stolz überreichte, lang bevor man es meinen Altersgenossen anvertraute. Malte anfangs krakelig, dann mit übereifriger Sorgfalt, schließlich aber voll überlegenen Vorwitzes.
Ich tat dies nicht, des Vaters Gefallen zu finden oder seiner strafenden Strenge zu entgehen. Gewiss, schwer trug er an der Bürde seines Amtes, uns in die widerständigen Köpfe jene Erkenntnis der heiligen Schöpfung zu treiben, welche der HERR selbst vernachlässigt hatte, dem Mensch sogleich mit in die Wiege zu legen! Wo Wort und Schrift dazu als Werkzeug nicht genügten, unsere Augen und Ohren zu eng schienen als Zugang, da sah er es als seine Pflicht der Nächstenliebe, nicht mit dem Rohrstock zu sparen und es uns über Handrücken und Hosenboden in die Leiber zu dreschen. Nicht mit Lust allerdings, muss ich sagen – sondern mit einer Miene des enttäuschten Vorwurfs, dass wir ihn dazu zwangen. Es schmerze ihn selbst, vielleicht sogar mehr denn den Bestraften, sagte sein Gestus – doch was ließen wir ihm für eine Wahl, wenn wir einmal mehr den Metuschael vor den Metzujael setzten, oder dem Henoch, bis Gott ihn hinwegnahm, weniger zuzugestehen bereit waren denn an der Zahl 365 Jahr!
Nein, nicht daher rührte mein Eifer – nicht der Wille zur Unterwerfung, nicht Furcht und Gehorsam waren’s, die mich gelehrig machten. Vielmehr war es ein Wille nach Macht. Mein knospender Geist war nicht gebannt vom Großen und Ganzen, welches der Vater uns aus all diesen Wissens-Kieseln aufzutürmen suchte – er berauschte sich an der Erkenntnis, dass Sprache und Schrift ihm alles gemein machten, teil- und zerlegbar und fasslich. Dass noch das Fernste und Höchste benennbar war, nicht minder denn jeder vertraute, niederste Gegenstand meines Lebens: Dass jedes Blümlein und Möbel so sehr wie die Flotte Achilleus’, dass der Schuster des Dorfs und seine Rotzbengel von Söhnen so sehr wie die fremden, biblischen Könige Nebukadnezar und Abednego mit dem gleichen, geringen Vorrat an Lauten und Zeichen zu greifen und zu beschwören waren. Noch kindlich, noch spielerisch und unvollständig, empfand ich doch erstmals die ungeheure, erhebende Kraft der Zergliederung: Mit schaudernder Lust dividierte ich Wort um Wort, Name um Name, Ding um Ding auseinander und führte es stets hinab zu denselben, von mir nun beherrschten Elementen und deren Gesetzmäßigkeiten. Und gleich einem Alchemisten vermengte ich Buchstaben, Silben und Wörter, um mir daraus Neues und Edleres zu gewinnen.
Lallend und kritzelnd saß ich argloses Kind in dumpfer Schulstube in K--- an der T---, am äußeren Rinnsal aller fernen himmlischen wie irdischen Macht, wo der Vater sich mühte, uns bescheidene Ehrfurcht einzuträufeln – und begann, mir den Quell der Welt zu erobern. Wenn ich in jener Zeit bald eine Ermüdung, dann gar eine Verachtung in mir keimen fand bei den Spielen meiner Altersgenossen, dann weil mir ihre Regeln zu fad und augenblicklich ergründbar erschienen, ihre Scherze und Abzählreime zu abgeschmackt, zu täppisch in Maul und Geist, aufgewogen gegen die wahren Wunder der Sprache. In meinen freien Stunden stapfte ich lieber – noch kaum fest auf den Füßen – durch Ort und Felder und Wald. Stieg hoch zur Burg, um mehr von der Welt meinem Blick einzuverleiben, bevor die Grenze zum Himmel sie mir beschnitt, und um die Ahndung zu atmen, dass dort einst Ahnen von Rittergeblüt hausten. Lernte die Blumen, Büsche und Bäume zu unterscheiden und ihre Namen, und wo ich die Namen nicht in meinem Wissensschatz fand, da erfand ich sie. Legte mich auf staubigem Weg, in sommerdurchsäuselter Wiese auf die Lauer nach allem, was kreuchte und fleuchte, nach Gewürm und Geschwirr, um darin Gesetze und Plan zu entdecken. Und empfand Einsamkeit nur, wenn ich nicht allein sein durfte mit der Welt und meinen Gedanken; wenn ich gezwungen ward, unter meinesgleichen zu verweilen, nur um zu merken, wie fern und überlegen ich ihnen allen war.
Doch wenn Kälte und Regen mir meine Streifzüge verwehrten – den Elementen hätte ich wacker getrotzt, nicht aber dem Donnerwetter von Amme und Vater, wäre ich verdreckt und durchnässt heimgekehrt –, dann schlich ich mich im Dorf in die Handwerksstuben. Und in keine lieber als jene der Horologen. Meine Neugier war so beharrlich, wie sie still war und bescheiden. Und bald fanden die meisten Uhrmacher sich damit ab, dass es ihnen mehr Aufhebens machte, mich großäugiges Kind wieder und wieder zur Tür hinauszuschieben – was ich klaglos geschehen ließ, nur um kurz später wie mit selbstverständlichem Recht erneut im Türspalt zu erscheinen – denn mir einfach zu gestatten, mich in einem Winkel zu postieren, welcher mir aus respektvoller Nähe Blicke gewährte auf ihre Werkbank, Einblick in ihr Wirken. So ward ich gelitten – und fand meine wahre Leidenschaft.
Wenn ich Euch spreche von der Uhrmacherei, dann denkt Ihr gewiss an jene silberumrankte, goldziselierte Kunst, welche mit flüsternd huschenden Zeigern die Sekunden hascht. So kennt Ihr sie aus unserem Paris – doch so war sie nicht im Heim meiner Kindheit. Dort schuf man nicht Zierde für den Hof, verschaffte man nicht Adel und Bürgern die Herrschaft über die Zeit so klein und kostbar wie möglich in die Rocktaschen. Hier ward sie gezimmert für Bauernhofstuben und Handwerkerstätten; ward geschmiedet, den Lauf des heimischen Tags von der vagen Sonnenbahn zu trennen und allerweil an die Kette des Kirchturmschlages zu legen. Es waren ungeschlachte Instrumente, die man hier baute, ihr Werk mit den derb-eckigen Holzzähnen offen entblößt im unverkleideten Eisenrahmen: In grobe Stundenbrocken und Minutenfetzen hackten und rissen sie Gottes ungeteilte Zeit mit hinkendem Ticken. Fast jeden Morgen wollte dem Gang ihrer kunstlosen Zeiger (so sie denn überhaupt mehr denn einen besaßen davon) mit misstrauischem Blick und zurechtrückenden Fingern auf die Sprünge geholfen oder Einhalt geboten werden, um aufzuholen oder zurückzuerstatten, was im Spiel ihrer Räder gegen das Glockenläuten vom Turm verloren oder gewonnen ward. Nicht einzigartige Kostbarkeiten wollten sie sein, sondern so gleich und günstig gefertigt, dass man sie zu Dutzenden auf Kraxen gestapelt über die Dörfer tragen und feilbieten konnte, auch dem einfachen Volke erschwinglich als erster Einkauf in die beherrschte Zeit.
Mithin aber waren sie auch meinem wachen, doch jungen Verstand genügend billig: Wo mir die Taschenuhren eines Pariser Meisters wohl nur glitzerndes Geheimnis geblieben wären – zu klein und fein von meiner Warte aus –, waren mir die handtellergroßen Zahnräder, ihr einfältiges Ineinandergreifen, ihr immergleicher Auf- und Zusammenbau bald und bestens begreifbar. Denn ich entdeckte in mir eine angeborene Auffassungsgabe für alles Mechanische. Vom ersten Denken an schienen mir Hebel, Räder und Gelenke, schienen mir Kräfte, Winkel und Wirkungen wie dem wahren Musicus seine Töne und Harmonien, wie dem genialen Maler die Farben und Linien, dem reinen Poeten die Worte und Versifikationen: Nicht als Dinge der zweiten Ordnung, über welche nur Fleiß und gelehrte Übung nach bewusst angewandter Regel zu verfügen wussten. Sondern als ein natürlicher Stoff der Gedanken, in und mit welchem man sich unmittelbar auszudrücken vermag – seiner Gesetzmäßigkeiten so selbstverständlich geläufig wie der Bewegung der Gliedmaßen beim Gehen. Gleichsam als eine Muttersprache meines Geists.
Wie ich sagte: Es waren grobschlächtige Mechanismen; und es war entsprechend offensichtlich, wie es ihnen gelang, ihre Räder in den Fluss der Zeit einzutauchen, von ihm antreiben zu lassen zum Rundlauf, und diesen so umzuleiten, dass die Zeiger stetig damit Minuten und Stunden zermahlten. Den ein oder anderen Uhrmacher gab es auch, den meine stumme, glubschende Neugier belustigte oder dem womöglich bloß alles an Abwechslung willkommen und er deshalb bereit war, mir diesen und jenen Schritt, mal diese, mal jene Einzelheit zu erklären, sie in Geduld betrachten, gar betasten zu lassen. Und der mir den Mut, gar Ermunterung gab, ihn zu befragen. Wohl erwartend, die Anfangsgründe seines Handwerks aufsagen zu dürfen – und es dann reuend, als ich ihn begierig bedrängte, die Geheimnisse und tiefsten Prinzipien seiner Zunft darzulegen. Wenn ich nicht gar begann ihn zu piesacken, warum man jenes so, warum dieses nicht anders zu handhaben pflegte – und ihm dabei das Geständnis abnötigte, dass sich kein Gedanke seinerseits dahinter verbarg denn die Tradition, und ich in der Tat einen klügeren Weg aufzeigte.
So ward ich nach und nach von Hochmut erfüllt; lernte alsbald, was mir jüngst noch Staunen beibrachte und Bewunderung, mehr und mehr gering zu achten. Spürte schon die Versuchung, mit dem Stolz eines Kindes naseweis die in mir nistende, wachsende Überlegenheit offen zur Schau zu tragen, alles Mindere unnachsichtig hinfortfegend. Lernte jedoch zuvor meine damals wohl größte Lektion: Die Horologen duldeten mich, solange sie mich einen unverständigen Balg glaubten von zielloser Neugier. Duldeten weiter, sobald sie in mir einen gelehrigen, vor seinen Jahren verständigen kleinen Adepten erkannten. Jedoch endete ihre Duldung an jenem Tag, da ich zur Erkenntnis erwachte meines Talents – und ihrer Geringheit. Jede Dummheit hätten sie mit einem Lachen quittiert, mir übers strubblige Haar gestrichen und bereitwillig die Wahrheit erklärt. Alles hätten sie mir erlaubt – viereckige Zahnräder ihnen empfehlen, ein Zifferblatt mit fünfzehn Stunden einfordern. Und sie hätten’s possierlich gefunden. Nur eines durfte ich nicht: Recht haben, wo sie es nicht hatten.
Es genügte mir, dass ich zwei, drei Male beharrte, dass ich zwei, drei Male die Überlegenheit meiner Ideen bewies – nur um mich postwendend der Werkstatt verwiesen und Tage später beim nächsten, zaghaften Besuch alles im gleichen, schlechter gewohnten Gang vorzufinden. Dann verstand ich: Es hatte die Wahrheit zu kuschen vor der äußeren Macht. Sie hatte im Dunklen zu darben und wirken, und zu harren der richtigen Zeit. Äußerlich fügte ich mich darauf in die vermeintliche Unterlegenheit – weil dieser Schein mir die Handwerker gefügig machte und nützlicher war denn alle Rechthaberei. Ich stellte mich, wenn freilich nicht dumm, so doch dümmer, denn ich es war – stellte Fragen ehrfürchtig nur noch, die den Uhrmachern erlaubten, sich mir überlegen zu glauben. Und dachte mir stumm meinen Teil; fuhr Erkenntnis ein in die Kornspeicher meines Geistes, um mich davon eines anderen Tages zu nähren.
Auf diese Weise gewann ich mir einen rostigen, kostbaren Schatz. Ich hatte besonderes Vertrauen gefasst gerade zu einem der mürrischsten Meister. G––– hieß der Mann und betrieb seine Werkstatt ohne Gesellen. Gewiss ein Dutzend Male hatte er mich anfangs verscheucht, sobald ich über seine Schwelle trat, sodass ich ahndete, welch Abscheu er hegte gegen jede Störung seiner Ruhe. Da ich aber gar nicht die Absicht trug, ihm selbige Ruhe zu nehmen, erschien ich immer wieder aufs Neue – bis es mir gelang, mich mehrmals so in die Werkstatt zu schleichen, dass er erst nach Minuten überhaupt meine Anwesenheit bemerkte. Da scheuchte er nurmehr meine Impertinenz. Und fand schließlich selbst, dass ich ihm etwas zu geben vermochte, welches er bis dato nicht gekannt: Gesellschaft zur unbenommenen Ruhe. Eines Tages, den Arm schon zum Fuchteln gehoben, zögerte er. Verscheuchte mich dann nicht – sondern winkte mich vielmehr an seine Werkbank heran. Hätte ich da etwas gesagt, hätte gefragt oder gezaudert, hätte er mich wohl wieder verwiesen. Ich aber schwieg, postierte mich neben ihn, schränkte die kleinen Hände hinter dem Rücken – und er machte sich wieder an seine Arbeit. Von da an durfte ich bleiben.
Er war mir lieber als all die anderen, zuvorkommenderen Horologen, da ich ihm in unserem wechselseitigen Schweigegelübde nichts vorspiegeln musste. Und er schloss wohl, so ruppig er tat, meine Neugier ein wenig ins Herz. Mit jeder Handbreit, die in jenem Sommer draußen die Mittagssonne sich Abstand zu den Hügeln erklomm, durfte ich etwa ebenso viel dem Werken und Wirken des Meisters näher rücken. Mit jeder Minute, welche die Tage sich Licht gewannen, durfte ich um etwa ebenso länger schauen, bevor es den Meister wieder nach seiner gewohnten gänzlichen Einsamkeit verlangte. Durfte schließlich gar meinerselbst die Räder, Stänglein und Stifte berühren. Durfte dann, solange ich dabei in Stummheit verharrte, ab und an mein Verständnis des Ganzen auf die Probe stellen – fand den Horologen innehalten bei einem Schritt, sich zurücklehnen, mir das Feld überlassend. Wagte dann – mich selbst zu Bedacht zügelnd; mir jeden Griff erst erlaubend, wenn mir der Verstand zuvor dreifach bestätigte, was mir eigentlich als Wissen schon in Fleisch und Blut saß – das Werk des Meisters um zwei, drei Handlangungen fortzuführen.
Zeiht mich des Hochmuts, wenn ich Euch berichte, dass mich mein Uhrmacher dabei kein einziges Mal zurück- und zurechtwies. Doch so verhielt sich’s. Ich fehlte nicht – hätte zu fehlen gar nicht vermocht. Zu fehlen, das hätte bedeutet, eine Wahl zu sehen der Möglichkeiten. Doch meinem begreifenden Blick war nur das Richtige überhaupt sinnig.
Es wäre dem Meister niemals ein Lob über die Lippen gekommen; doch empfand ich, dass es ihn halb amüsierte, halb Achtung ihm abrang, wie ich Knirps mit noch tapsigen Händen, doch unfehlbar zugreifendem Verstand ihm allerlei Stücke seiner Kunst vor- und vollführte. Halb einem dressierten Äffchen gleich, an dem man sich ergötzt, weil es ein unbeseeltes Menschenimitat von solcher Ähnlichkeit abgibt – ein mechanisch-äußerer Nachvollzug ohne inneren Hall, ein drollig verzerrter Spiegel des eigenen, erhobenen Seins. Halb aber offenbar als Wunderkind – als ausgewachsener Geist in einem noch zu jungen, zu kleinen Körper herabgereicht, zur Vollendung vorgeformt durch etwas jenseits irdischer Erfahrung. Dass ihm meine Vorstellung jedoch bei allem schmunzelnden Amusement eine gewisse Hochachtung einflößte – das äußerte er eines Tages mit jenem rostigen Schatz, von welchem ich Euch sprach.
Zu jener Zeit war ihm meine Anwesenheit schon so zur Gewohnheit geworden, dass ich oft verweilte, bis mich das Läuten vom Kirchturm zum Abendbrot nach Hause rief. Doch auch dann nahmen wir nie förmlichen Abschied; schlich so stumm ich hinaus, wie ich kam. An diesem Tag aber war ich schon bis auf zwei Schritte an der Schwelle, da hörte ich’s hinter mir grunzen. Ich hielt inne, wagte mich nicht vor noch zurück – es klang so unwirsch, dass ich’s nicht grade als Einladung zum Verweilen deutete. Ein mürrischer Räusperer sprach daraufhin diese Einladung aus, so gut’s der Meister vermochte, ohne bei meiner- noch seinerselbst Zweifel zu säen an seiner Menschenfeindschaft. Ich blickte mich um – und sah ihn dasitzen, mir zugewandt, eine Hand mir entgegengestreckt. Und in dieser Hand: Eine Zange. Es war eines seiner ältesten, morschesten Werkzeuge – längst eigentlich bestimmt, auf den Unrat zu wandern, ihm nur noch selten und unzuverlässig zu Diensten. Und mir dennoch teurer als Gold, Edelstein und Geschmeide, als ich ahndete: Sie solle meins werden!
Ich schlich behutsam zur Werkbank zurück, als wäre die Zange ein scheuer Vogel, den ich nicht aufscheuchen durfte. Starrte großäugig dabei dem Horologen ins Antlitz, wie um dort sein aufforderndes Lächeln zu bannen – voller Furcht, es möchte sich im letzten Moment noch wandeln zu einem höhnischen Grinsen, mit dem der Meister mir die vermeintliche Gabe wieder entzöge. Doch zu guter Letzt stupsten meine Finger wahrhaftig gegen das speckige Eisen. Schnappten dann einem Raubtier gleich zu; schnappten und zerrten aus der Uhrmacherhand und schoben – schwupps! – unter den Kittel die Zange, dass sie sogleich geborgen war vor jedem Sinneswandel des Schenkenden. Dieser lachte auf, wohl zufrieden, zwischen uns keine weitere Vertrautheit aufkeimen zu sehen, kein Anerkennen, dass seine Geste Bedeutung hatte und Größe.
Ich floh mit meinem Schatz hinaus, an den Dorfrand, in eine Kuhle am Stamm einer Eiche, welche mir lieb war als Ort, dort im Verborgenen nachzuhängen meinen Gedanken und mein Hirn an seinen Gespinsten weben zu lassen. Erst daselbst wagte ich es, die schwitzige Faust mit der Zange hervorzuziehen und Letztere zu betrachten. Freilich kannte ich dieses Werkzeug; hatte es schon manches Mal an der Werkbank benutzt. Es war daran weder neues Geheimnis ergründbar, noch Schönheit zu bewundern. Zwei Flügel aus rostigem, grob behauenem Eisen, ein genieteter Stift, sie im Hebelkreuz zu verschränken: Dies war alles. Und doch war es genug, mir die Welt zu verändern. Denn ich war bisher ja allein auf meinen Geist angewiesen, der Dinge Natur zu durchdringen; war bisher darauf beschränkt – wie tief auch und erhebend –, allein zu verstehen. Was ich hier nun hielt in meinen kindlichen Fingern, das war meine erste erwachsene Handhabe, zu wirken in der Welt und auf sie.
Oh, wie schnell sollte mir dies jedoch zum Verhängnis werden! Gebt einem zergliedernden Verstand wie dem meinen solch Ding in die Hände, und was soll anderes geschehen, denn dass er zerteilt und zerlegt auch im unmittelbaren Sinne. Klug genug war ich, die Zange wie Kontrabande nach Hause zu schmuggeln – wohl ahndend, dass der Vater sie mir nicht lange gelassen hätte. Eine Schachtel barg ich unter der Schlafstatt, und darin war mein gesamter Besitz gehütet: Eine Handvoll geliebter Murmeln, ein Holzkreisel nebst seiner treibenden Peitsche, einige in meinen Augen außergewöhnlich geformte, gefärbte Kiesel, Vogelfedern, Eierschalen, ein zur Puppe geknotetes Schnupftuch und dergleichen Kindertand mehr.
Unter all dies bettete ich mit Behut und Bedacht meine kostbare Zange – welche mir jenes Spielzeug mit einem Male so albern und wertlos erscheinen ließ wie Putz und Gaben von Wilden, die jedes niedere Glitzern zur Ehrfurcht verführt. Nur wenn ich sicher mich wusste vor Vater und Amme, wagte ich es, die neue Errungenschaft heimlich hervorzukramen, streichelte sie, polierte mit Atemhauch und Kittelzipfel sie, um ihrer Stumpfheit wenigstens eine Andeutung von Glanz zu verleihen – und dann erst wagte ich auch, sie zu erproben. Erst zwackte ich lediglich Stücke aus der Luft; dann wollte am eigenen Leib ich erfahren, wie der platte Zangenkopf den Druck meiner Hand verstärkte und konzentrierte, zwickte mich vorsichtig, staunend, aber begierig an Fingern, Schenkeln und Ohr näher und näher heran an die Grenze der Pein. Schob damit doch nur hinaus, was ich von Anbeginn wusste: Dass ich dies Werkzeug zu seinem wirklichen Zwecke würde gebrauchen – und es in unserem Heim nur Eines gab, das dafür bestimmt sein konnte. Freilich vermochte ich noch eine Weile, das hungrige Mäulchen der Zange mit anderem zu sättigen – ließ es an Schuhnägeln knabbern und Möbelbeschlägen, doch stets nur zum Schein, ohne wirklichen Biss oder Zug. Doch stillte all dies ihr wahres Begehr ebenso wenig wie meines: Nämlich dem Fischer sein Geheimnis zu entreißen.
Jener Fischer gehörte zu einer Kostbarkeit an unserer Stubenwand – dem zweiten horologischen Luxus, welcher sich unter des Vaters Dach geschmuggelt hatte, und zwar dieser als ein Erbstück der Mutter: Ein Uhrenbild im rechteckigen Rahmen war’s, welches eine ländliche Szene zeigte – im Vordergrund auf einem Teich besagter Fischer in seinem Nachen, in der Halbferne inmitten von Feldern ein Dorf, dessen gepinselter Kirchturm auf seinem Zifferblatt tatsächliche Zeiger im wahren Minutengang kreisen hatte. Wenn das hinter dem Gemälde verborgene Uhrwerk jedoch zur vollen Stunde schlug, dann erwachte der Fischer zum Leben. Sein Oberkörper kippte zurück, sein Arm zog an der Rute – und an deren Schnur zerrte es einen glubschäugigen Fisch halb aus den flachen Fluten. Befreie ich meine Erinnerung von verklärendem Kinderblick, dann war dies bewegte Bild wohl ein gar grobes Werk: Die Malerei keinen Deut besser denn jene der Miniatur meiner Mutter, womöglich sogar vom nämlichen Künstler – in Proportionen und Perspektive von Bauern-Manier, fehlstichig und unnuanciert in den Farben, mangelnd aller Schattierung. In seiner Mechanik hätte es mir allemal durchschaubar erscheinen müssen. Und wäre dies wohl auch gewesen, hätte ich nur vermocht, es im Geist auf Achsen und Hebel zu reduzieren, es allein für das klägliche Arrangement von drei, vier Blechgliedern und eines Stückes Faden anzusehen, welches es war. Doch vergesst nicht: Noch zählte ich kaum fünf, sechs Jahre. Und wie ich später noch öfters erfuhr, lässt der menschliche Geist sich durch nichts so leicht täuschen wie selbst die ärmlichste Vorgaukelei einer Wesensverwandtschaft. Gebt etwas nur die krudeste Ähnlichkeit von menschlichem Angesicht oder Gestalt – man wird halb es schon beseelt glauben von menschlichem Leben, menschlichem Willen. Hatte ich damals bereits noch so viel mechanisches Genie – dieses Bild schien mir eher wie Zauberei.
Doch wo die große Standuhr auf mich von Anbeginn eine Art leiblichen Reiz ausübte, welcher sich an der bloßen, empfindenden Nähe ergötzte, verhielt es sich mit diesem Bild anders: Sobald mein Verstand weit genug erwacht war, zu begreifen, dass die bepinselte Fassade nicht mittels Magie animiert ward, sondern sich dahinter eine besondere Art von Uhrwerk verbarg, da drängte er bereits auf Entzauberung, gierte nach Offenlegung der Illusion.
Oh, wie ich lauerte! Oh, wie ich Vorwürfe formte und wieder verwarf! Es gingen Wochen einher, in welchen mein Bewusstsein des Werkzeugs unter der Bettstatt mir schier den Schlaf aus dem Kopf zwacken wollte. Bis endlich, endlich Zeitpunkt und Weg gefunden schienen, mein Werk zu vollbringen: Nämlich an einem Tage, da den Vater ich in der Schulstube wusste, seine Lateinschüler instruierend. Und die Haushälterin (zu welcher die Amme mittlerweile geworden) unten am Bach, da sie den Waschweibern niemals traute, ihr Werk hinreichend sorgfältig zu verrichten, und noch mehr fürchtete, es möge ihr eine Gelegenheit zum Schwatz leichtfertig entgehen. An solchem Tage also – ein Dienstag war’s, ich weiß es noch – schlich ich mich in die Stube und rückte einen Stuhl an die Wand. Leicht gelang es mir nicht, denn das Möbel war schwer und ich ungelenk. Doch nach einigem Schleifen, Zerren und Balancieren lag schließlich das Uhrenbild vor mir auf unserem Stubentisch. Ich wandte es um – und setzte die ausgehungerte Zange an die sich mir darbietenden Stifte. Ich fasste und zog, bald befreit von der ersten Unbeholfenheit eines Gesellen, welcher wohl das Prinzip verstanden hat, doch ungeübt ist in der Tat, und hatte nach kurzer Weile bereits die hölzerne Rückwand von dem Bilde abgekniffen.
Ich hob sie ab – und war enttäuscht, im Sinne des Wortes. Mir offenbarte sich da ein Mechanismus von kaum größerem Raffinement denn jene klobigen, klotzigen Uhren, welche die Horologen zuorts im Dutzend die Woche zusammenklopften. Das sollte alles Geheimnis schon sein? Ich hatte freilich im Grunde erkannt, dass dem so war – hatte ausreichend Anlass, diese Schande der billigen Täuschung sogleich zu versiegeln und alle Spuren meines Tuns auszulöschen. Jedoch wallte in mir wider alle zarte, kindferne Vernunft eine heiße, den Glauben zornig verweigernde Wut. Ich schickte mich an, das schlichtsinnige Räderwerk weiter zu zerlegen, irgend Mysterium aufzustöbern. Und gedieh darin halbwegs weit – ward aber vom Zorn ob meiner eigenen Leichtgläubigkeit so verblendet, dass ich schluderte. Dass ich ansetzte, mich beim ersten Widerstand sogleich der Ungeduld ergab, abglitt – und mir mit dem Werkzeug tief in den linken Handballen fuhr.
Ihr ahndet das Geschrei! Im Augenblick war jedes Bedenken verloren und ich aus der Tür, plärrend mir Linderung, Trost zu versorgen. Ich lief durch den Ort, die zerschundene Hand hochgereckt, als Bitte zur Hilfe so sehr wie zur blutüberströmten Anklage meiner Geschicke. Da mein Lebenssaft reichlich und hellrot herabquoll, den ganzen Arm mir bald benetzte, gab dies ein rechtes Spektakel, weit über der wahren Bedrohlichkeit meiner Wunde. Es rief mein Geschrei, mein purpurtriefender Anblick die Leute aus ihren Häusern, aus den Gassen zusammen. Man rannte herbei, fing und hielt mich, zeterte, zerrte an mir, zerstritt sich darob, was anzufangen sei. Die einen wollten den Pfarrer zueilen lassen, auf dass ich meine Seele nicht ungesalbt aushauchen möge; die anderen, irdischer ge- und besonnen, schickten dem Bader; die dritten riefen den Vater, holten die Haushälterin schon herbei. Sodass – als der große Tumult sich allmählich beruhigte und man einsah, dass ich nicht stürbe; als meine klaffende Hand versorgt und verbunden war – ich mich also mit versiegenden Tränen zu Haus wiederfand, in der Obhut von Vater und einstiger Amme. Welche bald Schreck und Besorgnis überwanden, alle tröstenden, kosenden Worte verstummen ließen, alles Tätscheln und Hätscheln versagten – um an deren Statt einem gewaltigen Zorn Bahn zu bereiten.
Denn freilich empfing sie beim Betreten der Stube die ganze Misere, welche ich daselbst so unvermittelt und überstürzt verließ. Es mischte sich in des Vaters Erleichterung, mich außer Gefahr meines Lebens zu wissen, geschwind und gärend zugleich die Ahndung, wie leicht ich mir schlimmere Versehrung hätte zufügen mögen, als auch die Erkenntnis des Schadens, den ich der wertvollen Wandzierde beigebracht. Und die Haushälterin sah in jedem Jota von Wut und Schuld, welche sie auf mich abzulenken vermochte, eine Minderung ihrer eignen Vernachlässigung aufsehender Pflicht. Kurz: Es fand die Narbe in meiner Hand noch Tage Gesellschaft in den peinvollen Striemen, welche die Rute des Vaters auf meinem Gesäß hinterließ; und ich fand weder Hilfe noch Trost, sondern schnell wieder Anlass zu greinen, sowie meinerselbst im Bett mit salzig genässten Wangen und knurrendem Grollen im Bauch, welchem auch das Abendbrot zur Strafe versagt blieb.
Das ärgste und bleibendste Weh aber versetzte mir, dass der Vater im heiligen Zorn vor meinen Augen das halb ausgeweidete Werk des Uhrenbilds vom Stubentisch wischte und zum Kehricht warf. Ich hatte es doch nie zerstören wollen – hatte es doch auch nicht zerstört! Ich wollte es nur ergründen und hätte es, wäre es nicht um mein Missgeschick, heil wieder zusammengefügt! Nicht allein ob meiner Wunden vergoss ich die Zähren – sondern um jenes geliebte Wunderwerk, welches meiner Neugier unbeabsichtigtes Opfer ward. Ein besonderer Zorn schwelte in mir, da ich den Vater verdächtigte, selbst keineswegs in blinder Überhastung gehandelt zu haben – sondern durchaus erkennend, dass meine nicht verheerende, sondern lediglich zergliedernde Tat mit wenigem Aufwand rückgängig zu machen gewesen wäre. Und eigentlich er, indem alles zum Unrat verschwand, mich erst zum Zerstörer machte – weil er durchaus wollte, dass meine Schuld einer gewaltigen Strafe angemessen sei.
Dies aber weckte in mir, kaum waren die Tränen getrocknet, eine noch größere Gewalt: Meinen Trotz. Ich sollte dem Vater sein Unrecht beweisen! Nicht etwa hadernd mit ihm im Disput – sondern durch ebenso stumme wie unwiderlegbare Tat. Eins kam mir dabei zugute: Selbst wenn mich meine Verletzung überstürzt zum Haus hinausgetrieben, hatte doch ein Ding sich in meinen Gedanken vor Schreck und Schmerz gedrängt. Mein kostbares Werkzeug, mein beißender, reißender Schatz! Das Uhrwerk in seinen Einzelteilen hatte ich der Entdeckung anheimgegeben – doch meine Zange hatte ich noch, kaum bewusst, mir unter den Kittel geschoben, bevor ich um Hilfe lief. Sie harrte nun unter der Bettstatt wieder in ihrem Kästlein – bereit, doch noch den heilenden Teil ihres Werkes zu tun. So passte ich zwei Morgen später eine unbeobachtete Stunde ab, schlich mich zum Kehrichthaufen und klaubte fein säuberlich heraus, was wohl einst Corpus und Eingeweide des Uhrenbilds ausmachten. Bei aller Heftigkeit, mit welcher der Vater sich dessen entledigte, war zwar das Werk aus allen Fugen geraten, seine Einzelteile jedoch hatten kaum weiteren Schaden genommen. So gelang es meinen geduldigen Augen, findigen Fingern, meiner säubernden Spucke, nach und nach auf dem Stubentisch nahezu wieder jene Szene zu häufen, welche ich so jäh und verräterisch zurückgelassen.





























