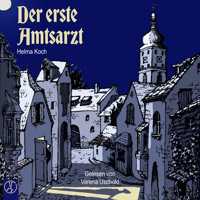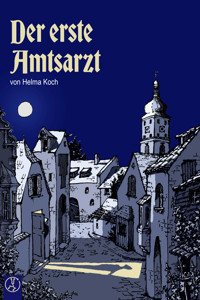
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Yellow King Productions
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Diese regional angesetzte, medizinhistorische Kriminalgeschichte aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stützt sich auf schriftliche und mündliche Quellen. Die Geschehnisse sind beispielhaft für diese Zeit des Umbruchs und vermitteln eine Fülle von Wissen. Im Mittelpunkt der Begebenheiten steht der erste Amtsarzt im damaligen Sulzbach, eine herausragende Persönlichkeit und Vater des Leibarztes von König Ludwig II. von Bayern. Helma Koch, Apothekerin i. R. Museumsführerin im Museum Alte Hof-Apotheke in Sulzbach-Rosenberg, Mitarbeiterin im Freilandmuseum Goglhof in Eberhardsbühl.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 65
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort und Danksagung
Die Bäuerin
Die Polizisten
Der Amtsarzt
Der Apotheker
Die Schaufel
Der Bauer
Das Kindergrab
Nachts beim Pfarrhaus
Der Kirchgang
Der Selbstmord
Im Dunkeln
Der Tümpel
Das weiße Kopftuch
Anhang: Medizin & Pharmazie in Sulzbach um 1800
Biografie der Autorin
Helma Koch
Der erste Amtsarzt
Impressum
Copyright © Yellow King Productions 2023
Mario WeißNeuöd - Gewerbepark 12a92278 IllschwangE-Mail: [email protected] Web: www.yellow-king-productions.de
Autorin: Helma KochHerausgeber: Mario Weiß Anhang: Dr. Markus LommerLektorat: Coralie Baier, Mario Weiß
Redaktion: Kristof KurzCover: Stefanie Adam, Kristof KurzCovergestaltung: Marco Rubenbauer
ISBN: 978-3-946309-39-0
Vorwort und Danksagung
Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, in welcher diese Geschichte spielt, war infolge der rasch zunehmenden Erkenntnisse in den Naturwissenschaften auch eine Zeit des geistigen Umbruchs. Durch die zunehmende Wissensverbreitung wurden die Menschen freier vom Aberglauben und selbstbewusster gegenüber Obrigkeit und Mitmenschen.
Der zu dieser Zeit in Bayern verantwortliche Minister Montgelas führte das Amtsarztwesen ein. Dieses umfasste weit mehr als nur unmittelbare ärztliche Tätigkeiten: Regelmäßig mussten Berichte mit detaillierten Beschreibungen der damaligen Lebensumstände nach München geschickt werden. Zusammen mit Einträgen, Kirchenbüchern und persönlichen Überlieferungen waren sie die Grundlage für meine Kriminalgeschichte.
Auf Namen, detaillierte Personenbeschreibungen und Nebenfiguren habe ich bewusst verzichtet; der historische erste Amtsarzt in Sulzbach hieß jedoch Dr. med. phil. Christoph Raphael Schleis von Löwenfeld (1772-1852), der Vater des späteren Leibarztes Ludwigs II., König von Bayern.
Zwar liegt mit Der erste Amtsarzt keineswegs der erste historische Roman mit »Sulzbacher« Thematik in Ihren Händen – Die Martinsklause von Ludwig Ganghofer (Berlin 1929; 1951 verfilmt von Richard Häussler) hat das im 12. Jahrhundert von den Sulzbacher Grafen gegründete Stift Berchtesgaden im Blick. Horst Wolfram Geisler publizierte kurz danach Die Dame mit dem Samtvisier über die bayerische Erbprinzessin Maria Anna von Pfalz-Sulzbach (München 1931). Erst 2016 erschien im Sulzbach-Rosenberger Verlag Yellow King Productions, der auch mein Werk noch einmal in der Ihnen vorliegenden Fassung veröffentlicht hat, der Titel Barbarossa und die Wäscherin – Die geheime Liebe des Königs von Barbara Reik (wiederum aus der Welt der Sulzbacher Grafen des Hochmittelalters). Der erste Amtsarzt jedoch ist die erste regionale medizinhistorische Kriminalgeschichte aus der Stadt in der Oberpfalz.
Wer sich eingehender über den Amtsarzt und diese spannende Zeit im Sulzbacher Raum informieren möchte, findet im Anhang ein von Stadtheimatpfleger Dr. Markus Lommer (Gründer und Leiter des Museums »Alte Hof-Apotheke«) verfasstes lokalhistorisches Zeitbild aus wissenschaftlicher Perspektive.
Danke
An alle, die mein zartes literarisches Pflänzchen gesät, gegossen, gedüngt, gehackt, von Ungeziefer befreit und vor Kälte geschützt haben.
Herausgekommen ist ein sortenreines oberpfälzisches Gewächs.
Die Bäuerin
Sie war weg. Zu der Zeit, in der diese Geschichte spielte, war dies etwas gänzlich Unerklärliches.
Sie war weg.
Der Bauer stand an diesem Morgen reglos vor der Haustüre und starrte ins Leere. Er sah verwahrlost aus und an seinem Kopf klaffte eine große Wunde. Er versuchte, sich an den gestrigen Abend zu erinnern. Im Wirtshaus war er gewesen, sehr lange, und dann – man hatte ihn gehänselt, dass ihn seine Frau wohl diesmal nicht abholen und heimführen würde. Aber vielleicht sei sie ja schon unterwegs. Gedemütigt dadurch, dass er ohne seine Frau so hilflos gewesen war und voller Zorn darüber hatte er sich alleine auf den Weg gemacht. Einen Stock hatten sie ihm in die Hand gedrückt, damit er sich auf den Beinen halten konnte. So war er losgestolpert und dann … was war dann? Er war wohl hingefallen und musste eingeschlafen sein. Irgendwann hatte er sich auf dem Schotterboden liegend wiedergefunden, sich dann an den schmerzenden Kopf gefasst und klebriges Blut gefühlt. Neben ihm war der Stock gelegen. Er hatte ihn wütend gepackt und von sich geschleudert. Da hatte er etwas klarer denken können und war den restlichen Weg heimgelaufen.
Und dann heute Morgen … diese unheimliche Stille. Die Kinder schliefen noch, obwohl es Zeit für die Schule war. Nur die Tiere machten sich bemerkbar, die Hühner im noch geschlossenen Hühnerhaus und die Kühe, die gemolken werden wollten. Sonst nichts. Keine gewohnten morgendlichen Geräusche wie knarzende Schritte, Geschirrgeklapper, der Klang abgestellter Milchkannen und das Bellen des Hundes. Ja, wo war eigentlich der Hund?
Irgendwann hörte der Bauer das Getrappel von Kinderschritten. Doch niemand schaute nach ihm. Die Mutter hatte die Kinder gewarnt, ihn an solchen Tagen besser nicht anzusprechen. Er öffnete mit mechanischen Bewegungen das Hühnerhaus. Mit lautem Gackern und Flügelschlagen stürmte das Federvieh nach draußen, denn die Zeit dafür war längst überfällig. Doch das gewohnte Futter fehlte, und bald staksten die Hühner mit langgezogenen Kreischtönen umher.
Dann wurde es wieder still, die beiden Kinder hatten sich eilig und selbständig auf den eineinhalb Stunden langen Schulweg nach Sulzbach gemacht. Vielleicht würde sie ein Fuhrwerk mitnehmen. Der Lehrer würde ihnen ihre Erklärung für das Zuspätkommen glauben, da er wusste, dass sich die Mutter normalerweise sehr um ihre Kinder kümmerte.
Doch am nächsten Morgen kamen sie noch später und mit ernsten Mienen auf den Gesichtern. Die Mutter sei nicht mehr da und der Vater spräche nicht mit ihnen. Seine schmutzige, blutverschmierte Kleidung hätten sie ihm waschen müssen und am Kopf habe er eine große Wunde. Der Lehrer schaute die Kinder nachdenklich an, er glaubte ihnen. Es war nicht seine Aufgabe, hier nachzuforschen, aber seine Pflicht, dies bei der Polizei zu melden. Deshalb ging er nach dem Unterricht zur Hauptwache gegenüber der Marienkirche. Einen älteren und einen ganz jungen Polizisten traf er dort an, die sich über den Besuch zunächst freuten. Doch sie nahmen die Aussage sofort ernst, denn die Bäuerin galt als äußerst zuverlässig. Es musste etwas vorgefallen sein, von dem die Kinder nichts wussten. Und der Bauer? Wusste er etwas? Sein Jähzorn war bekannt, der Wundarzt konnte das bestätigen. Die Sympathie der Bevölkerung galt deshalb mehr der klugen und ruhigen Bäuerin, welche in letzter Zeit immer ernster und ruhiger geworden war.
Mittlerweile waren die anderen Schulkinder mit der Neuigkeit von der verschwundenen Bäuerin nach Hause gekommen. Als dann die beiden Polizisten aus ihrer Amtsstube traten und sich auf den Weg zum besagten Bauernhof machten, verbreitete sich dies wie ein Lauffeuer in der kleinen Stadt. Auf dem Platz vor dem Rathaus, wo sich auch der Kramladen befand, bildeten sich schnell Grüppchen von Menschen, teils mit betretenen und teils mit aufgeregten, beinahe freudigen Gesichtern.
Eine Gruppe von Dienstmägden hatte ihre eigene Meinung dazu. Hochnäsig sei sie gewesen, die Bäuerin mit ihrer Verschwiegenheit, und ständig habe sie ein weißes Kopftuch getragen. Sie hätte als Großbäuerin ruhig zufrieden sein können. Sollte sie erst einmal selbst eine Dienstmagd machen! Doch der Bauer war fleißig und es war immer genug Essen auf dem Tisch gewesen, sogar in den beiden Hungerjahren ab 1816, in denen es keine Sommer gegeben hatte.
Damals hatte es erst Ende Juni gegrünt und zu dem Dauerregen waren bis auf wenige Wochen im Juli und August ständig winterliche Temperaturen gekommen. Auf den Weinbergen am Bühl in Sulzbach hatte es nur verfaulte Trauben gegeben. Doch die Bäuerin hatte es sich sogar leisten können, einem Künstler auf dem Jahrmarkt ein Bild von einem Sonnenuntergang abzukaufen.
Ja, die Sonnenuntergänge in diesen beiden Hungerjahren waren seltsam gewesen. Das Licht hatte schwefelgelb gestreut und die Künstler zum Malen und die Abergläubischen zu phantasievollen Erklärungen angeregt. Niemand hatte je von einem so extremen Wetter gehört. Dass dies mit dem Ausbruch eines fernen Vulkans, des Tambora, zu tun hatte, entdeckte man erst 200 Jahre später.
Ja, und der Amtsarzt sei in letzter Zeit auffallend oft zu diesem Bauernhof gegangen. Sicher, seine dienstlichen Aufgaben verlangten, dass er sich sorgfältig um seine Mitmenschen kümmerte und regelmäßig Berichte über Land und Leute, Tiere und Pflanzen, Wasserqualität, Krankheiten und Lebensweise der Bevölkerung nach München schickte. Aber – die verschwundene Bäuerin war auch eine schöne Frau.
Außerdem hatte man sie jüngst zu verschiedensten Zeiten ins Pfarrhaus gehen sehen, was die Phantasie entsprechend veranlagter Menschen noch zusätzlich anregte.
Wussten Arzt und Pfarrer mehr?
Was war geschehen?