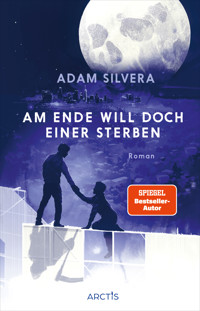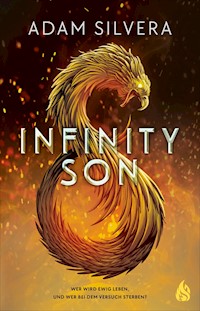17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arctis Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Das Prequel zu Adam Silveras Weltbestseller und TikTok-Hit AM ENDE STERBEN WIR SOWIESO! Willkommen zur ersten Nacht des Todesboten. Schon seit vielen Jahren rechnet Orion Pagan damit, dass er wegen seiner ernsten Herzerkrankung bald sterben wird. Um nicht länger jeden Tag in Angst zu leben und sich von geliebten Menschen verabschieden zu können, meldet er sich beim Todesboten an. Und er will ein einmaliges Event besuchen: die Todesboten-Premiere am Times Square. Einen Abschiedsanruf zu bekommen, ist das Letzte, woran Valentino Prince denkt – er hat sich nicht einmal für den neuen Dienst angemeldet. Er ist für eine Karriere als Model nach New York gekommen und entscheidet sich, seine erste Nacht auf der Premiere zu verbringen. Orion und Valentino begegnen sich, mitten im Herzen New Yorks, und ihre Verbundenheit ist sofort unumstößlich. Doch als die ersten Todesboten-Anrufe die Runde machen, ändert sich alles. Denn einer der beiden erfährt, dass er bald sterben muss – während das Leben des anderen nach dem außergewöhnlichen, herzzerreißenden Tag nie mehr dasselbe sein wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Adam Silvera
Der Erste‚ der am Ende stirbt
Aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Diestelmeier und Barbara König
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel The First to Die at the End bei Quill Tree Books, ein Imprint von HarperCollins Publishers, New York
© Atrium Verlag AG, Imprint Arctis, Zürich 2022
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2022 by Adam Silvera
Published by Arrangement with Adam Silvera
All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Übersetzung: Katharina Diestelmeier und Barbara König
Lektorat: Petra Deistler-Kaufmann
Coverillustration: Simon Prades
Coverüberarbeitung: Svenja Sund
www.arctis-verlag.de
Folgt uns auf Instagram unter @arctis_verlag
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03880-167-2
www.arctis-verlag.com
Folgt uns auf Instagram unter www.instagram.com/arctis_verlag
Für alle, die mich bereits von Anfang an begleiten.
Ein herzlicher Gruß an Nicola und David Yoon,
meine Lieblingsnachbarn mit den allergrößten Herzen.
Sie zeigen mir immer und immer wieder,
wie Liebe aussehen sollte.
Erster TeilDie Premiere
Alle wollen wissen, wie wir den Tod voraussagen können. Dann sagt mir mal: Bevor ihr in ein Flugzeug steigt, bittet ihr da auch den Piloten, euch die Gesetze der Aerodynamik zu erklären? Oder fliegt ihr einfach mit zu eurem Bestimmungsort? Ich möchte euch dringend raten, euch nicht damit zu befassen, wie wir euren Tod vorhersagen können. Konzentriert euch lieber darauf, wie ihr euer Leben lebt. Das Ende ist näher, als ihr denkt.
Joaquin Rosa, Schöpfer des Todesboten
30. Juli 2010Orion Pagan
22:10 Uhr
Vielleicht ruft mich der Todesbote ja um Mitternacht an. Das wäre allerdings nicht das erste Mal, dass mir jemand sagt, dass ich sterben werde.
Ich kämpfe schon seit einigen Jahren um mein Leben, da ich schwer herzkrank bin. Und jedes Mal, wenn ich mich zu sehr auslebe, muss ich Angst haben, plötzlich tot umzufallen. Irgendwann ist dann aus dem Nichts diese Organisation aufgetaucht, die sich der Todesbote nennt. Und hat behauptet, sie könne nicht nur voraussagen, ob, sondern wann jemand stirbt. Klingt eigentlich eher nach der Art von Kurzgeschichte, die ich gern schreiben würde. Nur beschert mir das echte Leben so einen Erfolg leider nie. Das Ganze wurde dann sehr schnell sehr echt, als vom Präsidenten der Vereinigten Staaten eine Pressekonferenz einberufen wurde, in der er den Schöpfer des Todesboten vorstellte und bestätigte, dass diese Leute unser Schicksal tatsächlich vorhersagen können.
Noch am selben Abend habe ich mich beim Todesboten angemeldet.
Und nun hoffe ich einfach, nicht einer der Ersten zu sein, der quasi zeitgleich zum Startschuss der Mission den Anruf bekommt, der meinen Abschiedstag einläuten wird.
Wenn doch, dann weiß ich wenigstens, dass das Spiel aus ist.
Bis dahin aber werde ich leben.
Und dazu gehört, dass ich an einer einmaligen Veranstaltung teilnehmen werde: der Premiere des Todesboten.
Der Todesbote veranstaltet im gesamten Land unglaublich viele Partys, wahrscheinlich um die allgemeine Stimmung zu heben und die Werbetrommel für eine Organisation zu rühren, die unseren bisherigen Blick auf Leben und Tod völlig verändern wird. Sie sind schon an ganz vielen Orten unterwegs, beispielsweise auf dem Santa Monica Pier in Kalifornien oder im Millennium Park in Chicago oder im National Museum of the United States Air Force in Ohio oder auf der Sixth Street in Austin, um nur ein paar der Locations zu nennen. Ich werde natürlich am besten Ort überhaupt sein, nämlich am Times Square, im Herzen von New York, wo die ersten Büroräume des Todesboten ihren Hauptsitz haben. Ich liebe meine Stadt, aber an Silvester würdet ihr mich nie am Times Square erwischen – da ist es viel zu kalt. An einem heißen Sommerabend für so ein historisches Ereignis hier zu sein, finde ich wiederum sehr cool.
Es ist echt krass, was der Todesbote im ganzen Land so auf die Beine stellt. Oder allein am Times Square. Die Großbildschirme werben ja immer für Millionen Sachen gleichzeitig; da ist wirklich alles dabei, von Limonade über Serienhypes bis hin zu irgendwelchen neuen Websites. Aber nicht heute Abend. Heute siehst du auf jedem Bildschirm nichts außer einem digitalen schwarzen Stundenglas vor einem grellweißen Hintergrund. Das Stundenglas ist fast voll, was bedeutet, dass die Anrufe des Todesboten um Mitternacht losgehen werden. Doch das ist längst nicht alles. Es kommt einem fast so vor, als wäre das Produkt, das uns der Todesbote verkaufen will, die Zeit an sich. Und das Marketing funktioniert. Überall sammeln sich Menschen um die Info-Stände, als könnte man dort für ein neues iPhone anstehen, und nicht, um mit dem Kundendienst des Todesboten zu sprechen.
»Stell dir vor, wir würden für den Todesboten arbeiten«, sage ich.
Meine beste Freundin Dalma sieht von ihrem Handy auf. »Nie im Leben.«
»Aber mal ehrlich. Irgendwie rettet jeder dieser Anrufe jemandem das Leben, und dann eben doch nicht. Ich frage mich, wie die nachts schlafen können, wenn jeder, den sie während ihrer Arbeitszeit angerufen haben, dann tot ist?«
»Ich weiß ja, dass du ständig den Tod im Kopf hast, Orion, aber du machst mich echt fertig.«
»Na ja, eigentlich habe ich den Tod im Herzen.«
»O Mann, ich hasse dich. Ich werde mir einen Job beim Todesboten besorgen, nur damit ich dich persönlich anrufen kann.«
»Nö, machst du nicht, weil du ohne mich nicht leben kannst.«
Ich sage ihr nicht, dass sie das irgendwann ohnehin wird tun müssen. Keiner rechnet damit, dass ich noch weitere achtzehn Jahre lang lebe. Nicht mal Dalma, selbst wenn sie das nie zugeben würde und immer Pläne schmiedet, was wir beide in unserem Leben noch alles zusammen anstellen können. Wie ihr Traum von meiner ersten öffentlichen Lesung, von dem sie jedes Mal spricht, wenn ich mich mal wieder dahinterklemme, einen Verlag für meine superkurzen Kurzgeschichten zu finden oder für den Roman, den ich zu gerne schreiben würde, wenn ich nur daran glauben könnte, dass ich ihn noch zu Lebzeiten abschließen kann. Oder wie ich Dalma anfeuern werde, wenn sie die Tech-Welt im Sturm erobert. Oder wie wir über unsere Dates lästern, woran ich, ehrlich gesagt, nicht glaube, weil wir uns eh nie trauen, irgendeinen Typen anzusprechen, den wir süß und/oder interessant finden. Hätte ich nicht dieses bescheuerte Herz, könnten wir all das wirklich zusammen machen, und noch so vieles mehr.
Doch ich muss mich ans Hier und Jetzt halten. Vielleicht werde ich die Zukunft nie erleben, aber noch existiere ich in der Gegenwart.
Allerdings ist es schwierig, den Tod aus dem Kopf zu kriegen – ja, diesmal aus dem Kopf und nicht aus dem Herzen –, während so ein vierzigjähriger Typ an uns vorbeigeht, mit einem Schild in den Händen, auf dem steht: Der Todesbote läutet den Weltuntergang ein. Okay, schon klar, er ist kein Fan des Todesboten, aber zu behaupten, die würden für den Weltuntergang sorgen? Das ist ganz schön heftig. Aber der Typ ist nicht allein. Seit der Todesbote Anfang des Monats vorgestellt wurde, schwafeln die Untergangspropheten von siedenden Ozeanen und verheerenden Stürmen und brennenden Städten, von Niedergang und Zerfall. Ich habe schon kapiert, dass apokalyptische und dystopische Romane momentan total angesagt sind, aber vielleicht sollten alle einmal tief Luft holen und ein wenig runterkommen.
Sich in Sachen Tod ständig verrückt zu machen, beschert einem nicht gerade ein gutes Leben. Trotzdem tun alle zurzeit genau das.
Als hätte das Ende der Welt schon angefangen.
In den letzten Tagen haben Einbrüche in Supermärkten neue Rekordzahlen erreicht: Die Plünderer haben sich mit Konserven und Klopapier und literweise Wasser eingedeckt. Und weil lebenslängliche Freiheitsstrafen keine Rolle mehr spielen, wenn der Weltuntergang wie prophezeit kurz bevorsteht, laufen viel zu viele buchstäblich Amok. Aber nichts trifft mich härter als die Geschichten über Menschen, die sich das Leben nehmen, weil wir einer Zukunft mit zu vielen Unbekannten entgegenrasen.
Ich war echt sauer, als ich von diesen Toten gehört habe.
Wie konnte der Todesbote Zugang zu den entscheidenden Informationen haben und diese Morde und Selbstmorde dann nicht verhindern? Aber anscheinend war das nie Thema. Der Todesbote behauptet, nicht zu wissen, warum jemand stirbt, nur wann. Und bedauerlicherweise ist es wohl so, dass, sobald dein Name in ihrem geheimnisvollen System auftaucht, dein Schicksal in Stein gemeißelt ist – und danach auf deinem Grabstein.
Der Todesbote ist vielleicht nicht allwissend, aber was meine Ängste angeht, wird er Wunder vollbringen. Bekomme ich keinen Abschiedsanruf, kann ich viel mutiger leben; anstatt ständig und immerzu und andauernd alles anzuzweifeln, was ich tue, aus Angst, mein Herz anzupissen und einen Herzstillstand zu verursachen. Und nie wieder wird mich der Tod von geliebten Menschen kalt erwischen. So wie als Neunjähriger, als meine Eltern zu einer Besprechung in die Stadt gefahren sind und getötet wurden, weil ein Flugzeug in den Südturm des World Trade Centers geflogen ist. Natürlich gab es den Todesboten damals noch nicht, aber die Vorstellung, wie ihnen irgendwann klar gewesen sein muss, dass sie gleich sterben werden, wird mich für immer verfolgen.
Ich schiebe diese herzzerreißenden Gedanken ganz weit von mir weg.
Der Todesbote wird dafür sorgen, dass mir nie wieder ein Abschied versagt bleibt.
Na ja, die Möglichkeit, mich zu verabschieden.
Ich weiß, dass ich nicht alle Zeit der Welt habe, ich spüre es in meinem Herzen.
Doch ich möchte noch ganz viele erste Male erleben, auch wenn es vielleicht meine letzten sein werden. Solange ich das noch kann.
Valentino Prince
22:22 Uhr
Der Todesbote kann mich nicht anrufen, weil ich mich für den Dienst nicht angemeldet habe. Er würde es allerdings sowieso nicht tun, da ich mit meinem Leben gerade erst so richtig durchstarte.
Wenn überhaupt, habe ich das Gefühl, heute wiedergeboren zu sein.
Für jemanden wie mich, der in Phoenix, Arizona, geboren und aufgewachsen ist, fühlen sich Wiedergeburten ganz passend an. Jetzt wird es Zeit, mit meinem Leben an keinem geringeren Ort als New York neu anzufangen. Vom Valley of the Sun zum Big Apple. Ich träume schon so lange von dieser Stadt, dass ich in Tränen ausgebrochen bin, als ich am Flughafen meine Bordkarte ausgedruckt habe und da stand: PHX→LGA. Dieses One-Way-Ticket bedeutet, dass ich meine Eltern nie wiedersehen muss. Dass ich mir zusammen mit meiner Zwillingsschwester ein neues Zuhause aufbauen kann.
Wahrscheinlich hätte ich nicht den Fensterplatz buchen sollen. Ich gab mein Bestes, mich zusammenzureißen, als das Flugzeug über die Startbahn schoss und dann abhob. Aber es stellte sich heraus, dass mein Bestes nicht viel taugt. Als all die Gebäude, Straßen und Berge immer kleiner wurden und schließlich verschwanden, weinte ich in den Wolken. Mein Sitznachbar fand das kein bisschen cool. Und ich wünschte mir sofort noch viel dringender meine Schwester auf den Platz neben mir, so wie es eigentlich geplant gewesen war, bevor sich im letzten Moment noch eine Jobmöglichkeit für sie ergeben hat. Zum Glück nimmt Scarlett den ersten Nachtflug, um zu mir in unsere neue Wohnung zu kommen.
Fünf Stunden später, als New York unter mir auftauchte, fühlte sich alles genau richtig an, obwohl ich noch nie einen Fuß zwischen diese Wolkenkratzer und Parks gesetzt hatte. Dann landeten wir, und ich rollte meine Koffer direkt zur Taxischlange, über die sich alle anderen offensichtlich ärgerten. Aber ich war einfach nur unglaublich aufgeregt, dass ich endlich in einem dieser legendären gelben Taxis fahren würde, die ich aus dem Fernsehen und als Requisite aus der Zeitschriftenwerbung kannte. Der Fahrer kapierte gleich, dass ich zum ersten Mal hier war, weil ich ununterbrochen nach draußen auf die Straße glotzte. Mein erster Schritt auf den Bürgersteig fühlte sich an wie ein Filmmoment, als müssten gleich überall die Kameras klicken. Aber das hat noch Zeit.
Jetzt erst mal, heute, kann ich mich als New Yorker bezeichnen.
Oder vielleicht muss ich auch noch warten, bis mein Vermieter mir meine Wohnungsschlüssel überreicht, damit ich sicher sein kann, keinem Betrug aufgesessen zu sein, als ich dieses Apartment im Internet gefunden habe. Während ich warte, sehe ich mich in meiner kleinen Ecke der Upper East Side um. Direkt nebenan gibt es eine winzige Pizzeria, die mich mit dem Duft von Knoblauchbrot anzulocken versucht. Hupende Autos richten meine Aufmerksamkeit wieder auf die Straße, wo jemand, der mein Großvater sein könnte, in sein Handy schreit, damit man ihn über die Musik hinweg hören kann, die aus der Bar an der Ecke dröhnt.
Die Stadt ist laut, und das finde ich genial.
Ob ich wohl je die Ruhe meiner alten Wohngegend vermissen werde?
Die Tür hinter mir geht auf, und da steht ein Mann, der nichts weiter anhat als ein weißes Unterhemd, Basketball-Shorts und Schlappen. Er hat einen dicken Schnurrbart und dünner werdende schwarze Haare und funkelt mich an.
»Kommst du rein?«, fragt er.
»Hallo, ich bin Valentino. Ich bin ein neuer Mieter.«
Der Mann zeigt auf meine Koffer. »Das sehe ich.«
»Ich warte auf den Vermieter.«
Er nickt, geht aber nicht weiter. Als wollte er mich reinlassen.
»Sind Sie Frankie?«
Er nickt erneut.
»Freut mich, Sie kennenzulernen«, sage ich.
Widerstrebend schüttelt er mir die Hand. »Ziehst du jetzt ein, oder was?«
Man hat mich schon vorgewarnt, dass nicht alle New Yorker nett zu mir sein werden, aber vielleicht ist Frankie einfach müde. Immerhin ist es schon ziemlich spät. Ich nehme meine Koffer und folge ihm ins Haus. Es ist ein warmer Abend, doch sobald ich eingetreten bin, verstehe ich, warum Frankie gekleidet ist, als würde er in Arizona morgens die Zeitung reinholen. Hier drin ist es ungefähr so heiß wie im Pizzaofen von nebenan. Der Flur ist schmal und in diesem Senfgelb gestrichen, das den Augen nicht gerade schmeichelt, aber was soll’s, ich respektiere die Wahl. In die Wand eingelassen sind stählerne Briefkästen, und auf dem Fußboden stehen Pakete, die darauf warten, abgeholt zu werden, sowie ein Papierkorb, der von Werbung überquillt, darunter auch Flyer des Todesboten. Offensichtlich haben sich nicht viele Leute in diesem Haus für die Abschiedsanrufe angemeldet. Ich übrigens auch nicht, weil meine Eltern der Sache total skeptisch gegenüberstehen, aber diese Paranoia ist ein weiterer Teil meines Erbes, von dem ich mich trennen muss.
Frankie bleibt auf der ersten Treppe stehen. »Und wo ist die andere?«
»Die andere?«
»Deine Zwillingsschwester.«
»Oh, sie kommt morgen früh nach.«
Frankie steigt weiter die Treppe hinauf. »Wenn noch mehr große Kisten kommen, sorgt dafür, dass ihr euch zügig darum kümmert. Deine ganzen Lieferungen diese Treppe raufzuschleppen, ist meinem Rücken nicht gut bekommen.«
»Das tut mir leid.« Ich musste ein paar Sachen vorab schicken, wie eine Luftmatratze, Handtücher, Töpfe und Pfannen. Obwohl ich annehme, dass der Hauptgrund für Frankies Rückenschmerzen die fünf Kisten mit Kleidern, Schuhen und Accessoires waren, die für mich genauso wichtig sind wie ein Provisorium für die Nacht, bevor meine richtige Matratze am Dienstag ankommt. »Ist der Aufzug kaputt?«
»Der ist kaputt, seit mein Vater hier das Sagen hatte«, erklärt Frankie.
Verstehe. Ich weiß zwar nicht, ob es legal ist, in der Wohnungsanzeige zu schreiben, das Haus habe einen Aufzug, wenn dessen Funktion rein dekorativer Natur ist, aber ich werde das Beste daraus machen. Die vielen Jahre, die ich zu Hause in unserem kleinen Fitnessraum verbracht habe, haben mich auf dieses Leben vorbereitet. Ich zerre meine beiden Koffer, über deren Gewicht von jeweils fast fünfundzwanzig Kilo mich die Waage beim Check-in aufgeklärt hat, hinter mir her. Frankie bietet mir keine Hilfe an, aber das ist okay. Nach der dritten Treppe fällt mir wieder ein, dass meine neue Wohnung im sechsten Stock liegt. Auf meinem unteren Rücken bildet sich Schweiß, und ich bin mir schon jetzt sicher, dass ich mir bei allen künftigen Work-outs das Beinmuskeltraining sparen kann. Oben bin ich außer Atem, aber – eigentlich gibt es kein Aber. Das gehört alles zu meiner Initiation in dieser Stadt. Nichts gibt mir mehr das Gefühl, ein echter New Yorker zu sein, als sagen zu können, dass ich in der Upper East Side im sechsten Stock ohne Aufzug wohne.
Ohne viel Aufhebens führt Frankie mich zu Wohnung 6G. Er heißt mich nicht im Haus willkommen, gratuliert mir nicht zu meiner ersten eigenen Bleibe, sondern schließt einfach die Tür auf. Ich folge ihm hinein und stelle meine Koffer in dem engen Vorraum ab. Gleich links von mir ist das Badezimmer, und obwohl ich weiß, dass ich dort jede Woche mehrere Stunden für meine ausgiebige Gesichtspflege verbringen werde, interessiert mich vor allem der Raum, in dem ich mich hauptsächlich aufhalten werde. Der Holzboden knarrt unter meinen Schuhen, als ich das einzige Zimmer der Wohnung betrete. Die gelieferten Kisten stehen links an der Wand, wo ich mein Bett hinstellen möchte. Zwei Fenster gehen zur Straße raus und ein drittes über der Küchenspüle bietet einen Blick in die Nachbarwohnung. Kein Problem, diese Woche besorge ich noch Vorhänge.
Das größte Problem ist dagegen, wie klein die Wohnung ist. Scarlett und ich verwenden das Geld, das unsere Eltern für unser College gespart haben, um unsere Träume zu verwirklichen – Modeln und Fotografie –, und wir hoffen, es reicht so lange wie möglich, deshalb auch das Ein-Zimmer-Apartment.
»Auf den Fotos im Netz wirkte es größer«, sage ich.
»Die habe ich gemacht«, erklärt Frankie.
»Die waren auch wirklich gut. Aber sind Sie sicher, die richtigen Bilder für diese Anzeige hochgeladen zu haben? Wir hatten eigentlich mit mehr Platz gerechnet.«
Frankie starrt mich an. »Du hättest die Wohnung besichtigen können, bevor du sie gemietet hast.«
»Leider unmöglich. Ich bin gerade erst angekommen.«
»Nicht mein Problem. Deine Schwester und du, ihr habt euch schließlich auch einen Bauch geteilt. Das kriegt ihr schon hin.«
Dann hoffen wir mal, dass sich dieses Ein-Zimmer-Apartment unseren Bedürfnissen entsprechend ausdehnt wie der Uterus unserer Mutter.
Zum Glück für Frankie gehe ich nicht gern auf Konfrontationskurs. Bei Scarlett ist das allerdings anders, aber diese Lektion wird er schon noch lernen, sobald sie hier ist. Am besten betrachte ich es positiv: Ich bin gerade erst in New York angekommen und habe schon eine typische Fehde mit meinem Vermieter angefangen. Der Mietvertrag läuft über ein Jahr, und ich bin sicher, danach werde ich all meinen neuen Freunden eine Menge Geschichten über diese Zeit in meinem Leben zu erzählen haben.
Es klopft an der Tür und ein kleiner Junge kommt rein. Ich bin nicht gut darin, das Alter anderer zu schätzen. Ist er fünf und groß für sein Alter, oder zehn und echt klein? Er kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich weiß nicht, woher.
Der Junge trägt einen Schlafanzug und winkt mir freundlich zu. »Bist du unser neuer Nachbar?«
»Das bin ich. Ich heiße Valentino.«
»Ich bin Paz.«
»Cooler Name, Paz.«
»Es ist die Kurzform von Pazito, aber so nennt mich nur meine Mom. Dein Name gefällt mir auch.«
Das ist mit Abstand das herzlichste Willkommen seit meiner Ankunft.
Bevor ich dem Jungen danken kann, bemerke ich, dass Frankie ihn anfunkelt.
»Warum bist du nicht im Bett?«
»Ich habe Angst wegen dem Todesboten.«
Frankie reibt sich die Augen. »Den Todesboten gibt es nicht. Geh schlafen.«
Paz fängt an zu weinen. »Ist gut, Daddy.« Er schlurft zur Tür und wirft dabei einen Blick über die Schulter, als hoffte er, sein Vater könnte es sich noch anders überlegen. Nichts. Ohne ein weiteres Wort geht er durch den Flur davon.
Ich würde Paz wirklich gerne aufhalten und ihn wegen des Todesboten trösten, aber vermutlich sollte ich Frankies Autorität nicht in seiner Anwesenheit untergraben. Es ergibt sich sicher noch mal eine andere Gelegenheit.
»Netter Junge«, sage ich.
Frankie erwähnt Paz nicht mehr. Er legt bloß zwei Schlüsselbunde auf die Küchen-Arbeitsplatte. »Der große Schlüssel ist für eure Wohnung, der mittlere für unten, der kleine für den Briefkasten. Ich wohne gleich nebenan, aber klopft nicht vor neun oder nach fünf.«
»Alles klar, vielen …«
Frankie geht und macht die Tür hinter sich zu.
»… Dank, Frankie«, sage ich zu niemandem.
Das Apartment wirkt ohne meinen Vermieter zwar kein bisschen größer, aber zum Glück nicht mehr so beklemmend.
Ich schaue auf die Uhr – 22:31 – und will Scarlett über FaceTime anrufen. New York ist Arizona drei Stunden voraus, deshalb rufe ich jetzt an, in der Hoffnung, sie noch zu erwischen, bevor sie die große Todesboten-Feier in Phoenix fotografieren geht. Dieser Job bringt ihr eine Monatsmiete ein, und zusätzlich noch ein bisschen Kleingeld für Fahrkarten und bescheidene Mittagessen. Ich sitze auf der Arbeitsplatte, während ich darauf warte, dass Scarlett sich meldet, und entdecke Frankie durch das Küchenfenster. Natürlich ist das direkt nebenan seine Wohnung. Frankie holt sich ein Bier aus dem Kühlschrank. Hoffentlich ist er ein schläfriger Betrunkener, denn ich finde ihn nüchtern schon ziemlich unerträglich.
Scarlett nimmt den Anruf an. Ihr Gesicht heitert mich sofort auf.
»Val!« Sie stellt ihr Handy auf dem Waschbecken ab, während sie sich schminkt. »Bist du in unserem neuen Zuhause?«
»Allerdings.«
»Zeig mal, zeig mal!«
Ich drehe die Kamera um, um ihr unser Zimmer zu zeigen. Es dauert nicht lange.
»Kommt es mir nur so vor oder …«
»Es kommt dir nicht nur so vor. Es ist wirklich kleiner als angekündigt.«
»Ist die Miete auch geschrumpft?«
»Der Vermieter hat wörtlich gesagt, dass wir das schon hinkriegen werden, da wir uns schließlich auch einen Bauch geteilt haben.«
»Wenn ich Zeit hätte, das Auftragen meines Mascara zu unterbrechen, um die Augen zu verdrehen, würde ich es tun. Aber ich muss gleich los. Bitte sag mir, dass du zum Times Square gehst.«
Scarletts Job heute und die fette Modelkampagne, für die ich gebucht wurde, sind ein Traum für uns, aber sie haben leider auch verhindert, dass wir zusammen die Premiere des Todesboten feiern können. Was Scarlett allerdings nicht davon abhält, mich andauernd zu drängen, die Party auf dem Times Square unbedingt mitzunehmen.
»Ich weiß nicht, Scar. Der Jetlag …«
Scarlett macht das Geräusch eines Buzzers nach. »Falsche Antwort. Du hast drei Stunden verloren, aber du bist nicht müde. Nächster Versuch.«
»Ich sollte mich trotzdem für das Shooting morgen ausruhen.«
»Du bist doch sowieso viel zu aufgedreht, um schlafen zu können, Val. Also, statt dich auf dieser billigen Luftmatratze hin und her zu wälzen, geh da raus, um mitzuerleben, was entweder ein historisches Ereignis sein wird oder die größte Verarsche aller Zeiten.«
»Ich würde wirklich gern Moms und Dads Gesicht sehen, wenn sich der Todesbote als real herausstellt.«
»Ich auch, aber ich werde nicht da sein, um sie zu fotografieren.«
»Du reist direkt nach der Feier ab?«
»Auf jeden Fall. Vor allem, nachdem sie dich heute so behandelt haben.«
Ich bin immer noch ein wenig schockiert. Das Gefühl erinnert mich an das anhaltende Brennen meiner aufgeschürften Ellbogen und Knie, wenn ich beim Laufen gestürzt bin. »Danke für deine Solidarität.«
»Ich wäre ein schrecklicher Zwilling – und ein schrecklicher Mensch –, wenn ich nicht auf deiner Seite stünde. Aber wir sollten ihnen nicht so viel Macht verleihen, indem wir heute Abend oder überhaupt je wieder an sie denken. Schon ganz bald werden Mom und Dad dich nicht länger ignorieren können, wenn dein Gesicht im ganzen Land zu sehen ist, selbst in ihren Zeitschriften.«
»Ich wette, sie kündigen ihre Abos.«
»Klare Bestätigung dafür, dass du gewonnen hast. Und jetzt raus mit dir zum Times Square, bevor du den auch übernimmst.«
Ich hole tief Luft, weiß, dass sie recht hat. »Ich wünschte, du wärst schon hier.«
»Ich auch, aber mit dem Geld, das ich heute Abend verdiene, können wir uns die besten Plätze bei unserer ersten Broadway-Show leisten.«
»Meinst du nicht eher eine Monatsmiete?«
»Wir müssen das Leben schließlich auch ein bisschen genießen.«
»Das klingt aber nach ziemlich großem Genuss.«
»Du hörst dich an, als wäre genießen was Schlechtes, Val.«
»Du hast ja recht.«
Ich bin umgezogen, weil das Leben mit meinen Eltern seit meinem Coming-out unerträglich geworden ist. Sie haben mir das Gefühl gegeben, ein Fremder im eigenen Haus zu sein. Ich dachte, das würde sich ändern, sobald ich meine Koffer durchs Wohnzimmer schob. Aber sie haben kein Wort gesagt, noch nicht mal, als Scarlett anmerkte, es sei ihre letzte Chance, bevor wir uns auf den Weg zum Flughafen machen würden. Mom und Dad schwiegen, als hätten sie nur ein Kind. Ich starrte das Kruzifix über unserer Haustür an und betete, dass es runterfallen möge, und zwar genau in dem Moment, in dem ich die Tür zuknallte und dieses Leben hinter mir zurückließ.
Freiheit sollte befreiend sein, aber das heißt nicht, dass sie einem nicht auch das Herz brechen kann.
Jetzt werde ich meinen eigenen Weg gehen.
»Schreib mir von deiner Feier«, sage ich zu Scarlett.
Sie greift nach ihrer Jacke und macht das Licht aus. »Wo wir gerade dabei sind, ich muss schon seit fünf Minuten weg sein. Hab dich lieb.«
»Hab dich genauso lieb«, entgegne ich, unser Lieblingsspruch als Zwillinge. »Fahr vorsichtig.«
»Wie immer!«
Sie fährt wirklich immer vorsichtig. Was leider nicht für jeden gilt.
Im Mai hat ein rücksichtsloser Fahrer Scarlett beinahe getötet. Ich war gezwungen, mir diese albtraumhafte Welt ohne ihren Glanz vorzustellen – etwas, das ich nicht mehr erlebt habe, seit ich zwei Minuten vor ihr geboren wurde. Es gibt für mich kein Leben ohne sie. Selbst der heutige Abend fühlt sich seltsam an, weil sie nicht in New York ist, aber da ich weiß, dass es ihr in Phönix bestens geht, ist es okay für mich. Solange sie am anderen Ende der Galaxie noch atmet, bin ich gerne bereit, planetenweit von ihr entfernt zu sein.
Eine OP hat meiner Schwester das Leben gerettet, obwohl unsere Eltern behaupten, es sei Gott allein gewesen. Damals habe ich den Ärzten und Gott gedankt, aber zurzeit habe ich so meine Schwierigkeiten mit geheimnisvollen Mächten. Das schließt auch den Todesboten mit ein – eine Organisation, die erwartet, dass wir ihr ohne echten Beweis trauen. Ein Teil von mir wäre gern gläubig, aber die andere Hälfte hat aus erster Hand miterlebt, was Glaube anrichten kann. Im Unterschied zu meinen Eltern bin ich allerdings durchaus in der Lage, mich von einer anderen Meinung überzeugen zu lassen, erst recht wenn ich dann nie wieder Angst haben muss, meine Schwester ganz plötzlich zu verlieren. Vielleicht wissen wir alle in ein paar Tagen schon mehr.
Gott segne all jene …
Ich halte inne, muss immer noch alles in meinem Kopf und Herzen neu sortieren.
Viel Glück für all jene, die im Grunde Versuchsobjekte für den Todesboten sind.
Was mich angeht, bin ich gerade wiedergeboren und habe noch ganz schön viel Leben vor mir.
Orion
22:34 Uhr
Der Weltuntergang mag ja bevorstehen, doch verkauft wird immer noch.
Eigentlich geht mir das Zeug, das die Händler am Times Square den Touristen anbieten, total am Arsch vorbei. Weder brauche ich Magneten mit dem Empire State Building drauf noch Taxi-Schlüsselanhänger mit meinem Namen. (Nicht dass sich jemand je die Mühe macht, etwas für die Orions dieser Welt herzustellen.) Aber obwohl es gerade mal einen Monat her ist, dass sich der Todesbote angekündigt hat, haben die Höker längst ihr Hirn eingeschaltet und passende Andenken zum Thema produziert: ein Feuerzeug, auf dem steht Nur zu, rauch sie ruhig!; Schnapsgläser mit Totenköpfen, Sonnenbrillen mit einem roten X darauf; und eine Menge Klamotten, wie T-Shirts und Basecaps. Fast bin ich versucht, eine verdammt süße Beanie zu kaufen, aber ich trage bereits das Yankee-Basecap, das meinem Dad gehört hat und jetzt immer auf meinen Locken sitzt, wenn ich unterwegs bin. Dieses Basecap würde ich für nichts in der Welt eintauschen. Okay, das ist vielleicht ein wenig übertrieben, für ein gesundes Herz würde ich nicht eine Millisekunde lang darüber nachdenken, aber ihr wisst schon, was ich meine.
»Nicht besonders intelligent«, sagt Dalma und guckt sich ein T-Shirt an, auf dem steht: Der Todesbote ruft dich todsicher an!
Dieser Spruch ist so platt, dass ich das Teil am liebsten verbrennen würde.
»Oh Mann, das kaufe ich garantiert nicht.«
Aber dann springt mir ein anderes T-Shirt ins Auge. Es ist weiß und in Schreibmaschinenschrift steht auf der Brust: Fröhlicher Abschiedstag! Das hat irgendwie Stil, selbst wenn ich nicht glaube, dass ein Abschiedstag fröhlich sein kann. Was soll am Sterben schon schön sein? Aber sie haben sich zumindest Gedanken gemacht, und das kann ich nicht schlecht finden. Auf jeden Fall hat man dann ein geiles Andenken und kann etwas vorweisen, wenn die Leute einen irgendwann fragen: Wo warst du, als der Todesbote angefangen hat? So wie man auch immer gefragt wird: Wo warst du am 11. September?
Hoffentlich passiert heute Abend nichts Schlimmes.
Mir reicht es auch so schon.
Ich kaufe mir das T-Shirt und ziehe es über mein dunkelblaues, das perfekt zu meinen Skinny Jeans passt. Aber so funktioniert der Look auch.
»Hast du auch was?«, frage ich Dalma.
»Kopfschmerzen«, sagt Dalma, wieder am Handy. »Mom meldet sich dauernd.«
Unsere Familie – also eigentlich Dalmas Familie – besucht gerade für eine Woche die Eltern von ihrem Stiefvater Floyd in Dayton, Ohio. Es ist das erste Mal, dass wir uns selbst überlassen sind. Dalmas Mutter Dayana nimmt ihre Verantwortung als mein gesetzlicher Vormund sehr ernst, besonders in Gedenken an meine Mom, ihre beste Freundin aus Kindertagen.
»Sie will nur, dass wir am Leben bleiben«, sage ich. »Und immerhin mussten wir nicht mitfahren.«
»Eine Schweigeminute für Dahlia«, sagte Dalma und schließt die Augen.
Wir denken an ihre Halbschwester, denn die hatte keine andere Wahl, als in den Ferien ihre Großeltern zu besuchen, die langsam so alt werden, dass sie wahrscheinlich die Ersten sein werden, die der Todesbote anruft. Meine Abuelita und mein Abuelito leben in Puerto Rico, und wir skypen immer dann, wenn meine Cousins bei ihnen sind, um ihnen mit der Technik zu helfen. Ich habe sie erst ein paar Mal getroffen, aber es bedeutet ihnen viel, mit mir zu sprechen, da ich meinem Dad wie aus dem Gesicht geschnitten bin, von den haselnussbraunen Augen meiner Mom mal abgesehen. Wenn meine Abuelita und mein Abuelito mich manchmal aus Versehen Ernesto nennen, sage ich nichts. Dieser Name tröstet all die Herzen, die damals gebrochen sind, als meine Eltern starben.
Dalma bricht unser Schweigen mit einem tiefen Seufzer. »Jetzt geht’s mir viel besser. Gracias.«
»Kein fucking Ding.«
»Komm, wir schicken Mom ein Foto, damit sie weiß, dass wir noch am Leben sind.«
Mit der neuen iPhone-4-Selfie-Kamera in der Hand dreht sich Dalma um die eigene Achse und versucht unter den strahlenden Lichtern des Broadways die richtige Beleuchtung zu finden. Als sie den besten Blickwinkel ausgemacht hat, bleibt sie stehen. Im Hintergrund ragt das Stundenglas auf.
Wir quetschen uns für das Foto zusammen und lächeln, als würden wir an diesem Abend so richtig einen draufmachen. Dann kommen wir zum für mich weniger spaßigen Teil, nämlich, uns das Foto genau anzugucken, bzw. in meinem Fall, jedes Detail, das ich an mir hasse, genau zu studieren. Dalma ist umwerfend schön, zweifellos zehn von zehn Punkten mit ihren braunen Augen, der silbernen Wimperntusche, die zu ihrem Lippenstift passt, ihrer leuchtend dunkelbraunen Haut und ihrem geflochtenen schwarzen Haar, das sie hochgesteckt hat. Für mich spricht nur, dass ich mit meinen fast zwei Metern über ihr aufrage, aber ansonsten bin ich eine einzige Katastrophe. Ich liebe die Farbe meiner Augen, aber ich verstehe nicht, warum das linke Auge so anders aussieht, so, als würde es gleich einschlafen. Die braunen Locken unter meinem Basecap sind zusammengeklumpt und werden in dieser Hitze immer krisseliger. Nicht gerade süß. Meine Nase und meine Wangen sind noch immer rot von dem Sonnenbrand, den ich mir letzte Woche beim Chillen auf dem Dach unseres Hauses geholt habe. Als ich sehe, wie rau meine Unterlippe aussieht, hole ich gleich meinen Lippenpflegestift raus. Und egal wie viele Komplimente ich ständig für meine markanten Wangenknochen bekomme, bin ich der Meinung, dass ich immer viel zu hager wirke, dem Tode nah, was ja auch irgendwie passend ist.
»Du findest es schrecklich«, sagt Dalma. Das ist noch nicht einmal eine Frage.
»Egal. Es ist sowieso nur für uns«, sage ich.
»Wir können ja noch eins machen.«
»Nö, alles gut.«
Wir gehen ein paar Schritte und bleiben zehn Sekunden später wieder stehen, um bei einer Verlosung zuzusehen: Ein Vertreter des Todesboten vergibt freie Mitgliedschaften. Wenn die Schlange nicht so lang wäre, würde ich mich auch anstellen, denn sich beim Todesboten zu registrieren ist nicht gerade billig. Eine Frau gewinnt einen freien Monat und spart damit 275 Dollar. Man kann nur 20 Dollar für einen Tag bezahlen oder 3000 Dollar für ein ganzes Jahr. Meine Arztrechnungen sind schon krass genug, aber meine Erziehungsberechtigten haben trotzdem ein Jahresabo für mich abgeschlossen, da mein krankes Herz schließlich auch keinen Tag freinimmt. Es muss schön sein, wenn man es nicht nötig hat, so viel zu investieren, und sich nur anmeldet, kurz bevor man etwas total Abenteuerliches vorhat wie Fallschirmspringen oder eine Wildwasserfahrt. (Wenn man rausfindet, dass man bald sterben wird, dann verzichtet man bestimmt gerne darauf, aus einem Flugzeug zu springen oder einen wilden Fluss hinunterzujagen.)
Wie so vieles, wird leider auch der Todesbote nicht von der Krankenversicherung abgedeckt. Was natürlich keine Rolle spielt, wenn man Tausende und Abertausende in der Tasche hat.
»Hast du den Artikel über diese Leute gelesen, die eine Platin-Mitgliedschaft fordern?«, frage ich Dalma.
»Nö. Aber will ich das wirklich wissen?«
»Wenn du wirklich jemandem in die Fresse hauen willst, dann ja.«
»Hab ich nicht vor. Aber sag schon.«
»Ein paar reiche Arschlöcher setzen sich dafür ein, dass der Todesbote einen Platin-Rang anbieten soll, der dann als Allererstes angerufen wird.«
Dalma bleibt wie angewurzelt stehen. »Die Reichen sind schuld daran, dass wir keine schönen Sachen haben können.«
Dayana und Floyd haben fünfzehn Riesen ihrer gesamten Ersparnisse investiert, um allen im Haus ein Jahresabo zu besorgen; nicht dass wir mit angehaltenem Atem auf einen Anruf des Todesboten warten, solange er nur rechtzeitig genug kommt, bevor jemand von uns stirbt.
Ich wende mich von der Verlosung ab, nachdem ich in das enttäuschte Gesicht von einem Mann geguckt habe, der eine Mitgliedschaft für nur einen Tag gewonnen hat. Der Typ hat ganz klar auf mehr gehofft, kann sich die höheren Gebühren sicher nicht leisten. Es gibt vieles auf der Welt, was ich gerne gratis hätte, und der Todesbote gehört mit auf die Liste. Schließlich stehen Menschenleben auf dem Spiel.
Dalma und ich gehen weiter und bleiben vor den noch fast neuen roten Glasstufen stehen, die wie eine Treppe nach oben führen und dem Times Square die Atmosphäre eines urbanen Amphitheaters verleihen. Ein guter Platz für alle, die in dem ganzen Trubel mal chillen wollen. Der Saal ist quasi voll und auf der kleinen Bühne steht eine Frau. Erst denke ich, es ist eine Vertreterin des Todesboten, weil sie darüber spricht, wie sehr sich alles verändern wird. Ich entdecke eine aufklappbare Reklametafel, die mich an die vor meinem Friseur erinnert. Nur wirbt die hier nicht für einen Haarschnitt, der dein Ego boostern soll. Stattdessen lese ich: Erzähl deine Todesboten-Geschichte. Die Frau ist keine Vertreterin. Sie gibt zum Besten, warum sie sich beim Todesboten angemeldet hat. Als sie mit der Geschichte über ihre Sichelzellenkrankheit zum Ende gekommen ist, zieht eine tatsächliche Vertreterin des Todesboten hinter einem Tisch einen Zettel aus einer Glasschüssel und lädt ein Mädchen namens Mercedes auf die Bühne ein, damit die ihre Story vortragen kann.
Seit Jahren träume ich davon, wie es sein würde, eine Lesung in einer Buchhandlung zu halten, vor lauter fremden Menschen, die alle meine Geschichte hören wollen. Natürlich will ich meine Freunde auch dabeihaben, aber die müssen ja quasi kommen. Die Vorstellung, Menschen durch meine Worte an einen Ort zu locken, hat etwas Magisches. Ich glaube nicht, dass ich lange genug leben werde, um wirklich ein eigenes Buch auf den Markt zu bringen – Roman, Kurzgeschichte, die kürzeste Autobiografie der Welt. Egal was! Aber das heißt nicht, dass ich heute Abend nicht die Chance habe, dem hier anwesenden Publikum meine Geschichte zu erzählen.
Ich mache mich auf den Weg zu der Vertreterin des Todesboten, schreibe meinen Namen auf einen Zettel und werfe ihn in die Glasschüssel.
Eins von diesen ersten Malen, die auch meine letzten sein können.
Valentino
23:09 Uhr
Google Maps hat fast gelacht, als ich nach dem schnellsten Weg zum Times Square gefragt habe.
New York ist für seinen guten öffentlichen Nahverkehr bekannt, aber die Premiere des Todesboten sorgt für totales Chaos. Vor allem in Manhattan. Ich hätte die 6 nehmen und dann in irgendeinen Shuttle-Bus umsteigen können, aber die Fahrt hätte ungefähr eine Stunde gedauert. Busse, die in die Innenstadt fahren, konnte ich nicht finden, also hielt ich es für das Beste, wieder ein Taxi zu nehmen. Ich ging in die grobe Richtung los und winkte Autos zu, genau wie es mir zahllose Schauspieler in zahllosen New-York-Filmen gezeigt haben, aber irgendwas machte ich falsch, denn es hielt kein einziges an. Dann, als ich schon halb da war – so wie bei meinem gerade absolvierten häuslichen Aufstieg –, fand ich mich damit ab, dass ich wohl den ganzen Weg zu Fuß würde gehen müssen, um mein Ziel zu erreichen.
Also tat ich das, und versteht mich nicht falsch, ich will unbedingt auch mal U-Bahn fahren, aber wenn ich unterirdisch unterwegs gewesen wäre, hätte ich diese ganze Sightseeing-Tour verpasst. Ich ging die Fifth Avenue entlang, kam am Eingang zum Zoo im Central Park vorbei, sah das berühmte Plaza Hotel und das Rockefeller Center, wo ich im Dezember auf jeden Fall hingehen werde, um diesen riesigen Weihnachtsbaum zu bewundern. Es war total aufregend, so viele berühmte Gebäude in echt zu sehen, aber auch einsam. Ich freue mich schon darauf, das alles mit Scarlett zu erleben und mit all den neuen Freunden, die wir hier finden werden. Ich bin sicher, dass ich die Dinge dann noch mal mit anderen Augen sehen werde.
Die Perspektive ist das Entscheidende. Beim Modeln bin ich, wer ich bin, aber wie ich wirke, hängt davon ab, wer hinter der Kamera steht. Manche Fotografen entdecken meine starken und schmeichelhaften Seiten. Andere nicht. Welche Bilder ich persönlich dann am besten finde, hängt von meiner Perspektive ab. Aber Perspektiven verändern sich auch mit der Zeit – über die Jahre, Monate, Wochen, Tage, Stunden, sogar Minuten. Heute Nachmittag – oder streng genommen wohl schon heute Abend, da ich jetzt in einer anderen Zeitzone bin – war ich mir sicher, dass nichts schöner sein könne, als in diesem Flugzeug zu sitzen und New York vor mir auftauchen zu sehen. Ich habe mich geirrt. Nichts ist schöner als mein erster Blick auf den Times Square.
Vom Himmel aus sieht alles unter einem aus wie eine Welt für Insekten.
Auf der Straße bin ich das Insekt.
Die Gebäude ragen hoch auf, und ich stelle fest, dass ich den Kopf in den Nacken lege wie beim Modeln, weil es mir gefällt, wenn mein Adamsapfel vorsteht und mein langer Hals sich reckt. Aber jetzt geht es mir nicht darum, gut auszusehen. Sondern darum, die Schönheit um mich herum in mich aufzusaugen.
Schon mehrere Häuserblocks zuvor habe ich aufgehört, Fotos zu machen, weil diese Handykameras der Stadt nicht gerecht werden. Morgen kommt Scarlett, und dann können wir unser neues Leben mit ihrer richtigen Kamera festhalten. Heute Abend bleibe ich im Hier und Jetzt.
Der erste Schritt auf den Times Square ist zugegebenermaßen überwältigend, weil in jeder Ecke so viel passiert. Jemand versucht mir DVDs mit Raubkopien von Filmen zu verkaufen, die noch im Kino laufen. Läden und Restaurants drängen sich so dicht aneinander, dass ich gar nicht wüsste, wo ich zuerst hingehen soll. Ich mache für Scarlett ein kurzes Video der Todesboten-Sanduhr auf dem größten Bildschirm, auch wenn wir bei YouTube später sicher bessere Aufnahmen finden werden. Zwei Männer, die sich gegenseitig schubsen, lenken mich ab. Einer von ihnen sagt, sie sollten ihre Schulden tilgen, bevor morgen das Ende der Welt beginnt; er gehört also zu denen. Ich kann kaum glauben, dass ich all diesen Verschwörungstheoretikern zu Hause entkommen bin, um dann direkt am Times Square einem zu begegnen, aber das ist schließlich der Reiz dieser Stadt, stimmt’s? New York ist Anknüpfungspunkt für alle auf dieser Welt. Sogar für Models aus Arizona, die ihr Leben neu ausrichten wollen und davon träumen, dass bald alle ihr Gesicht auf Reklametafeln sehen werden.
Ich rücke weiter auf den Platz vor. (Sagen die New Yorker so dazu? Das muss ich schnell herausfinden.) Dabei komme ich an jemandem in einem Iron-Man-Kostüm vorbei, der mit einer weitgehend als Elmo verkleideten Frau spricht. Nur der Riesenkopf steht neben ihr auf dem Boden, als hätte man ihn abgeschlagen, während sie eine Zigarette raucht. Ich liebe diese Stadt bereits von ganzem Herzen. Auch von dieser Szene muss ich unbedingt heimlich ein Foto für Scarlett machen, weil das einfach ein einmaliger Anblick ist.
Ich gehe weiter. Ein Teenager fällt mir auf, der auf einer Art Bühne steht. Erst rechne ich damit, dass er gleich ins Mikro singen wird, aber dann spricht er mit dieser tiefen Traurigkeit über die zerebralen Aneurysmen in seiner Familie und die Angst davor, selbst an einem zu sterben. Es ist bedrückender als erwartet auf einem Fest, das als Feier des Lebens angekündigt war, aber dann sehe ich das Schild, auf dem steht: Erzähl deine Todesboten-Geschichte, und alles ergibt Sinn. Auf dieser Bühne können Leute erzählen, wie dieser Dienst ihr Leben verändern wird.
Es kann nicht schaden, ein wenig zuzuhören, warum Leute bereit sind, an den Todesboten zu glauben.
Auf der roten Glastribüne gibt es keine freien Plätze mehr, aber es macht mir nichts aus, nach einem Stehplatz zu suchen. Direkt neben dieser schönen Schwarzen mit dem unglaublichen Style und dem süßen Weißen, dessen Locken unter dem Basecap hervorgucken, ist noch Platz. Der Junge sieht aus, als ginge ihm das alles ganz schön nah, denn er wischt sich Tränen von den Wangen.
Offenbar hat er ein großes Herz.
Orion
23:17 Uhr
Diese Geschichten brechen mir einfach das Herz.
(Jetzt ist es noch kaputter.)
Aber ich kann nicht anders als zuzuhören, selbst wenn sich das anfühlt, als würde ich in Stücke gerissen: Der Bräutigam einer Frau ist auf dem Weg zur Hochzeit bei einem Unfall ums Leben gekommen; ein Kind ist in der Badewanne ertrunken, während der große Bruder gerade den Müll rausbrachte und sich dabei ausgeschlossen hatte; die beste Freundin eines Mädchens wurde an ihrem Geburtstag erstochen, was diesen Tag für immer prägen wird; Frau und Kind eines älteren Mannes starben während der schwierigen Geburt, und obwohl der Todesbote nicht das Schicksal eines Fötus voraussagen kann, hätte der Mann sich trotzdem auf das große Loch in seinem Herzen vorbereiten können; und dann ist da noch ein Mädchen, das wie ich beide Eltern verloren hat, während eines Tornados.
»Wir haben noch Zeit für eine Geschichte«, sagt die Vertreterin des Todesboten. Anfang zwanzig, sieht sie aus wie eine junge Lehrerin, die gerade den nächsten Schüler für das letzte Referat des Tages aufrufen will. Sie greift in die Glasschüssel, bereit, einen Namen herauszuziehen.
Es soll bitte meiner sein.
Es muss meiner sein, das ist meine einzige Gelegenheit, meine Geschichte zu erzählen und …
»Lincoln«, ruft die Vertreterin.
Ein Junge steigt die roten Stufen herab, sehr behutsam, als hätte er Angst zu stolpern, zu fallen und zu sterben, bevor er seine Geschichte erzählen kann.
Bevor sie, wie meine, ungehört bleibt.
Lincoln schafft es wohlbehalten bis zum Mikrofon und erzählt uns von seiner Krebsdiagnose, zeigt auf seine Mutter und seine Schwester im Publikum und erklärt, wie der Todesbote ihnen die Möglichkeit bietet, das Unvermeidliche anzunehmen, das da auf sie zukommt.
Mir geht es nicht so schlecht wie ihm, aber ich kann gut verstehen, was es heißt, die Waffen zu strecken.
Dann ist er fertig mit seiner Geschichte. Die Vertreterin des Todesboten dankt der Menge für ihre Zeit und ein Sicherheitsbeamter begleitet sie von der Bühne. Und binnen Sekunden gehen alle wieder ihrem täglichen Leben nach – ihrem wirklich schwierigen, komplizierten Leben.
»Tut mir leid«, sagt Dalma.
»Was denn?«
»Dass dein Name nicht aufgerufen wurde.«
Ich habe nie direkt gesagt, wie sehr ich mir das gewünscht habe, aber meine beste Freundin durchschaut mich eben.
»Alles gut«, lüge ich.
Ich richte meinen Blick auf die Großbildschirme und sehe, wie der Sand bzw. winzige schwarze Blöcke in den Stundengläsern nach unten fallen. Bis ein großer Typ in meinem Alter (so was schätze ich immer ziemlich gut ein) an mir vorbeigeht und mich ablenkt. Mich wirklich ablenkt, denn er ist wunderschön; ich kann nicht anders, als ihm hinterherzugucken, während er sich auf eine Ecke der Treppe setzt und zu den Stundengläsern hochschaut, als wären es die Sterne.
Ich brenne darauf, seine Geschichte zu hören, genau wie ich darauf brenne, meine zu erzählen.
Mein Herz macht einen Sprung; wie krass es ist, dass es sich so aufregend und zugleich gefährlich anfühlt, wenn man jemanden anziehend findet; als könnte er alles, was gut ist, und alles, was schlecht ist, für einen bedeuten.
Seine Augenfarbe kann ich nicht erkennen, aber, Mann, würde mich das interessieren.
Er ist blass, aber kann sein, dass er so wie ich einfach nur als weiß durchgeht.
Wenn man sein verwuscheltes dunkles Haar mal außer Acht lässt und auch die Absätze seiner Timberlands, dann ist er wohl so groß wie ich.
Er hat breite Schultern, einen kräftigen Nacken und Arme, die garantiert dafür sorgen, dass er jedes Armdrücken gewinnt. Dazu noch Muckis, die unter seinem hautengen schwarzen V-Shirt geradezu ersticken müssen.
»Erde an Orion«, sagt Dalma und schnipst mit den Fingern. »Was … oh.«
»Ja. Ich wette, er ist ein Model.«
»Du hältst alle süßen Typen immer gleich für Models.«
»Und jedes Mal, wenn ich mich irre, ist das eine Zumutung für die gesamte Gesellschaft.«
Ich reiße meinen Blick los, obwohl ich ihn wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich weiter anstarren will. Scheiße, bin ich schwach. Ich halte es nicht mal eine Sekunde lang aus, und schon riskiere ich wieder einen Blick auf ihn, und halb hoffe ich, dass er mich nicht dabei erwischt, und halb, dass doch. Aber warum sollte er – vielleicht steht er gar nicht auf Jungs, dabei hätte ich auch gegen eine weitere Freundschaft nichts einzuwenden, besonders wenn Dalma diesen Herbst am Hunter College anfängt und wie eine Irre wird arbeiten müssen. Doch ich weiß gar nicht, ob ich es aushalte, um so eine Schönheit wie ihn zu kreisen, ohne mich zu verlieben, zu lieben, liebend zu sterben.
Bestimmt ist er ein heterosexueller Tourist, den ich niemals wiedersehen werde – das wäre typisch für mich.
Aber vielleicht auch nicht. Ich kann nicht hellsehen; ich kann nichts ausschließen.
»Ich sollte mal hingehen und Hey sagen.«
»Gute Einstellung, O-Bro, aber kann es sein, dass du gerade mit dem Schwanz denkst?«
»Ich glaube, ich denke mit dem Herzen?«
»Auch nicht besonders verlässlich.«
»Er hat auf jeden Fall eine positive Ausstrahlung. Er sieht nicht so aus, als würde er sich zum letzten Mal die Stadt angucken, bevor er für den Rest seines Lebens in einem unterirdischen Bunker verschwindet, oder als würde er, einfach so, Amok laufen.«
»Du findest aber auch jeden toll.«
»Und du solltest mich eigentlich unterstützen.«
»Auch wieder wahr. Wenn es denn so ist, dann carpe diem, pflück ihn dir.«
Ich gehe zwei Schritte auf ihn zu und bleibe schon wieder stehen.
Wie oft habe ich mich über die Jahre in dieser Stadt verknallt – bei Dave & Busters, im Central Park, bei Barnes & Nobles, in der U-Bahn –, aber ich kriege es nie hin, aus meiner Fantasie in die Realität zu springen. Und selbst wenn ich jemanden dann persönlich kennenlerne, wie ein paar Typen auf der Highschool, kann ich dann irgendwie nicht weitergehen, weil ich mich, außer vor Dalma, nie geoutet habe.
Das hat sich geändert, seit wir letzten Monat mit der Schule fertig waren.
Und obwohl ich diesen Schritt inzwischen gemacht habe, weiß ich immer noch nicht, wie der nächste aussehen soll.
»Verdammt, was soll ich denn sagen?«, frage ich.
»Lass dein Herz sprechen«, sagt Dalma. »Und nicht deinen Schwanz.«
»Herz, nicht Schwanz; Herz, nicht Schwanz«, murmele ich wie ein Mantra vor mich hin.
Ich möchte mir die Chance nicht entgehen lassen, diesen Typen kennenzulernen, denn die Wahrscheinlichkeit, ihn in einer Stadt wie New York wiederzutreffen, steht eins zu … keine Ahnung, irgendeine verdammt lange Zahl, für die man tagelang zählen müsste.
»Ich schaff das«, sage ich mit null Selbstvertrauen.
»Aber klar«, sagt Dalma mit null Glaubwürdigkeit.
Ich lege einen Zahn zu und überlege mir dabei, was ich ihn fragen könnte.
Wo kommst du her?
Du bist allein hier?
Du siehst aus wie Clark Kent. Verkleidest du dich manchmal als Superman?
Spielst du auch in meiner Mannschaft, sprich stehst du auch auf Jungs?
Oh, du bist hetero? Du hast nicht zufällig einen eineiigen Zwilling, der auf Jungs fliegt?
Dann stehe ich plötzlich vor ihm. Seine Augen – von so eisigem Blau, dass ich nach Luft schnappen muss – werden weit. Zunächst denke ich, dass er gleich ausflippt, so wie ich das einmal gemacht habe, als ich aus meiner Lieblingsbar raus bin und so ein weißer Typ mir ins Gesicht gesprungen ist und gedroht hat, mir die Fresse zu polieren, wenn ich ihm nicht Bargeld und Bonbons aushändige. (Ich bin ohne Bargeld und Bonbons nach Hause gegangen.) Aber er sieht nicht so aus, als hätte er Angst vor mir. Seine herzförmigen Lippen verziehen sich sogar zu einem Lächeln, und ich leuchte auf wie ein Stück Papier, an das man ein Streichholz hält.
»Hi«, sagt er.
»Hi«, wiederhole ich, als würde er mir eine neue Sprache beibringen.
»Wie geht’s denn so?«
Er soll das Gespräch nicht führen, schließlich habe ich ihn doch angesprochen.
»Es läuft gut, na ja, soweit man das behaupten kann, wenn die Welt gerade untergeht«, sage ich. Dann wird mir etwas bewusst. Wenn ich jetzt nicht sofort klarstelle, dass ich nicht an einen Weltuntergang pünktlich um Mitternacht glaube, werde ich das Ganze hier geradewegs im Keim ersticken. »Also, ich persönlich denke ja nicht, dass wir alle kurz davor sind zu sterben. Natürlich werden Menschen sterben, leider, tragischerweise … ja, tragisch … aber ich glaube nicht, dass jetzt der gesamte Planet in Flammen aufgeht oder überschwemmt wird oder in sich zusammenfällt oder so was.« Ich versuche Luft zu holen, aber ich habe das Gefühl, dass mein Körper jeglichen Sauerstoff ablehnt, damit ich wenigstens für eine Sekunde mal die verdammte Klappe halte. Aus unerfindlichen Gründen hat der Typ noch nicht das Weite gesucht. »Jedenfalls, ich bin zu dir rübergekommen, weil du das Stundenglas angestarrt hast, und ich habe mich gefragt, ob du dir auch Gedanken über diesen ganzen Irrsinn mit dem Todesboten machst.«
Er sieht wieder zu den Großbildschirmen auf und ich habe eine weitere Minute geschafft, obwohl es mir vorkommt, als hätte ich tausend Jahre verplempert, um auf den Punkt zu kommen.
»Ich denke tatsächlich gerade über den Todesboten nach. Und über das Leben.«
»Irgendwie gerade ein und dasselbe, oder nicht?«
»Ja, irgendwie schon.« Er steht auf und sein Blick trifft wieder auf meinen. »Ich bin übrigens Valentino.«
Scheiße, das passt. Ich weiß zwar gar nicht richtig, wie ich das meine, aber ich habe absolut recht, und wer was anderes behauptet, kriegt von mir eine reingehauen. Na ja, den Kampf würde ich natürlich ganz sicher verlieren, da ich in solchen Situationen eine totale Null bin, aber ich würde diesen Kampf trotzdem kämpfen und kämpfen und kämpfen.
»Ich bin Orion.«
»Das ist ja lustig, ich kenne inzwischen schon fünf Orions.«
»Wirklich?«
Valentino lächelt. »Nein, nicht wirklich.«
Mann, bin ich blöd. »Ich bin zu leichtgläubig, so was kannst du nicht mit mir machen.«
»Haha, tut mir leid! Du bist der erste Orion, dem ich je begegnet bin«, sagt Valentino. »Versprochen.«
Echt jetzt, wenn er meinen Namen ausspricht, ist es, als würde er mir Flammen ins Gesicht hauchen, die einen extra Sonnenbrand hinterlassen. Und so nah bei ihm zu stehen, macht mich innen drinnen ganz angespannt, als würden meine Herzvenen mein Herz im Würgegriff halten, nur weil es ihnen Geld schuldet. Aber Valentino wirkt total cool, ich glaube nicht, dass ich ihn auch nur das kleinste bisschen durcheinanderbringe. Ein Blick auf seine volle Unterlippe erinnert mich daran, dass meine eigene ganz rau ist, also hole ich meinen Pflegestift raus. Er sieht zu, wie ich ihn über meine Lippen ziehe, und bestimmt denkt er, dass ich mich auf einen Kuss vorbereite, doch das mache ich nicht, auch wenn ich natürlich nichts dagegen hätte.
Verdammt, vielleicht denke ich doch mit dem Schwanz.
Auf jeden Fall mache ich mich gerade mal wieder zum Deppen.
Im Moment kann man mich mit Valentino nicht allein lassen.
»Dalma!« Ich winke sie zu uns rüber und sie eilt mir asap zu Hilfe. »Dalma, das hier ist Valentino.«
»Hey«, sagt Dalma und schüttelt ihm die Hand; ich kam nicht einmal in die Nähe seiner Hand, geschweige denn dazu, sie zu schütteln.
»Nett, dich kennenzulernen«, sagt Valentino. »Dein Freund hier …«
»Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein«, sagt Dalma. Tiefer Atemzug, dann weiter: »Nein, nein, nein, nein.«
Ich starre sie an, etwas – nein, total – beleidigt, wie sehr sie in diesen Neins aufgeht. »Okay, komm mal runter, ich will ja auch nichts von dir.«
»Er ist sozusagen mein kleiner Bruder«, sagt Dalma.
»Nur zwei Monate jünger«, sage ich.
»Und die Welt hätte in den zwei Monaten nicht untergehen können?«
»Das sagst du immer, als wolltest du mich am liebsten direkt ins Nirwana befördern.«
Ich fasse es nicht. Ziehen wir wegen Valentino diese Show ab? Wir sind achtzehn, nicht acht, aber egal: Ich habe ihn zuerst gesehen, ihn zuerst begrüßt, mich zuerst zum Deppen gemacht. Ich darf zuerst sehen, wo das Ganze hinführt.
Zum Glück scheint Valentino unser Geplänkel nicht groß zu stören.
»Na ja, Geschwisterzoff beherrscht ihr jedenfalls perfekt«, sagt er, ohne jegliche Wertung in der Stimme. »Mit meinem Zwilling mache ich das genauso.«
Ach, du heilige Scheiße, es gibt zwei von ihm.
Echt, ich frage mich in diesem Moment, ob ich vielleicht schon gestorben bin und mich im Jenseits befinde, wo es zwei Valentinos gibt. Vielleicht muss ich gar nicht mit Dalma konkurrieren – wir können beide einen Valentino mit nach Hause nehmen und ein glückliches Leben führen.
Aber Moment mal, ich bin wohl etwas voreilig.
»Zwillingsbruder oder Zwillingsschwester?«
»Schwester«, sagt Valentino. Der Kampf um sein Herz ist also noch nicht ausgestanden.
»Und wo ist sie?«
»Scarlett ist zu Hause in Arizona.«
Zu Hause. Klartext: Er lebt nicht in New York.
Deswegen muss ich aufhören, dauernd so voreilig zu sein.
Wenn ich schreibe, erzähle ich immer Geschichten, bevor ich überhaupt weiß, um was es geht, lasse mich forttragen und verwandele Wörter in Sätze, Sätze in Absätze, Absätze in Kapitel, Kapitel in Liebesgeschichten. Vielleicht funktioniert das so im Roman, aber im wahren Leben kann dir deine Vorstellungskraft ein herzzerreißend jähes Ende bereiten.
»Das ist ja doof, dass sie heute die große Party verpasst«, sage ich und versuche, nicht allzu deprimiert zu sein. Ich muss wirklich aufhören, mich immer so schnell in was reinzuhängen.
»Na ja, dafür fotografiert sie die heutige Feier in Phoenix. Und morgen früh fliegt sie hierher, um New York unsicher zu machen.«
»Wie lange werdet ihr hier sein?«
»Ich bin gerade erst hergezogen«, sagt Valentino und sieht sich am Times Square um.
Seine Worte lassen mein Herz schneller schlagen.
Und sein Lächeln auch.
Valentino leuchtet geradezu vor Glück, während er sich als frischgebackener New Yorker umsieht. Wer weiß, wie lange er darauf gewartet hat, hierherzuziehen? Vielleicht einen Monat, ein Jahr, ein Jahrzehnt, sein ganzes Leben lang. War das Leben in Arizona nicht gut? Brauchten Valentino und Scarlett eine Veränderung? Wie läuft es mit seinen Eltern – oder Erziehungsberechtigten? Ziehen sie auch hierher? Ich habe so viele Fragen, und es dauert vielleicht ein bisschen, bis ich auf alles eine Antwort bekomme, aber immerhin weiß ich jetzt, dass ich Zeit habe.
»Willkommen in New York!«, sagt Dalma. »Bist du heute Abend ganz allein hier?«
»Ja. Ich bin erst vor ein paar Stunden angekommen und dann gleich hierher.«
»Du kannst gerne mit uns abhängen«, biete ich ihm an.
»Ein bisschen Gesellschaft wäre nett. Wenn es euch nichts ausmacht.«
»Ach was. Außerdem kennst du hier ja sowieso niemand.«
»Eigentlich bin ich sehr beliebt. Mein bester Freund ist wahrscheinlich mein Vermieter.«
»Ich kann es kaum erwarten, ihm zu begegnen«, sage ich. (Verdammt mutig von mir.)
»Er ist eigentlich ein Arsch, aber du musst trotzdem bald mal vorbeikommen«, sagt Valentino mit diesem unglaublichen Lächeln.
Okay, okay, okay – wenn hier nicht gerade was läuft, mache ich nie wieder den ersten Schritt. Ich brauche einen Freund, der auf das Grab meiner Eltern schwört, dass er mich liebt, und ich werde ihm auf keinen Fall sagen, dass ihre Gräber leer sind, damit er nicht auf die Idee kommt zu lügen.
Aber da ich Valentino gegenüber sowieso machtlos bin, brauche ich das alles gar nicht.
Sein Lächeln allein reicht schon.
Valentino
23:32 Uhr
Es ist mein erster Abend hier, und ich habe schon Freunde gefunden.
Freunde mit schönen Namen. Und schönen Gesichtern.
Ich starre Orion an, dessen Wangenknochen es verdient hätten, auf einem Zeitschriftencover zu landen, genau wie seine haselnussbraunen Augen, die für einen so jungen Typen vermutlich schon viel gesehen haben. Als er rot wird, merke ich, dass ich ihn schon zu lange anstarre. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Orion schwul ist. Vielleicht ist er auch bi, aber er mag auf jeden Fall Jungs. Dass ich das erkenne, ist schon mal nicht schlecht. Ich beneide ihn, dass er so offen wirkt und wahrscheinlich die Möglichkeit hatte, genau so zu sein. Jetzt muss ich irgendwie rüberbringen, dass ich auch auf Jungs stehe.
»Was gefällt dir bisher an New York?«, fragt Orion.
Ich könnte die ganze Nacht damit verbringen, diese Frage zu beantworten. »Ich will einfach alles machen. Leben wie ein Tourist, damit ich keinen Tag für selbstverständlich halte.«
»Das ist schlau«, sagt Dalma. »Ich liebe diese Stadt, aber es gibt so viel, wovon ich die Nase voll habe.«
»Was denn zum Beispiel?«
»U-Bahn-Auftritte. Die ersten paar sind super, aber dann hat man diese Shows irgendwann satt und konzentriert sich auf das, was man gemacht hat, bevor die Tänzer aufgetaucht sind.«
»Und betet, dass man keinen Fuß ins Gesicht kriegt«, fügt Orion hinzu.
»Ich hoffe, dass ich nie aufhören werde, das alles magisch zu finden«, sage ich bloß.
Orion bemerkt offenbar, dass ein wenig Enthusiasmus aus meinen Augen verschwunden ist. »Lass dir von uns nicht den Spaß verderben, wir sind beide hier geboren und aufgewachsen. Du wirst die ganze Zeit voll dabei sein.«
»Das habe ich vor.«
»Das Großartige an New York ist, dass man es nie schaffen wird, alles zu machen.«
»Und das ist großartig?«
»Ja, klar. Es bedeutet, dass es immer irgendwas zu tun gibt. Neue Viertel zu erforschen, in denen einem jede Straße ihre Geschichte erzählt. Ich mache gern den Stadtführer für dich, wenn du willst.«
Ich lächele und freue mich schon auf Orions eigene Geschichten, wenn er mich durch die Stadt führt. »Das klingt gut. Vielen Dank.«
»Gerne.«
Eine große Gruppe in lindgrünen T-Shirts und Stirnbändern geht an uns vorbei. Sie sehen aus, als wären sie von einer St.-Patrick’s-Day-Feier durch die Zeit hierhergereist, aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Es sind Alien-Gläubige, die überzeugt sind, dass um Mitternacht UFOs auftauchen und sie gen Himmel beamen werden; in Arizona gibt’s eine ganze Menge von denen. Diese Leute sind weitgehend harmlos – ein schwarzes Schaf gibt’s natürlich in jeder Gruppe –, aber sie werden wohl schon bald von der Realität eingeholt werden, wenn sie morgen immer noch hier auf der Erde sind, mit ihren Fulltime-Jobs und Steuern, die ihr Gehalt auffressen.
Ich will gerade ein Foto für Scarlett machen, als Dalma mich etwas fragt.
»Wechselst du im Herbst das College?«
»Nein, ich hab das Studium erst mal zurückgestellt. Ich will stattdessen meine Träume verfolgen.«
»Und die sind …?«, fragt Orion.
Ich bin immer noch jedes Mal leicht nervös, wenn ich anderen erzähle, was ich mache, weil viele Leute voreingenommen sind, aber wenn das auch für Orion und Dalma gilt, ist es besser, es gleich zu erfahren, bevor ich mich zu sehr auf sie einlasse. Ich kann mich nicht mehr mit Leuten umgeben, die mich nicht ich sein lassen. »Ich bin Model.«
Orions Augen leuchten auf, als er sich zu Dalma umdreht. »Ich hab’s dir gesagt!«
»Hättest du mich nicht für ein Model gehalten?«, frage ich sie.
»Du siehst natürlich gut aus, aber Orion sagt das über jeden süßen Typen.«
»Mmh. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich geehrt fühlen soll oder nicht.«
»Fühl dich geehrt«, wirft Orion ein. Dann wird er rot. »Ich meine, na ja, natürlich sollte dein Gesicht überall sein.«
»Danke, dass du an mich und mein Gesicht glaubst.«
»Jederzeit. Hätten wir dich schon irgendwo sehen können?«
Nur die echt berühmten Models haben eine schnelle Antwort auf diese Frage, und das gilt sicher nicht für mich.
Mein erster Auftrag war letztes Jahr für einen Produzenten von Namensanhängern – und damit man mich auf keinen Fall erkennt, haben sie mir eine Kette mit Leo