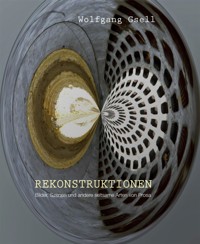7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Ich sehe Bilder eines fremden Planeten, und nicht nur in meinem Kopf. Ich sehe wahnsinnige Filme, verworrene Handlungssequenzen und weiß nicht, ob ich sie Leben nennen soll“, sagt M., unser Autor, den wir begleiten und der Genese seines Buches beiwohnen. Sind wir in der Lage, Realität wahrzunehmen? Bewegen wir uns tatsächlich im Augenblick der Gegenwart? Oder ist das, was wir sehen, denken und fühlen, was wir Leben und Wirklichkeit nennen, nur das Ergebnis einer bestimmten Sichtweise, mit der wir von Kindheit an als Brahmane, Moslem, Christ oder wissenschaftlich-rationaler Mensch der Postmoderne konditioniert worden sind? M. behauptet, dass wir die Welt und das Sein auf eine armselige, beschränkte Angelegenheit reduziert haben, auf ein geistiges Bild vom physikalischen oder göttlich inspirierten Universum, das wir mit intelligenten Thesen, wissenschaftlichen Argumenten, empirischer Beweisführung oder religiösen Credos zu untermauern suchen und als Wahrheit betrachten Der Autor forscht in seinem Buch nach einer anderen Wirklichkeit. Nach einer, die nichts mit dem Denken zu tun hat, nichts mit dem Ratio, auf das wir so stolz sind. Nach einer authentischen Realität jenseits der schönen und hässlichen Bilder im Kopf, jenseits des gewohnten Denkens, Fühlens und Handelns, jenseits des Normalen, das er mit der scharfen Klinge des Zweifels tranchiert, bis nur noch ein bedeutungsloser, lächerlicher Torso übrig bleibt, den er nicht nur sich, sondern auch uns vor die Füße werfen kann. „Das Gehirn ist pausenlos mit Problemen, Erklärungen und Urteilen beschäftigt“, insistiert M., „es kann Religionen und Computer erfinden, aber es weiß nicht, was Liebe bedeutet. Wir haben jedoch gelernt, explizit mit dem Verstand zu leben und die Liebe zu einer Sache des Kalküls gemacht.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Der Fels
oder Das Loslassen der Bilder
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenKapitel 1
1
„Nicht immer bin ich Gast der Disziplin bei den Versuchen, dir das Buch meines Herzens vorzulesen. So gerne breite ich das Mirakel der Leidenschaft und seiner Manifeste vor deinen Sinnen aus. Mit der Zunge festgewachsen am Fels der Wahrheit, den ich so liebe wie das Kind die göttliche Mutter, habe ich die Kraft der Bilder, habe ich die Kraft der Szenen, habe ich die Kraft des Gebetes, wenn ich mein Blut von diesem Felsen fordere für dich und mich.“
Wir werden M., der dieses Gedicht in jenen raren Anflügen kontemplativer Intention geschrieben hat und es heute mit fast ehrfürchtiger Distanziertheit liest, für sein Credo am Ende des Buches entweder lieben oder hassen. Dennoch müssen wir zugeben, dass es gleichermaßen töricht und absurd ist, sich bereits zu Beginn mit solch einer schwerwiegenden Entscheidung auseinander zu setzen.
Kapitel 2
2
Worin liegt die Antwort nach dem Sinn des Lebens? Wo sind die Uferwege zum Ozean der Erfüllung, in dessen türkis schillernde Wogen man eintauchen kann, eine Art Jungbrunnen der Erleuchtung für Körper und Geist? Wo ist der tributfreie Zutritt zu den heiligen Portalen einer tieferen, friedvollen Existenz? Wie besiegt man die quälende Angst, den Hass, die unendliche Mühsal, den Zweifel, die so vulgär vitale Begleiter durch alle Tage sind? Wo wartet das erlösende Schwert, die scharfe Edelstahlklinge in der Hand des vernichtend säkularisierten Wohlstandbürgers, die gesalbte Machete der Transformation, die das Geflecht unseliger Gedankenwirbel, den kontinuierlichen Zyklon zwischen Glück und Unglück, zwischen Sieg und Niederlage, zwischen Weinen und Lachen zerschneiden kann? Wo ist die Harmonie, die mehr bedeutet als nur der Glorienschein peripherer Idylle? Wo ist der Frieden? Wo ist die Geborgenheit? Wo ist der Glauben? Wo ist das Antlitz Gottes? Wo ist die letzte unumstößliche Wahrheit des Seins, die mehr impliziert als nur den Inhalt einer Brieftasche und anderer irdischen Indizien einer offiziell berechtigten Anwesenheit?
Wir haben so viele Fragen im Schädel. Und zugegebenermaßen ebenso viele unbefriedigende Antworten. So viele Halbwahrheiten auf dem kognitiven Schuttplatz menschlichen Daseins. So viele Alibis. So viele Ausreden. So viele abstruse Szenerien, die wir nicht verstehen. So viele Landschaften, durch die wir wie dumme Touristen reisen.„Ich sehe Bilder eines fremden Planeten, und nicht nur in meinem Kopf“, sagt M.. „Ich sehe wahnsinnige Filme, verworrene Handlungssequenzen und weiß nicht, ob ich sie Leben nennen soll. Ich sehe dunkle Foyers, in denen man trübsinnig hockt und sich den Schädel mit Problemen zermartert. Ich sehe leere Telefonzellen des Haders. Ich sehe Träume. Ich sehe Illusionen. Ich sehe Sehnsucht, die in Hinterhöfen stirbt. Und zurück bleibt Resignation oder Kapitulation. Zurück bleiben so viele Komplikationen aus Wut, Schmerz, Lust und Leidenschaft.
“Wir, als Amateure im Feld geistiger Schwerstarbeiter, mögen derartige Worte als defätistisch betrachten, vielleicht als depressive Eruption eines schwermütigen Denkers, aber die Art und Weise, mit der ein aufrichtig sanftes Lächeln seine Stimme begleitet, lässt uns gleich wieder beschämt die Gedanken und den Blick senken. Indessen können wir sicher sein, dass M. unsere dilletantischen Vermutungen großzügig übergehen wird.In was sind wir da hineingeraten? Was für einer Person hören wir hier zu? Was für Worte lesen wir? Was für Credos? Was für philosophische Ergüsse? Was für Fragen?
„Das ist kein Roman“, würde M. antworten, „und das ist auch kein Buch heiliger Erkenntnisse. Es ist keine private Audienz mit der intimen Bewandtnis meines Bewusstseins. Keine seltsame Form eines spirituellen Vermächtnisses. Kein autobiografisches Lustwandeln durch Gehirnmasse und Ganglien. Keine lineare Geschichte, mit der man sich amüsiert oder die einen bis zum Erbrechen nervt.“
Dann würde M. kurz innehalten und mit einer Geste der Besorgnis an seine Brust fassen, von der wir nie genau wissen werden, ob sie ihm persönlich oder der Welt gilt.
„Ich schreibe, um zu überleben, und ich schreibe für die, die lesen, um zu überleben. Das ist unsere gemeinsame Basis“, wird er leise ins Zimmer flüstern und wieder dabei lächeln.
Angesichts einer derartigen pathetischen Manifestation kognitiver Überlegenheit des Schriftstellers bleibt uns nichts anderes übrig, als den Schild der Argwohn und der Skepsis bei unserer Reise durch den Dschungel der nachfolgenden Zeilen und Kapitel bereitzuhalten. Und uns sollte klar sein, dass wir jederzeit auf unser freies Recht pochen können, diesem Buch nicht länger beiwohnen zu müssen. M., der über jene seltene Fähigkeit zur Ataraxie verfügt, wird uns garantiert nicht daran hindern wollen.Ist da nicht manchmal der verzehrende Wunsch, es möge einfach alles aufhören? Es möge einen absoluten Stillstand geben, jenseits von Mühseligkeit und Schuld? Die Visionen von einem Vakuum, aber nicht schwer und tot, sondern heiter vital und lichtvoll? Oder muss man sich mit dem Credo begnügen, das Leben bestenfalls mit einem moderat infantilen Lächeln ertragen zu können? Kann Ertragen das Fundament, die Basis der Existenz sein? Kann Ertragen zum Lehrziel unserer Zeit zwischen Geburt und Tod werden? Ist das die Wahrheit? Ist das der Weg? Ist das die Antwort? Oder liegt in diesem Ertragenmüssen nicht doch nur der jämmerliche Erguss von Resignation? Ist das nicht auch nur eine läppische Ausrede? Eine der vielen Lügen in uns und in der Welt, die wir so geflissentlich ignorieren, weil deren direktes Betrachten zur Indikation führen würde, dass wir dringend etwas etwas ändern sollten?
„Die Schädeldecke möge zerplatzen unter der Last aller Irrungen, Hypothesen, Erkenntnissen und Zerwürfnissen“, sagt M., und wir sind nicht sicher, ob wir den pastoralen Unterton seiner Stimme billigen wollen. „Das Herz möge explodieren in der Diskrepanz zwischen Tag und Nacht, zwischen Wissen und Dummheit, zwischen Himmel und Hölle. Der Leib möge niedersinken in der Zwiespalt aus Lebendigkeit und Taubheit. Das Auge möge erblinden angesichts der widersprüchlichen Szenarien, denen wir beiwohnen, immer in der Entscheidungslosigkeit, ob wir sie nun mögen oder hassen sollen.“
Mit einem gewissen Unbehagen, gleich in welcher erregten oder narkotisierten Verfassung wir uns derzeit befinden, registrieren wir M. ́s Sentenzen wie zwangsverpflichtete Zuhörer auf einer harten Kirchenbank. Müssen wir uns wirklich alle möglichen Predigten und Botschaften gefallen lassen? Müssen wir uns wirklich solche idiotischen Guruworte in die Eustachschen Röhren stopfen lassen? Müssen wir wirklich zuhören, obwohl wir noch längst nicht entschieden haben, ob wir unsere Aufmerksamkeit einem geläuterten Propheten oder einem wichtigtuerischen Arschloch schenken?
Wir sollten zuerst ein öffentliches Tribunal abhalten. Über diese Geschichte, diesen Roman, dieses philosophische Statement oder was es sonst auch immer sein mag. Wir sollten von dem Autor, der uns mit seinen Fragen nervt, eine aufschlussreiche Erklärung verlangen.
M. wird auf unsere gereizten Ganglien und Gemüter mit seinem so unmenschlich milden Lächeln reagieren und unbeirrt mit der Niederschrift seiner geistigen Reflexionen fortfahren. Vielleicht ist er ein Pilger im Mekka von Lyrik und Prosa, der nicht an der schwarzen Mauer des Fluches mit Felsbrocken wirft, um den Teufel symbolisch zu steinigen, oder mit Handys und Armbanduhren wie betuchte Muslime, die damit gleichermaßen ihre geistige und weltliche Überlegenheit demonstrieren wollen (wofür sie weder das wohlwollende Lächeln Allahs noch das des Gottes des Kapitals ernten), sondern mit den massiven Sentenzen seiner Eloquenz, wenn er schreibt: In diesem Buch findet man nicht die letzte, absolute Antworten auf jene Fragen, die uns so quälen, die uns zweifeln lassen, die alle Schritte so beschwerlich begleiten. Es ist nicht das Manifest endgültiger Gebote in der Wüste Moses. Es ist nicht die Erkenntnis der heiligen Weisheit. Es ist nicht das oberste Credo über allen anderen, beweihräucherten Schriftrollen der Glaubensbekenntnisse, Religionen, Philosophien, Ethiken und ähnlichen Konzepten für das argumentierbare Leben. Es ist nicht das Wort Gottes oder wie man ihn auch immer nennen möchte oder kann. Es ist nicht die Wahrheit. Es gibt so viele Handlungsreisende in Sachen Wahrheit. Es gibt so viele Lehrer, Meister, Gurus, Erleuchtete und Denker, die uns das Wissen vom besseren Leben verkaufen. Es gibt so viele Gehirnakrobatiken, Mythologien und Ideologien, denen man zustimmen könnte. Es gibt so viele schöne Worte, die das Zentrum der Sehnsucht zärtlich massieren.
Irgendwie klingt das konfus, abstrakt oder sogar arrogant, obschon wir uns vor dererlei Urteilen hüten sollten, denn bereits bei peripherer Betrachtung von M. ́s Persönlichkeitsbild sollte uns klar sein, dass er bei dem leisesten Verdacht der Überheblichkeit in Tränen ausbrechen würde. Und schließlich wollen wir ja niemandem wehtun, oder?!
Indessen dürften wir ruhig unserem Ärger Ausdruck geben über die frevelhafte Tatsache, dass wir im Epos eines philosophierenden Autors verweilen (ohne uns klar dafür entschieden zu haben, ob dieses Buch nun die Niederschrift einer Geschichte oder die Geschichte einer Niederschrift oder auch keines von Beiden ist), der sich hinter dem Kürzel M. versteckt. Das scheint zugegebenermaßen doch etwas übertrieben inkognito, auch wenn wir als erwachsene Menschen allerlei Heimlichkeiten und Anonymität gewohnt sind. Brauchen wir nicht, um jemanden wirklich ernst nehmen zu können, einen Namen? Können wir uns mit einer Person identifizieren, die M. genannt wird (was wie ein abstruses, unverbindliches Synonym wirkt, vielleicht auch eine gewisse Feigheit ausdrückt)?
„Nennt mich einfach M.“, würde er freundlich antworten. Wir wissen, dass er jedwedes Entgleisen aus seiner Ataraxie-Schiene vermeiden wird. „Nennt mich M. wie Melancholiker oder Müßiggänger. M. wie Mann. Oder M. wie Mensch.“
Gewiss ein unbefriedigender Kompromiss. Ein lächerliches Angebot seiner großzügigen Unverbindlichkeit, mit der er um unsere Sympathie feilscht. Doch lasst uns nicht kleinlich sein! Lasst uns nicht um irrelevante Banalitäten streiten! Lasst uns nicht durch die bittere Gallenflüssigkeit unserer Begierde nach Namen, nach Titulierung, M. ́s Botschaft, die Geschichte und die Reise durch Gedankenlandschaften verdrießen, bevor wir nicht sicher sein können, ob wir am Ende stehende Ovationen geben oder mit Tomaten und Eiern werfen werden. Wahre innere Intelligenz beweist der, der geduldig bis zum Schluss wartet, bevor er den Daumen zielsicheren Urteilens nach oben oder nach unten richtet, obschon M. zu bedenken gäbe, dass es wohlweislich darum ginge, sich des Ballastes jedweder Bewertung und Resümees zu entledigen.
„Der ganze Betonsockel festgelegter Meinungen, akkumuliert aus Zujubeln und Ablehnen“, erklärt M., „hält keiner genaueren Inspektion stand, ohne dass er unter dem Mikroskop der Aufrichtigkeit zu feigen Atomen des Zweifels explodiert.“
Während er sich wieder an den Computer setzt, um mit seinem Buch fortzufahren, und wir wie unsichtbare Voyeure über seine Schulter in den Monitor starren, noch unter der sanftmütigen Obhut eines Prologs stehend, aber bereits zu ahnen vermögen, wie die Bataillone philosophischer und spiritueller Redseligkeit künftig über uns hinwegfegen werden, kommen wir nicht umhin, eine Art pragmatischer Gegenwartsbewusstheit zu präsentieren, indem wir darauf hinweisen, dass diese Geschichte (oder was sie denn auch immer zu sein scheint) just anno 2001, mitten im Sommer begonnen wird. Das Wort „Sommer“ hat - zumindest hier in deutschen Gefilden - eine bestimmte fragwürdige Bewandtnis, eine marode Aussagekraft, die stets mit der launischen Unverbindlichkeit verheissungsvoller Hochdruckwetterlagen gepaart ist, so dass wir diesen meteorologischen Terminus nur ungern benutzen (wir sehen den festen Griff der Zweifelnden um Regenschirme bei 30 Grad im Schatten, während wir, unbekümmert Eis am Stiel leckend, die aufschlussreichen Varianten weiblicher Gesäßbacken gelangweilter Hausfrauen am Nacktbadesee studieren).
Aber es ist tatsächlich sonnig und heiss, wenn M. seine schriftstellerischen Intentionen ins Schreibprogramm tippt: Ich schreibe dieses Buch zwei Jahre nach einer Zeit, in der ich in eine absolute Talsenke gestürzt war, erzählt er, eine Zeit, in der alle Konstruktionen und Gebäude, auf die mein bisheriges Leben gestützt waren, in sich wie lächerliche Kartenhäuschen zusammenbrachen. Ich schreibe dieses Buch nach einer Zeit schmerzlicher Niederlagen. Ich sitze hier am Schreibtisch, eingerahmt vom Licht der alten, gelben Sonne, das sich über den Westen Stuttgarts ergießt, und denke darüber nach, wie innerhalb weniger Wochen alle Mauern der Sicherheit zerbrökelten, meine materielle Existenz, meine exaltierten Bemühungen als Unternehmer, meine Ehe, mein persönlicher Status in dieser Welt. Es war das Ende. Das Ende aller Festungen, die ich mir als Basis erbaut hatte. Das Ende von mir selbst.
Vielleicht sollten wir unsere Verwunderung im Zaum halten, dass die geistigen Ergüsse des Autors nun doch unerwartet autobiografische Züge annehmen (vielleicht ein literarischer Kunstgriff, um den Führstrick der Identifikation an unsere abschweifenden Herzen zu binden), und begreifen, dass seine Chance einer möglichen Katharsis eventuell darin liegen könnte, sich einmal selbst wichtig zu sehen, sich einmal selbst in den Vordergrund zu stellen.
„Heute bin ich beinahe arm wie eine Kirchenmaus“, sagt M. fast detachiert, und wir können uns nicht des Erstaunens über die Ehrlichkeit dieses 45jährigen Mannes erwehren. Wie ein unbeugsamer, vielleicht sogar ein bisschen störrischer Gelehrter sitzt er vorm Computer. Eine hochgewachsene, dürre Gestalt, sehnig und schlank, ein schmales Gesicht, umrahmt von graumeliertem Bart und kurzgeschnittenen Haaren, die runde Nickelbrille vor den Augen, die Zeugnis davon ablegt, wie er schon seit frühester Kindheit bei schlechtestem Licht in die Papierträume der Bücher gestarrt hat, und heute irgendwo im Niemandsland zwischen voller Manneskraft und langsamen Altwerden immer noch passionierter Studiosus geschrieben Wortes ist.
„Ich fühle mich keines Alters zugehörig. Ich weiß nicht, was es bedeutet, 45 Jahre alt zu sein. Ob das als jung oder als alt zu bewerten ist. Oder ob man überhaupt dem Begriff ,45 Jahre’ irgendeine emotionale oder gedankliche Bewandtnis zuordnen sollte.“ M. verkündet das nicht ohne den gewissen Stolz, sich nicht nur die Fähigkeit einer vitalen Sehnsucht nach Nähe und Berührung bewahrt zu haben, sondern auch vom Umstand beglückt zu sein, dass sein weltliches Fleisch immer noch von einer beinahe knabenhaften Jugendlichkeit durchwirkt ist. Wir ahnen, wovon er spricht und kennen den besorgten Blick auf Speckhüften, Hängebauch und erste ernstzunehmenden Runzeln am Gesäß (den wir mit den nackten Hausfrauen am Badesee teilen, die ihre Schwangerschaftsstreifen und die Zellulitis der Oberschenkel mit Zauberölen und sündhaft teuren Wundercremes der Kosmetikindustrie zu bekämpfen suchen, um wieder den bestärkenden Blick der Begierde und die Leidenschaft maskuliner Lenden zurück zu erobern, wie die Rekonstruktion eines fernen Traumes, dem man sein lustvolles Fleisch geraubt hat).
„Manchmal werden persönliche Geschichten zum tragischen Konglomerat aus Irrwegen, Entscheidungen, Rückschlüssen und Unvermögen“, konstatiert M. und wir applaudieren für diese weise Erkenntnis. Bravo, lieber M., bravo! Wir jubilieren über die kognitive Jugendlichkeit in deinem graumelierten Haupt!
Es waren Jahre des Zerfalls, fährt er unbeirrt fort - ohne es sich anmerken zu lassen, ob er darüber nachdenkt, dass wir ihn möglicherweise für seine ergötzlichen Worte eines Tages zu einem jener seltsamen Heiligen erheben könnten, die Levitation betreiben, übers Wasser spazieren oder mit Flügeln aus Hühnerfedern und Wachs vom Dach des Kaufhofes springen - denen ich handlungsunfähig und kapitulierend zuschaute. Ich wohnte dieser Agonie bei und die eigentliche Marter war nicht der langsame Zusammenbruch, sondern die unendliche Qual der Angst jeden Morgen beim Erwachen. Die Injektion des Morgens als brennende Nessel der Aussichtslosigkeit, einen bitteren Geschmack im Mund und dennoch ein Lächeln im Gesicht wie die eiserne Maske der Unzerstörbarkeit.
Ich schwieg resigniert über die Tatsache meines Unvermögens, schwieg über die Furcht, über das Entsetzen, schwieg über die Trostlosigkeit aller Perspektiven, die ich noch zu finden vermochte. Ich lächelte ehern, weil ich den Geboten und Gesetzen der Mitmenschen und der Welt gehorchen wollte, die das vermeintlich von mir erwarteten. Ich trug das Grinsen eines Pavians, das Manifest einer scheinbaren Geduld, aber in meinem Inneren da tobte die grausige Schlacht aller Widersprüche dessen, was ich gelebt und dem, was ich mir ersehnt hatte.
Wenn wir M. in diesen Zeilen und der Retrospektive seiner Biografie begleiten (obschon wir weiterhin den Verdacht hegen, uns mit einer fiktiven Geschichte abzumühen), den Zerfall seiner 15 Jahre Ehe betrachten, den Zusammenbruch seiner beruflichen Selbstständigkeit, die daraus entstandene materielle Not und Überschuldung (wir werden M.’s Bekenntnis zur armen Kirchenmaus nun endgültig in die Annalen aufnehmen), den ganzen Wust an Versagen und Unvermögen, die Angst vor dem Herausfallen aus allen Statuswerten, werden wir durchaus der Lügen, des Selbstbetruges gewahr, auf denen ein Leben basieren kann. Sind diese Illusionen, diese Rauchschwaden nicht das Dèjàvu desselben lächerlichen Terrains, auf das wir unsere eigenen Füße setzen? Die Empore in der Sonne auff der wir selbstzufrieden hocken, möge hoffentlich ebenso beständig sein wie unsere felsenfeste Überzeugung, stets genügend smart zu sein, um aller Situationen Herr zu werden. Amen und Hallejulah!
M. sitzt am Schreibtisch und fingert in die Tastatur: Ich kreiere hübsche Worte. Ich betrachte ein Ende. Einen Tod. Meinen Tod. Ich lächle über mich. Ich lächle über den trauernden Ölgötzen, der Elegien der Agonie singt. Ich grinse über das Dilemma des Scheiterns. Aber da ist nicht mehr das nette Zahnweißlächeln, der geduldig verharrende Pavian, der es so brav gelernt hat, dem Desaster des Schicksals mit der Maske unzerstörbaren Gleichmutes zu begegnen. Es ist das kognitive Lächeln über den scheinbaren Tod, dessen Verursacher, dessen Delinquent ich selbst war.
Wir sehen M. als Akteur einer Geschichte, von der er heute weiß, dass er deren Ablauf, deren Szenarien selbst entworfen hatte. Der Film bekam eine fast kitschig tragische Handlung, die er irgendwann nicht mehr mochte. Doch das Drehbuch war bereits zum Gesetz geworden.
„Die Rollen standen fest. Da war R., meine Frau, der ich mich versklavt hatte, um ihre pathologische Gier nach Selbstwertgefühl materiell und ideell zu nähren, das sie im exzessiven Betreiben des Reitsports, in der Bewunderung über ihre wohldressierten Hunde und Pferde zu finden glaubte, solange, bis diese Sucht nicht nur unsere Finanzen, sondern auch unsere Beziehung, unsere Ehe, unsere Liebe und schließlich auch ihre eigene Gesundheit aufgezehrt hatte“, erzählt M., und das fast prosaische Timbre seiner Worte bringt uns zur Überzeugung, dass es keinesfalls notwendig ist, ihn an irgendeine psychoanalytische Couch zu ketten, einen Janowschen Urschrei aus ihm herauszuquetschen oder neurologische Diagramme seiner Darmperistaltik aufzuzeichnen.
Das Bulletin des Leidens wird auf eine andere Art und Weise offenbart werden. Vielleicht wird ein Gebet die Diagnose bringen? Vielleicht wird eine geistige Petition an Gott oder adäquate Formen der Meditation die unheilvollen Mechanismen in M.’s Gehirn entlarven? Vielleicht bedarf es auch nur eines schamanischen Rituals, eines mystischen Voodoo-Zaubers, um sein Haupt von der Asche des Irrtums zu befreien?
Indessen fährt M. fort: „Dann gab es noch G., meinen cholerischen Geschäftspartner, der die paranoide Vorstellung hatte, dass man ihn als Chef, als Geschäftsmann, als Repräsentant eines Unternehmens (auch wenn es nur eine Zwei-Mann-Klitsche war), fürchten und gleichzeitig doch irgendwie liebevoll annehmend respektieren müsste. Dem ständig wechselnden Zyklon zwischen brachialen Tobsuchtsanfällen und Zuständen geradezu lächerlich affektierte Freundlichkeit war ich nie gewachsen. Andere übrigens auch nicht.“
Im leichten Zittern der Finger, wenn M. sich nun eine Zigarette ansteckt, obwohl er sicherlich selbst weiß, dass die Untugend des Rauchens von bestimmten Kreisen als spirituelle Schwäche ausgelegt werden wird, glauben wir einen leichten Anflug von Unsicherheit zu erkennen. Jetzt erst begreifen wir die Verletzlichkeit dieses hochgewachsenen, gertenschlanken Mannes. Wir sollten unserer eigenen Toleranz gewahr werden und die berührende Milde seines Lächelns nicht als arglistiges Täuschungsmanöver betrachten, mit dem er unser Gemüt seelsorgerisch besänftigen will.
Irgendwann wurde ich zum Spielball übermächtiger Personen, schreibt M. weiter. Sie blähten sich immer mehr auf und ich schrumpfte indessen zu einem lächerlichen Nichts. Ich trauerte, ich litt, aber ich konnte nicht erkennen, dass ich selbst den anderen, meiner Frau, meinem Geschäftspartner, eine so entscheidende und viel zu bedeutsame Rolle zugewiesen hatte. Doch anstatt die Figuren und Episoden abzuändern oder das Drama einfach abrupt zu beenden, spielte ich mit der Energie sklavischer Hingabe weiter den Protagonisten einer Erzählung, deren Ablauf längst meiner Kontrolle entglitten war. Ich hatte etwas begonnen, eine Ehe, ein Unternehmen. Doch irgendwann wurde die Kluft zwischen dem was ich erträumte und dem, was ich nun real tat, immer breiter.
„Ist das nicht so, als würde man sich plötzlich auf einem fremden Planeten wiederfinden, wenn du in einem Moment vollkommener Klarheit entdeckst, dass das, was du denkst, empfindest, erhoffst und erträumst, nichts mehr mit dem zu tun hat, was du gerade tust?“ M. weiß um seine sklavische Hingabe an etwas Begonnenes, um seine zwanghafte Ohnmacht, die ihn daran hindert, ein (zwar hoffnungsvoll gestartetes) Rennen mittendrin zu beenden, wenn man erkennt, dass es letztlich nur zu einem Desaster führen wird. M. läuft weiter wie ein mechanisch angetriebener Androide. Das Ziel, dem er entgegenhetzt, ist aber kein Ziel, sondern nur der Kollaps aller aufgewendeten Energien. Das Ziel ist nur eine Illusion. Eine Illusion, die Zerstörung bringt.
M. schreibt: Innerlich hatte ich bereits kapituliert und wusste, dass mich schließlich eine Exekution erwartete. Doch dieses Finale, das nur in einem wirtschaftlichen und familiären Desaster enden konnte, zog mich an wie das Licht eine dumme Motte, die sich selbst verbrennt. Ich ging meiner Hinrichtung entgegen und meine Unfähigkeit, dem scheußlichen Film ein anderes, selbstbestimmtes Ende zu geben, ließ mich gleichzeitig zum Inszenator, zum Opfer und zum Henker werden.
„Jeder Tag ein kleiner Tod“, hatte M. in jener Zeit geschrieben. „Man wird weiterleben. Man wird sich daran gewöhnen, morgens wieder aufzuwachen. Man wird sich an die Monotonie endlosen Sterbens gewöhnen. Selbst an die Narben im Gesicht der Jahre.“
Was soll dieser Nihilismus? Was soll diese pubertäre Depressionslyrik? Was soll dieser biografische Striptease eines insolventen Unternehmers, eines gescheiterten Ehemannes? Wir sollten M. zur Rechenschaft ziehen! Wir haben vom lächelnden Gelehrten eine andere Geschichte erwartet. Heute ist ein herrlicher Sonnentag im August. Ein klarer, blauer Himmel über unseren Köpfen. Andere fahren jetzt Cabrio. Andere genehmigen sich eisgekühlte Drinks in der Stuttgarter Königsstraße. Andere sind beseelt von Intentionen ozeanischer Sehnsucht. Andere träumen von den Bahamas oder den Malediven. Andere tauschen nun SMS oder Küsse in der S-Bahn aus. Andere sind nun heitere und fröhliche Scheckkarteninhaber beim Einkaufsbummel
.Wir werden M. unsere Tränen verweigern. Wir werden M. daran erinnern, dass wir vor noch nicht allzu langer Zeit erwägt haben, ihn mit Flügeln auf den Kaufhof zu stellen, um seine Flugkünste mit angemessener Ehrfurcht zu bewundern. Wir waren bereit, ihn übers Wasser gehen zu sehen. Wir haben uns von seinem spirituellen Lächeln verarschen lassen. Wir haben eine andere Geschichte erwartet und nicht nur die tröge Asche eines gestürzten Feuervogels. Wir waren geduldige Zuschauer am Monitor. Wir wollten Zeugen eines Meisterstücks sein. Wir werden den Trauerflor am Bildschirm nicht billigen.
M. ist ein zäher, störrischer Bursche, wenn er mit unserem Mitgefühl und unserer Anteilnahme ringt: Am Ende gab es so viele niedliche Lamentos in meinem Kopf. Schuldzuweisungen in alle Richtungen. Zerborstene Pläne. Konstruktionen. Depressive Emotionen. Dann wieder kurze Momente der Hoffnung, aber gleich darauf von erneuter Trauer erstickt. Die bleierne Rüstung des Ertragenmüssens drückte mich zu Boden. Ich fühlte meine gelähmten Hände und Beine. Ich haderte mit der Erkenntnis, es besser gewusst haben zu müssen. Ich begriff plötzlich die trostlose Tatsache, dass Wissen, war es auch noch so umfassend. manchmal nichts nützt.
Es mag sein, dass Sie und ich, wir, alle möglichen Bücher gelesen haben. Die Bibel. Den Koran. Die Lehren des Buddhismus. Erich Fromm. Ernst Bloch. Osho. Siegmund Freud. Oder viele andere Philosophien und heilige oder profane Lehrpläne für ein besseres Daseins. Wir waren berührt. Wir haben hungrig und inspiriert die Sätze und Gedanken verschlungen. Sie begierig in uns hineinfließen lassen, immer dem guten Vorsatz folgend, sie in unser Leben einzuflechten. Wir haben meditiert. Wir haben Techniken der Stille gelernt. Wir haben Mantras geplappert und unseren Geist damit gezähmt. Wir haben die unterschiedlichsten Wege begangen, die uns zu einem inneren Frieden führen sollten. Wir haben zelebriert und ritualisiert. Wir haben geglaubt. Wir haben gebetet in feierlichen Passagen, die Gott gelten sollten. Wir haben mit dem kontemplativen Scheinwerfer in die mysteriösen Katakomben höheren Geistes geleuchtet. Wir haben unser Leben betrachtet, analysiert und reflektiert im Zeichen einer Veränderung, im Spiegel einer wahren Wandlung. Wir waren beseelt von unserem Antrieb. Wir trugen plötzlich Flügel im Licht der Erkenntnisse. Und doch war da immer wieder eine gnadenlose Sonne, die grelle Glut über der Alltagswüste, die unbarmherzig die Realität von lächerlichen Schwingen aus Wachs offenbarte. Wir sprangen dennoch unbeirrt. Aber Ikarus, der göttliche Flieger, landete unsanft auf dem harten Boden des Desasters.
M. gehört zur Kategorie jener unglücksseligen schöpferischen Wesen, die mit der pathologischen Vision liebäugeln, als letzten Ausweg den Sprung aus dem 10. Stock zu haben. Sie träumen vom Ratschluss des Fallens, doch sie werden es solange nicht tun, bevor sie nicht vorher das vollkommene Gedicht, ein lyrisches Wunderwerk als Testament ihres gepeinigten Daseins, verfassen können. Das mag eine langwierige Angelegenheit werden, dessen sind wir sicher. Genervt warten wir auf den Höhepunkt der kreativen Fieberkurve, ohne zu wissen, was wir mehr fürchten sollen - die Eruption geistiger Schwerstarbeit oder den finalen Sprung aus dem Fenster?
Ist es nicht grausam, das eigene Unvermögen, die eigene Akinese in seiner ganzen gnadenlosen Konsequenz zu spüren? Muss daraus nicht ein anderes Resümee entstehen? schreibt M. weiter, und wir erinnern uns an die Passage einer Erzählung, in der er den pathologischen Fensterspringer zu einem Künstler salbt: „Ihr braucht mich nicht. Doch Ihr seid unvollkommen! Ihr habt mich ignoriert, aber Ihr konntet mich deshalb doch nicht beherrschen, weder mein Elend, noch mein Glück und auch nicht mein jämmerliches Leben! So will ich selbst Regent sein über Licht und Dunkelheit. Ich werde springen, die Sonne in den Armen und mit ihr in den lautlosen Ozean des Schweigens stürzen!“
„Man braucht manchmal Pathos für ein Leben ohne Pathos“, sagt M., und diesmal klingt seine Stimme nicht nach Gleichmut, sondern eher nach Melancholie. Doch bevor wir davon schmerzhaft betroffen sein könnten, geht er zielstrebig ans offene Fenster und starrt hinaus. Wir wissen nicht, ob er über die bleichen Wolkentürme am Himmel meditiert, die sich in die ewigen Formen von Trost und Martyrium verwandeln, oder über seine fleischliche Anwesenheit in den täglichen Katastrophen. Beides wäre Grund genug, um erschüttert zu sein.
Indessen kehrt M. zurück an den Schreibtisch (was wir fast beruhigt registrieren, denn es ist uns heute nicht danach zumute, Zeuge eines Suizids zu werden): Dieses Buch handelt nicht von einer endgültigen Lösung. Es ist nicht die Gebrauchsanweisung für ein besseres Leben. Kein hübscher Knigge mit Regeln und Methoden der Erleuchtung. Keine heilige Schrift der Gebote. Aber dieses Buch könnte der Beginn eines Prozesses, einer Katharsis sein. Ein erster Ansatz für eine neue Betrachtung, für eine Wandlung gefrorener Perspektiven. Dieses Buch ist nicht die objektive Erkenntnis über die zu verändernden Schritte. Es gibt keine wirkliche Objektivität, auch wenn mess-, morphologie- und ratiobesessene Wissenschaftler dies behaupten und ihre Fakten und Argumente auf Leben und Tod verteidigen. Es gibt keine klar fundierbaren Sachverhalte, die zur absoluten Erkenntnis führen. Es gibt keine unumstößlichen Thesen unter dem Himmel eines ruhelosen, bewegten Universums. Es gibt keine Wahrheiten für unsere begierlichen Blicke durch das kognitive Teleskop.
Die tragischen Räume der Tage sind anexakt. Die Konflikte und Desaster haben eine unbeständige Topologie und vage Grenzen zwischen Leid und Lust. Im trögen Zwielicht der Niemandszone suchen wir jene Fiktionen, die wir das Gute, Schöne, Wahre oder Gott nennen. Die Fähigkeit, uns selbst mit Sprache, Sexualität und Glücksobsessionen betrügen zu können, die wir irgendwie in Gesetze, Kausalitäten und Normen implizieren, zeigt das bestimmende Merkmal dessen, was es heisst, Mensch zu sein.Doch können Argumente des Geistes Gott oder die Liebe beweisen?
Die Welt ist umsponnen vom Netz der Richtlinien, Regeln und Wahrheiten, damit der Mechanismus begierlicher Beutezüge nach dem Skalp in der Hand des Siegers zu einer verifizierten öffentlich-rechtlichen Angelegenheit wird. Die Trophäe im Fadenkreuz des Erfolgstraumes, auch wenn sie manchmal ihren Tribut in Form von Opfer fordert, ist Grund genug, um diese Welt, deren Wissen und Strategien, die Gralsbotschaft menschlicher Weisheit, gegen alle subversiven Angriffe zu verteidigen. Wir haben Tatsachen geschaffen, an denen es nichts zu rütteln gibt. Aber wenn etwas nicht in Frage gestellt werden kann, weil es durch Argumente, Indizien und Fakten in den bombensicheren Bunker des Ratios einquartiert wurde, warum quält es uns dann so oft?
Wir wissen, dass M. nicht zu den Erfolgreichen, nicht zu den Triumphatoren zählt (zumindest nicht im Sinne spätkapitalistischen Geistes), und jedem muss klar sein, dass vor allem die Verlierer, die Nieten am lauesten jammern, wenn sie auf der Strecke bleiben. Der Tomahawk der Niederlage, der täglich auf seinen Schädel einschlägt, hinterlässt nun mal seine Spuren. Vielleicht ist M. ́s spirituelles Lächeln nichts anderes als eine gute Tarnung, mit der er seine weltlichen Wunden, seine seelischen Wunden kaschiert und den Pessimismus, Nihilismus und Depression, die daraus entstanden sind. Manchmal trägt man das Lächeln wie eine Maske im Gesicht und die besondere Kunst liegt darin, sie im Kreuzfeuer der Blitzgeräte und Blicke so lebendig wie möglich wirken zu lassen.
Wir sehen einen sanftmütig lächelnden Adolf Hitler, der zärtlich das Haupt eines arischen Kindes tätschelt, im Hintergrund zwei Schäferhunde und Eva Braun im dunklen Kostüm (wir können sie nicht mehr fragen, welch libidinöser Effekt der weiche Schein einer Nachttischlampe aus jüdischer Haut hatte oder anderer praktischer Gebrauchsgegenstände, recycelt aus den sterblichen Überresten ethnischer Säuberungsopfer, die dem deutschen Führerpaar einen gewissen menschlichen Komfort verschafften). Wir sehen den lächelnden Ghandiji, halbnackt und asketisch mager, der die Fäden für seinen Lendenschurz spinnt, im Kameraauge von Margaret Bourke- White. Wir sehen Arnold Schwarzenegger mit Zigarre. Lady Di und Prinz Charles vorm Buckingham-Palast. Joschka Fischer. Milosevic. Harald Schmidt. Sadam Hussein. Mister Bush junior. Wir sehen einen Minister lächelnd das Ehrenwort für seine Unschuld abgeben. Wir sehen den väterlichen Arm wie eine Efeuranke um die Schulter der 13jährigen Tochter wachsen und beide lächeln fürs Familienalbum (eine halbe Generation später wird man diese Idylle bei festlichen Anlässen bewundern und niemand wird das Sakrileg wagen, das Ehrenwerte des Bildes zu zerstören, indem er davon erzählt, wie der Vater seine Tochter über Jahre hinweg zum Beischlaf gezwungen hat). Das Lächeln vorm Objektiv und Zuschauer ist eine gesellschaftliche Konvention der Milde. Die fotografische Emulsion fällt kein Urteil über gut einstudierte Pose oder authentischen emotionalen Ausdruck des Herzens.
„Die Bilder lächelnder Gesichter sind autistisch und verraten nichts über den wahren Geist derer, die wir anschauen. Doch auch die judikativen Interpretationen der Betrachter wirken wenig zuverlässig, wenn sie zu entscheiden suchen, wen sie nun zum Idol küren und wen sie zur Bestie verdammen sollen“, sagt M. und frag sich, ob man nicht zuerst die Schleuse öffnen muss, mit der man all die ungeweinten Tränen persönlichen Elends vor dem öffentlichen Auge zurückhält (eine gesellschaftliche Zwangsverordnung männlicher Rationalität und Räson), bevor man wieder ein echtes Lächeln zu zeigen vermag, das der freudigen Eruption der Seele entstammt.
M. fährt indessen fort zu schreiben: Dieses Buch ist nicht die Expedition in die Landschaften der Wahrheit. Es eruiert keine neuen Tatsachen bei unserer Suche nach dem Glück oder nach Gott. Es findet keine neuen Prinzipien des eigentlichen Sinn des Lebens. Es ersetzt nicht die vorhandenen Wahrheiten gegen bessere Wahrheiten. Es gibt keine besseren Wahrheiten, weil wir weder gute noch schlechte Wahrheiten entdecken können, wenn wir begreifen, dass alle Wahrheiten, meine, unsere, nur Bilder im Kopf, in der Fotoemulsion des Gehirns sind. Es geht um das Verständnis, dass alle Projektionen des Verstandes, bewusst und unbewusst, lediglich Kartografien und Konstruktionen sind, mit deren Hilfe wir alle Handlungen und Erfahrungen in eine bestimmte Ordnung, in eine bestimmte Systematik bringen wollen, um zu vermeiden, dass unsere Wirrnis, das Durcheinander noch unerträglicher wird. Dennoch müssen wir immer wieder des Problems gewahr werden, dass das nicht die Lösung bedeutet, weil das Chaos, deren schmerzlichen Symptomatik wir unentwegt begegnen, weiterhin Bestand hat.
„In meinem Buch geht es um das Loslassen“, sagt M. zu J. in einem geradezu beschwörenden, feierlichen Timbre, der entweder von einer tiefen Überzeugung oder auch nur von der glückselig machenden Entspannung nach einer befriedigenden erotischen Begegnung zwischen Mann und Frau herrührt. „Es geht um das Loslassen von Bildern. Es geht um das Loslassen von Wahrheiten. Es geht um das Loslassen dessen, was wir als Ich wahrnehmen.“
J., die neue Lebensgefährtin unseres Protagonisten, unseres Autors oder wie wir ihn auch immer bezeichnen wollen, scheint die Worte, die Stimme ihres Geliebten voll genüsslicher Aufmerksamkeit aufzusaugen. Schweigend lauscht sie dem Sprecher, und wenn wir in diesem intimen Augenblick unseren männlich orientierten Blick über ihren üppig weiblichen Körper schweifen lassen, über die Schönheit femininen Fleisches, vermögen wir zu erahnen, warum M. trotz seines ehelichen Desasters nicht ins Zölibat gegangen ist oder sein künftiges Heil in flüchtigen Doppelbett-Affären verwirklicht, sondern sein Herz weiterhin tapfer an den Riemen der Liebe zu binden sucht.
„Ich habe sie an einem nebligen Novemberabend kennengelernt“, erzählt er, seltsam beseelt wirkend, „an einem jener kalten, schneeverdächtigen Abende, die ein einsames Herz schier nicht ertragen kann. Ich sah sie, eine hochgewachsene Frau mit kupfergetöntem, schulterlangem Haar, vielleicht ein paar Kilo zuviel, die aber kein Makel, sondern eher sympathischer Ausdruck üppiger Weiblichkeit waren, eine große Frau im dunklen bordeauxroten Laura Ashley-Kostüm mit kühlblauen, aufmerksamen Augen. Dann erblickte ich zwischen ihren Brüsten einen goldenen Engel, den sie an einer langen Kette trug. Und wer trägt in unserer säkularisierten Welt schon ein solches Flügelwesen am Herzen?“
Plötzlich bekommen M. ́s Augen jene irisierende Strahlkraft, die entweder den Anflug von Wahnsinn oder den kognitiven Blick in Gottes wahre Schönheit ankündigt. „Es war wie ein Déjávu...und plötzlich wusste ich, dass sie die fleischliche Inkarnation meiner inneren Frau, meiner ersehnten Seelenpartnerin war.“
Wir werden angesichts einer solchen Behauptung kommentarlos schweigen. Wir besitzen genug Vorstellungskraft, um zu verstehen, welch merkwürdige Visionen im Kopf eineseinsamen Mannes erigieren können. Später wird M. das Gedicht „An eine ferne Geliebte“ aus dem Jahre 1992 als Beweis heranziehen, dass ihm J. als lebendiges Bild in seinen Träumen erschienen ist: „Schon alleine wegen deiner Stimme könnte mein Traum in Ohren wachsen. Wenn sie auch nach Agonie klingt, hast du eine bestimmte Art des Überlebens gelernt und singst an sakralen Orten, dort wo man sich mit dem Zölibat und der Verleugnung des Fleisches gequält hat, die Lieder der Erlösung. Vielleicht trägst du dein Haar in Kupferrot und es schimmert in der Wintersonne wie eine metallische Rüstung über deinen Gedanken. Und du gibst dein Blut der heiligen Erde, und vielleicht wartest du auf mich und unsere Befreiung von der Zellophanhaut des Schweigens. So sage ich dir, dass meine Augen die Abwechslung lieben, und wenn wir auch immer noch Dilettanten göttlicher Konversationen zwischen Zunge und Körper sind, so mag allein die Farbe deiner Haare dieses Gedicht und meine Sehnsucht füllen.“
Wir kennen M. ́s fast pathologischen Hang zum Pathos, der beim Anblick eines goldenen Engels zu einer schier unerträglichen Energie anschwillt, aber wenn wir J. sehen, ihre menschlichen Tränen der Rührung, sollten wir uns jedweden Kommentars entheben und uns in die distanzierte Position des schweigenden Voyeurs zurückziehen.
Indessen wohnen wir wieder dem einsamen Agieren des Autors in Sachen Wort bei: Ich schreibe in diesem Buch über Gott. Ich schreibe über Gott, weil ich an ihn glaube. Aber ich bin nicht Missionar christlicher Mysterien. Ich bin kein Überredungskünstler, der Gott zur Wahrheit erklärt. Und es gilt zu verstehen, dass Gott nicht ein urheberrechtlich geschützter Name für Wahrheit ist. Der Name Gott braucht kein Copyright, er ist nur ein Wort. Und das Wort ist niemals absolute Wahrheit, sondern bestenfalls der Versuch deren Umschreibung. Gott, Allah, Krishna, Buddha, Manitou sind nur zusammengesetzte Buchstaben. Sie sind bei der detachierten Betrachtung ihrer Epidermis nur abstrakte Begriffe. Es geht nicht um das Verstehen von Begriffen, denen man so gerne die Vitalität des Fleisches überstreift. Es geht nicht um das bewandtnisreiche Einordnen von Namen. Es geht um die Konsequenz der puren Erkenntnis, dass die Schöpfung von einer kreativen, lebendigen Kraft durchdrungen ist. Und diese Kraft kann nur eine liebevolle Energie sein, wenn wir die fast unbegreiflichen Ausmaße und Vielfalten der Schönheit betrachten, aus der die Welt, das gesamte Universum erbaut ist. Es ist die Schöpfung einer lebendigen Welt. Und lebendig bedeutet auch steter Wandel. Stetiger Wandel impliziert das Ende aller Erstarrung. Wahrheiten sind erstarrte Käfige. Wandel ist das Verlassen der Käfige. Wandel ist das Loslassen von Wahrheiten.
In diesem Buch geht es um den Prozess des Loslassens von Wahrheiten. Es ist ein Versuch. Es ist der Versuch der Betrachtung, die Wahrheiten zu entlarven. Es ist der Versuch, eine Betrachtung abseits der Wahrheiten zu lernen. Eine solche Betrachtungsweise ohne den Filter unserer Wahrheiten, unserer Werte, unserer Beurteilungen ist ein Aufnehmen der Wirklichkeit in voller Wachheit, in voller Intensität. Das Erlernen der puren Aufmerksamkeit könnte der Schlüssel zu allem sein. In den Gedanken um diesen Schlüssel bewege ich mich als Schreibender in dem Buch. Ich bin auf Spurensuche. Ich ahne, dass die Fährtensuche eine ungeheuere Rigidität er- fordert. Dass sie eine Höllenfahrt durch alle geschaffenen Muster und Strukturen in unserem Inneren ist. Dieses Labyrinth des Egos, das wir gleichzeitig lieben und hassen, gilt es aufzulösen. Die Widersprüche verursachen Trennung. Und Getrenntes ist immer Chaos, impliziert immer die Qual des Zweifels über die richtige Entscheidung.
„Etwas aufzuteilen in das, was sein sollte und das, was ist, ist der trügerischste Weg, sich mit dem Leben zu befassen“, sagte der indische Philosoph und spirituelle Lehrer Jiddu Krishnamurti in einem seiner zahllosen Vorträge, die er in Asien, Amerika und Europa abhielt, um seine Botschaft zu vermitteln, die vor allem darin bestand, sich von allen religiösen, psychologischen, philosophischen oder sonstigen Dogmen zu befreien, um wahre, authentische Selbsterkenntnis zu betreiben, um die eigene innere Autorität zu entdecken. „Erst wenn alle religiösen Fesseln abgelegt sind, beginnt wirkliche Religiosität.“
„Ist Gott die paranoide Vorstellung exaltierter Gemüter, die in ihren Meditationen seltsamen heiligen Halluzinationen begegnen, um sie dann zu einer realen Skulptur der Hoffnung im täglichen Überlebenskampf zwischen Sieg und Niederlage zu formen?“ fragt M. und konstatiert: „Das Entfernen der Religion durch eine Operation ist unmöglich. Und wenn wir Gott für nichtexistent oder tot (wie Nietzsche) erklären, ist dies nur der Akt des Selbstbetruges, weil wir indessen bereits in neue Religionen geflüchtet sind, ohne es zu ahnen. Gott hat nur einen anderen Namen bekommen und er heisst jetzt vielleicht Geld, Macht, Ansehen, Sex oder Demokratie.“
Wir ahnen, auf was M. hinauswill, wenn er das philosophische Schwert der Moral über unsere Köpfe schwenkt („Keiner, der im Glashaus sitzt, soll mit spirituellen Steinen werfen!“). Wir weisen jedweden Wink mit dem moralischen Zaunpfahl entschieden zurück. Wir lassen uns die vergnüglichen Stunden im französischen Bett nicht vermiesen und erinnern M. an seine Liaison mit J.. Wir werden unsere Konten nicht plündern lassen. Wir werden unsere mühsam erarbeitete Position, unseren Büroblick auf chromblitzende Wasserspiele und Platanenalleen nicht aufgeben. Wir werden weiterhin die Raten für unseren BMW Z 3 tilgen und unser charmantes Lächeln der brünetten Sekretärin des Chefs schenken. Wir werden den Segnungen westlicher Kultur unbeirrt die Ehre erweisen und ihr Angebot an virtuellen, fleischlichen oder kulinarischen Köstlichkeiten preisen. Wir werden unseren Dispokredit erhöhen und ohne M. zu den Seychellen fliegen.
M. gäbe sicherlich seiner (so unmenschlich beständigen) Immunität gegenüber Kosumverlockungen dadurch Ausdruck, indem er uns erklärt, dass er nicht sonderlich an Pauschalreisen interessiert sei, bevor wir ihn wieder am Schreibtisch sitzen sehen, wo sein Geist über Regenbogen wandelt, durch das Auge des Wals in sein inneres Bewusstsein gleitet, das frei ist vom begrenzenden Kalkül menschlichen Denkens, zu den Sternen fliegt und deren Klang hört, der hinter dem Schweigen des physikalischen oder göttlich inspirierten Universums ertönt. Er wird berührt zurückkehren, eine Zigarette rauchen und mühselig um passende Worte ringen.
Indessen kommt M. uns bei sachlicher Betrachtung vor wie die armselige Ikone eines philosophischen Poeten, ein Eremit in der Wüste schriftstellerischer Katharsis. Möge er seine Erleuchtung am Monitor bekommen und wir Zeuge sein!
Wir erinnern uns plötzlich an die Worte Dalai Lamas, dem religiösen Oberhaupt Tibets im indischen Exil: „Mitgefühl und Altruismus, die Fähigkeit, das Leid der anderen auf uns nehmen zu können, um es zu lindern, sind Grundpfeiler buddhistischer Lehren. Wenn wir im Samsara, dem weltlichen Treiben des Menschen, die Habgier, den Neid und die Vergeltungssucht nicht mehr als Ausdruck des Bösartigen sehen, sondern die Not, die Verzweiflung erkennen, die sie verursacht, haben wir den ersten entscheidenden Schritt zur Barmherzigkeit gemacht.“
Solch ein Credo vermag uns durchaus zu berühren (und wir sind keineswegs aus Stein). Wir sehen das Konterfei des ewig lächelnden (Analogien zur gewissen Mimik eines M. lehnen wir strikt ab!), übergewichtigen Glatzkopfes, und es scheint uns weitaus sympathischer zu sein als das geplagte, bleiche Gesicht seines vatikanischen Pendants, der sein „Urbi et Orbi“ derart leidvoll timbriert, dass wir vermuten müssen, der päpstliche, greise Körper sei bei allen öffentlichen Auftritten von den Höllenqualen chronischer Nierenkoliken begleitet. Aber wahrscheinlich ist diese Form katholischer Deklamatorik das Manifest liturgischer Demut, die wir nicht verstehen können. Immerhin ist die gute Absicht beider religiöser Oberhäupter gemeinsamer Natur, wenn sie im Namen Gottes oder Buddhas an die Tugend der Nächstenliebe appellieren. Und wir ergreifen den Minimalkonsens altruistischen Denkens, indem wir M. durch die Schlusspassage seines Prologs folgen, und alle berechtigten Einwände gegen seine merkwürdigen Ansichten auf Eis legen.
Wenn du die Erläuterungen, Reflexionen und Spurensuche in diesem Buch nicht als mein Dogma betrachtest und deine eigenen Bewertungen und das eigene Wissen nicht als Widerstand, sondern lediglich als andere Sichtweise in die Waagschale wirfst, werden wir in diesen Überlegungen und Gedanken gemeinsam forschen.
Das plötzliche „Du“ des Autors, ein schon fast perfider, provokativer Stich in unser wohlwollendes Auge, das ein sträfliches Eindringen in den geschützten Raum des Privaten sieht (das „Du“ ist entweder ein familiäres Anrecht oder die Einladung, intime Nähe verbal oder körperlich zuzulassen), strapaziert unsere christlich oder buddhistisch induzierte Bereitschaft zur empathischen Toleranz aufs äußerste, und nicht ohne einen zurückhaltenden Hinweis auf unseren gewissen Unmut ertragen wir tapfer die weiteren Sentenzen: Wir werden gemeinsam Wahrheiten anschauen. Wir werden gemeinsam eine Exkursion durch den wilden Zyklon unseres Selbst durchführen. Du kannst mir zustimmen, aber auch Ablehnung finden. Du kannst mein Verständnis teilen oder auch total verwerfen. Das ist sehr gut. Denn je mehr du von dir einbringst, desto facettenreicher wird die Betrachtung. Wenn wir mutig und mit großer Sorgfalt forschen, berühren, beobachten, die Dogmen und Glaubenrelikte sezieren, bis sie zu bedeutungslosem Staub zerfallen, wird der Schlüssel, der möglicherweise aus dem Dilemma herausführen kann, immer konturierter und klarer. Du wirst erkennen, dieser Schlüssel besteht nicht aus diesem Buch und meinen Reflexionen. Ich halte deinen göttlichen Schlüssel nicht in der Hand. Der Schlüssel ist dort, wo er seit Urzeiten liegt: In dir selbst!
Kapitel 3
3
„Ist es nicht eine Tragödie, dass manchmal erst der Schwerthieb schicksalhafter Ereignisse an unserem Dornröschenschlaf zu rütteln vermag?“ fragt M.. Wir sehen wie seine Ehe, seine wirtschaftliche Existenz, die aufgesetzte Tarnkappe eines mechanisch funktionierenden Lebens, die man nach außen präsentiert wie eine Hollywood-Fassade, von der Tellermine unbarmherziger Fakten zerfetzt wurde.
„Ich hatte kein Geld mehr“, erzählt M., „und alle Konten waren bis zum Dispolimit geplündert. Es gab keine Aussichten auf neue Aufträge für unsere Firma. Die wirtschaftlichen Ressourcen waren erschöpft. Das menschliche Verhältnis zwischen meinem Geschäftspartner und mir hatte das feindselige Klima eines kalten Krieges angenommen. Jegliche Zusammenarbeit war somit aussichtslos geworden.“
M. steht am Fenster. Er spricht seine Worte in den tiefblauen Himmel eines schwülen Augusttages, als wäre es ihm unangenehm, jemanden angesichts seiner katastrophalen Geschichte, für die er sich vermutlich schämt, direkt in die Augen zu blicken. Ein heißer Saharawind streicht über die Kaskadendächer Stuttgarts. Der geschäftige Alltagslärm der Stadt hat etwas Malträtierendes für unsere Gehörnerven. Ein ewiger Klangteppich, der uns durchdringt, durchbohrt, dem wir nie entrinnen können, ist der Fluch der Zivilisation. Aber man hört das einsame Zirpen eines Vogels im bereits herbstlich getönten Blattwerk einer Kastanie und der Wind trägt den Geruch frischgemähten Grases zum Fenster. Das ist wie eine tröstliche Erinnerung daran, dass es noch etwas anderes gibt als Fahrzeugkolonnen, Düsenjets und Häuserschluchten.
„Diese Unwissenheit über, mehr: die Entfremdung von uns selbst ist der Grund, weshalb wir uns von der Natur isoliert fühlen“, schrieb der amerikanische Philosoph Alan Watts in seinem Buch „Im Einklang mit der Natur“.
„Ich kenne dieses Gefühl des Fremdseins“, sagt M. und vielleicht hätte er selbst in den Abgrund springen müssen anstatt hineingestoßen zu werden. Vielleicht hätte er im Ratschluss des Fallens eine Läuterung erfahren, um in tausend Jahren wieder zurückkehren zu können mit dem Skalp eines alten Lebens über der Schulter.
„R., meine Frau, hat mich just in dem Augenblick verlassen, als es keine Aussichten mehr gab, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, die Pferde, die Turniere, ihre sklavische Abhängigkeit von reiterlichen Erfolgstrophäen, in irgendeiner Form weiter zu finanzieren.“
Es klingt bitter, wenn M. sagt: „Das Schlimme war nicht die Trennung, sondern die Erkenntnis, dass aus der Verbindung zweier Herzen eine tote Institution materieller Zweckmäßigkeit und Gewohnheitsritualen geworden war.“
Später schreibt M. in sein Notizbuch: „Wir haben die Liebe zu einer steinernen Bürde werden lassen. Und als wir sie nicht mehr tragen konnten, musste sie zerschlagen werden, um dann festzustellen, dass möglicherweise der Stein schon immer ein totes Objekt gewesen war, dem wir mit unseren sinnlichen, sentimentalen und sonstigen verbrämten Träumen eine Lebendigkeit eingehaucht haben, das er nie hatte. Etwas Totes kann nicht sterben und die Schmerzen über die Agonie brennen solange unauslöschliche Feuermale in die Seele bis man die Illusion, die Maskerade begreift, auf die man hereingefallen ist.“
„Ich glaube schon, dass du R. wirklich geliebt hast“, entgegnet J., M. ́s engeltragendes Kupferhaar-Déjávu, und ihre besorgt gerunzelte Stirn gibt Aufschluss darüber, dass sie nicht gewillt ist, ihren weiblichen Körper und Geist einem schwammigen Zweifler zu überlassen anstatt einem soliden männlichen Herz.
An einem schlechten Tag wird M. mit einem desolaten „Ich weiß nicht“ antworten, aber da er derzeit ohne Frage im Aufwind eines kognitiven Hochs gleitet, fühlt er sich dazu veranlasst, J. zu erklären, dass sein bisheriges Leben, seine Liebschaften und Affären, seine Ehe nur lehrreiche Zwischenstationen waren, um den inneren, skeptischen Schweinehund so annehmen zu können, dass er sich irgendwann in jenen gütigen, weichbesaiteten Christus im schlichten Leinennegligé transformiert, von dem nicht nur er, sondern möglicherweise auch Frauen wie Maria Magdalena und J. träumen.
Indessen sind wir nicht bereit, sentimentalen heiligen Imaginationen widerstandslos zu folgen und auch nicht den bittersüßen, schwermütigen Kunstgriffen literarischer Seelenmassage, mit der uns schöngeistige Größen von Johann Wolfgang von Goethe bis John Updike überrumpelt haben, damit sie ihre moralische Botschaften in Form von schmerz- haften Rasierklingen in unsere weitgeöffneten Gemüter implantieren können. Wir werden nicht entspannt in den metaphorischen Plüschsessel sinken, nicht das Friedenspfeifchen des Poeten schmauchen, weil wir längst genügend Argwohn aufzubringen vermögen, um hinter der lächelnden Mimikry von M. das Entlarvungskalkül eines mathematisch kühlen Geistes zu durchschauen.
„Dort wo die Not, das Leid, die Tragödie am größten ist, ist die Chance des Erkennen, des Wachwerdens am nächsten. Wenn wir endgültig mit dem Rücken zur Wand stehen, und es keinen Ausweg mehr gibt, in den wir uns flüchten könnten, müssen wir der nackten Tatsache direkt ins Auge blicken, vielleicht zum ersten Mal in unserem Leben den ganzen Müll der Probleme sehen, in dem wir selbstvergessen gewatet sind, im Glauben über eine himmlische Wiese zu schreiten“, deklamiert M. und offenbart damit gleichermaßen J. und auch uns seinen philosophischen Genius, aus retrospektiven Lamentos nicht die tröge Alternative eines resoluten Durchschnitts der Pulsadern, sondern eine selbstkritische Kognition zu entwickeln.
Das können wir, dank unserer inneren Großzügigkeit, mit einer gewissen Sympathie und Zustimmung registrieren, obschon wir J. ́s zärtlichen Kuss auf die Wange für etwas überzogen halten, wenn M. fortfährt: „Ich war am Ende, pleite, von meiner Frau verlassen, ohne wirkliche Freunde, eine gescheiterte Existenz, bankrott in jeglicher Hinsicht.“
M. deutet auf Teddy, den schwarzen Australian Shepherd, treuer vierbeiniger Begleiter, nicht nur durch die Gezeiten meteorologischer Phänomene, sondern auch durch die täglichen Wechselbäder zwischen Hoffnung und Depression: „Wäre ich nicht der Verantwortung bewusst gewesen, die ich für meinen Hund übernommen hatte, wäre ich ohne Zögern meiner Intention gefolgt und hätte mir ein hohes Gebäude oder eine tiefen Abgrund gesucht, um zu springen.“
„Es gab kein Fundament mehr, auf das ich ein Weiterleben, eine Hoffnung bauen konnte.“ fügt er erläuternd hinzu. „Es gab noch nicht mal mich selbst. Zu einem Stalaktiten geworden, ohne Schmerz, ohne Missmut, ohne Trauer, ohne Zorn, ohne jede Empfindung, ausser einer steinernen Platte unterdrückter Angst, die auf meinen Bauch, meine Brust, meine Kehle drückte, sah ich mich der trostlosen Tatsache gegenüber, dass ich mich aufgelöst hatte, mit all meinen Träumen, Hoffnungen, Sehnsüchten und Visionen.“
„Die Hoffnung ist ein frischer Wind, der die Verzweiflung wegfegen muss. Das Leben beginnt heute und jeden Tag, das Leben ist die Hoffnung“, schreibt Martin Gray, Sohn einer jüdischen Familie in Warschau. Er hat die dunkelsten Katakomben menschlicher Tragödien durchschritten, nicht nur das Konzentrationslager Treblinka und den Aufstand im Warschauer Ghetto überlebt, sondern auch den Tod seiner Frau und seiner vier Kinder ungebrochen überstanden. Wenn er sein Credo mit dem Satz bekräftigt: „Man muss mir glauben, weil ich es durchlebt habe“, dürfen wir ihm als Experten in Sachen menschlichen Leidens nur zustimmen.
Hoffnung oder Sehnsucht, jene mysteriösen Antriebskräfte im Gefährt unserer Träume, Visionen und Fiktionen, können erst dann wieder ihre synergetischen Kräfte entfalten, wenn wir die Blockaden beenden, die uns selbst im Wege stehen, meint M. in seinem Buch, dessen Genese wir wieder beiwohnen, gleichwohl mit einem gewissen Nasenrümpfen über des Autors autobiografische Schicksalshinweise, die uns im Vergleich zu den Horrorerlebnissen eines Martin Gray geradezu harmlos vorkommen. Doch seiner Erkenntnis, es sei eine Tragödie, dass manchmal erst der Schwerthieb schicksalshafter Ereignisse an unserem Dornröschenschlaf zu rütteln vermag, wir also den schrillen Wecker einer Katastrophe brauchen, um unsere selbstvergessenen Eskapaden in Zweifel setzen können, müssen wir durchaus beipflichten.
Ein ähnliches Resümee dieser traurigen Bewandtnis finden wir auch in der wundervollen Liebesballade „Suzanne“ des kanadischen Romanciers Leonard Cohen: „Jesus war ein Seemann / wenn er auf dem Wasser ging / und lange stand er da und blickte / von einem einsamen Turm aus Holz / und als er sicher wusste / dass nur Ertrinkende ihn sehen / sprach er: Jeder wird ein Seemann sein / bis einst das Meer ihn freimacht / doch er selbst war schon zerbrochen / lang bevor der Himmel aufging / verachtet, fast menschlich / sank er in deine Weisheit wie ein Stein.“
M., manchmal narzisstisch mit der Attitüde eines wissensgeplagten Gelehrtens flirtend, wenn er beim Vorlesen seiner philosophischen Ergüsse die runde Nickelbrille an beiden Bügeln festhält, als könnte sie zusammen mit den gesprochenen Worten in ein zuhörerloses Universum entschwinden, so dass alle Mühe kognitiver Metaphorik verlustig geht, schreibt an einem lichtdurchfluteten, warmen Tag Ende August 2001: Wie viele Tage sind wir in den Wogen eines scheinbaren Glücksozean geschwommen? Wie viele Tage sind wir Herrscher über die Annehmlichkeiten materieller Sicherheit gewesen? Wie viele Tage haben wir uns selbst einfach vergessen in den Manegeninszenierungen weltlichen Vergnügens? Wie viele Tage haben unsere Bilder der Idylle gepasst, um uns darin zu ergötzen?
Am liebsten sind wir die Könige in der Provinz unserer eigenen Geschichte. Wenn sie nicht aus dem Stoff des Glücks gewebt ist, taugt auch manchmal die Ornamentik unseres Unglücks, um das Verweilen auf dem selbsterrichteten Thron zu rechtfertigen und keinen Zentimeter zu weichen. So vermögen auch die Szenarien des Dramas, der Depression, des Schmerzes, der Trauer, elektrische Drähte sein, die uns mit ihren Stimulationen an die Entscheidungslosigkeit und Stagnation eines unantastbaren Daseins zu ketten. Wir sind gequält. Wir werden gemartert. Wir sind verzweifelt. Aber wir lieben diese Nesseln. Wir lieben das Unglück. Wir lieben die Schmerzen. Wenn die Emotionen als ätzende Ströme durch unsere Tage fließen, deuten wir diese Säurereaktionen als lebendige Berührung, die uns deutlich zeigen, dass wir noch nicht gestorben sind. Kann Schmerz, können die brennenden Quallen der Schwermut die Erinnerung an das Lebendige in uns sein?Wir haben gelernt, dass das Leben ein ständiges Auf und Ab, ein kontinuierliches Pendel zwischen Glück und Unglück ist. Je mehr es ausschlägt, desto mehr fühlen wir uns in der Mitte der Realität, in der Tatsache einer existenten Welt. Die bedeutungsvollste Aktivität gilt dem kräftigen Anschlagen des Pendels.
Natürlich mögen wir am liebsten die Annäherung an die Ebenen der Glückseligkeit, der Freuden, der Erfolge. Je leichter dies gelingt, desto höher wächst der Status in unserem eigenen Bewertungsdiagramm und um so deutlicher können wir die erreichte Position unseren Mitmenschen als relevanten Beweis unserer Talente verkaufen. Wir genießen das Ansehen. Wir genießen den Triumph. Wir genießen die Beachtung. Aber das Verweilen auf der goldenen Empore ist meist nur von kurzer Dauer, denn das Spiel besteht aus der fortwährenden Wiederholung der Siege und Akkumulierung neuer Trophäen. Ein Sieg, der nicht durch weitere Siege bestätigt werden kann, ist nur ein zweifelhafter Gewinn. Alles basiert auf Wachstum. Auf Anhäufung. Auf kontinuierlichem Erfolg. Auf Expansion.
„Die Stunde des Siegers rumort als Hymne hörbaren Geistes durch spätkapitalistische Köpfe“, meint M. lappidar, obschon wir alle Muskeln anspannen, in der Erwartung, dass sich hinter der Harmlosigkeit seines ausdruckslosen Gesichts die perfide Absicht verbirgt, uns mit dem rhetorischen Meteoritenschauer eines Epigramms die gute Laune zu verderben. „Den Starken gehört die Welt...Diesem Credo folgend wirst du völlig einäugig. Du ruderst wie ein Berserker auf der Galeere des Erfolgreich-sein-wollens. Du zertrittst alle Hindernisse auf deinem Weg zum Profit. Ganz gleich, was du unter deinen mächtigen Plattfüssen zermalmst: Hauptsache du kannst voranschreiten, kannst die Ziele, die illuminierten Idole mit Vehemenz erobern.
Indessen bist du so agil, so eifrig, dass du nicht das Anschwellen der Hetze, der Jagd erkennst. Das Halali der Blashörner wird lauter, der Trommelschlag, der den Rudertakt auf der Galeere vorgibt, wird zu einem feurigen Stakkato, dem du fast nicht mehr zu folgen vermagst. Die Kraft wird vielleicht recht lange reichen auf deinen Kreuzzügen des Wohlstands. Deine Jugend und ihre vitale Energie sind deine Begleiter. Gekleidet in Harnisch und Rüstung, ein stolzer, motivierter Recke, bist du der große Triumphator, den nichts aufhalten kann. Aber der Faktor Zeit, der zwischen den ackernden Händen unaufhaltsam zerrinnt, wird irgendwann deinem Treiben Einhalt gebieten. Die Siege werden rarer und mühseliger werden. Du wirst eher einem keuchenden, pumpenden Emil Zatopek gleichen, der „Lokomotive aus Prag“, der wie ein Ochse schuftete auf seinen olympischen Langstreckenerfolgen, als einer behenden Gazelle, die mit geradezu frevelhafter Leichtigkeit durch die Savannenwälder weltlichen Glücks hüpft. Deine Schritte werden kleiner werden. Die Quelle deiner jugendlichen Kraft, einst ein reissender Strom, wird zu einem spärlichen Rinnsal werden. Dann wirst du allmählich erkennen, dass du mit einer Zeit gehandelt hast, die nur eine Illusion war, dass du den größten Teil deines Lebens mit suggestiv realen, aber doch nicht echten Idealen verplempert hast. Du hast dein Leben so geführt, als stünden dir nicht nur eins, sondern mehrere zur Verfügung.“
M., gewissermaßen durch bestimmte wirtschaftliche und gesellschaftliche Umstände (obschon er die uns als kognitives Ergebnis inneren Forschens verkaufen möchte) dazu verdonnert, sich den wesentlichen Dingen widmen zu müssen (was das denn auch immer sein mag), wird nach diesem verbalen Luftangriff auf die nutzlose Vergeudung unserer Zeit den römischen Stoiker Seneca zitieren: „Du bist immer mit Geschäften beladen, das Leben eilt; inzwischen wird der Tod sich einstellen, für den du Zeit haben musst, du magst wollen oder nicht.“
Während wir die schwere Einkaufstüte im Flur abstellen, mit gemischten Gefühlen und Sorgenfalten auf der Stirn den aktuellen Kontoauszug studieren und über die erfolgsversprechendste Taktik nachdenken, mit der wir den Chef von einer Gehaltserhöhung überzeugen könnten, haben wir kaum noch Gehirnreserven übrig, um M. ́s dialektischem Bombardement mit angemessener Prävention zu begegnen: Alles geht vorüber. Alles endet. Irgendwann werden wir bei diesem hübschen Spielchen nicht mehr die Nase vorn haben. Irgendwann werden wir zu Boden fallen, ganz erschöpft und ausgelaugt. Irgendwann werden wir selbst zum Hindernis für die anderen Kreuzzügler werden. Irgendwann werden uns mächtige Plattfüße zertreten...
„Die Menschheit ist in zwei Hälften geteilt: Auf der einen Seite sind die Erfolgreichen und auf der anderen die Erfolglosen. Und solange weder die Besiegten noch die Sieger erkennen, dass sie beide einem Irrtum unterliegen, wird kein einziges Problem jemals gelöst werden“, meint J. und sowohl M. („Diese Worte könnten von mir sein“) wie auch wir sind erstaunt über dieses plötzliche Manifest weiblicher Kognition.
Und M., mit der Fähigkeit ausgestattet, jede neue Erkenntnis geschickt in die eigenen eloquenten Reflexionen einfließen zu lassen, ergreift augenblicklich J. ́s Gedanken: Mag sein, wir sind der jämmerliche Protagonist einer Verlierergeschichte. Mag sein, dass wir zwei linke Hände haben. Mag sein, dass wir nie den Erfolgsplan begriffen haben. Mag sein, dass wir der untauglichste Sklavenarbeiter in der ökonomischen Hierarchie sind. So werden wir mit sehnsüchtigen Basedowschen Augen unser dürftiges Teleskop auf den gestirnten Himmel der Börsenhändler und Wirtschaftsstrategen richten und Lamentos über die ungerechte, schnöde Welt sabbern.
Das Firmament unserer Wünsche ist voll illuminierter Götter. Sie können alles und wir sind nur die ewigen Verlierer. Wir verehren das große Spiel um Macht und Ansehen, ohne jedoch die Regeln gründlich genug verinnerlicht zu haben. Wir knien demütig auf dem Boden des Jammertales und warten begierig darauf, es mögen ein paar Krumen, ein paar Sterntaler auch auf unser Haupt herniederfallen. Manchmal bleibt sogar für solche wie uns etwas übrig. Manchmal können wir ein paar leckere Apetitthäppchen erhaschen und vom erlesenen Geschmack der großen, weiten Welt kosten. Aber es ist nie genug. Es sind eben nur ein paar armselige Krumen auf der Zunge des Verlangens. Deshalb stellen wir uns hinter den Leierkasten des Selbstmitleids und erlernen das Singen von Elegien. Auch das Opfertum kann eine heilige Sache sein. Auch die Niederlage und das Lamentieren darüber können zur Religion werden. Und wir beginnen, aus dem Leid eine liturgische Handlung zu machen, unsere pessimistische, depressive und resignative Sichtweise zu kultivieren.
„Sie haben kein Recht, unglücklich zu sein - niemals!“ schreibt der australische Mystiker Barry Long und behauptet: „Aber Sie glauben, dass Sie es haben. Also sind Sie in Ihrer Unwissenheit eine enge und freiwillige Verbindung mit dem Unglück eingegangen; Sie haben es in Ihrem Leben zu Ihrem Partner gemacht und sind jeden Augenblick geneigt, sich deprimiert, mürrisch, ängstlich, ärgerlich, frustriert, verdrießlich oder launisch zu fühlen. Niemand kann sich darauf verlassen, dass Sie nicht über kurz oder lang unglücklich sind. Das Unglück steht Ihnen näher, ist Ihnen mehr ans Herz gewachsen als irgendein Mann, eine Frau oder ein Kind in Ihrem Leben.“
„Die Bilder vom Glück im Museum profaner oder sakraler Gedanken, die wir mit dem gewieften Blick des Kunstkenners betrachten, sind in Wahrheit die Bilder des Unglücks“, meint M. und zitiert eine gewisse Brigitte Bardot, die reifere Damen und Herren noch als vollbusige, blonde Schönheitsikone im französischen Film Noire der Sechziger Jahre bewundert haben, wenn sie in ihren Memoiren schreibt: „Ich war schön, reich und berühmt, aber nie wirklich glücklich.“
„Solange es uns nicht gelingt, dem derzeitigen Stand unseres Lebens mit einer versöhnlichen und genügsamen Haltung zu begegnen, können wir niemals den eigentlichen Sinn von Glück verstehen“, mahnt der tibetische Dalai Lama. Und der Stoiker Seneca gab zu bedenken: „Um zu erkennen, was uns zum Lebensglück verhelfen kann, dazu fehlt uns der richtige Blick. Nichts ist schwerer, als sich des glücklichen Lebens teilhaftig zu machen. Ja, je stürmischer man ihm zueilt, um so mehr entfernt man sich von ihm.“
Während unsere Gehirnzellen von all diesen Feststellungen und Weisheiten gereizt werden, unsicher, ob die Kopfschmerzen vom philosophischen Hagelschauer oder von unseren verzweifelten Lohnerhöhungsstrategien herrühren, sehen wir M., der in seinen autistischen Räumen der Fantasie so gerne die Rolle eines Protagonisten spielt, die Brille ablegen und irgendwie auch jene Leichtigkeit, mit der man eine Geste der Besorgnis um diese Welt gefällig anbieten könnte. Der schwarze Hund, als treuer Begleiter durch sanftmütige Melancholie und spirituellen Hochdruckstimmungen, döst auf dem Teppichboden in den schwülen Augusttag hinein.
„Das Träumen ist das bewandtnisreiche Gefährt höheren Geistes, das die Kreaturen miteinander verbindet oder trennt“, sinniert M.. Aber wer vermag das schon so präzis zu unterscheiden?