
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die beste Heldin aller Zeiten
Endlich wieder eine Heldin, die man lieben muss! Prinzessin Elisa, Trägerin des Feuersteins und kluge Königstochter, könnte alles sein für ihr Volk – Retterin und Auserwählte. Doch Elisa ist dick und von Selbstzweifeln geplagt, und weder ihr Vater noch ihre schöne Schwester oder ihr viel zu gut aussehender Bräutigam scheinen der schüchternen und mehr als rundlichen Sechzehnjährigen sonderlich viel zuzutrauen. Erst als Elisa entführt wird und nicht nur ihr Leben in Gefahr ist, zeigt sie, was in ihr steckt …
Alle hundert Jahre wird ein Mensch auserwählt, den göttlichen Feuerstein zu tragen. Prinzessin Elisa von Orovalle ist so eine Steinträgerin. Aber Elisa ist auch dick und außerdem nur die Zweitgeborene. Diejenige, die noch nie etwas Herausragendes vollbracht hat – und die auch nicht glaubt, das jemals tun zu können. Doch dann wird sie an ihrem sechzehnten Geburtstag die geheime Ehefrau eines schönen und mächtigen Königs – eines Königs, dessen Reich im Innern von Intrigen und von außen von grausamen Invasoren bedroht wird und der eine Heldin und keine Versagerin an seiner Seite braucht. Er ist jedoch nicht der Einzige, der Elisa für seine Zwecke einspannen will. Als die Prinzessin von mysteriösen Rebellen entführt wird, nimmt sie ihr Schicksal erstmals selbst in die Hand: Mit all ihrem Mut, ihrer Entschlossenheit und Klugheit schließt sie sich den Aufständischen an und kämpft gegen die feindliche Armee. Denn Elisa weiß, der Feuerstein, der in ihrem Nabel schlummert, könnte ihr unglaubliche Macht verleihen. Falls es ihr gelingt, seine Magie zu entfesseln. Falls sie nicht zu früh stirbt. Denn das ist das Schicksal der meisten Auserwählten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Rae Carson
Der Feuerstein
Roman
Aus dem Amerikanischen von Kirsten Borchardt
Wilhelm Heyne VerlagMünchen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel The Girl of Fire and Thorns bei Green Willow Books, einem Imprint von HarperCollins Publishers, New York.
Copyright © 2011 by Rae Carson
Copyright © 2012 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Redaktion: Sabine Thiele
Covergestaltung: DAS ILLUSTRAT, München
Unter Verwendung eines Motivs von HUT Design/Shutterstock
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-10546-4V004
www.heyne-fliegt.de
Inhaltsverzeichnis
Für Hannah Elise
Erster Teil
1
Gebetskerzen flackern in meinem Schlafzimmer. Die Scriptura Sancta liegt achtlos beiseitegeschoben und mit zerknickten Seiten auf meinem Bett. Vom langen Knien auf den harten Fliesen habe ich blaue Flecken, und der Feuerstein in meinem Nabel pulsiert spürbar. Ich habe gebetet – nein, ich habe darum gefleht –, dass König Alejandro de Vega, mein zukünftiger Ehemann, hässlich ist. Hässlich und alt und dick.
Heute ist der Tag meiner Hochzeit. Und mein sechzehnter Geburtstag.
Normalerweise vermeide ich Spiegel, aber dieser Tag ist von so großer Bedeutung, dass ich doch einen Blick riskiere. Allerdings zeigt das Bleiglas nur ein verschwommenes Bild, mein Kopf schmerzt, und mir ist schwindlig vor Hunger. Aber selbst so verzerrt sieht das Brautgewand, terno, das ich zur Hochzeit tragen soll, wunderschön aus. Es ist aus Seide, die wie Wasser fällt, und mit winzigen Glasperlen besetzt, die bei jeder Bewegung schimmern. Gestickte Rosen bedecken den Saum und die ausgestellten Manschetten der Ärmel. Es ist ein Meisterwerk, vor allem wenn man bedenkt, in welcher Eile es gefertigt wurde.
Leider ist mir nur zu sehr bewusst, dass das terno seine ganze Schönheit verlieren wird, wenn es erst einmal zugeknöpft ist.
Mit einer Handbewegung bitte ich meine Kinderfrau Ximena und meine Zofe Aneaxi, mir zu helfen, und bewaffnet mit Knopfhaken und entschuldigendem Lächeln treten sie zu mir.
»Atme tief ein, mein Himmel«, weist mich Ximena an. »Und jetzt atme wieder aus. Raus mit der ganzen Luft, mein Schatz.«
Ich presse die Luft aus meinen Lungen, presse und presse, bis mir noch schwindeliger ist. Die beiden Frauen ziehen und zerren mit ihren blitzenden Haken, und das Kleid wird eng und enger. Das Mieder im Spiegel zieht sich zusammen, gräbt sich in das Fleisch über meinen Hüften. Ein scharfer Schmerz schießt mir durch die Seite, ganz ähnlich wie das Stechen, das ich oft fühle, wenn ich eine Treppe emporsteige.
»Gleich haben wir es, Elisa«, versichert mir Aneaxi, während mich das ungute Gefühl beschleicht, dass sich der Klammergriff des Kleides beim nächsten Atemzug als tödlich erweisen wird. Am liebsten würde ich mir das Mieder wieder vom Leib reißen. Ich will nicht heiraten.
»Geschafft!«, rufen Ximena und Aneaxi wie aus einem Mund und treten einen Schritt zurück, um ihre Arbeit zu bewundern. »Was meinst du?«, fragt Aneaxi mit unsicherer, schwankender Stimme.
Das terno lässt nur flache, hastige Atemzüge zu. »Ich meine …« Benebelt sehe ich auf meine Brüste hinunter. Der Stoff drückt eine tiefe Falte in mein üppiges Fleisch. »Vier!« Ein angespanntes Kichern dringt aus meiner Kehle. »Vier Brüste!«
Meine Kinderfrau sieht mich mit einem seltsamen, beklommenen Gesichtsausdruck an. Als meine Brüste sich im letzten Jahr entwickelten, hat mir Ximena immer wieder versichert, dass Männer sie unwiderstehlich finden würden.
»Es ist ein wunderschönes Kleid«, schwärmt Aneaxi und blickt starr auf meinen Rock.
Ich schüttele den Kopf. »Ich sehe aus wie eine Wurst«, keuche ich. »Eine dicke, aufgedunsene Wurst in einer weißen Seidenhülle.« Am liebsten würde ich weinen. Oder lachen. Ich kann mich kaum entscheiden.
Der Drang zu lachen gewinnt schließlich beinahe die Oberhand, aber meine beiden Damen schwirren mit gefurchten Gesichtern um mich herum, ergraute Glucken, die mir mit beruhigenden, gurrenden Lauten Mut machen wollen. »Nein, nein, du bist eine hübsche Braut!«, ruft Aneaxi. »Du bist nur schon wieder gewachsen, das ist alles. Und deine wunderschönen Augen! König Alejandro wird es gar nicht auffallen, dass das terno etwas eng sitzt.« Und nun fließen doch die Tränen, weil ich ihr Mitleid nicht ertrage und weil mir Ximena nicht in die Augen sehen kann, als Aneaxi ihre falschen Schmeicheleien ausspricht. Doch einen Augenblick später weine ich vor allem deshalb, weil ich das terno überhaupt nicht tragen will.
Während ich herzzerreißend schluchze, küsst mich Aneaxi auf die Stirn, und Ximena wischt mir die Tränen weg. Zum Weinen braucht man Luft. Lange, tiefe Atemzüge. Die Seide spannt sich, der Stoff schneidet in meine Taille, das Gewebe reißt. Kristallknöpfe springen mit leisem Klirren über den glasierten Boden, während Luft in meine ausgehungerten Lungen strömt. Mein Magen reagiert mit einem zornigen Knurren.
Meine Kammerfrauen knien sich hastig hin, durchkämmen mit den Fingern die Lammfellteppiche, fahren über die Spalten zwischen den Tonfliesen und jagen die befreiten Knöpfe. »Ich bräuchte eine Woche«, murmelt Ximena vor sich hin. »Nur eine Woche, um dich richtig einzukleiden. Eine königliche Hochzeit braucht doch eine gewisse Vorbereitungszeit!« Ja, auch das macht mir Angst, dass alles so plötzlich kommt.
Das Mieder sitzt jetzt so locker, dass ich an meinen Rücken fassen und die verbliebenen Knöpfe selbst öffnen kann. Dann lasse ich den Stoff von den Armen gleiten und versuche, das terno über die Hüften hinunterzuschieben, aber der Stoff reißt weiter ein, also ziehe ich es mir lieber über den Kopf. Achtlos werfe ich das Kleid beiseite, und es ist mir egal, dass es mein Bett verfehlt und zerknüllt auf dem Fußboden liegen bleibt. Stattdessen streife ich nun ein grobes Wollkleid über. Es kratzt auf der Haut, aber es ist riesengroß und beruhigend verhüllend.
Während meine Kammerfrauen weiter nach den Knöpfen suchen, wende ich mich zur Tür und gehe hinunter zur Küche. Wenn mir mein Kleid sowieso nicht passt, kann ich zumindest versuchen, meinen schmerzenden Kopf und meinen knurrenden Magen zu besänftigen, indem ich mir eine warme Pastete genehmige.
Meine ältere Schwester Juana-Alodia hebt den Kopf, als ich eintrete. Eigentlich hätte ich erwartet, dass sie mir zumindest zum Geburtstag gratuliert, aber sie wirft lediglich einen Blick auf mein Kleid und verzieht dann das Gesicht. Sie sitzt am Rand der Feuerstelle, den Rücken gegen den bauchigen Ofen gelehnt. Dabei hält sie die Beine elegant übereinandergeschlagen und lässt ihren schmalen Knöchel vor und zurück wippen, während sie ihr Brot knabbert.
Wieso ist nicht sie es, die heute heiratet?
Der Küchenmeister lächelt mir unter seinem mehlbestäubten Schnurrbart zu, als er mich erblickt, und schiebt mir einen Teller zu, auf dem eine Pastete aus golden gebackenem Blätterteig liegt, mit gemahlenen Pistazien bestäubt und mit Honig überzogen. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich sage ihm, dass ich gern zwei davon hätte.
Mit dem Teller setze ich mich zu Alodia und bemühe mich, nicht mit dem Kopf gegen die Kupfertiegel zu stoßen, die überall von der Decke hängen. Meine Schwester wirft einen missbilligenden Blick auf das Gebäck. Sie muss nicht einmal die Augen verdrehen, ich fühle mich auch so, als ob sie es täte, und ich starre sie wütend an. »Elisa«, setzt sie an, weiß aber dann nicht mehr, was sie sagen soll, und ich ignoriere sie demonstrativ, indem ich mir die knusprige Pastete in den Mund schiebe. Fast augenblicklich lässt mein Kopfschmerz nach.
Meine Schwester hasst mich. Das weiß ich schon seit Jahren. Meine Kinderfrau Ximena sagt, der Grund dafür sei, dass ich von Gott erwählt wurde, um ihm zu dienen, und Juana-Alodia eben nicht. Gott hätte sich für sie entscheiden sollen, sie ist sportlich und vernünftig, elegant und kräftig. Besser als zwei Söhne, sagt Papá. Ich betrachte sie, während ich meine Pastete esse, ihr schimmernd schwarzes Haar, die fein gemeißelten Wangenknochen und die geschwungenen Brauen, die ein Paar selbstbewusst dreinschauende Augen einrahmen. Ich hasse sie mindestens genauso sehr wie sie mich.
Wenn Papá einmal stirbt, wird sie Königin von Orovalle. Sie ist ganz wild darauf, eines Tages zu herrschen, ich aber nicht, und von daher ist es aberwitzig, dass ich durch meine Ehe mit König Alejandro Königin eines Landes werde, das doppelt so groß und doppelt so reich ist wie das unsere. Ich weiß nicht, wieso ich diejenige sein muss, die heiratet. Der König von Joya d’Arena hätte sicherlich die schöne Tochter ausgewählt, die königliche. Mein Mund erstarrt, während ich kaue, als mir klar wird, dass er das wahrscheinlich auch getan hat.
Ich bin das Gegenangebot.
Wieder drohen mir die Tränen in die Augen zu steigen, und ich beiße die Zähne zusammen, bis mein Gesicht schmerzt, denn lieber würde ich von Pferden zertrampelt, als vor meiner Schwester zu weinen. Ich kann mir vorstellen, was sie gesagt haben, damit er in den Handel einwilligt. Sie wurde erwählt, um zu dienen. Nein, noch hat sich nichts ereignet, aber es wird bald etwas geschehen, da sind wir sicher. Jawohl, sie spricht die Lengua Classica fließend. Nein, schön ist sie nicht, aber klug. Die Dienerschaft liebt sie. Und sie kann sehr gut sticken, zum Beispiel Pferde.
Inzwischen hat er sicherlich viele Dinge gehört, die der Wahrheit eher entsprechen, und er weiß, dass ich mich leicht langweile, dass meine Kleider bei jeder Anprobe weiter ausgelassen werden müssen und dass ich im Wüstensommer wie ein Tier schwitze. Ich bete darum, dass wir auf irgendeine Weise zueinanderpassen werden. Vielleicht hatte er als Kind die Pocken. Vielleicht kann er kaum gehen. Ich wünsche mir einen Grund, aus dem es mir egal sein wird, wenn er sich angeekelt abwendet.
Alodia hat ihr Brot aufgegessen. Sie steht auf und streckt sich, führt mir genussvoll ihre Grazie und Körperlänge vor Augen. Dann wirft sie mir einen seltsamen Blick zu – Mitleid vermutlich – und sagt: »Lass mich wissen, wenn … wenn du heute Hilfe brauchst. Bei den Vorbereitungen.« Bevor ich ihr eine Antwort geben kann, eilt sie davon.
Ich nehme mir die zweite Pastete. Sie schmeckt nach nichts mehr, aber es beruhigt mich, etwas in der Hand zu haben.
Einige Stunden später stehe ich mit Papá vor der Basilika und wappne mich für meinen Brautgang. Die Türen ragen hoch vor mir empor, und der eingravierte Sonnenkranz der de Riquezas in ihrer Mitte blinzelt unheilvoll. Hinter den Türen ist das Raunen der Menge zu hören, die sich im Audienzsaal versammelt hat. Es überrascht mich, dass so viele gekommen sind, obwohl die Zeremonie so kurzfristig anberaumt wurde. Vielleicht ist es aber auch gerade diese Eile, die sie neugierig gemacht hat. Sie schmeckt nach Geheimnissen und Verzweiflung, nach schwangeren Prinzessinnen oder verdeckten Abkommen. Das alles interessiert mich nicht. Meine Gedanken kreisen nur um eines: dass König Alejandro hässlich sein möge.
Mein Papá und ich warten auf das Zeichen des Herolds. Papá hat bisher nicht daran gedacht, mir zum Geburtstag zu gratulieren. Doch dann sehe ich plötzlich Tränen in seinen Augen schimmern. Vielleicht ist er tatsächlich traurig, weil er mich nun gehen lassen muss. Oder er fühlt sich schuldig.
Überrascht ziehe ich die Luft ein, als er mich an die Brust drückt und fest umfängt. Es ist eine erstickende Umarmung, aber ich erwidere sie innig. Papá ist hochgewachsen und schlaksig wie Juana-Alodia. Ich weiß, dass er meine Rippen nicht fühlen kann, aber ich spüre seine. Seit Invierne immer wieder unsere Grenzen bedroht, hat er kaum noch gegessen.
»Ich erinnere mich noch gut an den Tag deiner Widmung«, flüstert Papá. Diese Geschichte habe ich sicher schon hundertmal gehört, aber noch nie aus seinem Mund. »Du lagst in deiner Wiege, in weiße Seide mit roten Schleifen gehüllt. Der Hohepriester beugte sich mit einem Fläschchen geweihten Wassers über dich und wollte es dir auf die Stirn träufeln, um dich auf den Namen Juana-Anica zu taufen.
Aber dann strömte das Himmelslicht durch die Empfangshalle, und der Priester schüttete die Flüssigkeit vor Schreck auf das Kissen. Mir war sofort klar, dass es das Himmelslicht war, denn es war weiß, nicht gelb wie Fackelschein, und es war weich und warm. Als ich es sah, wollte ich lachen und beten, beides zur gleichen Zeit.« Die Erinnerung lässt ihn auch jetzt lächeln, ich höre es in seiner Stimme, in der auch Stolz mitschwingt. Mir wird die Brust eng. »Dann bildete das Licht einen Strahl, der deine Wiege erhellte, und du lachtest.« Er tätschelt mir den Kopf und streicht dann über das Linnen meines Schleiers. Ich höre mich seufzen.
»Du warst erst sieben Tage alt, aber du hast gelacht und gelacht. Juana-Alodia war die Erste, die auf ihren unsicheren Beinchen zu dir hinüberlief, nachdem das Licht wieder verloschen war. Deine Schwester schlug deine samtenen Windeln zurück, und wir sahen den Feuerstein, der in deinem Bauchnabel eingebettet war, warm und lebendig, aber blau und geschliffen, hart wie ein Diamant. Daraufhin beschlossen wir, dich Lucero-Elisa zu nennen.« Himmelslicht, von Gott erwählt. Seine Worte erdrücken mich ebenso wie seine Umarmung. Mein ganzes Leben lang hat man mich stets daran erinnert, dass ich zum Dienen bestimmt bin. Dass ich eine Aufgabe erfüllen muss.
Trompeten erschallen, gedämpft durch die Türen. Papá lässt mich los und legt mir den Linnenschleier über den Kopf. Mir ist das recht; ich möchte nicht, dass jemand mein vor Entsetzen versteinertes Gesicht sieht oder den Schweiß, der sich auf meiner Oberlippe sammelt. Die Türen öffnen sich und geben den Blick frei auf den großen Saal mit der Kuppeldecke und den bemalten Ziegeln. Es riecht nach Rosen und Weihrauch. Viele Hundert Gestalten erheben sich von ihren Bänken, allesamt in hellen Hochzeitsfarben gekleidet. Durch den Schleier sehen sie aus wie Mamás Blumengarten – orangefarbene Flecken Bougainvillea, gesprenkelt mit gelber Allmanda und rosa Hibiskus.
Der Herald ruft: »Seine königliche Majestät, Hitzedar de Riqueza, König von Orovalle! Ihre königliche Hoheit, Lucero-Elisa de Riqueza, Prinzessin von Orovalle!«
Papá nimmt meine Hand und hebt sie auf Schulterhöhe. Seine Finger sind so feucht und glitschig wie meine, aber es gelingt uns, gleichmäßig vorwärtszuschreiten, während vier Musiker auf ihren Vihuelas den Hochzeitssegen spielen. Ein Mann steht, ganz in Schwarz gekleidet, am Ende des Mittelgangs. Sein Umriss ist zwar verschwommen, aber er ist weder klein noch bucklig. Und auch nicht dick.
Wir schreiten an steinernen Säulen und Eichenbänken vorbei. Aus dem Augenwinkel sehe ich eine Dame, eigentlich nur ein Klecks blauer Farbe. Sie fällt mir auf, weil sie sich zur Seite beugt und etwas flüstert, als ich an ihr vorübergehe. Ihre Begleiterin kichert. Meine Wangen brennen. Als ich meinen hochgewachsenen, ruhig dastehenden Verlobten erreiche, bete ich nur noch darum, dass er pockennarbig ist.
Papá reicht meine glitschige Hand dem Mann in Schwarz. Dessen Hand ist groß, größer als Papás, und sie fasst mit gleichgültiger Selbstsicherheit zu, als spielte es keine Rolle, dass sich meine wie ein toter, nasser Fisch anfühlt. Am liebsten würde ich meine Finger zurückziehen, sie vielleicht an meinem Kleid abwischen.
Hinter mir ist ein Schniefen zu hören, das durch die ganze Halle dringt. Das ist sicher Lady Aneaxi, die seit der Verkündigung meiner Hochzeit schon viele Tränen der Rührung vergossen hat. Vor mir steht der Priester und salbadert in der Lengua Classica über den Bund der Ehe. Ich liebe diese Sprache wegen der lyrischen Vokale und der Art und Weise, wie meine Zunge beim Sprechen gegen die Zähne stößt, aber jetzt höre ich die Worte kaum.
Es gibt Dinge, an die zu denken ich mich seit der Verkündigung geweigert, die ich mit dem Studium von Büchern, mit Stickerei und Pasteten tief in mein Innerstes verdrängt habe. Aber jetzt, da ich hier in meinem Hochzeitskleid stehe, die Hand im eisernen Griff dieses hochgewachsenen Fremden, da fallen sie mir plötzlich ein, und mein Herz beginnt wild zu klopfen.
Morgen werde ich ins Wüstenland Joya d’Arena reisen, dessen Königin ich dann sein werde. Der Jacaranda-Baum vor meinem Schlafzimmerfenster wird seine lila Blüten ohne mich tragen. Statt der bemalten Ziegelwände und den sprudelnden Springbrunnen werde ich eine steinerne, tausend Jahre alte Burg um mich herum haben. Ich tausche eine jüngere, lebendigere Nation gegen ein gewaltiges, altes Land – von der Sonne verbrannt und erstarrt in den Traditionen, die meine Vorväter einst dazu brachten, zu neuen Ufern aufzubrechen. Ich hatte nicht den Mut, Papá oder Alodia nach dem Warum zu fragen. Weil ich Angst vor der Entdeckung habe, dass sie froh sind, mich bald los zu sein.
Am meisten aber ängstigt mich, dass ich bald eine Ehefrau sein werde.
Ich spreche drei Sprachen. Die Belleza Guerra und die Scriptura Sancta kenne ich beinahe auswendig. Ich kann in drei Tagen den Saum eines terno besticken. Und trotzdem fühle ich mich jetzt wie ein kleines Mädchen.
Juana-Alodia hat sich stets um die Palastgeschäfte gekümmert. Sie ist es, die zu Pferd durchs Land reitet, die mit unserem Papá zusammen Hof hält und die Edelleute umschmeichelt. Von diesen Dingen, die Erwachsene tun, Ehefrauen, verstehe ich nichts. Und heute Nacht … an heute Nacht will ich gar nicht erst denken.
Ich wünschte, meine Mutter wäre noch am Leben.
Der Priester erklärt uns beide zu Mann und Frau, im Angesicht Gottes, des Königs von Orovalle und der nobleza d’oro. Er besprengt uns mit geweihtem Wasser, das aus einer tiefen Cenote geschöpft wurde, bedeutet uns dann, uns einander zuzuwenden, und sagt irgendetwas über meinen Schleier. Ich drehe mich zu meinem frisch angetrauten Ehemann. Meine Wangen sind heiß – ich weiß, dass sie fleckig sein und vor Schweiß glänzen werden, wenn er den schützenden Stoff von meinem Gesicht hebt.
Er lässt meine Hand los. Ich balle sie zur Faust, damit ich sie nicht unwillkürlich an meinem terno abwische. Seine Finger berühren den Saum meines Schleiers. Sie sind braun und breit, mit kurzen, sauberen Nägeln. Keine Gelehrtenhände, wie die Meister Geraldos. Er hebt den Schleier, und ich muss unwillkürlich blinzeln, als kühle Luft meine Wangen streift. Dann sehe ich zum Gesicht meines Gatten auf, sehe schwarzes, zurückgekämmtes Haar, das sich im Nacken ringelt, braune Augen, wärmer als Zimt, und einen Mund, der so kräftig ist wie seine Finger.
Kurz zuckt eine Regung über sein Gesicht – Nervosität? Enttäuschung? Aber dann lächelt er mich an, und es ist kein mitleidiges, kein hungriges Lächeln, sondern ein freundliches, das mich leicht die Luft einziehen lässt und mein Herz in hilflose Wärme taucht.
König Alejandro de Vega ist der schönste Mann, den ich je gesehen habe.
Ich sollte sein Lächeln erwidern, aber meine Mundwinkel gehorchen mir nicht. Er beugt sich vor, und seine Lippen streichen kurz über meine – ein keuscher und sanfter Kuss. Mit dem Daumen berührt er meine Wange und flüstert so leise, dass nur ich es hören kann: »Schön, dich kennenzulernen, Lucero-Elisa.«
Schüsseln und Teller mit Essen bedecken die lange Tafel, an der wir nebeneinander auf der Bank sitzen. Jetzt habe ich wenigstens etwas zu tun und muss mich nicht nur darauf konzentrieren, seinen Blicken auszuweichen. Unsere Schultern berühren sich kurz, als ich nach dem in Teig frittierten Tintenfisch und einem Glas Wein greife. Noch während ich kaue, denke ich darüber nach, welche Leckerbissen ich als Nächstes probieren will: grüne, mit Käse gefüllte Chilischoten oder Schweinegeschnetzeltes in Walnusssauce? Vor dem Podest, auf dem sich unser Tisch befindet, hat sich die nobleza d’oro versammelt, Weinkelche in den Händen. Juana-Alodia mischt sich unter sie, schlank und schön und lächelnd, und die Edelleute lachen und scherzen gut gelaunt mit ihr. Immer wieder gleiten ihre Blicke zu dem Mann an meiner Seite. Wieso kommen sie nicht zu uns und stellen sich vor? Es ist ungewöhnlich, dass die goldene Horde die Gelegenheit, einen König zu umgarnen, nicht wahrnimmt.
Ich fühle seine Augen auf mir ruhen. Gerade hat er mir zugesehen, wie ich mir knusprig gebratene Anchovis in den Mund geschoben habe. Es ist mir peinlich, aber dennoch kann ich dem Drang nicht widerstehen, seinen Blick zu erwidern.
Er lächelt noch immer so freundlich. »Magst du Fisch?«
»Ummm«, erwidere ich mit vollem Mund.
Sein Lächeln wird noch breiter. Er hat wunderschöne Zähne. »Ich auch.« Damit greift auch er nach den Anchovis. Leichte Fältchen zeigen sich in seinen Augenwinkeln, als er kaut und mich weiter beobachtet. Leicht undeutlich fügt er hinzu: »Wir haben viel zu besprechen, du und ich.«
Ich schlucke und nicke. Seine Worte sollten mich eigentlich nervös machen. Aber stattdessen breitet sich ein süßes Gefühl in meinem Bauch aus, weil der König von Joya d’Arena glaubt, ich sei jemand, mit dem man etwas besprechen kann.
Unser Bankett geht viel zu schnell vorüber. Wir reden ein wenig, aber meist sitze ich wie eine Närrin da und kann nur auf die Bewegungen seiner Lippen starren und seiner Stimme lauschen.
Er fragt nach meinen Studien, und ich platze damit heraus, dass ich eine hundert Jahre alte Kopie der Belleza Guerra besitze. Interesse flackert in seinen Augen auf, und er erklärt: »Ja, deine Schwester verriet mir bereits, dass du dich in der Kriegskunst gut auskennst.« Ich weiß nicht, was ich darauf erwidern soll. Jedenfalls möchte ich nicht über Juana-Alodia sprechen, und mir wird klar, wie albern ich aussehen muss – eine Kindbraut, dick wie eine Wurst, die nie auf einem Pferderücken gesessen hat und einen Dolch allenfalls dazu führt, einen Braten anzuschneiden. Dennoch fasziniert mich der Krieg, und ich habe jedes Scharmützel studiert, das es in der Geschichte meines Landes je gegeben hat.
Plötzlich senkt sich Schweigen über das muntere Geplauder der Edelleute. Ich folge ihren Blicken, die auf eine kleine, aus Holz gezimmerte Bühne gerichtet sind. Die Musiker sind verschwunden – ich habe nicht einmal gemerkt, dass das Spiel der Vihuelas verstummt ist, aber an ihrer Stelle stehen nun mein Vater und meine Schwester. Mit bloßem, sonnengebräuntem Arm hebt sie einen Kelch und sagt mit lauter, klarer Stimme: »Heute sind wir Zeugen der neuen Verbindung zwischen Joya d’Arena und Orovalle. Möge Gott sie segnen, mit Frieden und Verständnis, Wohlstand und Schönheit und«, sie lächelt breit, »mit vielen, vielen Kindern!« Lachen brandet durch den Bankettsaal, als hätte man nie einen ausgefalleneren und klügeren Segensspruch gehört. Mein Gesicht brennt, und ich hasse meine Schwester in diesem Augenblick mehr als je zuvor in meinem Leben.
»Nun ist es an der Zeit, dem glücklichen Paar eine gute Nacht zu wünschen«, fährt sie fort. Ich habe an Hunderten von Hochzeitsfeiern teilgenommen, dennoch zucke ich zusammen, als Lady Aneaxi mir die Hand auf die Schulter legt. Hinter ihr wartet ein Grüppchen Dienstboten, alle in Weiß gekleidet und mit Girlanden aus Papierblumen geschmückt, um uns ins Hochzeitsgemach zu begleiten.
Wir erheben uns, der König und ich, obwohl ich nicht weiß, wie mir das eigentlich gelingt, denn meine Beine prickeln vor Taubheit. Ich habe ein klebriges Gefühl unter den Achseln, und mein Herz hämmert wild. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Mit schnellen Wimpernschlägen versuche ich die Tränen zurückzudrängen.
Die Dienstboten grinsen und kichern und führen uns dann aus dem Speisesaal, während die nobleza d’oro uns Segenswünsche und Ermutigungen nachruft. Ich sehe verstohlen zu meinem Ehemann hinüber. Zum ersten Mal, seit er den Schleier von meinem Gesicht gehoben hat, meidet er meinen Blick.
2
Unser Gemach ist erfüllt vom warmen goldenen Licht und dem honigsüßen Geruch von Bienenwachskerzen, die flackernd überall im Zimmer stehen, auf dem Fensterbrett, dem steinernen Kamin und den kleinen Tischchen aus Mahagoni, die das hohe Himmelbett einrahmen.
Das Bett …
Zu meiner Rechten steht mein jetziger Ehemann beinahe ebenso steif da wie ich, eine dunkle Schattensäule, die ich nicht anzusehen wage, und so starre ich den Baldachin des Bettes an, der aus leuchtend rot gefärbter Baumwolle gefertigt ist. Diener eilen durch den Raum, ziehen die Vorhänge zurück und binden sie an den Bettpfosten zusammen. Ein riesengroßer Sonnenkranz, das Wappen der de Riquezas, strahlt mich vom Deckbett an. Ich klammere mich an den Einzelheiten fest, betrachte die gelben Flammenzungen, die aus den Strahlenspitzen dringen, als Lady Aneaxi einen Eimer Rosenblätter auf der Decke ausschüttet und sie mit den Fingerspitzen verteilt. Meinem Blick ist der Anker genommen, an dem er sich bis eben festhielt.
Die zartrosa Rosenblätter verbreiten einen sanften Blumenduft, der sich mit dem honigsüßen Bienenwachs zu einer betörenden Mischung verbindet. Unwillkürlich muss ich an die rosenumrankte Hochzeitszeremonie denken und daran, wie Alejandros Lippen die meinen berührten. Viel zu kurz.
Ich sehne mich danach, dass er mich wieder küsst.
Dabei war es nicht mein erster Kuss. Dieses zweifelhafte Privileg kam einem hochgewachsenen, schlaksigen Jungen auf einer Hochzeitsfeier zu, als ich vierzehn war. Da ich zu schüchtern war, um zu tanzen, hatte ich mich in einem Alkoven versteckt, wo er mich aufspürte und mir seine Liebe gestand. Seine Augen drückten so tiefe Gefühle aus, dass mein Gesicht ganz heiß wurde. Dann drückte er seine Lippen auf meine, ich schmeckte das Basilikum auf seiner Zunge, aber er küsste mich auf eine Weise, wie ich eine Passage aus der Allgemeinen Lehre ergebenen Dienens aufsagen würde. Routiniert. Leidenschaftslos.
Aufgeregt und durcheinander verließ ich das Bankett, und am nächsten Morgen, als Juana-Alodia und ich gemeinsam pochierte Eier mit Lauch zum Frühstück aßen, erzählte sie vom Sohn eines Conde, einem schlaksigen Jungen, der sie am Abend zuvor in einen Alkoven gezogen, ihr seine Liebe gestanden und versucht hatte, sie zu küssen. Sie habe ihn in die Nase gekniffen und sei lachend weggelaufen. Vermutlich, sagte sie, habe er einfach nur versucht, eine Prinzessin ins Bett zu bekommen.
Nun spüre ich Aneaxis Lippen auf meiner Stirn. »Meine Elisa«, flüstert sie. Dann verlassen sie und die Dienstboten unser Gemach. Bevor sie die Tür hinter sich schließen, fällt mein Blick auf große, sonnengebräunte Soldaten mit stählernen Brustpanzern. Sie tragen die roten Seidenbanner von König Alejandros Leibwache, und ich frage mich unwillkürlich, ob Seine Majestät sich hier nicht sicher fühlt. Aber dann sehe ich ihn an, sehe seine schwarzen Locken, die sich im Nacken ringeln und seine sonnenverbrannten Hände, und vergesse die Wächter.
Ich will mehr als nur einen kleinen Kuss. Gleichzeitig macht mir der Gedanke Angst.
Mein Ehemann sieht schweigend, mit starrem Blick auf die mit Rosenblättern bestreute Decke. Wie gern wüsste ich, was ihm gerade durch den Kopf geht, aber ich wage nicht, ihn zu fragen. Stattdessen betrachte ich sein Profil und denke an den leidenschaftslosen Kuss, den mir der Sohn des Conde gab. Das Blut pocht in meinen Ohren, als ich schließlich flüstere: »Es wäre mir recht, wenn wir heute Nacht nicht die Ehe vollziehen würden.«
Seine Schultern entspannen sich, und der Hauch eines Lächelns huscht über seine Lippen. Er nickt. »Wie du wünschst.«
Ich wende mich ab und lasse mich aufs Bett fallen. Die Rosenblüten geraten in Unordnung und rutschen auf den Boden. Ich bin unendlich erleichtert. Und gleichzeitig auch enttäuscht, dass er so schnell eingewilligt hat – es wäre nett gewesen, sich zumindest ein bisschen begehrt zu fühlen.
Mit verschränkten Armen lehnt sich König Alejandro gegen einen der massiven Bettpfosten. Nun betrachtet er mich entspannt; vermutlich ist er ebenso erleichtert wie ich. Im Kerzenlicht ist sein Haar von tiefroten Reflexen durchzogen, wie die Sierra Sangre in der Abendsonne. »Nun denn«, sagt er gut gelaunt. »Dann können wir uns ja unterhalten.«
Er hat eine so angenehme Stimme. Dunkel und warm. »Unterhalten?«, wiederhole ich geistreich.
Seine leicht gekräuselten Lippen verziehen sich zu einem breiten Lächeln, und es ist, als ginge in einer Sommernacht der Mond am Himmel auf. »Es sei denn, du ziehst es vor, mit einem Fremden verheiratet sein.«
Verheiratet …
Plötzlich erscheint das alles so albern, dass ich das Kichern nicht unterdrücken kann, das mit einem Mal in mir aufsteigt. Hastig halte ich mir die geballte Faust vor den Mund und lache in meine Knöchel hinein.
»Ich muss zugeben, dass ich mich ein wenig seltsam fühle«, sagt er, »aber es würde mir dennoch nicht einfallen, über unsere Lage zu lachen.«
Seine Worte bringen mich wieder zur Vernunft. Schnell sehe ich ihn an, weil ich fürchte, ihn verärgert zu haben, aber er lächelt noch immer, und auch die kleinen Fältchen um die Augen sind noch da.
Jetzt gelingt es mir, zurückzulächeln. »Es tut mir leid, Euer Majestät …«
»Alejandro.«
Ich schlucke. »Alejandro.« Sein verständnisvoller Blick löst die Blockade in mir, und Worte strömen aus meinem Mund. »Papá und Alodia haben immer gesagt, ich würde zum Segen Orovalles heiraten. Das habe ich schon vor Jahren akzeptiert. Aber ich bin erst fünf… sechzehn. Ich hatte gehofft, dass ich noch Zeit haben würde … und ich habe nicht erwartet … ich meine, du bist sehr …« Kurz versichere ich mich, dass noch immer kein Spott in seinem Blick liegt. »Du bist sehr nett«, beende ich meinen Ausbruch etwas lahm.
Er geht zur Bank in der Fensternische. »Gibst du mir ein Kissen?«
Ich nehme eins vom Bett, rund, mit langen roten Fransen, und schüttele die Rosenblüten ab, bevor ich es ihm zuwerfe. Er fängt es elegant, dann zieht er die langen Beine auf die Bank und hält das Kissen in seinem Schoß. Mit den angezogenen Knien und seinem offenen Blick sieht er plötzlich gar nicht mehr so viel älter aus als ich.
»Also«, sagt er und sieht zur Decke. Ich bin froh, dass er unser Gespräch eröffnet. »Gibt es irgendetwas über mich oder über Joya d’Arena, das du gern wissen möchtest?«
Ich denke darüber nach. Einiges weiß ich schon – dass seine erste Frau im Kindbett starb, dass sein Sohn sechs Jahre alt ist und dass Invierne seine Grenzen noch stärker bedroht als die unseren, weil unsere Feinde unbedingt einen Hafen und den Zugang zum Meer erobern wollen. Joya besteht größtenteils aus Wüste, verfügt aber über reiche Silber- und Edelsteinvorkommen, und an den Küsten wird viel Viehzucht betrieben. Es gibt nicht viel, was ich nicht schon wüsste. Außer …
»Nun, was denn?«, hakt er nach.
»Alejandro … was willst du? Von mir?«
Sein Lächeln erlischt. Für einen kurzen Augenblick fürchte ich, ihn erzürnt zu haben, so wie ich Alodia mit meinen Fragen stets verärgere, aber dann bewegt er den Kopf, und das Licht scheint weich auf die Konturen seines Kinns, zeichnet eine Linie, die sanft zum Haaransatz hinaufreicht.
Er seufzt. »Unsere Ehe ist Teil eines Bündnisses, das ich mit deinem Vater geschlossen habe. Und es gibt Dinge, bei denen du mir helfen kannst. Aber vor allem …« Er fährt sich mit der Hand durch das dichte schwarze Haar. »Vor allem könnte ich eine Freundin brauchen.« Damit sieht er mich erwartungsvoll an.
Eine Freundin. Mein Tutor, Meister Geraldo, ist mir ein Freund, nehme ich an. Meine Kinderfrau Ximena und Lady Aneaxi ebenfalls, obwohl sie mehr wie Mütter zu mir sind. Vermutlich könnte auch ich gut einen Freund gebrauchen. »Freund« ist ein beruhigendes Wort und gleichzeitig ein schmerzvolles, aber es klingt nicht annähernd so einschüchternd wie »Ehefrau«.
Es ist eine aufregende Vorstellung, dass ich ihm irgendwie helfen kann, aber auch befremdlich. »Ich habe das Gefühl«, sage ich nun etwas mutiger, »dass der König des reichsten Landes der Erde keine Schwierigkeiten haben dürfte, Freunde zu finden.«
Er sieht überrascht auf. »Deine Schwester sagte schon, dass du die Angewohnheit hast, schnell zum Kern einer Sache zu kommen.«
Fast verziehe ich verärgert das Gesicht, aber da fällt mir ein, dass Alodias Worte vielleicht gar nicht kritisch gemeint waren.
»Sag mir, Lucero-Elisa«, beginnt er, und seine Lippen verziehen sich zu diesem sanften Lächeln, das mir bereits vertraut erscheint, »ist es leicht für dich, Freunde zu finden? Als Prinzessin? Als Trägerin des einzigen Feuersteins seit hundert Jahren?«
Ich weiß genau, was er meint. Der Sohn des Conde, der meine Schwester und mich küssen wollte, fällt mir wieder ein, und ich sage: »Du traust niemandem, nicht wahr?«
Er schüttelt den Kopf. »Nur sehr wenigen.«
Ich nicke. »Ich vertraue meiner Kinderfrau Ximena und meiner Kammerzofe Aneaxi. Und auch Juana-Alodia, in gewisser Weise.«
»Was meinst du damit, in gewisser Weise?«
Vorsichtig suche ich nach Worten. »Sie ist meine Schwester. Sie will das Beste für Orovalle, aber …« Irgendetwas lässt mich verstummen. Vielleicht ist es die Intensität seiner Zimtaugen, die sich nun verdunkeln, bis sie fast schwarz sind. In Gegenwart meiner Kinderfrau zögere ich nie, über Juana-Alodia herzuziehen. Aber vor Alejandro …
»Aber?«
Er sieht mir so fragend ins Gesicht, wirkt so interessiert an dem, was ich sagen will, dass ich schließlich damit herausplatze: »Sie hasst mich.«
König Alejandro schweigt dazu. Ich spüre, dass ich ihn enttäuscht habe, und am liebsten würde ich meine Worte wieder in meinen Mund hineinsaugen.
Dann sagt er endlich: »Wieso glaubst du das?«
Ich antworte nicht. Einige Kerzen sind inzwischen erloschen, und ich bin froh darüber, weil es leichter ist, im zuckenden, dämmrigen Licht seinen Augen zu entgehen.
»Elisa?«
Erzähl ihm vom Feuerstein, mahne ich mich im Stillen. Sag ihm, dass Alodia neidisch ist. Dass sie zornig ist, weil ich schon sechzehn bin, aber noch immer keine Anzeichen dafür erkennen lasse, dass ich demnächst mein Schicksal als die Auserwählte Gottes erfüllen werde. Aber sein offener Blick verlangt Ehrlichkeit, und so erzähle ich ihm, was ich noch niemandem anvertraut habe.
»Ich habe unsere Mutter umgebracht.«
Seine Augen verengen sich leicht. »Was meinst du damit?«
Meine Lippen zittern, aber ich atme tief durch die Nase ein und distanziere mich dann von meinen eigenen Worten. »Alodia sagt, Mamá hatte vor mir zwei Fehlgeburten. Als sie dann wieder schwanger wurde, blieb sie im Bett, um sich zu schonen. Sie betete zu Gott um einen Sohn, einen Prinzen.« Ich muss für einen Moment die Zähne zusammenbeißen, bevor ich fortfahren kann. »Es war eine schwierige Schwangerschaft, und sie war schwach, und nachdem ich geboren wurde, war da sehr viel Blut. Alodia sagt, als man mich in ihre Arme legte, sah Mamá, dass ich ein Mädchen war. Noch dazu dunkelhäutig und dick.« Meine verkrampften Kiefermuskeln schmerzen. »Dann überkam sie tiefe Trauer, und sie hauchte ihr Leben aus.«
»Das hat deine Schwester gesagt? Wann war das? Wie lange ist das her?« Er bedrängt mich mit seinen Fragen, doch seine Stimme bleibt freundlich, als sei er tatsächlich um mich besorgt.
Aber ich kann mich nicht erinnern.
Er hebt eine Augenbraue. »Vor einem Jahr?«, hakt er nach. »Vor mehreren? Vielleicht, als ihr beide noch sehr klein wart?«
Stirnrunzelnd versuche ich, diese Szene zeitlich einzuordnen. Es war, als Alodia und ich noch gemeinsam unterrichtet wurden. Unsere Köpfe berührten sich beinahe, als wir über einer schimmligen Abschrift der Allgemeinen Lehre ergebenen Dienens brüteten. Als Meister Geraldo sie aufforderte, die Geschichte des Feuersteins zu erzählen, unterbrach ich sie, indem ich die entsprechende Passage aus der Schrift Wort für Wort zitierte. Nach dem Unterricht folgte mir Alodia die Treppe zur Küche hinunter und erzählte mir von Mamás Tod.
Ich will nicht, dass er erfährt, wie lange ich mich schon mit dieser Erinnerung quäle, deswegen bleibe ich stumm.
Alejandro sieht mich unverwandt an, und ich möchte am liebsten unter die Decke mit dem Sonnenkranz schlüpfen. »Meinst du, dass sie dich noch immer für den Tod eurer Mutter verantwortlich macht?«
»Sie hat mir keinen Anlass gegeben, etwas anderes anzunehmen.« Meine Stimme ist zu scharf und hart, wie die eines unartigen Kindes, aber ich weigere mich, den Blick zu senken.
»Ich glaube, du wärst überrascht«, sagt er.
»Worüber?«
»Über viele Dinge, Elisa.«
Da hat er recht. Es ist leicht, überrascht zu werden, wenn einem niemand etwas erzählt. Und plötzlich wird mir bewusst, dass ich noch immer nicht weiß, was er von mir will. Eine »Freundin« hätte er auch in Alodia finden können oder in vielen anderen jungen Edelfrauen. Der König hat meine Frage abgetan, als sei ich ein Kind, genauso wie es auch Papá und Alodia ständig tun, und wie eine dumme Gans habe ich das zugelassen.
Bevor ich den Mut aufbringe, noch einmal nachzuhaken, sagt er: »Ich denke, wir sollten ein wenig schlafen, denn schließlich steht uns morgen eine lange Reise bevor.« Er steht auf und fegt ein paar Rosenblätter von der Decke.
»Du kannst hier schlafen«, sage ich, »und ich nehme die Bank unter dem Fenster.«
»Das Bett ist groß genug für uns beide. Ich werde mich auf die Decke legen.«
Erst erstarre ich, dann fasse ich mich wieder: »Gut.« Ich schüttele die übrigen Blätter vom Bett und schlage die Decken zurück. Sicher wird es lange dauern, bis ich einschlafen kann. Zum einen wird mich nicht einmal das pulsierende Juwel in meinem Nabel dazu bringen, meinen terno abzulegen und es mir wirklich bequem zu machen, zum anderen kann ich mir nicht vorstellen, dass Alejandros Nähe dabei besonders hilfreich sein wird. Ich blase die Kerze auf meinem Nachttisch aus und schlüpfe unter die Decke, den Rücken meinem Ehemann zugewandt.
Die Matratze bewegt sich leicht, als Alejandro sich neben mir ausstreckt. Ich höre, wie er die Kerzen auf seiner Seite löscht. Dann fühle ich plötzlich warme Lippen auf meiner Wange. »Fast hätte ich es vergessen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Lucero-Elisa«, flüstert er.
Ich seufze leise in der Dunkelheit. Das Schlimmste, was geschehen könnte – so hatte ich jedenfalls angenommen –, wäre, wenn sich mein Ehemann voll Abscheu von mir abwendete. Aber da habe ich mich geirrt. Viel schlimmer ist, dass er mir zuhört und mich ansieht. Und dass er nicht nur gut aussieht, sondern auch noch so freundlich ist.
Es wird nur zu leicht sein, sich in ihn zu verlieben.
Ich liege noch lange wach, mit weit geöffneten Augen und wild schlagendem Herzen, nachdem die letzte Kerze auf dem Kaminsims flackernd verloschen ist, nachdem ich anhand seiner ruhigen und gleichmäßigen Atemzüge gemerkt habe, dass der Mann neben mir eingeschlafen ist.
Unsere Kutsche steht an der Spitze einer langen Prozession, die auf dem gepflasterten Hof wartet. König Alejandros Leibgardisten haben hoch aufgerichtet dahinter Aufstellung genommen, die dunklen Gesichter unergründlich. Um unser Gefährt zu erreichen, müssen wir an den Springbrunnen und den Jacaranda-Bäumen vorbei, durch eine Phalanx von Edelleuten und Dienstboten, die Samenkörner und Rosenblätter werfen. Alejandro streckt seine Hand nach meiner aus, aber Papá kommt ihm zuvor und umarmt mich.
»Elisa«, flüstert er in mein Haar, »du wirst mir fehlen.«
Das bringt mich beinahe aus der Fassung. In den letzten ein oder zwei Tagen hat mir mein Vater mehr offene Zuneigung entgegengebracht als im ganzen letzten Jahr. Er ist immer so beschäftigt, so weit weg. Kann er mir nur zeigen, wie viel ihm an mir liegt, indem er mich aufgibt?
»Du mir auch«, bringe ich heraus, und die Worte schmerzen mich, weil sie wahr sind. Ich weiß, dass ich ihm nie so lieb und teuer sein werde wie Alodia, aber ich liebe ihn dennoch sehr.
Er lässt mich wieder los, und meine Schwester gleitet zu mir herüber. Sie trägt ein schlichtes Kleid aus mehreren Schichten blauer Seide, die elegant von ihren schlanken Schultern fallen, ihr Gesicht ist gefasst, perfekt wie eine Skulptur. Als es sich meinem nähert – ich rieche ihr Jasminparfüm –, sehe ich winzige Fältchen rund um ihre braunen Augen. Sorgenfältchen. Seltsam, dass sie mir noch nie zuvor aufgefallen sind.
Alodia packt meine Schultern mit ihren kräftigen Fingern. »Elisa«, flüstert sie. »Hör gut zu.«
Etwas an ihrer Art, vielleicht die Intensität ihres Blickes, zwingt mich, das Plätschern der Springbrunnen und das Raunen der Menge auszublenden und mich auf ihre Stimme zu konzentrieren.
»Vertraue niemandem, Elisa, außer Alejandro, Ximena und Aneaxi.« Ihre Stimme ist so leise, dass wahrscheinlich nicht einmal unser Vater ihre Worte hört. Ich nicke, und plötzlich wird mir warm; der Feuerstein flackert heiß und heftig auf. Ist das eine Warnung? »Ich gebe dir einige Brieftauben mit«, fährt sie fort. »Benutze sie, wenn du mir schnell eine Nachricht schicken musst. Wenn du angekommen bist, zögere nicht, deinen Platz zu beanspruchen. Hab keine Angst davor, Königin zu sein.«
Sie drückt ihre Wange an meine und streicht mir seufzend übers Haar. »Alles Gute, Elisa, kleine Schwester.«
Ich stehe einfach nur da, völlig verblüfft. Mein Ehemann nimmt meine Hand und zieht mich an den vielen Gratulanten vorbei zu unserer Kutsche. Ich weiß, dass ich den Kopf heben und lächeln sollte, den Edelleuten einen letzten, herrlichen Blick auf ihre Prinzessin gönnen, die nun ihre Reise ins ewige Glück antritt. So würde es Alodia machen. Aber mein Blick ist zu tränenverschleiert, mein Gesicht zu heiß, und das nur wegen dieser Umarmung, weil meine Schwester mich nicht mehr so festgehalten hat, seit wir kleine Kinder waren.
Die Stufen der Kutsche sind zu hoch, als dass ich sie elegant hinaufklettern könnte. Die fremden Leibgardisten sehen zu, wie Alejandro als Erster einsteigt und mich dann zu sich emporzieht. Ich lächele ihn dankbar an. Samenkörnchen und Blütenblätter haben sich in seinem schwarzen Haar verfangen. Unwillkürlich fährt meine Hand zu meinem eigenen Schopf, und ich frage mich, wie lange Ximena brauchen wird, um alles wieder herauszukämmen. Meine Kinderfrau hat längst zusammen mit Lady Aneaxi in der hintersten Kutsche Platz genommen, und plötzlich kann ich es nicht mehr erwarten, sie wiederzusehen und mich von ihnen umsorgen zu lassen. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich zu ihnen hinübergehen, nehme ich mir vor.
Die Sitze sind mit dickem blauem Samt bezogen, doch trotzdem spüre ich eine starke Erschütterung, als sich das Gefährt in Bewegung setzt. Die nobleza d’oro jubelt laut, und für kurze Zeit ist die Luft von Körnern und Blumen und wild winkenden Armen erfüllt. Die Fenster der Kutsche sind hoch genug, dass ich über den ganzen Vorplatz sehen kann, über die feiernde Menge, bis zu meinem Vater und meiner Schwester. Die Morgensonne steht schon hoch am Himmel und wirft ein goldenes Licht auf die roten Ziegel des ausufernden Palastes, auf die Mauern des schönen Amalur. Ich sauge den Anblick der Torbögen mit den grünen Kletterpflanzen, der gepflasterten Straßen und gefliesten Springbrunnen tief in mich ein. Doch vor allem ist es meine Schwester, die immer wieder meinen Blick auf sich zieht. Ihre Augen sind geschlossen, und ihre Lippen bewegen sich, als ob sie betet. Die Sonne schimmert auf ihren Wangen und lässt die Feuchtigkeit darauf glitzern.
3
Alejandro scheint es zu genügen, meine Gesellschaft schweigend zu genießen. Ich halte meine Hände im Schoß gefaltet und tue so, als mache es mir nichts aus, dass sich die Kutsche unaufhaltsam von meinem Zuhause entfernt. Dabei denke ich über die verschiedensten Wege nach, ein Gespräch anzufangen. Alodia macht stets geistreiche Bemerkungen über Schiffbau oder die Wollpreise oder dergleichen, aber solche Themen würden aus meinem Mund seltsam klingen. Ich sollte Alejandro nach unserer Ehe fragen und danach, wieso meine Schwester zu so viel Vorsicht geraten hat, aber es macht mir weniger Angst, einfach still zu sein.
Mit einem Ruck bleibt die Kutsche stehen, und die Tür schwingt auf. Sonnenlicht erstrahlt hinter dem riesigen Umriss eines Leibgardisten, und ich hebe den Unterarm, um mich gegen den grellen Schein zu schützen. Verwirrt sehe ich meinen Gatten an.
»Es ist alles in Ordnung, Elisa«, sagt er. »Er wird dich zu deiner Kutsche bringen.«
Wie bitte? Ich versuche, mir einen Reim darauf zu machen. »Meiner …?«
»Es wäre leichtsinnig, wenn meine Frau und ich in derselben Kutsche fahren würden.«
Mein Gesicht beginnt wieder zu brennen, als er »meine Frau« sagt, und dann erst kann ich mir die Bedeutung der Worte erschließen. Ich habe von solchen Dingen gelesen. In Zeiten des Krieges dürfen ranghohe Persönlichkeiten nie ein gemeinsames Ziel bieten. Ich nicke und fasse nach der Hand des Gardisten. Eine raue Hand, stark und unfreundlich.
»Ich werde nach dir sehen, wenn wir zum Essen anhalten«, sagt mein Ehemann.
Wir steigen aus und entfernen uns einen Schritt von der Kutsche, der unfreundliche Leibwächter und ich, und dann führt er mich zur Nachhut unserer staubigen Prozession. Tempelbäume voll weißer Blüten säumen die Straße. Der Palast ist schon nicht mehr zu sehen. Mein Verstand arbeitet, sucht vernunftgesteuert nach einer Erklärung, als sei ich wieder in Meister Geraldos Studierzimmer, vertieft in die Belleza Guerra.
Kein gemeinsames Ziel bieten.
Ich erstarre und sehe zu dem Gardisten auf. Er hat ein jugendliches, angenehmes Gesicht, trotz der harten Züge und des sorgsam geschwungenen Schnurrbarts. Ungeduld flackert in seinen dunklen Augen auf, aber er reißt sich schnell zusammen. »Gnädigste, wir müssen zu Ihrer Kutsche.« Seine Stimme klingt rau und angestrengt, als ob er nicht viel Übung im Sprechen hat.
Hab keine Angst davor, Königin zu sein, hat Alodia gesagt. »Ihr werdet mich mit Hoheit ansprechen.« Meine Stimme ist fest und selbstbewusst, wie die meiner Schwester. Ich komme mir albern vor. »Nach der Krönung dann mit Königliche Majestät.«
Er hebt eine Augenbraue. »Natürlich, Hoheit. Verzeiht.« Aber sein Blick ist skeptisch, spöttisch.
»Wie lautet Euer Name?«
»Lord Hector. Ich gehöre zur Leibwache Seiner Majestät.«
»Ich freue mich, Euch kennenzulernen.« Ich schenke ihm ein höfliches Lächeln, wie es auch Alodia täte. »Lord Hector, in welcher Gefahr befinden wir uns?«
Mein Gesicht rötet sich, und mein Herz klopft wild in meiner Brust. Jeden Augenblick wird er erkennen, dass mein so demonstrativ zur Schau gestelltes Selbstbewusstsein nur gespielt ist.
Aber seine Miene hellt sich auf, und er nickt. »Es ist nicht an mir, Euch Einzelheiten zu erläutern, Hoheit. Aber ich werde Seiner Majestät Eure Frage vortragen.«
Ich kann mich nicht überwinden, weiter nachzuhaken. Er führt mich zum Ende unseres Zuges, wo meine Kammerfrauen schon die Tür ihrer Kutsche geöffnet haben. Da sie ganz hinten fahren, ist der Wagen bereits dick mit Staub überzogen. Sie strecken mir ihre Arme entgegen, um mir beim Einsteigen zu helfen.
Sie wollen wissen, weshalb ich nicht an der Seite meines Mannes reise. Eine gewisse Scheu zwischen Eheleuten sei am Anfang ganz natürlich, versichern sie mir. Keine Sorge. Ihr werdet euch schon bald aneinander gewöhnen. Ich beiße die Zähne zusammen angesichts dieser blinden Versicherungen, aber gleichzeitig bin ich auch dankbar dafür. Und da ich selbst keine Erklärungen habe, sehe ich zu Boden.
Mit einem Ruck setzt sich die Kutsche wieder in Bewegung. Es ist heiß hier drin, und meine Haut ist schon bald von einem klebrigen Schweißfilm überzogen. Wenn ich so sportlich wäre wie Alodia, würde ich aussteigen und laufen. Ich frage mich, ob dies der wahre Grund dafür ist, dass mein Ehemann nicht mit mir zusammen in einer Kutsche fahren will. Vielleicht besteht überhaupt keine Gefahr.
Ich bin mit einem Fremden verheiratet, und niemand hat sich bisher die Mühe gemacht, mir den Grund dafür zu sagen. Stattdessen war stets nur vage von einem Abkommen die Rede. Sicherlich hat es etwas damit zu tun, dass ich den Feuerstein trage. Aber da niemand mir etwas verraten will, werde ich es wohl selbst herausfinden müssen.
Während Ximena mir die Stirn mit dem Leinenstoff ihres Rockes abtupft und Aneaxi mir kühlen Wein aus einem Reiseschlauch einschenkt, bete ich in Gedanken und bitte Gott, mir etwas mehr Stärke und etwas mehr Mut zu verleihen.
Unser Weg führt durch den Dschungel der Hohen Sperre, jener Gebirgskette, die unsere beiden Länder voneinander trennt. Der König hält Wort und sieht regelmäßig nach mir. Wenn wir zu den Mahlzeiten anhalten, erkundigt er sich ausführlich nach meinem Befinden. Sind die Kissen weich genug? Wäre es dir lieber, wenn deine Kutsche eine Weile unseren Treck anführte? Schmeckt dir der Wein? Er ist wundervoll fürsorglich, nimmt stets meine Hand und sieht mir in die Augen, als sei ihm nichts wichtiger als mein Wohlergehen.
Auf die Frage hin, die ich Lord Hector übermitteln ließ, antwortet mein Gatte, der Dschungel sei gefährlich, denn hier wimmele es vor Nachkommen jener Sträflinge, die im letzten Jahrhundert in die Wildnis gejagt wurden, als die Gefängnisse von Joya überfüllt waren. Aber eine Seereise sei zu diesem Zeitpunkt noch weniger anzuraten, da schon die Jahreszeit der schweren Stürme bevorstünde.
Meister Geraldo hat diese Perditos erwähnt, die Verlorenen des Dschungels. Mein Lehrer sagte jedoch, sie hielten sich von den Heerstraßen fern, und deswegen weiß ich nicht, ob ich Alejandro glauben soll.
Manchmal ist unser Weg so steil, dass mein Rücken angenehm gegen die Wand der Kutsche gedrückt wird und ich trotz des ständigen Schaukelns ein wenig dösen kann. Aber nach einer Weile weichen Wüstenkakteen und Königspalmen goldenen Regenbäumen und gelben Trauertränen. Saatkapseln schlagen in unregelmäßigen Abständen gegen das Dach der Kutsche und halten mich wach. Nachts schlafe ich unruhig mit meinen Kammerzofen in einem großen Zelt.
Der Dschungel ist erfüllt von Lärm. Kreischende Vögel, keckernde Klammeraffen und summende Insekten wetteifern darum, sich Gehör zu verschaffen. Und auch, wenn der Wind nicht durch das Blätterdach dringen kann, um uns auf unserer Reise einen kühlen Hauch zu schicken, können wir ihn hören, wie er über uns in die Zweige fährt. Tatsächlich war ich noch nie an einem lauteren Ort als hier.
Doch am Morgen des vierten Tages verstummt der Dschungel, so plötzlich und gründlich, dass ich den Vorhang beiseiteschiebe und beinahe erwarte, dass Gott uns in eine andere Zeit und an einen anderen Ort versetzt hat. Aber die Mangrovenbäume ragen immer noch über mir auf, undurchdringlich dunkle Pfeiler in dem gefilterten Licht. Und immer noch winden sich Palmwedel um ihre Stämme, verzweifelt nach Sonnenlicht suchend.
Zwei Kutschen weiter vorn springt Lord Hector mit dem Degen in der Hand vom Dach zu Boden.
Unser Treck ist mit seinen Kutschrädern, den schnaubenden Pferden und klappernden Rüstungen schwerfällig und laut. Dennoch hat der Dschungel auf unseren Lärm noch nie mit einer so ängstlichen Stille reagiert. Ich höre Lady Aneaxi leise murmelnd beten.
Dann ist in großer Entfernung eine Trommel zu hören. Die Richtung, aus der sie kommt, kann ich zunächst nicht klar ausmachen, aber es ist, als täte sich durch das widerhallende Geräusch ein Loch in meiner Brust auf. Die Schläge ertönen erneut, kommen näher.
Die Kutsche bleibt mit einem Ruck stehen.
Nein.
Alejandros Leibwache hat instinktiv gehandelt. Die Männer haben eine Gefahr gespürt und den Treck angehalten, um einen Ring der Verteidigung um uns zu bilden. Das Blätterwerk ragt dicht an unseren Pfad heran; ich könnte meine Hand durchs Fenster strecken und mit den Fingerspitzen die hängenden Palmwedel berühren. Ein unsichtbarer Feind wäre ohne Weiteres in der Lage, mich aufzuspießen.
Vor uns liegt eine kleine Lichtung, eine Stelle, an der sich die Bäume ein wenig vom Wegesrand zurückziehen.
»Lord Hector!«, rufe ich mit klopfendem Herzen. Er sieht mich an, seine Brust hebt sich in einem tiefen Atemzug, als bemühe er sich um Gelassenheit. Aber ich weiß, dass ich in dieser Sache recht habe. Die Belleza Guerra widmet ganze Seiten dem Abwehren eines feindlichen Angriffs. »Wir müssen die Lichtung erreichen, damit wir sie kommen sehen können!«
Er nickt und ruft einen Befehl, während ein neuerlicher Trommelschlag mein Brustbein erschüttert. Die Pferde schnauben und tänzeln, denn das Geräusch macht auch sie unruhig, aber sie ziehen uns weiter voran, der Lichtung entgegen.
»Aneaxi. Ximena. Wir müssen nach unten, weg von den Fenstern.« Die Kutsche bebt, als sie sich meinen Worten fügen. Wir bilden ein seltsames Dreiergrüppchen, für das der Platz auf dem Boden zwischen den Sitzbänken kaum ausreicht.
»Die Leibwache Seiner Majestät ist die beste auf der ganzen Welt«, haucht Aneaxi. »Wir sind nicht in großer Gefahr.« Doch dabei umklammert ihre Hand die meine so fest, dass es wehtut.
Mit meiner freien Hand taste ich nach dem Umriss der Falltür, bis ich den Riegel finde, der sie verschließt. Der Gedanke, die Kutsche zu verlassen, macht mir Angst, und ich stelle mir vor, wie wir drei auf die Erde stürzen. Ich hoffe, dass Aneaxi recht hat und wir nicht ernsthaft in Gefahr schweben.
Die Trommeln schlagen nun schneller und lauter. Meine Schulter stößt gegen einen Sitz, als die Kutsche heftig schwankt. Ich wage es nicht, aus dem Fenster zu sehen, doch ich hoffe, dass wir die Lichtung erreicht haben. Von draußen sind schnelle Schritte und Lord Hectors gedämpfte Befehle zu hören, dann das metallische Klirren von gezogenem Stahl.
Etwas schlägt schwer gegen die Kutsche. Wieder und wieder, bis es sich anhört wie ein Hagel aus Steinen, der gegen eine Holzwand prasselt. Ein heftiger Aufprall erschüttert die Kutschwand neben meinem Kopf. Die schimmernde schwarze Spitze eines Pfeils hat sich hindurchgebohrt, eine knappe Handbreit von meiner Nase entfernt. Meine Haut glüht. Es ist zu heiß, zu stickig, man bekommt kaum Luft. Der Feuerstein in meinem Nabel sendet eiskalte Wellen aus, und ich ziehe vor Überraschung scharf die Luft ein. Noch nie zuvor ist er kalt geworden.
Die Holzverkleidung unter meinen Handflächen fühlt sich plötzlich an, als würde sie von der Sonne gewärmt. Viel zu warm. Der scharfe Geruch brennenden Holzes kitzelt in meiner Nase, während der Feuerstein weiter seine eisigen Warnsignale ausstrahlt.
Aneaxi wimmert: »Feuer!« Tatsächlich füllt sich die Kutsche mit leichtem Rauch, und das Geschrei draußen wird lauter und panischer.
»Die Prinzessin!«, schreit jemand. »Schützt die Prinzessin!« Aber die Stimme ist weit weg.
Wieder taste ich nach dem Riegel der Falltür. Sie schwingt nach unten auf, und wir rutschen hindurch, in die kühlere, sauberere Luft unterhalb der Kusche. Ich lande auf etwas, das knackend unter meinem Gewicht nachgibt. Aneaxi schreit.
Es bleibt keine Zeit, um darüber nachzudenken, wie schwer ich sie verletzt haben mag. Die Pferde wittern den Rauch und tänzeln unruhig in ihrem Geschirr. Wir können jeden Augenblick von den Rädern zermalmt werden. Ich wünschte, ich hätte ein Messer, um die Tiere loszuschneiden, um zumindest irgendetwas in der Hand zu halten, das mir ein wenig das Gefühl der Ohnmacht nehmen würde. Die Kutsche macht einen Satz nach vorn. Links hinter mir sehe ich Aneaxis Bein, das in unnatürlichem Winkel gebogen direkt vor einem der Kutschräder liegt.
Mir wird übel. »Aneaxi, zieh dein Bein dort weg!«
»Ich kann nicht!«, schluchzt sie.
Rasch packe ich sie unter einer Achsel und versuche sie zu bewegen. Ximena tut es mir auf der anderen Seite nach, aber Aneaxi ist schwer, und ich war nie besonders stark. Ein Pferd steigt hoch, und die Kutsche bewegt sich ruckartig. Voller Panik zerren Ximena und ich an unserer Freundin, aber unter der Kutsche ist es so eng, dass wir sie nicht richtig zu fassen bekommen, und oh, wir haben einfach nicht genug Kraft.
Ein metallisches Klappern ist zu hören, und wieder geht ein Ruck durch die Kutsche. Jemand hat das Pferdegeschirr zerschnitten, und Tränen der Erleichterung steigen in mir auf.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Kutsche bietet uns zwar Deckung, aber sie brennt. Rauch breitet sich am Kutschboden über unseren Köpfen aus und windet sich wie weiße Schlangen um die einzelnen Paneele. Auf Augenhöhe eilen Füße vorbei. Unsere Feinde sind barfüßige Dämonen, offenbar fast nackt und mit schwarz-weißen Kreisen bemalt. Fußkettchen aus winzigen Knochen klappern an ihren Knöcheln, wenn einer von ihnen aus dem Dschungel tritt oder sich wieder dorthin zurückzieht. Ein Satz, ein Schritt, und schon ist die Gestalt verschwunden, und die nächste nimmt ihren Platz ein. Es gibt kein Muster bei ihrem Angriff, in seiner Zufälligkeit und Unaufhörlichkeit ist er nicht abzuwehren.
Ein paar Schritte entfernt von unserer brennenden Kutsche klafft in einem der großen Stämme eine Öffnung, eine Höhle, geschaffen von den Wurzeln eines Mangrovenbaums. Ich könnte sie schnell erreichen, ebenso wie Ximena, aber ich weiß nicht, ob Aneaxi es mit ihrem gebrochenen Bein schaffen wird.
Hastig wende ich mich zu meinen beiden Zofen um. »Wir müssen hier weg, bevor die Kutsche zusammenbricht.«
Sie nicken. Aneaxis runde Wangen sind dreckverschmiert, durchzogen von hellen Tränenspuren. Mein Herz wird weit. Ich will keine von den beiden verlieren.
»Ximena und ich, wir gehen zuerst«, erkläre ich Aneaxi. »Und dann können wir dich an den Armen unter der Kutsche hervorziehen.« Ich hoffe, dass uns im Stehen gelingen wird, wozu uns im Liegen die Kraft fehlte. »Aneaxi, du darfst nicht schreien, egal, wie weh es tut.«
Sie holt ein paarmal bebend Luft. Dann reißt sie sich ein Stück Stoff vom Saum ihres Reisekleids. Ein Gefühl von Stolz steigt in mir auf, als ich sehe, wie sie es zusammenrollt und in ihren Mund schiebt. Ich bin bereit, sagt ihr Blick.
Wir warten trotzdem noch. Die Kämpfe sind zu nahe. Von unserem Versteck aus können wir Paare nackter, bemalter Wadenbeine in Stiefeln und steifen Häuten sehen. Ein Mann stürzt vor mir zu Boden, und ich zucke zurück. Seine Augen sind offen und blendend weiß inmitten des schwarz bemalten Gesichts. Sein Haar ist so lang wie meines, aber zu dicken Strähnen verfilzt. Er bleibt bewegungslos liegen. Vorsichtig und mit klopfendem Herzen drehe ich ein Flintsteinmesser aus seiner noch warmen Hand und schiebe es in mein Mieder.
Endlich lassen die Kämpfe ein wenig nach, und ich gebe Ximena ein Zeichen. Auf allen vieren kriechen wir unter der Kutsche heraus. Mein Fuß bleibt an meinem Unterrock hängen, aber ich befreie mich mit einem Ruck, und der Stoff zerreißt. Dann packen wir Aneaxi an den Armen. Sie stöhnt, als wir an ihr ziehen, ist aber durch den Knebel kaum zu hören. Sie kneift die Augen zusammen, ihr Gesicht läuft rot an. Dann wird sie schlaff, als die Bewusstlosigkeit sie übermannt. Verzweifelt schleifen wir sie zu der dunklen Höhle im Baumstamm, und jeden Augenblick fürchte ich einen Pfeil in ihre Brust dringen zu sehen. Schweiß läuft mir den Rücken und den Bauch hinunter. Ximenas grauer Knoten hat sich gelöst, und ihr Haar fällt ihr offen über die Schultern. Stück für Stück kommen wir dem Rand des Dschungels näher. Der Boden fällt ein wenig ab, als wir zwischen die Wurzeln rutschen. Hier ist es kühler und beruhigend dunkel. Der Platz in der kleinen Höhle reicht gerade für uns drei. Ich halte den Atem an und klammere mich fest an Aneaxis Schultern, so erleichtert bin ich, dass wir es bis hierher geschafft haben.
Jetzt habe ich einen besseren Überblick über die Schlacht. Die Leibwache meines Mannes scheint sich inzwischen gegen diese seltsamen Wilden zur Wehr setzen zu können. Rücken an Rücken kämpfen die Männer gegen die Attacken, die jede erkennbare Struktur vermissen lassen, halten Schilde in die Höhe, um sich gegen heransurrende Pfeile zu schützen. Überall liegen Tote, und mein Magen rebelliert beim Geruch von versengtem Fleisch. Unsere Kutsche hat sich in ein flammendes Inferno verwandelt. Ximena zuckt neben mir zusammen, als das lodernde Gefährt krachend in sich zusammenfällt und Funken in alle Richtungen stieben. Hätten wir noch ein wenig länger gezögert, wir wären jetzt verbrannt.
Hinter der zerstörten Kutsche haben zwei Wilde an einem Baum einen der unseren gestellt. Sein Gesicht kann ich nicht sehen, aber sein Körper ist starr vor Entsetzen.
Einer der Wilden springt mit einem Schrei nach vorn, um dem Mann ein Flintsteinmesser in die Brust zu rammen. Gerade noch rechtzeitig kann er sich zur Seite werfen, sodass das Messer lediglich seinen Arm trifft.
Nun kämpft er nur noch schwach mit der linken Hand. Als er wieder zu lange mit der Abwehr zögert, ist mir klar, dass er nicht überleben wird. Die bemalten Angreifer spüren, dass er leichte Beute ist. Sie beginnen mit seltsamen Bewegungen, fast wie ein Tanz. Hinhocken, drehen, anschleichen. Sie sind wie Dschungelkatzen, tödlich geschmeidig und von wildem Jagdtrieb erfüllt. Dann erhasche ich einen Blick auf das Gesicht ihres Opfers.
Alejandro.
»Nein!« Ich stürze aus unserem Versteck hervor. Ximena schreit etwas Unverständliches, packt meinen Arm, aber ich reiße mich los. Auf dem kurzen Weg hinüber zu meinem Mann komme ich mir furchtbar schwerfällig vor; mein Bauch und meine Brüste schaukeln schmerzhaft bei jedem Schritt. Als ich an der zerstörten Kutsche vorbeilaufe, ziehe ich das Messer aus meinem Mieder. Ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich damit tun will, aber ich kann nicht einfach zusehen, wie Alejandro stirbt. Die bemalten Männer umringen meinen Ehemann und sehen mich nicht kommen. Sie treten näher an ihn heran, während Alejandro mit dem gesunden Arm noch einmal den Degen zu heben versucht.
Tränen der Verzweiflung laufen über mein Gesicht, als ich den Mann angreife, der mir am nächsten ist. Wir stürzen beide zu Boden, und weinend steche ich auf ihn ein, steche immer wieder zu, bis mein Arm ganz nass und klebrig ist und meine Schulter brennt von dem harten Aufprall, wenn die Klinge auf einen Knochen trifft.
Jemand zieht mich weg. Es ist Alejandro. Ich blinzle, um meine brennenden Augen zu klären, und sehe zwei bemalte Männer zu unseren Füßen. Er muss den anderen erledigt haben. Ich sollte etwas zu ihm sagen, und mein Mund öffnet sich auch, aber etwas Leuchtendes lenkt meinen Blick nach unten. Rot. So viel Rot, überall auf meinem Mieder. Es durchtränkt meinen Rock. Metallischer Speichel kitzelt meinen Gaumen, und plötzlich zittere ich so sehr, dass ich das Gefühl habe, meine Zähne müssten mir aus dem Mund fallen.

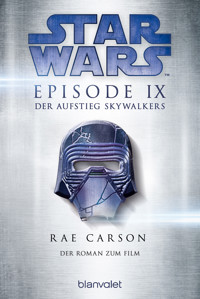













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













