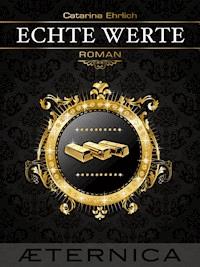3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aeternica Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie konnte nicht anders. Sie musste diesen Roman schreiben: Die dramatische Geschichte aus dem Südengland des 17 Jahrhunderts über die verhängnisvolle Liebe zwischen Feodora - einer jungen Frau aus einfachen Verhältnissen - und dem Grafen Liondale. Die Worte flossen nur so aus ihr heraus, ganz wie von selbst. Sie ist sich sicher, dass sie diesen Roman jederzeit noch einmal schreiben könnte, ohne dabei mehr als eine Handvoll Worte anders zu formulieren - so intensiv hat sie die Ereignisse der Geschichte miterlebt. Als wäre dies allein nicht schon unheimlich genug, muss sie eines Tages feststellen, dass nicht nur die Familie der Liondales tatsächlich existiert, sondern auch deren Burg in Südengland genau so aussieht, wie sie es im Geiste gesehen hat. Obwohl sie selbst noch nie zuvor in Südengland gewesen war. Doch das will sie nun ändern. Fest entschlossen macht sie sich auf, das Anwesen der Liondales persönlich zu besuchen, um herauszufinden, welche geheimnisvolle Verbindung es zwischen ihr und Feodora gibt, und was es mit dem unglückseligen Fluch der Liondales auf sich hat. - Eine mysteriös-romantische Achterbahnfahrt zwischen dem Südengland des 17. Jahrhunderts und heute. -
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Der Fluch der Liondales
Mystery-Romance
Catarina Ehrlich
Der Inhalt dieses Romans ist frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit realen Begebenheiten, existierenden Orten oder Namen und tatsächlich lebenden oder bereits verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Der Fluch der Liondales
Ein Sommer in der Gegenwart …
»Aber … aber das kann doch nicht sein!«
Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Mit weit aufgerissen Augen starrte sie auf das Porträt an der Wand zwischen unzähligen anderen. Ihr Herz schlug bis zum Hals, ihr Atem stockte und ihre Knie versagten den Dienst. Maja schwankte.
David Liondale konnte sie gerade noch auffangen. Er führte sie hinaus und ließ sie im Raum nebenan auf das alte Kanapee gleiten.
»Ich kann es selbst nicht glauben.« Seine Stimme kam aus weiter Ferne, erreichte sie kaum, während er ihre Füße hoch legte.
In ihren Ohren rauschte es, dazu erklang ein dünner, hoher Ton, er steigerte sich mit jeder Sekunde. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis ihr Kreislauf zusammenbrechen musste. Seit ihrer Kindheit litt sie darunter. Es sei nicht weiter schlimm, sagte der Arzt damals, ihr niedriger Blutdruck wäre schuld daran. Darüber machte sich Maja auch keine Sorgen. Beängstigend waren nur die Bilder, an die sie sich später würde erinnern können.
Sie atmete tief durch und kämpfte gegen das Pochen in ihrem Schädel an. Helle Flecken tanzten vor ihren Augen, ihre Lider flackerten, sie hatte keine Kontrolle mehr - es war zu spät. Ohnmächtig sank sie zusammen.
Es dauerte nur ein paar Augenblicke, bis Maja das Bewusstsein wiedererlangte. Viele der Bilder kannte sie dieses Mal schon, es sollte jedoch Tage dauern, bis sie sich an alles würde erinnern können. Maja wusste nie genau, ob es sich dabei um Erinnerungen, Eingebungen oder um reine Fantasien handelte. Das machte ihr viel mehr Angst als die gesehenen Bilder.
»Geht es Ihnen besser?« Ihr Gastgeber reichte ihr einen Sherry zur Stärkung.
Sie nickte stumm, nahm das Glas mit zitternden Fingern, während seine Hand in ihrem Nacken lag und ihren Kopf hielt. Der Alkohol brannte auf leerem Magen. Sie hatte seit dem Frühstück nichts mehr gegessen.
»Es ist nicht schlimm. Das passiert mir ab und zu mal. Nur der Blutdruck.« Ihre Stimme wollte ihr nicht gehorchen.
Maja setzte sich auf. Sie zitterte, nicht nur vor Kälte. David Liondale legte ihr eine Decke um die schmalen Schultern. Sie lächelte unverbindlich. Bei ihrer Ankunft hatte er sich so kalt und abweisend gezeigt, dass sie fast wieder gegangen wäre. Er hatte sie einfach ausgelacht. Sie hätte an seiner Stelle wohl kaum anders reagiert, doch sie musste wissen, wer ihr diesen Brief geschrieben hatte.
Sie hatte von all dem hier nichts gewusst, hatte zu Hause an ihrem Computer gesessen, tausend Kilometer entfernt, und sich die Seele aus dem Leib geschrieben. Sie hatte sich vor die leere Seite gesetzt und angefangen. Einfach so. Ohne zu wissen wovon, ohne Plot, ohne Recherche. Ohne zu wissen, wie es ausgehen würde. Doch die Worte machten Sinn, fügten sich wie von selbst zu Sätzen. Aus diesen wurden Seiten, Kapitel, ein Roman. Beängstigend und faszinierend zugleich. Berührte etwas tief in ihr, von dem sie weder bisher gewusst hatte, noch sagen konnte, was es war.
Wochenlang beherrschte das Geschehen ihr ganzes Denken. Maja schlief nur noch, wenn ihr Körper danach verlangte. Doch auch dann kamen ihre Gedanken nicht zur Ruhe. Stundenlang wälzte sie sich herum, mit hellwachem Geist, konnte die Augen nicht mehr offen halten, nicht mehr schreiben. Die Geschichte lief weiter, wie ein Film, den jemand vergessen hatte anzuhalten.
Irgendwann schrieb sie die letzten Zeilen. Die Geschichte ging nicht so aus, wie sie es gewollt hatte, aber sie war von Anfang an nicht in der Lage gewesen, ihren Figuren eine Richtung zu geben. Sie bewegten sich eigenständig durch die Welt der Worte. Sie war nur eine Beobachterin. Maja wollte den Schluss ändern, aber sie konnte es nicht. Ihre Finger weigerten sich, die Entfernen-Taste zu drücken. Nicht ein Wort konnte sie löschen. Oder durfte sie es nicht?
Sie legte sich ins Bett und schlief fast einen ganzen Tag lang, war trotzdem müde, ausgebrannt, wusste nichts mit sich anzufangen, saß untätig in ihrer abgedunkelten Wohnung und starrte vor sich hin. Ein paar Tage später dann bekam sie den Brief. Eine Einladung. Sie hielt die ganze Sache für einen dummen Scherz, wollte ihn in den Müll werfen, aber ein Satz hinderte sie daran: Sie solle das mitbringen, was sie zurzeit so sehr bewegt.
Maja überlegte zwei Tage, dann druckte sie das Manuskript aus und stieg in den Flieger. Fünf Stunden später war sie hier.
»Sie sollten etwas essen.«
Seine leise Stimme holte sie aus ihren Gedanken. Sie passte so gar nicht zu dem Mann, der ihr eigenhändig die schwere Eingangstür geöffnet und sie von Kopf bis Fuß verächtlich gemustert hatte. Doch Maja war nicht hungrig und schüttelte den Kopf.
»Versuchen Sie es wenigstens.« Die Kälte in seinem Blick war einem ungläubigen Staunen gewichen.
Maja gab nach. David Liondale bot ihr seinen Arm und geleitete sie hinüber an den Tisch. Maja kam die Situation so unwirklich vor. Da saß sie nun in diesem riesigen Schloss und sah sich einem Schlossherrn gegenüber, der eindeutig zu jung für seinen Job war, noch keine dreißig, ihn aber in Perfektion beherrschte. Stimmen wisperten in den alten Mauern, begrüßten sie, raunten ihr Namen aus längst vergangenen Tagen zu. Oder waren es Warnungen? Entsprangen sie ihrer überdrehten Fantasie?
Niemand hatte gewusst, woran sie in den letzten Wochen gearbeitet hatte, niemand hatte Zugriff auf ihre Dateien gehabt, kein Zugang zum Internet, dafür benutzte sie aus Sicherheitsgründen einen anderen PC. Niemand hatte ihre Wohnung betreten. Wer hatte diesen Brief geschrieben?
Schon als sie sich am Bahnhof ins Taxi setzte und dem Fahrer die Adresse nannte, blickte dieser sie so merkwürdig an. Sie fuhren durch ein Dorf, das ihr bekannt vorkam, dann eine steile Straße hinauf. Sie sah das Schloss und …
»Woher hatten Sie die Idee für Ihren Roman?« David Liondales Stimme riss sie aus ihren Überlegungen.
»Es war keine Idee. Ich schrieb einfach drauflos. Eigentlich ist es nicht mein eigenes Werk.«
Er war immer noch misstrauisch, unterstellte ihr unlautere Absichten und ließ sie dies auch sehen.
»Ich habe die Geschichte einfach nur aufgeschrieben«, versuchte Maja zu erklären.
»Und wer hat sie Ihnen erzählt?«
»Niemand. Die Worte waren einfach da.« Seine Musterung wurde ihr unangenehm. Sie blickte auf ihren Teller.
»Darf ich sie lesen?«
Maja zögerte. Nicht die Angst, sich lächerlich zu machen, hinderte sie daran. Sie wollte ihr Wissen nicht teilen. Es war ihre Geschichte, ein Teil von ihr, auch wenn sie den Zusammenhang nicht verstand.
»In irgendeiner Weise betrifft es mich ja auch. Bitte …«
Sie schnappte hörbar nach Luft. Nur ein Wort. Dieses eine Wort. Es verursachte ihr eine Gänsehaut und brach ihren Widerstand. Sie konnte nur noch stumm nicken.
Sie gingen nach dem Essen wieder in den kleinen Saal, der sie vorhin so erschreckt hatte. In den er sie geführt hatte, als sie ihm stammelnd den Grund für ihren Besuch erklärte. Zu erklären versuchte. Maja war diesmal jedoch vorbereitet.
Als das Taxi die steile Straße hinauf fuhr und sie das Schloss zum ersten Mal sah, traute sie weder ihren Augen noch ihrem Verstand. Sie hatte noch nie englischen Boden betreten. Sie hatte es noch nie gesehen, nur in ihrem Kopf … ein Déjà-vu. Es war älter, verwittert, aber genauso düster und finster, wie sie es beim Schreiben vor sich gesehen hatte.
Wie war das nur möglich? Und wenn das schon möglich war, geschah dann wirklich hier vor langer Zeit, was sie aufgeschrieben hatte? Die Tasche mit dem Manuskript wog schwer an ihrer Seite. Viel schwerer, als das Papier alleine wiegen konnte.
Sie musterte den Schlossherrn. David Liondale wirkte finster und unnahbar in seiner tiefschwarzen Kleidung. Schmal geschnittene Stoffhosen und Rollkragenpullover, teuer und modisch, glänzende schwarze Lederhalbstiefel. Die glatten, schulterlangen, weißblonden Haare und die blasse Haut boten einen harten Kontrast. Ebenso hell waren seine Augen in dem schmalen, kantigen Gesicht, die Iris kaum gefärbt. Vielleicht noch blau oder doch schon grau? Er war nicht viel größer als sie, sehr schlank, fast schon dünn. Kontrollierte Bewegungen, keine Geste zu viel. Lange, schlanke, gepflegte Finger. Zynisch seine Miene. Ein Dandy. Aber die Andeutung eines Lächelns erreichte auch seine Augen und das gab den Ausschlag.
Maja atmete tief durch und holte die Mappe mit dem dicken Stapel loser Blätter hervor. Es waren eine Menge Seiten, aber es war ja auch eine lange Geschichte. Sie reichte ihm das Manuskript. Er nahm es, suchte Antworten in ihrem Blick, die sie ihm nicht geben konnte. Noch nicht. Vielleicht konnte er einige zwischen diesen Blättern finden und auch einige ihrer Fragen beantworten.
»Lesen Sie.« Ihre Stimme zitterte vor Erwartung. »Ich will endlich Antworten.«
Er setzte sich in einen abgewetzten Ohrensessel aus dunkelbraunem Leder. Nur ein paar Sitzmöbel verloren sich in dem kleinen Saal, jedes aus einer anderen Epoche, kleine Tischchen aus derselben daneben. Als würde man nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit wandern. Die Messinglampe mit dem grünen Glasschirm neben ihm verbreitete ein überraschend warmes Licht.
Kerzen wären in diesem Raum angebracht gewesen, aber das Flackern hätte auch die Porträts an den Wänden wieder zum Leben erweckt, und Maja war sich nicht sicher, ob sie den Anblick im Moment ertragen hätte. Klein und unscheinbar kam sie sich vor. Beobachtet von den wissenden Gesichtern längst Verstorbener. Unheimlich der Saal, wie das ganze Schloss, wie die ganze Geschichte.
Maja wanderte von Bild zu Bild. Dicht an dicht hingen sie neben- und in zwei Reihen übereinander. Sie zeugten von einer langen Ahnenreihe. Drei Seiten des Saales waren von ihnen bedeckt, an der vierten erlaubte ihr das hohe und mehrfach geteilte Fenster einen weiten Blick über das Land. Es war bereits dunkel. Sie kannte den Anblick bei Tage, auch wenn sie ihn noch nie gesehen hatte.
Nur die Lichter aus dem Dorf tief unter dem Schloss gaben ihr das Gefühl, nicht ganz alleine mit ihm auf der Welt zu sein. Die Realität verschwamm vor ihren Augen und sie wurde erneut von der Vergangenheit gerufen, als sie vor dem Bild stand, das vor langer Zeit ein Künstler mit Farben und sie vor kurzem mit Worten gemalt hatte.
Maja blickte kurz hinüber. David Liondale schlug skeptisch die Mappe auf und nahm das Deckblatt beiseite …
England - im Herbst 1683 …
Feodora starrte in den morgendlichen, regnerischen Himmel. Es war kalt. Nebel hing noch über den Wiesen. Sturm lag in der Luft. Düster zeichnete sich die Burg vor den dunklen Wolken ab und ragte bedrohlich empor.
Feodora schlug ihren Umhang enger um die Schultern. So nah war sie ihr noch nie gekommen. Doch sie hatte keine Wahl. Längst war sie alt genug, um ihren Dienst im Herrensitz zu versehen, wie es der Pachtvertrag ihrem Vater vorschrieb. Fünf Jahre lang war sie nun verpflichtet, den Dreck ihrer Herrschaften wegzuräumen, sich um deren schmutzige Wäsche zu kümmern, für ihr leibliches Wohl zu sorgen und stets fleißig und demütig zu sein.
Fleiß war kein Problem für Feodora, aber mit der Demut vor den Herrschaften sah es leider ganz anders aus. Sie eckte immer wieder an, weil sie sich mit den schlimmen Gegebenheiten nicht anfreunden konnte. Sie rebellierte nicht nur innerlich, wenn sie daran dachte, dass alleine ein geerbter Titel, ein auf dem Rücken der hart arbeitenden Bevölkerung gemachtes Vermögen und der Besitz dieses Ungetüms reichte, um nach Lust und Laune über die Menschen, die von ihnen abhängig waren, zu herrschen.
Feodora hätte laut Vertrag schon vor fast vier Jahren ins Schloss gemusst, aber irgendwie entging sie der Aufmerksamkeit Seiner Lordschaft. Ihre Eltern machten kein Aufheben darum. Niemand schickte freiwillig sein Kind ins Schloss. Verärgert kickte sie einen kleinen Stein über die verwilderte Ligusterhecke, die sich den Weg bis zum Schloss hinauf zog.
»Aua!« Ein bekanntes Gesicht tauchte auf und hielt sich die Stirn.
Feodora atmete nach dem ersten Schrecken erleichtert auf. »Benjamin! Was machst du denn hier?«
Ihr zwei Jahre jüngerer aber einen Kopf größerer Bruder stieg über die Hecke und blickte sie betreten an. »Ein Auge auf dich haben, Schwester, was denn sonst! Stelle dir mal vor, nicht ich hätte den Stein abbekommen sondern er!«
Sie zuckte mit den Schultern, ihre schwarzen Augen funkelten. »Was stand er da auch so blöde herum! Ich konnte doch nicht ahnen, dass Seine Lordschaft unseren Weiher dem heimatlichen Bad vorzieht! Noch dazu bei dieser Kälte.«
»Sei froh, dass du nur zum Dienst im Schloss verdonnert wurdest, Fee! Es hätte dir weitaus schlimmer ergehen können!«
»Ach!«, schnaubte sie und kickte den nächsten Stein davon. »Sein edler Hintern wird den kleinen Stoß schon vertragen haben. Was kann ich denn dafür, wenn er vor Schreck das Gleichgewicht verliert und ins Wasser fällt? Baden wollte er doch sowieso, sonst hätte er da nicht nackt herumgestanden.«
Ihr Bruder legte ihr die Hände auf die Schultern und blickte sie eindringlich an. »Bitte, Fee! Mache keinen Ärger! Sein Vater ist dafür bekannt, dass er kurzen Prozess mit Leuten macht, welche denken, sie könnten sich gegen ihn stellen. Und was willst du kleine Maus schon ändern? Du musst die Verhältnisse akzeptieren, du kannst dir keine andere Welt aussuchen!«
Feodora wollte keinen Streit und seufzte. »Schon gut, Bruder. Aber jetzt gehe bitte! Ich komme sonst zu spät und dann habe ich gleich den ersten Ärger am Hals - und das ist es doch, was ich um alles in der Welt vermeiden soll, oder nicht?«
Benjamin umarmte sie noch einmal und drückte sie fest an sich. Er hatte Angst um sie, aber auch er musste sich dem Willen des Grafen fügen.
Immer wieder drehte er sich auf seinem Rückweg um und sah ihr hinterher, wie sie den Weg zum Schloss erklomm: Schön wie ihr Name, zielstrebig und selbstbewusst - und leider kein bisschen demütig.
Trostlos zog sich der ausgefahrene Weg über einen weiten Platz bis zum Tor. Gras wuchs in den Fahrspuren, Pfützen gaukelten eine ebene Fläche vor. Die Herrschaften führten kein geselliges Leben.
Feodora kam einen Moment lang in Versuchung, das imposante Vordertor zu nehmen, sich vor die große, schwere Eichentür zu stellen und laut dagegen zu hämmern. Ein Bediensteter würde ihr die Tür öffnen und sie höflich - ja, wohin bringen? Wieso war sie es nicht wert, genauso zuvorkommend behandelt zu werden wie reiche Leute? Nur weil ihre Eltern Bauern waren? Wo wäre Seine Lordschaft heute, wenn es die Bauern nicht gäbe? Wäre er nicht ebenfalls arm wie eine Kirchenmaus? Müsste er nicht selbst das Feld bestellen, die Kühe melken, die Schweineställe ausmisten?
Sie bog widerwillig vom Wege ab, hielt sich links und umkreiste das Schloss. Grau und unheilbringend stand das Gemäuer vor ihr. Mehrere Anbauten und Türme waren im Laufe der Jahrhunderte hinzugekommen. Als hätte jemand einen Krug zerbrochen und dann versucht, ihn wieder zu kitten - und war kläglich an dem Geduldsspiel gescheitert.
Das Gebilde erdrückte sie mit seinem Gewicht. Die schweren Wolken zogen schnell Richtung Atlantik, das Tosen des Meeres drohte wie ein aufziehendes Gewitter. Krachend brachen sich die Wellen an den Klippen. Jeden Moment konnten die Mauern auf sie niederstürzen. Kein Mensch war zu sehen, kein Vogel flog durch die Luft. Keine Möwe schrie. Selbst das Gras unter ihren Füßen erstarrte vor dem mächtigen Fels, den seine Bewohner Schloss nannten und der noch immer aussah wie eine Burg.
Feodora atmete noch einmal tief durch und ging, von der Wache unbehelligt, durch das kleinere Tor, das den Wirtschaftsbereich von dem Rest des Anwesens trennte. Von einem Moment zum anderen herrschte Leben hinter den Mauern. Aber was für ein Leben! Männer, Frauen und Kinder jeden Alters liefen geschäftig umher und verrichteten ihr Tagewerk. Gehetzt, ängstlich, unterdrückt. Niemand sprach ein Wort mehr, als er musste. Armselig war ihre Kleidung, schmutzig. Zwei alte Frauen steckten in Gewändern, die seit Monaten nicht mehr gewaschen worden waren. Ihre Schürzen erstarrten vor Dreck, die spärlichen, grauen Haare verfilzt, sie selbst so unreinlich wie ihre Gewänder. Die Kleidung der Kinder war unzählige Male geflickt, lieblos, flüchtig.
Kein Kinderlachen, keine Fröhlichkeit empfing Feodora, als sie über den großen Platz blickte und sich versuchte zu orientieren. Wo sollte sie hin? Wozu brauchte Seine Lordschaft so viele Bedienstete? Und warum kümmerte sich Seine Lordschaft nicht besser um seine Untertanen?
»Gott zum Gruße!« Ein blonder, junger Bursche stand plötzlich hinter ihr. »Bist du fremd hier?«
Feodora musterte ihn argwöhnisch. Er war nur wenig älter als sie, sein Lächeln wirkte freundlich und seine Frage ohne Hintergedanken. Um seine blauen Augen lag ein Hauch von Melancholie, was ihn älter wirken ließ. Auch seine Kleidung war die eines Bauern, abgenutzt, ausgebessert, aber sauber. Von ihm drohte offenbar keine Gefahr. Sie schluckte ihre derbe Antwort herunter.
»Suchst du Arbeit?« Er zeigte auf eine Tür, die in den niedrigen Wirtschaftstrakt nahe dem eigentlichen Schloss führte. »Dann musst du dort beim Verwalter nachfragen. Ich bin Kevin. Ich arbeite in den Stallungen.«
»Feodora«, stellte sie sich vor und gleichzeitig klar: »Und ich suche keine Arbeit - ich muss hier arbeiten!«
Er musterte sie genauer. »Bist du nicht schon ein wenig zu alt für deine ersten Dienstjahre? Oder ist deine Familie gerade erst zugezogen?«
Feodora warf die langen, schwarzen Haare zurück, musterte ihn ebenso ungeniert und entgegnete spitz: »Geht es dich irgendetwas an, wie alt ich bin, oder warst du nur zu lange unter Gäulen, um noch zu wissen, was sich gehört?«
Er lächelte verlegen. »Du hast Recht, verzeih. Soll ich dich begleiten?«
»Danke, das schaffe ich schon!«, schnaubte sie, raffte ihre Röcke zusammen und eilte über den schlammigen Erdboden zu der Tür, die er ihr gezeigt hatte. Sie spürte seine Blicke in ihrem Rücken. Bedauerte ihre ruppige Art, die an ihm sicher dem Falschen getroffen hatte.
Kevin blickte ihr ebenso hinterher, wie noch ihr Bruder vor ein paar Minuten, aber sein Interesse war ganz anderer Natur. Sie gefiel ihm. Sie war fast einen Kopf kleiner als er und sehr zierlich, graziös fast wie eine Fee. Der Name passte gut zu ihr. Aber beim Namen hörten die Ähnlichkeiten auf. Er nahm sich vor, ein Auge auf sie zu haben. Sie würde hier gewiss noch Schwierigkeiten mit ihrem vorlauten Mundwerk bekommen.
Feodora stockte der Schritt, je näher sie dem Gebäude kam. Das Dach musste dringend ausgebessert werden, die Fensterläden schlossen nicht richtig, ein paar klapperten im Wind. Die Mauern waren seit Jahren nicht mehr gekalkt worden. Gewiss, ihre Familie war arm, aber so heruntergekommen sah es bei ihnen zu Hause nicht aus.
Es widerstrebte Feodora, das düstere Gemäuer zu betreten, die nächsten Jahre hier zu verbringen. Mit jedem Schritt wurde ihre Angst größer, ihr Herz schlug bis zum Hals, das Blut dröhnte in ihren Ohren, ihre Hände waren schweißnass. Sie konnte kaum einen Fuß vor den anderen setzen. Der Lärm um sie herum verstummte, ihr Blickfeld verengte sich. Dieses dunkle Loch hinter der Tür war der Eingang zur Hölle. Sie wollte sich umdrehen und weglaufen, aber der Schlund zog sie hinein, hielt sie fest, ließ sie nie wieder los …
Feodora schüttelte die ungewohnt dunklen Empfindungen ab. Die Empörung kehrte zurück. Sie atmete noch einmal tief durch und klopfte an die Tür. Sie bekam eine kurze Antwort und trat ein. Der Raum war Arbeitsraum und zugleich Wohnraum des Verwalters. Im Gegensatz zum äußeren Zustand des Hauses blitzte hier jedoch alles vor Sauberkeit.
Die Möblierung war dennoch armselig: ein schäbiger Tisch, ein paar roh gezimmerte Stühle, eine verwitterte Truhe, ein Regal an der Wand für das wenige Geschirr, ein weiteres für Papier, Tinte und Feder. Ein gemauerter Herd, auf dem das Mittagessen köchelte und der gleichzeitig für ein wenig Wärme sorgte. Zwei kleine Fenster, die nicht einmal mit Glas bestückt waren. Dünne, gespannte Lederhäute schützten kaum vor der Kälte. Die Fensterläden nahmen das ohnehin spärliche Tageslicht.
Eine freundlich wirkende Frau, etwa so alt wie ihre Mutter, aber fülliger gebaut als diese, blickte ihr neugierig entgegen. Ihr dunkelblaues Gewand war schlicht, ihre weiße Schürze und Haube sauber. Sie sah müde aus. Wie jemand, der hatte aufgeben müssen, was er sich vor langer Zeit zum Ziel gesetzt hatte.
»Gott zum Gruße«, sagte Feodora mit brüchiger Stimme, »mein Vater, William Page, schickt mich. Ich muss meinen Dienst im Schloss antreten.«
Die Frau lächelte. »Bist schon ein wenig spät dran, Kind. Wie hast du es geschafft, dich so lange zu drücken?«
»Niemand zwang mich, hier zu erscheinen.«
»Gott zum Gruße, Kind. Ich bin Gwen Dorsley. Mein Mann, Owen, ist der Verwalter des Schlosses. Er wird dir auch sagen, was in Zukunft deine Arbeit ist.«
»Feodora. Meine Familie nennt mich Fee.« Sie versuchte, sich ihre Verwunderung nicht anmerken zu lassen, aber sie hatte ein wenig mehr Reichtum bei einem so hoch gestellten Bediensteten erwartet.
Gwen folgte ihren Blicken. »Wie du siehst, ist es hier auch nicht besser als anderswo. Wir müssen genauso hart arbeiten wie ihr Pächter. Das Leben ist nicht einfach im Schloss, Kind.«
»Das weiß ich auch«, erwiderte sie unwillig. »Aber alles in allem könnte es ein wenig fröhlicher sein! Und vielleicht auch ein wenig gerechter!«
Die Ältere lachte bitter auf. »Du scheinst ja eine Menge Fantasie zu haben! Glaubst du wirklich, nur weil unsere Herrschaften genug haben, würden sie auf den Gedanken kommen, uns armen Leuten etwas abzugeben? Was glaubst denn du, wie sie zu ihrem Reichtum gekommen sind?«
Feodora wurde wütend, weil diese Frau sie wie ein dummes Kind hinstellte. »Mir ist schon klar, wie sich die Welt bewegt! Aber im Gegensatz zu anderen gebe ich mich nicht so leicht mit meinem Schicksal zufrieden. Wenn ich die Möglichkeit habe, etwas an dem meinen oder an dem anderer zu verbessern, nutze ich sie, anstatt wie ein altes, zahnloses Weib über ein zähes Stück Fleisch zu jammern, wenn mich der Hunger quält!«
»Dann sei aber vorsichtig mit solchen Worten, wenn du in die Nähe der Herrschaften kommst«, hörte sie unerwartet eine tiefe Stimme hinter sich und drehte sich erschrocken um. Ein kräftiger, gedrungener Mann mit rötlichen Haaren und wettergegerbtem Gesicht stand hinter ihr. Das musste Owen, der Verwalter, sein.
Er musterte sie unverblümt. »Vielleicht sollte ich dir erst einmal eine Aufgabe zuweisen, wo du nicht Gefahr läufst, auch nur in Sichtweite der Herrschaften zu kommen, geschweige denn in Hörweite, bis du dich eingewöhnt hast.« Er wandte sich an seine Frau. »Sie ist eine richtige kleine Wildkatze, Gwen, denkst du nicht auch?«
Owen lachte ganz offen, Gwen lächelte mitleidig. Feodora kämpfte mühsam ihre Wut herunter.
»Nichts für ungut, Mädchen«, lenkte er ein, als er ihren Ärger bemerkte, »du wirst die nächsten fünf Jahre hier verbringen, ob du willst oder nicht. Es ist gut, wenn du dich sofort anpasst. Es erspart dir, deiner Familie - und auch mir - eine Menge Ärger.«
Feodora schwieg. Die Beiden konnten nichts für die Zustände hier. Aber dass sich alle stillschweigend fügten und ihr Schicksal so einfach hinnahmen, ärgerte sie maßlos.
Es ist so, wie es ist, hatte ihre Mutter noch heute Morgen zu ihr gesagt, und du wirst nichts daran ändern können, auch wenn du versuchst, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, Fee. Du holst dir nur Beulen oder brichst dir den Schädel, aber du kannst nichts ändern!
Oh, wie hasste Feodora diesen Satz! Ihr war es egal, wie viele Beulen sie sich einhandeln würde! Kein Wunder, dass die Zeiten nicht besser wurden, wenn niemand den Mut aufbrachte, etwas zu unternehmen!
Du als Mädchen hast dich da herauszuhalten!, war ein gern gesagter Satz ihres Vaters, und als sie ihm vor ein paar Jahren einmal antwortete: Dann tu du als Mann doch endlich etwas!, erhielt sie als Lohn eine schallende Ohrfeige. Erschrocken hatten sich beide angestarrt. Er hatte sie bis dahin noch nie geschlagen. Erst Jahre später verstand Feodora, dass er aus Hilflosigkeit so reagiert hatte. Weil ihr Vorwurf ihn traf und er glaubte, versagt zu haben. Doch er konnte nichts verändern. Er kämpfte jeden Tag aufs Neue um ihr Überleben, und sie wollte gar nicht wissen, wie viele Kuhhändel er schon in seinem Leben eingegangen war, um die Familie über Wasser zu halten.
In Zukunft musste sie das auch tun, erkannte sie plötzlich und fühlte Tränen in sich aufsteigen, fünf lange Jahre musste sie nach deren Pfeife tanzen, und sie konnte sich freuen, wenn sie nur harte Arbeit von ihr verlangten. Ihre Mutter hatte versucht, ihr schonend zu erklären, dass sie ihren freien Willen verlor, wenn sie ins Schloss ging. Schon manches junge Mädchen trat unschuldig in den Dienst und kam mit einem Kind zurück. Oder auch gar nicht. Feodora wollte deren Schicksal nicht teilen. Sie wollte die Jahre irgendwie ertragen und dann von hier verschwinden.
»Dann komm mit«, sagte Gwen und riss sie aus ihren Gedanken, »ich werde dir deine Unterkunft zeigen. Du teilst dir eine Kammer mit drei weiteren Mädchen im Haus der unverheirateten Frauen. Sei dankbar, dass ihr nur zu viert seid.«
»Wir sind neun zu Hause und haben auch nur zwei Räume. Ich bin kein verwöhntes oder dummes Gör«, entgegnete sie zornig.
»Dumm ist nicht nur der, der keine Ahnung hat«, wies Owen sie streng zurecht, »dumm ist auch der, der nicht weiß, wann er den Mund halten muss.«
»Aber dumm ist auch der, der ihn nur noch zum Essen benutzt«, schleuderte sie ihm entgegen und sah entsetzt, wie er zum Schlag ausholte. Im letzten Moment beherrschte er sich jedoch.
»Vergiss nicht, wen du vor dir hast«, warnte er leise, »es gibt hier Leute, die sich solche Widerworte nicht gefallen lassen. Ich sagte eben schon: Mache uns hier keinen Ärger!«
Feodora warf stolz die Haare zurück und erwiderte seinen Blick ohne Angst. So leicht konnte niemand ihren Willen brechen!
Owen seufzte und schüttelte nachsichtig den Kopf. »Du musst wirklich noch viel lernen. Fang am besten gleich damit an. Gwen, bring sie zu den anderen. Molly soll sie in der Wäscherei behalten. Dort kann sie sich mit harter Arbeit beschäftigen und hat hoffentlich keine Zeit mehr für ihre kindischen Flausen.«
Gwen zog Feodora mit sich fort, bevor diese wieder den Mund aufmachen konnte.
Sie gingen an Menschen vorbei, die im Gegensatz zu ihr genau wussten, wohin sie wollten, und nicht einen Blick für sie hatten. Stumpfe, trübe Augen, die viel zu viel gesehen hatten und viel zu viel ertragen mussten, blickten zu Boden. Einzig ein kleines Mädchen, vielleicht vier Jahre alt, ein hübsches Kind, wenn es denn nicht so verwahrlost gewesen wäre, starrte zu ihr hinauf. Scheu ließ sie ihre schmutzige Hand über Feodoras Gewand gleiten, als hätte sie noch sie etwas so Schönes gesehen wie das saubere, einfache Kleid eines Bauernmädchens.
Feodora schämte sich plötzlich, ein Kloß schnürte ihr die Kehle zu. Sie schluckte ihn wie die Tränen hinunter und folgte Gwen, die hinüber zu einem größeren Gebäude eilte. Als Feodora sich noch einmal umdrehte, war das kleine Mädchen in der Menge verschwunden.
Im Haus der unverheirateten Frauen zählte sie zehn Kammern. Und wenn sie selbst nur eine kleine hatte, mussten wohl an die fünfzig Mädchen hier ihren Dienst verrichten.
»Hier wirst du schlafen, Feodora.« Gwen öffnete eine Tür. »Und wenn ich dir einen guten Rat geben darf: Hetze mir die anderen Mädchen nicht auf. Wir werden nicht dulden, dass du uns hier alle rebellisch machst. Es passiert nur selten, aber Owen hat das Recht, dich zu bestrafen - und die Peitsche ist noch die mildeste Strafe. Vergiss das nie!«
Feodora schwieg trotzig. Sie warf ihr Bündel auf das Lager und folgte Gwen quer über den Platz. Schon von weitem roch sie die Seife, den Geruch nach Schweiß und Ausscheidungen, Mist von Schweinen, Kühen und Pferden, die gleich nebenan in den Ställen untergebracht waren. Der Dampf des heißen Wassers schlug ihr ins Gesicht, als sie durch das offene Tor traten.
Etwa zwanzig Frauen arbeiteten hier. Sie trugen nur ihre Unterkleider, schoben sich immer wieder die nassen, wirren Haare aus dem Gesicht, hatten die Röcke hochgebunden. Einige standen mit nackten Beinen in der Lauge, sie schenkten ihr kaum einen Blick. Eine unglaublich dicke Matrone, im gleichen dunkelblauen Gewand wie Gwen, schimpfte mit einigen Mädchen, die nicht schnell genug arbeiteten. Als sie Gwen sah, verstummte sie.
»Dies hier ist Feodora Page, Molly. Sie steht ab heute in Diensten. Owen will, dass sie die nächste Zeit bei dir arbeitet. Feodora, dies ist Molly Muldun. Sie leitet nicht nur die Wäscherei, sondern hat auch die Aufsicht über die unverheirateten Frauen. Ihr Wort ist Gesetz. Also, folge ihren Anweisungen, dann wirst du keine Schwierigkeiten haben.«
Gwen drehte sich um und ließ sie zurück. Nachdenklich blickte Feodora ihr hinterher, bis Mollys laute Stimme sie aufschreckte.
»So, du bist also die Neue! Wir haben ja schon einiges von dir gehört. Du scheinst dich wohl für eine feine Dame zu halten, wenn du erst jetzt kommst. Aber hier gibt es keine Ausnahmen, schreibe dir das hinter die Ohren! Hier wird hart gearbeitet!«
Sie zeigte auf die verschieden, riesigen Bottiche und ebenso großen Wäschehaufen. »Erst kommt die Wäsche der Herrschaften, dann die der Bediensteten, die im Schloss arbeiten. Dann die, die auch noch Berührung mit den Herrschaften haben könnten, dann die derer aus der Küche und, wenn dann noch Zeit ist, unsere und die des anderen niederen Volkes.«
Sie blickte Feodora abschätzend an. »Hier bist du das Letzte, Mädchen! Noch tiefer kann man nicht sinken. Im Sommer wirst du dir die Seele aus dem Leib schwitzen, aber im Winter freust du dich, weil du ein warmes Plätzchen ergattert hast.«
Feodora hatte tausend Worte auf der Zunge. Für jedes Wort dieser Molly Muldun hätte sie hundert Erwiderungen hervorbringen können - aber was brachte es ihr? Sie fügte sich. Was sollte sie auch sonst tun?
In der Gegenwart …
Maja beobachtete David, während er Seite um Seite las. Sie wünschte, es wäre heller Tag gewesen. Ob es im Wirtschaftshof noch genauso aussah, wie sie es beschrieben hatte? Hier im Schloss schien die Zeit jedenfalls stillzustehen.
Eine zierliche Kaminuhr aus schwarzem Ebenholz mit goldenen römischen Ziffern, sie stand auf einem der Tischchen, zeigte auf drei Minuten vor acht. Die Zeiger bewegten sich langsam. Rückwärts. Maja starrte sie an, glaubte ihren Augen nicht zu trauen. Unaufhaltsam liefen sie zurück, schneller und schneller, ließen ihr den Atem stocken. Ihre Finger krampften sich um die Lehnen des Stuhls, der so unbequem war wie das Leben damals. Gerade und stocksteif darauf sitzen, Bewegung war Widerstand, verursachte unerträgliche Schmerzen. Stillsitzen. Stillstehen. Keine Veränderungen zulassen. Die Verhältnisse hinnehmen. Sein Schicksal annehmen. War es ihr Schicksal, dass sie hier auf diesem harten Stuhl saß und den Blick nicht von der Uhr abwenden konnte?
»Sie haben bereits zwei Namen genannt, die mir geläufig sind. Woher kennen Sie diese?«
Davids Stimme schreckte sie auf. Mühsam riss sie den Blick von der Uhr und atmete tief durch. »Ich sagte doch, ich weiß es nicht. Sie waren einfach in meinem Kopf.«
»Irgendwer muss Ihnen aber doch die Informationen geliefert haben. Bilder, Daten, Namen.«
Er war misstrauisch. Maja schüttelte nur den Kopf. Was sie auch sagte, nichts konnte ihn überzeugen. Nur die Geschichte selbst konnte es, wenn es denn mehr als eine Geschichte war. Die Geschichte selbst. Die Vergangenheit. David musste sich ihr ebenso stellen wie sie. Er war ein Teil von ihr.
»Ist das Ihr erstes Buch?«, fragte er.
»Das erste dieser Art, ja. Ich beschränke mich sonst auf Dinge, von denen ich etwas verstehe, die ich wenigstens begreifen kann. Bisher wurden meine Bücher allerdings nur im deutschsprachigen Raum veröffentlicht, vielleicht ist Ihnen mein Name daher nicht geläufig.«
Sie stand auf, drückte das schmerzende Kreuz durch und ging zu dem Bild. Gleich daneben hing ein Gemälde von Feodora. Maja strich mit der Hand sachte über das Gesicht, das ihr so vertraut war, fühlte den harten Pinselstrich, aber nichts sonst.
»Was halten Sie davon?«, fragte David hinter ihr.
»Es spricht nicht. Es ist nur ein Abbild. Dem Maler ist es nicht gelungen, etwas von ihrem Wesen einzufangen. Es zeigt nur eine schöne, junge Frau. Viel zu wenig. Aber er wusste es nicht besser. Er hat getan, was er konnte.«
Maja wandte sich ab, erwiderte seinen fragenden Blick nur zögernd und suchte sich einen üppig gepolsterten Sessel, der bequemer war und den Blick auf die Uhr versperrte, die jetzt kurz nach acht zeigte. »Lesen Sie weiter, dann verstehen Sie, was ich damit sagen will.«
Wortlos setzte er sich wieder und nahm das Manuskript.
Maja studierte sein Profil, die gerade Nase, das schmale Kinn, die kerzengerade Haltung, die sie an jemand anderen erinnerte. Vermutlich würde David sich auf dem Stuhl wohler fühlen, auf dem sie gerade noch gesessen hatte. Was für ein Mensch war er? Hatte sich der Charakter ebenso wie das Aussehen vererbt? Musste sie sich ebenso vor ihm fürchten, wie Feodora und all die anderen sich vor seinem Vorfahren gefürchtet hatten?
Februar 1684 …
Wie Molly es ihr prophezeit hatte, freute sich Feodora über den warmen Platz in der Wäscherei. Lange war der Winter nicht so eisig gewesen. Obwohl die Unterkünfte vor Jahren erneuert und auch Kamine gebaut worden waren, durften sie kein Feuer machen.
Tagsüber haben sich die Untertanen warm zu arbeiten und nachts sollen sie sich gefälligst unter ihren Decken verkriechen, lautete die Anordnung Seiner Lordschaft, des Grafen Winston Liondale.
Fast fünf Monate arbeitete Feodora nun schon hier. Sie kamen ihr vor wie eine Ewigkeit. Sie hatte sich an die Bedingungen gewöhnt, aber billigen konnte sie diese nicht. Immerhin hatte sie gelernt, ihren Mund zu halten und sich lieber ihren Teil zu denken. Ihre Mutter wäre stolz auf sie gewesen, schafften andere doch das, wobei sie glaubte, versagt zu haben. Aber das lag an der unterschiedlichen Vorgehensweise - und der ständigen Furcht, die allen hier im Genick saß.
Einige Male geriet sie mit Molly aneinander, bis sie verstand, dass ihre herrschsüchtige Art nur die mütterlichen Gefühle überdeckte, die Molly für ihre Schutzbefohlenen hegte. Sie selbst hatte keine Familie mehr. Ihr Mann war in der letzten kriegerischen Auseinandersetzung gefallen und ihr kleiner Sohn starb bereits mit zwei Jahren am Fieber. Molly Mulduns Schicksal hatte Feodora betroffen gemacht. Sie wollte es ihr nicht schwerer machen, als die Witwe es ohnehin schon hatte.
Die jüngeren Mädchen in der Wäscherei mieden Feodora. Sie hatten Angst vor ihr, vor ihren Ansichten. Sie waren wie die meisten Menschen ihrer Zeit, machten sich keine Gedanken um sich oder die Welt außerhalb des Schlosses. Ob die Zustände so sein mussten, wie sie waren. Ob es anderswo besser war. Sie lebten, sie arbeiteten. Das Denken überließen sie dem Adel und der Kirche. Alles andere machte ihnen Angst.
Es dauerte Wochen, bis Feodora den Anblick der Kinder ertragen konnte. Sie redete auf die Mütter ein, bis die ihr deren Kleidung gaben, wusch und besserte sie nachts aus, wenn alle anderen Frauen in ihren Kammern waren. Sie war erst zufrieden, als das letzte Kind unter zehn Jahren halbwegs anständig gekleidet war. Feodora hätte gerne mehr getan, aber ihre Zeit ließ es nicht zu.
Nicht immer stieß sie auf Verständnis. Die Menschen hatten Angst. Um ihre Kinder. Um ihre Töchter. Besonders um die älteren. Ihnen stand das gleiche Los bevor wie Feodora. Der Ruf ins Schloss. Sie wusste inzwischen, was er bedeutete, und betete, dass er sie niemals erreichen würde.
Molly schüttelte über Feodoras Bemühungen nur den Kopf, aber sie ließ sie gewähren. Alleinige Unterstützung bekam sie von Kevin. Er war inzwischen der große Bruder für sie, den Feodora nicht hatte. Kevin hielt sie zurück, wenn sie den Mund wieder einmal zu weit aufmachte, und stand ihr zur Seite, wenn andere Streit suchten. Seine ruhige, besonnene Art brachte ihm trotz seiner jungen Jahre Achtung ein. Die Menschen hier vertrauten ihm. Auch Feodora tat das.
Ihr stand der Schweiß auf der Stirn. Sie hatte sich die Röcke hochgebunden, die Haare straff im Nacken geknotet, damit sie ihr nicht ständig ins Gesicht fielen, und kämpfte mit den Flecken auf der vornehmen, schwarzen Männerhose. Wieder und wieder rieb sie den Stoff erst mit Seife ein und dann über das Waschbrett.
Molly blickte ihr über die Schulter. »Den wirst du nicht herausbekommen, Fee. Gib die Hose zu den anderen ausgesonderten Kleidungsstücken. Einer der Bediensteten im Schloss wird sie bekommen.«
Feodora blickte Molly ärgerlich an. »Das ist das vierte Beinkleid in dieser Woche! Ich selbst besitze nur zwei Gewänder, die Menschen hier manchmal nur das, was sie am Leib tragen! Wie kann man nur so sorglos mit seinen Sachen umgehen?«
»Sprich gefälligst leiser!« Molly blickte sich besorgt um. »Es gibt Leute, die nur zu gerne solche Äußerungen hinüber ins Haus tragen. Du hast dir in den letzten Monaten nicht nur Freunde gemacht.«
»Aber es stimmt doch«, wütete Feodora weiter, wenn auch deutlich leiser. »Ich würde diesem Burschen zu gerne einmal die Meinung sagen. Nur leider gibt man mir keine Gelegenheit.«
Einmal jedoch hatte es diese gegeben, ein paar Tage nach ihrer Ankunft. Sie war auf dem Weg von der Wäscherei in ihre Unterkunft gewesen, als der junge Graf, Randolf Liondale, Feodora fast über den Haufen ritt. Sie konnte gerade noch zurückweichen, stolperte - und landete mit der Kehrseite zuerst in einer großen Pfütze. Er hielt sein Pferd, lachte und meinte, nun wären sie wohl quitt. Feodora rappelte sich auf, versuchte wenigstens den größten Teil des Wassers aus ihrem Rock zu drücken, und bedachte ihn mit wütenden Blicken. Demütig war sie sicher nicht, aber den Mund aufzumachen, wagte sie auch nicht mehr, jetzt, wo sie wusste, wer er war.
»Vielleicht geht dein Wunsch schneller in Erfüllung, als dir lieb ist«, sagte Molly leise. »Owen war gerade bei mir. Du sollst ins Schloss.«
Feodora erstarrte mitten in der Bewegung. »Nein! Bitte nicht, Molly!«, flüsterte sie kaum hörbar.
»Es tut mir leid, Fee«, sagte Molly traurig, »ich kann den Befehl nicht übergehen. Lasse den Kopf nicht hängen und mache das Beste daraus. Du wirst es schon schaffen.«
»Wann?«
»Packe am besten gleich dein Zeug zusammen und gehe zu Owen.« Molly strich ihr scheu über die Wange.
Feodora wischte sich die nassen Hände an ihren Röcken ab und fiel der Älteren um den Hals. »Danke für alles, Molly. Kümmere dich bitte um die Kinder. Vielleicht sind ein paar der Mädchen bereit, sich die Arbeit zu teilen. Sie lohnt sich, glaube es mir!«
»Ich versuche es. Geh schon, Fee.« Molly unterdrückte ihre Rührung und schob sie von sich, wischte sich verlegen eine Träne weg und herrschte gleich darauf ein paar andere Mädchen an, die mit der Arbeit innegehalten hatten und neugierig zu ihnen hinüber sahen. »Was faulenzt ihr hier herum? Habt ihr keine Arbeit mehr? Ich werde euch Beine machen, ihr faules Gesindel! Los, bewegt euch!«
Feodora lief in ihre kleine Kammer, richtete ihr Äußeres und packte ihre wenigen Habseligkeiten zusammen. Sie musste sich beschäftigen, sie durfte nicht nachdenken, denn dann kam zu der Angst die Wut und die konnte sie jetzt gar nicht gebrauchen.
Sie atmete tief durch, wischte sich das Gesicht trocken und lief durch die Kälte zum Haus des Verwalters und schlüpfte schnell durch die Tür, bevor die Wärme das Haus verließ. Wenigstens hier durfte geheizt werden und manch einer stahl sich für ein paar Minuten unter einem Vorwand von der Arbeit, um sich aufzuwärmen.
Gwen und Owen hatten keine Kinder. Sie waren strenge, aber herzensgute Menschen, die sich um ihre Untergebenen kümmerten, so gut es ihnen eben möglich war.
»Gott zum Gruße, Gwen.« Feodora kämpfte die Tränen herunter. »Owen wollte mich sehen?«
Gwen blickte sie mitfühlend an. »Dir auch, Fee. Er kommt gleich wieder. Es war nicht unser Gedanke, Kind, glaube mir bitte.«
Feodora lächelte verzagt. »Das weiß ich doch, Gwen. Ich wünschte nur, ich hätte noch einmal meine Familie sehen können.«
Nur selten bekamen sie Ausgang. Weihnachten war eine dieser Ausnahmen gewesen. Für ein paar Stunden hatte sie zu ihrer Familie gedurft, um mit ihnen zu feiern. Aber es wurde keine Feier, es wurde nur ein trauriges Wiedersehen, welches viel zu schnell vorbei gewesen war.
»Ich war selbst überrascht, als ich von der Anordnung des jungen Herrn hörte«, sagte Gwen.
Feodora verzog das Gesicht. »Es wundert mich, dass es so lange gedauert hat.«
»Kennst du den jungen Grafen etwa?«
»Kennen wäre zu viel gesagt«, meinte sie bitter, »ich traf ihn einmal - mit einem Steinchen auf dem nackten Hintern, als er bei uns im Weiher baden wollte. Allerdings war das keine Absicht und ich wusste auch nicht, wen ich vor mir hatte. Nackt sieht man einem Mann nicht an, ob er ein einfacher Bauer oder ein hochwohlgeborener Graf ist!«
Sie hatte sehr gehofft, dass er zu den Bauern gehörte. Er gefiel ihr. Sehr sogar. Er war keiner von diesen unreifen Burschen, die sich bisher um sie bemüht hatten. Ihr Vater hatte ihr die Hoffnung gleich wieder genommen, als er ihr sagte, wer der Mann war. Am nächsten Tag kam der Befehl.
Gwen blickte sie vorwurfsvoll an.
Feodora zuckte mit den Schultern. »Wenn ich allerdings auch nur geahnt hätte, wer er ist, wäre ich gelaufen, so schnell ich kann, statt mich auch noch über ihn lustig zu machen, weil er vor Schreck ins Wasser plumpste.«
Sie hatte sogar mit dem Gedanken gespielt, seine Kleidung irgendwo zu verstecken und das Pferd loszubinden, aber sie war froh, dass sie es nicht getan hatte.
Gwen schlug vor Überraschung die Hand auf den Mund. »Deswegen bist du doch noch hier!«
»Bis dahin war es den Herrschaften wohl entgangen, dass ich die älteste Tochter der Familie Page bin. Auch wenn ich nicht weiß, wie er herausbekommen hat, wer ich bin.« Bestürzt blickte Feodora auf. »Oh, Gwen! Was soll erst in vier Jahren geschehen, wenn meine jüngere Schwester hierher muss? Ich darf gar nicht daran denken!«
»Bis dahin wird noch viel Wasser ins Meer zurück laufen, Kind. Wer weiß, ob der alte Herr dann noch das Sagen hat. Wenn er nicht mehr ist, kann es nur besser werden.« Gwen bot ihr einen Becher Hagebutten-Tee an und setzte sich.
»Was weißt du eigentlich über den jungen Grafen?« Feodora setzte sich zu ihr.
Gwen zuckte die Schultern. »Nicht allzu viel. Es wird viel gemunkelt. Einige Male habe ich ihn gesehen. Durch Owen erfahre ich dann ab und zu Neuigkeiten aus dem Schloss.«
Feodora legte ihr die Hand auf den Arm. »Erzähle mir bitte alles, was du von der Familie weißt, Gwen, egal ob Gerücht oder Wahrheit. Ich muss wissen, was mich erwartet.«
Gwen musterte sie nachdenklich. Dann nickte sie. »Das sollte ich wohl tun. Je mehr zu weißt, desto … desto sicherer ist es für dich. Der alte Graf Liondale ist ein grausamer und herzloser Herrscher, Fee, du brauchst dich hier ja nur einmal umzusehen. Aber das hast du ja bereits getan. Früher war es einmal anders. Ich kann mich noch an bessere Zeiten erinnern, als ich ein Kind war. Sein einziger ehelicher Sohn soll anders sein, aber er lässt ihn nicht an die Macht. Ob es der junge Graf nach seinem Tod besser macht, oder ob auch er durch den Fluch verbittert, weiß nur Gott allein.«
Feodora runzelte die Stirn. »Was für ein Fluch?«
»Hast du etwa noch nie davon gehört?«, fragte Gwen erstaunt.
Feodora schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht an solche Ammenmärchen!«
»Das solltest du aber. Vor langer Zeit, noch zu Zeiten von Richard Löwenherz soll es gewesen sein, als ein Vorfahre des Grafen mit Hilfe eines Zauberers in den Besitz von zwei Schmuckstücken kam, die ihm Macht und Reichtum bringen sollten. Mit ihrer Hilfe konnte er die Gunst des Königs gewinnen und kam zu seinem Namen: Liondale - Tal des Löwen. König Richard gab ihm dieses Lehen und er baute seine Burg nahe der Klippe. Seit jener Zeit soll alle Macht der Familie aus diesen Ringen kommen. Nur wenn diese bei der Trauung auch getauscht werden, bleibt der Familie ihre Macht und ihr Reichtum erhalten. Sie müssen ständig getragen werden, dürfen nie verloren gehen oder getrennt werden, sonst besiegelt der Tod den Treuebruch und der andere verliert seine Menschlichkeit.«
Feodora schüttelte den Kopf. »Glaubst du etwa an diesen Unsinn?«
Gwen blickte sich unsicher um, als könnte einer der Toten aus ihrer Geschichte sie hören. »Vielleicht. In jeder Geschichte steckt ein Körnchen Wahrheit, Fee. In der Vergangenheit sind viele merkwürdige Sachen passiert. Als der alte Graf heiratete, war er noch ein ganz anderer Mensch. Freundlich und gütig. Ein guter Herrscher. Aber seine Frau starb bei der Geburt des Sohnes. Ihre Hände waren durch die Schwangerschaft so stark geschwollen, dass sie den Ring abnahm, bevor er ihr den Finger abschnüren konnte, und das war ihr Tod. Der Graf hat nie wieder geheiratet. Er wurde zornig, verbittert und ein Tyrann. Niemals haben die Menschen so unter der Herrschaft gelitten wie in den letzten dreißig Jahren unter ihm.«
Feodora schüttelte erneut den Kopf und trank ihren Tee. »Aber es ist doch auch vorstellbar, dass er seine Frau so sehr geliebt hat, dass er ihren Tod nicht verwinden konnte.«
»Ich beneide dich um deine Unbedarftheit und deinen Glauben an die Liebe, Fee«, meinte Gwen. »Wenn du einen Menschen so bedingungslos lieben würdest, wie würdest du dich nach seinem Tode verhalten? Warum, glaubst du, sind nur junge, hübsche Mädchen im Schloss und kommen manchmal schnell, manchmal aber auch gar nicht wieder? Denkst du wirklich, der junge Graf hat so einen Verschleiß an Weibern?«
Feodora wurde blass. »Der alte …? Ich dachte immer …«
»Siehe dich vor!«, warnte Gwen nachdrücklich. «Gehe ihm aus dem Weg! Vermeide alles, ihm aufzufallen! Niemand weiß, was mit den Mädchen geschah, die nicht wiederkamen. Nicht einmal die Bediensteten im Haus. Oder aber sie schweigen aus Angst. Viele der anderen haben jetzt einen Balg am Hals, manche den Verstand verloren. Du kennst das Haus im Dorf, dorthin, wo deine Mutter dich sicher nie gehen lassen wollte. Wer, glaubst du, lebt dort?«
Natürlich kannte Feodora das alte Haus, etwas außerhalb des Dorfes, von dem Gwen sprach. Sie hatte die verwirrten Menschen bemitleidet, ihnen manchmal, wenn sie es entbehren konnten, Essen gesandt, aber sie hatte nie erfahren können, warum sie krank waren.
»Warum tut denn niemand etwas dagegen? Warum schaltet niemand die Obrigkeit ein?«, rief sie aufgebracht aus.
»Weil es sich bei uns nur um arme Leute handelt, Feodora«, entgegnete Gwen sanft, »weil diese Familie viel zu viel Einfluss hat und weil der Fluch sie beschützt. Niemand würde uns glauben. Und auch du tust gut daran, den Mund zu halten.«
Feodora atmete tief durch. Ärger stieg in ihr auf, Zorn, doch sie kämpfte ihn herunter. Sie musste einen klaren Kopf behalten. »Was weißt du noch über den Fluch?«
»Der alte Graf war nicht der Erste, der für seinen Reichtum bezahlen musste. Meine Großmutter erzählte immer eine Geschichte: Eines Tages, nachdem der damalige Graf geheiratet hatte, verließ ihn dessen Frau wegen eines anderen Ritters, mit dem Ring. Er ließ sie ziehen, denn er hatte, was er wollte - ihr Vermögen. Doch es dauerte nicht lange, bis die Ernte auf den Feldern verfaulte, das Vieh starb und die Menschen der Umgebung von einer Seuche befallen wurden. Auch er glaubte nicht an die Macht des Fluches. Erst als er selber unter der Seuche litt, versuchte er wenigstens den Ring wiederzubeschaffen, wenn ihm auch die Frau nichts bedeutete, und so ließ er sie jagen. Sie fanden die Gräfin und brachten sie zurück, nachdem die Wachen ihren Geliebten getötet hatten.«
»Was ist dann passiert?«
»Meine Großmutter erzählte, die Gräfin weigerte sich, den Ring herauszugeben. Sie forderte einen Ausgleich für ihren Besitz, aber der Graf, inzwischen verbittert und gierig wie der unsrige, verwehrte ihr das. Er ließ er sie wegen Ehebruchs hinrichten und nahm den Ring wieder in seinen Besitz. Am nächsten Tag soll sich die gesamte Bevölkerung wie durch ein Wunder erholt haben, auf den Feldern wuchs das Getreide so gut wie seit Jahren nicht mehr und das restliche Vieh bekam mehr Nachwuchs als sonst. Nur der Graf wurde nie wieder der Alte. Du kannst den Geistlichen fragen, es steht in den alten Dorfchroniken, die er unter Verschluss hat. Glaubst du jetzt an den Fluch, Fee? Warum denkst du, werden die Leute hier nicht krank, obwohl sie in all dem Dreck und Elend leben? Das, was du für die Kinder getan hast, hätten auch die Mütter selbst tun können. Warum tun sie es nicht? Vielleicht ist es für den Grafen kein Fluch, aber für uns arme Leute allemal!«
Feodora glaubte nicht daran, versprach aber dennoch vorsichtig zu sein.
Owen brachte sie etwas später hinüber ins Schloss. Feodora sah das Unbehagen in seinen Augen, genauso wie die stumme Bitte um Verzeihung.
»Grüße Kevin von mir, Owen. Ich konnte mich nicht einmal verabschieden. Sage ihm, ich werde ihm keinen Kummer machen. Und er soll auf die Kinder achten.«
Er nickte nur und öffnete eine kleine, fast versteckte Tür ins eigentliche Schloss.
Eine alte Frau, unglaublich groß und spindeldürr, mit einer Adlernase in dem hoch erhobenen Gesicht, erwartete sie bereits. Sie trug ein schwarzes Gewand, das bei jeder Bewegung wie trockenes Herbstlaub raschelte. Die kostbare, ebenfalls schwarze Haube aus edler Spitze verbarg noch nachtschwarze Haare. Sie trug keine Schürze, gehörte somit nicht zur niederen Dienerschaft. Sie hielt sich kerzengerade und in der Hand eine brennende Fackel. Das flackernde Licht verlieh ihr etwas Dämonisches.
So ähnlich muss die Verwandtschaft des Teufels aussehen, grauste es Feodora. Sie schüttelte sich. Es war kalt in dem Gang und bis auf den Schein dieser Fackel stockfinster.
»Madam Raven, die Hausdame - Feodora Page.« Owen verbeugte sich untertänig. »Ich soll sie auf Geheiß des jungen Grafen hinüber bringen.«
Die Alte nickte, stolzierte um Feodora herum und musterte sie wie ein Stück Vieh.
»Du kannst gehen, Owen.« Sie entließ ihn gnädig mit einer lästigen Handbewegung und verlangte von Feodora mit einer eben solchen, ihr zu folgen.
Feodora drehte sich noch einmal hilfesuchend nach Owen um, doch der blickte sie nur ermunternd an. Zögernd folgte sie schließlich der Alten.
Karg, düster und kalt wie alles, was sie bisher vom Schloss gesehen hatte, erschloss sich der lange, verwinkelte Gang vor ihr. Kein Fenster schenkte dem niedrigen Weg ein wenig Helligkeit. Auf den schmalen, unregelmäßigen, aus Stein gehauenen Stufen der Treppe musste sich Feodora vorsichtig voran tasten, weil sie ihre eigenen Füße nicht sehen konnte.
Nach einigen Minuten verließen sie die Irrgänge. Durch eine Tür kamen sie in einen Flur, der nur durch ein einziges schmales und vergittertes Fenster weit über ihren Köpfen erhellt wurde. Vor einer der vielen Türen blieb Madam Raven abrupt stehen und stieß sie auf. Feodora blickte in eine winzig kleine Kammer mit drei bescheidenen Lagern, einem alten Hocker mit einer Waschschüssel, einer polierten Metallplatte als Spiegel an der Wand und einem kleinen Loch, das die Bezeichnung Fenster nicht verdient hatte. Eine kleine Truhe musste für die wenige Habe der drei Mädchen reichen. Eine halb herunter gebrannte Kerze wirkte genauso trostlos wie Feodora sich hier bereits jetzt fühlte. Es gab nicht einmal eine Möglichkeit, für ein wenig Wärme zu sorgen.
»Hier wirst du schlafen, wenn die Herrschaften nicht nach dir verlangen. Zurzeit brauchst du dir die Kammer nicht zu teilen, aber hüte dich davor, die anderen zu betreten«, erklärte die Alte barsch. »Dort auf dem Bett liegen deine neuen Gewänder. Gehe sorgsam mit ihnen um und halte dich stets sauber.«
Feodora unterdrückte die passenden Worte. Sie nickte nur. Hier war es noch wichtiger, den Mund zu halten, als drüben in der Wäscherei.
»Wasche dich und dann ziehe dich um«, verlangte Madam Raven.
Feodora sortierte die Kleider. Der dunkelblaue Stoff des Gewandes war verwaschen, sie hatte viele davon in der Wäscherei gesehen. Sie fand zwei Kleider, ebenso die passende Unterkleidung, und unterdrückte die Frage, was aus dem Mädchen geworden war, das diese Sachen vor ihr getragen hatte.
Die Alte machte keine Anstalten, sie alleine zu lassen, und so tat Feodora, wie ihr geheißen, während die andere sie musterte. Als sie fertig war, nickte Madame Raven zufrieden.
»Komm mit!«, verlangte sie.
Wieder folgte ihr Feodora quer durch das Schloss. Doch bald verließen sie die dunklen Gänge und kamen in eine Halle, die auch die Bewohner nutzten. Gleich wurde es heller. Die Sonne ließ einen großen Engel in dem riesigen Bleiglasfenster oberhalb der großen Treppe leuchten. Doch er konnte weder Wärme noch Hoffnung verbreiten.
Einige kunstvoll gearbeitete Wandteppiche, einer davon mit dem Familienwappen, einem gewaltigen Löwen, der drohend auf den Klippen stand und das Meer anbrüllte, hingen an den nackten, grauen, aus Felssteinen gemauerten Wänden. Drei große Leuchter in Form von Wagenrädern baumelten an dicken Ketten unter der Decke. Hier und da stand eine Holztruhe.
Unzählige Türen zweigten von den Gängen ab, die der Halle auf beiden Seiten folgten. Auf ihrer Seite standen in Rufweite zueinander Wachen in dunklen Nischen reglos herum. Ihre wachsamen Blicke folgten ihnen. Feodora schüttelte sich. Eiskalte Schauer liefen ihr über den Rücken. Sie richtete ihre Aufmerksamkeit darauf, den Rückweg in ihre Kammer zu finden.
Vor einer Tür wie vielen anderen auch blieb Madam Raven stehen, musterte Feodora noch einmal prüfend, war offenbar zufrieden und klopfte.
»Herein!«
Eine dunkle Männerstimme antwortete ebenso barsch, wie die Alte mit ihr sprach. Feodora betete, dass das nicht der alte Graf war. Madam Raven schob sie in den Raum hinein, gleich darauf sah sie sich dem jungen Grafen Liondale gegenüber. Vor Erleichterung seufzte sie laut auf. Er stand vor dem mittleren der drei großen Fenster, die seinem Gemach die nötige Helligkeit gaben, und blickte hinaus. Die Wintersonne stand tief und blendete sie. Feodora konnte kaum mehr als seinen Schattenriss erkennen, doch er deckte sich mit dem Bild aus ihrer Erinnerung.
»Dies ist Feodora Page, junger Herr.«
Feodora bemerkte zu ihrem Erstaunen, wie untertänig die Alte in Gegenwart der Herrschaften doch sein konnte.
»Danke, Maggie, du kannst gehen. Ich brauche dich nicht mehr.«
»Wie der junge Herr wünscht.« Madam Raven knickste tief und schloss leise die Tür hinter sich.
Feodora fühlte ihr Herz bis zum Halse klopfen. Doch es war keine Angst, die sie hatte. Graf Randolf Liondale kam aus dem Licht auf sie zu. Feodora trat einen Schritt beiseite, damit die Sonne sie nicht mehr blenden konnte. Er blieb einen Schritt vor ihr stehen und sah auf sie herunter.
»So, so … du bist also diejenige, die mich damals so unfreundlich ins Wasser geschickt hat.«
»Baden wollten Eure Lordschaft doch sowieso«, fauchte sie zurück.
Er lachte und musterte sie ungeniert von Kopf bis Fuß. Feodora tat es ihm gleich, nur blieb sie auf dem Fleck stehen, während er langsam um sie herum ging. Er musste ein Nachfahre der legendären Nordmänner sein. Er war über einen Kopf größer als Feodora und sehr stattlich. Die hellblauen Augen und blonden, halblangen Haare unterstrichen noch den Eindruck seiner Abstammung. Er verzichtete auf die stutzerhafte Kleidung seines Standes, trug ein einfaches weißes Hemd ohne Rüschen und hellbraune Beinkleider. Feodora fragte sich plötzlich, wessen Hosen sie nicht wieder sauber bekommen hatte. Ihm wären sie mit Sicherheit viel zu klein gewesen.
»Und du ahntest natürlich nicht, wen du vor dir hast«, höhnte er und blieb dicht vor ihr stehen.
Feodora kämpfte die aufsteigende Wut herunter. »Nein. Hätte ich es gewusst, hätte ich Euer Lordschaft sicher nicht gestört. Ich wäre ganz still und leise vorbei gelaufen, in der Hoffnung, Ihr würdet mich nicht bemerken.«
Er lachte erneut. Es klang bitter. »Dann bist du die erste Frau, die nicht glaubt, sich einen Vorteil aus meinem Interesse verschaffen zu können.«
Sie warf die Haare zurück. Ihr Blick sprühte Funken. »Dann bin ich eben die erste, Graf! Und ich hoffe bei Gott, ich bin nicht die letzte!«
Er blickte zu ihr herunter und musterte sie erneut, doch beschränkte er sich diesmal auf ihr Gesicht. Sie hatte keine Ahnung, was er tun würde, aber sie blickte auf seinen Mund und dachte an die Begegnung am Weiher. Verwirrt versuchte sie, sich den Gedanken gleich wieder aus dem Kopf zu schlagen, und senkte den Blick.
»Du siehst aus wie eine kleine dunkle Fee, aber du benimmst dich wie eine Wildkatze. Ich bin neugierig, wonach du ansonsten schlägst«, sagte er leise und suchte ihren Blick.
»Versucht es besser nicht, Graf«, zischte sie und hielt ihm mühsam stand. »Die Wildkatze weiß sich zu wehren, und sie wird ihre Ehre ebenso wie ihr Leben verteidigen!«
Respekt blitzte kurz in seinen Augen auf. »Es passiert nicht oft, dass es jemand wagt, mir zu widersprechen. Du gefällst mir. Du wirst in Zukunft für mein Wohl sorgen.«
Er sah den Ärger in ihren Augen und lachte anzüglich. »Nein, das meinte ich nicht. Noch nicht. Du wirst mir das Essen bringen und mein Zimmer aufräumen und mir auch ansonsten zur Hand gehen. Alles Weitere wird sich finden.«
Er rührte sich nicht von der Stelle. Feodora kämpfte mit sich, aber sie hielt seinen Blicken stand. Stumm standen sie sich gegenüber. Eine Ewigkeit, wie es ihr schien.
Schließlich wandte er sich ab und ging zurück zum Fenster. »Du kannst gehen. Ich lasse nach dir rufen, wenn ich dich brauche.«
Sie ließ den Atem entweichen, drehte sich so rasch um, dass die Röcke wirbelten, und eilte zur Tür.
»Beim nächsten Mal erwarte ich einen Knicks von dir zu sehen, wenn du dich verabschiedest«, rief er ihr hinterher. »Übertreibe es nicht, Feodora, ansonsten kannst du gerne die Bekanntschaft meines Vaters machen!«
Die Drohung war offensichtlich. Feodora verschwand, so schnell sie konnte, durch die Tür. Ohne Knicks.
Draußen lehnte sie sich an die kalte Wand und rang um Fassung. Was war nur mit ihr geschehen? Ihre Knie zitterten, sie fühlte sich ganz flau im Magen. Sie schloss die Augen und sah sein Gesicht vor sich. Sein anzügliches Benehmen regte sie längst nicht so auf, wie es das hätte sollen. Er war nicht der Erste, der es versucht hatte, doch seine anmaßende Art hätte sie ärgern müssen.
Sie bemerkte das Interesse der Wache neben sich und erschrak. So schnell sie konnte, lief sie zurück in ihre Kammer und war unendlich erleichtert, als sie sofort die richtige Tür fand und hinter sich schließen konnte.
Feodora warf sich auf das Lager und dachte nach. Lag es an dem Fluch, dass der junge Graf so einen Eindruck auf sie gemacht hatte, oder war es nur der Respekt vor seiner Stellung? Aber Feodora hatte noch nie Respekt vor einem Titel gezeigt. Respekt verdiente man sich mit Taten, nicht mit Titeln.
Sie erinnerte sich an ihre erste Begegnung, am Weiher. Schon damals gingen die Gefühle mit ihr durch. Sein nacktes Abbild stand noch immer vor ihren Augen. Und das machte die Situation kein bisschen leichter. Warum war er kein einfacher Bauernbursche? Oder ein Bürger der Stadt? Ein Handwerksbursche oder irgendein anderer? Sie hätte keinen Gedanken verschwendet, sie hätte gewusst, was sie tun musste. Warum kam der Befehl lange Jahre gar nicht, aber dann doch noch so kurz vor ihrem einundzwanzigsten Geburtstag?
Gegenwart …
»Worüber schreiben Sie sonst?«, fragte David mit einem spöttischem Lächeln und blickte auf. »Lovestorys? Mit garantiertem Happy-End?«
Maja wurde zu ihrem Ärger rot. »Niemand verlangt, dass Ihnen der Stil gefällt. Es geht um den Inhalt. Ignorieren Sie den Rest einfach.«
»Und wann waren Sie das letzte Mal verliebt?«
»Das geht Sie ja wohl kaum etwas an!«
Er lachte gehässig. »Also schon ein Weilchen her, vermute ich. Kann es sein, dass Sie einfach nur zu lange alleine sind und sich deshalb dieser Unsinn in Ihrem Kopf ausbreiten konnte?«
»Unsinn?«, rief Maja aufgebracht aus. »Hören Sie, ich schreibe keine Lovestorys! Ich schreibe Kriminalromane, die bisweilen auch in den Bestsellerlisten auftauchen. Ich habe es nicht nötig, mich von Ihnen beleidigen zu lassen!«
Er grinste amüsiert, doch fehlte das Gefühl. »Ich habe Sie beleidigt, weil ich fragte, ob Sie Liebesgeschichten schreiben?«
»Nein«, erwiderte sie ärgerlich. »Sie nannten sie Unsinn!«
»Und das hat Sie beleidigt?«, fragte er spöttisch zurück. »Sorry, kommt nicht wieder vor.«
Maja suchte nach Worten. Doch bevor sie die fand, vertiefte er sich wieder in das Manuskript.
Was sollte die Frage nach ihrem Liebesleben? Sicher, dass sie das letzte Mal verliebt gewesen war, lag schon ein wenig zurück. Aber sie hatte gar keine Zeit für eine Beziehung gehabt, in den letzten Jahren fast nur gearbeitet. Dabei hätte ein Mann nur gestört.
Maja hatte ihre eigene Routine, ihren eigenen Lebensrhythmus. Wenn sie schreiben wollte, schrieb sie. Uhrzeit, Wochentag, ihr war alles egal. Sie igelte sich in ihrer Wohnung ein, stellte Klingel und Telefon ab und arbeitete. Die wenigen Mußestunden, die sie sich gönnte, verbrachte sie mit den wenigen Freunden, die sie hatte, und sich schon beschwerten, dass sie kaum Zeit für sie fand. Wie sollte sie die für einen Mann finden? Und außerdem gab es da noch einen Grund … nie wieder wollte sie so enttäuscht werden …