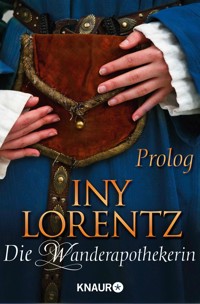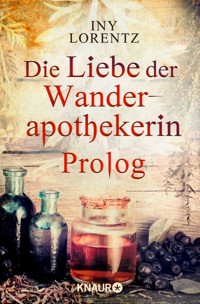9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine verbotene Liebe und ein mörderischer Mönch zur Zeit der Fugger: Mit dem historischen Roman »Der Fluch der Rose« lässt Bestseller-Autorin Iny Lorentz ein besonders spannendes Stück Geschichte lebendig werden. Deutschland, Österreich/Kärnten und Italien, Ende des 15. Jahrhunderts Die junge Maria wächst als Ziehtochter von Hans Fugger in der neu gegründeten Erzschmelze Fuggerau auf. Zur gleichen Zeit erziehen die Mönche im nahegelegenen Kloster Arnoldstein das Findelkind Johannes zu einem intelligenten jungen Mann. Nur Pater Norbert weiß um Johannesʼ wahre Herkunft und überlegt seit Jahren, wie er Profit aus dieser Information schlagen kann. Es ist Liebe auf den ersten Blick, als sich Maria und Johannes das erste Mal begegnen. Doch Johannes ist kurz zuvor zum Priester geweiht worden. Und nicht nur sein geistlicher Stand steht dem Glück der Liebenden im Weg: Ohne es zu wissen, hat Maria sich schon als junges Mädchen Pater Norbert zum erbitterten Feind gemacht. Als das Kloster und die Erzschmelze der Fugger in den Krieg zwischen der Republik Venedig und König Maximilian von Habsburg hineingezogen werden, sieht der Pater seine Chance gekommen … Geschickt verbindet Bestsellerautoren-Duo Iny Lorentz die spannende Zeit der Fugger mit dem dramatischen Schicksal zweier junger Menschen. »Will man einen historischen Roman lesen, bei dem man schon zuvor weiß, dass er einen begeistern wird, dann muss man zu einem von Iny Lorentz greifen!« Alex Dengler, denglers-buchkritik online
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 808
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Iny Lorentz
Der Fluch der Rose
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Deutschland, Österreich und Kärnten, Ende des 15. Jahrhunderts:
Die junge Maria wächst als Ziehtochter von Hans Fugger in der neu gegründeten Erzschmelze Fuggerau auf, während die Mönche im nahegelegenen Kloster Arnoldstein das Findelkind Johannes zu einem intelligenten jungen Mann erziehen. Nur Pater Norbert weiß um Johannesʼ wahre Herkunft und überlegt seit Jahren, wie er Profit aus dieser Information schlagen kann.
Als sich Maria und Johannes das erste Mal begegnen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch Johannes ist kurz zuvor zum Priester geweiht worden. Und nicht nur sein geistlicher Stand steht dem Glück der Liebenden im Weg: Ohne es zu wissen, hat Maria sich schon als junges Mädchen Pater Norbert zum erbitterten Feind gemacht.
Als das Kloster und die Fuggerau in den Krieg zwischen König Maximilian von Habsburg und der Republik Venedig hineingezogen werden, sieht der Pater seine Chance gekommen …
Inhaltsübersicht
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Zweiter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Dritter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Vierter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Fünfter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Sechster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Siebter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Achter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Neunter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Zehnter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Elfter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Historischer Überblick
Personen
Glossar
Erster Teil
Das spanische Weib
1.
Esmaralda lächelte glückselig, als sie die sanfte Berührung spürte, mit der Felipe ihr den Ring an den Finger steckte.
»Jetzt bist du meine kleine esposa, und nichts kann uns mehr trennen«, sagte er leise und berührte ihre Lippen mit den seinen.
»Du bist so gut zu mir!«, hauchte Esmaralda.
Sie konnte noch immer kaum glauben, dass Felipe, der Sohn des Grafen Don Rodrigo de Azuaga y Pinjara, seinem Vater getrotzt und sie, die Tochter eines einfachen Edelmanns, eines hidalgo, zur Frau genommen hatte. Doch mit ihren Unterschriften unter der Heiratsurkunde war diese Ehe gültig, und nur der Herr im Himmel konnte sie wieder auflösen.
Esmaralda betete, dass Gott Felipe und ihr viele Jahre gemeinsamen Glücks schenken würde, auch wenn die Zukunft vielleicht nicht ganz so rosig werden dürfte, wie sie es erhofft hatten. Denke nicht so etwas an deinem Hochzeitstag, schalt sie sich, als sie an Felipes Seite die kleine Dorfkirche verließ und vor sich das Spalier seiner Söldner sah, die ihrem capitan und ihr die Ehre erwiesen, angeführt von Felipes Stellvertreter Domingo, einem untersetzten, ganz in Leder gekleideten Mann mit schwarzem Vollbart. Seine Miene wirkte säuerlich, denn er hatte Felipe mehrmals beschworen, keine solch große Dummheit zu begehen, diese Frau zu heiraten.
Rasch wandte Esmaralda ihren Blick den anderen Söldnern zu. Von denen hatte ihres Wissens niemand gegen sie gesprochen. Dabei stammten auch Alfonso und Raúl von den Besitzungen des Grafen Azuaga. Deren Gesichter waren jedoch fröhlich, und sie ließen Felipe und sie mehrfach hochleben. Domingo bewegte zwar ebenfalls die Lippen, doch war Esmaralda klar, dass aus seinem Mund kein Segenswunsch kam.
»Es betrübt mich, Felipe, der Grund für dein Zerwürfnis mit deinem Vater zu sein«, entfuhr es ihr unwillkürlich.
Ihr Mann winkte mit lächelnder Miene ab. »Mein Vater wird sich mit dieser Ehe über kurz oder lang abfinden. Er hat ja noch meinen Bruder Miguel, und der ist der eigentliche Erbe von Azuaga. Miguel wird die Frau heiraten, die unser Vater für ihn aussucht, und mit ihr Kinder in die Welt setzen. Spätestens dann, wenn Vater die Erbfolge gesichert sieht, wird er seinen Frieden mit uns machen.«
»Bis dorthin bist du ein Söldnerhauptmann in fremden Diensten«, wandte Esmaralda beklommen ein.
»Lass dich davon nicht betrüben, mein Lieb. Wir Azuagas haben seit Jahrhunderten das Schwert geschwungen, und ich bin stolz, dem Beispiel meiner Ahnen folgen zu können. Zu Hause zu hocken, Rinder und Schafe zu zählen und Domestiken zu kommandieren, wie Miguel es tut, wäre nichts für mich. Ich will Ruhm gewinnen und Beute machen. Dann kann ich mit dir an meiner Seite vor meinen Vater treten. Jetzt mag er mir noch zürnen, doch später wird er stolz auf mich sein und dich an sein Herz drücken.«
Felipe klang so überzeugend, dass Esmaralda ihm nur zu gerne Glauben schenkte. Er ist ja auch ein Held, ein Held ohne jeden Fehl. Ihr Held, ihr Felipe! Es wird alles gut werden, dachte sie und tadelte sich selbst, weil sie für einen Augenblick daran gezweifelt hatte.
Das Weinen eines Kindes riss sie zurück in die Gegenwart. Esmaralda erschrak. Hatte sie mit offenen Augen geträumt? Seit ihrer Hochzeit waren doch bereits drei Jahre vergangen!
In dem Augenblick brach das ganze Elend wieder über sie herein. Bis vor wenigen Tagen waren Felipe und sie glücklich gewesen und hatten sich aneinander und an ihrem kleinen Sohn Juan erfreut. Die letzte Schlacht aber hatte ihr Glück wie ein Kartenhaus zusammenfallen lassen.
Esmaralda schauderte, als sie daran dachte, wie Raúl verletzt und blutend mit der grässlichen Nachricht ins Feldlager zurückgekehrt war, die Schlacht sei verloren und Don Felipe im Kampf gefallen. Seit jenen Stunden waren sie auf der Flucht. Wie viele Meilen sie dabei mit Juan auf den Armen zurückgelegt hatte, konnte sie nicht einmal schätzen. Es gab in der gesamten Truppe nur noch ein Pferd, und das ritt Domingo. Raúl hatte ihn gebeten, es ihr abzutreten, war aber nicht einmal einer Antwort gewürdigt worden.
Schwäche und Hunger setzten ihr und Juan zu, und es wurde immer mühsamer, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Verzweifelt blickte Esmaralda nach vorne. Es klaffte bereits eine erhebliche Lücke zwischen ihr und den Söldnern, die von der Angst vor den Türken vorwärtsgetrieben wurden.
»Mein Gott, warum helft ihr mir nicht? Es ist ja nicht um meinetwillen! Helft Juan! Er ist doch der Sohn eures Hauptmanns«, versuchte Esmaralda zu rufen, um an das Ehrgefühl der Männer zu appellieren. Die Worte kamen jedoch kraftlos und kaum vernehmbar aus ihrem Mund.
Domingo hatte das Kommando übernommen und sorgte dafür, dass die Männer trotz ihrer Verletzungen stramm marschierten. Was mit Esmaralda und Juan geschah, kümmerte ihn nicht.
Verzweifelt nahm die junge Frau wahr, wie sich der Abstand zu den Soldaten ständig vergrößerte. Schon bald würde sie allein auf dieser staubigen Straße sein, die von himmelhohen Bergen gesäumt wurde und weit oben im Nichts zu enden schien.
»Juan, mein Juanito, was soll ich nur tun?«, flüsterte sie weinend und wusste doch, dass sie nicht aufgeben durfte, denn ihr Ende würde auch der Tod ihres Kindes sein. Doch Felipes Sohn sollte leben!
2.
Die Soldaten kämpften sich den steilen Anstieg hinauf. Fast jeder war verwundet, und ihre Kleidung und ihre Ausrüstung hatten auf dem harten Marsch und im Gefecht gelitten. Zwar besaß Domingo ein Pferd, war aber abgestiegen, weil das Tier völlig abgetrieben war und ihn nicht mehr den Passweg hätte hochtragen können. Obwohl er während der Flucht immer wieder im Sattel gesessen hatte, war er nicht weniger erschöpft als seine Kameraden.
»Wie weit ist es denn noch bis zur Passhöhe?«, fragte einer der Männer verzweifelt.
Froh, einen Augenblick verschnaufen zu können, blieb Domingo stehen. »Ich weiß es nicht. Sehr weit kann es nicht mehr sein.«
Der Mann blickte mit furchtsamer Miene nach oben. »Für mich sieht es so aus, als würde dieser Pfad erst im Himmel enden.«
Domingo bedachte ihn mit einem zornigen Blick. »So etwas sagt man nicht, es sei denn, man will es herbeirufen! Wir sind diesen verdammten turcos nur um Haaresbreite entkommen und haben dabei unseren braven capitan und viele compañeros verloren. Da will ich nichts vom Himmel hören!«
»Beruhige dich, Domingo! Alfonso hat es doch nicht böse gemeint«, warf Raúl ein. »Doch was meinst du? Haben wir die Türken endlich hinter uns gelassen?«
»Davon bin ich überzeugt! Auf jeden Fall sind wir jenseits des Passes in Sicherheit. Verdammt, dass dieser Feldzug so beschissen enden musste!« Domingo stieß noch einige Flüche aus und setzte sich wieder in Bewegung.
Es dauerte ein paar Augenblicke, bis die Kameraden ihm folgen konnten. Sie alle waren am Ende, wussten aber, dass sie diesen Pass hinter sich bringen mussten, wenn sie nicht doch noch Verfolgern zum Opfer fallen wollten. Am meisten kränkte es Domingo, dass sie diesen Weg ohne ihren Hauptmann bewältigen mussten. Don Felipe war als einer der Ersten in der Schlacht gefallen und nach ihm viele ihrer Kameraden. Dem Rest war nach dem Rückzug ihrer venezianischen Verbündeten nur die Flucht geblieben.
Während er noch mit dem Schicksal haderte, schloss Raúl erneut zu seinem Anführer auf. »Domingo, wir müssen ihr helfen! So kann sie nicht mehr mithalten.«
Raúl wies auf Esmaralda, die sich in einem Abstand von mehr als vierhundert Schritt hinter ihnen herschleppte und ihr zweijähriges Kind an sich gepresst hielt.
»Lass mich mit der in Ruhe!«, fuhr Domingo auf. »Sie allein ist an unserem Unglück schuld – und auch an Don Felipes Tod!«
»Sie war doch sein Weib, und es ist sein Sohn«, erwiderte Raúl drängend.
»Sie ist eine Tochter des Satans, nur geboren, um das ehrenwerte Haus de Azuaga zu verderben! Ohne sie hätte Don Felipe sich niemals mit seinem Vater zerstritten und in fremdländische Dienste treten müssen!«, schrie Domingo außer sich vor Zorn.
Da einige seiner Männer trotzdem so aussahen, als wollten sie auf die Frau warten, drohte er ihnen mit der Faust. »Ich erschlage jeden, der versucht, ihr zu helfen! Das bin ich Don Rodrigo de Azuaga schuldig. Er muss seinen jüngeren Sohn betrauern, auf den er so stolz war, und das nur, weil dieses Weib den armen Don Felipe mit ihren Teufelskünsten in ihren Bann geschlagen hat.«
»Wenn wir Doña Esmaralda nicht beistehen, muss Don Rodrigo außer seinem Sohn auch noch seinen Enkel betrauern«, antwortete Raúl heftig.
Domingo wies diesen Einwand mit einer Geste des Abscheus zurück. »Das Kind ist ein Teufelsbalg und hat nicht verdient, zu leben!« Dann deutete er Richtung Pass. »Marschiert weiter! Oder wollt ihr, dass die turcos euch doch noch kriegen?«
Für einen Augenblick sah es so aus, als wolle Raúl sich trotz dieser Drohung seinem Befehl widersetzen. Der junge Mann war jedoch verletzt und seine Kraft fast aufgebraucht. Mit einem mitleidigen Blick streifte er Esmaralda de Azuaga und bat Gott, sich ihrer anzunehmen, selbst wenn dies hieß, dass die Türken sie und ihren Sohn ergreifen und versklaven würden. Schon bald aber vergaß er die Frau und ihr Kind unter dem anstrengenden Aufstieg und betete nur noch, dass diese Schinderei endlich ein Ende nehmen würde.
3.
Mit Bitterkeit im Herzen blickte Esmaralda de Azuaga hinter den Soldaten her, von denen ihr fast alle freundlich und hilfsbereit begegnet waren, solange ihr Mann noch gelebt hatte. Nun aber zogen sie immer weiter davon, ohne sich um sie zu kümmern. Felipe hatte seine Männer stets gut behandelt und hätte keinen von ihnen zurückgelassen. Doch Felipe war tot, und nun führte Domingo das Kommando. Ausgerechnet Domingo, der seine Abneigung gegen sie häufig genug geäußert hatte und deshalb schon einige Male von ihrem Ehemann gerügt worden war.
Sie fragte sich, wie ein Mensch so hasserfüllt sein konnte, ein unschuldiges Kind wie ihren Juan einfach in einem fremden Land zurückzulassen. Bei dem Gedanken an den Kleinen kamen ihr die Tränen. Alle Soldaten hatten mit ihrem Sohn gespielt … Nein, nicht alle, berichtigte sie sich. Domingo hatte seine Abneigung gegen sie auch auf ihr Kind übertragen und freute sich jetzt wahrscheinlich, sie endlich so behandeln zu können, wie er es schon lange gewollt hatte.
Als Esmaralda eine Verwünschung gegen Domingo ausstieß, begriff sie, dass sie ihren Atem für den harten Anstieg zum Pass sparen musste. Sie kannte den Namen des Ortes nicht, den sie zuletzt passiert hatten, wusste nicht einmal, in welchem Land sie sich befand. Während des Kriegszugs war sie klaglos ihrem Ehemann gefolgt. Aber nun war sie allein, ohne den Schutz des geliebten Mannes, und musste erleben, wie die Soldaten, die vor wenigen Tagen noch den Rücken vor ihr gebeugt hatten, immer weiter in der Ferne verschwanden, ohne ihr auch nur eine Hand gereicht zu haben.
»Mein kleiner Juanito, wenn ich nur wüsste, wohin ich mich wenden soll«, flüsterte sie unter Tränen und drückte das Kind an sich.
Juan brach ebenfalls in Tränen aus, denn er hatte Hunger. Doch seit sie auf der Flucht vor den Türken waren, gab es kaum noch etwas zu essen. Esmaralda hatte das wenige, was ihr geblieben war, mit ihrem Sohn geteilt und besaß nun keinen Krümel mehr. Auch sie spürte den Hunger mit eisernen Krallen im Magen wühlen und kämpfte gegen ihre Verzweiflung an.
»Wir werden über den Pass kommen, mein Juanito«, versuchte sie, sich Mut zu machen, während sie einen Schritt vor den anderen setzte. Es war ein harter Weg für die erschöpfte Frau, die zudem ihr Kind tragen musste, doch Esmaralda biss die Zähne zusammen und stieg weiter bergan.
»Bald werden wir das nächste Dorf erreichen, und dort bekommen wir etwas zu essen, mein Juanito«, flüsterte sie dem Kind zu und betete zu Gott, dass er sich ihres Sohnes und auch ihrer erbarmen möge.
Als die Sonne hinter den Bergen versank, befürchtete Esmaralda, im Dunkeln fehlzutreten und sich und das Kind zu verletzen. Daher kroch sie in ein Gebüsch, wiegte den weinenden Jungen und überlegte verzweifelt, wie sie seinen Hunger stillen konnte.
Wenn meine Brüste wenigstens noch Milch geben würden, dachte sie. Anders als die Edeldamen der hohen Häuser hatte sie ihr Kind selbst genährt, da ihr Mann nicht auch noch eine Amme auf seine Kriegszüge hatte mitnehmen können. Nach dem Zerwürfnis mit seinem Vater war das Geld knapp gewesen, und er hatte zusehen müssen, wie er sein Fähnlein versorgen konnte.
Esmaralda dachte an ihren Schwiegervater Rodrigo de Azuaga. Dieser hatte seinen Sohn vor die Wahl gestellt, entweder auf sie zu verzichten oder heimatlos zu sein. Felipe hatte sich für sie entschieden, und so hatten sie drei glückliche Jahre miteinander verlebt. Nun war Felipe tot, und sie befand sich in einem ihr unbekannten Land, dessen Sprache sie nicht verstand. Auch wusste sie nicht, von wem sie Hilfe erwarten durfte.
Auf ihren Schwiegervater brauchte sie nicht zu hoffen. Dieser war fern und würde vermutlich nur sagen, sein Sohn und sie hätten das ihnen gebührende Schicksal erlitten. Der einzige Lichtblick waren mehrere Schmuckstücke, die Felipe ihr vor ihrer Heirat geschenkt hatte. Als er seine Truppe gesammelt hatte, hatte sie sie ihm zurückgeben wollen, damit er sie verkaufen und seine Männer mit dem Erlös ausrüsten könne, doch er hatte es abgelehnt.
»Wenn ich einmal so weit bin, deinen Schmuck versetzen zu müssen, weiß ich, dass der Name Felipe de Azuaga nicht mehr den Klang besitzt, der einen Feldherrn dazu bringt, mich in seine Dienste zu nehmen«, hatte Felipe damals lachend zu ihr gesagt.
Zu jener Zeit war sie ein wenig enttäuscht gewesen, weil sie ihm hatte helfen wollen. Nun aber war sie froh um die drei Broschen, den Ring und die Perlenkette. Wenn sie diese verkaufte, konnten Juan und sie gewiss ein paar Jahre davon leben.
Ihr knurrender Magen verriet Esmaralda, dass es nicht an der Zeit war, an die Zukunft zu denken. Es zählte nur der Augenblick, und der war düster. Wenn Juan und sie nicht bald etwas zu essen fanden, würde ihr Weg in diesen Bergen zu Ende sein.
Trotz ihrer quälenden Überlegungen schlief Esmaralda schließlich ein und wachte mitten in der Nacht durch die Kälte auf, die ihr in alle Glieder kroch. Am Tag war es heiß gewesen, doch nun klapperten ihr die Zähne. Damit ihr Sohn nicht zu sehr fror, schob sie ihn unter ihr Kleid, um ihn mit ihrem Körper zu wärmen.
Die Nacht dehnte sich schier endlos, doch als im Osten der erste Schein des neuen Tages aufleuchtete, nahm Esmaralda ihren Sohn erneut auf den Arm und stieg weiter die Passhöhe hinauf. Ihren Durst konnten sie mühsam an einer tröpfelnden Quelle stillen, die aus einer Felswand trat. Eine kurze Zeit schien es, als habe die Nachtruhe ihr frische Kräfte verliehen. Doch kaum war die Sonne höher gestiegen, wurde es warm, und sie fühlte ihre Erschöpfung doppelt. Alle drei, vier Schritte musste sie anhalten und verschnaufen.
Stunden vergingen. Der kleine Juan war so geschwächt, dass er die meiste Zeit schlief, während Esmaraldas wirbelnde Gedanken längst einer dumpfen Leere gewichen waren, in der sich Gegenwart und Vergangenheit mischten. Immer wieder vernahm sie die Stimme ihres Schwiegervaters, der sie verfluchte, weil sie ihm den Sohn genommen habe. Während ihr die Tränen über die Wangen liefen, glaubte sie Schritte an ihrer Seite zu hören, und dann erklang die Stimme ihres Mannes.
»Es wird alles gut, Esmaralda, glaube mir! Auch wenn der Vater mir zürnt, werden wir unseren Platz im Leben erkämpfen.«
»Das werden wir!«, sagte sie, doch ihr antwortete nur der Wind.
Allmählich machte ihr wieder der Durst zu schaffen. Ihre Lippen wurden erst trocken, dann rissig, und irgendwann spürte sie den Geschmack von Blut im Mund. Angeekelt wollte Esmaralda ausspucken, doch der Speichelfluss war längst versiegt.
»Mein Gott, warum quälst du mich so?«
Die Trauer um ihren Mann, die während der Flucht ein wenig in den Hintergrund getreten war, brach sich jetzt mit aller Macht Bahn, und sie wünschte sich, ebenso tot zu sein wie ihr geliebter Felipe.
Das Greinen ihres Sohnes erinnerte Esmaralda daran, dass sie an mehr zu denken hatte als nur an sich. Während sie mit einer Hand das Kind hielt, wischte sie sich mit dem Handrücken die Augen trocken und ging weiter.
Irgendwann drang ein plätscherndes Geräusch an ihr Ohr. Zuerst achtete sie nicht darauf, blieb dann aber mit einem Schlag stehen.
»Wasser!« Sie sah sich um und entdeckte hoch über sich einen kleinen Wasserfall, der jedoch auf der Felswand versprühte. Da die Steine in ihrer Nähe feucht waren, presste sie die Lippen dagegen, um die Flüssigkeit abzulecken. Dann benetzte sie ihre Hand und bestrich damit Juans Lippen.
»Mama, mehr!«, flehte der Junge und brachte sie damit erneut zum Weinen.
»Ich habe nicht mehr, mein Kleiner, und ich kann nicht hoch genug steigen, um an das Wasser zu gelangen!«
Schweren Herzens ging sie weiter. Sie hatte Glück, denn nur wenig später erreichte sie eine Stelle, an der Wasser aus einer kleinen Öffnung im Felsen trat und sich als schmaler Bach in der Tiefe verlor. Endlich konnte sie Juan genug zu trinken geben und selbst ihren Durst stillen.
Als sie weiterging, bemerkte sie, dass sie die Passhöhe überschritten hatte, denn sie sah tief unter sich einen weiten Talkessel, der von grauen Bergriesen umgeben war. Zur rechten Hand erstreckte sich ein länglicher See, und unweit davon lag eine Stadt. Nach ein paar weiteren Schritten schien es ihr, als erkenne sie auf einer an einem Fluss entlangführenden Straße Fuhrwerke.
Für Esmaralda war es wie ein Blick ins Paradies. Dort würde sie Hilfe finden, fuhr es ihr durch den Kopf, als sie ihren Sohn aufhob und weiterschritt.
4.
Esmaraldas Erleichterung hielt nicht lange an. Für den Aufstieg zum Pass hatte sie beinahe zwei Tage gebraucht, und sie begriff rasch, dass der Abstieg kaum weniger anstrengend sein würde. Als der Abend hereinbrach, hatte sie ihrer Schätzung nach weniger als ein Drittel des Weges bis ins Tal geschafft. Da sie immer wieder an tiefen Abgründen und Felsspalten vorbeikam, musste sie auch in dieser Nacht an einem Hang rasten, dessen spärliches Gestrüpp keinen Schutz bot. Zudem machte ein kühler Wind aus dem Norden den Aufenthalt zur Qual. So legte Esmaralda sich mit dem Rücken zum Wind, um ihren Sohn zu schützen.
Das Kind war so matt, dass sie sich wünschte, ein Engel des Herrn würde vom Himmel steigen, sie und Juan an der Hand nehmen und zu ihrem Mann bringen. Doch der Himmel blieb verschlossen, und zu allem Unglück setzte mit der Dämmerung auch noch Regen ein. So willkommen der erfrischende Guss in der Hitze des letzten Tages gewesen wäre, verstärkte er jetzt die Kälte, die sich in Esmaraldas Gliedern breitgemacht hatte und die auch nicht mehr weichen mochte, als sie wieder aufbrach.
In Esmaraldas Gedanken hatte nichts anderes mehr Platz als der Wille, das Kind festzuhalten und einen Fuß vor den anderen zu setzen. Irgendwann kam sie an einigen Pferdeäpfeln vorbei, die Domingos Gaul hinterlassen hatte. Sie waren bereits ganz zerfallen, und der Regen spülte ihre Reste die Straße hinab.
Nach den nächsten Schritten wurde die Straße eben, und die ersten Häuser kamen in Sicht. Bei ihrem Anblick erinnerte Esmaralda sich daran, weiter oben niedergebrannte Reste von Gebäuden gesehen zu haben. Waren die turcos sogar bis hierher vorgedrungen? Erschrocken sah sie sich um, schüttelte diesen Gedanken aber schnell ab und richtete ihr Augenmerk auf die Straße am Fluss. Sie erreichte diese und sank dort so entkräftet zu Boden, dass sie glaubte, nie wieder aufstehen zu können. Mit einem Mal vernahm sie das Geräusch rollender Räder, raffte sich auf und stolperte auf die sich nähernden Gespanne zu.
Es war ein Zug aus mehreren großen Fuhrwerken, die von jeweils vier Pferden gezogen wurden. Bewaffnete begleiteten die Wagen, und die Fuhrleute und Knechte trugen ebenfalls Kurzschwerter oder lange Dolche am Gürtel. Esmaralda taumelte auf einen der Männer zu und sprach ihn in ihrer Muttersprache an.
»Guter Mann, hab Mitleid mit mir und meinem Sohn! Hilf uns, denn wir sind allein und verlassen!«
Der Mann musterte ihre zerrissene, schmutzige Kleidung und ihr abgezehrtes Gesicht und versetzte ihr einen Stoß. »Lass mich in Ruhe, du Landstreicherin!«
Esmaralda war so schwach, dass sie stürzte und das Bewusstsein verlor. Der Mann warf ihr noch einen kurzen Blick zu und nahm wieder seinen Platz im Wagenzug ein.
Esmaralda erwachte durch das Schreien ihres Sohnes. Einige Augenblicke starrte sie verwirrt um sich und konnte kaum glauben, neben einer staubigen Straße in einem fernen Land zu liegen, denn sie war eben noch zusammen mit ihrem Felipe auf dessen Vater zugetreten und von diesem unerwartet freundlich empfangen worden.
Es dauerte eine Weile, bis sie begriff, dass sie wieder von Traumgebilden heimgesucht worden war, und sah dann nach ihrem Sohn. Zu ihrer Erleichterung hatte er bei ihrem Sturz keinen Schaden genommen. Sein Bauch war jedoch angeschwollen, und er jammerte, dass er Hunger und Durst habe.
»Das habe ich auch, mein Kleiner! Das habe ich auch …«, antwortete sie und schleppte sich mit dem Kind auf dem Arm zum Fluss, um wenigstens ihren Durst zu löschen.
Sie blieb am Ufer sitzen. Von der Höhe aus hatte sie eine Stadt gesehen und auch mehrere Dörfer. Esmaralda begriff jedoch mit erschreckender Klarheit, dass sie nicht einmal sagen konnte, in welcher Richtung die nächste Ansiedlung lag. Und selbst wenn sie es gewusst hätte, wäre sie zu schwach gewesen, sie zu erreichen. Sie musste an dieser Stelle warten, bis ein barmherziger Samariter erschien und sich ihrer annahm. Nach ihren Erfahrungen mit dem Wagenzug bezweifelte sie jedoch, dass es dazu kommen würde.
Daher blickte sie nicht einmal auf, als sich wieder ein Wagen näherte. Dieser wurde von einem einzigen Ochsen gezogen, und es saßen nur ein Mann und ein Junge darauf. Zuerst schien es, als würden sie an der jungen Frau und dem Kind vorbeifahren. Da klang die helle Stimme des Knaben auf.
»Papa, schau, dort sitzt jemand!«
Der Mann zügelte den Ochsen und hielt an. Sein Blick war misstrauisch, doch verlor sich das, als er Esmaralda sah.
»Kann ich dir helfen?«, fragte er.
Esmaralda verstand ihn nicht, schloss aber aus seiner Miene, was er meinte, und zwang ihren widerstrebenden Körper aufzustehen. »Um Gottes Gnade willen, nehmt mich mit! Wir sind vor den turcos geflohen, und meine Begleiter haben mich zurückgelassen«, sagte sie, während sie auf den Wagen zuwankte.
»Schon gut! Ich versteh dich nicht«, wehrte der Mann ab und wandte sich an seinen Sohn. »Was meinst du, was wir mit ihr machen sollen?«
»Vielleicht versteht einer der frommen Patres von Arnoldstein, was sie sagt«, antwortete der Junge.
»Es ist sicher das Beste, wir bringen sie dorthin. Komm, steig auf!«
Auf die einladende Geste des Mannes hin legte Esmaralda ihr Kind auf den Wagen. Als sie selbst aufsteigen wollte, fehlte ihr die Kraft dazu.
»Das hat man von seiner Gutmütigkeit«, stöhnte der Mann, während er dem Jungen die Zügel reichte und abstieg, um der Frau auf den Wagen zu helfen.
»Muchas gracias!«, flüsterte Esmaralda, zog ihren Sohn zu sich her und kauerte sich auf dem Wagen zusammen.
Der Fuhrmann stieg wieder auf und trieb den Ochsen an, der den Wagen in langsamem, aber stetem Trott nach Südwesten zog. Esmaralda fiel derweil in einen von Albträumen gequälten Schlaf, in denen ihr Schwiegervater sich mit den Türken zusammentat, um sie und ihren Sohn zu vernichten.
Eine Berührung an der Schulter weckte Esmaralda, und sie schreckte mit einem leisen Aufschrei hoch.
»Wir sind da!«, erklärte der Fuhrmann. »Aber das letzte Stückerl musst du selber gehen.«
Seine rechte Hand wies auf einen Anstieg, der fast so steil in die Höhe führte wie die Passstraße. Zu ihrer Erleichterung sah Esmaralda jedoch, dass sie keinen Berg erklimmen musste, sondern nur einen Felsriegel, der sich über das umgebende Land erhob und oben von Mauern gekrönt wurde. Zu seinen Füßen lag ein Dorf mit neu aussehenden Häusern und rauchgeschwärzten Ruinen, die von Dornensträuchern und Brennnesseln überwuchert waren.
Wie es aussah, hatte hier erst vor wenigen Jahren eine fürchterliche Feuersbrunst geherrscht, die kaum ein Haus verschont hatte. Die Kirche, die sie etwas seitlich hinter dem Felsriegel entdeckte, war noch im Bau, und oben auf dem Felsen wurde ebenfalls gearbeitet. Die Anlage deutete auf ein Kloster hin, das auf beengtem Raum errichtet worden war und den Marktort zu seinen Füßen wie eine Festung überragte.
Esmaralda war so müde, dass sie kaum einen klaren Gedanken fassen konnte, aber sie hoffte, bei den frommen Brüdern, die dort im Kloster lebten, Hilfe zu erhalten. Schwerfällig kletterte sie vom Wagen, nahm das Kind an sich und machte sich auf den Weg nach oben.
5.
Bruder Vincentius, der Pförtner des Klosters, betrachtete sein Gegenüber mit einem zweifelnden Blick, denn er vermochte den Mönch, den ihr Oberhaupt, Philipp von Henneberg, der Fürstbischof von Bamberg, ihnen geschickt hatte, nicht einzuschätzen. Erst vor kurzem war Bruder Ewald nach Arnoldstein gekommen, und viele Mönche nahmen an, dass er die Lage im Kloster und in der ebenfalls zum Machtbereich des Fürstbischofs gehörenden Umgebung in dessen Auftrag überprüfen sollte. Es ging um das Geld, das an diesem Ort dringend zur Aufarbeitung der Schäden gebraucht wurde, derzeit aber noch nach Bamberg in die Schatulle des Fürstbischofs floss.
»Du siehst selbst, Bruder Ewald, wie Arnoldstein und das Gailitz- und Gailtal unter dem Feldzug der türkischen Heiden gelitten haben«, erklärte er eindringlich.
»Ich habe darüber bereits mit dem hochwürdigen Herrn Abt gesprochen und weiß, dass etliche Schäden aufgetreten sind«, gab der Bamberger zu.
»Das ist zu gering gegriffen, Bruder Ewald. Die Türken haben alle Dörfer der Umgebung niedergebrannt, ungeachtet der Frage, ob sie zu Habsburg zählen oder zu Bamberg. Auch der Handel durch das Tal der Drau und über das Kanal- und das Eisental nach Venedig hat schwer gelitten. Seine Gnaden, der Fürstbischof, sollte dies bedenken und seinen Untertanen beistehen. Es würde ihm später durch höhere Zoll- und Steuereinnahmen gedankt«, fuhr Bruder Vincentius fort.
»Ich verstehe deine Sorgen, Bruder«, antwortete der Bamberger. »Doch Seine Gnaden hat große Ausgaben, nicht zuletzt wegen der Türkengefahr.«
»Vor Bamberg stehen die Türken nicht, doch hier waren sie erst vor kurzem und haben nicht das Kind im Mutterleib geschont«, fuhr der Pförtner gereizt auf.
»Jetzt errege dich nicht, Bruder!«, erwiderte Ewald von Bamberg. »Seine Gnaden weiß sehr wohl, was seine Schutzbefohlenen in diesen Landen durch die ruchlosen Heiden erdulden mussten, und hat mich beauftragt, in seinem Namen die Schäden zu schätzen, die durch die türkischen Angriffe entstanden sind. Auch hat er Seiner Majestät, Kaiser Friedrich III., Botschaft gesandt mit der Mahnung, dass dieser die Grenzen des Reiches besser schützen solle.«
»Die Dienstleute des Kaisers haben sich beim Anblick der Türken in ihre Burgen Landskron und Finkenstein verkrochen, genauso wie die zu Bamberg zählenden Ritter auf Federaun, Löwenberg und Straßfried. Den Kampf mit den Türken hat keiner von denen gesucht. Dabei war die Schar der Heiden nicht so groß, dass die habsburgischen und bambergischen Ritter nicht hätten siegen können! Sie hätten nur zusammenhalten müssen.« Bruder Vincentius machte kaum Hehl aus seinem Ärger über die Untätigkeit der adeligen Herren in diesem Land.
Diesen Argumenten konnte sich auch Ewald von Bamberg nicht verschließen. In den letzten Tagen hatte er mit Abt Christoph und anderen Mönchen über die Lage in diesem Landstrich gesprochen, der durch die wiederholten Einfälle der Türken aufs Schlimmste verwüstet worden war. Die Arnoldsteiner Bürger drängten darauf, dass ihr Landesherr in Bamberg den Wiederaufbau des Klosters und der Dörfer und Städte im Umkreis nicht nur durch fromme Worte, sondern auch durch Taten unterstützte. Dazu zählte, die zusammengeschrumpften Handelszölle nicht in die Kassen von Bamberg abzuziehen, sondern damit die größten Schäden zu beseitigen und das Leiden der Menschen zu lindern. Das Arnoldsteiner Kloster hatte bereits wertvolle Stücke des Klosterschatzes verkauft, um helfen zu können. Allein aber vermochte es die schwere Bürde nicht zu tragen.
»Darauf sagst du nichts, Bruder?«, fragte Vincentius mit gerunzelter Stirn.
»Ich kann nur zuhören und aufschreiben, was geschehen ist und getan werden müsste. Entscheiden aber kann ich nicht!« Ewald bedauerte dies aufrichtig, denn sowohl das Kloster wie auch der dazugehörige Markt waren schwer heimgesucht worden, ebenso die Orte Thörl, Maglern, Goggau und Tarvis mit all ihren Dörfern unter der Bamberger Herrschaft. Auch ärgerte er sich nicht weniger als Bruder Vincentius über die einheimischen Adeligen, die sich auf ihren Burgen verschanzt und den einfallenden Türken das Land überlassen hatten.
»Dann will ich hoffen, dass du das Richtige nach Bamberg schreibst.«
Auch wenn im Kloster das Gerücht umging, der Fürstbischof habe Bruder Ewald geschickt, damit dieser Abt Christoph als Oberhaupt des Klosters nachfolgen sollte, nahm der Pförtner kein Blatt vor den Mund. Dies hier war Grenzland. Im Osten, Norden und Westen herrschte Kaiser Friedrich III. als Herzog von Kärnten, der die noch selbstständigen Herrschaften und vor allem das große bambergische Gebiet, das die Städte Villach und Tarvis mit einschloss, gerne seinem eigenen Herrschaftsgebiet angegliedert hätte. Im Süden gab es Ärger mit Venedig, das seine Position im Eisen- und Kanaltal ausbauen wollte, und aus dem Südosten brachen immer wieder die Türken ins Land, um es unter den Halbmond zu zwingen. In Bamberg mochte man diese Gefahr vielleicht für gering achten. Hier aber hatte man sie tagtäglich vor Augen.
Während des Gesprächs blickte der Pförtner hie und da durch das schmale Fenster auf den Weg, der zum Kloster hochführte, wie es seine Pflicht war.
Mit einem Mal kniff er die Augen zusammen. »Da kommt ein Weib auf das Tor zu!«
»Eine Frau will ins Kloster?« Ewald von Bamberg eilte ebenfalls ans Fenster und blickte hinaus. Es war zu wenig Platz für zwei Leute, und so trat Bruder Vincentius einen Schritt zurück.
»Eine Landstreicherin! Solche gibt es nach den Einfällen der Türken in diesen Landen zuhauf. Ich kann sie aber nicht hereinlassen«, erklärte Vincentius.
»Wir sollten ihr ein Stück Brot in die Hand drücken und sie weiterschicken«, schlug Ewald von Bamberg vor.
Vincentius nickte, blickte wieder hinaus und sah, wie die Frau taumelte und samt dem Kind, das sie auf den Armen trug, zu Boden sank.
»Wie es aussieht, müssen wir ihr helfen«, rief er und öffnete die Pforte neben dem großen Tor.
»Du willst die Frau berühren, Bruder?«, fragte Ewald von Bamberg erstaunt. »Ein Weib ist Sünde und Verführung!«
»Aus dem Alter, verführt zu werden, bin ich mittlerweile wohl heraus. Außerdem ist es Gottes Gebot, den Armen und Schwachen beizustehen.«
Ohne sich von dem Bamberger aufhalten zu lassen, eilte der alte Mönch nach draußen und beugte sich über die Frau. Diese lag still, und nur das rasche Heben und Senken ihrer Brust zeigte, dass sie noch lebte. Das Kind hingegen schrie zum Gotterbarmen.
Bruder Vincentius musste es aus den Armen der Frau winden, um nachsehen zu können, ob es sich bei dem Sturz verletzt hatte. Die kleinen Gliedmaßen waren jedoch unversehrt, und das Kind wies nur eine kleine Beule an der Stirn auf. Der alte Mönch ahnte, dass es mehr aus Schreck und Hunger weinte, und winkte den Bamberger zu sich.
»Nimm du das Kind, Bruder Ewald! Ich will zusehen, dass ich die Mutter in die Pförtnerstube schaffe.«
»Aber nicht weiter hinein!«, erwiderte der Bamberger abwehrend und nahm das Kind an sich. Als er sah, wie sehr sich Vincentius mit der Frau abmühte, schüttelte er den Kopf.
»So geht es nicht, Bruder Vincentius! Nimm du das Kind, und ich kümmere mich um die Mutter. Ich werde Gott heute Abend durch Fasten und Gebet um Verzeihung bitten, dass ich sie berührt habe.«
Vincentius empfand den Bamberger Mönch als seltsam, denn wo Hilfe nötig war, tat man dies in Gottes Namen und musste diesen dafür nicht um Vergebung ansuchen. Doch ihm sollte es recht sein. Er ließ die Frau aufatmend los, übernahm das Kind und brachte es in die Pförtnerstube. Wenig später schleifte Ewald die Frau herein. Zu tragen hatte er sie nicht gewagt, um Gott nicht zusätzlich zu erzürnen. Immerhin hatte er bei seinem Gelübde geschworen, Frauen zu meiden und keine von ihnen zu berühren. Gegen diesen Eid hatte er nun verstoßen und würde Gott dafür im Gebet um Vergebung bitten.
Vincentius hingegen überlegte, wie sie Mutter und Kind am besten helfen konnten. »Bruder Ewald, sei so gut und hol Bruder Cyprian. Er ist in der Versorgung von Wunden und dem Heilen von Krankheiten beschlagener als unser Bruder Apotheker. Und bring ein wenig Hühnersuppe mit. Das Kind hat gewiss Hunger, und ich wage es nicht, ihm in seinem Zustand feste Nahrung zu geben. Außerdem brauche ich Tücher, die sich als Windeln eignen. So wie es riecht, ist seine jetzige Windel schon länger nicht mehr gewechselt worden.«
»Hoffentlich ist es ein Knabe«, sagte Ewald von Bamberg.
»Und wenn es ein Mädchen ist, werde ich ihm trotzdem die Windeln wechseln!« Nun ärgerte Vincentius sich doch über Ewalds Bedenkenträgerei. So konnte man vielleicht in Bamberg handeln, wo es genug Knechte gab, die einem Mönch unangenehme Pflichten abnahmen. Hier aber hieß es, zuzugreifen, und die Einzigen, die dazu in der Lage waren, waren sie beide und Pater Cyprian.
6.
Pater Cyprian war ein derb gebauter Mann, der fast vier Jahrzehnte jünger war als Vincentius, und mit seinen Pranken vermochte er Hufeisen zu biegen. Es gab jedoch im weiten Umkreis niemanden, dessen Hände bei der Behandlung von Verwundeten und Kranken sanfter waren als die seinen.
Er untersuchte zunächst das Kind, das sich zu Ewald von Bambergs Erleichterung als Junge erwies, und schob es diesem zu.
»Alle Knochen sind heil! Der Junge hat aber schon länger nichts mehr in den Magen bekommen. Sei also vorsichtig, wenn du ihn fütterst. Vier, fünf Löffel Suppe, mehr verträgt er nicht. Es kommt sonst zum Ausfluss, und der kann bei einem so kleinen Würmchen tödlich sein.«
»Was ist mit dem Weib?«, fragte Ewald und begann, dem kleinen Juan den ersten Löffel Hühnersuppe einzuflößen.
»Das muss ich erst feststellen!« Pater Cyprians Stimme klang bedrückt, denn der Frau waren die Strapazen weitaus stärker anzusehen als ihrem Sohn. Ihr Gesicht war abgezehrt, die Lippen aufgesprungen und blutig, und die Stirn so heiß, dass er das Schlimmste befürchtete.
»Ich werde ihr Arznei einflößen müssen, obwohl sie bewusstlos ist. Bruder Vincentius, du wirst mithelfen! Halte sie so, dass sie sich nicht verschlucken kann. Sollte etwas in die Luftröhre gelangen, könnte es ihr Tod sein.«
»Das wollen wir nicht hoffen.« Vincentius setzte die Frau mit Cyprians Hilfe auf, und dieser begann mit äußerster Vorsicht, ihr ein wenig von seinen Tinkturen in den Mund zu träufeln.
Plötzlich hustete sie, öffnete die Augen und sah sich verwirrt um. »Mi hijo?«, flüsterte sie.
Obwohl die drei Mönche sie nicht verstanden, begriff Bruder Cyprian, was sie meinte, und hob den Jungen auf, damit sie ihn sehen konnte.
»Juanito!« Ein Seufzer der Erleichterung erklang, dann schloss Esmaralda die Augen und versank in einen Zustand, der zwischen Dämmern und einem wie betäubten Schlaf lag.
Es gelang Bruder Cyprian jedoch, ihr all seine Arzneien einzuflößen. Danach sah er sie kopfschüttelnd an. »Sie müsste ausgezogen und gebadet werden und in ein richtiges Bett kommen.«
»Aber nicht hier im Kloster!«, wandte Ewald von Bamberg ein.
»Wir haben bei der Pforte ein paar Kammern für Gäste eingerichtet. Wenn der Abt einverstanden ist, kann sie dort bleiben. Wir müssten nur ein oder zwei Weiber aus dem Ort holen, die sich um sie kümmern.«
»Noch mehr Frauen im Kloster?«, fragte Ewald von Bamberg entsetzt. Ihm passte dies gar nicht, denn er kannte genug Klöster, in denen die nötige Trennung der Geschlechter nicht eingehalten wurde. Bei einigen hieß es sogar, sie bräuchten keine Neueintritte, weil sie für ihren Nachwuchs an Novizen und Nonnen selbst sorgten. Doch auch er begriff, dass man die Frau nicht in der Pfortenstube liegen lassen konnte. Als er Esmaralda genauer betrachtete, nahm er wahr, dass ihr Kleid zwar abgetragen, schmutzig und zerrissen war, aber aus edlen Stoffen wie Samt und Seide bestand.
»Das ist gewiss keine arme Frau«, sagte er zu seinen Mitbrüdern.
Diese achteten jedoch nicht auf ihn, sondern versorgten Esmaralda. Schließlich bat Pater Cyprian Ewald von Bamberg, warmes Wasser in eine der Gästekammern schaffen zu lassen.
»Ich hole unterdessen die Kesslerin. Sie ist eine brave Witwe, die als Hebamme arbeitet, und zwei ihrer Söhne dienen dem Kloster auf den Fluren von Arnoldstein. Sie soll die Fremde entkleiden und waschen.«
»Damit bin ich einverstanden«, erklärte Bruder Ewald und ging los, um einem der minderen Brüder zu befehlen, in der Kammer alles für die Fremde vorzubereiten.
Während der junge Mönch diensteifrig loseilte, gesellte sich ein weiterer Pater zu Ewald von Bamberg.
»Was habe ich da gesehen? Ihr habt ein Weib ins Kloster geholt?«, fragte er.
Ewald nickte. »Bruder Cyprian und Bruder Vincentius waren der Meinung, dass dies das Beste wäre. Die Frau ist sehr erschöpft. Ich halte sie ihrer Kleidung nach für eine Edeldame, die vor den Türken fliehen musste. Immerhin gab es einen Feldzug der Venezianer gegen dieses gottlose Gesindel, und da mag sie ihr Heim verloren haben.«
»Dann hätte sie gewiss Geld bei sich – und Urkunden, die ihre Herkunft bezeugen.«
Zwar hatte Ewald von Bamberg noch nicht nachgesehen, erinnerte sich aber, dass die Fremde eine Tasche am Gürtel trug. »Das mag sein, Bruder Norbert. Ich werde es prüfen.«
Er ging in die Pförtnerstube, in der die Fremde immer noch lag, und Norbert folgte ihm beinahe auf dem Fuß.
»Wer mag sie sein?«, fragte er.
»Sie ist noch zu schwach, um Rede und Antwort stehen zu können. Die wenigen Worte, die sie sagte, gehören zu einer fremden, mir unbekannten Sprache«, antwortete der Bamberger.
»Wäre es Windisch gewesen, hätte Bruder Vincentius es verstehen müssen. Er ist selbst einer der Windischen, auch wenn er hier im Kloster unsere Sprache gut zu sprechen gelernt hat. Er versteht sogar das Welsche, das in Friaul und in Venedig gesprochen wird. Sollte es vielleicht eine Französin sein?«, mutmaßte Pater Norbert.
»Das glaube ich nicht. Ich verstehe ein wenig von dieser Sprache, denn ich habe im Auftrag meines Abtes mehrere Wochen in einem Kloster in Frankreich verbracht«, antwortete Ewald von Bamberg leicht gereizt. Ihm war Pater Norbert zu neugierig, doch er konnte ihn nicht wegschicken, da er zu jenen Arnoldsteiner Mönchen zählte, deren Wort beim Abt etwas galt.
»Helft mir nachzusehen, ob das Weib etwas von Wert oder Urkunden bei sich hat«, sagte er daher und trat wieder in die Pfortenstube.
Pater Cyprian war noch nicht zurückgekehrt, daher blieb ihm die Zeit, die Tasche vom Gürtel der Frau zu nehmen und sie zu öffnen. Pater Norbert, ein hoch aufgeschossener Mann mit angenehm wirkenden Gesichtszügen, blickte ihm über die Schulter.
Als Erstes kam eine goldene Brosche zum Vorschein, die mit Halbedelsteinen besetzt war. Auch wenn deren Wert sich in Grenzen hielt, zeigte es doch, dass keine arme Frau vor ihnen lag.
Norberts Augen leuchteten beim Anblick des Schmuckstücks auf. Als Ewald von Bamberg zwei noch wertvollere Broschen, eine Perlenkette und einen Siegelring zum Vorschein brachte, nickte er anerkennend. »Wie es aussieht, hat das Weib mehr von Wert bei sich, als sich derzeit in der Truhe des Abtes befindet.«
»Dieser Vergleich ist unangebracht«, wies Ewald von Bamberg ihn zurecht. »Was die Fremde bei sich hat, ist wohl ihr Schmuck, den sie bei ihrer Flucht in die Tasche gesteckt hat. Wir werden uns zu späterer Zeit darum kümmern. Vorerst nehme ich alles zu mir und bewahre es auf. Ihr seid meine Zeugen!«, erklärte er Pater Norbert und Bruder Vincentius.
Während der alte Pförtner nickte, warf Pater Norbert einen begehrlichen Blick auf den Schmuck. Den anderen gegenüber aber tat er so, als interessiere er sich nicht für den Besitz der Fremden.
»Es sei, wie du sagst, Bruder Ewald! Wenn du erlaubst, werde ich eine Liste der gefundenen Gegenstände erstellen, so dass ihr Besitz zweifelsfrei erwiesen werden kann.«
Da dies im Sinne Ewalds von Bamberg war, stimmte er zu. »So sei es! Doch ich sehe Bruder Cyprian mit einer der Frauen aus dem Markt den Weg heraufsteigen. Wir sollten die Fremde der Kesslerin überlassen.«
»Es sollte einer von uns dabei sein, wenn die Hebamme sie auszieht. Ich halte es für möglich, dass sie wertvolleren Schmuck und wichtige Dokumente am Leib versteckt hat«, wandte Pater Norbert ein.
Ewald von Bamberg wehrte mit beiden Händen ab. »Wo denkst du hin? Es ist bereits nicht richtig, die Fremde im Kloster zu lassen. Da darf sie auch als Bewusstlose niemanden von uns zur Sünde verführen.«
Pater Norbert lachte spöttisch auf. »Sünde? Was du schon wieder denkst, Bruder! Mir geht es nur darum, dass die Kesslerin nicht etwas findet und mitnimmt. Oder willst du sie durchsuchen, wenn sie das Kloster wieder verlässt?«
»Kesslers Witwe war immer ehrlich und gottergeben! Weshalb sollte sie es plötzlich nicht mehr sein?«, rief Bruder Vincentius, der sich ebenfalls über Pater Norbert ärgerte.
Dieser hob mahnend den Finger. »Weißt du, ob der Teufel sie verführen und zur Unehrlichkeit bringen will?«
»Auf jeden Fall wird er uns nicht verführen. Wir bringen die Fremde in die Kammer und verlassen diese dann, während die Kesslerin sich ihrer annimmt.«
Ewald von Bambergs Stimme ließ keinen Widerspruch zu. Auch wenn er hier in Arnoldstein mit keiner fest umrissenen Aufgabe betraut war, so verfügte er als Abgesandter des fürstbischöflichen Landesherrn über eine Autorität, der sich sogar Abt Christoph beugen musste.
Pater Norbert gab es daher auf zu fordern, dass er bei der Entkleidung der Fremden dabei sein sollte. Stattdessen klopfte er Esmaraldas Kleidung ab, entdeckte aber zu seiner Enttäuschung nichts mehr. Danach half er, die Frau in die Kammer zu bringen, die Bruder Cyprian für sie bestimmt hatte.
7.
Die Kesslerin war seit Jahren die Hebamme im Ort und hatte schon vielen Arnoldsteinern auf die Welt geholfen. In den letzten Jahren waren ihre Fertigkeiten im Verbinden von Wunden jedoch wichtiger geworden. Bei den wiederholten Angriffen türkischer Streifscharen hatte es viele Verletzte gegeben, und wenn sie auch nicht jeden von ihnen hatte retten können, gab es doch viele, die ihr das Leben verdankten.
Für die alte Frau war es daher nichts Neues, an ein Krankenbett gerufen zu werden. Sie musterte die Fremde und das Kind, das in einen Schlaf der Erschöpfung gefallen war, da sein Durst gestillt war und auch der Hunger nicht mehr ganz so sehr zwickte. Obwohl dem Kleinen die Strapazen anzumerken waren, konnte die Kesslerin feststellen, dass es ein hübscher Junge mit feinen, schwarzen Locken war und so gesund, wie man es sich in seiner Lage nur wünschen konnte.
Anders sah es bei der Mutter aus. Als sie Esmaralda entkleidet hatte, zeigte es sich, dass die Anstrengungen der Flucht tiefe Spuren hinterlassen hatten. Schlimmer als das war jedoch das Fieber, das im Körper der Frau wütete. Die Hebamme legte mehrmals die Hand auf ihre Stirn und schüttelte den Kopf. Zwar wusste sie Aufgüsse aus Brombeerblättern, Hagebutten und anderen Pflanzen zu bereiten, doch gegen ein solches Fieber waren sie wohl nicht besser, als wenn sie mit Kirschkernen nach einem Wolf würfe, um diesen zu vertreiben.
Trotzdem ging die Kesslerin zur Tür und streckte den Kopf hinaus. »Ich brauche heißes Wasser und mehrere Kräutersäckchen aus meinem Haus. Sagt der Ria, sie soll Euch die Mittel gegen Fieber geben – und zwar alle!«, wies sie Pater Cyprian an, der zusammen mit Pater Norbert draußen wartete.
Pater Cyprian nickte und wandte sich an Pater Norbert. »Sorge du für das Wasser! Ich gehe ins Dorf hinab.«
»Kann das die Alte nicht selbst tun? Wir sind doch nicht ihre Knechte!«
»Ich muss das Weib waschen und schauen, ob sie Wunden aufweist«, erklärte die Kesslerin und schlug Pater Norbert, der an ihr vorbei einen Blick in die Kammer erheischen wollte, die Tür vor der Nase zu.
Danach säuberte sie Esmaralda vorsichtig, tastete dabei deren Glieder ab, um zu sehen, ob sie verletzt war, und legte ihr schließlich Wadenwickel an, um das Fieber ein wenig zu senken. Da sie ihr die schmutzige Kleidung nicht mehr anziehen wollte, legte sie eine Decke über die junge Frau und widmete sich anschließend dem Jungen.
Ihr erster Eindruck bestätigte sich. Er war in einem weitaus besseren Zustand, als man es anhand seiner abgezehrten und erschöpften Mutter hätte vermuten können.
»Hast gut aufgepasst auf deinen Buben«, lobte sie die Ohnmächtige, während sie die Windeln des Kindes wechselte und es, als es wach wurde und sich verwirrt umsah, mit ein paar Löffeln der mittlerweile kalt gewordenen Hühnersuppe fütterte.
Wenig später brachte Pater Cyprian die von ihr angeforderten Kräuterarzneien, während das heiße Wasser noch auf sich warten ließ.
»Muss wohl erst kochen«, murmelte der Pater und verließ die Kammer wieder, da er seinem Mitbruder Norbert zutraute, diesen Auftrag nicht weitergegeben zu haben.
Kurze Zeit später kehrte er mit einem kleinen Kessel voll dampfendem Wasser zurück.
»Da ist es!«, meinte er überflüssigerweise.
Die Kesslerin hatte unterdessen ihre Kräuter in mehrere Becher verteilt und übergoss diese nun mit dem heißen Wasser. Besonders zuversichtlich wirkte sie nicht. »Ich glaube, das Gebet ist diesmal eine stärkere Medizin für die Frau als meine Kräuter«, sagte sie leise.
»Wir werden die Fremde in unser Gebet aufnehmen«, versprach der Pater und wollte die Kammer wieder verlassen. Da klang erneut die Stimme der Kesslerin auf.
»Hochwürdiger Herr, die Frau braucht ein Gewand. Oder wollt Ihr sie hier so liegen lassen, dass man nur die Decke heben muss, um ihre Nacktheit zu sehen?«
Pater Cyprian blieb an der Tür stehen. »Natürlich nicht! Hast du nicht etwas, das du ihr überziehen kannst?«
»Ich bin ein armes Weib und froh über das, was ich am Leib trage. Außerdem passt ihr mein Gewand nicht, und meine Enkelin ist noch zu klein, um ihr das Hemd zu leihen«, antwortete die Hebamme kopfschüttelnd.
»Ich werde sehen, was ich machen kann. Bleib du so lange da! Ich will nicht, dass sich einer meiner Mitbrüder hier hereinschleicht, um Verbotenes zu betrachten.«
Pater Cyprian klang verärgert, doch er wusste selbst, dass die Bewohner, nachdem die Türken ihre Häuser niedergebrannt hatten, zu arm waren, um sich ausreichend Tuch für Kleidung leisten zu können. Selbst hier im Kloster trugen die Mönche ihre Kutten sehr viel länger, als sie es gewohnt waren.
»Schickt jemanden ins Dorf zur Ria, damit sie heraufkommt und mich ablösen kann. Ich habe zu arbeiten«, forderte die Kesslerin ihn noch auf, bevor er ging.
Pater Cyprian überlegte kurz und beschloss dann, es nicht zu tun. Zwar war das Mädchen erst zwölf Jahre alt, stellte aber trotzdem eine Verlockung für jene Mönche dar, die durch die Schrecken der letzten Jahre im Glauben irregeworden waren. Einer davon war in seinen Augen Pater Norbert. Dieser war früher ein fähiger Mann gewesen und auf dem besten Weg, in der Klosterhierarchie aufzusteigen. Doch seit er das Treiben der türkischen Krieger hatte mit ansehen müssen, fehlte ihm die Innigkeit des Glaubens, die für einen Mönch unabdingbar war.
8.
Zwei Tage vergingen. Bruder Cyprian hatte im Dorf ein sauberes Hemd aufgetrieben, so dass Esmaraldas Blößen bedeckt waren, und er hatte sein Versprechen eingehalten, für die Fremde zu beten. Doch es schien, als wolle Gott ihn nicht erhören. Zwar war der kleine Junge den Worten der Kesslerin zufolge wieder gesund, doch um seine Mutter stand es schlecht.
»Ich habe ihr eingegeben, was ich hatte«, erklärte die Hebamme an diesem Abend den Patres Cyprian und Norbert.
Der Abt hatte bestimmt, dass immer zwei Mönche die Kammer der Kranken betreten mussten, und nie einer allein. Auch er traute nicht jedem seiner Mitbrüder. In so schlimmen Zeiten wie diesen geschahen oft Dinge, die früher undenkbar gewesen wären.
Pater Cyprian hätte sich einen anderen Begleiter gewünscht, Pater Ewald zum Beispiel. Der Bamberger war ein kluger Kopf, und Abt Christoph hatte bereits anklingen lassen, es sei der Wunsch des Fürstbischofs von Bamberg, dass dieser ihm einmal als Oberhaupt des Klosters nachfolgen solle.
Aber Pater Norbert ging seiner Aufgabe zumindest mit dem nötigen Ernst nach. Er hatte sogar Papier und Feder bei sich, um aufzuschreiben, was die Frau in halber Bewusstlosigkeit von sich gab.
»Es ist möglich, dass wir auf diese Weise erfahren, woher sie kommt«, erklärte er Pater Cyprian, während er wieder ein paar Worte notierte.
»Immerhin haben wir bereits den Namen des Knaben erfahren«, stimmte Bruder Cyprian ihm zu.
»Sie nennt ihn Juanito. Wenn ich mich recht entsinne, könnte dies Spanisch sein und Hänschen bedeuten. Damit ist der Knabe auf den Namen des heiligen Johannes getauft. Wir wissen nur nicht, ob er am Tage des Täufers oder des Evangelisten Namenstag hat«, erklärte Pater Norbert und beugte sich erneut vor, um zu hören, was kaum verständlich aus Esmaraldas Mund kam.
»Felipe. Das müsste auch ein spanischer Name sein und Philipp bedeuten. Daher ist es möglich, dass dies ein spanisches Weib ist«, erklärte er seinem Mitbruder.
»Du bist sehr klug«, sagte Pater Cyprian anerkennend.
Pater Norbert nickte zufrieden, doch dann huschte ein Ausdruck des Unwillens über sein Gesicht. »Was nützt jede Klugheit, wenn andere aufgrund ihrer Herkunft oder der Protektion durch hohe Herrschaften den Vorzug erhalten? Pater Ewald zum Beispiel könnte strohdumm sein. Da aber der Fürstbischof ihn sich als Abt Christophs Nachfolger wünscht, wird er wohl gewählt werden, mögen auch andere zehnmal besser dafür geeignet sein.«
Pater Cyprian begriff durchaus, dass sein Mitbruder dabei an sich dachte. Vor einigen Jahren hatte es so ausgesehen, als werde Pater Norbert einen bedeutenden Rang im Klostergefüge einnehmen. Er war jedoch mit seinem Ehrgeiz angeeckt und hatte jene Mitbrüder mit Missgunst verfolgt, die er, ob zu Recht oder Unrecht, als diejenigen ansah, die seinem Aufstieg im Weg standen.
»Das Kloster ist autonom! Der Fürstbischof kann uns keinen Abt gegen unseren erklärten Willen aufzwingen«, antwortete er.
Pater Norbert lachte. »Glaubst du wirklich, hier würde es einer wagen, sich gegen Fürstbischof Philipp von Henneberg zu stellen? Wir sind auf seine Gnade und seine Großzügigkeit angewiesen, wenn wir Arnoldstein wieder in die Höhe bringen wollen. Da sagt keiner etwas, und wenn er einen fünfjährigen Sohn, den er mit seiner Mätresse haben sollte, zum Abt erheben würde.«
Pater Cyprian missfiel es, dass Pater Norbert von allen Menschen immer nur das Schlechteste annahm. Dabei war Ewald von Bamberg vermutlich am besten geeignet, den Fürstbischof dazu zu bewegen, wenigstens einen Teil der Straßenzölle, die von den Mautstellen eingezogen wurden, für den Wiederaufbau des Klosters und der zugehörigen Dörfer zu verwenden. Dies Norbert zu erklären, war jedoch vergebene Liebesmüh.
»Ich glaube, sie sagt wieder etwas«, rief er und reichte dem Mitbruder die Feder.
»Wenn ich diese Sprache wenigstens verstehen würde. So muss ich sie nach dem Hörensagen aufschreiben und weiß nicht einmal, wann ein Wort zu Ende ist!«, erklärte Pater Norbert aufstöhnend, während seine Feder über das Papier flog.
Nach einer Weile sah er zu Pater Cyprian hoch. »Das Tintenfass scheint leer zu sein. Wärst du so gut, Bruder, es zu füllen? Ich versuche, mir derweil zu merken, was sie sagt.«
Es war nicht im Sinne des Abtes, wenn ein Mönch mit der Frau allein blieb. Andererseits konnte das, was sie sagte, wichtig sein. Pater Cyprian zögerte daher nur kurz und verließ dann doch die Kammer.
Er hätte sich keine Sorgen machen müssen, denn die Frau sah viel zu elend aus, um Pater Norbert als Mann zu reizen. Zudem wagte der Mönch es wegen ihres hohen Fiebers nicht, sie zu berühren, sondern lehnte sich zurück und starrte gegen die Wand. Nie zuvor hatte er für seine Zukunft so schwarz gesehen wie in diesen Tagen. Obwohl es ihm gelungen war, die Gunst des Abts zu erringen, würde er in der Hierarchie nicht so hoch aufsteigen, wie er es gehofft hatte. Ewald von Bamberg mochte ihn nicht und würde, sobald er Abt Christoph nachgefolgt war, ihn höchstens mit nachrangigen Pflichten beauftragen.
Plötzlich sah die Kranke den Pater an und sagte etwas, das ihrer Miene nach »Wo bin ich hier?« bedeuten konnte.
»Wie geht es dir, meine Tochter?«, fragte er zuerst auf Deutsch und wiederholte es dann in lateinischer Sprache.
Esmaralda atmete auf. Zwar wusste sie nicht, wie sie an diesen Ort gelangt war. Es konnte eine Burg sein oder vielleicht sogar ein Kloster, weil ein Mönch bei ihr wachte. In ihrer Kindheit hatte sie teilweise am Unterricht ihrer Brüder teilnehmen dürfen und dabei ein wenig Latein gelernt. Zwar musste sie sich anstrengen, um die passenden Worte zu finden, konnte aber in dieser Sprache antworten.
»Wo bin ich hier?«
»Du befindest dich im Kloster Arnoldstein, meine Tochter.«
»Wo ist mein Sohn?« Esmaralda sah sich erschrocken um und atmete auf, als sie den Jungen auf einem Strohsack neben ihrem Bett entdeckte. Juan schlief, bewegte aber die Händchen und sah gesund aus.
»Wer bist du, meine Tochter?«, fragte Pater Norbert.
»Ich bin Esmaralda de Azuaga, die Witwe von Don Felipe de Azuaga y Carrion.«
»Ihr seid von Adel?« Pater Norbert beugte sich gespannt näher, denn eine adelige Dame und deren Sohn zu retten, konnte eine Belohnung bedeuten. Dabei verschwendete er keinen Gedanken daran, dass diese nicht an ihn, sondern an das Kloster gehen würde.
»Mein Gemahl war der jüngere Sohn des Grafen Don Rodrigo de Azuaga y Pinjara.«
»Der jüngere Sohn?« Das schränkte eine mögliche Belohnung wieder ein. Dennoch faszinierte der Gedanke Pater Norbert, und er bat Esmaralda, ihm mehr über sich und die Familie ihres Mannes zu erzählen.
Sie tat es, denn sie war froh, jemanden zu haben, dem sie sich anvertrauen konnte. Da sie ihre Schwäche spürte und begriff, dass sie der Schwelle des Todes näher war als dem Leben, tat sie dies auch für ihren Sohn. Obwohl ihr Schwiegervater sie abgelehnt und gehasst hatte, hoffte sie doch, er würde sich seines Enkels annehmen und ihn zu sich holen lassen. Sie redete daher, ohne ihre Kräfte zu schonen. Pater Norbert erfuhr nun, dass ihr Ehemann sie gegen den Willen seines Vaters geheiratet hatte und dafür von diesem verstoßen worden war.
Die Belohnung, die er bereits vor Augen gesehen hatte, zerrann im Nichts, und er ärgerte sich, dass Esmaralda de Azuaga nach Arnoldstein gekommen war. Dabei gab es in dieser Gegend genug Orte, an die sie sich hätte wenden können. Die Stadt Villach zum Beispiel oder die Burgen Landskron und Finkenstein, die Kaiser Friedrich III. zu eigen waren. So aber würde sein Kloster, das durch den Türkeneinfall arm geworden war, für die nächste Zeit auch noch die Frau und ihren Sohn durchfüttern müssen.
Esmaralda wollte noch so viel sagen, doch sie spürte, dass die Hitze in ihrem Leib wieder stieg. Ihr Blick verschleierte sich, und sie vermochte nur noch mit Mühe ihre Gedanken zu ordnen. Schließlich sank sie mit einem Seufzer zurück und fiel erneut in einen Zustand lähmender Bewusstlosigkeit.
Just in dem Augenblick kehrte Pater Cyprian mit dem Tintenfass zurück. »Hat sie noch etwas gesagt?«, fragte er.
Pater Norbert schüttelte den Kopf. »Kein Wort! Sie lag da wie eine Tote.«
Eigentlich hatte er sich vorgenommen, das, was er erfahren hatte, nicht mehr aufzuschreiben. Nun überlegte er doch, es zu tun. Immerhin war es möglich, dass er in späteren Zeiten dieses Wissen noch brauchen konnte.
»Ich kehre in meine Zelle zurück«, sagte er und nahm Papier, Feder und Tintenfass an sich.
»Aber ich kann nicht allein hierbleiben«, protestierte Pater Cyprian.
»Das musst du auch nicht. Ich werde Bruder Vincentius bitten, sich zu dir zu gesellen. Es reicht, wenn er von Zeit zu Zeit auf den Weg hinausschaut.« Pater Norbert lachte bei diesen Worten leise und verließ den Raum.
Wenig später betrat der Bruder Pförtner den Raum. »Ich werde die Tür offen lassen, damit ich höre, wenn jemand gegen das Tor pocht«, erklärte er und setzte sich zu Pater Cyprian. »Wie geht es ihr?«
Pater Cyprian hob in einer resignierenden Geste die Hände. »Wenn der Allmächtige nicht doch noch unsere Gebete erhört und für sie ein Wunder tut, wird sie schon bald in die Ewigkeit eingehen.«
»Es wäre wirklich schade! Die Kesslerin sagt, sie muss bis zuletzt um ihren Sohn besorgt gewesen sein.«
»Habt ihr wenigstens ihren Namen erfahren?«, fragte der Pförtner.
»Nur den des Buben, den ihren jedoch nicht.« Pater Cyprian bedauerte dies sehr, denn er hätte den Angehörigen der jungen Frau gerne eine Botschaft gesandt, damit diese von ihrem Schicksal erfuhren und sich des Kleinen annehmen konnten.
»Es ist ein Kreuz auf dieser Welt!«, fuhr er fort. »Manchmal frage ich mich, weshalb unser Herr im Himmel uns Menschen so prüft. Es sind so viele, die rein im Herzen waren, den Schwertern der Ungläubigen zum Opfer gefallen, während andere, die es verdient hätten, am Leben geblieben sind.«
»Du solltest nicht an Gottes Gerechtigkeit zweifeln, Bruder Cyprian«, mahnte der Pförtner. »Wir Menschen vermögen seine Pläne nicht zu durchschauen. Doch er ist die Macht und die Herrlichkeit, und wenn er Unschuldige Qualen erdulden lässt, dann nur, um sie ungesäumt in sein Himmelreich aufzunehmen, während andere ihr Leben weiterführen müssen, um vielleicht doch noch durch gute Taten seine Vergebung zu erlangen.«
»Du hättest Priester werden sollen, anstatt an der Pforte zu sitzen«, antwortete Pater Cyprian mit einer gewissen Bewunderung für den schlichten, aufrechten Glauben des alten Mannes.
Die beiden Mönche unterhielten sich noch lange, wenn auch flüsternd. Als die Nacht heraufzog, zündete Bruder Vincentius zwei Fackeln an und steckte sie draußen in Halterungen, damit er erkennen konnte, wenn sich jemand näherte. Irgendwann wurde der Junge wach. Obwohl er sichtlich Hunger hatte, kämpfte er sich auf seine kurzen Beine und eilte zum Bett der Mutter.
»Mama!«, flehte er und fasste nach ihrer Hand.