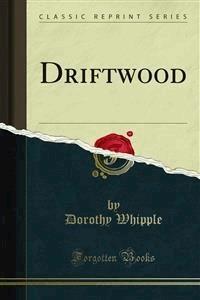14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit zwanzig Jahren ist Ellen North glücklich verheiratet mit ihrem Mann Avery, sie haben zwei Kinder und leben in der idyllischen Peripherie Londons. Doch dann tritt Louise in ihr Leben, eine junge Französin, die eingestellt wurde, um der ungeliebten Schwiegermutter Gesellschaft zu leisten. Mit frisch gekränktem Stolz, weil sie kurz zuvor von ihrem Freund verlassen wurde, und einer gehörigen Portion Je ne sais quoi fängt Louise an, sich bei der Schwiegermutter unverzichtbar zu machen und nebenbei Avery zu umgarnen. Mit Erfolg. Die alte Welt, wie Ellen sie kannte, ist bedroht: Wie kann sie sie selbst bleiben und sich trotzdem neu erfinden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Dorothy Whipple (1893–1966) war eine britische Bestsellerautorin von Romanen, Kurzgeschichten und Kinderbüchern. Während sie sich in den 1930ern größter Beliebtheit erfreute, gerieten ihre Werke nach dem Krieg in Vergessenheit. Die britischen Neuausgaben einiger ihrer Romane in den letzten Jahren trugen in ihrer Heimat wesentlich zu ihrer Wiederentdeckung bei. Der französische Gast (1953) war ihr letzter Roman und ist das erste Buch von ihr, das ins Deutsche übersetzt wurde.
ÜBER DAS BUCH
Ist das nicht das pure Familienglück? Mit ihrem Mann Avery, einem Verleger, und ihren fast erwachsenen Kindern wohnt Ellen North in einem idyllischen Landhaus in der Nähe von London. Doch dann tritt Louise, eine junge Französin, in ihr Leben – und verändert sie alle bis zur Unkenntlichkeit. Die alte Welt, wie Ellen sie kannte, ist bedroht: Wie kann sie sie selbst bleiben und sich trotzdem neu erfinden?
EINS
I
Eines Tages gab die alte Mrs North ihrem lange gehegten Wunsch nach, jemand würde ihr wieder Gesellschaft leisten, und antwortete auf ein Inserat in der Times. Sie lebte als Witwe in dem Haus, das ihr Mann gebaut hatte, samt Spiel- und Schlafzimmer und einem Musikzimmer für die Kinder, als blieben die für immer bei ihnen, statt so früh wie möglich zu heiraten und fortzugehen.
Mrs North war von ihrem Ehemann verwöhnt worden, doch nun, da er tot war und ihre drei Kinder verheiratet, verwöhnte sie niemand mehr. Sie kam bei niemandem mehr an erster Stelle, und das missfiel ihr. Einer Frau, die drei Kinder zur Welt gebracht hatte, stand es ihrer Meinung nach zu, im Alter von ihnen umsorgt zu werden. Wozu hatte man Kinder, wenn man sie kaum zu Gesicht bekam? Cecily, ihre Tochter, die ihr eine Stütze hätte sein können, hatte es sich einfallen lassen, einen Amerikaner zu heiraten, und lebte in Washington. Während des Kriegs schickte sie zwar großzügige Pakete, das schon, und kam auch selbst, kaum dass er vorbei war. Natürlich fuhr sie aber wieder hinüber und ließ ihre Mutter so einsam zurück wie zuvor.
Der verstorbene George North hatte eine Strumpfwarenfabrik gegründet und zum Erfolg geführt, und auch wenn seine Söhne noch substanzielle Einnahmen daraus bezogen, war keiner von ihnen in die Firma eingestiegen. Howard, der ältere, arbeitete im Außenamt. Es hatte nach einer hervorragenden Stellung ausgesehen, als sein Vater ihm dazu verhalf, führte aber dazu, dass Howard sein Leben mit seiner Frau im Osten verbrachte, dem Nahen wie dem Fernen, und seine Mutter ihn bloß selten sah. Nur Avery, der Jüngste der Familie, war in ihrer Nähe geblieben.
Avery hatte eine Beteiligung an einem Verlagshaus erworben, dessen Büroräume unweit der Strand Street in London lagen und das seit nun fünfzehn Jahren unter dem Namen Bennett und North firmierte. Drei Meilen außerhalb der Kleinstadt Newington, in der seine Mutter lebte, besaß er ein Haus auf dem Land und fuhr von dort aus jeden Tag nach London, das eine Stunde entfernt war.
Die alte Mrs North klagte unablässig darüber, dass sie Avery, seine Frau Ellen und seine beiden Kinder so gut wie nie zu sehen bekam. Von den Kindern hatte Hugh, der Sohn, gerade seinen Wehrdienst angetreten, und Anne, die Tochter, ging ins Internat. Avery war dauernd in London, und Ellen war dauernd beschäftigt, weil sie keine Hausmädchen hatte. Niemand hatte heute noch Hausmädchen, schon gar nicht, wenn man auf dem Land lebte.
»Warum zieht ihr nicht alle zu mir? Das Haus ist so groß und so leer …«, sagte Mrs North von Zeit zu Zeit.
Doch ihre Einladung wurde nicht angenommen, und es war ihr eigentlich auch recht. So konnte sie einen beständigen Groll gegen die Schwiegertochter hegen, weil die sie nicht öfter besuchen kam. Außerdem wären die Kinder ihr zu viel. Die jungen Leute strapazierten ihre Nerven.
Mrs North beschäftigte eine Haushälterin, eine Miss Daley, die, von Zugehfrauen unterstützt, alles penibel in Ordnung hielt, bedauerlicherweise jedoch im Kirchenchor sang. Bedauerlich zumindest für Mrs North, denn zum einen war sie der Meinung, Miss Daleys Stimme sollte überhaupt niemand hören müssen, sie war viel zu kräftig, und zum anderen führte ihre Leidenschaft Miss Daley mittwochs zum Proben und sonntags für die Auftritte außer Haus. Dem Kirchenchor galt Miss Daleys brennendes Interesse, und die Interessen anderer waren Mrs North ein Ärgernis. Der Gesang ihrer Haushälterin und die Gartenarbeit ihrer Schwiegertochter beanspruchten Zeit, die, wie sie fand, mit ihr verbracht werden sollte. Sie hatte schließlich ein Recht darauf; auf Miss Daleys Zeit, da Miss Daley dafür bezahlt wurde, und auf Ellens Zeit, da sie als Averys Frau Pflichten gegenüber dessen Mutter hatte.
»Ich bin eben alt«, sagte Mrs North zu ihrem Sohn. Sie sagte es verbittert, denn es gefiel ihr nicht, alt zu sein. »Ich kann wohl nicht erwarten, dass Ellen mehr Zeit mit mir verbringt als unbedingt nötig.«
»Ellen hat immer zu tun, Mutter«, verteidigte Avery sie. »Du weißt doch, wie schwierig Zugehfrauen heutzutage sind. Wir finden einfach niemanden, der am Nachmittag noch den weiten Weg aus der Stadt auf sich nimmt. Ellen muss das Abendessen deshalb immer selbst zubereiten. Und sie arbeitet so viel im Garten. William Parkes ist alt. Er hat alle Hände voll zu tun mit dem Küchengarten und mit Annes Stute.«
»Dann solltest du Parkes aus dem Cottage herauswerfen und jemanden einstellen, der tüchtiger ist. Ich verstehe auch nicht, Avery, warum du ein Pferd hältst, wenn Anne es nur drei oder vier Monate im Jahr reiten kann. Es wäre doch viel besser, ihr mietet …« Sie war vom Thema abgekommen und hatte darüber ihre Klage vergessen, dass Ellen keine Zeit mit ihr verbrachte, weil sie alt war.
Es lag nicht an ihrem Alter. In Somerton Manor, einem Landhotel, in dem Ellen und die Kinder in den Kriegsjahren einige Wochen gewohnt hatten, gab es eine Mrs Brockington, die ebenfalls alt war und mit der Ellen liebend gern Zeit verbrachte.
Eigentlich wollte Mrs North Ellens Art der Gesellschaft auch gar nicht. Sie wollte etwas, was Ellen ihr nicht bieten konnte, und Ellen hatte keine Ahnung, was das war. Sie merkte nur, dass sie nicht gut miteinander auskamen, was schade war, schließlich liebten sie beide Avery. Ellen gab sich selbst große Schuld daran, denn manchmal vergaß sie ihre Schwiegermutter sträflich lange, drei volle Tage, ehe sie erschrocken wieder an sie dachte.
Ach, du liebe Zeit, ich bin nicht … ich habe nicht angerufen … Das letzte Mal, wann war das? Dann ließ sie das Gartengerät fallen, zog die Gummistiefel aus, wusch sich die Hände, streifte ein Kostüm über, holte das Auto heraus, fuhr zu ihrer Schwiegermutter und konnte abends dann erleichtert zu Bett gehen, da sie erst in ein, zwei Tagen wieder hinmusste. Trotzdem schämte sie sich.
Eines Abends im Juni fiel ihr plötzlich die alte Mrs North ein, als sie Avery mit ihrem Auto vom Bahnhof abholte, weil seines in Reparatur war.
»Deine Mutter!«, rief Ellen aus.
»Was ist mit ihr?«, fragte Avery.
»Fahren wir für fünf Minuten bei ihr vorbei. Ich hab sie diese Woche nur einmal besucht und du gar nicht.«
Avery murrte, es sei heiß gewesen in London, und er wolle nach Hause.
»Ich weiß, Liebling. Und ich habe etwas auf dem Herd – nur auf einen Sprung«, redete sie ihm zu.
Sie fuhr durch das Tor, hinter dem das spätviktorianische Backsteinhaus aufragte, mit seinen Türmchen und Zinnen und den speziellen Tafelglasfenstern, auf die George North seinerzeit bestanden hatte.
Mrs North saß auf dem Sofa im Salon, neben sich ein paar abgegriffene Schulbücher, hinter sich an der Wand eine Sammlung von Miniaturen, die ihren Ehemann, sie selbst und ihre Kinder in frühen Jahren zeigten. Die Rahmen aus Elfenbein ließen die ganze Familie chronisch krank aussehen.
»Guten Tag, Fremdlinge«, sagte die alte Dame bissig.
»Ich weiß, Mutter«, sagte Ellen und gab ihr einen Kuss. »Aber die Tage fliegen nur so an mir vorbei. Mein Leben kommt mir vor wie eine einzige Hetzerei …«
»Ja, meine Liebe, das habe ich aus deinem Munde schon gehört. Wollt ihr euch setzen? Nein? Das hatte ich auch nicht erwartet. Ich nehme an, ihr wollt nach Hause. Nun ja, das ist nur natürlich. Dann lasst euch nicht aufhalten, ihr beiden. Mir geht es gut, es ist alles in Ordnung. Danke fürs Kommen. Auf Wiedersehen.«
Avery lachte. Für Ellen war es damit aber nicht getan. Außerdem war ihr nicht nach Lachen zumute; sie war zerknirscht. Jetzt, wo sie einmal da waren, meinte sie, müssten sie auch ein Weilchen bleiben. Sie wollte sich gerade auf einem Stuhl niederlassen, da fasste Avery sie fest am Arm und lotste sie zur Wohnzimmertür. Als sie dort angekommen waren, veranlasste Mrs North sie zum Innehalten.
»Ich habe auf eine Anzeige geantwortet«, sagte sie.
Sie wandten sich um.
»In der Times von gestern.« Sie hielt ihrem Sohn die zusammengefaltete Zeitung hin. Über seine Schulter hinweg las Ellen die markierte Stelle.
»Junge Französin möchte den Juli und August in einem englischen Haus verbringen. Französische Konversation. Leichte häusliche Tätigkeiten …«
»Aber warum willst du eine Französin?«, fragte Avery.
»Wenn du mal in meinem Alter bist, Avery«, sagte seine Mutter, »wirst du feststellen, dass du auch gelegentlich Gesellschaft benötigst.«
»Aber du könntest doch jederzeit eine englische Gesellschafterin haben, Mutter.«
»Ich hätte gern eine Französin«, erwiderte Mrs North bestimmt.
»Deshalb liegen da die französischen Grammatiken?«, sagte Ellen, die sich über die Schulbücher gewundert hatte. »Ich konnte mir gar nicht denken –«
»Du hättest fragen können, meine Liebe«, unterbrach sie Mrs North. »Um genau zu sein, ich poliere mein Französisch auf.«
Ellen fand irgendetwas an dieser Ankündigung so rührend und hilflos, dass sie nach der Hand von Mrs North griff.
Avery lachte vergnügt. »Du bist ein tapferes altes Mädchen.«
»Ich halte das für eine sehr gute Idee«, meinte Ellen. »Das macht bestimmt Spaß.«
»In meinem Alter erwarte ich keinen Spaß«, gab Mrs North zurück. »Aber ich hoffe, es wird interessant. Ich bin zu alt, draußen nach Abwechslung zu suchen, also schau ich, ob ich mir Abwechslung ins Haus holen kann. Mir ist es hier zu still.«
»Ja«, sagte Ellen kleinlaut.
Mrs North entzog Ellen ihre Hand mit einer gewissen Ungeduld.
»Das ist mein altes Exemplar der französischen Redewendungen«, sagte Avery, der keine Ahnung hatte, was zwischen den Frauen vor sich ging. »Wie ich die Schwarte gehasst habe! Heute gibt es bessere Bücher, Mutter. Soll ich dir welche aus der Stadt mitbringen?«
»Nein, vielen Dank. Wenn die junge Frau kommt, werde ich keine Zeit haben, viel zu lernen. Und wenn sie nicht kommt, lerne ich eben nichts. Ihr beiden könnt jetzt gehen. Ich bin sicher, Ellen hat etwas auf dem Herd, worum sie sich kümmern muss.«
»Oh, ja, hab ich«, rief Ellen und eilte mit fliegender Jacke aus dem Zimmer. »Das habe ich ganz vergessen. Avery, komm … Auf Wiedersehen, Mutter … Auf Wiedersehen …«
II
Auf der Ausfallstraße aus der Stadt wimmelte es an diesem schönen Sommerabend von Fahrrädern. Ellen, die es eilig hatte, nach Hause zu kommen, musste bremsen, drückte auf die Hupe, zog ein finsteres Gesicht und ärgerte sich.
»Warum müssen die zu viert nebeneinanderfahren?«, sagte sie und wich einer Radfahrerin mit bloßen Beinen aus, die nach links ausschwenkte und sich dann mit so verlegenem Lächeln auf die Unterlippe biss, dass Ellens Missmut verflog und sie das Lächeln gutmütig erwiderte. »Ich sollte mich mehr um deine Mutter kümmern«, sagte sie.
»Es geht ihr gut«, sagte Avery entspannt. »Sie hat doch eigentlich Glück. Gut versorgt, genügend Geld, bei guter Gesundheit trotz der Klagen über ihr Herz. Verglichen mit anderen alten Leuten heute …«
»Oh, da hast du recht«, gab Ellen, die sich nicht zu lange unbehaglich fühlen wollte, zu. Das konnte Avery gut, Dinge ins Licht der Vernunft rücken. »Stell dir das vor, eine junge Französin«, sagte sie und setzte das Gespräch zwanglos, wie bei Ehepaaren üblich, fort. »Ich hab alles Französisch, das ich mal konnte, wieder vergessen, du nicht?«
Avery erhob die Stimme und führte sein Können vor. »Si par hasard tu vois ma tante«, sang er. »Complimente-la de ma part.«
Ellen lachte entzückt. »Mach weiter!«
»Kann ich nicht.«
»Ich verrate dir einen französischen Ausdruck, der mir neuerdings laufend begegnet und den ich nicht leiden kann«, verkündete sie und touchierte die Knöchel einer anderen Radfahrerin. »L’homme moyen sensuel.«
»Mais c’est moi«, sagte Avery blitzartig. »Das passt haargenau.«
»Natürlich nicht«, sagte Ellen entrüstet. »Du bist kein Durchschnitt.«
Seine Familie würde niemals zulassen, dass er etwas Tadelnswertes an sich fand. »Bin ich zu dick?«, sagte er manchmal und spreizte beunruhigt die Hände über den Rippen, worauf alle mit so viel Verve im Chor Nein riefen, dass er ihnen fast glauben konnte. Trotzdem legte er mit seinen dreiundvierzig Jahren allmählich zu. Bis jetzt unterstrich es nur sein blendendes Aussehen. Er war groß, und es passte zu ihm, etwas kräftiger gebaut zu sein.
»Wir geben nächste Woche eine Party für Geddes Mayes. Du weißt schon, den Amerikaner«, sagte er jetzt.
»Oh, tatsächlich? Muss ich mitkommen?«
»Nein. Nicht, wenn du nicht möchtest.«
»Hurra. Ich würde lieber im Garten bleiben.«
Schuldbewusst und vergnügt mied sie die Partys, die Bennett und North für Autoren, Agenten und ähnliche Leute gaben. Anfangs hatte sie mit jugendlichem Elan noch tun wollen, was man für ihre Pflicht als Gattin des Verlegers halten konnte, war lächelnd von einem Grüppchen zum anderen gewandert. Aber alle unterhielten sich lautstark, und auch wenn hier und da mal jemand zur Seite trat, um sie passieren zu lassen, unterbrach niemand für sie sein Gespräch. Schmal, blond und ohne eine Vorstellung davon, wie sie Eindruck machen konnte, sah sie unbedeutend aus, und niemand fragte sich, wer sie war. Allmählich wurde es stickig in den Räumen und die Luft so verraucht, dass sie das Gefühl hatte, sie würde sich entzünden, wenn sie ein Streichholz hineinhielt. Womöglich züngelten dann kleine Flämmchen über den Häuptern der Autoren wie auf den alten Darstellungen von Pfingsten. Von irgendeiner Form der Erleuchtung hätten dann auch Bennett und North profitiert.
Neben Averys Büro lag eine Junggesellenwohnung, in der er übernachtete, wenn er in der Stadt bleiben musste, und dorthin entfloh Ellen immer wieder, erfrischte sich und brachte etwas Zeit herum. Sie sah die Kleider durch, die Avery dort hatte, kontrollierte, ob sie etwa von Motten befallen waren, sie strich den Inhalt der Schubladen glatt und sammelte ein paar vergessene Taschentücher für die Wäsche ein. Nicht dass ihr Ordnung besonders wichtig war, aber es war eine Beschäftigung.
In dem leeren Büro gleich nebenan setzte sie sich an seinen Schreibtisch und versuchte, sich das Leben vorzustellen, das er fern von ihr verbrachte. Wie war es, hier Avery zu sein? Er war wichtig und besaß Macht, wurde von Sekretärinnen und Stenotypistinnen bedient, teils sehr attraktiven jungen Frauen. Vermutlich wurde er von einigen bewundert, dachte Ellen ruhig. Sie war sich seiner zum Glück sicher.
Als sie das Gefühl hatte, schon zu lange weg gewesen zu sein, ging sie zurück zur Party, auf der es war wie vorher, nur mit inzwischen noch stickigerer und blauerer Luft. Sie lächelte ganz starr, stand an Averys Seite und war froh, als es vorbei war.
Aber es nahm sowieso niemand Notiz davon, ob sie da war oder nicht, und so blieb sie inzwischen weg.
Die Aufgabe, Partys zu besuchen und selbst welche zu geben, blieb meist an Avery hängen, denn John Bennett, sein Partner, war kein größerer Partyfreund als Ellen. Kurz vor seinem Rückzug in den Ruhestand hatten Thomas Bennett, Johns Vater, große Zukunftssorgen in Bezug auf die Firma geplagt. Auf sich allein gestellt, würde John, wie er wusste, sich an das Büro klammern wie eine Schnecke an ihr Haus. Sein Interesse galt Büchern und ihrer Herstellung. Er würde den ganzen Tag dasitzen und lesen, diskutieren, Projekte wälzen und kaum die Nase vor die Tür stecken. Er war scheu, war kein Gesellschaftsmensch. Er brauchte jemanden, der Kontakte mit der Außenwelt knüpfte, der dafür sorgte, dass die Firma von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde und der sie am Laufen hielt. Avery stellte sich genau im richtigen Augenblick vor. Er verstand zwar nichts von Büchern und hatte wohl auch kein großes Interesse daran, besaß aber Fähigkeiten im gesellschaftlichen Umgang. Er sah gut aus, war sympathisch. Sie fanden, er wäre die richtige Ergänzung, und sein Vater war bereit, eine erkleckliche Summe in die Firma einzubringen.
George North war einer jener viktorianischen Industriellen gewesen, die Kultur ehrfürchtig bewunderten. Er förderte Literatur und Musik. Daher das Musikzimmer in The Cedars, ihrem Haus in Newington, in dem zumeist nur der dünne Sopran seiner Tochter erklang, manchmal aber auch ein gefeierter Künstler einen Liederabend für eingeschüchterte und beeindruckte Gesellschaften gab, die nicht wussten, was sie sagen sollten, wenn er vorbei war. Die Vorstellung, dass sein Sohn Verleger sein würde, erfüllte George North mit Freude und Stolz, und Avery selbst fand sowieso alles andere besser als das Strumpfgeschäft. Ihm gefiel der Gedanke, in London zu arbeiten und abends aufs Land zurückzukehren.
Er machte sich daran, seine Rolle zu lernen. In der Anfangszeit bei Bennett und North verhielt er sich klug. Er verriet sich nie, sagte nur wenig. Er lächelte, hob eine Braue, murmelte etwas und amüsierte sich insgeheim darüber, dass er damit davonkam. Selbst lachte er oft über sich, passte aber auf, dass kein anderer Anlass hatte, über ihn zu lachen. Er tastete sich vorwärts und gewann Selbstvertrauen. Er verhärtete sich, und wenn andere, die mit ihm zu Mittag aßen und ihn für ein Leichtgewicht hielten, dann die Entschlossenheit bemerkten, die gelegentlich hinter seiner lässigen Fassade hervorschien, ging ihnen plötzlich auf, dass sie besser auf der Hut sein sollten.
Seine Frau kannte seine Beharrlichkeit. Sie lächelte, wenn sie daran dachte, wie unermüdlich er um sie geworben hatte. Sie hatte ihn anfangs nicht heiraten wollen, doch er ließ nicht locker, und schließlich willigte sie ein und liebte ihn seitdem bedingungslos.
Nicht dass er sie am Anfang nicht verwirrt hätte. In ihrer ersten gemeinsamen Zeit schmollte er heftig, wenn sie ihn kränkte. Aß nicht, um sie zu bestrafen, sprang entweder vom Tisch auf, ohne sein Essen angerührt zu haben, oder weigerte sich gleich, zu Tisch zu kommen. Ellen war erstaunt. Sie war damals noch sehr jung gewesen und umschmeichelte ihn nicht, wie seine Mutter es getan hatte, sondern sah ihn nur weiter mit großen grauen Augen an wie ein Kind, das über das unerklärliche Verhalten eines anderen staunt. Sie selbst aß weiter, wenn er schlechte Laune hatte, und hätte nicht im Traum auf die Mahlzeit verzichtet.
Als seine Kinder, die die wachen, interessierten Augen ihrer Mutter geerbt hatten, alt genug waren und Averys üble Launen mit derselben Überraschung verfolgten, legte er sie ab. Im Grunde brauchte er sie nicht mehr, denn er und Ellen stritten sich nur selten und niemals ernsthaft.
Es gab einen Avery, den nur Ellen kannte. Den Avery, der in der Nacht, in der ihr erstes Kind geboren wurde, an ihrem Bett auf die Knie ging. Als er Ellen nach den entsetzlich langen Wehen endlich sehen durfte, kniete er vor dem Bett nieder, sein Gesicht auf einer Höhe mit ihrem, seine Augen voller Tränen.
»Liebling, ich dachte, du stirbst …«
»Sch. Jetzt geht es mir gut. Hast du ihn gesehen?«
Sie blickten sich lächelnd in die Augen. Sie war eins mit ihm und er mit ihr. Es war der kostbarste Augenblick ihres gemeinsamen Lebens. Die Geburt des zweiten Kindes war leichter, doch Ellen vergaß ihn nie, den Moment damals, in dem ihr Mann vor dem Bett gekniet hatte, absolut er selbst, ganz der Ihre. Das, bar aller kleinen Eitelkeiten und Gereiztheiten, war der wahre Avery gewesen, und sie liebte ihn von ganzem Herzen.
»Gleich zu Hause«, sagte Ellen glücklich, verließ die Hauptstraße und bog unter den Ulmen ab.
»Die Straße wirkt heute Abend irgendwie nett, obwohl sie so sehr nach Vorstadt aussieht«, sagte Avery und ließ den Blick über die gepflegten Grasstreifen, die akkuraten Hecken und die Zierbäume schweifen.
»Sie sieht immer nett aus«, murmelte Ellen liebevoll. »Ich hab mich inzwischen richtig an die Häuser gewöhnt.«
Vor zwanzig Jahren, als Averys Vater ihnen Netherfold zur Hochzeit schenkte, war ihr Haus das einzige in dem schmalen Sträßchen gewesen, ein reizendes kleines Herrenhaus, dreihundert Jahre alt. Jetzt hatten sich etwa zwanzig Häuser drum herum versammelt, und obwohl die Norths anfangs sehr verärgert gewesen waren, fanden sie sich nach und nach damit ab, Nachbarn zu haben, und sei es nur aus dem Grund, dass sie für Kinder sorgten, mit denen ihre eigenen spielen konnten.
Als Ellen durchs Tor fuhr, kam eine kleine Katze, schwarz mit weißem Brustlatz und weißen Pfoten, vergnügt angesprungen und begrüßte das Auto.
»Moppet, Liebling«, säuselte Ellen, stieg aus dem Auto und hob das Tier hoch. »Bin ich lange weg gewesen? Avery, nimm sie, ich muss mich beeilen.«
Avery nahm das geliebte Kätzchen, und Ellen eilte davon.
Morgens und abends hatte sie am meisten zu tun, und immer, wenn sie Hilfe am dringendsten brauchte, hatte sie keine. Dienstmägde, die auch bei ihren Arbeitgebern wohnten, waren aus den Haushalten schon lange verschwunden. Nachdem sie es bereits mit Auswärtigen und Haushälterinnen versucht hatte, sowohl »verheiratet« als auch »berufstätig«, mit Kindermädchen und diversen anderen Haushaltshilfen, die jedoch alle zu wünschen übrig ließen, tat Ellen, was ihre Nachbarn taten, und stellte Zugehfrauen ein, die tageweise oder eher halbtageweise kamen. Mrs Pretty und Miss Beasley wechselten sich an den Vormittagen ab, mehr konnten sie nicht anbieten. Sie waren in ihrer Straße sehr gefragt, denn sie gehörten zu den wenigen Frauen, die sich breitschlagen ließen, so weit rauszufahren, obwohl es in der Stadt doch viele Anstellungsmöglichkeiten gab.
Ellen hätte mehr Hilfe haben können, wenn sie weniger »weich« wäre, wie Mrs North es ausdrückte. Neben dem Stall stand ein kleines Häuschen, in dem ein fähiger Gärtner und Koch unterkommen konnte, aber dort wohnten William Parkes und seine Frau Sarah. Sie waren bereits dort, als die jungen Norths nach Netherfold kamen, und blieben es, obwohl es, wie Sarah selbst als Erste zugab, mit ihr schon »vorbei« war, und mit William, wie er oft sagte, »bald vorbei sein« würde. Ellen brachte es nicht übers Herz, sie vor die Tür zu setzen. Sie waren so alt, sagte sie, und hatten so lange in dem Häuschen gelebt.
Sie komme zurecht, sagte sie. Das sagte sie immer. Mrs Pretty war nicht gerade penibel bei dem, was sie tat, und wenn sie gegangen war, machte Ellen das meiste noch einmal. Aber sie sei so nett, sagte Ellen, so warmherzig und angenehm.
»Meinetwegen«, sagte Avery, der diese Dinge nicht am Hals haben wollte. »Wenn du willst, mach halt alles selbst.«
Ellen hatte einen Wecker, den sie mit ins Bett nahm, damit Avery das Ticken nicht hörte. Sie stand um sieben Uhr auf, winters wie sommers. Die Zeit bis zum Frühstück war für sie mit viel Lauferei, Warten und Hinaufrufen verbunden, weil Avery nur schlecht aus dem Bett fand und folglich mit allem spät dran war. Abends war sie mit Kochen, mit dem Auftragen der Speisen, dem Abwaschen, Aufräumen und den Vorbereitungen für den Morgen beschäftigt. Auch an diesem Abend im Juni tat sie dies alles, während Avery, das Kätzchen auf dem Arm, durch den Garten schlenderte und Ellen im Haus hin und wieder etwas zurief. Sie wolle ihn nicht in der Küche haben, weil er, sagte sie, nach London ein bisschen an die frische Luft musste, und er war einverstanden, wenngleich nur unter Protest.
Es war noch hell, als die Norths um halb elf Türen und Fenster schlossen und nach oben gingen. Ellen war nach der Hetzerei froh, in ihr bequemes Bett zu kommen, das ungefähr einen Meter von Averys entfernt stand. Die Vorhänge wurden zurückgezogen und die Fenster zu dem sanften Himmel hin geöffnet. Der köstliche Duft des nächtlichen Gartens drang herein. Ellen seufzte glücklich, als sie auf dem Kissen die richtige Stelle für ihren Kopf fand.
»Ach herrje«, sagte sie gleich darauf. »Ich hab ja meine Gebete noch gar nicht gesprochen.«
»Kannst du nicht im Bett beten?«, murmelte Avery.
Aber sie war schon draußen und auf den Knien, den Kopf in die Daunendecke vergraben. Avery glaubte nicht an Gott. Gegen jede Logik gefiel es ihm aber, dass Ellen es tat. Es passte irgendwie zu ihr, und es war besser für die Kinder, von einer Mutter großgezogen zu werden, die an etwas glaubte, vor allem in der heutigen Zeit.
Wieder im Bett, kam Ellen auf ein Thema zurück, das sie beim Beten ein bisschen abgelenkt hatte. »Glaubst du, dass die Französin kommt?«
»Wohl eher nicht«, sagte Avery. »Sie wird jede Menge Zuschriften bekommen. ›Leichte häusliche Tätigkeiten‹, das spricht viele Leute an. Warum sollte sie sich für Mutter entscheiden?«
ZWEI
Als der Postbote am frühen Morgen auf seiner Runde in der Rue des Carmes anlangte, hielt er vor der »Librairie-Papeterie Lanier, Spécialiste du Stylo« an und warf mehrere Briefe durch den Schlitz in der Tür.
Madame Lanier, in Morgenmantel und Filzpantoffeln, eine Schürze um die üppige Mitte gebunden, kam durch den Flur an der Treppe geschlurft, durchquerte den Laden, dessen Auslagen noch abgeschlossen waren, und hob die Briefe vom Steinboden auf. Während sie langsam durch den Laden zurückging, inspizierte sie die Umschläge. Ihre Tochter kam gerade die Treppe herunter.
»Sind die Briefe für mich?«, fragte sie mit schneidender Stimme.
Madame Lanier, beim Schnüffeln erwischt, zuckte schuldbewusst zusammen. »Ja, ich glaube, die sind alle für dich. Ja, sind sie.«
»Dann gib sie mir bitte«, sagte Louise und streckte gebieterisch die Hand aus.
Madame Lanier lieferte sie ab, und Louise stieg wieder nach oben. Ihre Mutter ging in die Küche und trug einen Krug Café-au-lait ins Esszimmer, wo Monsieur Lanier bereits am Tisch saß.
»Was war denn?«, sagte er und goss sich Kaffee in seine Schale.
»Die Post. Es war alles für sie«, antwortete Madame Lanier. Sie schenkte sich selbst Kaffee ein, schlug die schlaffe, große Serviette auf und schob einen Zipfel zwischen die beiden oberen Knöpfe ihres Morgenmantels. Ihr Ehemann hatte seine bereits um den Hals gebunden.
Einen kurzen Moment waren beide damit beschäftigt, Brotrinde zu zerreißen und in ihren Kaffee zu werfen, wo sie wie Enten in einem Teich dümpelten. Dann griffen sie nach ihren großen grauen Löffeln und aßen mit einem Appetit, den nicht einmal das unzulängliche Benehmen ihres einzigen Kindes schmälern konnte.
»Ich verstehe nicht, warum sie noch einmal nach London fahren will«, sagte Madame Lanier. »Die drei Monate, die sie in Foxton war, genügen doch. Wenn Amerikaner in den Laden kommen, loben die immer ihr Englisch.«
Monsieur Lanier tat es mit einem Achselzucken ab. »Sie ist siebenundzwanzig«, sagte er. »Es wird Zeit, dass sie heiratet. Sie wartet zu lange damit.«
»Aber was sollen wir machen, wenn sie niemanden findet? Die Zeiten sind vorbei, in denen Kinder geheiratet haben, wen ihre Eltern für sie aussuchten. Was schade ist, weil damit oft Kummer erspart blieb und es weiß Gott meist erfolgreicher war, als wenn sie sich selbst jemanden ausgesucht haben«, sagte Madame Lanier, drückte sich den Laib an die Brust und schnitt mit einem scharfen Messer zwei weitere Scheiben Brot ab.
»Vergiss aber nicht, dass unsere Tochter sehr intelligent ist«, sagte der Vater auf seine präzise Weise. »Die bisherigen Bewerber waren doch ein wenig unter ihrem Niveau.«
»Waren sie, ja.« Madame Lanier räumte es mit Freuden ein. »Und obwohl nicht einmal ich behaupten kann, dass sie schön ist, hat sie etwas. Sie hat Stil, sie sticht heraus.«
»Psst«, sagte ihr Ehemann. »Sie kommt. Guten Morgen, Louise.«
»Guten Morgen, Papa«, sagte Louise mit Zurückhaltung, aber sie merkten dennoch, dass sie heute bessere Laune hatte, und ihre Mienen hellten sich auf.
»Einen kleinen Moment, mein Liebling«, sagte Madame Lanier und erhob sich vom Tisch. »Ich bringe dir deinen Kaffee.«
Louise, die mit den Fingern auf die Briefe trommelte und mit leerem Blick vor sich hinstierte, ließ es zu. Ihr Gesicht war glatt wie Elfenbein und von ebensolcher Farbe. Ihre dunklen Augen verliefen an den Außenwinkeln ein wenig nach oben. Ihr glänzendes dunkles Haar war in der Mitte gescheitelt und in ihrem schmalen Nacken zu einem Knoten zusammengebunden. Ihre Lippen hatte sie schon zum Frühstück purpurrot geschminkt, was ihr allerdings gut stand und zum Lack auf den Nägeln der schmalen Hände passte.
Sie setzte sich in das Hinterzimmer, wo die Gerüche zahlloser guter Abendessen noch in den dunklen Ecken waberten, wo der hellbraune Porzellanherd den Sommer über kalt blieb, wo eine schlaffe Decke mit großen roten und weißen Karos über den Tisch gebreitet war, wo wirklich nichts von Geschmack zeugte, ja nicht einmal vom Bemühen darum. Bemerkenswert war hier nur Louises auffällige, fast erlesene Eleganz, ein Gegenstück ihrer beiden aus der Form geratenen Eltern.
Sie trug ein Kleid aus einem feinen schwarzen Stoff mit schmalem Kragen. An der Wand hinter ihr hing eine vergrößerte Fotografie von ihr im Alter von acht Jahren, auf der sie mit einem Puppenwagen auf dem Rasen des Marktplatzes stand. Auf dem Bild trug sie ein Samtkleid, einen weißen Kragen, weiße Strümpfe und einen gekräuselten Hut, unter dem ihre dunklen Augen mit einer ganz unkindlichen Wehmut hervorsahen.
Genau dieses Kleid war der Anlass für Louises ersten Wutanfall und ihren ersten Sieg über ihre Mutter gewesen.
»Ich finde es scheußlich«, hatte sie geschrien, als sie eines Tages von der Schule nach Hause kam. Sie hatte die Hände in die Taille gekrallt, als wollte sie es sich vom Leib reißen. »Das ziehe ich nicht mehr an. Du willst, dass alle über mich lachen. Du weißt nicht, was man anziehen muss. Ich will ein blaues Sergekleid. Ich will ein blaues Serge–«
»Mein Liebling, du bekommst eines. Wein doch nicht, mein Engel. Du tust dir noch weh. Mutter dachte nur, es gefällt dir vielleicht –«
»Du weißt überhaupt nichts. Du bist so dumm …«
Von dem Tag an teilte Louise ihrer Mutter mit, was sie für sie kaufen sollte, und das, bis sie sich ihre Kleider selbst kaufte. Heute erschien sie in schlichtem Schwarz mit, immerhin, einem goldenen Armband, an dem Dutzende kleiner Anhänger baumelten. Wo sie das wohl herhat, dachte ihre Mutter, wagte aber nicht zu fragen.
»Hier, mein Kind«, sagte Madame Lanier und kam mit dem Kaffee angelaufen.
»Merci, maman.«
Madame Lanier war hocherfreut. Ihr wurde nicht oft gedankt, in letzter Zeit seltener denn je. Sie setzte sich mit seligem Gesicht vor ihren erkaltenden Kaffee. Niemand konnte liebenswürdiger sein als Louise, wenn sie denn wollte, dachte sie. Sie wartete ruhig ab und war sich sicher, dass Louise bald von den Briefen anfangen würde, trotzdem achtete sie darauf, nicht einmal flüchtig zu den Umschlägen auf dem Tisch zu schauen. Sie hütete sich, offen Interesse zu zeigen.
Erst als die Kaffeeschale ihrer Tochter fast leer war, wurde ihr Takt belohnt.
»Ich habe heute Morgen fünf Antworten auf meine Anzeige bekommen«, sagte Louise. »Das macht dann insgesamt sieben.«
»Wirklich?«, riefen ihre Eltern gleichzeitig aus und stürzten sich wie zwei ausgehungerte Hühner auf diesen Brosamen Auskunft. Er war im Nu verschlungen, und sie warteten gespannt auf mehr.
»Ich glaube, hier ist das, was ich möchte«, sagte Louise voller Zufriedenheit, zog einen Brief aus seinem Umschlag und führte die erhaben gedruckte Anschrift vor.
»Gutes Papier«, murmelte ihr Vater anerkennend. »Es ist distinguiert, seine Anschrift so drucken zu lassen, und kostet eine hübsche Stange Geld.«
»Oh, so sind die Briefe alle«, sagte Louise, zog sie heraus und verstreute sie über den Tisch. »Alles gute Häuser, aber ich habe mich für das hier entschieden.«
Ihr Vater rückte die Brille zurecht, ihre Mutter beugte sich vor und sprach langsam: »The Cedars, Newington.«
»Wie ist der Name dieser Person?«, fragte ihr Vater.
»North.«
»Ça veut dire Nord, je crois?«
»Ja.«
»Tiens, Madame Nord. C’est assez curieux, ça«, staunte Madame Lanier.
»Und was schreibt sie?«, fragte Monsieur Lanier, der die Gelegenheit nutzen und so viel in Erfahrung bringen wollte, wie er konnte.
»Sie schreibt, sie sei verwitwet, schon älter, aber bei guter Gesundheit. Und reich, vermute ich, denn das ist ein Foto des Hauses.«
Sie schnipste eine Fotografie in Richtung ihrer Eltern, und sie vertieften sich beeindruckt in die Türmchen und Befestigungen, Erkerfenster und Terrakottazierelemente, die der verstorbene George North mit so viel Stolz zu einem Bau vereint hatte.
»C’est une maison solide«, tat Monsieur Lanier kund.
»Was sollst du für diese Madame North tun?«, fragte Madame Lanier.
»Mich mit ihr auf Französisch unterhalten«, sagte Louise.
Sie ließ ihr Angebot zur Übernahme leichter Hausarbeit unerwähnt. Sie war so darauf bedacht, nach England zu fahren, dass sie sich so gefällig wie möglich präsentiert hatte. Da sie der Hausarbeit daheim jedoch erfolgreich aus dem Weg ging, sollten ihre Eltern nicht wissen, dass sie im Ausland welche übernehmen würde.
»Hat diese Frau Kinder?«, fragte ihr Vater.
»Nicht in ihrem Haus. Deswegen fahre ich dorthin. Ich bin nicht an Kindern interessiert. Sie hat einen Sohn, der in der Nähe wohnt. Der hat Kinder. Er ist Verleger.«
»Tatsächlich«, sagte ihr Vater mit lebhaftem Interesse. »Das ist ja merkwürdig. Dann gehst du sozusagen von Büchern zu Büchern. Aber es gibt solche Verleger und solche. Soll ich Erkundigungen einziehen? Das wäre leicht und auch klüger.«
»Wie du willst«, sagte Louise achselzuckend. »Aber ich werde fahren. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich kenne die Engländer und weiß, dass das eine achtbare Frau ist.«
Die Augen der Eltern verweilten voller Stolz auf ihrem Kind. Allein schon aus dem Anblick der eigentümlichen und für sie unleserlichen englischen Handschrift konnte Louise auf die Persönlichkeit der Schreiberin schließen. Ja, sie konnte auf sich aufpassen. Sie war alles andere als gewöhnlich.
Louise trank ihren Kaffee aus, und ihre Mutter den ihren, nun ziemlich kalt.
»Und wann würdest du fahren?«, fragte Monsieur Lanier.
»Anfang Juli.«
»Dann kommst du im August also nicht mit deinem Vater und mir nach Binic?«, sagte ihre Mutter wehmütig.
»Ah, Binic«, gab Louise zurück und lachte auf. »Gott sei Dank nicht, nein. Ich werde dieses Jahr im August nicht in Binic sein.« Sie faltete ihre Serviette zusammen, schob sie in die Leinenhülle und stand auf. »Ich komme heute Vormittag für ein oder zwei Stunden in den Laden, Papa.«
»Ah, das ist nett von dir, mein Kind. Wenn du das tust, könnte ich ein bisschen Ordnung machen.«
»In dem Fall, mein Liebling«, sagte Madame Lanier, »räume ich dein Zimmer auf.«
»Sehr gern«, sagte Louise.
Vater und Tochter gingen und bereiteten den Laden für die Öffnung vor. Sie waren bereits präsentabel angezogen, Madame jedoch noch nicht. Das würde sie auch erst sein, wenn sie mit Cécile, der femme de ménage, die tagsüber kam, die Betten gemacht, Louises Zimmer, in das sie Cécile nicht hineinließ, selbst aufgeräumt und das Mittagessen sowie einen Biscuit de Savoie gemacht hatte, der Louises Appetit beim Abendessen anregen sollte. Anschließend wollte sie die Kleider ihres Mannes, Louises Kleider und ihre eigenen ausbürsten, und zwar gründlich. Wie alle Französinnen hielt Madame Lanier große Stücke auf das Ausbürsten und verbrachte täglich viel Zeit damit auf dem Treppenabsatz.
Anschließend wollte sie sorgfältig Toilette und sich für den Laden parat machen, wo sie sittsam in Hemdbluse und voluminösem schwarzem Rock erschien, die Haare nach oben gekämmt und in Form eines Kranzes sicher auf dem Haupt befestigt.
Madame Lanier gehörte zu der Schicht und Generation von Französinnen, die fand, dass die äußerliche Erscheinung eines Menschen auf den ersten Blick anzeigen sollte, dass der Betreffende ehrbar war. Niemals, so hatte man es ihr beigebracht, durfte man falsche Vorstellungen dadurch befördern, dass man sich hübsch machte. Sie war in ständiger Sorge, was die Leute wohl von ihrer Tochter hielten, und musste sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass die jungen Mädchen heute alle so waren. Die anständigen waren von den leichten nicht zu unterscheiden.
Als sie an diesem Vormittag gegen halb zwölf geschnürt und frisiert im Laden erschien, sagte Louise: »Endlich.«
»Ich gehe jetzt aus, ein bisschen frische Luft schnappen«, fügte sie hinzu.
»Tu das, mein Liebling, es ist ein wunderschöner Vormittag. Das wird dir guttun«, sagte ihre Mutter, die außer an Sonntagen nur selten das Haus verließ.
Louise trat auf die sonnenbeschienene Straße. Amigny war eine Kleinstadt, es gab aber immer viel Lärm und Bewegung, und heute mehr denn je, da auf der Place de la Cathédrale ein kleiner Markt stattfand. Fahrradklingeln schepperten unablässig, Lastwagen rumpelten, Autos hupten, Menschen überquerten die Straße von einer Seite zur anderen und wieder zurück, begrüßten einander, schüttelten sich hastig die Hände.
Louise ging zwischen den Menschen hindurch; sie wurde gegrüßt und grüßte zurück, stellte eine Freundlichkeit zur Schau, die sie nicht empfand. Die Stadt war provinziell, die Leute waren dumm. Sie hatte das Leben hier schon lange satt. Früher hatte sie es einfach verachtet, doch heute verabscheute sie es. Anmerken ließ sie sich das aber nicht. Vielleicht brauchte sie Amigny und die Leute hier irgendwann noch mal, sehr wahrscheinlich sogar. Sie sah nun keine andere Zukunft mehr als eine Ehe mit jemandem aus dem Distrikt, vermutlich mit André Petit, dem Apotheker. Das wollte sie jedoch so lange hinauszögern wie möglich, wollte jeder anderen Möglichkeit die Chance geben, sich zu bieten.
Sie machte ein paar Einkäufe, damit sie einen Grund dafür hatte, nicht zu Hause zu sein. Sie hatte sich schon lange angewöhnt, jeder ihrer Regungen einen Deckmantel überzuziehen. Sie machte eine Runde durch die halbe Stadt, am baumgesäumten und fast menschenleeren Boulevard entlang, bevor sie in eine sonnenbeschienene, völlig leere Gasse einbog. Glyzinien purzelten in malvenfarbigen Kaskaden über eine hohe Gartenmauer. Als Louise katzengleich an dieser Mauer entlangschlich, öffnete sich darin, wie sie es erwartet hatte, eine Tür, und ein junger Mann trat heraus, der ein Fahrrad vor sich herschob.
Es war einer der drei Söhne der Familie Devoisy, die einen großen Teil von Amigny besaßen, darunter die Kreidesteinbrüche vor der Stadt. Die Familie war reich und durfte sich sogar auf adelige Vorfahren berufen. Der junge Mann hier, Paul, der Liebling seiner Mutter, war angeblich nicht sehr kräftig. Er radelte mitten am Vormittag nach Hause, um sich an der Bewegung, der frischen Luft und einer Tasse von dem zu stärken, was seine Mutter in dem Moment für ihn ratsam fand.
Bei Louises Anblick blieb Paul stocksteif stehen, einen Ausdruck von Verlegenheit im Gesicht, das von romantischer Blässe war und das ein schmaler dunkler Schnurrbart zierte. Er sah sich sogar nach einer Fluchtmöglichkeit um, wie ihr nicht entging. Ihre Unverschämtheit war einschüchternd. Sie trat näher, fixierte ihn mit dunklen Augen, und seine Verlegenheit nahm zu.
»Du brauchst keine Angst zu haben«, sagte sie. »Ich werde dich nicht bloßstellen. Nicht mehr lange, und ich verschwinde sowieso. In zwei Wochen gehe ich nach England.«
Paul riss die Augen auf; er hatte Wimpern wie ein Mädchen.
»England!«, sagte er. »Das kommt plötzlich, nicht?«
»Dachtest du, ich bleibe hier und steh dir bei deiner Hochzeit bei?«, fragte Louise.
Er zog ein finsteres Gesicht und sah weg.
»Das ist alles, was ich dir mitteilen wollte«, sagte sie, rang sich ein Lächeln ab und zeigte ihre makellosen kleinen Zähne. »Guten Tag und auf Wiedersehen. Wie du siehst, bist du ganz leicht aus dieser Sache herausgekommen, besser als erwartet, nicht?«
Sie ging davon, von Zorn und Stolz verzehrt. Es ging nicht darum, dass sie ihn noch liebte, sagte sie sich, aber es war unerträglich, wie sie behandelt wurde, weil ihr Vater nur Buchhändler war. Wie sie beiseitegeschoben wurde, damit er Germaine Brouet heiraten konnte, die Tochter eines Anwalts, ein mustergültiges Mädchen, ein Vorbild an Frömmigkeit und Güte und, nach Louises Ansicht, unglaublich und unverbesserlich fade.
Am Ende der Gasse sah sie sich um. Paul radelte in die entgegengesetzte Richtung. Sah nicht zurück. Sie hatte nicht vergessen, wie er sie früher aus einem Versteck heraus beobachtet hatte. Und wie sie, kaum war er an einer Ecke abgebogen, selbst dorthin zurückging und nachsah, ob er noch da war. Das war er immer, und sie liefen beide lachend los und mussten sich dann ein zweites Mal trennen.
Gott, was für ein Leben, wenn alles zu Ende ging, wenn alles zu nichts führte und man Ausschau nach etwas Neuem halten musste.
England! Wie langweilig, fahren zu müssen. Doch sie musste. Sie musste hier weg.
DREI
Am ersten Tag der Sommerferien hatte Anne North nur selig im Garten unter dem Kirschbaum gelegen, weil es für alles andere schlicht zu heiß war. Doch nach dem Abendessen hatte es sich so weit abgekühlt, dass sie tun konnte, was sie immer an ihrem ersten Tag zu Hause tat, nämlich auf Roma, ihrer Stute, auszureiten, begleitet von ihrem Vater, der auf dem alten, nur für diesen Zweck benutzten Fahrrad neben ihr hereierte.
Ellen beugte sich zum Treppenfenster hinaus und sah die zwei lachend entschwinden. Als ihr eigener Vater noch lebte, hatte sie nur selten mit ihm gelacht, und wenn, dann nur aus Höflichkeit. Das natürliche, liebevolle Band zwischen Avery und Anne empfand Ellen als etwas sehr Ungewöhnliches.
Mit strahlendem Gesicht sah sie auf die sich entfernenden Köpfe hinab, das Haar Annes silbrig hell, das Averys dunkel und am Hinterkopf so minimal lichter werdend, dass man es nur von einem oberen Hausfenster oder über das Treppengeländer hinweg ausmachen konnte.
Als ihre Stimmen und das gemächliche Getrappel der Hufe Romas auf der Straße erstorben waren, zog Ellen sich vom Fenster zurück, nachdem sie einen letzten Blick zum Himmel geworfen hatte, der über den Ulmen indigoblau war und etwas versprach, was er nicht hielt. So dunkel war er in den letzten Tagen schon öfter gewesen, geregnet hatte es trotzdem nie.
Sie ging nach unten und wusch das Geschirr vom Abendessen, das sie zwar gern über Nacht für Mrs Pretty stehen gelassen hätte, aber nicht stehen ließ, weil es genug andere Arbeit gab, die jeden Morgen erledigt werden musste. Sie spülte und trocknete ab und trauerte am Spülbecken vor dem weit geöffneten Fenster um ihren Garten. Er war so trocken. Die Wiesen waren ausgedörrt, und Rosen, Flammenblumen, Stiefmütterchen und Löwenmäulchen lechzten nach Regen.
Die Vogeltränke war wieder leer. Die durstigen Vögel, der durstige Stein, die Sonne selbst hatten das ganze Wasser ausgetrunken. Ellen ging mit einem Krug hinaus und füllte die Tränke nach. Sofort, als habe es nur darauf gewartet, erschien ein Rotkehlchen und nahm ein Bad. Wieder am Spülbecken, sah Ellen ihm zufrieden zu. Sie kümmerte sich gern um alles. Im Garten rettete sie ständig die eine oder andere Pflanze, fand bessere Standorte, päppelte auf.
Sie scheuerte die Pfannen und sah nach draußen. Vom Tennisplatz der Wilsons drangen aus der Ferne dumpfe Spielgeräusche herüber. Weniger weit entfernt klapperte plötzlich eine Amsel wie eine Schere.
»Moppet«, rief Ellen und beugte sich zum Fenster hinaus.
Ein kleines schwarz-weißes Katzengesicht schob sich fragend unter der dichten Hecke hervor.
»Dachte ich mir’s doch«, schimpfte Ellen. »Lass die Vögel in Frieden und komm her. Na los. Ich geb dir Milch.«
Moppet hatte die liebenswerte Angewohnheit, auch wirklich zu kommen, wenn sie gerufen wurde. Sie galoppierte über die Wiese, machte einen Satz durch das Küchenfenster und hockte sich gleich vor ihre Untertasse.
»Jetzt bin ich fertig«, sagte Ellen zufrieden und hastete zur Gießkanne. Die Wasservorräte im Kreis waren so knapp, dass die Verwendung von Gartenschläuchen untersagt war.
Mit der schweren Kanne in der einen und dem schweren Eimer in der anderen Hand lief sie etliche Male zwischen dem Waschhaus und den Rabatten hin und her, schüttete sich dabei eine Menge Wasser vorn auf ihr Leinenkleid, fing kräftig an zu schwitzen und sank schließlich in die Gartenschaukel, um sich auszuruhen. Sie schaukelte sacht und ließ den Blick über ihr Königreich schweifen, ihren Garten.
Wie der Wind, so jedenfalls schien es, kam Anne von der Koppel angerannt, erst auf dem Plattenweg zwischen den Apfelbäumen und dann über die Wiese, und ließ sich mit so viel Schwung in die Schaukel plumpsen, dass die Federn hüpften. Sie rieb die Wange am bloßen Arm ihrer Mutter und seufzte wohlig.
Ellen blickte zärtlich auf ihre fünfzehn Jahre alte Tochter hinab. Sie sah nur blassgoldenes Haar, eine klare Stirn und die aufsteigende Kurve dunkler Wimpern.
»Das Ausreiten war himmlisch. Roma ist wie ein Lämmchen, nicht? Ach, Mami, ich bin so froh, zu Hause zu sein.«
Sie kuschelte sich an ihre Mutter und schaute zum Haus hinüber.
»Schöner als hier kann man nicht wohnen, oder? Ich stelle es mir immer vor, wenn ich im Internat schlafen gehe. Und denke darüber nach. Aber manchmal bekomme ich auch schlechte Träume davon. Dass ich wiederkomme und es sieht alles anders aus, verlassen, oder es wohnt jemand anders hier. Und ich bin schrecklich traurig, aber dann wache ich auf und merke, dass es bloß ein Traum war.«
Anne hatte die Hand ihrer Mutter gehalten und spürte plötzlich die Furchen und Schwielen auf dem Handteller.
»Mami«, sagte sie verwundert. »Deine Hände sind so hart. Die fühlen sich an wie das Zeug, das man in Vogelkäfige tut, damit sich der Vogel den Schnabel wetzen kann. Du weißt schon – Fischbein.« Diese Vorstellung fand sie so lustig, dass sie laut lachen musste.
Ellen lachte mit, allerdings kläglich. »Es ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber du hast recht«, sagte sie. »Ich muss etwas unternehmen. Aber die Gartenarbeit und das Spülen …«
»Oh«, stöhnte Anne zerknirscht auf. »Ich wollte doch heute Abend abspülen, aber ich habs vergessen. Es tut mir so leid, Mami«, sagte sie und gab ihrer Mutter zur Entschädigung einen Kuss. »Ist die Hausarbeit dir nicht lästig? Du tust sie doch nicht etwa gern? Spülen, Pfannenscheuern, Feuermachen, das macht dir doch keinen Spaß, oder, Mami?«
»Tja«, sagte Ellen und sann darüber nach, »Spaß macht es eigentlich nicht, aber das gehört alles dazu, wenn man sich um das Haus kümmert und um euch alle, und das macht mir zumindest Freude.«
Nach der Angst des Kriegs, nach den Trennungen und Gefahren war es wunderbar, dass sie alle in Sicherheit und zusammen waren, wenn man von den leichten Einschränkungen in Form von Schultrimestern und dem Militärdienst absah.
»Ich bin sehr froh, dass ich mich um das Haus kümmern kann«, sagte sie. »Und um den Garten.«
»Tja, ich hasse Hausarbeit«, sagte Anne. »Was ich im Internat machen muss, ist mir viel zu viel. Wir haben so wenig Dienstmädchen, dass wir an manchen Tagen das Essen auftragen und abwechselnd die Klassenzimmer und Schlafräume sauber machen müssen. Das hassen einfach alle. Wenn ich mit der Schule fertig bin, suche ich mir eine Arbeit, bei der ich keine Hausarbeit tun muss.«
»Was willst du denn mal machen?«, fragte ihre Mutter.
»Vielleicht gehe ich zur Bühne«, sagte Anne. »Oder ich schreibe Romane. Wozu hat man einen Verleger zum Vater, wenn man das nicht ausnutzt?« Sie lächelte unter den Wimpern hervor und wollte schauen, wie ihre Mutter diese raffinierte Auskunft aufnahm.
»Nein«, sagte sie, rutschte herum, legte den Kopf in Ellens Schoß und zog die Knie heran. »Ich eröffne wahrscheinlich eine Reitschule, dann brauche ich gar nicht von zu Hause wegzugehen. Die kann ich doch von hier betreiben, nicht? Aber egal, was ich mal mache oder wo ich bin, Roma werde ich immer haben. Pferde können doch ein langes Leben haben, nicht?«, fragte sie besorgt.
»Ja«, versicherte ihr Ellen. »War das ein Auto auf der Straße? Ich hoffe, es kommt niemand.«
»Das kann nicht sein«, sagte Anne abwehrend. »Wir erwarten doch niemanden.«
Sie schaukelten sacht. Avery war zwischen den Rabatten aufgetaucht, knipste hier und da verblühte Blüten ab und warf sie – leider, dachte Ellen – auf den Rasen. Sie schloss die Augen. Sie fühlte sich wohl und war sehr schläfrig. Anne hatte die Augen auch zu.
Als Ellen die Augen aufschlug, standen zwei Gestalten vor ihr, eine bekannte und eine fremde.
»Oh, Großmama!« Anne schwenkte ihre Beine auf die Erde und richtete sich verblüfft auf.
»Wir waren schon eine ganze Weile im Haus«, sagte Mrs North tadelnd. »Aber es war niemand da. Jeder hätte alles mitnehmen können.«
Ellen betrachtete die Fremde. Die ernste, hochelegante Person musste das französische Mädchen sein. Ellen war ganz perplex, mit so jemandem hätte sie nie und nimmer gerechnet.
»Ellen, das ist Mademoiselle Louise Lanier«, sagte Mrs North. »Mademoiselle, meine Schwiegertochter. Ma belle fille, n’est-ce pas?«
»Oh, Mami, so ein schönes Kompliment für dich«, rief Anne.
»Keineswegs«, sagte Mrs North. »Das ist Französisch für Schwiegertochter. Das solltest du in deinem Alter, Kind, eigentlich wissen, würde ich meinen. Meine Enkelin, Mademoiselle. Ma petite fille.«
»Guten Tag«, sagten Mutter und Tochter.
»Ich dachte ja, du wärst schon eher einmal zu deiner Großmutter gekommen, Anne«, sagte die alte Dame und bot ihre Wange dem Mädchen zum Kuss an.
»Oh, Großmama, ich wollte ja auch kommen. Aber ich freue mich immer so sehr, wieder zu Hause zu sein, dass ich die ersten beiden Tage nicht für fünf Minuten von hier weggehen kann, stimmts, Mami? Aber ich wollte kommen, ganz bald schon, Großmama, wirklich …«
»Nun ja, mit deinem Pferd kann ich sicher nicht mithalten«, sagte die alte Dame. »Und es ist ja auch nicht wichtig. Dieses Mal habe ich nicht allein herumgesessen und gewartet, ob von euch mal jemand anruft. Wir hatten viel zu tun, nicht, Mademoiselle?«
»Ja, Madame, das hatten wir.«
»Sie sprechen bereits Englisch?«, sagte Ellen und lächelte.
»Ein wenig, ja«, sagte Louise und lächelte nicht.
»Avery«, rief Ellen zu den Rabatten hinüber. »Deine Mutter ist da. Und Mademoiselle – äh – Lanier.«
»Wer?«, rief Avery in familiärem Ton zurück und wandte sich halb um.
»Oh«, sagte er und trat aus dem Beet heraus. »Mutter!« Er ging zu ihr, küsste sie und lächelte, nachdem das erledigt war, die Fremde an, damit sie ihm vorgestellt würde. Er konnte sich nicht denken, wer das sein mochte.
»Mademoiselle, das ist mein Sohn Avery«, sagte Mrs North. »Das jüngste meiner Kinder. Avery, Mademoiselle Lanier.«
»Ich wusste nicht, dass Sie bereits da sind, Mademoiselle«, sagte Avery, der sich jetzt wieder erinnerte, und streckte die Hand aus.
Louise drückte sie leicht mit den Spitzen ihrer schmalen Finger, von Anne mit Interesse beobachtet.
»Du hörst nicht zu, wenn ich dir etwas sage, Avery«, sagte seine Mutter. »Ich habe es dir ausführlich erklärt. Ellen hatte sogar angeboten, Mademoiselle mit mir zusammen am Bahnhof abzuholen. Aber nein.«
»Oh, entschuldige bitte«, sagte Ellen und sah ebenso zerknirscht aus wie Anne wegen des versäumten Abwaschs. »Das hab ich völlig vergessen. Du hättest anrufen sollen. Ich war so aufgeregt, weil Anne nach Hause kommt. Mademoiselle, Sie sehen es mir nach, ja?«
»Madame«, sagte Louise und schloss für einen Moment die Augen, »da ich nichts von Ihrer Existenz wusste, habe ich Sie auf dem Bahnsteig auch nicht vermisst.«
Die Norths waren leicht verdattert. Avery und Ellen tauschten Blicke, und Avery zwinkerte seiner Frau zu.
»Nein, natürlich nicht«, sagte Ellen. »Großmama, bitte setz dich doch. Setz dich hierhin, ich bringe dir etwas Kühles zu trinken. Was möchtest du haben?«
»Sie nimmt Limettensaft mit Soda und einem Spritzer Gin«, sagte Avery. »Ich hole ihn. Was darf ich Ihnen mitbringen, Mademoiselle?«
Louise hob kaum merklich die Brauen und Schultern, als wäre ihr gleichgültig, was sie trank. »Irgendeinen Sirup, vielen Dank. Grenadine, Johannisbeere, was Sie dahaben …«
»Sirup?«, flüsterte Anne verwundert.
»Ich glaube, das bedeutet einfach Fruchtsaft«, sagte Ellen.
»Möchten Sie ein Glas Wein?«, sagte Avery. »Madeira? Marsala? Sherry?«
»Nein, danke. Ich nehme dasselbe wie Madame votre mère, bitte.«
Mrs North lächelte vor Freude darüber, Madame votre mère genannt zu werden. Das klang doch viel besser als »die alte Mrs North«, wie es in England üblich war. Das sagte man nur, um sie von Ellen zu unterscheiden, der »jungen Mrs North«. Beides allerdings unzutreffend, fand Mrs North, da sie nicht alt und Ellen mit zweiundvierzig sicher nicht jung war.
»Ich hol die Getränke, Avery. Bleib du bei deiner Mutter«, sagte Ellen und drückte ein paarmal seinen Arm, ihr Zeichen dafür, dass sie wegwollte. Anne begleitete sie.
»Was für eine merkwürdige Person«, sagte Anne, als sie die Küche betraten. »Ich dachte, Franzosen wären furchtbar höflich, ist sie aber nicht, oder?«
»Franzosen unterscheiden sich untereinander genauso wie Engländer«, sagte Ellen und holte die Eiswürfel aus dem Kühlschrank. »Mrs Beards Benehmen zum Beispiel käme bei Franzosen bestimmt nicht so gut an, oder?«
»Oh, nein«, sagte Anne. »Soll ich das bemalte Tablett holen?«
»Nein, das eckige silberne.«
»Ist das sauber?«, fragte Anne überrascht.
»Ja. Ich habe es extra vor deiner Heimkehr geputzt.«
»Ach, Mami, du bist komisch, als ob ich das merken würde! Hör mal, hast du die Fingernägel dieser Französin gesehen? Wie Schreibfedern. Sie braucht sie bloß in Tinte zu tauchen, dann kann sie damit schreiben.«
»Hol mir doch einen anderen Siphon, Liebling.«
»Mami, ich glaub, ich kriege einen Lachanfall, wenn Großmama noch mal ihr Französisch vorführt. Warum will sie in ihrem Alter Französisch lernen? Das lohnt sich doch nicht, oder? Ich begreife nicht, warum jemand Französisch lernen will, wenn er es nicht muss. Ich kann Französisch nicht ausstehen.«
Als Louise das eisgekühlte Glas mit der trüben hellgrünen Flüssigkeit entgegennahm, sagte sie: »Ist das Pernod?«
Ellen wusste nicht, was Pernod war, aber Avery sagte: »Leider nicht. Absinth bekommt man in England nicht oft.«
Während sie trank, ruhten die Augen der Fremden auf Ellens Leinenkleid, das zerknittert und an der Vorderseite von dem verschütteten Wasser noch feucht war.
Ich weiß, ich weiß, verteidigte Ellen sich stumm. Ich hätte mich umziehen sollen. Hätte ich es bloß getan.
Das Mädchen war so elegant gekleidet: der leichte Anzug, die weiße Häkelmütze auf dem dunklen glatten Haar, die weiße Batistbluse – alles genau richtig.
»Und wie gefällt Ihnen England?«, versuchte Avery, das Gespräch am Laufen zu halten.
»Ich bin nicht zum ersten Mal hier«, erwiderte Louise, als gäbe es dazu nicht mehr zu sagen.
Wieder zuckten Averys Augen belustigt.
»Was für eine merkwürdige Person«, sagte Anne erneut, als die beiden Gäste gegangen waren.
»Sie schien uns nicht zu mögen«, sagte Avery.
»Vielleicht hat sie Heimweh«, sagte Ellen. »Das wird es sein. Sie hat Heimweh, armes Mädchen.«
Mrs North begleitete Louise zu ihrem Zimmer und vergewisserte sich, dass sie alles für die Nacht hatte, obwohl es bereits die zweite war, die sie darin verbringen würde. Mit Interesse besah sich die alte Dame die Zeichen französischer Inbesitznahme ihres schönsten Zimmers. Den Kalender mit den Namen von Heiligen, noch dazu französischen Heiligen: »Ste Ursule … S. Isdore … Ste Geneviève.« Es traf Mrs North mit der Wucht einer Offenbarung, dass die französische Vorstellung von Gott und seinen Heiligen völlig anders sein musste als die englische. Für einen Augenblick betrachtete sie Louise, bevor sie ihren Rundgang durch das Zimmer fortsetzte. Auf der Frisierkommode bemerkte sie einen kleinen vergoldeten Cupido mit angelegtem Pfeil, ein Geschenk von Paul Devoisy.
»Hübsch«, sagte Mrs North bewundernd. »Sie haben ja gar keine Fotografien Ihrer Eltern aufgestellt.«
»Ich habe keine mitgebracht«, sagte Louise.
»Ich hatte angenommen, Sie hätten gern ein Bild Ihrer Eltern bei sich …«
»Ach, pour trois mois«, sagte Louise achselzuckend.
Als Mrs North gegangen war, widmete sie sich voller Hingabe dem eingerissenen Nagelhäutchen ihres Zeigefingers. Mit einer Nagelschere entfernte sie ein winziges Stück Haut und trug eine Heilsalbe auf, cremte sich die Hände ein, das Gesicht, den Hals, verbrachte viel Zeit mit ihrer Toilette für die Nacht.
Sie ging ins Bett, doch bevor sie das Licht ausschaltete, ließ sie den Blick durchs Zimmer schweifen. Es war anders als ihr Zimmer zu Hause, das alt war, in einem alten Haus, mit einer verblichenen Streifentapete, dem Eisengitter vor dem Kamin, Jeanne d’Arc auf dem Kaminsims, dem Parkettboden und dem Läufer vor dem Bett, der, wenn man darauf trat, gleich ins Rutschen geriet und morgens als Erstes von ihrer Mutter aus dem Fenster gehängt wurde.
Ihre Eltern erschienen vor ihrem geistigen Auge, unförmig, bescheiden, liebevoll. Beim Gedanken an sie wurde Louise jedoch ungeduldig, sogar unwirsch. Sie wussten nichts. Nichts von ihrem Leiden, nicht nur wegen Paul, sondern wegen verschiedenster Dinge von Kindertagen an. Sie waren ihr keine Hilfe. Das sollten sie aber sein, fand sie. Selbst ohne ein Wort von ihr sollten sie das sein. Sie wischte den Gedanken weg und richtete ihre Aufmerksamkeit auf das englische Zimmer.
Es war auf eine auffällige, fast plumpe Art hübsch. Es enthielt jeglichen Komfort: fließendes Wasser, einen weichen Teppich, einen Sessel. Die Engländer waren Spezialisten für Bequemlichkeit. Le confort anglais war in Frankreich ein fester Begriff. Aber mit ihren Betten stimmte etwas nicht. Warum hatten sie so seltsame Kopfkissen? Sie hatten die falsche Form und waren nicht mal halb so groß wie nötig. Die quadratischen französischen Kissen waren wesentlich besser, weil sie die Schultern stützten. Die Engländer machten sich die Tage bequemer, die Franzosen die Nächte. Auch in der Literatur beider Länder waren die Tage den Engländern wichtiger, die Nächte den Franzosen.
Sie seufzte tief, als sie an ihre Nächte zurückdachte. Was tat er wohl jetzt? Den respektvollen Verlobten einer tugendhaften Germaine markieren? Bah! Sie wollte nicht an ihn denken. Lass, sagte sie sich und schaltete das Licht aus. Sie würde sich ausschließlich mit der Gegenwart beschäftigen. Es war nicht übel hier. Ganz und gar nicht übel. Allerdings uninteressant. Die Familie heute Abend zum Beispiel, wie stumpfsinnig in ihrem mittelmäßigen Glück.
Trop de simplicité, so lautete ihr Urteil über die Norths, während sie die Schultern bequem auf den fremdartigen Kissen zu lagern versuchte.
In Netherfold war Ellen gerade am Einschlummern, als Avery in seinem Bett schallend auflachte.
»Was ist so lustig?«, murmelte sie.
»Ich muss gerade daran denken, wie wir uns abgestrampelt haben, der jungen Französin die Befangenheit zu nehmen, und sie nichts anderes tat, als unsere zu steigern. Sie hat erst dich wunderbar abgefertigt und dann mich.«
»Wenn es einen nicht schert, ob man unverschämt ist, hat man nur Vorteile«, sagte Ellen.
»Mich hat sie ja erheitert«, sagte Avery. »Ich hab eine Prise Pfeffer ab und zu ganz gern. Es ist zu viel Zucker im Gerede der Leute.«
»Mmh, kann sein«, murmelte Ellen und sank genüsslich in die Kissen.
Es war ihr nicht lange vergönnt. In der Nacht brach das Gewitter los. Blitze knisterten über dem Haus, Donner grollte, und aus dem tief hängenden Himmel goss es plötzlich in Strömen. Ellen sprang aus dem Bett, lief reihum in alle Zimmer und schloss die Fenster. Avery fühlte sich für derlei nicht zuständig.
Anne stützte sich auf den Ellbogen, als ihre Mutter ins Zimmer gerannt kam.
»Oh, Mami, meinst du, Roma geht es gut?«
»Jaja«, sagte Ellen, von wehenden Vorhängen umhüllt. »Mach die Augen zu, Schätzchen.«
Sie rannte wieder in ihr eigenes Bett.
Aber Anne stand auf und trat ans Fenster. Der nächste Blitz erhellte die Umgebung und zeigte Roma, die am Zaun der Koppel stand. Ein schwaches Wiehern drang von ferne herüber. Das genügte. Anne zog ihre Sandalen an, ging im Schlafanzug – es hätte keinen Zweck, den Morgenmantel pitschnass werden zu lassen – geräuschlos die Treppe hinab und trat in das Gewitter hinaus. Der Regen schlug auf sie ein, nasse Blätter wehten ihr ins Gesicht, sie war im Nu durchnässt. Roma wieherte noch einmal zur Begrüßung. Sie zitterte, als Anne bei ihr angekommen war.
Kind und Pferd gingen durchs Tor und in den Stall. Das Feld wurde von Blitzen erhellt, die Pappeln schwankten in alle Richtungen. Anne rieb Roma trocken, die Stute schnaubte sanft, teilte sich in ihrer Sprache mit.
»So, bitte, Liebling«, sagte Anne und küsste die samtige Nase. »Jetzt ist alles wieder gut. Bis morgen früh.«
Sie schlüpfte zurück ins Haus. Oben an der Treppe angekommen, ging das Licht an, und Mutter und Tochter standen sich gegenüber – Anne mit am Körper klebenden Schlafanzug und strahlenden blauen Augen.
»Anne! Du bist wahnsinnig! Du hast wohl Roma hereingebracht?«
Anne nickte, während das Wasser an ihr heruntertropfte. »Es war wunderbar. Aber ich bin patschnass.«
»Ab ins Bad!«, sagte ihre Mutter. Sie brachte einen trockenen Schlafanzug und rubbelte Anne die Haare.
»Ich reibe Roma ab, du reibst mich ab«, sagte Anne.
Als sie wenig später ins Bett stieg, fragte sie ihre Mutter, ob sie noch etwas zu essen haben dürfe.
»Mitten in der Nacht?«
»Ich hab schrecklichen Hunger, Mami.«
»Ich mach dir was«, sagte Ellen und dachte daran, wie sie in ihrer Jugend nachts manchmal der Hunger überfallen hatte.
»Kann ich vielleicht ein Brot mit Braten haben? Und mit Roter Bete, bitte, liebste Mami …«, rief Anne ihr nach.
VIER
I
An einem warmen Samstagabend saßen Avery, Ellen und Anne nach dem Abendessen noch im Garten zusammen, jeder mit etwas anderem beschäftigt. Avery, eine Hornbrille auf der Nase, las mit finsterer Miene in einem dicken Manuskript, das er ausnahmsweise einmal nach Hause mitgenommen hatte. Anne hatte die Beine unter sich gezogen, kaute aufgeregt auf einem Taschentuchzipfel und verschlang mit dem Ungestüm der Jugend ein Buch. Ellen las die Morgenzeitung, wozu sie tagsüber noch keine Zeit gehabt hatte.
Der Garten war friedlich, verströmte den Duft von Rosen und Lefkojen. Der Himmel war so prachtvoll, als wäre gerade eine Schar Engel vorübergezogen und hätte mit goldenen Flügeln darüber gestrichen.
Da erschien in der Terrassentür des Wohnzimmers die kakigrüne Gestalt eines Jungen mit einem spitzbübischen Lächeln im Gesicht, das für einen Achtzehnjährigen seltsam gutmütig war.