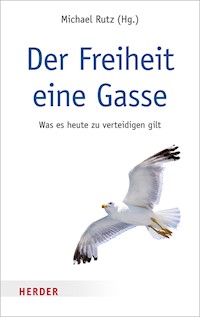
Der Freiheit eine Gasse E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Freiheit – ein hoher Wert, den es auch heute immer wieder aufs Neue zu verteidigen gilt. Im Rahmen der Münsteraner Diskussionsreihe DomGedanken, auf der dieser Band basiert, debattieren Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft unter dem Titel "Der Freiheit eine Gasse", wo Freiheit bedroht, wie Freiheit gelebt und wann Freiheit errungen wurde. Mit Beiträgen von Lothar de Maizière, Udo Di Fabio, Markus Gabriel, Hermann Parzinger, Annette Schavan und Rüdiger von Voss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Rutz (Hg.)
Der Freiheit eine Gasse
Was es heute zu verteidigen gilt
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2016
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Christian Langohr, Freiburg
Umschlagmotiv: © Sergii Figurnyi-Fotolia
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster, Belgern
ISBN (E-Book) 978-3-451-80857-9
Inhalt
Michael RutzDie Freiheit – ein Lebenssubstrat Ein Vorwort
Udo Di FabioRiskante FreiheitWider den bevormundenden Staat
Hermann ParzingerWider die Barbarei Kunst-, Kultur- und Meinungsfreiheit sind für Demokraten nicht verhandelbar
Annette Schavan»Das Netz ist zerrissen, und wir sind frei.« Warum Glauben frei macht
Lothar de MaizièreVom Kampf um die Freiheit des Glaubens Der erste demokratisch gewählte Ministerpräsident der DDR Lothar de Maizière im Gespräch mit Michael Rutz
Rüdiger von VossWenn Widerstand zur Pflicht wird Der 20. Juli 1944 und der Kampf um Freiheit und Recht
Markus GabrielDie Freiheit des Willens und die Freiheit des Geistes Vom Handeln im Lichte von Ideen
Der Herausgeber
Die Autoren
Michael RutzDie Freiheit – ein LebenssubstratEin Vorwort
Dass um die Freiheit, ihre Möglichkeiten und Grenzen, ihre Sicherung, ihre Feinde und Förderer seit Jahrtausenden gestritten wird, liegt in der Natur des Menschen. Seit der Homo sapiens denken und damit auch über sich und seine Existenz räsonieren kann, strebt er danach, seine Lebensumstände selbst gestalten zu wollen. Freiheit – das ist der Zustand der Autonomie, der Selbstbestimmung eines Subjekts.
Diese Autonomie wiederum kann nicht grenzenlos sein. Seit der Mensch in soziale Zusammenhänge eingebunden ist, ist Freiheit regelgebunden. Aus der Optimierung der Freiheitsräume in Abgrenzung zu allen anderen Freiheitssuchern ist ein Spiel des Ausgleichs und der gebotenen Rücksichtnahmen geworden, mit Institutionen, die die Freiheitsräume durch vielfältige Maßnahmen sichern, den Ausgleich der Interessen organisieren und Regelverstöße ahnden sollen.
So erhalten letztlich Menschen Macht über Menschen, ein Quell ständiger Versuchung. Macht ausüben – das bedeutet, anderen seine Gesetze, seine Handlungsmaximen, seine Moralvorstellungen überstülpen zu können, sie in Reih und Glied zu zwingen und Verstöße zu sanktionieren.
Wer aber begrenzt die Macht der Institutionen, des Staates, einer Ideologie? Welchen Anspruch hat der Einzelne gegen den Staat – und welchen Anspruch der Staat gegen seine Bürger? Wer garantiert welche Freiheitsrechte? Welche Rolle spielen die Religionen dabei? Wie korrespondieren die physischen und materiellen Freiheiten mit jenen der Meinungs-, Kunst-, Glaubens- und Gewissensfreiheit?
Stets spielte bei der Verankerung von Freiheiten die geschriebene Verfassung einer Nation die Schlüsselrolle, als letzter Anker gewissermaßen, auf den man sich berufen kann. Ihr Rechtsrahmen, die darin festgelegten Rollen für Legislative, Exekutive und Judikative und ihre Austarierung sind die Garanten der Freiheit. Was also ist die Rolle der Verfassung, und welche ethischen Grundlagen muss sie enthalten?
Um diese Fragen der Freiheit wird seit Jahrtausenden gerungen. In den letzten Jahrhunderten haben sich Sozialismus, Kommunismus, Konservatismus und Liberalismus heftige Fehden geliefert, jeweils von unterschiedlichen Menschenbildern ausgehend, von unterschiedlichem Zutrauen auch in die Freiheitsfähigkeit des Menschen und von unterschiedlichem Willen, ihn mit allen Ingredienzien der Freiheitsfähigkeit auszustatten, ihm also zu seinen Freiheitsmöglichkeiten zu verhelfen. Zu groß sind die Versuchungen der Macht. Und zu leicht lassen sich Menschen verführen und in die Strudel größenwahnsinniger Versprechungen hineinziehen, lassen sich gegen Andersdenkende aufhetzen – mit dem furchtbarsten Beispiel der Hitler-Zeit und des Holocaust.
Auch heute hat dieser Kampf um die Freiheit kein Ende gefunden. Er wird niemals beendet sein. Nichts wird sich daran ändern, dass nur wenige Menschen wirklich frei sein können, in geistigem und materiellem Sinne. Noch immer halten Diktaturen und totalitäre Strukturen Menschen in Schach, noch immer berauben Kriege die Menschen ihrer Freiheitsmöglichkeiten, noch immer begrenzt Armut die Sehnsucht nach Freiheit. Immer wieder setzt sich auch in Demokratien das Ringen darüber fort, wie stark die Freiheit des Individuums gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit zurückzustehen hat – wenn etwa die Freiheit auf informationelle Selbstbestimmung dem terrorabwehrenden Überwachungsstaat im Wege steht oder die finanzamtlichen Ritter der Steuergerechtigkeit das freiheitsbegründete Bankgeheimnis abschaffen wollen. Und unverändert werden Philosophen darüber rätseln, ob es wirkliche Freiheit überhaupt geben kann, wenn das vermeintlich freie Denken und Wollen doch wiederum abhängig sein könnte von Vorprägungen, die dem freien Willen gar nicht mehr unterliegen.
»Der Freiheit eine Gasse!« – unter diesem Motto hat sich im Herbst des Jahres 2015 im Dom zu Münster eine Vortragsreihe mit all diesen Fragen beschäftigt, die mit freundlicher Förderung durch die Evonik Industries AG zustande kommen konnte und für deren Mithilfe bei Konzeption und Ausgestaltung vor allem dem Domkapitel mit Dompropst Kurt Schulte, dem Domkapellmeister Thomas Schmitz sowie Spiritual Dr. Paul Deselaers sehr zu danken ist. Den Raum der Kirche für solche »DomGedanken« – so der Name der Reihe – zu öffnen, das ist ein Beleg für den Freiraum des Denkens, den Kirche heute bieten kann und sollte, und die katholische Kirche als freiheitsbegründende Religion zumal.
Der Staatsrechtslehrer Udo Di Fabio nahm das Verhältnis des Individuums zum Staat in den Blick und mahnte fünf Bedingungen der bürgerlichen Assoziation an, nämlich das Prinzip der Eigenverantwortung, einen lebensbejahenden Optimismus, die soziale Dimension jeder bürgerlichen Freiheit, den zur politischen Beobachtung fähigen und zum politischen Handeln bereiten Bürger sowie schließlich die Bereitschaft und die Fähigkeit einer Gesellschaft, sich auch ohne Hilfe des Staates und jenseits der Macht von Kollektiven zu organisieren.
Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wendete das Problem der Freiheit im Hinblick auf Kunst und Kultur. Barbarische Bücherverbrennungen, Bilderstürme, Kunstwerkschändungen und Tätigkeitsverbote machen bis heute deutlich, welche Angst Machthaber vor Kunstfreiheit und der Freiheit des Denkens und Schreibens haben. Denn wenn Kunstfreiheit herrscht, kann die Kunst nicht als »Waffe der Umerziehung, der Umarbeitung des Menschen« eingesetzt und Künstler als Seeleningenieure missbraucht werden. Und Parzinger schließt: »Für eine wirklich demokratische Gesellschaft ist die Freiheit der Kunst und Kultur ebenso wie die Freiheit der Meinung nicht verhandelbar.«
Annette Schavan, die deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl, hat die historischen Mühen geschildert, mit denen sich das Christentum zum Garanten der Freiheit aufgeschwungen hat und heute einen Glauben anbietet, dessen befreiende Wirkung dem Menschen eine Gegenwelt zu seiner Einbindung in staatlich organisierte Sozialität offeriert. Diese innere Freiheit wird durch die staatlich gesicherte Religionsfreiheit ermöglicht, zwei getrennte Welten, die Johannes Paul II. deutlich machte, als er 1998 in Havanna betonte, »dass ein moderner Staat aus dem Atheismus oder der Religion kein politisches Konzept machen darf.«
Lothar de Maizière, der erste demokratisch gewählte Ministerpräsident der DDR (und zugleich deren letzter), hat in seinen Tätigkeiten als Rechtsanwalt und als Vizepräses der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR diese Kämpfe miterlebt und im Dom zu Münster davon berichtet: Eine Geschichtsstunde 25 Jahre nach der Wiedervereinigung über ein Land, in dem die Freiheit der Glaubensausübung staatlich befehdet war, aber »irgendwann hat die SED gemerkt, dass man den Sozialismus wohl offensichtlich nicht gegen sechs Millionen Christen aufbauen kann und sie versuchten, so eine Art Burgfrieden herzustellen.« Wie hier der Kampf um die Freiheit ausging, ist bekannt.
Zu diesen Vorträgen im Dom tritt in diesem Buch ein Beitrag von Rüdiger von Voss, der aus eigenem familiären Erleben ein düsteres Kapitel deutscher Barbarei schildert: die Zeit des Nationalsozialismus und damit eine Periode, die mit imperialistischem Machtwillen, größter Vernichtungsbereitschaft und der industriellen Durchführung von Genoziden sich um die Freiheit der Menschen einen Dreck scherte. Dann wird Widerstand zur Pflicht, und so empfanden es auch die Männer und Frauen des Widerstands gegen Adolf Hitler, der im 20. Juli 1944 seinen tragischen Höhepunkt fand.
Markus Gabriel, Philosoph in Bonn, dachte über das Problem des freien Willens und seines Verhältnisses zur Idee des Determinismus nach. Frei seien wir, weil wir Lebewesen sind, die im Lichte von Ideen handeln, die wiederum einer Ordnung angehören, die unsere Freiheit nicht bedroht, sondern ermöglicht – »dies ist die Ordnung des Geistes«.
Es bleibt festzuhalten: Freiheit kommt nicht von selbst, sie geht leicht abhanden, man muss um sie kämpfen. Ihr wohnt ein moralischer Kern inne, sie ist Teil der Menschenwürde. Das macht es legitim, Widerstand gegen einen Staat zu leisten, der Menschen in Knechtschaft nimmt und ihnen die Freiheit abspricht. Das war so in der DDR, und von diesem Widerstandsrecht haben die Kirchen dort – mehr oder weniger mutig, aber immerhin – Gebrauch gemacht.
Dieses Buch, für dessen freundliche lektorierende Begleitung ich Frau Sarah Mayer-Voigt vom Herder Verlag sehr danke, möge beim Leser idealerweise ein Nachdenken darüber bewirken, wie sehr die Freiheit, die wir heute haben, schätzenswert ist. Wir nehmen sie allzu selbstverständlich, beteiligen uns mit nachlassender Intensität an ihrer demokratischen Sicherung, schätzen ihre Institutionen gering.
Manchmal hilft es, von außen auf Deutschland zu blicken, ganz im Sinne Nietzsches: »Von dem, was du erkennen und messen willst, musst du Abschied nehmen, wenigstens auf eine Zeit. Erst wenn du die Stadt verlassen hast, siehst du, wie hoch sich ihre Türme über die Häuser erheben.«
Und noch erheben sich die Türme unserer Freiheit stolz.
Berlin, im April 2016
Michael Rutz
Udo Di FabioRiskante FreiheitWider den bevormundenden Staat
Im Mittelpunkt der modernen Gesellschaft steht der sich selbst entfaltende Mensch. Eigenverantwortung, Privatautonomie, Vertragsfreiheit, Persönlichkeitsrechte prägen die Rechtswelt. Auch politische Herrschaft ist vom Wählerwillen bestimmt.
Die Demokratie garantiert die friedliche und vernünftige Ordnung des Zusammenlebens als Selbstregierung des Volkes. Doch auch sie neigt wie jede Regierungsform zur Über-Regulierung, zu kollektiven Glücksverheißungen und übernimmt bereitwillig Risiken der Freiheit bis zu dem Punkt, an dem sich alle Augen auf den Staat richten. Wenn alle Probleme und Risiken, das Gelingen von Wirtschaft, die Kreativität von Kunst und Wissenschaft, die Vorsorge für Gesundheit und Alter auf das Kollektiv übertragen sind, entsteht beinah unmerklich ein Klima der Bevormundung, des Paternalismus, häufig unter dem Beifall des Publikums. Der Beitrag nennt Beispiele und Tendenzen, fragt nach der richtigen Gewichtung von individueller Entfaltungsfreiheit und sozialem Rechtsstaat.
I.
Jede politische Herrschaft, auch die Demokratie, ist selbstbewusst und ordnet die Welt. Sie lässt sich ungern durch Grenzen wirtschaftlicher, rechtlicher oder wissenschaftlicher Natur bremsen, auch nicht durch die Eigenwilligkeit der Bürger. In einer Demokratie wird diese Grundeinstellung durch die öffentliche Erwartung einer Allzuständigkeit und prinzipiellen Allmächtigkeit kollektiver Mehrheitsentscheidungen verstärkt. Dabei zeigt sich in jedem politischen Betrieb immer wieder aufs Neue eine besser-wissende, eine bevormundende Tendenz, an historischen Vorbildern gemessen sogar ein neomerkantilistischer oder auch neokameralistischer Drall.
Die paternalistische Tendenz zur Regulierung der Wirtschaft und kleinteiligen Verhaltenssteuerung der Gesellschaft war in Deutschland immer stark, wurde aber im 19. Jahrhundert durch liberale Grundpositionen mit der Einführung der Gewerbefreiheit und der Aufhebung der Leibeigenschaft und preußischen Politik der Handelsöffnung planmäßig zurückgedrängt.1 Doch seit dem Gründerkrach von 1873 und der sich anschließenden bis in die Neunzigerjahre des Jahrhunderts reichenden wirtschaftlichen Depression erhielt der wirtschaftsintervenierende Staat wieder Oberwasser2 und veranlasste den Ökonom Joseph Schumpeter zur Rede vom »neomerkantilistischen Kondratieff«.3
Schon lange zuvor waren die Folgewirkungen der Industrialisierung sozialkritisch thematisiert worden und hatten auch den Obrigkeitsstaat seine Verantwortung zur Bekämpfung von Armut und Verelendung (wieder)entdecken lassen.4 Spätestens im Übergang zum 20. Jahrhundert markiert etwa die Kritik am Nachtwächterstaat und die Betonung der Notwendigkeit des sozialgestaltenden und wirtschaftslenkenden Staates die Rückkehr von Fürsorgekonzepten und auch wieder intensiverer individueller Verhaltensvorgaben.5
Die öffentliche Meinung ist häufig ungeduldig und für den Umweg über die Form und die Institution kaum zu begeistern. So verliert sich der Sinn für Institutionen, wenn man allzu oft unmittelbaren materiellen Rechtsgüterschutz und prompte Zielverwirklichung will. Nicht die gute Organisation freiheitsermöglichender Entfaltungsräume wie in der Universität, der Wirtschaft, der Erziehung wird erstrebt, sondern direkte Handlungsvorgaben oder aber unauffällige Verhaltenslenkung wie »Nudging«6 mit demselben Ziel, dass nur das von der politischen Moral für richtig erkannte Verhalten sich durchsetzt.
Unter dem Druck von Krisen weitet sich diese Tendenz noch aus. Nicht der Streit über die richtige Richtung, sondern die technokratische Bewältigung eines Problems durch Verhaltensanpassung möglichst aller Menschen wird dann das Ziel. Sollte in einer Gesellschaft der Umfang inhaltlich-sachlicher Verhaltenslenkung zunehmen und dagegen das Vertrauen in die Kraft (Rationalität) von Institutionen wie die Privatautonomie, Markt, demokratische und rechtstaatliche Verfahren abnehmen, so wäre das ein alarmierendes Signal. Der politische und rechtliche Regelungsbedarf, ja der Bedarf nach einer politisch vorgeschriebenen Alltagsmoral könnte in dem Maße wachsen, wie traditionelle Rollenfixierungen unter der Logik einer auf Befreiung eingestellten Aufklärung verschwinden. An die Stelle tradierter Ordnungen tritt dann ein politisches Meinungsklima, das wiederum enge Standardisierungen enthält und für eine lebendige politische und öffentliche Diskussion wie ein allzu eng geschnürtes Korsett wirkt.
Dabei ist die Ambivalenz offensichtlich. Befreiung von starren Rollenklischees und hartnäckigen Vorurteilen war noch in den vergangenen Jahrzehnten in bestimmten Bereichen dringend angezeigt, und auch für die Zukunft ist nicht auszuschließen, dass es befreiende Korrekturen geben muss. Westliche Gesellschaften mit dem liberalen Lebensstil der späten fünfziger und der sechziger Jahre (american way of life) hatten einen großen Horizont an Möglichkeiten eröffnet, allerdings mit noch erheblichen Restriktionen für Minderheiten, vor allem Homosexuelle oder ethnische Minderheiten in den USA. Diese Ausnahmen werden heute nachholend beseitigt, aber zeitgleich mit der Fortsetzung gesellschaftlicher Liberalisierung ist auch eine unterschwellig gegenläufige Neuformatierung von Verhaltensstandards zu beobachten, die politische Codices in Alltagsverhalten übersetzen wollen, etwa wenn es um die Sexualerziehung in der Schule7, um die Rollenbilder von Einwandererkindern geht.
Inhaltliche Verhaltensregeln und Orientierungen sind auch in einer freiheitlichen Gesellschaft erlaubt und für die Erziehung schlechthin notwendig, aber das Grundgesetz will seine abstrakte Wertordnung verteidigen und nicht unbedingt konkrete Inhalte der gerade herrschenden Überzeugungen durchgesetzt wissen. Wer eine freie Gesellschaft will, muss Vertrauen in die selbstexpansiven Tugenden der Bürger haben und mit den Unterschieden, die aus ihren eigenwilligen Entwürfen entstehen, leben können, und zwar ohne ständig die Sonde materieller Ergebnisgleichheit anzulegen.
II.
Welches Leitbild der Freiheit legt unsere Verfassung auch der demokratischen Selbstgestaltung zugrunde?
Bürger zu sein, ist eine Frage des Lebensentwurfs, der Überzeugung vom richtigen Leben. Diese Idee stammt letztlich wohl aus der aristotelischen oder christlich-thomistischen Tugendlehre. Die Bürgertugenden knüpfen an die bekannten aristotelischen Kardinaltugenden durchaus an und formen sie für die sich ausdifferenzierende Neuzeit um: Weisheit wird zum Bildungsideal und zu wissenschaftlichem Forscherdrang, Tapferkeit wird zum Bürgerstolz und zum unbeugsamen Freiheitsanspruch, Besonnenheit wird zum zweckrationalen Kalkül und zu einem verstandesgeführten Leben, die Gerechtigkeit wird zu der Verantwortung für das Gemeinwesen und zu der Hilfe für die Schwachen. Und auch die von Thomas von Aquin betonten christlichen Tugenden wie Glaube, Hoffnung und Liebe finden ihre moderne Interpretation. Der Glaube an Gott wird zur persönlichen Glaubensfreiheit und zur Gewissensentscheidung, aus der Hoffnung wird die Fortschrittserwartung abgeleitet, die Liebe wird zum Lebenselement tragender Gemeinschaften und zum kulturellen Reservoir für die romantische Perspektive eines ansonsten doch eher kühlen Rationalisierungsprozesses. Daraus folgt ein in den Zeitläufen recht variables, im Kern aber konstantes Bild des Bürgers, das uns prägt und das wir heute unter der Rubrik »selbstexpansive Tugenden« wieder abrufen.
Als »selbstexpansive Tugenden« gelten das Streben nach Bildung, Selbstdisziplin, Aufstiegsorientierung, Persönlichkeitsentwicklung, auch die Suche nach ästhetischen und künstlerischen Standards. Zu diesen Tugenden der Selbstüberschreitung gehört ein neu akzentuierter Bindungswille, aus freier Entscheidung und kluger Einsicht in das, was ein selbstbestimmtes, auch unbequemes, aber dadurch reiches Leben ausmacht. Ohne solche bürgerlichen Tugenden gedeiht keine Hilfsbereitschaft, ist keine Solidarität und kein Zusammenhalt auf Dauer möglich. Verantwortungsgefühl, der Mut zur Übernahme auch von riskanten Aufgaben zuerst im sozialen Nahbereich, der Mut, eine Familie zu gründen oder ein Unternehmen, der Antrieb zum Neuen und zur Weiterbildung, der Wille, für sich selbst und die Zukunft zu sorgen: All das ist nicht staatlich zu verordnen. Selbstexpansive Werte sind für das Gelingen einer freien Gesellschaft unentbehrlich, sie wachsen nicht in Ministerialverwaltungen und Agenturen. Dabei sollte man eine Formulierung des Grundgesetzes wörtlich nehmen: das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit.
Der Entwurf eines Grundgesetzes durch den Herrenchiemseer Verfassungsausschuss, der im August 1948 tagte, formulierte in seinem Art. 2 Abs. 2 noch: »Jedermann hat die Freiheit, innerhalb der Schranken der Rechtsordnung und der guten Sitten alles zu tun, was anderen nicht schadet.« Warum hat der Parlamentarische Rat an dieser Formulierung nicht festgehalten und an die Stelle dessen ein »Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit« gesetzt?
Entfaltung der Persönlichkeit ist viel anspruchsvoller als lediglich das zu tun, was einem beliebt. Es geht darum, von sich selbst eine Idee zu entwickeln, mit Selbstdisziplin und Anstrengung, Einsicht und Engagement. Bürger streben nach Glück, mit dem Hunger auf Wissen und dem Drang zur Gestaltung der Welt, um hier ihren Ort zu finden, Spuren zu hinterlassen. Ein auf Freiheit gegründetes Gemeinwesen funktioniert nicht, wenn jeder nur seiner Wege geht, tut und lässt, was ihm beliebt. Damit auch diese Freiheit, zu tun und lassen, was einem beliebt, auf Dauer bestehen kann, kommt es auf den vernünftigen Gebrauch der Freiheit an. So etwas kann nicht politisch vorgeschrieben werden, jedenfalls nicht an erster Stelle und nicht in jeder Hinsicht. Der vernünftige Gebrauch der Freiheit wächst aus der Einsicht der Menschen. Andernfalls gefährdet bloßes Freisein sich selbst oder provoziert den Paternalismus bürokratischer Eliten. Es geht also um die Einsicht in die Bedingungen des Freiseins. Es sind die Bedingungen der bürgerlichen Assoziation.
Die Bürgergesellschaft baut auf das Selbstvertrauen, der auf sich bezogenen Verantwortung also, für seine Existenz zu sorgen, Mühen des Alltags ebenso zu ertragen wie das Leben zu genießen und dabei doch immer über sich hinauszugreifen und die anderen zu erreichen.
Es beginnt mit dem Prinzip der Eigenverantwortung. Der Ruf nach dem anderen, nach Hilfe ist erlaubt und in der Stunde der Not sogar geboten, aber er steht nicht am Anfang des Erwachsenenlebens. Es ist wie beim plötzlichen Druckabfall im Flugzeug, wenn die Sauerstoffmasken herunterfallen: Erst für sich sorgen, damit wirkungsvoll anderen geholfen werden kann. Das ist ein Grundprinzip der Bürgergesellschaft, es ist auch die Basis des freiheitlichen Sozialstaates gegen die Versorgungsmentalität eines falsch verstandenen Wohlfahrtsstaates.
Eine andere unentbehrliche Maxime ist der lebensbejahende Optimismus, der mit der Betonung selbstexpansiver Tugenden verbunden ist. Die klassisch humanistische Idee der Bildung, aber auch alle Modelle der neuzeitlichen Gesellschaftsphilosophie setzen auf persönliche Selbstüberschreitung. Gemeint ist der Wille, über sich hinauszuwachsen, der zum schaffenden und weltverstehenden Menschsein gehört. Hier hat Europa manchen Elan verloren, der zum Kern unserer kulturellen Identität zählt.
Die dritte Bedingung der gelingenden Bürgergesellschaft liegt in der sozialen Dimension jeder individuellen Freiheit. Dazu gehört schon vom Ausgangspunkt her eine Einstellung, die den anderen in seinem Freisein konstitutiv mitdenkt und mit ihm konstruktiv verfährt: beim Vertragsschluss nach Treu und Glauben, beim Eingehen von Bindungen, ohne die Verpflichtung zu fühlen, seine Selbstbestimmung zu opfern oder sein Eigeninteresse zu verleugnen.
Die Bürgergesellschaft ist nicht identisch mit dem Staat, aber sie trägt ihn als personelles Substrat, ist sein lebendiger Raum. Eine Demokratie ist so gut wie ihre Bürger. Klug zu wählen und keinen Illusionen über das politisch Machbare anzuhängen und die verschachtelten Systeme übernationalen Regierens ebenso pragmatisch wie kritisch nachzuvollziehen, Urteilskraft zu schärfen, öffentliche Ämter und Parteien nicht zu meiden: das sind die Tugenden des zoonpolitikon. Der zur politischen Beobachtung fähige und zum politischen Handeln bereite Bürger ist deshalb eine weitere Voraussetzung der freien Gesellschaft.
Und damit zusammen hängt die fünfte Funktionsbedingung der zivilgesellschaftlichen Selbstgestaltung: Eine Gesellschaft muss bereit und fähig sein, sich auch ohne Hilfe des Staates und jenseits der Macht von Kollektiven zu organisieren





























