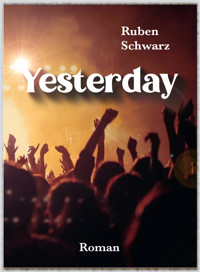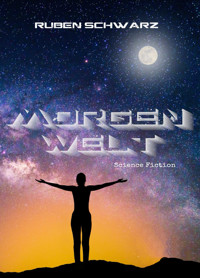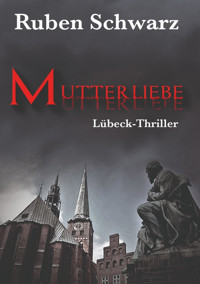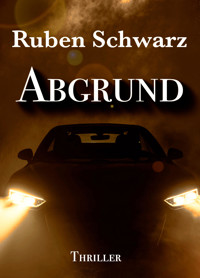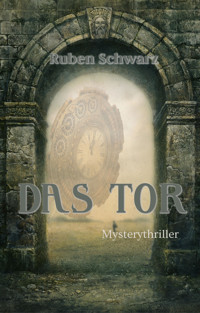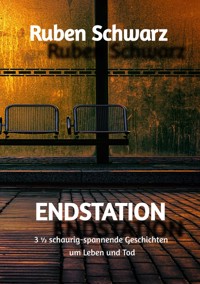6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Findelkind im Schatten des Schwertes – zwischen Liebe und Loyalität Im düsteren Forst des 9. Jahrhunderts wird der junge Finn von einer Bauernfamilie aufgenommen und wächst im Tal des Ritters Dietrich heran, ein Leben zwischen Stallknechten, Bauern, frommen Frauen und dem Dröhnen kriegerischer Trommeln. Heimlich träumt Finn von Ruhm und Ehre mit dem Schwert in der Hand, doch sein Herz schlägt für Adalheidis, das anmutige Mündel des Nachbarbauern. Als das Reich zum Waffengang ruft, steht Finn vor einer schweren Entscheidung, die sein Schicksal besiegelt. Ein epischer Roman über Mut, Menschlichkeit und die Frage, was wir opfern, um das zu werden, was wir erträumen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 704
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ein Findelkind im Schatten des Schwertes – zwischen Liebe und Loyalität
Im düsteren Forst des 9. Jahrhunderts wird der junge Finn von einer Bauernfamilie aufgenommen und wächst im Tal des Ritters Dietrich heran, ein Leben zwischen Stallknechten, Bauern, frommen Frauen und dem Dröhnen kriegerischer Trommeln. Heimlich träumt Finn von Ruhm und Ehre mit dem Schwert in der Hand, von fernen Gestaden, doch sein Herz schlägt für Adalheidis, das anmutige Mündel des Nachbarbauern.
Als das Reich zum Waffengang ruft, steht Finn vor einer schweren Entscheidung, die über sein Schicksal entscheidet.
Ein epischer Roman über Mut, Menschlichkeit und die Frage, was wir opfern, um das zu werden, was wir erträumen.
Impressum:
Copyright © 2025 Ruben Schwarz
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, GermanyDas Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:[email protected]
Der Fuchs von Astnide
Historischer Roman
Von Ruben Schwarz
Für dich, Rosi.Für uns.Für die Liebe.
„Nicht mit Waffen, sondern mit Gebet besiegte er die Heiden“
Chronist Adam von Bremen über Erzbischof Rimbert von Bremen-Hamburg (830-888 n Chr.)- Eine grandiose Verklärung der Realität -
Inhalt
Kapitel 1: Vor der Schlacht
Kapitel 2: Die Ankunft
Kapitel 3: Die Hufe
Kapitel 4: Arnulf von Astnide
Kapitel 5: Adalheidis
Kapitel 6: Junker Dietrich
Kapitel 7: Ein schwerer Gang
Kapitel 8: Der Aufstieg
Kapitel 9: Heiltrud
Kapitel 10: Die Burg
Kapitel 11: Die Beichte
Kapitel 12: Fischdiebe
Kapitel 13: Das Versteck
Kapitel 14: Richolf
Kapitel 15: Hagen
Kapitel 16: Siebrecht
Kapitel 17: Die Fähre
Kapitel 18: Köln
Kapitel 19: Wölfe
Kapitel 20: Kaiserwerth
Kapitel 21: Der Bär
Kapitel 22: Der Physikus
Kapitel 23: Der Meuchler
Kapitel 24: Rebellen
Kapitel 25: Spielleute
Kapitel 26: Sigiburg
Kapitel 27: Herrenloses Lehen
Kapitel 28: Eroberung
Kapitel 29: Verrat
Kapitel 30: Bannruf
Kapitel 31: Festung Broich
Kapitel 32: Roter Schnee
Kapitel 33: Dänen
Kapitel 34: Diusburh
Kapitel 35: Herfried
Kapitel 36: Das Ende der Nacht
Kapitel 37: Waltbert von Höxter
Kapitel 38: Die Heerfahrt nach Norden
Kapitel 39: Weißer Dunst
Kapitel 40: Suolle
Kapitel 41: Brokmerland
Kapitel 42: Gau Norditi
Kapitel 43: Kriegskonvent
Kapitel 44: Dietrichs Ränke
Kapitel 45: 25. Dezember Anno Domini 884
Kapitel 46: Rimbert
Kapitel 47: Rösser
Kapitel 48: Dietrichs Ränke (2)
Kapitel 49: Sumpfland
Kapitel 50: Jagdglück
Kapitel 51: Der Brautbote
Kapitel 52: Der Rhein
Kapitel 53: Nachtalben
Kapitel 54: Blutige Rast
Kapitel 55: Die Falle
Kapitel 56: Brautwerbung
Kapitel 57: Die Ruhr
Kapitel 58: Burgherrin
Kapitel 59: Das ewige Licht
Kapitel 60: Auswege
Kapitel 61: Die Hexe
Kapitel 62: Flucht
Kapitel 63: Runenknochen
Kapitel 64: Himmlische Stimmen
Kapitel 65: Die Krypta
Kapitel 66: Turris fortissima nomen Domini
Kapitel 67: Dietrichs Ränke (3)
Kapitel 68: Hinterhalte
Kapitel 69: Gekreuzte Klingen
Kapitel 70: Minne
Kapitel 71: Der Aufbruch
Kapitel 72: Blendwerk in Thercwitigau
Kapitel 73: Bruchselven
Kapitel 74: Westsee
Über dieses Buch
Kapitel 75: Das verborgene Kapitel
Ein Tag zuvor
Der Fuchs von Astnide
Ruben Schwarz
Vor der Schlacht
ah!“, rief Jasper aus. „Mein Spieß giert danach, Dänen zu durchbohren. Ich kann nur hoffen, dass es morgen endlich losgeht. Was wird es für ein gottgefälliges Schlachten sein.“ Finn, der auf dem Rücken seines hochbeinigen Falben direkt neben Jasper saß, betrachtete diesen nachdenklich von der Seite und gewahrte, wie er verächtlich auf das gefrorene Watt spie. Die braunen Locken des Kriegers, die vorn und an den Seiten aus seiner wollenen Kapuzenhaube hervorquollen, und sein Bart wurden von einem kalten Westwind zerzaust. Er saß auf seiner gescheckten Stute und hatte die Faust um den Spieß geballt, welcher jedoch friedlich, mit der Spitze gen Himmel, in seinem Futteral neben dem Sattel ruhte.
Das Watt glitzerte wie eine endlose Ebene aus winzigen Glassplittern in der tiefstehenden Nachmittagssonne. Finn beschattete seine Augen mit einer Hand und ließ seinen Blick von Westen, wo das Heer der Friesen auf und neben den Warfen des Gaus Norditi lagerte, nach Nord über den dünnen Streifen der Halbinsel hinwegschweifen, die draußen jenseits des Watts lag, auf der feinen Linie, die den Himmel vom Meer trennte, und die von den Einheimischen Nordernoy genannt wurde. Dann blickte er nach Osten, wo sich in der Ferne eine ausgedehnte Meeresbucht tief ins Hinterland wölbte. Ein paar winzige Rauchfähnchen stiegen dort hinter einer Reihe von niedrigen Sandhügeln auf und wurden vom kalten Seewind ins Landesinnere geweht. Dort, an der Mündung des Flusses Harle, befand sich die Siedlung der Dänen und ein paar ihrer Langboote, die mit ihrem geringen Tiefgang auch in flachen Gewässern manövrieren konnten.
Innerhalb weniger Tage hatten sich in dieser Siedlung mehr als viermal hundert Heiden unter Waffen versammelt. Sie waren heraufgezogen von ihren Stützpunkten an den Gezeitenflüssen Leda, Jümme und Amisia, und gleichermaßen aus den Gauen im Osten entlang der Westsee.
Das brave Ross zwischen seinen Schenkeln schnaubte leise und nickte mehrmals mit dem Kopf, hielt aber ansonsten ergeben still. Finn und seine beiden Getreuen, Jasper und Herfried, trugen keine Helme, lediglich die Hauben aus Wolle hatten sie sich zum Schutz gegen Kälte und Wind über die Köpfe gezogen. Sie waren lediglich als Späher ausgeritten, um die Umgebung des Lagers zu inspizieren.
„Kämpfe wohl mit kaltem Blut und klarem Blick, Kamerad“, entgegnete Finn dem Mann zu seiner Linken. „Und nicht nur mit dem Eisen. Du weißt, die Dänen sind Teufel ohne Furcht und ohne Ehre. Ihre Klingen verzeihen keine Fehler.“
„Das weiß ich wohl, Finn. War ich doch schließlich mit dir in Diusburh, wo viele von uns Schlamm und Steine fressen mussten, bis das Gesindel endlich geschlagen war. Gott allein weiß, warum wir sie nicht längst überrollt haben, jetzt, wo es noch nicht so viele sind.“
Finn nickte nur stumm und blickte verdrießlich auf die wehende Mähne seines Rosses. Er war nichts als ein einfacher Knecht, der einen Haufen von vierundzwanzig Heerboten befehligte, und der Erzbischof hätte eher dem Teufel Gehör geschenkt, als ausgerechnet seinen Rat zu erfragen, oder ihn überhaupt nur anzuhören. Aber hätte er es getan, Finn hätte ihm dringend dazu geraten, besser heute als morgen anzugreifen, solange sich der Feind noch nicht vollzählig formiert hatte. Er hätte ihm überdies nahegelegt, die paar hundert Krieger mit der jetzt zweifellos noch weit überlegenen eigenen Streitmacht niederzumachen, und später die zusätzlich nachrückenden Kräfte aus dem Osten und dem Süden einzeln abzufangen und zu erschlagen, bevor sie noch recht wussten, wie ihnen geschah.
Aber offenbar stand dem Erzbischof der Sinn nach einer offenen Feldschlacht, denn er wähnte keinen Geringeren als Gott den Allmächtigen auf seiner Seite. Und auf der Seite der freien Friesen und ihrer Unterstützer aus dem ostfränkischen Reich. Welche unter anderem Finn und seine Leute waren, die zusammen mit dem Gefolge von Ritter Dietrich von Astnide und dem Segen des Grafen Waltbert von Höxter, zur Unterstützung des Friesenheers nach Norden gezogen waren.
Erzbischof Rimbert von Bremen-Hamburg hatte Abgesandte zu seinem Bruder in Christo, dem Erzbischof Willibert von Köln und zum König höchstselbst geschickt, die ihrerseits Herolde in alle Teile des Reichs entsandten, um dort Hilfe im heiligen Krieg gegen die gottlosen Heiden aus dem Norden zu erbitten. Aus Westfranken waren nur wenige dem Ruf gefolgt, und das Herzogtum Baiern hatte ihn gänzlich ignoriert. Doch aus Ostfranken, dem Lothringischen und dem Herzogtum Sachsen waren beachtliche Streitkräfte herangezogen. Angesichts der unfassbar großen Zahl von mehreren Tausend friesischen Bauernkriegern, die nun in Norditi lagerten, wirkten sie jedoch beinahe wie ein armseliges Häuflein.
Die genaue Zahl der Kämpfer kannte Finn nicht, denn für einen einfachen Knecht wie ihn war das Heerlager schier unüberschaubar. Für ihn war auch die Art der militärischen Organisation gewöhnungsbedürftig, denn es gab keine Edelleute im friesischen Heer. Zwar hatte der Erzbischof den Oberbefehl inne, und seine Leibgardisten hatten die Kämpfer in Scharen eingeteilt, aber im Prinzip war jeder Friese sein eigener Herr.
Ein weiteres Problem war die Sprache. Die Verständigung zwischen Friesen und Franken war ohne den intensiven Gebrauch von Extremitäten und begleitenden Grimassen kaum möglich. Und weil man einander so fremd war, schauten beide Gruppen wechselseitig mit einem Quäntchen an Überheblichkeit aufeinander herab.
Finn hatte mit seinem Haufen schon jetzt vereinbart, möglichst beisammenzubleiben, wenn es zur Schlacht kam, zu beobachten wie sich der Verlauf des Kampfes in ihrer direkten Umgebung entwickelte, aufeinander zu achten, und im Übrigen so viele Dänen wie eben möglich zu erschlagen.
„Was sagst du, Herfried?“ Finn wandte sich an den jungen Mann zu seiner Rechten, der auf einem Rotschimmel saß. Der Bursche hatte keine vier mal fünf Sommer gesehen. Sein Haupt zierte weizenblondes Haar, welches ihm ungestüm ums Gesicht wehte, und sein Bart war nicht mehr als Flaum. Aber er hatte ein Grinsen im Gesicht, das bis zu den Ohren reichte.
„Sie werden in ihrem eigenen Blut ertrinken“, bemerkte er lakonisch und ohne eine Spur von Erregung in der Stimme. Er war der Einzige von ihnen, der neben seinen eisernen Waffen auch einen Bogen und Pfeile mit sich führte. Es sind eher solche wie Herfried, dachte Finn, die Besonnenen, die kalten Blutes sind, welche im Kampf bestehen. Nicht die Heißsporne, die Blindwütigen wie zum Beispiel Jasper.
Obwohl Finn selbst noch ein Jüngling an Jahren war, hatte er diese Besonnenheit schon mehr als einmal an den Tag legen können – und müssen. Und es hatte ihm zum Nutzen gereicht. Er war mit Jasper und vielen anderen in Diusburh gewesen und hatte gemeinsam mit einer stattlichen Streitmacht dort die Dänen besiegt. Aber es war ein harter und verlustreicher Kampf gewesen. Die Dänen kämpften in der Tat wie Berserker, und sie kannten keinerlei Regeln.
Damals, vor gut einem Jahr, war Finn noch einfacher Heerbote gewesen, und seine Besonnenheit und sein Geschick im Kampf hatten ihm die Ehre eingebracht, von Graf Waltbert zu einem der Burgmannen der Burg Broich ernannt zu werden, nachdem der Burgherr in Diusburh gefallen war.
„Mag sein, der Erzbischof will auf die Ritter aus Lothringen warten, und die flandrischen Söldlinge“, bemerkte Finn, obwohl er wusste, dass die nicht sehr große Schar aus Rittern und Kriegsknechten, die derzeit, wie der Herold berichtete, bei Esilingis lagerten – kaum noch einen Tagesritt von Norditi entfernt – keine spürbare Auswirkung auf den Ausgang der Schlacht haben würden. „Aber ich glaube, er will zuerst das Christfest verstreichen lassen.“
„Den Gefallen werden ihm die Dänen nicht tun“, versicherte Jasper.
„Nein, werden sie nicht“, sagte Finn. „Wir reiten zum Lager.“ Er wendete das Ross und ließ es über das gefrorene Watt nach Osten traben. Die Hufe zerbrachen die dünne Eisschicht und wirbelten feine Splitter auf. Jasper und Herfried folgten ihm. Sie lenkten ihre Rösser über den schmalen Kieselstrand in das ebenfalls gefrorene Sumpfland. Die Dänen würden ihre Spuren sicher entdecken, wenn sie selbst Späher aussandten. Aber das spielte keine Rolle. Ein paar Hufabdrücke waren nichts Ungewöhnliches. Und Finn hoffte, dass die Dänen nicht ahnten, was für ein großes Heer sich gegen sie formierte. Natürlich konnten die Truppenbewegungen den Heiden nicht verborgen geblieben sein, sonst würden sich an der Bucht nicht immer mehr von ihnen einfinden. Aber es bestand die Hoffnung, dass sie sich über das wahre Ausmaß nicht im Klaren waren. Zumindest jetzt noch nicht. Zu gut waren die Zelte und Rösser des Friesenheers in der Umgebung der Warfen verborgen.
Während des Ritts ins Heerlager wurde nicht gesprochen. Finn war sich sicher, dass auch die beiden Kameraden ihren eigenen Gedanken nachhingen. Sie dachten an Tod, an Blut und Schmerzen, und an die Heimat. Und sie dachten auch an Furcht, ein Wort, das jedoch nie über ihre Lippen kommen würde. Aber da war auch die Gottesfurcht und der Glaube an das Recht, das an ihrer Seite kämpfen würde. Aus den Augenwinkeln gewahrte Finn, wie Herfried sich während des Ritts bekreuzigte. Missgelaunt schrien ein paar Möwen hoch über ihren Köpfen, Vögel, die er auch aus seiner Heimat kannte, weil einige von ihnen sich gelegentlich in die Umgebung des Flusses verirrten.
Die Gedanken lasteten schwer auf Finns Gemüt, wie Bleigewichte in einer überladenen Waagschale, die an einer Seite bis auf den Grund gedrückt wurde. Es war allein seine Entscheidung gewesen, nach Norditi zu ziehen, und auch der freie Wille jedes Einzelnen seiner Heerboten. Niemand hatte ihnen befohlen aus der Burg Broich nach Norden aufzubrechen. Weder der Graf von Höxter noch Ritter Dietrich - der selbst am Feldzug teilnahm - hatten Druck auf die Männer ausgeübt. Denn es stand zwar niedergeschrieben, dass die Region Frisia zum Ostfränkischen Reich zählte, doch tatsächlich wurde der Norden eigenmächtig von den alteingesessenen Geschlechtern verwaltet.
Finn schien diese Gesellschaftsstruktur reichlich ungeordnet. In seiner Welt entschieden Fürsten und Kirchenobere über das Geschick des gemeinen Volks. Jeder kannte seinen Platz, und jeder wusste, wie er gottgefällig zu leben hatte. Die Eltern und Geschwister daheim in Astnide waren Bauern und damit Hörige des Ritterguts. Das war die heilige Ordnung, so vom Allmächtigen selbst gefügt.
Die meisten Friesen, die Finn bisher kennengelernt hatte –sofern ein Kennenlernen in einem riesigen Heerlager wie diesem überhaupt möglich war – nannten sich zwar Christenmenschen, aber Herfried, der mit dieser sonderbaren Sprache des Nordens am besten zurechtkam, schwor jeden Eid, dass sich die Einheimischen zu Hause auf ihren Hufen noch heute lieber an die alten Abgötter hielten als an den wiederauferstandenen Sohn des Allmächtigen. Aber wie auch immer, das Blut von ihnen allen war rot, und es würde eine Menge davon in den kommenden Tagen den Marschboden tränken. Morgen war der Tag vor der Heiligen Nacht, und viele von ihnen – zu viele – würden vor ihrer Zeit dem ewigen Thron Gottes gegenübertreten, ohne jemals Nachkommen gezeugt und Enkel im Bogenschießen unterwiesen zu haben.
Finn dachte an Adalheidis, die weit weg in der Heimat bei ihren Eltern weilte, deren Hufe neben der von Finns Familie lag. Sechs hungrige Mäuler in einem niedrigen Haus aus Holz, Lehm und Stroh auf drei mal zehn Morgen Land in der Nähe des Flusses, das zum Lehen des Ritters Dietrich gehörte. Adalheidis, der holde Klang dieses Namens berührte ihn auf seltsame Art, immer noch, schon seit er die Jungfer, die damals noch, wie er selbst, ein Kind gewesen war, vor vielen Sommern zum ersten Mal erblickte. Damals auf dem Karrenpfad neben Albrechts Acker.
Immer wenn er heute an Adalheidis dachte, wurde ihm das Herz schwer, denn sie vermisste er nicht erst seit seinem Aufbruch ins Nordland. Als die Kunde durchs Land getragen wurde, dass Waltbert von Höxter junge Schildknechte für die neuerrichtete Feste in Broich suchte, hatte er sein Bündel geschnürt und war aufgebrochen. Auch das Flehen seiner Mutter Luitgard hatte ihn nicht aufhalten können. Und seitdem hatte er Adalheidis nicht gesehen. Sie hatten sich einander versprochen, draußen am Ackerrain zwischen Ginsterbüschen, während der Flachs reif und hoch auf dem Feld stand und die Amseln über ihnen am Himmel zeterten. Aber niemand konnte heute wissen, ob Adalheidis´ Zieheltern viel auf dieses Versprechen geben würden, das ihre Tochter dem jungen Bankert gegeben hatte, sollte sich in der Zwischenzeit ein anderer wackerer Freier finden. Einer, der einen eigenen Hof besaß. Denn in den Köpfen einiger Bauern in Astnide war Finn noch immer der Bankert, wie man ihn lange Zeit genannt hatte, obwohl er nun schon so lange einer von ihnen war.
Denn Finn war kein leibliches Kind von Luidgard und Albrecht, so wie Dietlind und Walther. Er war ein Findelkind, und dazu eines, dessen Erinnerung sich nur über zwölf Sommer erstreckte. Manchmal träumte er von jenem Tag, an dem er nach Astnide gekommen war, ohne zu wissen, woher er tatsächlich stammte. Und kurz nach dem Aufwachen umklammerte ihn dann das bedrückende Bangen, welches Menschen befällt, die sich nicht an ihre eigene Vergangenheit erinnern können.
Die Ankunft
s war Sommer gewesen, an einem Donarestag. Der Tag, welcher Thor, dem alten Gott des Donners, gewidmet war, und zwar an jenem, der dem sechsten Sonntag nach Trinitatis folgte. Das hatte ihm Luitgard berichtet, die seine Mutter geworden war, nachdem er begonnen hatte, ihre Sprache zu verstehen. Er hatte nichts gewusst. Er hatte geschlafen, mitten im Forst auf einem Bett aus verrottenden Blättern, direkt neben mehreren großen Felsblöcken, die von Moos bedeckt waren. Und sein Kopf hatte geschmerzt.
Der Junge schlug die Augen auf, weil er Kinderstimmen hörte. Und er sah hoch über sich auf einem Ast eine Krähe, die argwöhnisch auf ihn herabblickte. Und er wusste nicht, wo er sich befand. Das war verwirrend und beängstigend. Er richtete sich in eine sitzende Haltung auf und schaute sich um, blickte hinauf zu dem steinernen Hügel in seinem Rücken. Die Wipfel der Buchen und Eschen über seinem Kopf – damals kannte er die Namen der Bäume nicht – bewegten sich sachte im Wind. Dann erblickte er zwischen den mächtigen Baumstämmen die beiden Kinder. Dem ersten Augenschein nach handelte es sich um ein Mädchen und einen Jungen, beide waren wohl etwas jünger als er selbst. Aber wie alt war er denn eigentlich?
Der Junge erhob sich und blickte den beiden Kindern entgegen, die in einiger Entfernung durchs Unterholz kletterten, den Blick auf den Waldboden geheftet. Der Junge fragte sich … wo er … wo wer war? Er erinnerte sich nicht, ob er allein oder in Begleitung im Wald gewesen war. Eigentlich war er überhaupt nicht im Wald gewesen, soweit er sich erinnern konnte. Eine Eule schrie, oder ein Uhu, oder ein Kauz. Auch damit kannte er sich damals nicht aus. Als der fremde Knabe ihn bemerkte, blieb er wie erstarrt stehen und stieß das Mädchen an. Beide hefteten ihre Blicke für einige Augenblicke auf ihn, dann wandten sie sich um und liefen eilig davon. Beide hatten Bündel von Zweigen in den Armen getragen.
Dann war der Junge wieder allein. Der Wald war dicht und schwarz, und der Boden übersät mit herabgefallenen Zweigen, Ästen und umgestürzten Stämmen. Alles sah völlig anders aus als … war er überhaupt schon einmal in einem Wald wie diesem gewesen? Die Einsamkeit war so überwältigend, und der Wald so mächtig und einschüchternd, dass er anfing zu weinen. Er wollte rufen, aber er wusste nicht nach wem. Nach Mutter, nach Mama?
Im Unterholz nahm er ein Rascheln wahr, dann huschte ein kleines pelziges Tier über den Boden aus winzigen Zweigen, Moos und Blättern. Der Junge erschrak fast zu Tode. Er musste jemanden finden. Wen er genau vermisste, würde ihm schon noch einfallen. Hoffentlich. Menschen auf jeden Fall, er musste Menschen finden. Er setzte sich in die Richtung in Bewegung, in der die beiden Kinder verschwunden waren. Das war gar nicht so einfach, denn es gab hier keine Wege. Immer wieder musste er um umgestürzte Bäume und riesige Felsbrocken herumlaufen, oder diese überklettern, Gräben überspringen.
Die ganze Zeit über weinte der Junge, und es war ihm nicht einmal richtig klar, ob er das tat, weil er allein war, oder weil er nicht die geringste Ahnung hatte, wie er hierher gelangt war. Trotzdem durchquerte er eine ganze Weile den Wald, der auf abschüssigem Gelände wuchs, und setzte wie automatisch einen Fuß vor den anderen. Dabei kamen ihm irgendwann Zweifel, ob er wirklich noch dieselbe Richtung verfolgte, die er ursprünglich eingeschlagen hatte.
Als er plötzlich wieder Stimmen hörte, zuckte er zusammen und blieb stehen. In einiger Entfernung tauchten Personen zwischen den mächtigen Baumstämmen auf. Es waren zwei … nein, drei. Der Junge duckte sich hinter einen Felsbrocken, welcher derart mit Moos bedeckt war, als trüge er ein grünes Fell. Es war eine Frau, die zusammen mit den beiden Kindern, die er schon zuvor gesehen hatte, in seine Richtung kam.
Der Junge musste sich zu erkennen geben. Sich zu verstecken ergab keinen Sinn. Also kam er zögernd hinter seinem Felsbrocken hervor und blickte den Leuten entgegen. Die Frau rief etwas, das er nicht verstand. Aber die Stimme klang freundlich, ein bisschen außer Atem. Er glaubte nicht, dass sie Böses im Sinn hatte. Keuchend kam sie den Hang herauf. Die beiden Kinder hielten sich hinter ihr.
„Halo Jungô, hab kêni Angist.“ So oder so ähnlich klang es für ihn, als die Frau näherkam und ihn erneut ansprach. Nach einer Weile kam ihm eine Vermutung, was das bedeuten konnte. Aber er hatte trotzdem Angst. Verdammte Angst sogar. Nicht vor dieser Frau, aber vor der rätselhaften Situation, in der er sich befand.
Schwer atmend blieb die Frau vor ihm stehen. Sie mochte dreißig oder vierzig Jahre alt sein, vielleicht so alt wie … seine Mutter? Sie trug eine grobe Wolljacke über einem braunen Kleid, das glockenförmig fast bis zum Boden reichte. Davor hatte sie eine Schürze gebunden. Auf dem Kopf trug sie eine Haube aus Stoff, die unter dem Kinn geschlossen war. Das kleine Mädchen war ähnlich gekleidet, trug aber die langen dunkelblonden Haare offen. Der Junge war in eine braune Tunika gehüllt, die nur bis zu den Oberschenkeln reichte und oberhalb der Hüften mit einer Kordel umwickelt war. Die Beine waren nackt, und die Füße steckten in unförmigen, abgeschabten Lederhüllen, die nur mit viel Fantasie als Schuhe durchgehen konnten.
„Hwanân kumes thu? Hvi heisestu?“ Der Junge, der für einen Moment vergessen hatte zu weinen, begann erneut damit. Er hatte offenbar alles vergessen, was bis zu diesem Moment in seinem Leben passiert war, und zusätzlich konnte er nicht mehr verstehen, was gesprochen wurde. Das war schrecklich, und da er nicht glaubte, sich in einem fernen Ausland zu befinden, musste in seinem Kopf irgendetwas kaputt sein. Dann glaubte er jedoch, den letzten Teil des Satzes zu verstehen und sagte zaghaft: „Finn.“ Er legte die Finger der rechten Hand an seine Brust. „Ich heiße Finn.“ Das war ein Geistesblitz gewesen, und beinahe hätte er hysterisch aufgelacht. Die eigene Stimme kam ihm brüchig und fremd vor. Ja, er hieß Finn, tatsächlich.
„Finn“, wiederholte die Frau und lächelte. Ihr Gebiss war lückenhaft, aber sie sah unheimlich freundlich und warmherzig aus.
„Hwaz ist mit dir giwurtan?“ Die Frau hob den Arm und berührte ihn an der Stirn. Finn zuckte hilflos mit den Schultern, denn er hatte wieder nicht verstanden, was man ihn fragte. Und er war sich sicher, die Frage auch dann nicht beantworten zu können, selbst wenn er sie verstanden hätte.
„Hwaz ist dhesar ceo ein cneht?“, kam die piepsende Stimme des kleinen Mädchens hinter dem ausladenden Kleid der Frau hervor. Es hatte große braune Augen und starrte ihn an, als sei er ein Fabelwesen. Finn versuchte krampfhaft, nicht mehr zu flennen, nicht vor dem kleinen Mädchen, was ihm nur unvollständig gelang.
„Ich heiße Finn, und ich weiß nicht, woher ich komme“, sagte er entschlossen, in der Hoffnung, dass die Leute wenigstens ihn verstanden. Aber das Gesicht der Frau wirkte ratlos. Sie drehte sich kurz zu den Kindern um und wechselte Blicke mit ihnen. Bestimmt waren das ihre Kinder. Dann wandte sie das Gesicht wieder Finn zu.
„Ik bium Luitgard, des Albrehtes wîb.“ Sie hatte jetzt ihrerseits die Fingerspitzen auf ihre Brust gelegt. Das war auch nicht sehr verständlich, aber wahrscheinlich hatte die Frau ihm ihren Namen gesagt. Der ihm seltsam vorkam. Finn nickte. Irgendwo über ihnen schrie wieder der Kauz oder die Eule. Oder der Uhu.
„Thu kumist nu êrst mit uns“, sagte die Frau entschlossen, und dieses Mal hatte Finn sie verstanden. Und das war tröstlich. Er war also nicht vollkommen verblödet. Und natürlich würde er mit ihnen gehen. Was sollte er sonst tun? Als Alternative konnte er weitere Stunden allein ziellos durch einen fremden Wald marschieren, in dem es – und davon war er überzeugt – gefährliche Tiere geben musste. Und als die Frau sich anschickte, sich mit den Kindern in die Richtung auf den Weg zu machen, aus der sie gekommen waren, schloss Finn sich ihnen an.
Die Hufe
n den folgenden Tagen kam Finn kaum dazu, viel über sein Schicksal nachzudenken. Gleich am nächsten Tag nahm Albrecht, der Vater von Dietlind und Walther den Neuzugang mit an den Waldrand, um zusammen mit ihm Bäume zu fällen, weil der Junge größer und kräftiger als die beiden anderen Kinder war. Dietlind war sieben, und Walther neun Sommer alt. Ihn selbst hatte Dietlind auf zwölf Sommer geschätzt, aber Finn konnte sich leider noch immer nicht daran erinnern, wie alt er tatsächlich war und woher er stammte.
Von der Stelle im Wald, an der Luitgard Finn gefunden hatte, bis zu dem einfachen Gehöft der Familie waren es nur wenige Minuten Fußweg gewesen. Durch das schmale langgestreckte Tal, in dem sich Weiden, Äcker und ein paar winzige Häuser befanden, und das ringsum von sanft ansteigenden bewaldeten Höhenzügen eingerahmt wurde, schlängelte sich ein dünnes Bächlein, welches sich wenige hundert Meter hinter der Hufe von Albrecht und Luitgard zwischen Wiesen und Äckern verlief. In dem Tal gab es fünf oder sechs weitere winzige Häuschen mit Ställen, die allesamt weit voneinander entfernt lagen. Die Hufe der Familie umfasste – das hatte Luitgard ihm erklärt, denn Albrecht sprach nur, wenn es unbedingt nötig war –, etwa dreißigmal der Landfläche, die ein Bauer mit einem Ochsengespann an einem Morgen bis zur Sext, also bis zur Mittagsstunde beackern konnte. Deshalb nannte man diese Fläche Morgen. Das, zusammen mit den drei Ziegen, zwei Sauen, einer Kuh, einem Ochsen und einer Handvoll Hühner, würde gerade ausreichen, um vier hungrige Mäuler zu stopfen, hatte Luitgard gesagt. Und wenn er, Finn, nicht sehr bald von seinen Leuten abgeholt würde, müsse er für sein Brot arbeiten, wie alle anderen auch.
„Gib dir mehr Mühe!“, befahl Albrecht, und der Blick, mit dem er Finn betrachtete, wirkte unwirsch. Er hielt die schwere Axt mit einer Hand und deutete auf den Spalt, den er bereits in den Stamm einer Buche geschlagen hatte. In Wahrheit hatte er gesagt „Berfa dih mêra muaha!“ Aber Finn verstand die Leute inzwischen schon ein bisschen besser. Er hatte sich angewöhnt, die gesprochenen Sätze in einzelne Worte zu zerteilen, und mithilfe der Worte, die er glaubte zu verstehen, das Fehlende dazwischen im Kopf zu rekonstruieren. Der Umstand, dass ihm das gelang, erfüllte ihn mit ein bisschen Stolz, denn er war offensichtlich nicht so dumm, wie er es für eine Weile befürchtet hatte. Er hatte nicht vergessen, wie man verständlich sprach, sondern diese sonderbaren Menschen sprachen einfach nicht seine Sprache. Es lag also an ihnen, nicht an ihm. Die gesamte Situation, in der er sich seit seinem Aufwachen im Wald wiedergefunden hatte, war so fremdartig, dass er zeitweise glaubte zu träumen. Und ein bisschen hoffte er auch, über kurz oder lang zu Hause in seinem … Bett (?) aufzuwachen. In seinem Zimmer?
Wie auch immer, obwohl er sich offensichtlich auf die Funktion in seinem Oberstübchen einigermaßen verlassen konnte, in der Fertigkeit des Holzfällens verfügte er über keinerlei Übung, und so verfehlte er beinahe jedes zweite Mal diesen Spalt im Holz, den es zu treffen galt, um den Stamm irgendwann zu Fall zu bringen. Dass Ritter Arnulf ihnen gestattet hatte, einen halben Morgen zu roden, um ein weiteres Feld für Rüben und Hafer anzulegen, hatte Luitgard ihm am Morgen erzählt. Der Ritter gebot über das ganze Tal und den umgebenden Wald, allerdings gehörte alles letztlich dem König.
Während Finn breitbeinig auf dem leicht abschüssigen Grund des Waldrandes stand, ließ er seine Axt ein ums andere Mal mit mäßiger Treffsicherheit ober- oder unterhalb des Spalts in die Rinde fahren, während er Albrechts missbilligenden Blick geradezu auf seiner Wange fühlen konnte. Albrecht war ein grobschlächtiger Mann mit schütterem Haupthaar und einem dunklen Vollbart, der von silbernen Fasern durchwirkt war. Sein Gesicht war von Wind und Wetter zerfurcht, und die große Nase sah aus wie eine runzlige Knolle. Er trug ein grobes langes Hemd in einer Farbe, die irgendwo zwischen grau und beige lag, und das in der Taille von einem breiten Ledergürtel gerafft wurde, an dem ein einfaches, vielleicht dreißig Zentimeter langes, Messer mit Holzgriff in einem ledernen Futteral steckte.
Finns Hände begannen bereits wund zu werden, und seine Schultern schmerzten, aber er presste die Lippen zusammen und hieb beinahe verbissen immer wieder ins Holz. Vor diesem fremden Mann, der wie selbstverständlich erwartete, dass er für ihn arbeitete, wollte er sich keine Blöße geben.
Diese Tätigkeit an frischer Luft, so anstrengend sie war, schien tatsächlich seine Passion zu sein. Sie lenkte ihn ab von den unzähligen Fragen, die in seinem Kopf umeinanderkreisten. Er musste Eltern gehabt haben, ein Zuhause, das sich ganz sicher nicht in diesem Tal befand. Leute, die sich fragten, wo er abgeblieben war. Die ganze Welt erschien ihm sonderbar unwirklich, wie aus einem … Er war nicht imstande, den Satz zu vollenden, weil ihm die passenden Worte nicht einfallen wollten. Die einfachen Häuser, die nur aus Holz, Lehm und Stroh zu bestehen schienen, die offene Feuerstelle im Wohnraum, die primitive Einrichtung, nichts war ihm vertraut, die ganze Welt war vollkommen fremd. Aber das musste wohl so sein, wenn man alles vergaß, was man bisher erlebt hatte. Wahrscheinlich hatte er immer hier gelebt und wusste es nur nicht.
Aber er weinte nicht mehr. Jedenfalls nicht tagsüber, dafür waren die Nächte da. Zumindest die kurze Spanne zwischen dem Niederlegen auf sein Lager aus mit Stroh gefüllten Säcken und dem Eintauchen in einen traumlosen Schlaf, der ihn vor Erschöpfung kurz darauf umfing.
Während Albrecht damit begann, den Baumstamm mit seiner Axt von der anderen Seite zu bearbeiten, lenkte Finn sich von seinen Schmerzen mit dem Gedanken an Luitgard ab, die sich warmherzig um ihn gekümmert hatte. Und an das Gespräch zwischen ihr und ihrem Mann, das Finn am Vorabend belauscht hatte, während er sich in seiner Fertigkeit geübt hatte, diese fremde Sprache zu ergründen.
„Vielleicht gehört er zu den Spielleuten“, hatte Luitgard vermutet.
„Das Gesindel ist vor dem Sonntag von Johannes und Paulus hier durchgezogen“, widersprach Albrecht. „Da müsste er sich seit dem Neumond im Wald herumgetrieben haben.“
„Aber vergiss nicht seine sonderbare Kleidung. Die kann nur von den Gauklern stammen. Der kommt auf keinen Fall von hier. Vielleicht sogar aus der Ostmark oder aus Langobardien. Daher auch seine plumpe Rede.“ Finn hatte in einer Ecke neben dem Herd auf einem Schemel gesessen. Zuvor hatte man ihm eine mit einem grauen Brei gefüllte hölzerne Schale gereicht, während Albrecht, Luitgard und die Kinder an einem grob behauenen Holztisch gesessen hatten und aßen. Der Brei hatte undefinierbare grobe Stücke enthalten, war aber nicht eklig gewesen, und er hatte schließlich auch einen irrsinnigen Hunger gehabt.
„Und denk an seine Kopfverletzung“, führte Luitgard weiter aus. Tatsächlich hatte sie gesagt: „Und dhink an sīn huobiskūla.“ Finn hatte sich den Satz nur deshalb erklären können, weil die Frau sich dabei an ihren Hinterkopf gefasst hatte, genau an die Stelle, die sie ihm noch kurz vorher mit einer brennenden Tinktur betupft hatte. „Der Knirps war sinnelos, und nur Gott weiß, wie lange.“ Finn vermutete, dass er auf die Felsen geklettert war – warum auch immer –, neben denen er dann später aufgewacht war. Er musste abgestürzt und mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen sein. Sicher hatte ihm das die Erinnerung geraubt.
„Auf jeden Fall gefällt mir der Knabe nicht“, brummte Albrecht und trank einen Schluck aus seiner Schale. Was sich darin befand, wusste Finn nicht.
„Der rote Schopf“, brummte er. „das geckenhafte Gewand, das alles liegt näher dem Rossfüßigen als dem Herrn.“
„Du übertreibst, Albrecht“, sagte Luitgard und legte über den Tisch hinweg eine Hand auf den Arm ihres Mannes. „Er ist ein Kind, und wir müssen ihm Obdach geben. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, spricht der Herr. Denk an die Worte von Kleriker Heimirich.“
„Der Pfaffe hat gut schwatzen“, knurrte Albrecht und blickte missmutig auf Finn, der in seiner Ecke saß und so tat, als würde er nicht zuhören. Luitgard bekreuzigte sich und quittierte die Verfehlung ihres Gatten mit einem entrüsteten „Albrecht!“
In Wahrheit war Finn sehr betroffen über die Art, wie Albrecht über ihn redete, während er sich doch im Raum befand. Schließlich waren das hier die einzigen erwachsenen Menschen, an die er sich wenden und von denen er Hilfe erwarten konnte. Und er war schließlich ein Kind, wie Luitgard richtig bemerkt hatte. Er wusste ja nicht einmal, wohin er sich zurücksehnen und wen er vermissen sollte.
Finn nahm sich fest vor, die Felsen im Wald aufzusuchen, sobald sich eine Gelegenheit bot, um nachzuschauen, ob es irgendeine Spur gab, die seiner Erinnerung auf die Sprünge helfen konnte. Als er an diesem Abend endlich auf dem Strohlager ruhte, das Luitgard ihm in einer Ecke der Stube in einer Bretterkiste bereitet hatte, weinte er still vor sich hin. Das half ein bisschen, aber er bemühte sich, dass Dietlind und Walther nichts davon mitbekamen, die, ebenso wie die beiden Erwachsenen, im selben Raum nächtigten.
„Hwâr, der boum fallet!“, erscholl Albrechts raue Stimme dicht bei ihm. Finn fuhr aus seinen Gedanken auf und blickte nach oben. Tatsächlich begann der Stamm der Buche, deren Geäst sich in der Höhe mit dem benachbarter Bäume verflochten hatte, sich unmerklich zu neigen. Albrecht packte Finn grob am Arm und zerrte ihn zur Seite. Sie liefen ein Stück gemeinsam den Hang hinab, während das Krachen hinter ihnen lauter wurde. Mit einem Laut, als würde sich ein rheumatischer Riese stöhnend erheben neigte sich der Stamm in die Waagerechte und stampfte mit einem dumpfen Schlag auf den von Disteln und Wegerich überwucherten Grund des Waldrandes.
Als Finn zu Albrecht aufblickte, sah er ein freundlich lachendes Gesicht. „Guot Werch“, dröhnte der Mann, und schlug Finn seine Pranke auf die Schulter. Das tat weh, ahnte er doch ohnehin, dass er morgen vermutlich keinen Arm ohne Schmerzen würde heben können, aber Albrechts Anerkennung durchflutete ihn mit einer warmen Woge der Freude. Und dem Gefühl, dass alles vielleicht doch nicht so schlimm war.
Arnulf von Astnide
er Rehbock war offensichtlich reich an Jahren gewesen.
„Warst du nicht sicher, ob der Bock wirklich tot ist?“, fragte Arnulf seinen Mundschenk Chlodwig, welcher ihm gegenübersaß und mit ihm zusammen gespeist hatte. „Oder warum hast du ihn so lange im Feuer gelassen, dass man ihn ebenso gut als Wams hätte tragen können?“
„Ich hab´s gemacht wie immer, Herr“, gab der Angesprochene Auskunft, und weder seine Miene noch seine Stimme drückten die geringste Spur von Bedauern aus. Stattdessen puhlte er mit dem Fingernagel des Zeigefingers zwischen seinen Zähnen. Für Arnulf, der schon als Junker Probleme mit seinen Kauwerkzeugen gehabt hatte, und nicht erst jetzt, da er bedeutend mehr als vierzig Sommer zählte, war der Braten jedenfalls eine Herausforderung gewesen. Missmutig schob er die Schüssel mit dem abgenagten Knochen zur Tischmitte und nahm einen Schluck Rheinwein aus seinem Becher, mit dem er zuerst seinen Gaumen spülte, bevor er ihn hinunterschluckte.
Nach dem Essen pflegte sich sein Zahnfleisch gewöhnlich wund anzufühlen. Einer seiner verbliebenen Backenzähne gab seit einer Weile schon ein peinliches Pochen von sich. Mit Schaudern dachte er daran, wie er im vergangenen Herbst kurz vor Michaelis nach dem Physikus Heribald in Köln hatte schicken lassen, weil er der Kunst des Heilers aus Werden nicht über den Weg traute. Der Physikus war in teure Kleider gehüllt gewesen und hatte salbungsvolle lateinische Sprüche von sich gegeben, sich allerdings auch in klingendem Silber bezahlen lassen. Und die Extraktion des peinigenden Backenzahns, bei dem ganz hinten in seinem Kiefer der Zahnwurm sein zerstörerisches Werk getan hatte, war die schlimmste Tortur seines Lebens gewesen. Viel hätte nicht gefehlt, und Arnulf hätte dem Kerl mit dem Knauf seines Dolchs den Schädel zertrümmert. Der Säbelhieb des Sarazenen, der ihm als jungem Edelmann am Ufer der Regen im Nordgau tief in den Oberschenkel gefahren war, gehörte im Gegensatz dazu, zu Arnulfs angenehmeren Erinnerungen. Und dann hatte der Quacksalber noch die dreiste Frage gestellt, warum er für derlei banale Handlungen nicht den Barbier oder den Schmied gerufen hätte.
Unten im Hof hatte Dietrich, Arnulfs einziger Sohn, den Quacksalber noch vor dessen Abreise über Köln ausgefragt. Später hatte er seinem Vater vorgeschwärmt von einer Stadt, deren Mauern höher waren als ihre Burg. Von prächtigen, sogar zweistöckigen Häusern, von denen es so viele gab, dass man sich zwischen ihnen verlaufen konnte. Mehr als zehn mal tausend Bürger sollten innerhalb der Stadtmauern leben, die Straßen seien voll von Menschen, die in edle Tücher gewandet seien, von Händlern, von Dirnen, die dem Wanderer jeden Wunsch erfüllten, von Geschäften in denen exotische Gewürze, kostbare Stoffe, Rösser, Enten, lebende Affen und Schmuck in Gold und Silber zu haben seien.
Arnulf selbst war zweimal in Köln gewesen. Er erinnerte sich mit Unwillen an den Gestank in den Gassen, den Schlamm aus menschlichen Exkrementen und Rosspisse, die engen Gassen und Häuser mit Vorkragungen, deren obere Stockwerke jeden Blick auf den Himmel versperrten. An die Krüppel, die Bettler, die aufdringlichen Gaukler und die fetten, nach altem Fisch riechenden Weiber, die sich einem ungefragt an den Arm hingen und einen in einer Sprache anschwatzten, die kein vernünftiger Christenmensch verstand. So Gott gnädig war, musste er in diesem Leben keinen Fuß mehr in diesen Dreckspfuhl setzen.
Umso schlimmer war die Erkenntnis, dass sich ein erneutes Ereignis ähnlicher Art, nämlich ein weiterer Besuch des Physikus, möglicherweise nicht mehr allzu lange würde hinausschieben lassen. Warum Gott ihn mit dieser Hartnäckigkeit verfolgte, konnte man nur mutmaßen. Dass er gelegentlich eine Dirne, von denen manchmal welche im Gefolge von Kauffahrern durch sein Land zogen, mit einem Denar und einem halben Tuchballen, oder mit ein paar Eiern und einem Topf Honig dafür entlohnte, dass sie für eine Nacht das Lager mit ihm teilte, mochte ein Grund dafür sein. Und, dass er seit Jahren keine Beichte abgelegt hatte, vielleicht ebenfalls. Aber dass der Herr ihm seine Engeltraut bereits genommen hatte, als sie mit Dietrich im Kindbett lag, spielte vor Gottes Antlitz offenbar keine Rolle. Da hätte er ruhig ein Auge zudrücken können, der alte Mann.
Und wo sollte er schon beichten? Im benachbarten Stift gab es nur Weiber, und den Wanderprediger hatte er schon anno 69 zum Teufel gejagt, weil er ein Hühnerdieb war. Und wollte man vielleicht von ihm erwarten, persönlich nach Werden zu ziehen und vor einem Pfaffen zu Kreuze kriechen, der es wahrscheinlich toller trieb als er selbst? Ave Maria und Paternoster konnte er schließlich auch in seiner Kammer herunterbeten.
„Nehmt Ihr noch von den Linsen und Möhren, Herr?“, fragte der Mundschenk, wobei er mit begehrlichem Blick das Gemüse auf der Platte beäugte.
„Nein, friss es nur selbst, Spitzbube“, knurrte der Ritter und machte eine wegwerfende Handbewegung. „Den Koriander hast du beigemischt, gleichwohl dir bekannt ist, dass er mir zuwider ist.“ Chlodwig schien auch von diesem Vorwurf wenig beeindruckt und schaufelte das Gemüse, welches vielmehr ein verkochter Brei war, in seine Schale. Als Mundschenk war er nicht nur für das leibliche Wohl seines Herrn verantwortlich, sondern auch seit vielen Sommern sein engster Berater.
Arnulf war sich darüber im Klaren, dass es besser wäre, mehr auf Brei und Suppen zu setzen, aber das Wildbret, das Dietrich und seine Schildknechte in seinem Forst erlegten, war leider zu verlockend. Er stand von seinem hölzernen Sessel auf, reckte sich und rieb sich die Hände. Das Feuer auf dem gestampften Lehmboden prasselte, der Rauch kroch träge hinauf zum Dachfirst. Außerdem loderten die Flammen in einer eisernen Feuerschale, und dennoch wurde es in diesem alten Gebälk in der Winterzeit nie richtig warm. Auf dem Tisch zwischen den beiden Männern flackerten fünf heruntergebrannte Kerzen in einem Leuchter. Die schmalen Fensterschlitze waren wegen des scharfen Ostwinds, der immer neue Schneewolken gegen die Palisaden trieb, durch Holzläden verschlossen, durch deren Ritzen es dennoch empfindlich zog.
Arnulf klappte den Riegel an einem der Fenster zur Seite und öffnete den Holzladen nach außen. Kalter Wind traf sein Gesicht. Von dieser Seite der Burg aus hatte er einen guten Blick über die Palisaden und den umlaufenden Erdwall hinweg auf die schneebedeckten Wipfel des Forstes. Wandte er seinen Blick nach links, erblickte er unterhalb des Hügels, auf dem seine Feste errichtet war, das gewundene graue Band der Ruhr. Da die Burg zu Astnide eine erhöhte Position innehatte, konnte Arnulf, wenn er nach rechts blickte, in der Ferne hinter einem schmalen Streifen aus Mischwald den oberen Teil des Frauenstifts mit der hölzernen Kirche und dem Klostergebäude sehen. Auch das Stift war von hohem Pfahlwerk umgeben, wäre aber ohne die militärische Präsenz der Burg sicher schon mehrfach ausgeraubt und niedergebrannt worden.
Arnulf kannte Gerswida, die Oberin, schon seit Jahren, sah sie aber nicht oft. Wann immer es ging, mied er den Kontakt zum Kloster, denn all die Frömmlerei und das Beten war ihm unbehaglich und drückte sein Gewissen. Gerswida war ein resolutes und streitbares Weib, und dazu gar nicht dumm. Man konnte sich mit ihr beinahe wie mit einem Mann unterhalten, diese Erfahrung hatte Arnulf gemacht. Kein Wunder, denn so viel er wusste, war die Oberin eine nahe Verwandte von Altfried, dem Bischof von Hildesheim, der früher einmal Abt in Werden gewesen war. Das Weib stammte also aus einem Haus, in dem man nicht nur die lateinische Sprache pflegte, sondern sich auch in den sieben freien Künsten wie zum Beispiel der Grammatica, der Rhetorica und der Astronomica übte. Arnulf fand derlei Studien für ein Weib unangemessen, widersprachen sie doch der ureigenen Bestimmung des Weibes als Gefäß der Fruchtbarkeit. Aber bei einer Nonne lagen die Dinge natürlich ein bisschen anders. Der Papst musste es schließlich wissen.
Arnulf war derart in seine Überlegungen vertieft, dass er die polternden Schritte auf der Treppe zu seinem Gemach nicht wahrnahm. Erst das krachende Öffnen der Tür schreckte ihn aus seinen Gedanken, und er fuhr ungehalten herum.
„Herr“, keuchte ein Büttel in der offenen Tür und atmete schwer.
„Himmel und Hölle“, fuhr Arnulf auf. „Was stolperst du hier zur Sext herein, du Tölpel?“
„Herr, sie haben die Basilika geplündert! Sie waren in der Krypta! Sie waren in der Schatzkammer!“
„Rede verständlich, Dummkopf“, herrschte der Ritter den Mann an. „Wer hat geplündert, und wo?“
„In Werden, Herr. Die Dänen. Sie haben den Abt und mehrere Mönche erschlagen.“
„Woher weißt du das? Wer hat berichtet?“
„Roderich, Herr, der Müller von Werden. Er ist mit seinen Leuten geflohen. Es hat einen Kampf zwischen den Bauern und den Dänen gegeben. Die Bauern konnten sie schließlich vertreiben, aber da war der Schaden schon angerichtet.“ Chlodwig, der Mundschenk war von seinem Stuhl aufgefahren. Offenbar war er mit seinem Mahl am Ende.
„Ja, verschwinde du in deiner Küche!“, herrschte Arnulf ihn an. Der Mann trollte sich und drängte sich an dem Mann vorbei, der noch immer in der Tür stand. Diese Dänen hatten ihm gerade noch gefehlt zu seiner Seligkeit. „Wann war das?“, wandte er sich wieder an den Büttel.
„Vor zwei Tagen, Herr, am Wodanstag.“ Zwei Tage, dachte Arnulf. Die sind also längst über alle Berge. Aber er musste trotzdem etwas tun. Etwas, das wirksam war. Das dem Pack klarmachte, wer der Herr im Land war.
„Schick mir Dietrich!“, herrschte er den Büttel an.
„Der junge Herr ist auf der Jagd, Herr“, antwortete dieser, ließ den Kopf hängen und machte ein betretenes Gesicht, als sei er persönlich verantwortlich für den ganzen Schlamassel. Auf der Jagd, wie so oft, dachte Arnulf grimmig. Was sonst? Blieb zu hoffen, dass sich der Taugenichts im Winter wenigstens auf Rehwild und Eber beschränkte.
„Dann Everard, aber schnell. Soll seine Hufe schwingen.“ Der Mann verschwand, augenscheinlich heilfroh, der ungemütlichen Aura zu entrinnen. In der Aufregung ließ er die Tür offen, was dazu führte, dass es in kürzester Zeit deutlich kälter im Raum wurde. Arnulf stapfte zum Tisch und ließ sich auf seinen hölzernen Sessel fallen, der die jähe Belastung mit einem ärgerlichen Knarzen quittierte.
Die Dänen waren ihm seit einiger Zeit ein Dorn im Auge. Godefried sorgte mit seiner ungewaschenen Horde schon seit Ostermond im Niederfränkischen entlang des Rheins für Unfrieden. Darüber hörte man allenthalben von Kauffahrern und reisenden Spielleuten. Nicht, dass diese Tatsache an sich Arnulf besonders interessiert hätte, aber wenn die Dänen immer frecher wurden und die Ruhr heraufkamen, war er dem König verpflichtet, im Bereich seines Lehens für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Dieses Gesindel war sich ja nicht einmal zu schade, seine Schiffe über Land zu transportieren, um die Wasserfälle und Stromschnellen des Flusses zu überwinden. Aber auch die Dänen an der Ruhr wären nicht das drängendste Problem für Arnulf gewesen. Er konnte seine Schildknechte aussenden, um der gelegentlichen Wirrsal Abhilfe zu schaffen. Er selbst jedoch verließ nur noch ungern seine Burg. Dafür gab es jüngere und stärkere Recken unter seinem Banner.
Arnulfs eigentliche Befürchtung war, dass König Ludwig auf den Gedanken kommen könnte, der Bedrohung durch den Dänenkönig im Reich ein endgültiges Ende zu setzen. Ludwig II. war ein alter Mann und lag mit etlichen Grafen und Adeligen im Streit. Allen voran mit dem Erzbischof von Mainz. Wenn Arnulfs Informationen noch galten, hatte man sich zwar für den Moment geeinigt, aber um die Machtbalance zwischen geistlicher und weltlicher Autorität wurde schließlich ständig gerungen. Sollte aus einem dieser Konflikte ein Krieg entbrennen, würde Ludwig Arnulfs Gefolgschaft einfordern, was bedeutete, dass er mit allen seinen Mannen persönlich in die Schlacht ziehen müsste.
Er hatte zwar keine Angst vor Krieg – in früheren Zeiten hatte er so manche Schlacht geschlagen und manchen Schädel gespalten – aber Arnulf fand, dass jedes Ding seine Zeit hatte. Und seine Zeit für derlei Scharmützel war vorbei. Jetzt war seine Zeit für Wildbret, Entenküken, Honigkuchen und Rheinwein angebrochen. Und hin und wieder – nicht sehr oft – die Zeit für eine Magd oder eine Dirne, die sein Lager wärmte.
Ein eiskalter Wind zog ihm in den Nacken, und ein paar Schneeflocken wirbelten durch den noch immer geöffneten Fensterschlitz in seinem Rücken herein. Arnulf stand auf, um den Laden zu schließen und sah draußen, weit unten am Fluss, wie große Ballen von Rohwolle von einem Kahn abgeladen wurden. Auf der Treppe waren Schritte von schweren Stiefeln zu hören. Arnulf schloss das Fenster, und Everard, einer seiner ältesten Knechte betrat das Gemach. Er mochte fünfunddreißig oder mehr Sommer zählen. Wie bei seinem Herrn wurde sein Gesicht von einem opulenten Bart eingerahmt. Er trug ein ledernes Wams, und an seinem Wehrgehenk baumelte das Schwert.
„Herr“, sagte der Ankömmling knapp.
„Everard, du musst eine Schar sammeln“, erklärte ihm Arnulf. „Zwanzig Mannen sollten genügen. Es geht nach Werden. Heute, noch vor der Non. Nein, lass es dreißig sein. Wir wollen Godefried eine Lehre erteilen.“
Adalheidis
leich nach der Prim, noch vor Sonnenaufgang, war die Familie auf dem Acker. Es galt, den Boden auf dem Feld rechts des Baches für die erste Aussaat von Hafer und Gerste zu bereiten. Während Albrecht den Ochsen am Joch führte, folgte Finn hinter dem Tier und hielt die Pflugstiele mit beiden Händen, wobei er sich schwer nach vorn lehnte, um die Pflugschar, die aus dem besonders strapazierfähigen Holz der Hainbuche bestand, in den noch nicht sehr weichen Ackerboden zu pressen.
Mutter Luitgard und der jetzt zehn Sommer zählende Walther folgten dem Gespann in einigem Abstand und zerschlugen nach Kräften mit einfachen Hacken aus Eiche die groben aufgeworfenen Erdklumpen in kleinere Brocken. Dietlind, die Finn inzwischen als kleine Schwester betrachtete, bummelte am Ackerrain entlang und pflückte Leinkraut und Schlüsselblumen. Sie erholte sich noch von einer schweren Fieberkälte, die sie im Sohlmonat mehr als sieben Tage aufs Lager geworfen hatte. Für Finn war es die erste Aussaat in seinem Leben, an der er teilnahm. Zumindest soweit er sich erinnern konnte. Denn die Erinnerung an seine Herkunft schien für immer verschüttet zu sein.
„Tiefer, Fuchs“, rief Albrecht ihm zu, als sie nach dem Wenden des Ochsen parallel zur zuvor gezogenen Furche pflügten. „Das Holz muss tiefer in den Grund.“ Finn stemmte sich so stark mit den Händen auf den Pflug, dass er beinahe in der Luft schwebte. Wenn ich schwerer wäre, dachte er, würde es besser gelingen. Vielleicht nach ein paar Sommern in Astnide. Albrecht nannte ihn meistens Fuchs, wegen seiner rötlichen Haare, die inzwischen recht lang geworden waren. Das meinte der Mann, den er nun gelegentlich Vater nannte, jedoch nicht böse. Auf jeden Fall war es besser als Bankert, wie ihn andere Bauern im Tal oft titulierten. Es kam jetzt auch nicht mehr oft vor, dass Finn einzelne Worte und Begriffe nicht verstand.
„Weib, gib dem Knaben die Hacke“, sagte Albrecht. „Und führ du den Ochsen. Ich werde pflügen.“ Man wechselte dementsprechend die Positionen. Finn schlug nun Erdklumpen entzwei, und Albrecht drückte die Pflugschar in den Grund, während Luitgard den Ochsen lenkte. Finn fand es schade, dass das große brave Tier keinen Namen hatte. Allerdings war ihm noch keiner eingefallen, der so recht passen wollte.
Als Luitgard eine Weise anstimmte, fiel Dietlind, die lachend am Ackerrain stand, sofort mit ein. Finn wunderte das nicht, denn die beiden sangen oft am Tage bei der Arbeit, oder auch am abendlichen Herdfeuer, während Luitgard Beinlinge und Hemden flickte. „Das erfuhr ich bei den Menschen, am weisesten der Menschen, dass Erde nicht war, noch Himmel.“ Es war Luitgards Lieblingslied, und Finn hatte es schon oft gehört. Eigentlich handelte es sich um so etwas wie ein melodisches Gebet. Finn hatte den Sinn des Textes nie verstanden, und er war auch nicht davon überzeugt, dass Luitgard selbst ihn verstand. Dietlind ganz bestimmt nicht, aber sie sang es dennoch mit Inbrunst und Begeisterung.
Der Frost war, durch Gottes Segen, ungewöhnlich früh, zum ersten des Lenzmonats gewichen, und eine wärmende Sonne hatte die gefrorene Reifkruste auf dem Land aufgelöst. Der Lindenbaum neben der Scheune war dabei auszutreiben, und die Blütezeit der Haselnusssträucher war angebrochen. Hildegardis, die einzige Milchkuh – sie immerhin hörte auf einen eigenen Namen –, hatte laut im Stall gerufen – was sie sonst selten tat – und die Hühner scharrten so emsig im noch immer spärlichen Gras vor dem Haus, als gälte es, einen Schatz aus Denaren und Schillingen ans Tageslicht zu fördern.
„Grüß euch in Christo“, rief eine Frauenstimme auf dem Karrenpfad neben dem Acker. Finn blickte auf und sah eine Frau, die, wie Luitgard, ein langes Kleid und Schürze, und auf dem Kopf eine dunkelgraue Stoffhaube trug. Sie war jedoch wesentlich korpulenter als Finns Ziehmutter. Das Mädchen neben ihr war dagegen eher dünn und hatte die dunkelbraunen Haare zu einem dicken Zopf geflochten, der ihr bis tief über den Rücken fiel. Beide zogen gemeinsam einen vierrädrigen Karren, auf dessen Ladefläche sich Holzbottiche befanden. Vermutlich hatten sie Wasser vom Bach geholt.
„Grüß dich, Heiltrud“, antwortete Luitgard, die das Joch des Ochsen hielt und hob ihre freie Hand zum Gruß. Auch Albrecht blickte auf und grüßte die Frau. Finn vergaß für einen Moment seine Arbeit mit der Hacke. Sein Blick wurde von dem zierlichen Wesen mit dem braunen Zopf eingefangen. Obwohl das Mädchen sicher zwanzig Ellen von ihm entfernt neben der kräftigen Frau an der Deichsel des Karrens zog, gewahrte er die stolzen hohen Wangenknochen und den klugen und forschenden Blick aus ihren grauen Augen. Sie mochte etwas jünger sein als er, aber wahrscheinlich nicht viel. Vielleicht hatte sie zehn oder elf Sommer gesehen. Finn fragte sich, warum sie ihm noch nie aufgefallen war, denn im Verlaufe des vergangenen Herbstes und Winters hatte er die Menschen von den Nachbarhufen nach und nach kennengelernt, selbst Heiltrud und Giselbert, die mit ihren drei Kindern am anderen Ende des Tals lebten, da wo der Bach es nicht mehr weit bis zur Ruhr hatte. Zuletzt hatte sich zu Epiphanias, dem ersten Sonntag nach Neujahr, beinahe die halbe Siedlung bei klirrendem Frost und strahlendem Sonnenschein auf dem Anger vor der Mühle des alten Hartmann eingefunden, um die Worte des Wanderpredigers aus dem Süden zu hören, der sich auf dem Weg nach Aachen, zur Kaiserpfalz, befand.
Das sei nicht nur eine mühselige, sondern auch gefährliche Reise. Mit dieser Ansprache hatte der Bauer Hildebrand den frommen Mann nach dessen Predigt beiseite genommen. Er möge es sich wohl überlegen, ob er sich nicht besser nach Norden wenden wolle, vielleicht nach Minden oder Biliuelde, wo viele gottesfürchtige Menschen lebten. Die Gebiete im Westen, entlang der Ruhr um Kettinge, Broich und Mulinhem seien in diesen Zeiten nicht sicher, und die Fährstätten entlang des Rheins oft von mordlüsternen Heiden belagert.
Das würde für ihn keine Rolle spielen, hatte der fromme Mann erwidert. Gott allein sei es, der ihn und sein Muli auf ihrem Weg leite, und bisher sei ihm kein einziges Haar gekrümmt worden, obwohl er mit seinem Packtier den Weg durch den schier endlosen finsteren Forst zwischen Babenburg und Fuldensis herauf durchmessen habe.
Wie auch immer, dieses holde Mädchen an der Seite der Bäuerin, war damals nicht bei der Predigt erschienen, daran hätte Finn sich erinnert.
„Was für feine Blumen du da hast, Kleine“, sprach Heiltrud die kleine Dietlind an, die mit ihren gepflückten Schlüsselblumen und dem Leinkraut am Wegesrand stand. Sie trippelte von einem Bein aufs andere, und offensichtlich war ihr kalt. Es gab zwar keinen Frost mehr, aber ohne rechte Anstrengung konnte man leicht ins Bibbern kommen, was sicher nicht gut war so bald nach der Fieberkälte. Dietlind lächelte die Frau nur stumm an.
„Sicher sind die für deine Mutter“, vermutete die Bäuerin, und Dietlind nickte artig. „Das hier ist unsere Adalheidis“, führte Heiltrud weiter aus, und fügte mit einem Blick auf Luitgard hinzu: „Sie lebt jetzt mit uns, seit der Herr meine liebe Ermengard, die meine Schwester war, zu sich geholt hat.“
„Das tut mir leid, Gott hab sie selig“, entgegnete Luitgard und blickte dann das Mädchen Adalheidis an. „Deine liebe Mutter sitzt jetzt zu Füßen unseres Herrn.“ Das Mädchen nickte und schaute unter sich. Sie zog Finns Blick in ihren Bann wie durch weiße Magie.
„Wir müssen dann weiter“, sagte Heiltrud und hob eine Hand zum Gruß. „Wünsche noch ein wohlgetanes Werk.“ Sie zog an der Deichsel, und der Wagen setzte sich rumpelnd in Bewegung. Über die Ränder der Bottiche schwappte das Wasser. Albrecht grüßte durch Brummen und Kopfnicken, und stemmte sich auf den Pflug.
Während Finn mit seiner Hacke auf die groben Erdklumpen eindrosch, blickte er immer wieder auf, und betrachtete das Mädchen in seinem blauen Kleid, einer Farbe, die man im Tal nur selten zu Gesicht bekam, wenn man von den Kornblumen absah, die sich im vergangenen Jahr noch bis zur Ernte in der Mitte des Herbstmondes unter Gerste und Roggen gemischt hatten. Adalheidis, dachte er. Was für ein wundersamer Name.
In diesem Moment brachen vier Reiter zu seiner Rechten aus dem Gehölz hervor. Einer hielt ein zusätzliches Ross am Zügel, dem man offensichtlich erjagtes Wild auf den Rücken geschnürt hatte. Die Männer hielten im gestreckten Galopp auf den eben bearbeiteten Acker zu, ließen ihre Gäule Klumpen aufwirbelnd durch die frischen Furchen preschen und schwenkten dann auf den schmalen Pfad ein, auf dem sich Heiltrud und Adalheidis mit ihrem Karren befanden.
Albrecht hatte vor Schreck den Pflug fahren lassen, und Finn rannte spontan mit großen Sprüngen auf den Pfad zu. Für einen Moment fürchtete er, die Kerle würden die beiden Frauen niederreiten, aber im letzten Moment lenkten sie ihre Rösser zur Seite und preschten links und rechts an ihnen vorbei. Die Bäuerin hatte die Deichsel fahrenlassen und stolperte rückwärts zu Boden.
„Aus dem Weg, Frau“, rief einer von ihnen. Die anderen lachten. Finn bückte sich impulsiv, hob einen faustgroßen Stein auf und schleuderte ihn mit voller Kraft den Reitern hinterher. Tatsächlich traf er den Hintern eines der Rösser. Das stieß ein erschrecktes Schnauben aus, machte einen Satz zur Seite und stieg dann mit den Vorderläufen in die Luft. Der Reiter hatte Mühe, sich im Sattel zu halten, und brauchte lange Sekunden, sein Tier wieder zu bändigen. Finn stand schweratmend bei dem Weib und dem Mädchen, das seiner Tante auf die Beine half.
„Finn, beim Himmel!“, hörte er Luitgards erschrockene Stimme im Hintergrund. Er sah, wie die drei anderen Reiter mit dem Packtier, die schon einige Klafter weiter voraus waren, anhielten und sich anschickten, ihre Rösser zu wenden.
„Dich werd ich ehelichen“, hörte Finn Adalheidis unvermittelt dicht neben sich sagen. Er starrte sie entgeistert an.
„Lauf, lauf weg, rasch“, raunte die Bäuerin ihm zu. „Mach, dass du wegkommst.“ Finn reagierte sofort. Er sah, wie der Reiter, dessen Ross er beworfen hatte, ihm grimmige Blicke zuwarf, drehte sich um, rannte über den Acker – wobei er ein paar Saatkrähen aufscheuchte –, überquerte den schmalen Streifen einer Wildwiese und erreichte alsbald den Rand des Forstes, als er hinter sich schon die dumpfen Hufschläge vernahm. Die Stämme der Eiben und Eschen, standen so dicht, ihre Äste waren derart ineinander verzahnt, dass Finn sich bücken und mit den Händen Zweige zur Seite biegen musste. Dann übersprang er einen Graben, hastete durchs Unterholz, kletterte über einen Felsen, stolperte und rollte haltlos einen Hang hinunter, bevor er auf die Beine kam und erneut rannte. Über ihm flatterten Vögel auf.
Hinter sich hörte er Huftritte, das Krachen von Holz und das raue Fluchen der Männer. Offenbar hatten sie Mühe, mit ihren Rössern das dichte Gehölz zu durchqueren. Mit einem gewagten Sprung überquerte Finn ein dünnes Rinnsal, das zwischen Steinen durch ein Bett aus abgestorbenen Blättern und Moos sickerte. Dann ließ er sich in eine Senke fallen und kauerte sich unter einen Felsvorsprung. Jetzt hörte er sein Herz überlaut in den Ohren pochen, und er war sich gewiss, dass die Männer es würden hören können, wenn sie nur nahe genug herankämen.
Eine Weile lauschte er reglos den Rufen und dem Knacken im Unterholz, das die Gäule verursachten. Eben noch hatte er das Schnauben eines Rosses in direkter Nähe vernommen, aber die Laute bewegten sich von ihm weg, wurden leiser. Dann war es still. Nur das warnende Tak-tak-tak einer Amsel hallte über seinem Kopf in den Baumkronen. Noch immer fühlte er sein Herz laut in der Brust schlagen. Zu schnell, aber nicht beängstigend. Im Gegenteil. Er sah Adalheidis in seinem inneren Blick, das zarte Mädchen im blauen Kleid. Das liebliche Antlitz, die hohen Wangenknochen, das Kinn, welches sich wagemutig nach vorn reckte, die feine Nase, nicht zu groß und nicht zu klein. Und die grauen Augen. Waren da kleine grüne Einschlüsse in ihrer Iris, die schimmerten wie Smaragde? Dich werd ich ehelichen, hatte sie gesagt, und die Stimme war hell, klar und vollkommen rein gewesen, fest und sicher.
Sie beide waren Kinder. Kinder heirateten nicht. Aber er hatte ihr imponiert, sein Steinwurf hatte ihr gefallen. Gut also, dass er es getan hatte. Aber was ging jetzt vor? Was taten die Männer als Nächstes? Wie erging es seiner Familie? So spontan sein Mut aufgeflammt war, als er den Stein aufhob – es war ein Aufbegehren gegen die Rücksichtslosigkeit der Reiter gewesen, Wut und vielleicht ein kleines bisschen Beschützerinstinkt – so sehr fürchtete er sich jetzt davor, sein Versteck zu verlassen. Die Verfolger hatten ihn fürs Erste verloren, die Sache war ihnen vielleicht auch nicht wichtig genug gewesen. Ein Knabe, der einen Stein wirft. Man verpasst ihm eine Maulschelle und geht seiner Wege. So würde es hoffentlich auch in diesem Fall ablaufen.
Junker Dietrich
brecht war zu seinem Weib getreten und hielt jetzt den Ochsen am Joch. Die Sonne schimmerte milchig durch trüben Hochnebel. Es mochte die Stunde zwischen der Terz und der Sext sein. Sie hätten viel weiter sein sollen mit dem Acker. Aber sie alle, sogar Heiltrud und ihre Ziehtochter Adalheidis, standen noch immer reglos jeweils an den Plätzen, an denen sie sich befunden hatten, als der Steinwurf erfolgte. Albrecht und die anderen Erwachsenen wussten, wessen Ross Finns Stein getroffen hatte. Es war zum Glück nicht das des jungen Herrn selbst gewesen, aber der Frevel hatte einen seiner Begleiter ereilt, der um ein Haar schmachvoll zu Boden gestürzt wäre.
Sie alle starrten wie gebannt auf die Stelle am Forstrand, an der die drei Rösser ins Unterholz eingebrochen waren. Niemand warf einen Blick für den vierten Reiter, der zusammen mit dem Packross auf dem Karrenpfad wartete. Fast hoffte Albrecht, sie würden den Fuchs erwischen. Sie würden ihn bestrafen, der Sohn des Landesherrn würde ihm einen deftigen Backenstreich zuteilwerden lassen, und vielleicht würde es damit gut sein. Er war nur ein Knabe, mit dem die Gäule durchgegangen waren.
Aber wie würde Dietrich handeln, wenn er des Übeltäters nicht habhaft werden konnte, um seine Würde wiederherzustellen? Eine Weile lauschten sie, wie die Männer sich im Wald gegenseitig etwas zuriefen. Dann brachen drei Rösser aus dem dunklen Forst hervor. Im leichten Trab näherten sie sich den Bauersleuten auf dem Feld. Die Männer waren ohne Helme unterwegs, in graue Beinlinge und blaue Tuniken gekleidet, über denen sie sandfarbene Wämser trugen. Nur ihr Anführer steckte in einem dunkelbraunen Wams aus gestepptem Leder. Alle waren mit Jagdspießen, Bögen und Pfeilen, Messern und Schwertern bewaffnet. Hoch auf ihren kräftigen Rössern thronend boten sie einen ehrfurchtsgebietenden Anblick.
„Weißt du, wer ich bin, Bauer?“, herrschte der Anführer Albrecht an.
„Natürlich, Herr, Ihr seid Junker Dietrich.“ Albrecht hatte sicherheitshalber eine ehrfürchtige Haltung eingenommen, senkte dabei aber nicht seinen Blick.