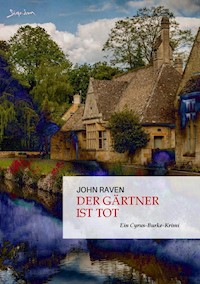
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Signum-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Cyrus Burke, ein junger Antiquitätenhändler aus Connecticut, kommt in das englische Dorf Darkmere, um einer Gutsherrin ein mittelalterliches Schriftstück abzukaufen. Doch bevor er mit der resoluten Elizabeth Huntington handelseinig werden kann, wird Burke in einen höchst seltsamen Mordfall verwickelt: Mrs. Huntingtons Gärtner Charlie Corrigan - ein kaum liebenswert zu nennender Zeitgenosse - wird brutal erschlagen. Und der ermittelnde Beamte, Inspektor Lejeune, ist durchaus nicht von der Unschuld des Amerikaners überzeugt... Der Roman DER GÄRTNER IST TOT aus der Feder des britischen Schriftstellers John Raven (eigentlich Jonathan Quinton Raven, Jahrgang 1968) ist der Auftakt einer Serie von Romanen um den Antiquitätenhändler Cyrus Burke, der immer wieder unversehens in die merkwürdigsten Kriminalfälle stolpert. John Ravens Romane erscheinen exklusiv im Signum-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
John Raven
Der Gärtner ist tot
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
DER GÄRTNER IST TOT
Die Hauptpersonen dieses Romans
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Impressum
Copyright © 2023 by John Raven/Signum-Verlag.
Published by arrangement with the Raven Family Trust.
Lektorat: Dr. Birgit Rehberg.
Übersetzung: Anna Borkowska.
Originaltitel: Well, The Gardener Is Dead.
Umschlag: Copyright © by Christian Dörge.
Verlag:
Signum-Verlag
Winthirstraße 11
80639 München
www.signum-literatur.com
Das Buch
Cyrus Burke, ein junger Antiquitätenhändler aus Connecticut, kommt in das englische Dorf Darkmere, um einer Gutsherrin ein mittelalterliches Schriftstück abzukaufen. Doch bevor er mit der resoluten Elizabeth Huntington handelseinig werden kann, wird Burke in einen höchst seltsamen Mordfall verwickelt: Mrs. Huntingtons Gärtner Charlie Corrigan - ein kaum liebenswert zu nennender Zeitgenosse - wird brutal erschlagen. Und der ermittelnde Beamte, Inspektor Lejeune, ist durchaus nicht von der Unschuld des Amerikaners überzeugt...
Der Roman Der Gärtner ist tot aus der Feder des britischen Schriftstellers John Raven (eigentlich Jonathan Quinton Raven, Jahrgang 1968) ist der Auftakt einer Serie von Romanen um den Antiquitätenhändler Cyrus Burke, der immer wieder unversehens in die merkwürdigsten Kriminalfälle stolpert.
John Ravens Romane erscheinen exklusiv im Signum-Verlag.
DER GÄRTNER IST TOT
Die Hauptpersonen dieses Romans
Cyrus Burke: ein Antiquitätenhändler aus Connecticut.
Elizabeth Huntington: Herrin von Huntington House.
Edward Huntington: ihr Sohn.
General Redcliffe: Offizier im Ruhestand.
Sybil Redcliffe: seine Tochter.
Jonathan Redcliffe: ihr Bruder.
Jack Ardingly: Pfarrer von Darkmere.
Charles Corrigan: Gärtner auf Huntington House.
Will Brock: Farmer.
Ernst Richter: Drogist.
Inspektor Daniel Lejeune: Kriminalbeamter.
Superintendent Stewart Harcourt: Kriminalbeamter.
Dieser Roman spielt 1975 in Darkmere, Gloucestershire, England.
Erstes Kapitel
Alles erschien mir wie in einem Traum. Ich kannte England aus Reisebeschreibungen, aus Prospekten und Filmen, musste mich geschäftlich mit englischer Geschichte befassen und hatte Kontakt mit dortigen Antiquariaten. Aber es war doch etwas völlig anderes, selbst hier zu sein. Und nichts konnte diesen Unterschied deutlicher betonen als der Punkt, an dem ich jetzt stand: am schmiedeeisernen Tor eines englischen Herrensitzes.
Ich zündete mir eine Zigarette an und folgte der kiesbestreuten Auffahrt durch den Park zum Huntington House. Der weitläufige Park wirkte etwas vernachlässigt; unter den mächtigen alten Buchen weideten Kühe. Das war kein Wunder, denn Mrs. Huntington befand sich in finanziellen Schwierigkeiten und konnte es sich wahrscheinlich nicht leisten, mehrere Gärtner zu beschäftigen.
Möglicherweise irrte ich mich auch. Ich wusste keineswegs mit Gewissheit, dass sie pleite war. Aber ich vermutete es nach Dr. Lippincotts Darstellung, mit der er mich auf die Spur des Raimond-Manuskripts gebracht hatte.
Dr. Lippincott war ein alter Freund meines Vaters. Die beiden hatten sich während des Krieges in London kennengelernt, wo Dad eine amerikanische Chiffrier-Stelle geleitet hatte. Als Dad sein Geschäft wiedereröffnet hatte, war Dr. Lippincott sein Verbindungsmann in England geworden – aus alter Freundschaft, nicht etwa, weil er Geld brauchte. Er war wohlhabend, kannte eine Unmenge von Leuten und hörte oft von beabsichtigten Verkäufen, so dass er Dad auf ausgezeichnete Gelegenheiten aufmerksam machen konnte. Nach Dads Tod hatte es sich ganz natürlich ergeben, dass Lippincott weiterhin für mich tätig war.
Er hatte mir von dem Raimond im Juli geschrieben, als er hörte, Mrs. Huntington beabsichtige, einiges aus dem Nachlass ihres Onkels zu verkaufen. Ende August hatte Dr. Lippincott mir die Abschrift des Eintrags in Sir Francis’ eigenem Katalog geschickt, weil er wusste, dass sie mein Interesse wecken würde:
15 Seiten einer Raimond de Poitiers zugeschriebenen Handschrift; Teil einer Beschreibung des Kreuzzugs von Richard Löwenherz. Ähnlichkeit mit dem Ambroise-Text. Durch Killie von Comte Jean de Verac erworben, zu dessen Familienbesitz die Handschrift seit dem Mittelalter gehörte. 31. Mai 1900.
Dr. Lippincott hatte recht – mein Interesse war geweckt. Ich beschloss sogar, mir das Manuskript selbst anzusehen. Bob, mein Partner, erhob keine Einwände, und so saß ich am 7. September in einem Flugzeug, das mich nach London brachte. Dr. Lippincott hatte bereits an Mrs. Huntington geschrieben und einen Termin mit ihr vereinbart. Nach einigen Tagen in London mietete ich mir einen Wagen, fuhr nach Darkmere hinaus und traf dort pünktlich um elf Uhr ein.
Als jetzt das Haus vor mir auftauchte, war ich ziemlich verblüfft. Ich hatte ein schlossähnliches Gebäude erwartet und sah zwei mächtige Steinmauern mit leeren Fensterhöhlen, durch die Bäume zu erkennen waren. In diese äußere Schale war ein kleineres Haus hineingebaut worden, das derart baufällig wirkte, als werde es nur durch die Burgmauern zusammengehalten.
Ein junger Mann mit einem Schubkarren voll Brennholz stand am Rand der Einfahrt. Als ich ihn erreichte, warf er mir einen abschätzenden Blick zu und fragte: »Haben Sie eine Zigarette für mich?«
Sein Tonfall – halb bettelnd, halb unverschämt – gefiel mir nicht. Ich fand den ganzen Kerl unsympathisch: seine schmutzigen langen Haare, seine allzu engen Jeans, seine Visage und sein Grinsen. Doch warum sollte ich ihm keine Zigarette geben, wenn ich selbst rauchte? Ich bot ihm eine an.
»Danke«, murmelte er und steckte die Zigarette in die Hemdtasche. »Wollen Sie ins Haus?«
Ich nickte.
»Falls Sie was zu verkaufen haben, vergeuden Sie Ihre Zeit. Sie kauft nichts.« Er warf mir einen Blick zu, der abweisend sein sollte und seinen Zweck erfüllte. Ich war größer und kräftiger als er, aber der junge Mann hatte etwas Unberechenbares an sich.
»Ich verkaufe nichts«, sagte ich und ging weiter.
»Sind Sie ein Yankee? Oder Kanadier?«, fragte er. »Ich mag Yankees. Sie sind reich und wissen etwas mit ihrem Geld anzufangen.«
»Ja, ja, schon gut«, wehrte ich ab.
»He, wie wär’s mit noch einer Zigarette?«, rief er mir nach.
»Eine genügt«, entschied ich.
Das Haus war weitaus baufälliger, als ich zunächst vermutet hatte. Ich betätigte den eisernen Türklopfer. Nach einer Weile wurde die Tür von einer älteren Frau geöffnet, die mich misstrauisch anstarrte. Sie trug eine schmutzige graue Kittelschürze.
»Mein Name ist Cyrus Burke«, stellte ich mich vor. »Ich bin für elf Uhr mit Mrs. Huntington verabredet.«
»Aha?«, fragte sie.
Ich wiederholte meinen Spruch.
»Kommen Sie herein«, forderte sie mich auf. »Ich sage es der gnädigen Frau.«
Die Diele war groß, düster und holzgetäfelt. Ich hatte den Eindruck, sie sei früher der Hauptraum des Hauses gewesen. Eine steile Holztreppe führte zu einer Galerie hinauf, wo Jagdtrophäen und dunkle Ahnenbilder an den Wänden hingen. Ich wurde in einen etwas helleren Salon geführt, der mit abgenützten alten Möbeln ausgestattet war, und brauchte dort nicht lange zu warten. Eine Frau kam rasch herein.
»Mr. Burke?«, fragte sie. Ihre Stimme war nicht laut, aber energisch. Im Gegensatz zu allem anderen war Mrs. Huntington gepflegt und sogar elegant. Sie trug ein schlichtes schwarzes Kleid mit einem Medaillon an einer Silberkette, die gut zu ihrem silbergrauen Haar passte.
»Mrs. Huntington? Guten Tag.« Ich streckte die Hand aus. Sie ignorierte sie.
»Ich hatte einen etwas... reiferen Verhandlungspartner erwartet«, erklärte sie mir scharf.
»In meinem Geschäft ist nicht das Alter wichtig, Mrs. Huntington«, antwortete ich mit gewinnendem Lächeln. »Ich versichere Ihnen, dass ich über große Erfahrung verfüge.«
»Ja, ich weiß, dass Sie Amerikaner einem wahren Jugendkult huldigen.«
»Tut mir leid, dass Sie Amerikaner nicht mögen, aber...«, begann ich.
»Wen ich mag oder nicht, tut nichts zur Sache. Als Dr. Lippincott Ihren Namen erwähnt hat, war ich nur einverstanden, weil bekannt ist, wie reich die Amerikaner auf Kosten anderer Staaten geworden sind. Ich hatte jedoch mit jemandem in seinem Alter gerechnet.«
Ich musste mich beherrschen, um keine bissige Antwort zu geben. »Ich kaufe und verkaufe seit fast fünfzehn Jahren Bücher und Handschriften, Mrs. Huntington«, erklärte ich, was allerdings ein wenig übertrieben war. »Ich bin nicht reich, falls Sie das annehmen. Aber ich kenne den Markt und zahle gut für gute Ware. Mehr können Sie von keinem Händler erwarten. Ich bin nicht gekommen, um mich mit Ihnen zu streiten, aber wenn Sie mir die Handschrift lieber nicht zeigen wollen...«
»Durchaus nicht«, unterbrach sie mich. »Sind Sie immer so empfindlich? Die Handschrift ist ausgesprochen wertvoll, und man muss sich eben davon überzeugen, dass man die richtigen Menschen vor sich hat.« Sie lächelte flüchtig. »Möchten Sie sich die Handschrift jetzt ansehen?«
Mrs. Huntington wartete meine Antwort nicht ab, sondern führte mich in die Diele hinaus und die Treppe hinauf. Die ungewöhnlich steile Treppe war so schlecht beleuchtet, dass ich auf der vorletzten Stufe fast das Gleichgewicht verlor und mich am Geländer festhalten musste. Mrs. Huntington öffnete eine massive Eichentür am Ende der Treppe. Dahinter lag eine behaglich eingerichtete Bibliothek mit hohen Bücherschränken, einem Marmorkamin, Empire-Möbeln und einem riesigen Globus in einem Mahagonigestell. Der Raum gefiel mir, und ich äußerte mich anerkennend darüber.
»Mein Onkel hat die letzten fünfzehn Jahre seines Lebens im Rollstuhl verbracht – vor allem hier«, antwortete sie. »Mein Vater hat die Bibliothek selten benutzt. Ich selbst interessiere mich nicht für Bücher, aber ich finde den Raum gemütlich.«
Mrs. Huntington wählte einen Schlüssel aus ihrem Schlüsselbund aus und schloss damit einen der Schränke auf. Sie nahm eine Lederschatulle heraus, die sie auf den Tisch am Fenster stellte.
»Sie kennen natürlich die Beschreibung aus dem Katalog meines Onkels«, sagte sie. »Kurz vor dem Krieg ist die Bibliothek geschätzt worden, weil sie versichert werden sollte. Ein Mann von Saxby’s in London war hier und hat sich die ganze Sammlung angesehen. Hier ist sein Schätzbericht. Das Manuskript hat die Nummer drei.«
Sie gab mir mehrere zusammengeheftete Briefbogen mit dem bekannten Aufdruck der Londoner Firma. Ich stellte interessiert fest, dass die beiden ersten Nummern ein Stundenbuch aus dem 13. Jahrhundert und ein Messbuch aus dem 15. Jahrhundert waren. Bei Nummer drei hieß es:
Handschrift auf Pergament, gereimte Chronik auf Altfranzösisch, vermutlich 12. Jahrhundert, von Raimond de Poitiers. 15 Seiten, Einband aus dem 16. Jahrhundert, keine Initialen. £ 500.
»Was ist mit den ersten Nummern?«, fragte ich.
»Die besitze ich nicht mehr«, antwortete Mrs. Huntington kurz. »Ich hoffe, dass Sie keinen Zweifel an der Echtheit des Manuskripts haben. Saxby’s ist eine alte und angesehene Firma.«
»In der Tat, Madam«, nickte ich.
»Die Handschrift ist heutzutage selbstverständlich mehr als fünfhundert Pfund wert. Die Preise haben seitdem angezogen, und der Geldwert ist seit der Vorkriegszeit zurückgegangen.«
»Ich möchte mir das Manuskript gern in Ruhe ansehen, Mrs. Huntington. Falls es meinen Vorstellungen entspricht, mache ich Ihnen ein faires Angebot. Doch ich möchte es ungestört studieren können – hier an diesem Tisch.«
»Ich soll Sie damit allein lassen?«, fragte sie ungläubig.
»Hören Sie, Mrs. Huntington«, sagte ich geduldig, denn ich erlebte diese Reaktion nicht zum ersten Mal. »Ich bin Händler, kein Dieb. Ich will Ihr kostbares Stück nicht stehlen. Ich weiß, wie man mit so etwas umgeht. Es bleibt unbeschädigt, das verspreche ich Ihnen. Aber ich brauche mindestens eine halbe Stunde Zeit und mag nicht, wenn mir jemand dabei zusieht. Das macht mich nervös. Sie wollen doch, dass ich Ihnen das bestmögliche Angebot mache, nicht wahr?«
»Gut, meinetwegen«, stimmte Mrs. Huntington zögernd zu. »Genügt Ihnen eine halbe Stunde? Falls Sie mich vorher sprechen wollen, brauchen Sir nur zu klingeln.« Sie zeigte auf den Knopf neben der Tür.
»Danke«, antwortete ich. »Ich werde so rasch wie möglich arbeiten, Mrs. Huntington.«
Sie blieb noch einen Augenblick stehen, schloss dann bewusst langsam den Schrank ab, aus dem sie das Manuskript genommen hatte, und verließ den Raum. Die große Tür blieb offen.
Ich setzte mich an den Schreibtisch am Fenster, öffnete die Schatulle und entnahm ihr eine Leinenmappe, die das in Leder gebundene Manuskript enthielt. Der Einband war alt und abgewetzt, aber noch immer ein schönes Beispiel für die Buchbinderkunst des 16. Jahrhunderts. Als ich den Deckel aufschlug, fiel ein zusammengefaltetes Blatt Papier heraus. Ich hob es auf und versuchte die Aufschrift zu entziffern. Die Schrift war schwer zu lesen, aber ich erriet, dass die Anschrift Chas. Nowlle Esq. lautete. Der Brief trug das Datum des 5. Mai 1895; er war praktisch unleserlich, und ich fand kein Wort, das wie Raimond oder Manuskript aussah, so dass ich den Brief vorerst wieder zusammenfaltete und weglegte.
Dann wandte ich mich dem Manuskript zu. Das Pergament wirkte echt, die Tinte und die Schrift ebenfalls. Ich begann zu lesen.
Ieu sui Raimond del vil Poictier E longue estoire ja traicter...
Die zweite Zeile war fast mit der ersten des französischen Dichters Ambroise identisch. Aber Ich bin Raimond aus der Stadt Poitiers schien besser zu Und ich habe eine lange Geschichte zu erzählen zu passen. Ich las weiter und merkte bald, dass nur ein Sprachwissenschaftler beurteilen konnte, ob dies ein Original oder nur eine frühe Kopie des Ambroise-Textes mit gewissen Ausschmückungen war. Doch ich war von dem Manuskript beeindruckt.
Ein lautes Poltern ließ mich zusammenzucken. Ich sah auf und erkannte meinen Freund, den langhaarigen Zigarettenschnorrer. Er leerte eben einen Eimer voll Brennholz in den Kupferkübel am Kamin. Jetzt richtete er sich grinsend auf.
»Was tun Sie da?«, fragte er. »Sie lesen wohl?«
»So ist es.«
Er kam heran und betrachtete die Handschrift mit zusammengekniffenen Augen. »Ein handgeschriebenes Buch, was? Bestimmt ein Vermögen wert. Die Schränke sind voll davon. Das ist schon eine Versuchung, nicht wahr?«
Sein unangenehmer Geruch ließ mich den Stuhl zurückschieben.
»Hören Sie, ich habe keine...«
»Das wäre nicht einmal richtiger Diebstahl. Heutzutage kümmert sich kein Mensch mehr um die Bücher. Sie verstauben nur. Eigentlich keine schlechte Idee, ein paar davon zu Geld zu machen. Aber sie behält sie hinter Schloss und Riegel.« Er beugte sich vor. »Sie haben nicht zufällig den Schlüssel?«
»Sind Sie übergeschnappt?«, fragte ich verblüfft. »Glauben Sie wirklich, dass ich Ihnen helfen würde, Mrs. Huntingtons Bücher zu stehlen?«
»Immer mit der Ruhe«, antwortete er. »Wer hat denn von stehlen geredet? Doch nur Sie! Ich habe bloß gefragt, ob Sie den Schlüssel haben.«
»Nein, ich habe ihn nicht.« Ich stand auf. »Lassen Sie mich jetzt bitte in Ruhe. Ich habe zu arbeiten.«
»Na, na, warum denn gleich so patzig?«, fragte er grinsend.
Das war mir zu viel. »Ich bin hier nicht zu Hause und will deshalb keinen Streit mit Ihnen anfangen«, erklärte ich ihm. »Aber ich habe nicht die geringste Lust, mich von Ihnen stören zu lassen. Verschwinden Sie jetzt endlich!«
»Sie sind wohl ein ganz harter Bursche, was?«
Ich überlegte, ob ich ihm einen Kinnhaken verpassen sollte. Aber dann ging ich doch lieber zur Tür, um nach Mrs. Huntington zu klingeln. Als ich mich umdrehte, stand er über die Handschrift gebeugt. Ich trat an den Schreibtisch und klappte das Manuskript energisch zu.
Er richtete sich auf. »Es fehlt doch nichts?«, erkundigte er sich spöttisch. Er griff nach seinem Eimer. »Auf Wiedersehen, Yankee. Ich nehme nur, was mir gehört, verstanden?«
Er begegnete Mrs. Huntington an der Tür und trat zur Seite, um sie vorbeizulassen. Sie achtete kaum auf ihn. Als er hinausging, warf er ihr über die Schulter hinweg einen hasserfüllten Blick zu.
»Nun, sind Sie zu einer Entscheidung gelangt, Mr. Burke?«, wollte Mrs. Huntington wissen.
»Ich bin leider gestört worden, Madam. Die Handschrift interessiert mich aber. Wenn ich sie noch etwas länger ansehen darf, kann ich Ihnen bestimmt ein Angebot machen.«
»Jetzt? Tut mir leid, das ist ausgeschlossen. Ich muss gleich fort.«
»Es muss nicht jetzt sein. Ich möchte ohnehin erst meinem Partner ein Telegramm schicken. Wäre Ihnen morgen recht?«
»Ich habe morgen zwei Ausschusssitzungen«, antwortete Mrs. Huntington. »Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so lange brauchen würden. Schließlich haben Sie den Schätzbericht gesehen. Ich empfinde Ihre Vorsicht als reichlich übertrieben.«
»Ich muss mir mein Angebot reiflich überlegen, Mrs. Huntington«, erklärte ich ihr gelassen. »Aber ich kann Ihnen schon jetzt sagen, dass ich Ihnen eine vierstellige Summe bieten werde.«
Das verfehlte seine Wirkung nicht. Mrs Huntington blinzelte kurz, sagte jedoch nur: »Sonntags mache ich keine Geschäfte. Wenn Sie am Montag gegen elf Uhr wiederkommen, können Sie sich das Manuskript in aller Ruhe ansehen.«
Ich konnte den Mund nicht halten. »Wollen Sie sich nicht davon überzeugen, dass das Manuskript in Ordnung ist, bevor ich gehe?«
»Selbstverständlich«, stimmte sie eisig zu. Sie blätterte es durch und legte die Leinenmappe in die Schatulle zurück. »Danke. Es scheint in Ordnung zu sein.«
Sie begleitete mich mit der kühlen Höflichkeit hinaus, die sie vermutlich einem Arzt, dem sie nicht recht traute, erwiesen hätte.
Ich brauchte nicht lange, um mir hinsichtlich des Manuskripts Klarheit zu verschaffen. Und es bestand kein Zweifel: Mrs. Huntington war mir unsympathisch. Ich wollte ihr einen fairen Preis bieten, aber mir ging es natürlich auch darum, nicht mehr als unbedingt nötig auszugeben, und da sie so bissig gewesen war, sollte sie keinen Penny zu viel erhalten. Die Handschrift war vor über dreißig Jahren auf £ 500 geschätzt worden; heutzutage brachten solche Manuskripte erheblich mehr. Ich würde also mit £ 1.500 anfangen, etwas mit Mrs. Huntington handeln und ihr schließlich £ 2.000 geben. Das war eine Menge Geld, und ich musste erst Bobs Einverständnis einholen, bevor ich eine derartige Summe ausgab.
Im Goat & Compasses, wo ich mir ein Zimmer genommen hatte, fragte ich Mr. Davies, den Wirt, nach einer Möglichkeit, ein Telegramm direkt aufzugeben, ohne bei der telefonischen Durchsage Übermittlungsfehler riskieren zu müssen. Das war erst in Ross-on-Wye möglich. Die kleine Stadt lag im nächsten County, aber ich hatte nichts gegen eine längere Fahrt: Ich konnte unterwegs üben, auf der ungewohnten linken Fahrbahnseite zu bleiben, und hatte außerdem Gelegenheit, mir den Nordwesten von Gloucestershire anzusehen.
Auf der Rückfahrt hielt ich in Goodrich, einem Dorf an der Straße, um die Ruine einer mittelalterlichen Burg zu besichtigen. Beim Anblick der eindrucksvollen Überreste wurde mir plötzlich klar, warum Mrs. Huntingtons Gärtner mir so unsympathisch gewesen war. Das lag nicht an seinem Auftreten oder der Tatsache, dass er mir einen äußerst merkwürdigen Vorschlag gemacht hatte, sondern vor allem daran, dass er nicht zu der Vorstellung passte, die ich mir von England gemacht hatte. Er und seinesgleichen hatten nichts mit der glorreichen Vergangenheit zu tun, deren Zeugnisse Bauwerke wie dieses waren.
Eine romantische Einstellung, nicht wahr? Aber ich täuschte mich. Allerdings sollte ich das erst später bemerken.
Zweites Kapitel
Das Wetter schlug um. Plötzlich war es unzweifelhaft Herbst: ein grauer, wolkenverhangener Himmel, kalter Regen und feuchte Luft. Ich war einigermaßen verblüfft, als Mrs. Davies mir das Frühstück servierte und dabei sagte: »Schönes Wetter, nicht wahr?«
»Finden Sie?«, fragte ich.
»Nun, es gießt doch wenigstens nicht«, erklärte mir Mrs. Davies lächelnd. »Das wäre schlimmer.«
»Ja, natürlich«, stimmte ich zu.
Mrs. Davies war rundlich, grauhaarig und freundlich. Im Gegensatz zu ihr war Mr. Davies groß und hager. Er bewegte sich langsam und sprach so ernst und nachdrücklich, dass aus jeder Bemerkung eine Parlamentsrede wurde.
Er räumte hinter der Bar auf, als ich mir eine Packung Zigaretten holte und zu ihm sagte: »Hier im Dorf ist sonntags wohl nicht viel los?«
»Nein, das stimmt«, gab er zu und polierte nachdenklich ein Glas. »Aber manchen Leuten ist das gerade recht. Ah, Sir, wenn man den Trubel der Großstadt kennt, ist man froh, aufs Land fliehen zu können. Finden Sie nicht auch, Mr. Burke?«
Ich nickte. »Ich lebe in Amerika allerdings auch auf dem Land«, erklärte ich ihm.
»Tatsächlich? Nun, ich kann mir vorstellen, wie klein und beengt Ihnen unsere Verhältnisse vorkommen müssen, wenn Sie die unermesslich weiten Prärien Amerikas gewöhnt sind.«
»Amerika besteht nicht nur aus Prärien«, wandte ich ein. »Connecticut hat viel Ähnlichkeit mit England.«
»Oh?«, sagte er höflich, ohne mir ein Wort zu glauben.
»Sie Engländer bilden sich Ihre Vorstellungen wie wir aus Filmen«, stellte ich fest. »Vielleicht irren wir uns beide.«
Mr. Davies richtete sich auf. »Ich bin kein Engländer, sondern Waliser, Mr. Burke. Aber Ihre Bemerkung war gerechtfertigt. Ich stimme Ihnen dahingehend zu.«
Sein Sohn Ted, ein Junge von elf oder zwölf Jahren, kam herein und verkündete, er müsse zu einem Treffen seiner Pfadfindergruppe. Er lächelte mir zu. »Guten Morgen, Mr. Burke.«
»Hallo, Ted«, sagte ich. »Wie geht’s dir heute?«
»Ganz okay«, antwortete er grinsend. Er zog seine Gummistiefel an. »Ich möchte einmal nach Disneyland. Waren Sie schon oft dort?





























