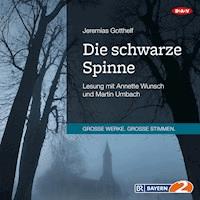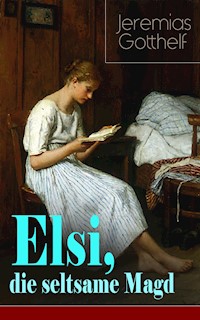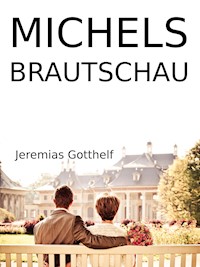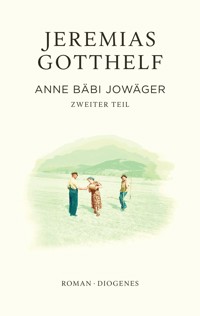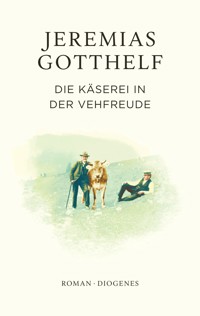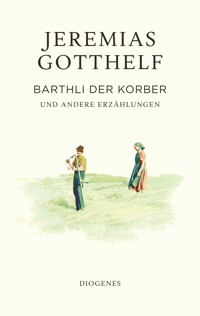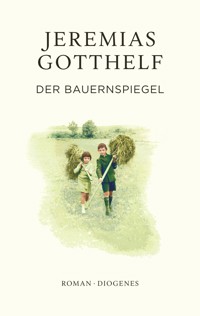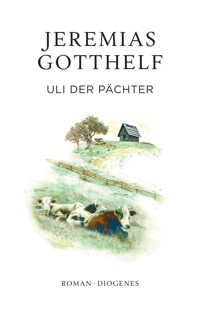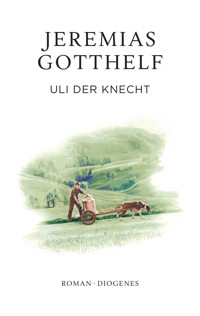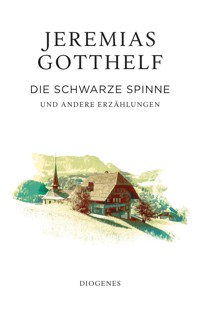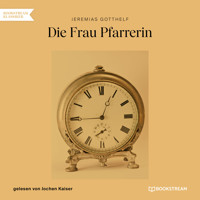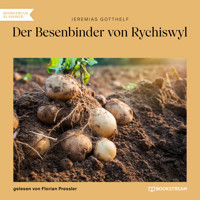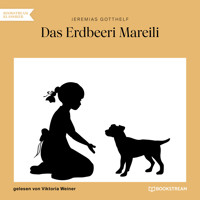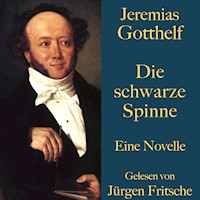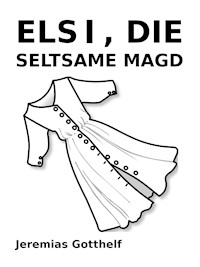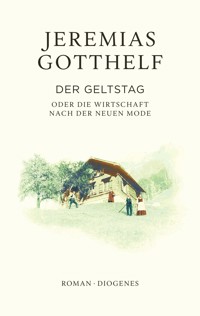
32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gotthelf Zürcher Ausgabe
- Sprache: Deutsch
Dem Wirtshaus ›Zur Gnepfi‹ droht der Geltstag – der Konkurs. Das Wirtspaar hat das Geld mit vollen Händen ausgegeben und sich zudem verschuldet, um es im Dorf zu Ansehen und vorgegebenem Wohlstand zu bringen. Doch nach dem Tod des Wirts müssen Witwe und Kinder erfahren, was es heißt, nicht nur die Existenzgrundlage, sondern auch die Würde zu verlieren. Jeremias Gotthelf hat mit ›Der Geltstag‹ ein Zeitbild geschaffen, in dem sich unsere Gegenwart durchaus wiederzuerkennen vermag – wenn sie genau hinsieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jeremias Gotthelf
Der Geltstag
oder die Wirtschaft nach der neuen Mode
roman zürcher ausgabe
Herausgegeben von Philipp TheisohnMit einem Nachwort von Alex Capus
Diogenes
Kapitel 1
Die Gräbt
Kläglich wimmerte das Glöcklein aus dem niedern Türmchen der Kirche zu Uefligen. Auf dem Kirchhofe stand ein Mann und legte Stricke über ein offenes Grab; um den Kirchhof herum schwärmte die der Schule entlassene Jugend, die nicht gerne heimgeht, wenn was zu sehen ist im Dorfe, sei es eine Hochzeit, sei es ein Leichenzug. Der Neugierde ist alles eins.
»Du, wen begraben sie heute?«, fragte eine vorübergehende Frau eine andere, welche mit den Händen unter dem Fürtuche schlotterend dastand. Es schien eine kränkliche Frau, um guten Lohn wäre sie nicht im kalten Winde gestanden. Sie möchte es nicht erleiden, hätte sie gesagt, sie sei gar gliedersüchtig und es fehle ihr sonst noch viel. Aber wenn der G’wunder ins Spiel kam, da achtete sie alles nicht, und keine mochte mehr Kälte und Wind, Hitze und Staub erleiden wie sie. »E«, antwortete die Angeredete, »weißt du das nicht, und reden doch alle Leute davon? Habe gemeint, es sei niemere auf der Welt, der das nicht schon wisse.« – »Kein Sterbeswörtli habe ich gehört«, entgegnete die Erste. »Weißt de nit, d’r Wirt uf d’r Gnepfi ist g’storbe, u mi bigrabt neh hüt.« – »Nit müglich«, sagte die Erste, »den sah ich ja erst letzten Samstag vor acht Tagen zu Solothurn, und da ist er noch ganz lustig und hellauf gewesen, hat beim Storchen Wein gezahlt ein paar Mädchen, es weiß kein Mensch, wie manche Halbe.« – »So het ers chönne«, antwortete die Zweite; »er het nit dra g’sinnet, wie kurz es währt, wenn man’s z’stark treibt. Letzten Dienstag am Morgen fand man ihn tot im Bette. Am Abend vorher ist er noch wohlauf gewesen, hat mit ein paar Kameraden g’ramset bis nach Mitternacht, man hat ihm von Krankheit gar nichts angemerkt; nur hat er sie nie fortlassen wollen, sie waren manchmal z’weg zum Gehen. Nur noch eine, hat er gesagt, nur noch eine, ins Bett mög er nicht, man könne ja morgen liggen, so lang man wolle, es sei ihm afe nichts so z’wider als id’s Bett z’gah. Sie haben sich dessen nicht sövli g’achtet, er hat’s immer so gehabt, je länger es des Abends bei ihm gegangen, desto lieber war es ihm. Am andern Tage aber, als sie hörten, er sei tot gefunden worden, dachten die Kameraden, ob es ihm wohl vorgewesen, wegem lang ligge? Von wegen jetzt könne er ligge, länger als ihm wohl lieb sei, und wenn er endlich aufstehen müsse, so könne ihm das Aufstehen noch schwerer werden als das Ligge. Allweg hets ihnen ag’fange gruse vor dem Höckle bis nach Mitternacht, sie wollen lieber früh nieder und früh wieder auf, als ung’sinnet so lang müsse ligge wie d’r Wirt uf d’r Gnepfi.
Aber lueg, dort kommen sie, Potz, was für e große Lycht! Aber so ist’s, wo es eine gute Gräbt gibt, gibt’s viel Leute, wo es keine gibt, gibt es auch keine Leute, auf den Menschen kommt es dabei nicht an, und sei er in Gottes Namen gestorben oder in einem andern.«
Voran kam auf einem Wägelchen der schwarze Sarg. Arme Leute verköstigen sich nicht mit der Farbe, lassen weiß den Sarg, sie werden denken, wenn Trauer sei in den Herzen der Begleitenden und weiß das Herz des Gestorbenen, so sei es alles, was vor Gott nötig sei; die Welt habe sich nie viel um den armen Gestorbenen bekümmert, warum sollte man sich nun um die Welt kümmern bei seiner Begräbnis. Hinter dem Wägelein her kamen Knaben des Gestorbenen, pfausbäckige Jungens mit falben Haaren. Sie trampelten ziemlich gedankenlos einher, man konnte ihnen nicht ansehen, waren sie Weinens satt oder hatten sie es noch nicht zum Weinen bringen können. Bloß der Jüngste, ein sechsjähriger Bube, weinte stark und schluchzte laut; er war des Vaters Liebling gewesen; was er wollte, hatte er vom Vater gehabt; sooft der Vater trank, kriegte der Junge auch, und wenn er sagte: »Vater, der ist mir z’sure«, so holte der Vater bessern, und wenn der Vater aß, so kriegte der Junge ebenfalls, und wenn der Vater Rindfleisch aß und der Junge sagte: »Vater, mag nit Rindfleisch, möchte lieber Hamme oder es Prägelwürstli«, so holte ihm der Vater das eine oder das andere. Seit drei Tagen, seitdem der Vater tot war, bekümmerte sich niemand viel um ihn. Niemand holte ihm bessern Wein, niemand ein Prägelwürstli; da fühlte er, wie übel es ihm mit des Vaters Tode gegangen, darum weinte er so sehr. Großes Bedauern hatte mit dem Jungen die Welt. Das ist e b’sungerbar e Witzige für so ne Junge, sagten die Leute, der merkt, wie übel es ihm gegangen, dass der Vater gestorben. Es sei sich auch nicht zu verwundern, er sei dem Vater b’sunderbar wert gewesen, und dann wisse man nicht, ob die Leute das Wirtshaus behalten könnten, sövli King u sövli jung und sövli e lüftige Mutter; es wüsse kei Mönsch, was die anstelle. U das merk dä Jung scho u heygs i d’r Nase.
Hinten her kamen viele Männer in schwarzen Mänteln und Wollhüten auf den Köpfen; schwarze Strohhüte haben nicht Gültigkeit, weder bei Leichen noch beim Abendmahl. Bei Leichen tragen sie nur die, welche es nicht besser vermögen, und beim Abendmahl nur Güterbuben, deren Bauern zu geizig zu einem Wollhut waren. »E Strauhut tuts sauft, er ist z’halb wöhlfeler und notti schwarz, u schwarz wird doch d’Hauptsach sy«, sagt so ein geizig Mannli, das nicht weiß, was d’Hauptsach bei Gott ist, bei dem aber d’Wöhlfeli d’Hauptsach ist.
Unter den Wollhüten sah man ernsthafte Gesichter, aber gerührte hätte man vergeblich gesucht. Die Gedanken hinter den Gesichtern sah man nicht; es kam manchem wohl. Es hätte es sicher mancher ungern gehabt, wenn man hinter seinen Augen hätte lesen können: Hätte ich nur das Geld für das letzte Kalb, so früg ich allem nicht viel nach, d’Sach könnte sein, wie sie wollte; oder: Hätte ich nur die letzte Nacht nicht mit ihm gespielt und getrunken, aber es will mir nicht aus dem Sinn; ins Haus gehe ich nicht mehr, wenn ich nicht muss; und tags mach ich mich heim; wenn’s nachtet, so fängt’s mich an zu schaudern, weiß gar nicht, wie es kömmt.
Hinter den Männern kamen die Weiber, ihrer wenige, aber schaurig schwarz und schwatzten nicht. Einige wischten die Augen, sie wussten kaum warum, wahrscheinlich bloß so des allgemeinen Gebrauchs wegen. Andere machten sonderbare Augen, man wusste nicht, waren sie zornig oder wollten sie lachen. Wollten sie vielleicht sagen: »Hast du jetzt einmal Feierabend, gäll, dä ist d’r cho ung’sinnet und dest’ g’schwinger, je länger du unsere Mannleni im Wirtshause versäumt hast. Gäll, jetzt hörst sagen, ume no eini, ume no eini!«
Zuletzt schritt eine stattliche Frau daher, gut angetan, weinende Mädchen um sie; das kleinste führte sie an der einen Hand, während sie mit der andern das Nastuch vor den Augen hatte. Sie war ergriffen, man sah es wohl, aber was sie ergriffen hatte, das wusste man nicht. Es kann ein Weib gar manches ergreifen, wenn es dem Sarge des Mannes das Geleite zum Grabe gibt; es kann die Liebe sein Herz zerreißen oder die Reue; es kann der Kummer für die Zukunft oder der Gram über die Vergangenheit dessen Seele erschüttern. Am lautesten jammerte das kleinste Mädchen, ein fünfjähriges Kind, kein Zusprechen stillte seinen Jammer. Warum dieses Kind so jammerte, dass es den Nächsten die Seele zerriss und Schauer um Schauer durch die Gebeine jagte, wusste man.
Als es den toten Ätti sah, hatte es die Mutter gefragt: »O Müette, het d’r Ätti ächt no bätet, eh er g’storbe ist, het er ächt o?« – »Wie wett er, er ist ja im Schlaf g’storbe«, hatte die Mutter geantwortet. Da war das Kind in einen unbeschreiblichen Jammer versunken und hatte immer gerufen: »Su chunt üse Ätti nit i Himmel, oh, üse Ätti chunt nit i Himmel!« Vergebens wollte die Mutter trösten und sagen: Er hatte ja nicht beten können, weil er im Schlaf gestorben. Das Kind wollte das nicht fassen: »Du hast’s gesagt, und der Schulmeister hat’s gesagt, wer nicht bete, komme nicht in Himmel, und üse Ätti het nüt betet, und jetzt chunt er nit dry!« Da wollte kein Trost anschlagen, es blieb bei dem, was man ihm zuerst gesagt, wie Kinder es oft haben, dass man umsonst ihnen zuredet, zu vergessen, was man ihnen zuerst gesagt hat. Wohl hatte es in der Zwischenzeit sich zuweilen beschwichtigen lassen und geschwiegen, hatte gefragt, wenn es recht bete, ob’s ächt o füre Ätti gält, und auf die bejahende Antwort Ernst mit Bete gehabt, dass ihm in der vergangenen Nacht endlich die Mutter unwillig befahl, es solle doch aufhören stürme und o einist schlafe. Es war nicht böse gemeint, aber eine müde geängstigte Frau, die gerne schlafen möchte, wiegt die Worte nicht ab. Aber schon als man vom Hause wegging, besonders als man das wimmernde Glöcklein hörte, das so schaurig der Leiche zu rufen schien, war der Jammer noch heftiger losgebrochen, und als man zum Grabe kam, die Erdschollen so hart polterten auf dem Sarge, da brach es in lautes Schreien aus, dass alle großes Erbarmen bekamen, und viele weinten um des Kindes willen. »Du arm’s Tröpfli«, sagte eine alte Frau, »brieg du nur, so lang de witt u so lut de witt, das schadt dir hie nit u dert nit. Solang du ume über angeri brieggist, macht alles nüt, üse Heiland het ja o briegget, mach ume, dass de nie über di selber briegge musst, selb chönt de fehle.«
In die Kirche zum Gebete zog die Menge. Wie sie drinnen war, verhallte das Glöcklein; stille ward’s, man hörte nur noch des Mädchens Schluchzen, das wurde aber auch dumpfer, seltener, und bald hörte man nichts mehr als vom Taufsteine her das ernste tiefe Gebet, das den Menschen mahnet an seine Sterblichkeit und was ihm nottue, damit, wenn der Herr komme wie ein Dieb in der Nacht, im Schlafe eine Seele fordere, dieselbe nicht unvorbereitet dahinfahre, kein Kind weinen müsse über den Ätti oder übers Muetti in Kummer und Angst, dass ihre armen Seelen verloren gehen möchten, weil sie nicht bloß aus leiblichem, sondern auch aus geistigem Schlafe vor Gericht gerufen werden. In tiefen Schlaf hatte der Herr das arme Mädchen gewiegt, als das Gebet zu Ende war; milde und lieblich lächelte es auf den Armen einer muntern Base, die es nach Hause trug. Die Menge wandte sich dem Wirtshause auf der Gnepfi zu, nachdem die Männer die schwarzen Mäntel abgenommen, sorgfältig in mitgenommene Säcklein sie gepackt, die Weiber die Züpfen, die nicht halten wollten, sich wieder um den Kopf festgebunden hatten. Die Gräbt war im Wirtshause auf der Gnepfi, und zwar nicht bloß eine Käsgräbt, d.h. eine, wo bloß Wein, Brot und Käse aufgestellt wird, sondern eine Fleischgräbt, und zwar von den bessern, denn da war Voressen, Rind- und Schweinefleisch, Sauerkraut und dürre Bohnen, dann Braten, Hamme, Salat und Tateren. Es waren Leute da von weither, und die Wirtin zählte sich zu den Vornehmen im Lande, sie hätte es nicht anders getan, und was es kostete, frug sie nicht, ans Rechnen war sie nicht gewöhnt, und wenn man die Sache selber habe, so brauche man ihr gar nichts nachzurechnen, war ihre Meinung bei allem, was in ihrem Hause gebraucht wurde. Sie war streng vorausgeeilt, um die letzte Hand an alles zu legen und dafür zu sorgen, dass die Leute nicht warten müssten; sie ward nicht gerne verbrüllet, sondern lieber gerühmt. Ob sie aber recht wusste, was Ruhm bringt und z’Verbrüllen macht, das ist eine andere Frage, darin irrt sich gar manche Frau.
Langsam waren ihr die Leute nachgekommen, und viel zu mustern gab es noch, ehe sie alle saßen um die langen im Tanzsaale aufgestellten Tische. Zu was allem doch so ein Saal dienen muss und was er alles sehen muss! Wenn er reden könnte, man würde sich verwundern; verwundern z.B., wenn er erzählen würde, wie er oft an Tanzeten traurigere Herzen gesehen hätte als an Gräbten. Die Wirtin hantierte unten in der Küche, hatte aber Aufträge gegeben diesem, jenem: »Lue m’r doch de öppe, dass es nieders zu syr Sach chunt, u schaych y!« Wenn aufgetragen war, so trat sie einen Augenblick unter die Türe und übersah die Tische, ob allenthalben was sei, die Speisen recht verstellt und die mäßigen Flaschen nicht leer. Wer sie zuerst sah, füllte sein Glas, drehte sich auf seinem Stuhl und sagte: »Es gilt d’r, Wirti, chum u tue B’scheid!« – »Es angers Mal«, sagte dann die Wirtin, »bis ume rühyig.« – »Chunst nit o zu nihs?« – »Ih chume de, aber z’erst muss ih no ache, si hei m’r g’rüft.«
»Wie geht’s ihr wohl?«, fuhr der fort, welcher es ihr gebracht hatte, »kann sie wohl bleiben, oder kehrt es sie?« – »Sie meint nichts anders als furtfahre«, antwortete ein anderer; »sie hat davon gesagt, wie es jetzt gehen müsse, und häb im Sinn, viel lah z’weg z’mache.« – »Dere könnte es noch anders kommen«, antwortete der Erste, »entweder tut sie nur dergleichen, oder si chennt de nüt vo d’r Sache. Da werde no Sache fürecho, a die no niemere sinnet.« – »Meinst?«, antwortete der andere. »Ih ha o afe neue e Ton g’hört, aber ih ha du denkt, es wird afe gar viel g’schwätzt.« Dieses Gespräch verbreitete sich, langsam schleichend wie Feuer im Moose, doch nicht bis zuoberst an den Tisch, wo die Verwandten saßen, auch nicht an der Weiber Tische, die abgesondert saßen, denn nicht ungerne tun die zuweilen, als ob ihnen die Nähe des Mannevolks in der Seele zuwider sei. Das schickt sich auch nie besser als an einer Gräbt, wo es sich ohnehin nicht schickt, Carlishof zu haben und Gugelfug untereinander. Die sprachen davon, wie doch das Mädchen getan hätte, wie es ihnen dabei afe fast g’schmuecht worden sei. Es syg ume es King, aber denen werde manchmal was eingegeben, was große Leute nicht wüssten, und schon manches Kind hätte etwas gesehen, Erwachsene hätten nichts bemerken können, gäb wie si g’luegt heyge. Sei das, wie es wolle, so sei es allweg grüßlig, so plötzlich z’sterbe und no unbetet. Man sage nicht umsonst: e Schlagfluss, Gott b’hütis d’rvor. Es sei zehnmal besser, e Plätz krank z’sy; wenn man schon dabei leiden müsse, so könne man sich doch rangiere wegem Zytliche und wegem Ewige. Was ihnen aber am meisten gruse, sei, dass man schon oft gehört habe, wie so einer, der sich nicht habe rangieren können, sondern etwas auf dem Herzen behalten, nicht ruhen könne, sondern wiederkommen müsse, bis es ihm jemand habe abnehmen können. Das duech se z’Schröcklichste vo allem; sie wollten lieber gradewegs i d’Höll; wenn me einist dert wär, su wär me doch de dert und viellicht könnt me si z’letzt o no dra g’wahne, mi g’wahn si ja a alles uf der Welt. »Herr Jeses, Züsi, schwyg u v’rsüng di nit, denk, wie’s dem alte Schlyfer gange ist, wo o sym Mul ke Rechnig g’macht het. Weißt no?« Einmal auf diesem geschichtlichen Boden, ist den Weibern zu wohl, als dass sie ihn bald verlassen sollten; so streng ihnen die Gänsehaut den Rücken auffuhr, so streng jagte ein Geschichtchen das andere, doch auch hier alles halblaut.
Lauter, jedoch gemessen, ging es bei den Verwandten zu, Brüdern des Gestorbenen, Brüdern der Wirtin und andern, die in näherm und weiterm Grade ihnen angehörten. Sie berührten weder den Verstorbenen noch die mutmaßlichen Umstände desselben; sie redeten von ganz fremden Dingen. Zuerst redeten sie vom Korn, wie viel jeder use mach im Tenn von hundert Garben, von welcher Sorte sie hätten, rotes, blaues, weißes; verabredeten Tausch und sprachen vom Aufschlag und Abschlag, wie viel jeder zum Verkauf übrighätte, und ob der Verkauf besser sei daheim oder auf dem Markt. Allweg löse man einige Batzen mehr auf dem Markt, meinte ein Schalk, aber wie viel man dann davon heimbringe, sei Gott bekannt, manchmal alles, manchmal wenig, manchmal gar nichts. Manchmal wüsste man, wo man die Sache hintäte, und manchmal nicht, manchmal sehe man ohne Spiegel das Gras wachsen, und manchmal könnte man sieben Spiegel aufeinandertun und vermöchte keine sechszentnerige Sau zu sehen, v’rschweige dann, wie bös ein Sack sei und wie groß die Spälte im Kistlein – so komme immer alles auf die Umstände an. Und wie so ein Gespräch gleitet wie Schlittschuhläufer auf dem Eisspiegel von einem Ende zum andern, so kam man von Löchern und Schweinen auf die Luzerner und die Aargauer, auf die Politik, man wusste nicht, wie. Es waren sich da nicht bloß zwei Verwandtschaften gegenüber, sondern auch zweier Gattig Leute. Die eine Verwandtschaft bestund hauptsächlich aus ältern und gesessenen Leuten, d.h. aus solchen, die etwas Solides besaßen und in einem Eigentum saßen, aus Sassen also; die andern mehr aus Leuten, die flüchtiger waren, auf Pöstlein saßen, die alle sechs Jahre zu vergeben waren, oder auf solche Pöstlein harrten wie auf die Maus die Katze, oder denen die alte Welt von Gott gemacht bereits verleidet war und sie neu machen wollten nach ihrem Sinn, akkurat wie sie aus ihrem blonden Schnauz einen schwarzen gemacht hatten. Es waren gegenüber den Sassen die Alemannen, oder die Allmend-Leute gegenüber den Hofbesitzern, um in Beispielen zu reden.
»Aberebo und wie steht’s«, fragte einer der Ersteren, welchen das Korn wenig interessierte, weil er keines pflanzte, »mit den Jesuiten, wollen wir bald dran hin und sie austreiben?« Da entstand eine lange Stille in Israel. Als niemand was sagte, fuhr er fort: »An die hin hulf ich, und wer ein freisinniger Mann sein will, muss mit.« – »He ryt emel afe, wennd’ de nit g’fahre mast, su mach Bescheid.«
Während der Erste eine bittere Antwort verbiss, antwortete ein anderer: »Ja, so hat man es bei uns, da will es einer an den andern lassen, und wenn am Ende Freiheit und Religion und sust alles verloren geht, su wett de niemere z’Schuld sy.« – »Ho«, sagte ein anderer, »was sell ist, so ha nih ke große Chummer; was d’Religion isch, su ha nih die selber, u emel einist nimmt m’r die niemer, u we m’r d’Pintewirte myni Bube nit v’rführe u d’Neutäufer myni Meitli nit und die Separierte myni Alti nit, su ha nih wege d’r Religion ke Chummer, u zur Freiheit soll d’Regierig luege, die ist zahlt d’rfür, u luegt die nit, he nu so de, su sy m’r de geng no da.« – »Ja, ja, wenn’s de z’spät ist, zu selligem cha me nit früh gnue tue.« – »Aber lösche, gäbs brönnt, cha me doch o nit, selb schickt sich neue nit«, ward geantwortet. – »Das wär g’spässig, wenn’s nit brönnti, fraget die Freisinnige im Kanton Luzern? Wenn’s e Brunst ist, su faht me a lösche, wenn’s afaht brönne, u nit erst, wenn z’eige Dach acheghyt«, antwortete der, welcher reiten wollte. – »Selb ist wahr«, antwortete einer, der noch nicht geredet. »Aber wenn d’r Nachbar chüchle will, su geyt me nit und wirft ihm Wasser i d’Pfanne, selb chunt de erst nit gut. U we d’Luzerner d’Jesuiter für Chüchli wey, su hulf ih se lah mache, wenn ih se numme nit fresse muss. Aber d’rvo het no niemere g’seyt. Ih ha no vo niemere g’hört, dem d’Chüchli nit erleidet wäre, wenn er geng ume Chüchli ha sött.« – »Ein jeder redet, wie er es versteht«, antwortete ein anderer. »Aber sagt mir doch, was und wer die Jesuiten sind?« – »He, selb wett ih vo Euch v’rnäh, Ihr werdet’s wohl besser wüsse als ih, es nähm mih selber wunder«, antwortete der Gefragte. – »Das ging z’lang, euch z’brichten«, antwortete der Erstere, »das könnt ihr in jeder Zeitung lesen. Wir würden heute nicht fertig, wenn ich anfangen wollte.« – »Ja, ja, ih v’rstah. Wenn er ag’fange hät, z’Höre war mängem ke Kunst. Wenn mih albez d’r Pfarrer öppis Wunderligs g’fragt het, su ha nih g’seit, ih wüsst’s, aber ih chöns nit säge.« – »Ja«, sagte einer, »aber lätz ist’s, ih hät es schöns Munikalb, u die hey m’r albez d’Luzerner abkauft, si sy chum trocke g’si, u jetz het si längs Stück kene by m’r zeigt. Es ist doch lätz, dass si jetz üser eim d’Sach etgelte muss, wenn anger z’Garn v’rhürschet hey.« – »He ja, wenn’s m’r ume um d’Kalber wär, es wär m’r o so, aber ih sinne o as Vaterland und a d’Religion«, entgegnete einer. – »Grad so geyts mir o«, antwortete ein anderer, »was ih nit ha, dara muss ih am hertiste sinne; wenn ih key Geld ha, su duecht mih, ih syg niene daheim, und wo ih Witlig g’si bi, hets mi duecht, ih möcht a me niedere Zunstecke ume Hals falle un neh frage, ob er well cho Büri sy uf d’Bot hinteri?« – »Du wirst du es bravs Muetti übercho ha, so dere eys, wenn e Hühnerträger siebni um 3 Krüzer übercho chönt, er lieber z’leerem z’Märit ging, als se i d’Kräze nähm?« – »Ih ha emel eys übercho, u d’z’best ist i der Zyt, dass ih wege syne emel d’Jesuite nüt z’förchte ha. Es chunt m’r scho längs Stück ke Länder u ke Schwebelhölzler meh unger d’Tür, u doch ha nih ke Hung meh, sit me e Neuthaler d’rvo zahle sött.« – Man sieht, es war Giecht in der Wechselrede, wenn man ihn auch immer mit einem Spaß dämpfte wie beim Brechen das Feuer mit dem nassen Besen. Solch Giecht ist zuweilen bei Gräbten zwischen den beiden Verwandtschaften von Frau und Mann, wenn die Aussicht gefährlich ist und jede Beschwerde fürchtet und jede von ihrer Seite weg die Schuld auf die andere schieben will; begreiflich erzeigt man es aber nicht, man fasst sich, und wer nicht ein feines Ohr für den Ton hat, würde an den Worten wenig merken.
Die Wirtin war hereingekommen, war den Tischen nachgegangen, hatte sich entschuldigt, dass alles nicht besser sei, aber mi söll v’rzieh, wenn me selligs erlebe müss, su heyg me i Gotts Name d’r Sinn nit, hatte eingeschenkt hier und dort und endlich sich bei den Verwandten niedergesetzt, wo man sie zum Essen nötigen wollte, aber zur Antwort erhielt, sie mög nit, si heyg e Tropf Suppe g’no u dä heyg si schier nit möge ache bringe u heygne no z’oberist obe. »Es ist sich nicht zu verwundern, Base«, sagte ein alter Vetter, der des Gestorbenen Götti gewesen, »wenn man so was erleben muss, so ung’sinnet u sövli jung noh; es duecht mih, es syg erst gestern g’si, dass m’r neh tauft heyge u d’Kingbetti du g’ha i d’r Kädere. Aber hest ihm de nüt ag’merkt, dass ihm öppe fehl?« – Diese Frage gab der Wirtin Gelegenheit, des Weiten zu erzählen, wie ihr Mann wohl hie und da g’ruchset, aber z’G’rechtem g’fehlt hätte es ihm nie, und bruche hätte er erst nichts wollen. Scho es Wyli heyg ihm d’r Ate kurzet u du syg er i Gurnigel g’si, aber bessert hätte es ihm nicht. Wie es sie hätte möge dueche, bruch me dert schier meh Wy weder Wasser, emel e Teil, si well nicht säge all. Aber böset hätte er auch nicht, und a öppis bös g’sinnet hätt si de gar nicht. »Da cheut d’r denke, wie es mir am Morge g’si ist.« Dann erzählte sie plastisch, d.h., ohne ein Düpflein auszulassen, was sie am Morgen gesehen, wie es ihr gewesen, was sie gemacht, was sie gesagt und was andere gesagt. Während ihrer Rede verrann die Zeit; die Leute begannen aufzustehn und sich zu empfehlen, denn bei einer Gräbt ist lang Dorfen nicht Sitte, es sei denn, es sei eine Base oder ein Vetter begraben worden, kinderlos, aber mit vielem Geld behaftet. Die Gäste dankten für die gute Aufwart, wie sie de öppe nit dra denkt hätte u deretwege sie de nadisch nit cho syge. Die Witwe dagegen dankte, dass sie hätten kommen wollen und ihrem Mann d’Liebi erzeige, si heyge müsse vorliebnäh, wenn’s eim selber breycht heyg, su chön me de öppe nit ufwarte, wie me dra denk u wie wenn’s neuer Frömd’s wär. Aber es angersmal well si’s nachebessere, wenn me ere well d’Ehr atue u zure cho u se nit ganz vergesse u v’rlah. Si well öppe ihres Mügliche tue, dass d’Lüt si nit z’erchlage heyge, dass si ihre Sach eh besser weder böser heyge. So höflich und manierlich begegnete sie den Gästen, die alle fast zusammen aufbrachen, wie hart es auch manche hielt, aber man hielt sich doch nicht dafür, dass man länger nicht genug hätte als die andern. Den nächsten Verwandten hatte sie aber Winke gegeben, dass sie bleiben möchten, weil sie noch neuis mit ihnen zu reden hätte und das am besten sei, wenn sie alle beieinander seien, es könne da ein jeder sagen, was er denk und wie er die Sache ansehe, hinger dry helfs einem dann nicht viel, wenn man einem sage: »Hättist mich gefragt, ich hätte dir schon raten wollen, u de g’wüss, dass es gut cho wär.« Als die Stube sauber war, begann die Wirtin: »Sie haben mir die Sache versiegelt, die Manne hier (sie war nicht da daheim), es het mich duecht, es sött öppe nit nötig g’si sy, aber es wird neh o öppe um ihres Löhnli g’si sy. D’Sach sött me neh v’rgebe gäh, aber v’rgebe tät eim hie niemere e Tritt v’rsetze, i selligem sys wüst Lüt, d’rnebe wäre si gut, si meine de öppe nit, dass alles für d’Kings King müss g’spart sy. Die hey mir du no welle Angst mache u hey g’seyt, mit dem werds de no nit gnue sy, es werd no müsse es Benefizi gäh. Selb wird doch öppe nit sy.« – Die Manne sahen einander an, keiner sprach, endlich sagte ihr Bruder: »Das kann dir hier niemand sagen. Brauch ist’s, d’rnebe kömt’s auf die Gemeinde an und wie öppe die Sache stange.« – »Selb wirst du am besten wissen. Öppe reich worden sind wir hier nicht«, antwortete die Wirtin. »Wir haben böse Zeiten gehabt, große Verluste gemacht, viel machen lassen, und was wir geerbt, das wüsst d’r öppe ume z’gut, es bravs Trinkgeld, nit viel meh; aber notti ist no öppis da, u vo wege zur Sach g’luegt hey m’r, u brucht öppe nit viel meh, as si wohl g’schickt het u nötig g’si isch.«
»Natürlich habt ihr ein Hausbuch, u drinn wird’s g’schriebe sy, wie’s öppe gange isch u was d’r z’heusche heyt u was d’r schuldi syt.« – »Ja, so nes Buch hey m’r, und drinn ist viel g’schriebe, bald het er dry g’schriebe, bald ha nih neuis dry g’macht, wenn ih glaubt ha, ih chönts v’rgesse. Aber das hey si m’r o yb’schlosse, gäb wie nih gewehrt ha, es syg m’r gar uchumlig, wenn ih öppe öppis ufmache well, wo nih glaub, ih chönts v’rgesse.« – Die Männer sahen einander an; endlich sagte ihr Bruder: »Z’Best ist, du gehest vor die Gemeinde, der Schwager kömmt schon mit dir und trägt ihr die Sache vor, emel einist cha nih a d’r Sach nüt mache.« – »He das wär g’spässig«, sagte die Wirtin, »du wirst doch öppe welle e Bruder a mer sy u wirst öppe nit bigehre, dass ih jetz no i unnötig Köste chume. Wenn man mir öppe beistehn wollte wie üblich und recht, so weiß ich, die Sache ginge und vielleicht besser als vorher, aber wenn niemand will, he nun sodann in Gottes Name, so weiß ich, wer es zu verantworten hat, und was es einem nützt, Brüder und Schwäger zu haben.« – »He Schwester«, sagte der Bruder, »nur nicht so hitzig, du hast noch immer einen Bruder an mir gehabt, aber alles auf der Welt hat seinen Gang, und dem muss man den Lauf lassen. Es wär öppe noch nie erhört worden, dass man bei einem Wirt, wo so viel mit Wygumene, Käshändler, Herdöpfler u dere Züg, u sust allerlei Lumpepack in Verkehr gestanden, kein Benefizi ergehen ließe, du kämist in größten Schaden, glaubs, und wurdist dene Zägge nie los. Wenn das gange ist, kann man dir helfen, dann wohl.« – »Hans Uli hat recht«, sagte der Schwager, »grad so ist’s.« Das bestätigte der Götti auch und alle Manne, Schwäger und Brüder und andere Verwandte, die noch da waren. Die Wirtin verstund das aber nicht, sie wurde böse; sie sagte, sie sehe wohl, wie es ihr gehen werde, z’helfe begehre ihr niemand, aber alles werd welle ufere sy u a re sugge. Es sei immer so gewesen und werde immer so sein, wer Witwen und Waisen am besten b’schyße chön, dä mein, er syg d’r Größt. Sie hätte erst noch eine Geschichte aus dem Oberland obe gehört, wie vornehm Manne eine Witwe hätten machen z’Geltstage und ihr Vermögen hintere packt und eingesacket, und jetz werde man es ihr gerade so machen wollen. Selligs Geld heyg me hützutag nötig, wenn me d’Bube well zu Herre mache, als ob me dere Mulaffen nit meh als gnue hätt.
»Los, Schwester, darüber wollen wir jetzt nicht zanken«, sagte der Bruder, »wenn du es anders machen kannst, he nun, so ist’s mir ja recht, ich will dir da gar nicht im Wege sein.« – »Ja«, sagte die Wirtin, »aber dann möchte ich noch einen rechten Mann für mir anfangs beizustehen, nachher wird’s schon gehen.« – »Nun, deretwegen musst auch vor die Gemeinde, sie muss ihn dir verordnen. Weißt einen?«, sagte der Bruder. – »Allweg«, sagte sie, »eine aus der Nähe, wo ich nicht so weit zu laufen brauche, wenn ich Rat mangle, und der sonst ungeheißen kömmt. Ich habe schon mit ihm g’redt, er wett.« – »He nun so dann, so wär d’Sach i d’r Ornig, u jetz muss ih furt, ih will gah lah aspanne«, antwortete derselbe. Ihm nach ging der Schwager; unten in einer Ecke stellten sie sich wie zufällig, und der Bruder sagte zum Schwager: »Du siehst doch ein wenig zur Sach, bist näher als ich, und d’Sach geht dich noch mehr an. Aber es Benefizi muss es allweg geben.« – »Versteht sich«, antwortete der andere, »wenn’s de ume d’rby blybt und es si bi dem still het.« – »Meinst? ’s wird öppe nit sy«, fuhr der Bruder z’weg. – »Man kann nicht wissen«, antwortete der Schwager, »es kann noch manches zum Vorschein kommen, an welches man jetzt nicht sinnete. D’rnebe weiß ich es nicht, der Bruder ist in der letzten Zeit so wunderlich gewesen, öppe rede het me nit mit ihm chönne.« – »Ich kann’s nicht wohl glauben«, antwortete der Bruder, »wie wollte das gegangen sein, bei dem Vermögen, wo sie zusammengebracht, und auf dem Platz, wo auch gut ist. Freilich, wo’s lustig gange ist, ist er gerne dabei gewesen, aber das hätt doch nicht alles sölle mache.« – »He ja«, antwortete der Schwager, »und dann hat er oft geklagt, seine Frau sei keine Hausfrau, wie er sie g’mangelt hätte, sie mache keiner Sache eine Rechnung, und was die Augen sehen, das, meine sie, müsse sie haben.« – »Sie werden einander nicht viel vorzuhalten gehabt haben, und wär er mehr daheim gewesen, so hätte er sie können b’richten«, antwortete der Bruder. »Da muss man Weibergut machen, so viel man kann, das ist d’Hauptsach«, setzte er hinzu. – »He ja«, antwortete der Schwager, »und die Leute, welche dem Bruder getraut haben, brav mache z’v’rliere und ihn unterm Herd unte no zumene Schelm! Selb wär bravs!« Damit ging er in den Stall und ließ den andern stehn. Dieser sah ihm nach und brummte für sich: »Er wird ihm o schuldi sy, sust redti dä nit so; wenn’s ume anger Lüt aging, er wär nit halb so eigeli. Mi het de öppe nie g’hört, dass die, wo vo dem Züg nachechöme, bräver syge as anger Lüt, z’kunträri.«
Die Gedanken, welche beide wälzten in ihrem Sinne, waren ganz andere als die, welche sie hergebracht hatten, sie rüsteten beide sich auf eine schwere Zeit.
Kapitel 2
Der Leser vernimmt, wer begraben worden und wie derselbe seinerzeit zu einer Frau gekommen
Der Wirt, der begraben worden war, war eines angesehenen Mannes Sohn, welcher bei der alten Regierung viel gegolten, daher mit manchem Pöstlein beehrt worden war. Diese Pöstlein hatten ihn jedoch nicht reich gemacht, wenn er gleich ein Schönes daraus zog. Er hatte viel Land und viele Kinder; der Pöstlein wegen musste er viel von Hause weg sein, da weiß jeder, wie es geht, besonders wenn daheim keine Frau waltet, welche Hosen anhat und die Hand am Arm. Eine solche hatte er aber nicht. Wenn der Vater ein vornehmer Mann ist, so meinen die Kinder gerne, sie müssten dem Vater z’Lieb und z’Ehr großen Staat machen, und der Vater ist oft Gäugels genug und meint, es sei so. Wenn dabei viel gebraucht und wenig gearbeitet wird, so denkt er, das mögs wohl erleiden, so ein paar hundert Franken jährlich vom Himmel oben aben, man wisse nicht wie, glichen alles wieder aus. An eins aber denkt er nicht, obgleich er eigentlich seiner vielen Ämter wegen mehr Verstand hätte haben sollen als gemeine Leute. Er dachte nicht daran, dass seine Kinder an viel Brauchen und wenig Werchen sich gewöhnten. Und wenn er auch Land und Heustocke rechnen konnte wie Schnupf, mit und ohne Krümpe, mit und ohne Träm oder Fußwege, so konnte er doch den Unterschied nicht herausrechnen, welcher entsteht, wenn ein Kind wöchentlich 2 Fünfunddreißger vertut und keinen verdient, oder wenn es wöchentlich 2 Fünfunddreißger verdient und keinen vertut. Wer zum Rechnen nicht ganz dumm ist, der bringt mit Gottes Hülfe heraus, dass das einen Unterschied von 200 Fünfunddreißger macht per Jahr; und wenn er recht anwendet, so bringt er vielleicht noch heraus, dass 700 Fr. den Zins eines Kapitals von 17500 Fr. ausmachen. Eine schöne Summe, viele werden sagen ein schön Vermögen. Also wer alle Wochen 2 Fünfunddreißger vertut, muss den Zins von 8750 Fr. haben, und wer alle Wochen 2 Fünfunddreißger verdient, statt 2 zu vertun, trägt ein Vermögen in sich, welches ihm den Zins von 8750 Fr. abträgt, während er zu gleicher Zeit den Zins von 8750 Fr. erspart. Nun hört man so oft, »das ist ein reiches Meitschi, es hat so und so viel tausend Kronen und noch dazu Verfalles«, oder »das ist es arms, keinen Kreuzer hats«. Ganz gut, aber was braucht das eine, was verdient das andere? Das muss noch dazugerechnet werden; erst dann kann man das Vergleichen anfangen, und wenn man eine Subtraktion ansetzen will, so frägt es sich, ob das Mädchen, welches keinen Kreuzer hat, nicht die reichere Frau wäre als das andere mit seinen paar tausend Krönchen. So manches Herrentöchterchen heißt reich, 50000 Fr. habe es wie einen Batzen. Wenn es aber nun nichts kann als Kontos machen bei Schneiderinnen, Putzmacherinnen, Zuckerbäckläden usw., vom Kammermeitli muss anziehen lassen und von der Köchin betrügen, rechne man nur doch, wie reich ist die? Und dann erst so ein Bauerntöchterchen mit 20000 Pfund und meinethalben noch mit einem Halbdutzend zentnerigen Dackbetten, 17 Fassene, einem schönen Schaft, einer französischen Bettstatt und einem 12dublönige Schwarzkleb, das einem großen Haushalt vorstehen soll und kann nichts als Pantöffeli brodiere, merci sagen, z’Mul büschele und d’Lüt usgränne hinterm Rücke, gixt: »Herr Jeses, pfi tusig!«, wenn es den kleinen Finger in eine Säumelchtere tunchen sollte, steyt am nüni uf, schlärplet um z’Hus u geyt am eilfi u seit: »Mädi, was hey m’r hüt z’esse, mach ihs fry öppis Guts, öppe es Tätschli u viel Zucker dry u brav Zimmet druf«, u über Kopfweh schreit u Zahngweh, wenn es einist Bohne rüste sött oder afüre, u nüt erlyde ma as usz’ryte, un öppe Gotte z’sy oder z’tanze u das de länger, je lieber; wo d’Krone nit zählt, wenn’s ume Kittel geht oder um eine Kappe oder gar um Göllerketteli; aber dann anstatt Kabis Erdäpfelkraut einmachen will, das gang sust z’Schange, u einist heyg es neue g’hört, das gäb z’best Surkrut. – Was meint ihr wohl, wie reich ist ein solch Meitschi und was helfen die 20000 Pfund dem Bauer husen mit einer solchen Frau? – Ja, wird man sagen, das sei eine dumme Rechnung, die Rechnung eines Zaunstecklers, der das Leben nur nach dem Ersparten setze und wo das Geld die Hauptsache sei. Heutzutage lebe man gottlob in andern Zeiten, in aufgeklärtern, und da sei die Bildung die Hauptsache. So ein gebildet Frauenzimmer, das sei das Wahre, das sei ein einzig Kleinod, ein Gut, von dem man nicht wisse, o, o, o, o, o, wie herrlich. Und wenn man dann erstaunt nach dieser Bildung frägt, wenn man frägt, in welchem Verhältnis das Meitschi zu seinen Eltern gestanden und anderen Menschen, wie es sich in Leiden und Verdrießlichkeiten schicken könne, in Entbehrungen usw., so zuckt man die Achsel und sieht einen verächtlich an und sagt, d’Mutter sei eine ungebildete Frau, mit der sei nicht nachzukommen, mit gebildeten Leuten vertrage es sich trefflich, aber zuzumuten sei es so einer gebildeten Person gar nicht, dass sie sich nach rohem und gemeinem Pack richte, reizbare Nerven hätte sie und möge nicht viel ertragen. Das sei aber so bei gebildeten Leuten, die seien ganz anders g’natürt als so die gemeinen, wo seien wie Holzböck oder steinig Türlistöck. Wenn man dann noch einmal das Herz in beide Hände nimmt und frägt, worin denn eigentlich die Bildung bestehe, wenn sie nicht die Kraft sei, Leben und Menschen zu ertragen, weil man beide erkannt und seine eigene Bestimmung, so werden die Augen noch verächtlicher, und spöttisch verzieht sich der Mund, und man hört endlich: »Das begreifst du nicht, aber weil du es bist, so will ich es dir sagen, damit du doch einmal vernimmst, was Bildung ist.
Sie hat verflucht gute Schulen genossen und alles Mögliche darin gelernt; es hat Tage gäh, wo si füfzehnergattig g’ha hey. Da lert me angers as da so i de ordinäri Schule, wo me geng am Glyche lyret. Si hey vo d’r G’schicht g’ha und vo d’r Erdkugle, vo z’vorderist bis hingerus, u wie mänger Gattig Affe es git, hets Punktum g’wüsst, u wie sie lebe u wie si tue. Si hey z’selbisch e grusam e g’schichte Lehrer g’ha, er het ne alles, u b’sungerbar d’Affe, chöne so bigryflich mache, dass es eim duecht het, mi hey fry eine vor d’r Nase. U du ists im Weltschlang gsi u het brav gelert; gäb wie liecht es si b’sinne cha, su chas no alles säge, und wenn’s scho nit geng weltschet, su wird me nihms am manierlich Rede syr Lebtig amerke, a merci u si vous plaît und pas du tout. Es tanzet höllisch gut und het Konversation; es ist einist auf dem Dampfschiff g’fahre, und das erzählt es einem, so oft man will und recht kurzwylig; und arbeiten kanns auch, und zwar schön, brodiere, Kindskäppeli mache, und lue, dä Geldseckel het es m’r g’lismet; das ist öppis angers als so grad ane e wullige Strumpf. Du glaubst nicht, was das für ein Unterschied ist zwischen einer gebildeten Person und einem groben Mensch, auf 100 Schritt sieht man ihn. Selb ist Bildung.«
S’ist schön, diese Bildung, verflümeret schön. Wenn dann diese Gebildete zu einer Hausfrau gerät, so hat’s diese Bildung nicht selten wie schlechte Indienne, wo nach ein paar Wochen e Uflat wird, den man gar nicht mehr ansehen mag. S’ist aber kurios, nach dieser Bildung wird hauptsächlich beim weiblichen Geschlecht gebrüllt wie bei einer Feuersbrunst nach Wasser. Beim männlichen Geschlecht, versteht sich Ausnahmen abgerechnet, fordert man bloß, dass einer sich recht lustig machen, schwatzen und flattieren könne, und einige sind, die sich am liebsten von Schnäuzen flattieren lassen. Die Sache, von der wir ausgegangen, bleibt die gleiche; der Unterschied vom Vertun und Verdienen wird nicht bemerkt. Wenn einer sich recht lustig machen und gut flattieren kann, ein Schübeli Geld hat, aber keines zu verdienen weiß, so meint so ein Meitschi, was es erobert, wenn es so ein luftig Bürschli erzappelt hat, zieht ihn hundertmal einem fleißigen G’stabi vor, der gut arbeitet, aber schlecht tanzt, es ehrlich meint, aber nicht zu flattieren weiß. Unseres Mannes Kinder waren teils gebildet, d.h. die Töchter, und waren lüftig und lustig, die Söhne nämlich. Unter ihnen machte sich besonders Stephan bemerkbar, ein gescheuter Bursche mit Kruselhaar und heitern Augen. Wo es lustig ging, war er der Erste und Letzte, ob er aber der Erste oder Letzte zum Mähen auf die Matte kam, dessen achtete sich der Vater nicht, und wenn er dem Vater von den andern Geschwistern verklagt wurde, er wolle nicht hacken, nicht helfen hier oder dort, so redete ihm die Mutter z’best.
Da man ihn zu Hause recht gut entbehren konnte, so wurde beschlossen, er solle das Metzgen lernen. Das ist auf dem Lande das adeliche Handwerk, wie in den Städten der Weinhandel der adeliche Handel war. – Stephan ließ sich das recht gerne gefallen. Er lernte das Metzgen, so wie es ein junger Sohn lernt, der Geld im Sack hat und Muggen im Kopf. Daheim machte er, was er gerne wollte, und wenn er über Land musste dem Veh nach, so kam er heim, wenn es ihm gefiel. Daneben geriet er zum Scharfschütz, und wenn irgendwo ein Schießet war, so fehlte Stephan nicht, und wenn er in Garnison musste, so kam seinen Vater allemal das Seufzen an.
Die Lehrzeit dauerte nicht lange. Metzgerknecht sein, sich binden, wollte er begreiflich nicht, das wäre seinen Ehren ein Abbruch gewesen. Er ging also wieder heim, sollte im Sommer wieder werchen, im Winter dann auf gut Schick passen, ob irgendein Vetter oder einer, der sich beim Vater in Gunst setzen wollte, sich seiner erbarme und ihn anstelle, um seine Sau oder zwei zu schlachten, oder ob irgendeine ihrer Kühe so gefällig sei, ein Kalb zu gebären, das man nicht abbrechen, nicht wohl verkaufen konnte, sondern es am besten war, dasselbe selbst zu schlachten und das Fleisch zu verhausieren. Das erleidete ihm aber auch; es trug wenig ein, und doch wurde er je länger, je mehr darauf verwiesen, wenn er Geld wollte.
Da kam die neue Ordnung der Dinge, und bald darauf wurden die Konzessionen zu Wirtshäusern so häufig erteilt, dass allenthalben das Gelüsten entstund zu wirten, um ring reich zu werden. Das kam unsern Stephan auch an, und sein Vater, den er so zu drehen gewusst hatte, dass er um seinen Kredit nicht gekommen war, hatte nichts darwider, sondern meinte, man müsse d’G’legeheit profitiere und nusse, wenn Nuss syge. Zu einem Wirtshaus wolle er ihm schon helfen. Dazu aber, sagte er, gehöre eine Frau, welche Geld habe; viel könne er ihm nicht geben, öppe es kuraschierts Mönsch, das der Sach wisse vorzustehn und den Leuten anständig sei, nit öppe so nes Tschaggeli, so nes Kuderbützi, wo me nit wüss, was hinger oder vorfert syg. –
Ein luftiger Bursche wie Stephan hatte begreiflich schon manche Liebschaft gehabt, aber die einen waren erkaltet, und aus andern hatte es sonst nichts gegeben, sodass er in diesem Augenblick wirklich nichts angesponnen hatte, also das Herz frei war und nirgends weder Schleiftrog noch Kette. Nun hätte man denken sollen, die Familie sei zu Rate gesessen, hätte eine Landkarte zur Hand genommen, worauf die Wirtshäuser verzeichnet gewesen, und nun nachgedacht und nachgefragt, wo ledige Töchter seien, die d’Sach verstünden und Geld hätten. Aber daran dachte man nicht von ferne. Im Kanton Bern herrscht der Glaube, und selbst auf der Hochschule (damals florierte sie jedoch nicht wie jetzt) wird ihm nicht widersprochen, dass man eigentlich d’Sach nicht zu lernen brauche, sondern wer Couraschi hätte, sie auch könnte; zwar nicht aus Gottes Gnaden, sondern von Rechts wegen; denn die Aristokratie des Wissens soll ja abgeschafft sein im Kanton Bern, wie ein verdächtig gewordener Schulmeister gesagt hat. Das ist übrigens ein Glaube, welcher alt ist im Kanton Bern, welcher mit der Verfassung nicht bloß nicht abgeschafft, sondern, wie es scheint, noch duppliert worden ist, sodass jeder Gugag meint, er sei gut genug in jedem Rat. Es wäre wohl gut, es stünde mit dem rechten Glauben im Kanton Bern so gut als mit diesem Glauben. In diesem Glauben war unsere Familie auch recht stark. Sie dachte nicht daran, dass man das Wirten und alles damit Verbundene lernen müsse; sie meinte, das verstehe sich von selbst. Wer wirte, der nehme das Geld. Die Gäste sehen begreiflich nur, was der Wirt einnimmt. Wenn er was ausgibt, so sieht es nicht der Hundertste. Und was man nicht wisse, das könne man fragen, oder es sei bald gelernt, es wisse öppe ein jedere Löhl, wie es in einem Wirtshaus gehe, und was für Ürtene man machen müsse. So hätte die Familie geantwortet, wenn man ihr von so etwas gesprochen oder eine Wirtstochter oder gar ein Stubenmeitschi in Vorschlag gebracht hätte als Frau für Steffen. Ja, sie hätte sich ordentlich erschüttet ob diesem Vorschlag; sie hätte geglaubt, man meine, es sei im Schoße ihrer Familie nicht Verstand genug zu jeder Sache, sie mangle noch was anderes als Geld. Es saß also die Familie nicht an der Landkarte und studierte die Wirtstöchter. Aber die Mutter war eine gute Frau, hatte also viele Weiber, welche bei ihr aus und ein gingen, so gleichsam ihre Adjutanten, welche für sie in der Welt agierten und ihr Kundschaft brachten aus der Welt Getümmel. Diesen vertraute sie ihr Vorhaben und wie es ihnen anständig wäre, wenn sie für den Steffen ein aufgeheitertes Mädchen wüssten mit einem schönen Schübeli Geld. –
Für solche Freundinnen ist ein solcher Auftrag fast was himmlisches Manna, wenigstens eine der größten irdischen Wonnen. Wie die davonstoben, dann wieder daherstoben, zu b’richten hatten und die Hände verwarfen und nötlich taten. Wenn man sie hörte, so hätte man glauben sollen, es hätte über Nacht reiche, aufgeheiterte Mädchen geschneit ganze Hüfe. Steffen hätte Tag und Nacht auf den Beinen sein müssen, wenn er alle Mädchen hätte g’schauen wollen, welche ihm angegeben wurden als wie gemacht für ihn. Wenn er auch nur dem Zehnten nachlief, so magerte er doch sichtbarlich ab und klagte der Mutter, das Ding erleide ihm afe und entweder nehme er jetzt das erst Best, oder er schlage z’Wirte aus dem Sinn. Die besten der Mädchen hatten schon einen Liebern und wollten nichts von ihm, einige, die Geld hatten, hatten dazu Gesichter wie ungewaschene Pfannen; andere, die für eine Wirtin nicht unzweckmäßige Gesichter hatten, besaßen eigentlich kein Vermögen, hatten bloß starke Hoffnung auf ein großes Erbe. Z.B. ihrer Großmutter Halbschwester Tochter hätte bloß ein Kind, und zwar gar es leids, das z’Manne kum erlebe werd, und wenn das sterbe und der Großmutter Halbschwester ihren Mann überlebe, so lasse die eine Verordnung machen, und dann könne sie den bessern Teil nehmen. Gesagt hätte sie es zwar nicht, aber merken hätte man es schon manchmal können. Eben als Steffen am Abstehen oder Ertauben war, eins von beiden, vernahm man, es Tüfels es ufg’heiterts Meitschi mit einem schönen Schübeli Geld, wo’s nüt bruch, as es z’näh, wo me ke Stung druf warte müss, we me einist kuppeliert syg. Und dazu sei die Familie b’sunderbar huslig und zum Werche abg’richtet wie keine so. Das schlach vom Morgen bis am Abe dry, dass es eim fry übel grus. Grad so eine, dachte alsobald die ganze Familie, mangle Steffen; was er nicht möge, mache die, und es werde ihr wohl kommen, wenn sie recht viel möge, von wegen, er werde an sie lassen je mehr, dest lieber. Eisi hieß sie, und ihr Vater war ein großer Bauer gewesen u Hungs gytig; ihre Mutter eine Werchadere wie keine. Keine ihrer Töchter mache ihr das geringste Ding recht, darum machte sie am liebsten alles alleine, und ihre Töchter waren am besten hinter Mutters Rücken oder wenigstens 10 Schritt vom Leibe. Geld für Kleider gab der Vater so wenig als möglich und für Lustbarkeiten gar nichts, wollten sie was Besseres oder was Lustiges, so mussten sie es erlistelen oder erstehlen; sie übten sich in beidem, so gut sie konnten. Werchen mussten sie wie d’Ross. Dusse werche, grad ane dryschlah konnten sie, dass es einem fry drab grusete. Aber daheim war keine dressiert; sie konnten kaum den Schweinen kochen, geschweige den Menschen. Nähen konnten sie so viel, für im Notfall die Fetzen am Fürfuß vernähen zu können, wenn sie ihnen über die Schuhe hinaushangen wollten. In einem halben Tag brachten sie so einen Fürfuß zur Ordnung im Schweiße ihres Angesichtes; den andern Tag ruhten sie von ihrer Arbeit, und am dritten Tage nahmen sie erst den zweiten Fürfuß übers Knie mit Angst und Seufzen. Von Lismen war keine Rede, ward dasselbe dringlich, so nahm man ein Solothurner Mönschli auf die Stör oder gar zwei. Die Leute waren b’sunderbar berühmt von wegen der Häuslichkeit und von wegen der Brävi, und was die Leute nicht sahen, das wusste die Mutter ihnen aufs Brot zu streichen, damit sie es auf die Dromme brächten. – Kurz nacheinander starben die Eltern am Nervenfieber, und wirklich war da Geld unter die Kinder gekommen. Die Töchter hatten ein artig Schübeli abgekriegt. Da fand Steffen, was er wollte und zudem sehr freundliche Aufnahme; er war in Verlegenheit, wie wehren; es hätten ihn alle drei Schwestern gerne gehabt, und er konnte doch nur eine nehmen. Wir wollen ihnen nicht nachreden, dass sie lieber als andere Meitscheni Männer gehabt hätten. Aber so z’Leerem, für nichts und wieder nichts, arbeiten viele Schwestern nicht gerne bei den Brüdern, haben bös, müssen Jungfrauen vorstellen und am Ende in der Vogtsrechnung noch sehen, dass sie nicht einmal das Essen verdient, sondern noch ein ordentlich Tischgeld schuldig geworden. Darum stellen sie lieber was für sich selbsten an, wo sie, wenn es gewerchet sein muss, doch wissen, für wen sie werchen. Steffen entschied sich bald. Er wollte Eisi, die lüftigst und lustigst von allen, die läuferlen konnte, dass einem düechte, sie rühre den Boden nicht an, und ein Mundstück hatte wie ein Schlängli. Die andern Schwestern ließen, als sie das merkten, anfänglich den Trümel hängen, indessen trösteten sie sich bald, weil jede einen Tröster fand. Es gab Hochzeit über Hochzeit und Glück über Glück, und alle meinten, ihnen sei das leibhaftige Glück zugefallen. Aber die Töchter fielen ganz anders aus, als man erwartet hatte. Bei ihnen erfuhr man, was Huslichkeit und Arbeitsamkeit in einem Hause helfen, wenn der rechte Boden fehlt. Wo der rechte Boden fehlt, da artet das Schönste aus, und Tugenden verwandeln in Laster sich.
Eisis Eltern, z’Bure ufem Gugger, waren sogenannte ehrbare Raggerleute, sie galten für brav, aber dass sie es in Mein und Dein besonders exakt nahmen, selb war nicht; sie hatten nicht großen Verkehr mit der Welt, weil sie immer von der Welt fürchteten, betrogen zu werden; aber wenn sie eine Sau oder ein Kalb bei der Gewicht verkauften, so sparten sie das Füttern und Stopfen nicht, es bringe immer sövli, meinten sie, und der Metzger hätte allweg z’Bessere.
Sie lebten karg in Kleidern und Essen; besonders so weit der Vater es zwingen konnte, und wenn die Kinder an eine Lustbarkeit wollten, so setzte es allemal Händel ab. Aller sogenannten Freude war der Vater feind und hielt die Kinder davon ab. Aber der Kinder Sinn so zu lenken, dass sie an etwas anderm Freude kriegten, das tat er nicht. Der Kinder Auge nach etwas Höherm zu lenken, das ihnen ein Genügen geben konnte, tat er ebenfalls nicht; der Kinder Herz durch Liebe und Gemütlichkeit so zu fesseln, dass sein Sinn ihr Sinn wurde, sie mit Freuden ihm zur Hand sprangen, das tat er wiederum nicht. Er hasste alles Lesen, es trage nichts ab, sagte er. Er brummte oft über das Kirchengehen, besonders bei schlechtem Wetter; man mach d’Schuh dure u heyg nüt d’rvo, man sei ja unterwiesen worden und sött öppe wüsse, was me z’tue und z’glaube heyg, meinte er. Auch führte er keine geistlichen Gespräche mit seinen Kindern, außer wenn ein Nachbar, den er hasste, ins Unglück kam. Dann sagte er: Es sei notti gut, dass zuweilen so einem etwas auf die Nase werde, sonst würd’ z’letzt niemand mehr glauben, dass ein Gott im Himmel sei. Freundliche Worte gab er das Jahr durch wenige. Sauersehn war seine Freundlichkeit. Klagte jemand über etwas, so sagte er, »he es ist si doch d’r wert, so z’gruchse, wed schwygst, su wirds scho bessere«. Wenn das Gruchsen sich so steigerte, dass der Fehlbare nicht mehr arbeitete und nebetzi lag, so sagte er, das sei nur Fantast und Fulkeit. Die Mutter war darin gleich, dass sie ebenfalls nichts Besseres pflanzte in die Kinder, dass das Raggern auch ihre Gewohnheit war, dass sie also ziemlich einträchtig mit ihrem Manne einem Ziele zulief. Aber sehr getäuscht würde man sich haben, wenn man geglaubt hätte, sie hätte ihren Mann geliebt. Sie liebten beide bloß den Mammon, keine lebendige Seele, die Frau höchstens ihre Mastschweine von Martistag bis Ostern, wenn sie recht gut taten. Aber eben weil sie sich nicht liebten, kam zuweilen der Frau der Widerspruchsgeist an, d’r Alt müss’ doch de nit meine, dass er alles zwängen wolle. Dann half sie den Töchtern hinter dem Rücken des Mannes zu allerlei, zu Kleidern und Schleckereien. Wenn er den Rücken kehrte, so wurde g’eiertätschelt oder geküchelt oder ein Abendsitz angestellt, oder sie rissen sonst aus, und wenn dann der Alte das Korn nachgemessen hätte oder das Gespinst nachgewogen oder die Eier gezählt, so hätte er zuweilen was merken können. Indessen geschah das selten genug. Durst und Drang nach der Welt und ihren Genüssen ward nicht gestillt, nicht ausgetrieben, nur aufgestaucht. Da saßen sie auf ihrem Gugger oben und mussten immer denken, »o hätt ich doch, o könnt ich doch«. – Wenn Markt, Musterung, Tanzsonntage waren und alles zottelte, sie aber bleiben mussten, so wollte das sie fast versprengen, und was es für einen Unwillen gab, kann man sich denken. So schienen sie wohl eingezogen, konnten mit Recht dafür gelten, aber die Eingezogenheit war nicht ihr Sinn, war Zwang, inwendig sah es ganz anders aus. Sie glichen Äpfeln, gesund und ganz von Ansehn, die unter der Rinde aber ganz anders sich zeigen. So waren aber nicht bloß sie, so würden auch noch viele andere erfunden werden und sind bereits erfunden worden, wenn es zum Fecken kam. Ähnlich verhielt es sich mit ihrer Arbeitsamkeit, die hatte auch nicht ihre Wurzel inwendig in dem Sinne, der Freude hat an treuem Benutzen seiner Gaben, am treuen Beschicken seines Tagewerks, in der Liebe, welche Freude machen will dem irdischen Vater und das Wohlgefallen des himmlischen sucht, sondern sie wurde getrieben und erzeugt durch einen äußern Zwang, hörte der Zwang auf, sank die Arbeitsamkeit auch in sich selbst zusammen. Zudem war dieses Arbeiten eigentlich nicht weit her, sondern bloß ein so allgemeines Dreinschlagen. Vom Hauswesen verstunden sie hell nichts, achteten sich allerwelt nichts, hatten nur immer zu sinnen und zu denken, wie es doch lustig wäre, wenn sie machen könnten, was ihnen wohl gefiele, und wie es doch verflucht sei, dass sie machen müssten, was sie nicht gerne mochten. Sie waren weder im Stall noch in der Küche daheim, und was das Spinnen anbelangt, so fluchte der Weber immer grenzenlos, wenn er dem Garn vom Gugger nicht entrinnen konnte. So war die Arbeitsamkeit und Eingezogenheit der gepriesenen Töchter beschaffen, und wie viel sie wert waren und wie häblig, erfuhr auch bald die Welt. Das hätte man doch afe nicht gedacht, hieß es dann, wie doch die Menschen sich ändern könnten u d’rzu no so kurzum. Bäbi, die älteste, ward alsbald liederlich, begann zu essen und zu trinken, was das Herz gelüstete, so gut und so viel als es z’weg bringen mochte, dem Mann dagegen gönnte es nichts, am liebsten hätte es ihm nur Erdäpfelschindti gegeben oder Treber, wenn es welche gehabt hätte. Es ging nicht viele Jahre, so starb der Mann an der Auszehrung, Bäbi aber an der Wassersucht. Mädi, die zweite Tochter, ward eine grenzenlose Schlampe und Dampe, schwatzen war seine Seligkeit, und bal laufe, bal höckle, kam ihm grad nache; die Kinder ließ es verhudelt laufen, manchmal hatte es längst Mittag geläutet, und Mädi hatte noch kein Feuer angemacht, keine Erdäpfel gewaschen. Einmal hätte es bald das Haus verbrannt. Es hatte Anken ob dem Feuer zum Auslassen, eine Nachbarin ging vorüber, Mädi schoss hinaus: »Du, du, los doch neuis«, rief es, und wenn es einmal diesen Haken eingehängt hatte, so kriegte es ihn nicht wieder los; so dampete es, bis der Anken im Feuer war; da wohl hatte das Dampen ein Ende, und wenn die Nachbarin nicht gewesen wäre, Mädi hätte sich nicht zu helfen gewusst. Kommod kam es ihm, dass die Schweine nicht reden konnten; wohl, die hätten ihm Sachen ausgebracht, dass Gott erbarm. Wie es Eisi erging, dem aufgeheiterten, welches den luftigen Steffen kriegte, das wollen wir nun auch sehen.
Kapitel 3
Wie diese Frau in sechs Wochen Wirten lernt
Auf der Gnepfi hatte sein Vater ihm ein altes Haus gekauft und eine Konzession richtig erhalten. D’Gnepfi lag an einer Straße, Steffen hoffte dabei aber noch, dass akkurat bei seinem Hause künftig eine zweite Straße sich münden werde. Und wenn die Leute seine Hoffnung auslachen wollten, so lachte er noch mehr und sagte: Er verlasse sich auf gute Bekanntschaft, und auf einen Zapfen oder zwei käme es ihm nicht an. Da ließen sie nun bauen, z’wegmachen, einrichten, und während das geschah, sollte Eisi geschwind das Kochen lernen. Steffens Mutter hatte bald gemerkt, wie es mit Eisis Kochkunst bestellt war und dass die Schweine allemal gränneten, wenn Eisi ihren Hafen in Obhut gehabt hatte. Sie gab daher Steffen untern Fuß, Eisi sollte doch wäger noch ein wenig kochen lernen, es sei nicht einmal imstande für d’Tauner z’koche und d’Handwerkslüt, geschweige denn für neuis Grechts, e Kindsbetti, es Hochzyt oder gar für d’Grichtsmanne. Steffen begriff das. Er aß nicht ungern was Gutes, und Eisi hatte ihm einmal einen Eiertätsch gemacht, der war zäh wie Sohlleder gewesen und hatte gestunken wie ein verbranntes Haus, wo alles Vieh dringeblieben war. Seitdem hatte er großen Respekt vor Eisis Kochen, und wenn er es in der Küche sah, so hielt er allemal die Nase zu. Er hatte einen Freund, der auch Scharfschütz war, ein Wirtshaus besaß und eine Frau, von welcher Steffen sagte, das sei ihm ein donnstigs Ketzerli von einer Frau, die gefiel ihm, so sollten alle Wirtinnen sein. Diesen fragte er, ob er sein Eisi nicht drei oder vier Wochen zu ihm tun könnte für z’Koche z’lere, öppe gar e Hex drin sei es noch nicht. Der Freund war ganz bereitwillig, schwerer war Eisi zu bereden, es meinte, selb wär nicht nötig, und was es öppe nicht könne, sei bald gelernt, es werd ihm de, wenn Not a Ma chöm, scho z’Sinn cho, wie d’Sach müss’ g’macht sy, u de chönn me öppe probiere, bis es gut chöm, es syg jetzt alles gar wohlfeil. Je weniger man von einer Sache kennt, desto leichter kömmt einem das Erlernen derselben vor, und je weniger Begriff man von einer Kunst oder Wissenschaft hat, desto geringer schätzt man sie. Indessen ließ es sich bereden; vier Wochen seien bald vorbei, dachte es, und geschrieben stehe es nirgends, dass es den ganzen Tag in der Küche sein und den Kuchimutz machen müsse. Es nahm eine ganze Kiste voll Kleider mit, aber Kuchischurz keinen einzigen; dere werden sie dort wohl haben, dachte es, wenn es einen sein müsse. Die Wirtin dort war ein lustig, leichtfertig Ding, die sich um die Küche wenig bekümmerte, aber mit den Gästen lustig tun konnte, wenn dieselben für sie waren. Sie waren reich, ihre Wirtschaft hatte einen eingeurbeten Gang, es mochte sich da schon etwas erleiden. Sie hatte anfangs ihren Mann tüchtig ausgeschnauzt, dass er ihr so eine bringe, mit der sie sollte in der Küche sein, dergleichen tun, was sie für eine Köchin sei, und er wisse ja wohl, wie ihr das in der Küche Hocken zuwider sei, wie sie auch nichts weniger erleiden möge als das. Als aber Eisi kam, grollte sie mit ihrem Manne nicht länger, sie sah, dass es mit dem in der Küche Sitzen nicht so gefährlich sei, und sie und Eisi waren b’sunderbar wohl füreinander. Eisi war die Welt neu, es sah hundert Dinge mit staunenden Augen an, welche Weltmenschen alltägliche Dinge waren, und brach darüber in Lobeserhebungen aus. Es tat daher der Wirtin b’sunderbar wohl, wenn sie Eisi ihre Herrlichkeiten in Stuben und Kasten auspacken und zeigen konnte und Eisi dann aus Herzensgrund zu loben begann: »E aber ni, aber ni, tusig Schieß, Türk abenangere, wie schön! Selligs ha nih no niene g’seh, ni aber was doch de Lüte afe nit z’Sinn chunt, mi steyt fry uf e Gring!« So ein herzgründlich Lob, dem man es von Weitem anhört, dass es nicht ein übliches, alltägliches ist, tut einem sogenannten großen Geiste wohl. Warum sollte also dadurch eine Wirtin nicht gewonnen werden, warum sollte sie mit einer solchen Freundin nicht die herrlichsten Tage verleben? Eisi war daheim gezwungen gewesen, spätestens um 5 Uhr des Morgens aufzustehen, bei seines Mannes Eltern hatte es bis 6 döselen lassen können, hier kam, oder wie man sagt, schloff es das erste Mal erst um 7