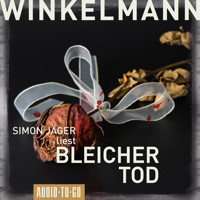9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es ist im Keller. Und bald kommt es herauf. Die eigenen vier Wände auf dem Land: Für Kristin und Tom geht ein Traum in Erfüllung. Doch die junge Mutter beschleicht von Anfang an ein ungutes Gefühl. Das alte Haus ist ihr unheimlich. Als Tom kurz nach dem Einzug überraschend stirbt, werden Kristins Ängste von Tag zu Tag schlimmer. Sie hört Stimmen, und nachts träumt sie von einer Gestalt, über die man im Dorf spricht: von einem Scherenschleifer, der hier vor langer Zeit eine Frau getötet haben soll. Kristin glaubt, langsam verrückt zu werden. Die Dorfbewohner raten ihr, das neue Heim so schnell wie möglich zu verlassen. Sie entschließt sich zu bleiben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Andreas Winkelmann
Der Gesang des Blutes
Thriller
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Dieses Buch ist meiner Frau Stefanie gewidmet. Durch ihre Liebe und ihren Glauben ist das Unmögliche möglich geworden.
Prolog
Bringt heraus Messer und Scher,
so sie schneiden wieder schwer.
Ich schleif sie euch, schnell und gut,
und führ sie vor an meinem Blut.
Wie ein Totenglöckchen wehte der helle Klang durch das offene Küchenfenster, untermalt von einem zugleich erregt und monoton klingenden Sprechgesang, den der Wind oder die Entfernung verschluckten. Aber da hatte sie schon das Knirschen der Räder auf dem Kiesweg gehört und einen Blick durch das Fenster geworfen. Sie sah einen großen bärtigen Mann, der einen Handkarren hinter sich herzog. Sein tief in die Stirn gezogener speckiger Filzhut verschattete sein Gesicht in der Mittagssonne gänzlich. Er trug Lumpen, und all das ließ ihn geradewegs als Finsterling erscheinen.
«Der schwarze Mann!», flüsterte sie und krampfte ihre Finger in die Schürze.
Aber es war der Scherenschleifer, nur der Scherenschleifer. Vor ihm brauchte sie keine Angst zu haben, dass wusste sie. Trotzdem trat sie rasch einen Schritt zurück. Allerdings zu spät, denn er hatte sie längst entdeckt.
Sie sah ihn erstaunt an, als die letzte Zeile seines Gesangs wie ein Traumfetzen an ihr vorüberzog. Er blickte ihr direkt ins Gesicht. Und dann lächelte er.
… und führ sie vor an eurem Blut …
Vor dem Tod
1
«Es gibt keine gruseligen Keller! Es gibt überhaupt keine gruseligen oder unheimlichen Räume! Ein Keller ist ein Keller, ist ein Keller! Egal wie dunkel und feucht er ist. Keller! Verstehst du? Alles andere spielt sich in deinem Kopf ab, nirgends sonst», sagte Tom und warf ihr einen zweifelnden Blick zu, der von seinem typischen spöttischen Lächeln begleitet wurde, das immer dann auftauchte, wenn er sich um Längen überlegen fühlte. Dabei hatte sie sich damals in sein Lächeln verliebt. Allerdings in ein anderes. Sie bereute schon, überhaupt etwas gesagt zu haben. Aber was konnte sie schließlich für ihre Gefühle?
Das Haus war eigentlich genau der Traum, dem sie schon so viele Monate hinterherliefen. Ein bisschen weitab vom Schuss, aber man musste halt Abstriche machen. Das hatte schon ihr Makler gesagt. Doch für dieses Haus würde Tom sicher eine Stunde Fahrt zur Arbeit auf sich nehmen, das spürte sie. Was also war ihr Problem? Dieses Kellerloch beunruhigte sie. Es war wie eine schwärende Wunde.
Sie wich Toms Blick aus, richtete ihre Augen noch einmal auf den großen rechtwinkligen Raum und erschauerte erneut. Es war nicht einzig die Dunkelheit, der Geruch oder die feuchten Wände. Wenn jemand sie aufgefordert hätte, in klaren Worten zu beschreiben, was sie an diesem Keller so ängstigte, hätte sie versagt.
Streng genommen war es gar kein richtiger Keller, sondern eines dieser Löcher, wie sie vor hundert Jahren unter die Häuser gegraben wurden. Ein einziger großer Raum mit Wänden aus Bruchstein und einer niedrigen Decke, die Tom zwang, sich zu bücken. Man musste eine gefährlich schmale, steile Betontreppe hinunter, bis man endlich auf dem feuchten, modrigen Lehmboden stand, der bei jedem Tritt nachzugeben schien und einen zu verschlingen drohte.
In der Mitte des Bodens zeigte sich eine deutliche rechteckige Vertiefung, als habe vor Jahren jemand eine Sickergrube angelegt.
Tom irrte sich, oh ja! Es gab sehr wohl gruselige Räume. Dieser hier war einer, und zwar nicht nur in ihren Augen. Kristin wusste selbst, dass sie seit jeher empfänglich für solche Sachen war. Ihre Kindheit war vollgestopft mit abscheulichen Schrankgespenstern und heimtückischen Waldtrollen. Aber das war damals, damals, als ihre Phantasie noch um einiges lebendiger war. Heute brauchte es ein bisschen mehr, um sie einzuschüchtern. Und dieses bisschen Mehr war dieser Keller!
«Was ist, gefällt dir das Haus etwa nicht?»
Kristin sah ihn nicht an. Ihr Blick war an der rechteckigen Vertiefung im Lehmboden hängengeblieben. Er wusste nur zu gut, wie sehr ihr das Haus sonst gefiel, und vor allem das riesige Grundstück, das endlich ihren Traum vom eigenen Pferd zu erfüllen versprach.
«Doch, es gefällt mir sehr, aber …»
«Aber? Was gibt es hier für ein Aber? Kristin, ich bitte dich, genau das haben wir uns immer vorgestellt. Wenn ich den Preis drücken kann, und ich weiß, dass ich diesen Armleuchter von Makler um mindestens Zwanzigtausend drücken kann, ist es mehr als ideal für uns. Schatz, denk mal rational.»
Architekten dachten immer rational, das hatte Kristin inzwischen gelernt. Toms Leben war ausgefüllt mit Zahlen, Zahlen kannten keine Trolle und Schrankgespenster. Er würde nie begreifen, was sie empfand. Zahlen kannten keine Gefühle. Andererseits hatten ihr ihre Gefühle bis jetzt auch die Beklemmungen, die der Keller in ihr ausgelöst hatte, nicht erklären können.
Nur schwer konnte sie den Blick von der Vertiefung lösen, um Tom anzuschauen.
Er hatte den Ausdruck des unschuldigen kleinen Jungen aufgesetzt, mit dem er bei ihr alles durchsetzen konnte. Selbst das, fürchtete sie, war seiner rationalen Strategie geschuldet. Aber darüber wollte sie lieber nicht nachdenken.
«Ach Tom, es ist wirklich ein Traum, und wenn dir die Entfernung nichts ausmacht …», sagte sie und ließ die Schultern fallen. «Etwas Besseres werden wir kaum finden.»
Er eilte auf sie zu und nahm sie in die Arme. Kristin meinte, den Boden unter seinen Füßen schmatzen zu hören. Immerhin wog er fünfzig Kilo mehr als sie. Es konnte doch durchaus möglich sein, dass der Kellerraum ihn zu verschlingen trachtete, nicht sie. Für einen winzigen Moment fühlte sie sich in seinen Armen gefangen.
«Ich wusste, dass du vernünftig bist. Wir müssen den Keller ja nicht nutzen, oder? Das Haus ist ja groß genug. Und? Haben wir noch Gerümpel? Nein, oder? Und dann haben wir ja immer noch den großen Speicher, meinst du nicht?»
Er warf einen Blick auf die Vertiefung und kratzte sich am Kopf.
«Der Keller ist wirklich ein Dreckloch. Aber Wohnfläche, Zuschnitt und Grundstück müssen stimmen. Und das tun sie allerdings, oder?»
Was blieb ihr anderes übrig, als zu nicken? Ja, ja, er hatte recht.
Er warf ihr einen gönnerhaften Blick zu. Ja, ja, sie würden den Keller nicht nutzen, niemals, außer für ein paar alte Sachen vielleicht, die sie hier runterschaffen könnten. Selbst das war zu überlegen, wegen der Feuchtigkeit, aber mein Gott, sollten sie deswegen etwa …? Tom hatte recht: Wohnfläche, Zuschnitt und Grundstück. Und die stimmten weiß Gott!
Sie nickte schließlich und ließ sich von Tom küssen, zuerst auf die Stirn, dann auf den Mund.
Plötzlich fühlte sich auch das rational an, und zum ersten Mal, seitdem er sie vor dem Altar geküsst hatte, war sie nicht bei der Sache.
«Komm, Mäuschen, wir gehen noch mal nach oben. Ich will den Ausblick aus dem Schlafzimmer noch mal sehen, bevor ich von Rahden auf die Füße trete.»
Ohne auf sie zu warten, stieg er die steile Treppe hoch. Sie konnte die Sohlen seiner Schuhe auf dem Beton schaben hören. Unwillkürlich zog sie die Schultern zusammen. Rückwärts, den Raum nicht aus den Augen lassend, tastete sie sich zur Treppe. Warum stand hier kein Gerümpel? Warum stand, von einem halb vergammelten Holzregal abgesehen, absolut nichts in diesem Keller? In den letzten sechs Monaten hatten sie vier alte Häuser besichtigt, deren Keller voll mit altem Gerümpel standen. Aber dieser Keller, so leer, so tot … Nicht mal Spinnen gab es hier unten.
Als sie den Mauerdurchbruch erreichte, der den Raum vom Treppenaufgang trennte, blieb sie stehen und tastete links nach dem altmodischen Lichtschalter. Bevor sie das Licht löschte, sah sie noch einmal hinunter. Für einen winzigen Augenblick hatte sie den Eindruck, als wollte eine unendliche Tiefe sie hinuntersaugen. Quatsch, das ist nichts anderes als eine Delle im Lehmboden, eine Delle. Wahrscheinlich hat das Grundwasser da gestanden, und der Boden ist später abgesackt, verstehst du? So wird es gewesen sein, du Dummerchen, komm, bleib bitte rational.
Entschlossen drehte sie den Lichtschalter, worauf die Glühbirne gehorsam erlosch, und stürmte die Treppe hinauf. Auf halber Höhe rutschte sie auf der schmalen Stufe ab. Instinktiv streckte sie beide Arme aus und stützte sich mit den Händen an den Wänden ab. Es gab keinen Handlauf! Tom musste unbedingt einen Handlauf anbringen, sonst geschah auf dieser Treppe noch ein Unglück. Aber wozu, wenn sie den Keller ja doch nicht nutzen wollten?
Ihr Herz schlug schnell und heftig, als sie die Tür hinter sich zuschlug.
«Ich bin hier!», hörte sie Tom von irgendwoher rufen.
2
Herbert von Rahden, ihr Makler auf der langen Suche nach dem Objekt ihrer Begierde, konnte ihnen nicht viel über das Haus erzählen. Dieser überaus fette Mann, der ständig zu schwitzen schien und seinen Mund nie länger halten konnte, als es dauerte, sich eine Zigarre anzuzünden, war auffallend schweigsam, was das Haus betraf. Er kannte Daten und Fakten, aber keine Namen und schon gar keine Geschichte. Das Haus war vor fast genau hundert Jahren erbaut worden. Nicht dieses, ein anderes, aber dieses war nach dem Ende des Krieges aus den Resten des anderen entstanden. Das genaue Alter war also schleierhaft. Der Keller hielt wohl den Rekord, jene Wand stammte vielleicht ebenfalls aus Gründerzeiten, genauso wie das Fachwerk des vorderen Giebels, wohingegen das Dach jüngeren Datums sein dürfte.
Nachdem sie sich am Tag der Besichtigung per Handschlag einig geworden waren (Tom hatte von Rahden sogar um dreißigtausend Euro drücken können), hatte es noch zwei weitere Treffen mit dem Makler gegeben. Bei jedem war er Kristins Fragen ausgewichen: «Nein, haha, wie kommen Sie nur darauf? Warum sollte das Haus eine interessante Geschichte haben? Es stand so lange leer, weil es eben so weit draußen liegt und renovierungsbedürftig ist. Oh Gott, nein, davon weiß ich nichts. Vielleicht ist mal jemand darin gestorben, aber woher soll ich das wissen, großer Gott!»
Sie kauften es, betranken sich einen Abend sinnlos vor Freude und begannen mit der Renovierung. Um die Kosten zu senken, machten sie das meiste selbst. Vor seinem Studium hatte Tom Maurer gelernt und er war geschickt. Unter seinen Händen verwandelte sich das alte Haus nach und nach in ein Schmuckstück. Kristin mochte es von Anfang an – bis auf den Keller –, und je mehr sie an ihm herumwerkelten, umso tiefere Zuneigung, vielleicht sogar Liebe empfand sie für ihr Haus. Es entwickelte ein Gesicht, Charakter, und es gab ihr eine Menge Zuversicht für die Zukunft ihrer kleinen Familie.
Die Fragen aber blieben offen. Kristin hätte gern etwas über die Geschichte des Hauses erfahren. Ein so altes Haus musste einfach eine Geschichte haben. Doch es gab niemanden, den sie hätte fragen können. Da sie während der Renovierungsphase noch in Hamburg lebten und nur für die Arbeiten herauskamen, war noch kein Kontakt zu den Nachbarn zustande gekommen. Wenn sie in dem kleinen Edeka-Laden in der Dorfmitte einkaufen ging, verhielten die Einheimischen sich so, wie Städter es von Landmenschen erwarteten: zurückhaltend, wortkarg, reserviert. Also behielt das Haus seine Geschichte und seine Geheimnisse zunächst für sich. Bis zum Nachmittag des 16. August, an dem Kristin den Anbau entrümpelte. Was sie dort fand, erregte ihr Interesse, doch kurz darauf kam der Tod und veränderte alles.
Kristin war mit der Absicht in den Schuppen gekommen, ihn so weit aufzuräumen, dass sie wenigstens ihre Fahrräder und Lisas Kinderwagen hier unterstellen konnten. Offensichtlich hatte der Schuppen den früheren Bewohnern des Hauses als Lagerplatz für Brennholz gedient. Er war furztrocken, wie Tom es genannt hatte, und damit seiner Meinung nach zu gefährlich als Lagerplatz für brennbare Materialien. Man musste dem Feuer ja nicht noch zusätzliche Nahrung verschaffen. Später würden sie auch einen Kamin haben, doch Tom wollte das Brennholz auf einer freien Fläche hinter dem Haus stapeln, wo der Wind es trocknen würde. Also konnte dieser Teil des Schuppens, der zwischen Garage und Werkstatt lag, als Fahrradraum dienen. Wenn er aufgeräumt war!
Kristin betrachtete den Holzberg mit in die Hüften gestemmten Fäusten. Durch das von Spinnenweben überzogene kleine Fenster drang nur milchiges Licht herein, in dem der von ihr aufgewirbelte Staub einen kosmischen Tanz aufführte. Alles Mögliche konnte unter diesem undurchdringlichen Haufen leben: Ratten, Mäuse, Spinnen, Kleinstlebewesen, von denen sie noch nie etwas gehört hatte und die es in der Stadt auch nicht gab. Aber wofür hatte sie Arbeitshandschuhe? Als sie den ersten anziehen wollte, fiel er zu Boden. Kristin bückte sich, hob ihn auf und streifte ihn in hockender Stellung über. Bevor sie sich wieder aufrichtete, fiel ihr etwas auf. Der Haufen füllte bis auf einen schmalen Streifen bei der Tür den gesamten Raum aus. Und irgendwo in dieser Tiefe sah sie ein Rad. Ein hölzernes Rad. Durch einen schmalen Tunnel in dem Gewirr aus Brettern, Kanthölzern, Pfählen und Teilen von alten Möbeln konnte sie es erkennen. Jedenfalls einen kleinen Ausschnitt davon.
Im Haus hatten sie rein gar nichts Altes gefunden. Darüber war Kristin enttäuscht. Sie hatte sich darauf gefreut, zwischen altem Gerümpel auf Entdeckungsreise zu gehen und dabei vielleicht ein klein wenig in die Vergangenheit anderer Leute zu tauchen. Deshalb hatte sie auch bereitwillig die Entrümpelung des Stalles übernommen.
Und wenn hinter dem Brennholzhaufen etwas mit Rädern stand, wenn dort etwas versteckt war? … Wer konnte schon sagen, was sie alles finden würde?
Kristin streifte auch den anderen Handschuh über und machte sich an die Arbeit. Ein Stück nach dem anderen schaffte sie nach draußen, wo sie es auf einen Haufen warf, der später aufgebrannt werden sollte. Nach einer halben Stunde war sie ihrem Ziel noch nicht viel näher gekommen. Der Raum schien tiefer zu sein, als es den Anschein hatte, und was immer mit Rädern in dem Haufen verborgen war, stand ganz weit hinten. Sie brauchte Hilfe. Toms Hilfe. Aber der war in der Küche damit beschäftigt, Fliesen zu verlegen. Er hatte bestimmt keine Lust, seine Arbeit für die Neugierde seiner Frau zu unterbrechen. Wenn er sich in eine bestimmte Sachen vertiefte, war er kaum davon loszubekommen.
Kristin seufzte, pustete sich die widerspenstige Haarsträhne zum wiederholten Male aus dem Gesicht und machte weiter. Eine halbe Stunde später hatte sie zwar genug Platz für die Fahrräder und den Kinderwagen geschaffen, das Ding mit den Rädern aber noch immer nicht freigelegt. Sie war erschöpft und hatte keine Lust mehr. Sie nahm sich vor, am nächsten Wochenende weiterzumachen. Dass das Schicksal andere Pläne bereithielt, konnte sie freilich nicht wissen.
3
Ihr Hals war voller Blut!
Mit dem roten Schal darum sah es so aus, als sei er voller Blut. Hanna Wittmershaus beugte sich vor und blickte in den großen Ankleidespiegel im unteren Flur. Einmal mehr sah sie, was die Schlaflosigkeit aus ihrem Gesicht gemacht hatte. Tief lagen ihre Augen in den Höhlen, und das schlechte Licht der matten Glühbirne verstärkte die blauen Schatten darunter noch. Ebenfalls tief eingegraben zogen sich Runzeln von der Nase und den Augen über die Wangen zum Hals. Mit den Fingerspitzen fuhr sie über die beiden Falten rechts und links der Mundwinkel. Diese Falten hasste sie am allermeisten; sie verliehen ihr einen bitteren Zug und hatten nichts mit ihrem Alter zu tun. Hanna wusste nur allzu gut, wie sie entstanden waren.
Seit damals, als sie Gerd neben der Kloschüssel gefunden hatte, erstickt an seinem eigenen Erbrochenen, hatten sie sich Jahr für Jahr tiefer eingegraben. Gegen diese Art Falten halfen keine Cremes, dagegen gab es keine Wundermittel – außer vielleicht ausreichend Schlaf, doch den bekam sie nicht. Sie wandte sich von ihrem Spiegelbild ab und wickelte sich den Schal vollends um.
All die Jahre, die vergangen waren, und nun mussten sie sich wieder mit dem Haus beschäftigen. Seit die Merbolds es gekauft und mit der Renovierung begonnen hatten, schien der Vorhang, der sich mit der Zeit langsam, viel zu langsam, aber glücklicherweise dann doch vor ihre Erinnerungen geschoben hatte, fortgerissen zu sein. Die Schlaflosigkeit hatte sich verschärft, und in den langen Nächten tauchten Bilder in ihrem Kopf auf, die sie längst vergessen geglaubt hatte. Letzte Nacht war besonders schlimm gewesen. Im schummrigen Licht der Notbeleuchtung hatte sie Ware ins Regal sortiert (die Deckenbeleuchtung hatte sie nicht einschalten wollen, denn dann hätte jeder auf der Straße sie sehen können), und jetzt, um Viertel vor acht am Abend, war sie völlig übermüdet, spürte aber, dass sie trotzdem nicht würde einschlafen können. Zum einen lag das an der Verabredung mit Johann und Maria, zum anderen aber auch an der Kanne Kaffee, die sie am Nachmittag getrunken hatte. Jetzt bereute sie es. Das Koffein war nicht gut für sie, es schadete ihren Knochen und Gelenken. Doch ohne hätte sie den Tag nicht überstanden.
Hanna warf sich ihren Mantel über und nahm den Schlüsselbund vom Haken. Sie hatte die Haustür schon geöffnet, da erinnerte sie sich an den Tabak, um den Johann am Telefon gebeten hatte. Sie ging in den Laden, nahm zwei Packungen Pfeifentabak aus dem Ständer an der Kasse und verließ das Haus durch den Hintereingang.
Johann hatte am Telefon kein Wort darüber verloren, warum sie sich treffen sollten. Aber das war auch nicht nötig. Seit zwei Monaten befand sich das Haus im Besitz der Merbolds. Bislang hatten sie den Kopf in den Sand gesteckt, hatten so getan, als wäre alles in bester Ordnung. War das dumm? Vielleicht sogar feige? Andererseits, warum sollten sie sich um anderer Leute Dinge kümmern?
Weil wir als Einzige die Wahrheit kennen! Weil diese junge Familie vielleicht ins Unglück rennt!
Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wer konnte das schon sagen?
Hanna stieg in ihren alten Opel Astra und fuhr los. Kaum drei Minuten brauchte sie für den Weg zur Baumschule der Möncks. Johann erwartete sie in der offenen Haustür. Seine große Gestalt füllte das helle Rechteck aus.
«Komm rein, Hanna», rief er. «Ziemlich kalt heute, was?»
Sie drückte sich an ihm vorbei in den Hausflur. Wie immer verströmte er den süßlich-herben Geruch seines Pfeifentabaks.
«Das kannst du laut sagen. Vielleicht bekommen wir dieses Jahr mal wieder Schnee?»
Johann half ihr aus dem Mantel. «Ich würd nicht unbedingt meinen Besitz drauf verwetten, aber mein Gefühl sagt mir, dieses Jahr kriegen wir sogar ’ne weiße Weihnacht.»
«Hat dich dein Gefühl letztes Jahr nicht auch schon getäuscht? In der Manteltasche ist übrigens dein Tabak.» Während Johann den Mantel an die Garderobe hängte und seinen Tabak aus der Tasche nahm, ging Hanna in die Küche.
Marias Küche war der zentrale Ort in dem großen Haus. Dort kam die Familie zusammen – und immer wenn Hanna sie betrat, fühlte sie sich zugehörig. Der Raum war groß und hatte ein breites Fenster auf die Einfahrt und einen Teil der Pflanzungen. Maria Mönck saß am Kopfende des langen Tisches. Im hellen Licht der tief hängenden Lampe wirkte ihr Gesicht unverschämt jung. Tatsächlich war Maria dreiundfünfzig, und damit nur zwei Jahre jünger als sie selbst, doch im direkten Vergleich schnitt sie um mindestens zehn Jahre besser ab. Sie hat nicht gesehen, was du gesehen hast, sagte sich Hanna, doch die vielen Jahre hatten diesen Worten den Trost genommen.
Sie umarmten sich zur Begrüßung. Dann schob Maria sie ein Stück von sich, sah sie an und sagte: «Du hast nicht gut geschlafen, oder?»
Hanna zuckte mit den Schultern. «War mal wieder eine jener Nächte.»
«Setz dich», forderte Maria sie auf. «Ich habe Tee aufgebrüht. Du möchtest doch sicher eine Tasse.»
«Gern.»
Auf dem Flur schloss Johann die Haustür ab, löschte das Licht, betrat ebenfalls die Küche, zog auch diese Tür hinter sich zu und setzte sich Hanna gegenüber auf die Bank. Während Maria drei große Tassen auf den Tisch stellte und den dampfenden Tee eingoss, begann Johann in aller Ruhe seine Pfeife zu stopfen. Mit der Routine vieler Jahre gingen seine Finger zu Werke. Hanna bemerkte die dunklen Schatten unter seinen Nägeln. Sie konnte sich nicht erinnern, ihn je mit sauberen Fingernägeln gesehen zu haben.
Erst als Maria sich setzte, sah Johann zu ihr auf.
«Alles klar im Laden?»
«Wie immer. Was soll sich auch ändern? Solange wir hier keine Bevölkerungsexplosion haben, ändert sich auch mein Umsatz nicht.»
Johann nickte. Noch immer mit seiner Pfeife beschäftigt, sagte er dann: «Du machst dir auch Sorgen, nicht wahr?»
«Ja.» Hanna nippte an ihrem Tee und sah über den Rand der Tasse die beiden Möncks an. «Sieht man mir das so deutlich an?»
«Ich will dich ja nicht beleidigen, aber du siehst mehr tot als lebendig aus. Du schläfst nicht gut, oder?»
Hanna schwieg einen Moment.
«Seit die Merbolds eingezogen sind, ist es wieder schlimmer geworden.»
Johann erwiderte ihren Blick von unten herauf. «Und, was sollen wir tun? Hast du einen Vorschlag?»
«Einen Vorschlag?» Hanna lachte hölzern. «Woher soll ich den nehmen? Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wieder jemand dort wohnt.»
Maria nickte und schmiegte ihre Hände um die Teetasse. «Wer hätte nach all den Jahren auch gedacht, dass sich je wieder ein Käufer findet, hier draußen?»
«Wir waren dumm. Wir hätten es besser wissen müssen. Man liest es doch überall. Die Städter zieht es aufs Land.» Johann schloss den Tabaksbeutel und klopfte mit der Pfeife auf den Tisch.
Hanna trank einen großen Schluck von dem schwarzen Tee mit Zitrone. Wärmend breitete er sich in ihrem Magen aus. Sie ahnte, dass der Tee nicht unbedingt gut für die vor ihr liegende Nacht war, doch im Augenblick war er bestens geeignet, ihre innere Kälte zu vertreiben. Außerdem konnten sich ihre Hände mit der Tasse beschäftigen.
«Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Noch ist nichts, aber auch rein gar nichts geschehen.»
Johann nickte. «Ganz meine Meinung, aber Maria sieht das anders.»
«Ja, allerdings, das tue ich. Wir können sie doch unmöglich ins Verderben laufen lassen.»
«Wenn es überhaupt eines gibt.»
«Eben das wissen wir nicht genau. Aber selbst auf die leiseste Gefahr hin, dass es wieder geschehen könnte, müssen wir etwas unternehmen.»
Sie schwiegen, sahen sich nicht einmal an.
Maria schüttelte den Kopf. «Wir können doch gar nicht anders! Oder wollt ihr später damit leben müssen, nichts unternommen zu haben?»
Johann hatte seine Pfeife noch immer nicht angezündet. Er spielte damit, drehte sie hin und her, betrachtete sie und strich mit dem Daumen über das glatte Kirschbaumholz.
«Keiner von uns will, dass den dreien etwas geschieht, und das weißt du auch. Aber wir müssen genau überlegen, was wir tun.» Seine Stimme klang versöhnlich und beruhigend, so als spreche er zu einem kleinen, trotzigen Kind.
«Das streite ich auch nicht ab, aber ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben. Bei Gott, ich hoffe wirklich, wir haben so viel Zeit!»
«Wir müssen es ihnen nach und nach beibringen, in kleinen Schritten, eins nach dem anderen», sagte Johann. Er legte seine Hand auf den Unterarm seiner Frau. «Und vor allem muss einer rübergehen. Jemand muss nach dem Rechten sehen.»
«Ich mach das», sagte Hanna.
«Und was willst du sagen?»
«Nun … ich nehme eine Blume mit und heiße sie willkommen. Wird sowieso mal Zeit.»
Maria schüttelte den Kopf. «Das meine ich nicht. Was willst du ihnen darüber sagen?»
Hanna zögerte und dachte einen kurzen Moment über die Frage nach.
«Ich erzähle ihnen von damals, nur von damals. Für sie wird es wie ein Märchen klingen. Und ich werde dafür sorgen, dass sie den Eindruck haben, die einsame Frau Wittmershaus hat nichts Besseres zu tun, als sich selbst zum Kaffee einzuladen und solche Geschichten zu erzählen.»
«Und dann?», fragte Maria und zog damit die Blicke auf sich.
«Dann warten wir ab», sagte Hanna. «Und beten.»
4
«Zwanzig- oder dreißigtausend, mehr brauchen wir doch gar nicht. Wenn ich nicht so viel selbst gemacht hätte, hätten wir die schon längst ausgegeben.»
«Aber damit liegen wir weit über dem, was wir uns als Grenze gesetzt hatten. Erinnerst du dich noch?»
Tom ging zum Fenster, sah einen Moment in den dunklen Garten hinaus und drehte sich zu ihr um. «Natürlich erinnere ich mich. Aber bei einer Renovierung kann man nie genau sagen, wie teuer es wird. Dreißigtausend, was ist das schon?»
«Eine Menge Geld! Und wer weiß … vielleicht gewährt Barnickel uns keinen zusätzlichen Kredit mehr? Können wir nicht bis zum nächsten Jahr warten?»
Er schüttelte den Kopf und kam zurück zur Couch.
«Das ändert doch nichts. Nächstes Jahr haben wir auch nicht mehr Geld. Wenn wir die Fenster nicht vor dem Winter auswechseln lassen, blasen wir das Heizöl praktisch zum Fenster hinaus. Nein, es ergibt nur Sinn, wenn wir es jetzt gleich machen. Und was Barnickel angeht … den lass mal meine Sorge sein. Ich kann ganz gut mit ihm, da sehe ich keine Probleme. Immerhin habe ich einen unbefristeten Job im besten Architekturbüro der Stadt.»
Tom stand mit Händen in den Taschen vor der Couch und sah sie an. Im schummrigen Licht der kleinen Kaminlampe waren seine Züge weich und mit tiefen Schatten untermalt. Während der Umbauphase hatte er sechs Kilo abgenommen; das stand ihm gut, er wirkte jugendlicher denn je. Außerdem hatte er wieder sein Kleine-Jungen-Gesicht aufgesetzt. Jetzt glaubte Kristin nicht, dass er diesen Ausdruck mit Berechnung einsetzte. Er bekam ihn einfach, wenn er etwas wollte, es aber so aussah, als würde er es nicht bekommen. Tom hatte sich nie mit dem ersten Nein zufriedengegeben, er war jemand, der für seine Vorstellungen kämpfte. Ohne sein Durchsetzungsvermögen würde ihr eigenes Haus noch in weiter Zukunft liegen, das wusste sie. Ihr Vater war ganz anders gewesen; er war stets den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Sie hatten nie ein eigenes Haus besessen, und nie hatten sie mit solchen Summen jongliert. Kristin war nicht wohl dabei, aber sie vertraute Tom. Und dieses Gesicht liebte sie.
Sie klopfte mit der flachen Hand auf die Sitzfläche des Sessels. Als Tom nicht gleich reagierte, klopfte sie noch einmal. Schließlich kam er zu ihr. Sie drückte ihn in den Ledersessel und setzte sich auf seinen Schoß.
«Und du bist dir sicher?», fragte sie.
Tom nickte.
«Dann lass es uns machen. Ich vertraue dir.»
«Nur wenn du es auch willst.»
«Ich wollte schon immer das, was du willst. Deshalb passen wir doch so gut zueinander.»
«Vorhin warst du anderer Meinung.»
«Wegen dem Geld. Diese großen Summen bin ich nicht gewöhnt. Sie machen mir immer noch Angst. Dieses Haus verschlingt so viel.»
«Aber es ist schön geworden, nicht wahr?»
Kristin schlang ihre Arme um seinen Nacken und gab ihm einen Kuss. «Mehr als das. Es ist die Erfüllung unseres Traumes.»
Er fuhr mit seinen Händen unter ihr T-Shirt und streichelte ihren Rücken. «Und, bist du glücklich?»
Kristin schloss die Augen. Seine Berührung verursachte eine Gänsehaut bei ihr. «Das weißt du doch.»
«Sag es mir trotzdem.»
Sie legte ihre Hände an sein Gesicht, presste ihre Lippen auf seine und küsste ihn. Als ihre Zungen sich fanden, spürte sie seine Erregung an ihrem Oberschenkel. Vorsichtig ließ sie ihr Becken kreisen.
«Reicht dir das als Antwort?»
«Nein.»
«Was möchtest du noch?»
«Alles.» Seine Hände glitten nach vorn und über ihre Brüste. Kristin seufzte und vergrub ihr Kinn an seinem Hals. Der letzte Hauch seines am Morgen aufgetragenen Rasierwassers stieg ihr in die Nase.
«Versprichst du mir was?», flüsterte sie ihm ins Ohr.
«Was du willst.»
«Du darfst Lisa und mich nie verlassen.»
«Spätestens morgen früh muss ich zur Arbeit.»
Sie ließ ihre Hand zwischen seine Beine gleiten und drückte sanft zu. «Nie!»
Mehr als ein gepresstes «Nie» bekam Tom nicht mehr heraus. Für die nächste halbe Stunde sprach keiner von beiden. Damit gab Tom ein Versprechen, das er nicht halten konnte – und auch nicht halten würde.
Nach dem Tod
1
«Ich bin wieder hier,
in meinem Revier,
war nie wirklich weg,
hab mich nur versteckt.»
Kristin Merbold stand mit fleckiger, blau karierter Schürze am Herd und summte den Refrain des Liedes mit. Warmes Oktoberlicht flutete durch das alte, trüb gewordene Fensterglas in die Küche und ließ die aufsteigenden Dampfschwaden bläulich erscheinen. Die raue Stimme des Sängers trieb ihr einen Schauer über den Rücken. In Gedanken kehrte sie in die Vergangenheit zurück: zu jener warmen Juninacht, als sie an Tom gelehnt dieses Lied in der dunklen, nur von Feuerzeugen erhellten Arena eines Fußballstadions gehört hatte.
Plötzlich unterbrach der Radiosprecher das Lied für eine Verkehrsmeldung. Ihr Wachtraum zerplatzte. Kristin machte sich daran, das Omelett zu wenden. Die Unterseite hatte genau die richtige, goldbraune Farbe, und nun kam der entscheidende Moment, den sie noch immer fürchtete. Tom konnte von ihren spanischen Omeletts nicht genug bekommen; kaum eine Woche verging, in der er nicht quasi darum bettelte. Wie viele dieser Dinger sie schon gebraten hatte, wusste Kristin nicht, aber noch immer war das Wenden ein kritischer Moment, der oft genug im Spülbecken endete. Diesmal jedoch tat das Acht-Eier-Omelett, was von ihm erwartet wurde. Nach einem geschickten Wurf landete es in einem Stück in der Pfanne.
Als sie einen Wagen auf dem Schotter ihrer Zufahrt hinabrollen hörte, verharrte Kristin. Noch immer missfiel ihr dieses Mahlen und Knirschen der Steine unter den Autoreifen. Es klang, als würde sich etwas von tief unter der Erde nach oben wühlen. Schnell stellte sie die Pfanne auf dem heißen Ceranfeld ab und reinigte ihre Hände an der Schürze. Tom brachte Lisa vom Kindergarten mit, und um keinen Preis wollte Kristin den Anblick verpassen, wenn die beiden aus dem Wagen stiegen. Der Umzug, die langen Fahrten in die Stadt, die vielen Überstunden des Geldes wegen – all das hatte dazu geführt, dass Lisa wenig von ihrem Vater hatte und solche Momente selten waren. Doch noch bevor sie zum Fenster ging, runzelte Kristin die Stirn.
Da stimmte was nicht.
Im vergangenen Jahr hatten sie bei einer Nikolauslotterie den Jeep Cherokee gewonnen. Einen Fünfunddreißigtausend-Euro-Wagen, mit einem Los, das nicht einmal fünf Euro gekostet hatte. In dem kleinen Lottogeschäft unten an der Durchgangsstraße, in dem Kristin jede Woche die Fernsehzeitung gekauft hatte, hatte Lisa nervtötend lange in der Lostrommel herumgewühlt und sich schließlich für das eine besondere Los entschieden. Seitdem war es ihr «Jeepi».
Kristin hatte ein gutes Gehör dafür entwickelt, ob es ihr Jeepi war, der die Zufahrt hinunterkam, oder nicht. Sie mochte dessen zuverlässiges, satt brummendes Geräusch. Der Motor da draußen klang anders. Fremd.
Mit zwei Schritten war sie am Fenster. Ein dunkelgrüner Ford Kombi hielt auf ihrem Hof. Der Staub des blaugrauen Schotters waberte an den Reifen empor. Sonnenlicht reflektierte in der getönten Windschutzscheibe, sodass sie nicht erkennen konnte, wer am Steuer saß.
Der Motor erstarb. Die Tür der Fahrerseite wurde geöffnet, und ein rundlicher Mann quälte sich aus dem Sitz empor. Ihm folgte auf der anderen Seite eine große, hagere Frau. Beide trugen dunkle, offiziell wirkende Kleidung, die für einen solch sonnigen Spätsommertag entschieden zu warm war. Sie verharrten in den geöffneten Türen und blickten zum Haus.
Bevor sie Kristin am Küchenfenster entdecken konnten, trat sie rasch einen Schritt zurück. Ihr Herz schlug dumpf. Obwohl ihr Kopf plötzlich leer war und sie kaum noch denken konnte, stellte sie die Herdplatte ab. Dann legte sie die Schürze beiseite und ging auf die Diele. Dort war es dunkel und kühl; es gab kein Fenster, durch das sie gesehen werden konnte. Draußen wurden die Türen des fremden Wagens zugeschlagen – zwei dumpfe Geräusche –, dann scharrten Schritte auf dem Rotsteinpflaster des kurzen Weges, der vom Hof zum Haus führte.
Vielleicht gehen sie ja wieder, wenn ich mich nicht zeige, dachte Kristin. Vielleicht haben sie sich nur in der Adresse geirrt und machen auf dem Absatz kehrt, sobald sie unseren Namen auf der Klingel gelesen haben.
Ihre Hoffnungen wurden nicht erfüllt – es schellte. In der angespannten Stille des Hauses kam ihr der melodische Gong unerträglich laut vor. Sie zog den Pferdeschwanz straff, mit dem sie ihr langes Haar wie jeden Tag gebändigt hatte, strich ihre Bluse glatt und öffnete die Tür. Im Gegenlicht der Sonne wirkten die beiden Fremden ungleich dunkler und größer, als sie es wirklich waren.
Schwarze Männer … sie sehen aus wie schwarze Männer.
«Frau Merbold?», sprach der Mann sie an. Sein rundliches Gesicht war gerötet. Schweißperlen glänzten auf seiner hohen Stirn. Kristin sah zu ihm hinab, dann zu der Frau hoch, die genauso groß war wie sie. «Ja.»
«Was kann ich für Sie tun?», hatte sie noch fragen wollen, doch es blieb ihr im Halse stecken. Sie glaubte einen unterschwelligen Geruch wahrnehmen zu können: den Geruch der Angst! Die beiden Fremden hatten ihr etwas zu sagen, und sie fürchteten sich davor.
«Können wir für einen Moment hereinkommen, Frau Merbold?», fragte die Frau. Sie sprach leise, vorsichtig.
«Nun … ich weiß nicht …» Noch immer hielt Kristin die Tür nur schulterbreit geöffnet. Dabei kam ihr das alte, offenporige Holz wie eine letzte Bastion gegen etwas vor, das sie lieber nicht im Haus haben wollte. Wie oft hatte Vater ihr verboten, Fremden die Tür zu öffnen?
«Oh, entschuldigen Sie bitte.» Der Mann griff in sein dunkles Jackett und holte ein braunes Lederetui hervor. Er klappte es auseinander und zeigte ihr einen Ausweis mit Lichtbild. Ebenso gut hätte er Kristin auch den schwarzen Peter aus einem Kartenspiel zeigen können, so wenig nahm sie den Ausweis wahr, obwohl sie ihn anstarrte.
«Mein Name ist Felix Leitmann … das ist meine Kollegin Natascha Hensen. Wir sind von der Kripo Hamburg.»
Als würde das alles erklären, steckte Leitmann seinen Ausweis wieder ein. Und in der Tat reichte es Kristin, seinen Beruf zu kennen, um ihre dunkle Vorahnung bestätigt zu wissen. Etwas war geschehen. Etwas Schlimmes.
Tom war wegen der Krediterweiterung für die neuen Fenster am frühen Morgen nach Hamburg zur Bank gefahren. Vorher hatte er Lisa beim Kindergarten abgesetzt. Wie stolz sie zu ihm in den Cherokee gestiegen war …
Kristin blinzelte, um die Erinnerung loszuwerden. Eigentlich hätten die beiden jetzt auf den Hof rollen müssen. Jetzt, genau in diesem Moment. Der Kindergarten ging bis drei viertel zwölf. Immer! Doch so sehr Kristin sich auch Jeepis sattes Brummen herbeisehnte – es blieb still.
«Es geht um Ihren Mann.» Die Frau trat einen Schritt vor, sodass Kristin ihr Gesicht sehen konnte. Für einen Moment glaubte sie ihrem Spiegelbild zu begegnen: langes, dunkelblondes Haar, zu einem Pferdeschwanz gebändigt, schmales Gesicht, grünblaue Augen. Einzig die Nase der Frau war länger und knochiger. Nur ganz kurz begegneten sich ihre Augen.
«Dürfen wir hereinkommen, Frau Merbold?»
Kristin nickte und öffnete die Tür vollends. Dann ging sie voraus und führte die beiden durch die Diele ins Wohnzimmer. Durch die große Terrassentür fiel warmes, dunstiges Licht herein. Kristin meinte durch einen Traum zu wandeln. Gewiss, ein böser Traum, aber eben nur einer jener Zustände, die durch kräftiges Kneifen beendet werden konnten. Wortlos sah sie die beiden Polizisten an.
«Wollen wir uns setzen, Frau Merbold?», fragte abermals die Frau.
Kristin versuchte sich an ihren Namen zu erinnern, aber er war weg. Das Innere ihres Kopfes glich einem verwaisten Fußballfeld. Eine riesige, gähnende Leere, die darauf wartete, von irgendjemandem oder irgendetwas gefüllt zu werden. Gehorsam ließ sie sich auf die vorderste Kante von Toms schwarzem Ledersessel sinken. Das Leder knarzte erschreckend laut.
«Wo ist Ihre Tochter, Frau Merbold?»
«Mein Mann, Tom … kommt gleich mit ihr nach Hause. Er bringt sie aus dem Kindergarten mit.»
Der Beamte warf seiner asketischen Kollegin einen hilfesuchenden Blick zu und rutschte auf der Couch nach vorn. «Frau Merbold … wir müssen Ihnen leider eine schlechte Nachricht überbringen. Ihr Mann ist heute gegen zehn Uhr verstorben.»
Nein, das ist ein Irrtum. Sie irren sich. Tom ist zur Bank gefahren, wegen dem Geld für die Fenster und die Haustür. Er kommt gleich mit Lisa zurück. Heute gibt’s spanisches Omelett, sein Lieblingsgericht. Er hat mir doch versprochen, mich nie zu verlassen. Sie irren sich!
Kristin meinte zu sprechen. Sie hörte ihre Worte, spürte sie über ihre Lippen fließen, und doch verließ kein einziges ihren Mund. Erst als der Beamte sie ansprach, setzte der Ton wieder ein. Wie bei einem Fernseher, der vorübergehend stumm geschaltet war.
«Hab ich das Omelett von der Herdplatte genommen?», fragte Kristin.
Die Beamten sahen sich an. Die Frau legte ihre Hand auf Kristins Unterarm. «Frau Merbold … haben Sie verstanden, was mein Kollege Ihnen mitgeteilt hat?»
Kristin sah auf die fremde Hand hinab, die sie berührte.
«Sie irren sich.» Worte wie aus Watte geformt, weich und ohne Nachdruck. Ein kümmerliches Aufbegehren gegen das Begreifen.
«Frau Merbold, es tut uns leid … wirklich leid. Ihr Mann ist in der SA-WestBank in einen Überfall geraten und getötet worden. Er wurde erschossen.»
Kristins Augen füllten sich nicht mit Tränen, und es tat sich auch keine bodenlose Leere auf, sie zu verschlingen. Sie fiel nicht in tiefe Bewusstlosigkeit und wurde auch nicht von Krämpfen geschüttelt. Sie saß einfach nur da und starrte die Frau an.
«Aber ich hab doch Omelett gemacht.»
2
Robert Stolz kauerte in schwarzer Kleidung in der überdachten Eingangsnische eines kleines Lottogeschäftes, das laut des verblichenen Schildes über der Tür Eduard Pawzella gehörte. Dort war er vor dem orangen Licht der Bogenlampen geschützt und verschmolz geradezu mit der Dunkelheit. Feiner kalter Nieselregen zog einen geisterhaften Vorhang durch das Streulicht der Lampen.
Er warf einen Blick auf seine Timex am Handgelenk: zweiundzwanzig Uhr vorbei. Trotz des starken Kaffees, den er vorhin getrunken hatte, machte sich die Müdigkeit bemerkbar. Außerdem knurrte sein Magen. Er holte ein Snickers aus der Innentasche seiner Lederjacke, riss es auf und biss hinein. Von seiner Körperwärme aufgeweicht schmeckte es süßer als sonst.
Er kaute und fror. Der kühle Wind ging durch bis auf die Knochen. Im Wagen zu warten wäre bequemer gewesen, doch dann hätte er in der Nähe des Red Fox parken müssen. Das war zu auffällig. Ein Auto ließ sich schlecht verstecken, und diese Leute waren auf der Hut. Sie würden sich an einen Wagen erinnern, in dem jemand länger als gewöhnlich am Straßenrand gewartet hatte.
Die Fassade des gegenüberliegenden Gebäudes weckte Erinnerungen. Mit fünfzehn, als er zu begreifen begonnen hatte, womit sein Vater Geld verdiente, hatte er ihn beobachtet und oft in den Red Fox gehen sehen. Robert hatte den schäbigen Laden längst vergessen, und dabei wäre es auch geblieben, wäre ihm Kalle vor drei Monaten nicht über den Weg gelaufen. Karl-Heinz Stolz, Kalle für seine Kumpel, hatte ihn nicht gesehen, und wie damals, vor achtzehn Jahren, war er durch die Tür dort drüben verschwunden. Also gab er noch immer Geld für Stoff und Huren aus, das seiner Frau für Lebensmittel und Kleidung fehlte.
Als Robert dem Verlangen nach einer Zigarette kaum noch standhalten konnte und sich seine mit Kaffee gefüllte Blase bemerkbar machte, rollte ein schwarzer Sportwagen von der Hofeinfahrt des Red Fox auf die Straße. Im Licht der Bogenlampen konnte Robert für einen kurzen Moment Brian Cox am Steuer und seinen bulligen Leibwächter daneben erkennen.
Er sah dem auffälligen Wagen nach, bis er an der nächsten Ecke verschwand, dann löste er sich aus dem Schatten der Nische. Die Hände tief in den Taschen seiner schwarzen Lederjacke, den Rücken gebeugt, die Schultern nach vorn gezogen schlenderte er langsam zu seinem Wagen. Beeilen brauchte er sich nicht. Er wusste, wohin Cox fuhr.
Nachdem er eingestiegen war, zündete er sich eine West an, nahm einen tiefen Zug und warf einen Blick in den Innenspiegel. Seine Augen waren rot gerändert, dunkle Schatten lagen darunter. In den letzten Nächten hatte er schlecht geschlafen. Obwohl es nicht der erste Job dieser Art war, machte ihm die Aufregung zu schaffen. Wahrscheinlich lag es an dem familiären Zusammenhang. Die Sache wurde dadurch riskant. Jemand könnte eine Verbindung herstellen. Er sah seinem Vater ähnlich: die gleichen braunen Augen und Haare, das gleiche kantige Gesicht, die große Statur mit den breiten Schultern.
Robert wandte den Blick ab, startete den Motor und fuhr los.
Fünfzehn Minuten später parkte er den BMW zwei Straßen von dem Haus entfernt, das Cox und sein Leibwächter gerade betraten. Als er es nach einem kurzen Fußmarsch erreichte, war niemand zu sehen. Der Wagen des Iren stand in der Auffahrt des Grundstücks. Wie immer, wenn einer dieser Geschäftsmänner einen Kunden erwartete, war das Haus hell erleuchtet, die Hunde weggesperrt und die Zufahrt offen. Sie waren sich ihrer Sache sicher.
Als wäre er offiziell eingeladen, betrat Robert mit langen Schritten das Grundstück über die Zufahrt, achtete aber darauf, nicht in das Sichtfeld der Videokameras zu geraten. Er wusste genau, wo sie angebracht waren. Rasch ging er bis an die verschlossene Haustür, stellte sich daneben in den Schatten des überstehenden Daches und zog eine schwarze Skimaske über. Sie kratzte auf der Haut, und die feinen Fäden kitzelten in der Nase, aber er brauchte das Ding. Für Robert gab es nichts Abstoßenderes als einen Gauner, der sich einen Damenstrumpf übers Gesicht zog.
«Schwule Pisser!», hatte sein Vater immer gesagt. «Alles schwule Pisser!»
Nachdem er die Maske übergezogen hatte, stieg sein Adrenalinspiegel spürbar an. Robert mochte diese innere Spannung, die für eine solche Aktion notwendig war. Die Ruhe vor dem Sturm. Das intensive Konzentrieren auf nur eine einzige Sache, die damit gleichsam zum Nabel seines Universums wurde.
Er zog die klobige Waffe aus dem Schulterholster und wartete. Jedes noch so kleine Geräusch hinter der Haustür würde ihn alarmieren. Alles andere – die Geräusche von der Straße, das leise Hundegebell irgendwo weit entfernt, die Sirene eines Einsatzfahrzeuges –, all das erreichte zwar seine Ohren, doch er nahm es nicht wirklich wahr. Er achtete auf seine rechte Hand. Sie war ruhig, nicht das kleinste Zittern. In Extremsituationen konnte er sich auf seine Nerven und Reflexe verlassen. Seine gesamte Kindheit und Jugend hatte aus Extremsituationen bestanden.
Plötzlich hörte er Stimmen hinter der Tür. Sie kamen! Fünfzehn Minuten mochten vergangen sein, seit Cox das Haus betreten hatte. Die übliche Zeit, um ein solches Geschäft abzuschließen.
Drei Stufen führten zur Haustür hinauf. Robert postierte sich mit gezogener Waffe auf der obersten. Das Geschäft der Männer da drinnen war erledigt, alle waren gelöst und freundlich, mit nichts rechneten sie in diesem Augenblick weniger als mit einem direkten Angriff. Der Vorteil der Überraschung war auf seiner Seite.
Jemand schloss auf, die Tür wurde nach innen gezogen – allerdings sehr langsam. Robert half nach. So wuchtig er konnte trat er mit dem rechten Fuß dagegen. Nur kurz spürte er einen leichten Widerstand. Die Tür schlug auf, er stürmte in die Vorhalle und erfasste mit einem Blick die Situation.
Cox befand sich rechts von ihm, der Leibwächter direkt dahinter. Der Hausherr hatte seinen Kunden die Tür öffnen wollen und lag nun am Boden. Sein Gesicht war vom Schmerz verzerrt, er hielt seine rechte Hand umklammert. Keiner von ihnen griff zur Waffe, zu groß war die Überraschung.
Robert zielte auf Cox.
Dessen Augen weiteten sich. Hinter ihm bewegte sich sein Leibwächter, seine Hand tastete zur Jacke. Robert handelte schnell. Die Luftdruckpistole gab ein leises «Plopp» von sich, und der zwei Zentimeter kurze, goldfarbene Betäubungspfeil bohrte sich in den Oberschenkel des Iren. Es war wichtig, dass die Injektion von einer größeren Muskelpartie aufgenommen wurde, sonst konnte er daran sterben. Cox griff reflexartig nach dem Pfeil, konnte ihn aber nicht entfernen. Viel zu schnell wirkte das Azepromazin. Binnen zwei Sekunden verdrehte er die Augen und sank seufzend zu Boden. Damit machte er die Schusslinie auf seinen Leibwächter frei. Der bullige Kerl mit dem kurz rasierten Haar sah zu seinem Boss hinab und verstand wohl nicht recht, was vor sich ging. Bevor er eins und eins zusammenzählen konnten, lähmte Robert auch ihn mit einem Pfeil in den Oberschenkel. Dann schwenkte er die Waffe auf den Hausherrn.
Bis dahin war noch kein Wort gefallen. Kaum fünf Sekunden hatte es gedauert, zwei Dealer außer Gefecht zu setzen. Der am Boden liegende Mann in dem teuer aussehenden Anzug hob abwehrend seine Hände vors Gesicht.
«Hee, was soll das … nein, nicht!», rief er laut genug, damit seine Karate-Krieger im Büro es hören konnten.
Robert ließ ihn nicht lange zappeln. Kaum hatte er den Pfeil abgefeuert, rannte er los. Während des vergangenen Monats hatte er das Haus mit einem Richtmikrophon belauscht und wusste daher recht genau, wo sich das Büro befand. An der Tür kam ihm einer der Freunde des Hausherrn mit vorgehaltener Waffe entgegen. Robert prallte gegen ihn und warf ihn zurück. Der Junge, der wohl erst seit einem Jahr seinen Führerschein hatte und an dessen Kinn noch Pupertätspickel leuchteten, schrie auf und ging zu Boden.
Den anderen sah Robert sofort.
Er stand rechts des großen Schreibtisches und beugte sich über die Platte, um an den Revolver zu kommen, der neben dem geschlossenen Koffer lag. Robert zielte auf ihn. Bevor der Kerl auch nur eine Silbe von sich geben konnte, ging er mit einem Pfeil im Hintern zu Boden. Blieb noch einer übrig.
Robert drehte sich um – und erstarrte. Der Junge lag zwischen zwei verchromten Stühlen auf dem Rücken und hielt seine Waffe im Anschlag. Das dunkle Loch der Mündung war auf Robert gerichtet.
«Lass fallen», sagte er.
Würde er schießen?
Seine Hände zitterten, der Ausdruck in seinen Augen war nicht der eines abgebrühten Killers. Trotzdem, er wähnte sich in Lebensgefahr, das machte ihn unberechenbar. Robert wartete eine Sekunde zu lange. Der Jungmafiosi krümmte den Zeigefinger und zog den Abzug durch.
Roberts Herzschlag setzte aus, in seinem Inneren schien irgendwas mit großer Kraft nach unten zu sacken. Er erwartete den Einschlag des Projektils in seinen Körper, machte sich für den Schmerz bereit – doch es geschah nichts. Er konnte es kaum glauben. Der Typ hatte schlicht und ergreifend vergessen, seine Waffe zu entsichern.
Robert dachte nicht weiter über das Glück nach, das ihm zuteilgeworden war – er trat dem überraschten Jüngelchen die Waffe aus der Hand. Als die Spitze seines festen Schuhs dessen Handgelenk traf, hörte er die Knochen splittern. Die Waffe flog gegen ein Bücherregal und plumpste zu Boden. Wie von Sinnen schrie der Junge im Sportanzug auf, presste seine Hand an den Bauch, zog die Knie an und krümmte sich zusammen.
«Mann … verdammte Scheiße … du, du hast mir die Hand gebrochen. Hey, was soll das? Nimm das Ding weg!»
Dem Pickeligen stand die Panik ins Gesicht geschrieben. Robert konnte ihn verstehen. In das Auge eines Pistolenlaufes zu blicken konnte einen wirklich fertigmachen. Er hatte sich ja selbst eben beinahe in die Hosen geschissen. Aber Mitleid war hier fehl am Platze. Robert zielte auf den Oberschenkel und zog den Abzug durch. Der Betäubungspfeil bohrte sich in den Muskel. Der Junge griff mit der unverletzten Hand danach, im selben Moment fiel sein Kopf schlaff auf die Seite.
Sechs Betäubungspfeile passten ins Magazin der klobigen Waffe. Sie funktionierten wie eine Spritze. Beim Aufprall öffnete sich ein winziges Ventil, und die geringe Menge Azepromazin strömte in den Blutkreislauf des Körpers. Robert füllte die Kapseln der Pfeile selbst, daher wusste er, was er tat. Eine Winzigkeit mehr der weißlichen Flüssigkeit, und die Getroffenen würden den Rest ihres Lebens als sabbernde Krüppel im Rollstuhl verbringen. Ihr Gehirn, wertvoll oder nicht, würde paralysiert werden.
Robert stieg über die Betäubten hinweg zum Schreibtisch. Der Koffer war zwar geschlossen, die Kombinationsschlösser aber noch nicht eingeschnappt. Er hob den Deckel an. Gebündelte Geldscheine, denen man ansah, dass sie schon in vielen Hosentaschen gesteckt hatten, lagen ordentlich aufgereiht darin. Zehner, Zwanziger, Fünfziger, selten ein Hunderter. Robert nahm ein Bündel heraus und starrte es an. Einige dieser zerknitterten Scheine könnten seinem Vater gehört haben. Jetzt nahm er sich das Taschengeld, das er in seiner Kindheit nie bekommen hatte.
Robert legte das Bündel zurück, schlug den Deckel zu, stellte die Zahlenreihen auf null und verriegelte den Koffer. Während er das Haus verließ, nahm er die Skimütze ab, entfernte die Pfeile aus den betäubten Bewohnern und steckte sie in die Taschen seiner Jacke. Den Koffer mit den Drogen ließ er bei Cox liegen. Er hatte keine Verwendung dafür.
Wenig mehr als fünf Minuten war er drinnen gewesen. Fünf Minuten Arbeit, ungefähr zweihunderttausend Euro Lohn.
Seine Beine zitterten, als er die Auffahrt hinunterging.
3
Eine Reise durchs Land der Trauer, lange Aufenthalte in Städten voller Tränen, voller Leid, Schmerzen und bitteren Vorwürfen. Das Gepäck bestehend aus Erinnerungen und Wünschen; die Nahrung nur Zweifel am Sinn der Zukunft. Jeder Schritt kostet mehr Kraft als der vorherige, jeder Blick verzerrt die Wirklichkeit. Und das Grauen schleicht hintendrein. Man kann es nicht hören und nicht sehen, aber seine Anwesenheit ist intensiver spürbar als die eigenen Schmerzen. Warum ist es da? Warum mischt es sich ein und macht alles noch schlimmer?
Kristin wusste es nicht. Als sie ihre Augen aufschlug, verschwanden die Gedanken, mit denen sie sich Stunden schlaflos auf dem Laken gewälzt hatte. Nur eines blieb: das Grauen. Es war mit ihr in diesem dunklen Schlafzimmer, das ihr fortan allein gehörte, hockte in irgendeiner Ecke, vielleicht auch in allen. Es füllte die Finsternis aus, machte sie erdrückend. Kristin wagte nicht, sich zu bewegen. Die Decke bis zum Kinn gezogen, verharrte sie flach atmend und lauschte. Mit Blicken so intensiv, dass ihr die Augen schmerzten, versuchte sie die Dunkelheit zu durchdringen.
Was waren das für Geräusche? Das Haus. Ja, es war nur das Haus. Das alte Gebälk, das noch ältere Fundament … Tom hatte ihr gesagt, dass ein altes Haus immer Geräusche macht. Zu hören waren sie aber nur in den stillen Stunden der Nacht. Das machte sie unheimlich, aber sie waren es nicht. Es gab keine unheimlichen Häuser, nur Geräusche, nur altes Holz, das sich dehnt und nachgibt. Kristin spürte das Bedürfnis aufzustehen, in das Zimmer nebenan zu gehen und nach Lisa zu sehen. Sie wollte unbedingt, aber noch gehorchten ihre Beine ihr nicht. Aus Angst vor der Dunkelheit blieb sie still liegen; aus Angst vor dem Grauen, das lebendig geworden ihren Gedanken entstiegen war und nun im Zimmer hockte.