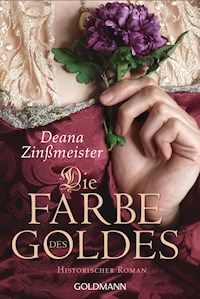2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein farbenprächtiger historischer Roman um zwei Schwestern, Machtgier, Liebe und Eifersucht
Württemberg 1607. Nach dem Verlust ihrer Eltern schließen sich die Schwestern Apollonia und Agnes einer Gruppe von Vagabunden an. Sie genießen die neue Freiheit, und die 17-jährige Apollonia verliebt sich schon bald in Michael, den charismatischen Anführer der Gruppe. Doch als Herzog Friedrich I. stirbt, bricht Unruhe im Land aus: In ganz Württemberg werden Feuer gelegt, und der Thronfolger fällt einem Mordanschlag zum Opfer. Die junge Agnes ist die Einzige, die weiß, wer hinter dem Komplott steckt. Aber dieses Wissen ist brandgefährlich und könnte sie und ihre Liebsten das Leben kosten …
Die packende, unabhängig zu lesende Fortsetzung von »Die Farbe des Goldes«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Württemberg 1607. Die Schwestern Apollonia und Agnes sind nach dem Verlust ihrer Eltern ganz auf sich allein gestellt. Während Apollonia mit ehrlicher Arbeit versucht, ihren Unterhalt zu bestreiten, wird ihre jüngere Schwester zur Diebin. Als sie erwischt wird, müssen die beiden fliehen und bei Vagabunden untertauchen. Schon bald fühlt sich Apollonia zu Michael, dem charismatischen Anführer der Gruppe, hingezogen.
Im Januar 1608 stirbt Herzog Friedrich I. von Württemberg. Sein ältester Sohn Johann Friedrich soll ihn beerben, fällt jedoch einem Brandanschlag zum Opfer. Schnell geht das Gerücht um, dass Vagabunden im Auftrag eines ausländischen Fürsten Feuer legen. Die junge Agnes ist die Einzige, die weiß, wer wirklich dahintersteckt. Aber dieses Wissen könnte sie und ihre Liebsten das Leben kosten …
Weitere Informationen zu Deana Zinßmeister sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Deana Zinßmeister
Der Glanz des Feuers
Historischer Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Originalausgabe Juni 2022 Copyright © dieser Ausgabe 2022 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH Umschlagmotiv: © Stephen Mulcahey / Trevillion Images, Blume: FinePic®, München Redaktion: Eva Wagner LS · Herstellung: ik Satz- und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-23899-5V001www.goldmann-verlag.de
Gewidmet meinem Glückskleeblatt.
Personenregister
Mit einem * Stern versehene Figuren sind reale historische Personen
Apollonia junges Mädchen, das als Waise auf der Straße lebt
Agnes ihre jüngere Schwester
Michael ein Vagant und Freund der beiden
Brid Begleiterin von Michael
Grete Waisenkind, das mit Michael und Brid zieht
Anna ihre Schwester
Kilian und Peter Zwillingsbrüder, ebenfalls in der Vagantengruppe
* Friedrich I. (1557–1608) Herzog von Württemberg
* Sibylla von Anhalt (1564–1614) seine Ehefrau
* Johann Friedrich (1582–1628) ihr Sohn
Frédéric Thiery Herzog Friedrichs Neffe, Bastard der Herzogsschwester
Georg Herzog Friedrichs Sohn
*Christoph Wagner (1571–1634) Laboratoriumsinspektor
Johannes Keilholz Alchemist
Nikolaus Döpfler Soldat
Rudolf Reichardt Kommandant der Festung Hohentwiel
Prolog
Württemberg, Ende Februar 1608
Ohne Vorwarnung fegte der scharfe Ostwind über das Land und drängte den gerade erwachten Frühling zurück. Er überzog die Natur mit Frost, sodass die frischen Triebe an Bäumen und Sträuchern schwarz wurden. Vögel, die bereits fröhlich gezwitschert hatten, verstummten. Als die Oberfläche der Seen und Bäche zu Eis erstarrte, suchten die Fische Schutz in der Tiefe.
Erneut froren und hungerten die Menschen. In ihrer Verzweiflung flehten sie Gott an, er solle den Frühling zurückbringen, damit sie die Felder bestellen und die Saat ausbringen konnten. Doch ihr Schöpfer schien sie nicht zu hören.
Der Jäger, der stoisch durch das frostige Land stampfte, spürte die Eiseskälte nicht. Seine Kleidung aus Wolfsfell wärmte ihn – wie auch der Zorn, der seit Tagen seine Laune beherrschte und heiße Wut in ihm hochsteigen ließ. Die Erkenntnis, dass sein Plan fehlgeschlagen war und er versagt hatte, nährte seine Wut immer wieder aufs Neue. Da er allein sein wollte, um nachzudenken, war er zur Pirsch aufgebrochen. Es ging ihm nicht um die Beute, nur ums Töten. Die Jagd wird mein Gemüt besänftigen, dachte er und zog die Armbrust in seinem Rücken gerade. Dabei ließ er den Blick über das vor ihm liegende Tal schweifen. Eine gespenstische Ruhe lag über der Senke, die er durchqueren musste. Es schien, als ob sich alles Leben verkrochen hatte. Er blickte zu dem Wald, der sich vor ihm aus dem Grau der Landschaft schälte. Nebel hüllte die Wipfel der Tannen ein, die bis in den Himmel zu ragen schienen. Als der kalte Wind Schneeflocken vor sich hertrieb, wurde hinter dem Weiß die Landschaft unscharf. Der Jäger senkte das Haupt, da die Eiskristalle wie Nadeln auf seinen Wangen stachen.
Plötzlich glaubte er Rauch zu riechen. Sein Kopf ruckte hoch. Die Augen leicht zusammengekniffen, blickte er sich nach allen Seiten um. Nirgends waren Flammen zu sehen. Auch in der Ferne entdeckte er keinen Feuerschein. Es war unmöglich, dass der Wind den Geruch von verbranntem Holz bis hierher tragen konnte. Seine Angst musste ihm einen Streich spielen. Ich werde wahnsinnig, dachte er, saß auf und ließ hastig das Pferd in Richtung Wald antraben.
Die Stute stapfte schweren Schritts durch die Schneeverwehungen. Als sie endlich den Wald erreichten, lenkte der Jäger das Tier zwischen die Baumreihen. Hier war der Wind kaum mehr zu spüren. Er folgte dem schmalen Pfad zwischen den Bäumen, die schon bald so dicht beieinanderstanden, dass es kein Durchkommen mehr gab. Der Jäger musste absteigen und die Zügel der Stute an einer Tanne festbinden. Umsichtig schulterte er den Köcher mit den Bolzen, der seitlich am Sattel hing, und marschierte zu Fuß weiter.
Bereits nach wenigen Schritten versanken seine Stiefel bis zum Knöchel im morastigen Waldboden. Das Leder weichte auf, nasse Kälte kroch durch seinen Körper. Wütend sah der Jäger sich um. Wenn wenigstens Wild zu sehen wäre, schimpfte er innerlich und nagte grimmig an seiner Unterlippe. Er war schon versucht umzukehren, als er Äste knacken hörte.
Angespannt lauschte er in alle Richtungen. Wieder ein leises Knacken. Dann sah er ihn.
Nur einen Steinwurf entfernt stand ein weißer Hirsch mit einem prächtigen Geweih vor einem mächtigen Baumstamm. Der König der Wälder schien den Menschen nicht wahrzunehmen und fraß genüsslich die Bodenflechten, die er mit dem Vorderhuf von Reif und Schnee befreite.
Der Jäger nahm geräuschlos die Armbrust nach vorn, spannte die Sehne und legte den Bolzen ein. Mit dem linken Fuß suchte er einen sicheren Stand im Morast, visierte sein Opfer an und drückte ab. Im selben Augenblick durchdrang ein kaum hörbares Zischen die Luft. Als der Bolzen das Ziel traf, bohrte sich seine Metallspitze tief ins Herz seines Opfers.
Ohne einen Laut brach der Jäger tot zusammen.
Kapitel 1
Einige Tage zuvor
»Wenn die Kirchturmuhr den Tag ankündigt, wirst du dich vor der Stiftskirche einfinden. Dort wird man dich erwarten«, zischte der Unbekannte mit harter Stimme.
Kaum war das letzte Wort gesprochen, stieß er Apollonia von sich und verschwand in der Dunkelheit. Zuerst glaubte sie an ein Trugbild, da alles so schnell gegangen war. Doch ein starker Geruch nach Kräutern, den der Mann verströmt hatte, übertünchte den beißenden Brandgeruch, der in der Luft lag. Selbst als der Fremde schon verschwunden war, konnte Apollonia Lavendel riechen. Auch kam ihr die Stimme bekannt vor. Hätte die Angst sie nicht betäubt, dann hätte sie ihn nach dem Grund des Treffens gefragt. Dann wüsste sie jetzt, was sie erwartete, und könnte sich darauf vorbereiten. Vor Schreck aber hatte sie keinen Ton hervorgebracht und wie gebannt auf der Stelle verharrt.
Als sich ihre Starre löste, rannte sie fort, ohne zu wissen, wohin ihre Beine sie trugen. So schnell das schmerzende Bein es zuließ, humpelte sie kreuz und quer durch die Gassen, bis sie sich schließlich vor dem Armenhaus wiederfand. Sie klopfte an die Pforte. Doch erst als sie mit der Faust dagegenhämmerte, öffnete sich die kleine Luke in der Tür.
Ein unrasiertes Gesicht kam zu Vorschein. »Warum störst du meine Nachtruhe? Alle Plätze sind belegt«, schimpfte der Mann und wollte das kleine Fenster wieder schließen.
»Das Feuer hat unsere Wohnung zerstört. Ich weiß nicht, wohin. Außerdem suche ich meine kleine Schwester«, versuchte Apollonia ihn umzustimmen, doch er blickte sie nur mürrisch an.
»Denkst du, das würde mein Mitleid wecken? Jeder im Haus hier hat mir Ähnliches erzählt, als er um einen Schlafplatz bettelte. Aber ich habe keinen mehr.«
»Putain de merde«, schimpfte sie.
»Außerdem sind die Armenhäuser nur für Einheimische geöffnet. Wäre ja noch schöner, wenn die Stadt und die Kirche Auswärtige durchfüttern würden. Jetzt sieh zu, dass du verschwindest.«
»Bitte seid nicht so hartherzig. Ich habe ein krankes Bein und kann kaum noch stehen«, jammerte Apollonia.
Doch auch das erweichte den Wächter nicht, sodass sie schließlich nach ihrem Rocksaum griff, wo sie eine Münze für Notfälle versteckt hatte. Und das hier war einer, entschied sie. Außerdem war sie zum Umfallen müde.
»Vielleicht habt Ihr doch noch ein schmales Plätzchen für mich«, bettelte sie und hielt ihm das Geldstück vor die Nase.
Wortlos riss ihr der Herbergsvater das Geld aus der Hand, öffnete die Tür und ließ sie eintreten.
Woher zum Kuckuck weiß dieser ungehobelte Mensch, dass ich hier fremd bin?, überlegte Apollonia irritiert, während sie sich einen freien Schlafplatz in den Räumen suchte. Doch dann fiel ihr ein, dass sie vor Aufregung auf Französisch, in ihrer Muttersprache, geflucht hatte. Doch das war jetzt einerlei. Wichtig war allein, dass niemand sie in dem Armenhaus vermuten würde, und deshalb war sie hier erst einmal sicher. So hoffte Apollonia und entspannte sich.
Doch schon einen Atemzug später zweifelte sie daran. Hatte der Fremde sie nicht auch mitten in Stuttgart gefunden? In einer Stadt, die so groß war, dass man sich darin verirren konnte?
Apollonia spürte, wie sich ihr Pulsschlag verstärkte, als sie daran dachte, wie der Fremde plötzlich zwischen den Häuserzeilen auf sie zugetreten war. In der Dunkelheit hatte sie gehofft, Reißaus nehmen zu können. Doch er hatte sie an ihrem Umhang erwischt und zu sich gezogen. Die Erinnerung verursachte ihr auch jetzt Übelkeit. Sie schluckte und zwang sich, ruhig zu werden. Es war wichtig, dass sie ihre Gedanken ordnete, um nachher denjenigen, den sie treffen sollte, von Michaels Unschuld zu überzeugen.
Sie hielt inne. Vielleicht ging es bei dem Treffen gar nicht um Michael. Vielleicht wollte man auch sie anklagen und verurteilen. Unfug, schimpfte sie mit sich. Dann hätte man sie nicht zu später Stunde auf offener Straße abgefangen, um sie dann wieder laufen zu lassen.
Hastig verkroch sich Apollonia in die hinterste Ecke des Raums, da bis dorthin weder der Schein der Feuerstelle noch das Licht der spärlichen Talglichter reichte. Trotzdem wäre sie nur zu gern mit dem Mauerwerk verschmolzen, um unsichtbar zu werden, damit niemand sie finden konnte.
Weil sie eine ganze Weile in der Stadt umhergeirrt war, immer von der Angst getrieben, dass der Fremde sie erneut aufspüren könnte, schmerzte ihr angeschlagenes Bein. Sie konnte das Zittern kaum kontrollieren. Mit beiden Händen rieb sie sanft über die Schwellung am Oberschenkel, damit der Schmerz erträglich wurde. Als er langsam nachließ, atmete sie erleichtert aus. Erschöpft lehnte sie den Kopf gegen die Wand und schaute sich um.
Durch die angelehnte Tür drang schwach das Licht aus dem Nebenraum. Obwohl der Morgen noch nicht angebrochen war, setzte verhaltenes Gemurmel ein. Wie sie hatten zahlreiche Menschen ihr Zuhause verloren und hier für eine Nacht ein Dach über dem Kopf gefunden. Dicht an dicht lagen sie auf einer dünnen Schicht Stroh, die wegen der Kälte über den festgestapften Lehm gestreut worden war. Trotzdem war die Kühle des Bodens zu spüren. Erst recht, seit der Winter zurückgekehrt war. Alt und Jung litten unter dem erneuten Schneefall und dem kalten Wind.
Auch hier im Haus war die Luft klamm. Fast jeder hustete oder nieste. Ein Kleinkind wimmerte und wandte sich unruhig hin und her. Einer der Burschen stand schlaftrunken auf und warf ein Scheit in die Feuerstelle. Als das nasse Holz die Glut traf, quoll dichter Qualm auf, den der Wind zurück in den Kamin drückte. Da der beißende Rauch wegen der zugestopften Fensteröffnungen nicht abziehen konnte, hing er in dem Schlafsaal fest. Mit tränenden Augen rissen einige Männer das Stroh aus den Öffnungen. Nun vertrieb eisige Luft den beißenden Qualm.
»Du elender Nichtsnutz! Wie dumm bist du, dass du nasses Holz in die Glut wirfst?«, schimpfte ein Mann und schlug dem Knaben so heftig ins Gesicht, dass der aufheulte.
Dank der Aufregung nahm keiner Notiz von Apollonia, die erleichtert die Augen schloss. Sie versuchte, die störenden Geräusche um sich herum auszublenden, denn sie musste nachdenken und Antworten auf Fragen finden, die sie noch nicht kannte, die man ihr aber sicherlich stellen würde. Warum sonst sollte sie in der Morgendämmerung zur Stiftskirche kommen? Doch nur, um sie auszufragen, überlegte sie und entschied, dass sie auf keinen Fall lügen durfte. Das würde Michael sicherlich schaden. Aber was, wenn eine Lüge sein Leben retten könnte und die Wahrheit ihm den Tod brachte? Unglücklich öffnete sie die Augen wieder. Wer konnte sie beraten? Wen konnte sie fragen?
Apollonia betrachtete die Menschen um sich herum. Als sie die Alten, die Waisen, die Krüppel, die Bettler und die beiden Ganoven, die sich unter das notleidende Volk gemogelt hatten, musterte, wusste sie, dass keiner von ihnen ihr helfen konnte. Niemand erahnte ihre Sorgen und ihre Ängste. Verzweifelt fuhr sie sich mit beiden Händen durch die Locken. Michael, ihr lieber, ihr guter Michael wurde für etwas angeklagt, das er nicht begangen hatte. Wie sollte sie seine Unschuld beweisen?
Verzweifelt schüttelte Apollonia die trüben Gedanken ab. Sie war zu erschöpft, um länger nachzudenken. Da sie die letzten Nächte kaum ein Auge zugemacht hatte, hätte sie im Stehen schlafen können. Aber sie musste wach bleiben, damit sie das Schlagen der Kirchturmuhr nicht verpasste. Müde rieb sie sich über die Augen. Nun quälte sie die Sorge, wo ihre jüngere Schwester geblieben war. Seit dem Tumult hatte sie das Mädchen nicht mehr gesehen. Vielleicht hatte Agnes sich irgendwo verstecken können. Allerdings traute Apollonia ihr auch zu, dass sie versuchen würde, Michaels Unschuld zu beweisen. Doch wie sollte das einer Elfjährigen gelingen?
Hoffentlich ist sie vorsichtig und bringt sich nicht in Gefahr, betete Apollonia im Stillen und überlegte, nach ihrer Schwester zu suchen, anstatt zur Stiftskirche zu gehen. Sie haderte erneut mit dem seltsamen Befehl. Wer wusste, was sie dort erwartete? Womöglich war es eine Falle. Herr im Himmel, was sollte sie nur tun?
Kapitel 2
Agnes versuchte, den Anschein zu erwecken, dass das kleine Loch in ihrer Hose ihre volle Aufmerksamkeit verlangte. Doch während sie sachte mit dem Zeigefinger in dem abgetragenen Stoff pulte, schielte sie immer wieder zu den beiden Männern hinüber, die von ihr abgewandt am Fenster standen und sich leise unterhielten. Tatsächlich beachtete sie niemand, sodass Agnes sich unbemerkt in dem prunkvollen Raum umschauen konnte. Als der fremde Mann sie in dieses Zimmer gebracht hatte, war sie zu aufgeregt gewesen, um ihr Umfeld wahrzunehmen. Doch nun ließ sie ihren Blick umherschweifen.
Nie zuvor hatte Agnes eine solch prächtige Einrichtung gesehen. Keines der Häuser, in das sie bei ihren Raubzügen nachts eingestiegen waren, war auch nur annähernd so prunkvoll ausgestattet gewesen. Wie gern hätte sie den Brüdern von diesem Haus erzählt. Wenn sie hier einbrechen würden, wären sie alle mit einem Mal steinreich, dachte die Elfjährige. Leider wusste sie nicht, wo dieses Haus stand. Alles war so schnell gegangen. Noch bevor sie ahnte, wie ihr geschah, hatte der fremde Mann sie vor sich aufs Pferd gesetzt und war mit ihr davongeritten. Da sie erst vor Kurzem nach Stuttgart gekommen waren, kannte sie die Stadt außerhalb kaum. Sie hatte keine Ahnung, in welche Gegend man sie entführt hatte.
Agnes seufzte kaum hörbar. Es war unwichtig, wo dieses Haus stand, denn gleich zu Beginn hatte man ihr streng verboten, über dieses Treffen zu sprechen. Der Befehl der beiden fremden Männer war unmissverständlich und hallte in ihr nach: Sollte von ihr jemals auch nur ein Sterbenswörtchen über diese Zusammenkunft nach außen dringen, würde sie den Tag bereuen, an dem sie es ausgeplaudert hatte. Eingeschüchtert hatte Agnes geschworen, dass sie niemandem etwas sagen würde.
Allein bei der Erinnerung an die Drohung pochte ihre Schlagader so heftig, dass sie die Finger auf die Stelle am Hals presste. Nervös blickte sie zur gegenüberliegenden Wand, an der mehrere vergoldete Bilderrahmen mit farbigen Motiven hingen. Auf einem war eine Flusslandschaft zu erkennen, auf einem anderen spielten zwei Mädchen mit einem Ball, ein drittes zeigte das Portrait einer alten Frau, deren Augen Agnes wissend anzuschauen schienen.
Das Bild machte ihr Angst. Schnell schaute sie weg, blickte stattdessen zu dem Spiegel zwischen den Gemälden und studierte die feinen Schnitzarbeiten des Holzrahmens. Das blankpolierte Kantholz des wuchtigen Schreibtisches vor ihr, der nahe dem Fenster stand, zog ihren Blick an, da er im Schein des Kaminfeuers glänzte. Von ihrem Platz aus erkannte Agnes auf der Schreibtischplatte ein Kristallfläschchen mit Tinte und einen weißen Halter mit einer Schreibfeder. Außerdem lag ein Stapel Papier daneben.
Sicherlich ist nicht einmal der Herzog so reich wie dieser Mann, dachte Agnes und schaute voller Ehrfurcht auf den Rücken des Mannes, der kaum mit ihr geredet, sondern nur ihren Antworten gelauscht hatte. Als ihr bewusst wurde, dass sie nicht einmal die Namen dieser fremden Männer kannte, begann ihr Herzschlag abermals zu rasen. Sie schielte vorsichtig zu ihnen hinüber. Der in dem dunklen Mantel schien den anderen von etwas überzeugen zu wollen, denn er gestikulierte wild. Wie lange sie wohl noch hierbleiben musste?
Als Agnes seitlich an den fremden Männern vorbei zum Fenster hinausschaute, erkannte sie enttäuscht, dass der Wind Schneeflocken gegen die Fensterscheiben drückte. Sie verabscheute den Winter mit seinen kurzen Tagen und der Kälte. Sie war ein Sonnenkind und deshalb voller Freude gewesen, als die Wärme des Frühlings sich angekündigt hatte. Wo ist sie nur geblieben?, jammerte Agnes in Gedanken. Denn obwohl in dem großen und offenen Kamin große Holzstücke brannten, fröstelte es sie. Zudem war sie erschöpft, hungrig und vor allem durstig. Sie wusste nicht, wie lange sie schon in diesem Zimmer saß. Sicherlich sorgte sich ihre Schwester Apollonia um sie. Doch das traute sie sich nicht laut auszusprechen, denn sie spürte, dass sie das Gespräch der Männer nicht unterbrechen durfte.
Wenn sie wenigstens einen Schluck Wasser nehmen könnte. Ihr Mund war staubtrocken von dem vielen Reden zuvor. Zuerst hatte sie nicht gewagt, von ihren Beobachtungen zu erzählen. Doch nachdem man sie streng aufgefordert hatte, alles, wirklich alles preiszugeben, kamen die Sätze wie von selbst.
Aber würde man ihr glauben? Oder würde man sie der Lüge bezichtigen und bestrafen?
Kapitel 3
Michael presste sich die Hände gegen die Ohren. Er versuchte, die Geräusche, die durch das vergitterte Loch zu ihm nach unten in den Kerker drangen, nicht zu beachten. Er wollte nicht hören, wie die Richtstätte gebaut wurde. Doch das Sägen und Hämmern und die brüllenden Stimmen der Arbeiter schienen bis in den hintersten Winkel seines Gehörs zu kriechen. Stöhnend ging er zu Boden, zog die Beine an, streckte sie und zog sie erneut an die Brust. Dabei gruben seine nackten Füße Furchen in den feuchten, modrigen Boden.
Die Angst legte sich wie ein unsichtbarer Ring um seine Brust. Er konnte kaum durchatmen. Keuchend rang er nach Luft. Als der Mief von Fäkalien und fauliger Erde seine Lungen füllte, überfiel ihn ein Brechreiz. Er hatte heute noch kaum etwas gegessen, sodass nicht einmal mehr Galle kam. Stattdessen spürte er beim Würgen, wie ihm das Blut in den Kopf schoss und die Augen hervorquollen. Schnell schloss er die Lider und versuchte, durch die Nase zu atmen. Plötzlich löste sich ein Schrei aus seiner Kehle, der wie der eines waidwunden Tieres klang. Der laute Widerhall an den Steinwänden war vergebens, denn hier unten hörte ihn niemand.
Michael blinzelte in das Halbdunkel des Verlieses. Hoffnungslosigkeit erfasste sein Gemüt. Erschöpft kroch er zum Mauerwerk und lehnt sich dagegen. Die schleimige Schicht, die an den Kerkerwänden klebte, ekelte ihn. Er überwand seinen Widerwillen und drückte seinen Oberkörper gegen den Felsen, denn er musste wach bleiben. Die Feuchtigkeit und die Kälte der Steine durchdrangen das Leinen seines fadenscheinigen Hemds und kühlten die leichten Brandwunden und die blauen Flecke, die man ihm bei der Verhaftung zugefügt hatte. Selbst als er die scharfen Kanten des grobgehauenen Felsens im Kreuz spürte, blieb er sitzen.
Unerwartet blies der Wind einen Schwall Schneeflocken durch das Loch zu ihm in das Verlies hinunter. Kaum fiel die helle Pracht zu Boden, war sie auch schon geschmolzen. Gleichgültig beobachtete Michael das Schauspiel der sterbenden Schneeflocken, das sich vor seinen Füßen wiederholte. Er schloss die Augen und dachte an Apollonia. Wie gern würde er ihr Lachen hören, sie in den Arm nehmen und ihr Gesicht mit Küssen bedecken. Wenn er die Zeit zurückdrehen könnte, würde er niemals wieder zu ihr sagen, dass er sie nicht wollte. Sondern ihr versprechen, sie für immer zu lieben. Sie allein begehrte er, das wusste er jetzt. Doch nun war es zu spät.
Der Lichtschein wurde langsam schwächer. Der Schnee war kaum noch zu erkennen, nur der kalte Wind war zu spüren. Schon bald würden die Arbeiten auf dem Henkersplatz bis zum nächsten Morgen ruhen, der Lärm verstummen. Erneut spürte Michael quälenden Druck auf seinem Brustkorb. Es war abscheulich, einen Todgeweihten mitanhören zu lassen, wie sein Galgen gebaut wurde. Bei dem Gedanken lachte Michael verächtlich auf. Was würde er darum geben, wenn man ihn hängen würde. Ein kurzer Ruck, und es wäre vorbei. Doch sein Ende sollte ein anderes sein. Ein schmerzhafter, ein grausamer und vor allem ein ungerechter Tod erwartete ihn. Der Gedanke daran ließ seinen Körper erbeben. Abermals hörte er die Worte des Prinzen, die er bei Michaels Verhaftung gebellt hatte: »Wer ein Verbrechen mit Feuer begangen hat, sühnt es mit Feuer.«
Michael stellte die Beine auf, stützte die Ellbogen auf den Knien ab und vergrub sein Gesicht in beiden Händen. Wer hätte gedacht, dass ihn das gleiche Schicksal ereilen würde wie – nein, nur nicht darüber nachdenken, nur nicht an sie denken. Er glaubte, sein Atem würde aussetzen, als ihre Gesichter vor ihm aus dem Nebel des Vergessens, in den er sie verbannt hatte, auftauchten. Wie damals spiegelte sich der Glanz des Feuers in ihren Augen. Leuchtend gelb und flackernd rot.
Doch Michael wollte sich nicht erinnern, sie nicht erneut leiden sehen. Schreiend schlug er sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Immer und immer wieder, damit die Bilder verschwanden. Doch sie blieben und peinigten ihn – wie so oft, seit es geschehen war. Mittlerweile wusste er, dass er die Erinnerungen zulassen musste, damit sie verblassen konnten. Schon sah er das liebliche Gesicht seiner kleinen Schwester vor sich, hörte ihr leises Kichern. Auch hörte er das fröhliche Lachen seiner Mutter, wenn sein Vater versuchte, die Melodie eines Singvogels nachzupfeifen, obwohl er unfähig war, auch nur einen Ton zu treffen.
Ein Schluchzer quälte sich aus seiner Kehle. Nicht weiter darüber nachdenken, befahl er sich.
Bevor das Licht gänzlich schwand, schielte er zu dem Napf mit der dünnen Suppe. Obwohl ihm elend vor Hunger war, würde er keinen Schluck von der kalten Brühe und keinen Bissen von dem alten Brot zu sich nehmen. Lieber verhungerte er, was sicherlich ein angenehmerer Tod war als der, der ihn auf dem Scheiterhaufen erwartete. Er streckte die Beine von sich und lehnte den Kopf gegen den Stein.
Michael wusste nicht, wie lang er geschlafen hatte, als ein kratzendes und schabendes Geräusch ihn weckte. Im selben Augenblick sprang die schwere Kerkertür auf, und mehrere Soldaten betraten mit brennenden Fackeln in den Händen das Verlies.
Michael riss die Augen auf und verdeckte sie sogleich mit dem Arm, da die unerwartete Helligkeit ihn blendete. Sie holen mich zur Hinrichtung, schrie es in ihm. Sein Mund wurde trocken. Sein Herz raste. Er wollte brüllen, sich wehren, doch er blieb wie gelähmt sitzen. Dann wurde er von mehreren Händen gepackt und in die Höhe gezerrt.
Jetzt erwachte er aus seiner Erstarrung und schrie aus Leibeskräften.
Kapitel 4
Acht Wochen zuvor: Montbéliard, 1607
Michael hörte, wie Brid seinen Namen rief. Da er keine Lust hatte, mit ihr zu reden, stellte er sich taub. Der Marsch am Tag zuvor bei Schnee und Eis steckte ihm noch in den Knochen. Zudem war die letzte Nacht kurz gewesen, weil sie in der Dunkelheit keinen geschützten Lagerplatz gefunden hatten. Als sie auf einer gerodeten Stelle im Wald vor den Toren von Montbéliard endlich ihre Schutzplanen zwischen zwei geeigneten Bäumen aufgespannt hatten, war es weit nach Mitternacht gewesen. Jetzt war es früher Morgen, und Michael hatte noch etwas ruhen wollen, bevor er sich dem neuen Tag stellte.
»Michael, wo steckst du?« Brids Stimme wurde energisch.
Schließlich veranlasste ihn ihr dringlicher Ton, unter der warmen Decke hervorzukriechen. Er zog den Umhang über der Brust zusammen und setzte seinen Hut auf. Dann trat er vor den zeltähnlichen Unterschlupf. Sofort umschlang ihn die kalte Luft.
»Warum versteckst du dich vor mir?«, fragte die Siebzehnjährige, als sie auf ihn zueilte.
»Mache ich nicht«, brummte er und steckte die Hände in die Achselhöhlen unter seinem Umhang, um sie zu wärmen. »Hier bin ich. Was willst du?«, fragte er.
»Die Zwillinge sind weg.«
»Was heißt weg? Sind sie für immer fortgegangen?«, lachte er.
»Nein, natürlich nicht. Sie haben den Mädchen gesagt, dass sie in die Stadt laufen wollen, um sich die Kirche anzuschauen. Du weißt, was das bedeuten kann.«
Michael prustete durch die halbgeschlossenen Lippen. Er blickte an den Bäumen vorbei hinüber nach Montbéliard. Wegen des heftigen Schneefalls war die Silhouette der Stadt mehr zu erahnen, als zu sehen.
»Ich hatte bestimmt, dass sich niemand weiter als hundert Schritte von unserem Lagerplatz entfernen darf. Erst …«
»Du musst deine Anweisung nicht wiederholen. Ich kenne sie und halte mich daran. Doch die beiden Brüder scheren sich nicht darum. Sie werden die Einwohner des Städtchens schon am ersten Tag nach unserer Ankunft gegen uns aufbringen.«
»Sie sind in einem schwierigen Alter«, versuchte Michael, Brid zu beschwichtigen.
»Seit ich mit euch ziehe, rechtfertigst du das Verhalten der beiden Tunichtgute damit, dass sie in einem schwierigen Alter stecken. Doch langsam müssten sie aus diesem Alter raus sein. Sie sind dreizehn Jahre alt und keine zehn mehr. Weil sie nicht still sitzen können, müssen sie immer irgendetwas anstellen, das uns in Schwierigkeiten bringt. Womöglich wollen sie die Lebensmittel, die die Menschen als Weihnachtsgaben in die Kirche gebracht haben, stehlen.« Brid riss die Augen auf, da ihr anscheinend ein Gedanke kam. »Hast du den Kindern nicht erzählt, dass Montbéliard eine wohlhabende Stadt sei, weil hier der Herzog ein Schloss besitzt?«
Michael nickte.
»Während der Fahrt haben die Zwillinge den anderen erzählt, dass das Abendmahlsgeschirr aus purem Gold und nicht wie sonst aus Zink sein müsste.« Brid sah Michael strafend an. »Sie werden die Kirche bestehlen. Du hast sie auf den Gedanken gebracht mit deinem Geschichtsunterricht.«
»Ich habe nichts dergleichen getan«, wehrte sich Michael. »Außerdem weißt du nicht, ob sie tatsächlich …«
»Wir reden von den Zwillingen«, mahnte Brid.
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden es wagen werden, das Abendmahlsgeschirr …«, erwiderte Michael, doch im selben Augenblick lief er auch schon in Richtung Stadt. »Pass du auf die Mädchen auf«, rief er Brid zu, die ihm kopfschüttelnd hinterherschaute.
Michael versuchte, so unauffällig wie möglich im Pulk der Kaufleute, Bauern und Frauen über die langgezogene Brücke nach Montbéliard zu gelangen. Als die Menge kurz vor dem bewachten Stadttor ankam, war er so nervös, dass er einen Händler, der auf seinem Fuhrwerk mehrere Weinfässer geladen hatte, in ein Gespräch verwickelte.
»Bei der Kälte muss man aufpassen, dass der edle Tropfen nicht zum Eiswein gefriert. Allerdings kann man ihn dann vielleicht lutschen und hat länger was davon«, spaßte Michael und lachte so laut über seinen eigenen Witz, dass die Fremden, die neben ihm gingen, in das Gelächter mit einstimmten.
»Vielleicht kann ich dann einen höheren Preis verlangen«, grölte der Weinhändler und sah den Torwächter aus tränenden Augen an.
»Du scheinst schon am frühen Vormittag gute Laune zu haben«, meinte der Wachmann ernst, der ihn mit einem Handzeichen anhielt.
»Wenn ich lachen kann, geht es mir gut. Mein Freund hier …«, er zeigte auf Michael, »… hat mir den Tag gerettet mit seinem Humor. Jetzt lass du uns schnell in die Stadt hinein, damit wir uns am Feuer einer Taverne wärmen können«, forderte er schelmisch und überreichte dem Mann eine Flasche. »Mein bester Roter«, raunte er ihm zu.
»Deinen Passierschein, Bursche«, forderte der Wächter.
Sofort hielt ihm Michael sein Dokument unter die Nase.
»Geht eures Weges, damit ihr ins Warme kommt«, sagte er augenzwinkernd und ließ die beiden passieren.
»Mit Wein klappt vieles leichter, auch der Zutritt in eine fremde Stadt«, sagte der Weinhändler und sah Michael grinsend an. »Komm mit, mein neuer Freund, ich spendiere uns einen heißen Würzwein. Der wärmt von innen.« Er ließ Michael zu sich auf den Kutschbock steigen.
Michael wollte ihm danken, doch der Fremde winkte ab. Dann schnalzte er mit der Zunge, und die beiden Pferde marschierten los.
»Wo kommst du her?«
Michael hatte die Frage erwartet und antwortete mit fester Stimme: »Ich komme aus dem Norden des Reichs. Als mein Lehrherr starb, gab es keine Verwendung mehr für mich, und ich musste gehen. Eigentlich wollte ich nach Stuttgart, doch irgendwo muss ich falsch abgebogen sein«, erklärte er schief lächelnd.
»Da hast du den Weg tatsächlich verfehlt«, lachte der Mann. »Was kein Wunder ist bei den Schneeverwehungen. Willst du bleiben?«
Michael zuckte mit den Schultern. »Bis jetzt habe ich von der Stadt noch nichts gesehen.«
»Wo hast du dein Reisegepäck?«
»Ich habe es im Wald versteckt. Es behindert mich nur, und außerdem schmerzt mein Kreuz.«
»Dann ist es gut, dass ich dich mitgenommen habe. Wir werden uns erst mal stärken. Ich empfehle das Gasthaus …«
»Ich kann mir kein Gasthaus leisten«, gab Michael ehrlich zu.
»Das musst du auch nicht. Ich lade dich ein, junger Freund.«
»Dazu sage ich nicht Nein«, lachte Michael.
Während der Fahrt schaute er sich unauffällig in den Gassen um, in der Hoffnung, irgendwo die Zwillinge zu entdecken. Schon blieb das Fuhrwerk stehen.
»Hier sind wir richtig. Le Robinet Rouge ist die beste Taverne im Ort«, versprach der Winzer und sprang vom Gefährt.
»Der rote Hahn«, übersetzte Michael.
»Du bist der französischen Sprache mächtig?«, fragte der Mann.
»Das wäre zu viel gesagt. Aber die wichtigsten Wörter kenne ich, wie le vin rouge oder un petit pain«, erwiderte Michael grinsend.
Der Winzer schmunzelte. »Das sind tatsächlich wichtige Worte in unserer Sprache, denn mit Rotwein und Brot kann man jede Lage überstehen.«
»Trotzdem bin ich froh, dass in Montbéliard auch Deutsch gesprochen wird.«
»Bien sûr! Schließlich wurde unser Herzog Friedrich von Württemberg in diesem entzückenden Städtchen geboren, das er mehr liebt als alle anderen Städte seines Reichs. Selbst während seines Studiums in Tübingen und den Besuchen an unterschiedlichen Höfen ist er immer wieder hierher zurückgekehrt. Doch seit sein Onkel Herzog Ludwig verstorben ist und Friedrich die Würde und Macht über das Herzogtum Württemberg erbte, herrscht er von Stuttgart aus. Leider kommt er nur selten nach Mömpelgard, wie unsere Stadt in der deutschen Sprache genannt wird … Mömpelgard … so ein uncharmanter Name für so ein schönes Städtchen«, murmelte der Mann und übergab das Fuhrwerk einem Burschen, der die Pferde der Gäste während ihres Aufenthalts in der Taverne betreute. »Gib ihnen eine große Portion Heu. Sie mussten schwer ziehen«, ordnete der Weinhändler an und drückte dem Jungen eine Münze in die Hand.
Dann betrat er mit Michael die Schenke. Um diese Zeit waren nur wenige Männer in dem Wirtshaus anzutreffen.
»Nicht viel los«, meinte der Weinhändler, stellte sich an die Theke und bestellte zwei Becher Würzwein.
»Was erwartest du um diese Zeit, Gilbert?«, brummte der Wirt. »Hast du den Roten mitgebracht?«
»Vier Fässer.«
»Henri, lad die Fässer ab«, brüllte er in einen Nebenraum neben dem Tresen. »Der Wein muss bis ins Frühjahr reichen«, meinte er und schlug ein neues Bierfass an.
»Willst du, dass ich arm werde? Verkauf den Fusel, damit ich neuen liefern kann«, lachte der Winzer und prostete Michael zu.
»Wen hast du da mitgebracht?«, fragte der Wirt, der Michael neugierig betrachtete.
»Er hat meine schlechte Laune vertrieben, dabei kenne ich nicht mal seinen Namen«, sagte der Winzer und klopfte Michael auf die Schulter.
»Ich heiße Michael«, murmelte er und nippte an dem Becher.
»Wo kommst du her?«, wollte der Wirt wissen.
»Das haben wir schon geklärt, Jacques. Jetzt lass uns in Ruhe unseren Wein trinken. Ich muss gleich wieder zurück. Es schneit schon wieder, und ich möchte Weihnachten zu Hause verbringen und nicht in deiner Taverne.«
»Mir würde es hier besser gefallen als bei meiner Alten«, lallte ein Mann, der zusammengesunken an einem Tisch saß und anscheinend von der Nacht übrig geblieben war.
Michael und der Weinhändler unterhielten sich angeregt über das Keltern von Trauben. Doch als Michael seinen Becher geleert hatte, verabschiedete er sich.
»Ich danke für die Einladung und wünsche gesegnete Weihnachten.«
»Das wünsche ich dir auch, Junge«, erwiderte der Weinhändler und drückte ihm die Hand.
Kapitel 5
Im Inneren der Kirche schien es kälter zu sein als draußen. Apollonia fror erbärmlich in ihrem zerschlissenen Umhang. Sie wäre froh, diesem Eiskeller entfliehen zu können. Vor allem weil ihr verletztes Bein schmerzte. Zitternd machte sie vor dem Altar einen knappen Knicks und setzte sich in eine der Bänke. Mehrfach strich sie sich über den Oberschenkel, in der Hoffnung, dass der Schmerz nachließ. Wo blieb nur ihre Schwester? Agnes sollte längst hier sein, um ihr beim Herrichten des Gotteshauses für das Weihnachtsfest zu helfen. Zusammen wären sie mit der Arbeit beizeiten fertig, sodass sie den Käse bekommen würden, den ihr der Pfarrer als Extralohn versprochen hatte. Aber dafür müssten die Vorbereitungen abgeschlossen sein. Sollte Agnes nicht auftauchen, würde Apollonia länger brauchen als vereinbart und nur den Laib Brot als Lohn erhalten.
Mürrisch blies sie sich zwischen die Handflächen, um die klammen Finger zu wärmen. Ihr Atem bildete eine weiße Wolke vor ihrem Mund. Damit die Starre nachließ, krümmte und streckte Apollonia die Glieder. Leise begann sie zu zählen und schwor sich, wenn ihre Schwester bis fünfzig nicht da wäre, würde sie allein mit der Arbeit beginnen. Aber dann bekäme Agnes nicht einen Bissen ab.
Mit gequältem Gesicht versuchte sie ihr krankes Bein zu bewegen. Die feuchte Kälte, die seit Tagen herrschte, schien die Schmerzen zu verstärken. Wenn sie sich an einem Feuer wärmen könnte, würde ihr das Warten leichterfallen. Verärgert sah sie zum Eingangsportal. Wo blieb ihre Schwester nur?
Plötzlich quälte sie der Gedanke, dass Agnes womöglich verärgert war, weil Apollonia ihr das Haar abrasiert hatte. Kam sie deshalb nicht? Aber so dumm konnte ihre Schwester nicht sein. Agnes’ Haar war voller Läuse und Flöhe gewesen. Und nicht nur ihre Kopfhaut, auch ihr Genick war von den Bissen übersät gewesen. Manche Stellen hatten sich bereits entzündet, weil Agnes ständig daran kratzte.
Selbst das warme Öl, das Apollonia ihrer Schwester über den Kopf gegossen hatte, hatte nicht alles Ungeziefer abgetötet. Deshalb war es das einzig Richtige gewesen, ihr das Haar abzurasieren. Gewiss, Apollonia hatte keine scharfe Schere zum Haareschneiden benutzt, weil sie von der zahnlosen Berta nur das Werkzeug ihres Mannes ausgeliehen bekam, das er zum Schafescheren benutzte. Doch die feinen Schnittstellen auf Agnes’ Kopf würden heilen, ebenso wie die entzündeten Bisse. Wichtig war nur, dass das Ungeziefer ihre Schwester nicht weiter quälte. Nur darauf kam es an, entschied Apollonia.
Unter einem gequälten Stöhnen erhob sie sich von der Kirchenbank und humpelte nach vorn zum Altar. Vor dem Bild des Heilands schlug sie ein Kreuz vor der Brust.
Apollonia konnte froh sein, dass sie selbst bislang von Ungeziefer verschont geblieben war. Doch für den nächsten Winter würden sie sich ein anderes Quartier suchen müssen, um nicht länger mit der Plage zu kämpfen. In dieser Armenunterkunft kamen zu viele Menschen zusammen. Sie musste endlich eine geregelte Arbeit finden, damit sie sich ein eigenes kleines Zimmer leisten konnten und nicht länger auf die Bettlerhäuser angewiesen waren. Doch wer würde ein Mädchen dauerhaft in Lohn und Brot nehmen, wenn so viele Männer und Frauen auf der Suche nach einem Erwerb waren? Gerade im Winter war es schwer, eine Anstellung zu bekommen. Dabei sehnte sich Apollonia nach einem Zuhause – so wie sie es von früher her kannte, als Vater und Mutter noch gelebt hatten. Doch dieses Heim existierte schon lange nicht mehr.
Mittlerweile hatte Apollonia bis hundert gezählt. »Agnes, du bekommst nicht einen Krümel Brot von mir«, presste sie enttäuscht zwischen den Zähnen hervor und schnappte sich den Besen.
Auf Geheiß des Pfarrers hatte ein Bauer eine riesige Tanne im Wald geschlagen und sie mit Helfern nahe dem Altarraum aufgestellt. Weil die Männer den Baum quer durch die Kirche geschleift hatten, war der Kirchenboden mit feuchter Erde verschmiert, die nun vom Steinboden geschrubbt werden musste. Außerdem hatte der Geistliche Apollonia aufgetragen, die Weihnachtskrippe mit den Figuren aus dem Gewölbekeller des Pfarrhauses in die Kirche zu bringen und nahe der Tanne aufzustellen.
Während Apollonia vor sich hin schimpfte, spürte sie einen eisigen Windzug. Endlich, dachte sie und schaute zum Eingangsportal hinüber, in der Erwartung, dort ihre Schwester zu sehen.
Stattdessen erblickte sie einen fremden Burschen, der sich den Hut vom Kopf riss. Rotbraunes Haar kam zum Vorschein. Mit neugierigem Blick betrachtete er Apollonia.
»Warum glotzt du so?«, fragte sie bissig, da sie enttäuscht war, weil sie sich geirrt hatte. Als er nicht antwortete, rief sie ihm zu: »Der Pfarrer ist nicht da.«
»Ich suche zwei Burschen. Waren sie hier?«, wollte er wissen und kam näher.
»Wie du siehst, bin ich allein«, erwiderte Apollonia schnippisch.
»Was ist das für ein Baum?«, fragte er und zog nachdenklich die Augenbrauen zusammen.
»Ein Weihnachtsbaum.«
»Weihnachtsbaum …? Hab ich noch nie gehört oder gesehen.«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ich auch nicht. Der Pfarrer wollte ihn.«
Der Bursche sah sich suchend um. »Mir wurde gesagt, dass die beiden in der Kirche sind.«
Apollonia stützte sich auf den Besen ab, um das Zittern ihres Beins zu unterdrücken. »Hier ist niemand«, japste sie.
Er musterte sie ungeniert. »Hast du Schmerzen?«
»Nein … und wenn doch, dann geht es dich nichts an.«
»Warum so unfreundlich?«
Apollonia spürte, wie sie errötete. »Lass mich in Ruhe und verschwinde«, murmelte sie und kehrte den Dreck zusammen.
»Was ist mit deinem Bein?«
»Was willst du von mir?«, zischte sie.
»Beruhig dich. Ich will dir nichts Böses. Vielleicht kann ich dir helfen.«
»Ach? Bist du ein Heiler?«
»Nein.«
»Dann verschwinde. Ich habe zu tun. Anscheinend sind die Burschen, die du suchst, woanders hingegangen«, sagte sie, da er keine Anstalten machte zu gehen.
Schließlich setzte der Fremde sich den Hut wieder auf und ging zum Ausgang. Als hinter ihm das Portal mit lautem Knall zufiel, ärgerte sich Apollonia, weil sie ihn nicht gefragt hatte, was er ihr wegen des verletzten Beins geraten hätte. Auch steigerte sich die Wut auf ihre Schwester, denn wenn Apollonia nicht ihretwegen so aufgebracht gewesen wäre, hätte sie sich dem Burschen gegenüber sicherlich anders verhalten. Er schien kein übler Mensch zu sein, dachte sie. Seine Augen hatten neugierig geschaut. Auch die vielen Sommersprossen in seinem Gesicht wirkten lustig, fand sie und lächelte. Sie hatte ihn noch nie zuvor in Montbéliard gesehen. Vielleicht lebt er am anderen Ende der Stadt, überlegte sie und fegte weiter.
Kapitel 6
Als Michael hinaus auf das Treppenpodest trat, fiel hinter ihm das Kirchenportal mit lautem Knall ins Schloss. Schade, dachte er, denn er hätte sich gern länger mit der unbekannten Schönheit unterhalten. Es ärgerte ihn, dass er nicht nach ihrem Namen gefragt hatte. Susanna würde zu ihr passen, oder auch Annamaria. Michael schmunzelte. Sicherlich hätte sie ihm ihren Namen nicht verraten, so biestig, wie sie war. Aber genau das hatte ihm an ihr gefallen.
»Wirklich sehr schade, dass ich sie nicht näher kennenlernen werde«, murmelte er, während sein Blick auf dem Platz vor der Kirche umherwanderte. Doch von den Burschen fehlte jede Spur.
Er suchte über den Dächern nach einem weiteren Kirchturm, aber außer dem grauen Himmel war nichts zu sehen. Der kalte Wind blies Michael Schnee ins Gesicht. Er zog den Kopf zwischen die Schultern und stapfte in die nächste Gasse.
Als er dort in den Hinterhof eines Hauses spitzte, wurde er von einer Frau, die gerade ein Huhn eingefangen hatte, misstrauisch beäugt. »Hier gibt es nichts zu stehlen«, schimpfte sie.
»Ich habe nicht die Absicht zu stehlen. Gibt es ein weiteres Gotteshaus in Montbéliard?«
»Nein, nur dieses«, sagte sie und hackte dem Huhn den Kopf ab.
Michael wünschte frohe Weihnachten und eilte weiter.
Er suchte Gasse für Gasse ab, doch die Zwillinge blieben verschwunden. Schon wollte er aufgeben, da entdeckte er die beiden vor einem großen Gebäude, in dessen Eingang sie verschwanden.
Unbemerkt trat er hinter die Burschen und packte einen von ihnen am Ohr. Peter stieß einen gequälten Laut aus, während Kilian erschrocken zur Seite hopste.
»Hatte ich euch erlaubt, das Lager zu verlassen?«, zischte Michael und ergriff Kilian am Arm, als er weglaufen wollte. »Hiergeblieben!«, rief er böse und zog ihn zu sich heran.
»Mein Ohr! Du tust mir weh«, jammerte Peter.
»Was ist das für ein Lärm? Ihr vertreibt mir die Kunden«, schimpfte eine Krämerin, die aus ihrem Laden zu ihnen trat.
»Entschuldigt, Madame, meine Brüder suchten Schutz vor dem Schneefall und dachten, sie könnten sich hier unterstellen. Aber ich habe ihnen gesagt, dass dies sicherlich nicht erwünscht ist. Wir sind fremd in der Stadt, sie wussten es nicht besser«, entschuldigte sich Michael bei der Frau und ließ die Brüder los. »Wagt es nicht, euch vom Fleck zu rühren«, raunte er ihnen zu.
»Das ist die Markthalle von Montbéliard. Wenn man nichts kauft, darf man sich hier nicht aufhalten. Wo kommt ihr her?«, fragte die Krämerin und kam näher.
»Unser Vater ist Weinhändler. Er hat mehrere Fässer an die Taverne Le Robinet Rouge geliefert, und wir haben ihn begleitet. Weil es den Zwillingen langweilig wurde, wollten sie die Stadt erkunden. Ich hätte meine Brüder wegen des Schneetreibens beinahe nicht wiedergefunden«, log Michael und machte ein verzagtes Gesicht.
»Möchtet ihr einen warmen Kräutersud trinken, um euch aufzuwärmen?«, bot die Frau mitfühlend an.
»Das ist sehr freundlich, aber unser Vater erwartet uns. Wir wollen schnellstmöglich nach Hause fahren, bevor der Schnee eine Rückfahrt verhindert.«
»Das ist ratsam. Nehmt Gottes Segen mit auf die Reise.«
»Gesegnete Weihnachten«, wünschte Michael. Dann fasste er die Zwillinge rechts und links am Arm und zog sie mit sich hinaus in die Kälte.
Als sie außerhalb der Sichtweite der Kauffrau waren, verabreichte er jedem Burschen eine Ohrfeige. »Die sind dafür, weil ich im kniehohen Schnee waten musste, um in die Stadt zu gelangen, und die andere für die Lüge, die ich wegen euch erzählen musste, und diese …«, er hob abermals die Hand und schlug zu, »… dafür, dass ihr meine Anweisung nicht befolgt habt.«
»Wir wollten nur …«
»Du hältst die Klappe, Peter. Ich war schon lange nicht mehr so wütend«, erklärte Michael scharf.
»Uns war langweilig«, maulte der andere Junge.
»Es ist immer das Gleiche mit euch. Einerlei, was ich anordne, ihr widersetzt euch mir jedes Mal. Wollt ihr uns in Schwierigkeiten bringen? Ihr wisst, wie die Menschen über uns denken.«
»Wir haben nichts angestellt«, erklärten die beiden wie aus einem Mund.
Michael stöhnte auf, da die Brüder nicht verstanden, was der Kern seines Vorwurfs war. »Dass ihr nichts angerichtet habt, ist löblich. Doch wenn in einem Ort etwas gestohlen wird oder sonst etwas Verbotenes geschieht und wir in der Nähe sind, wird man immer uns die Schuld in die Schuhe schieben. Versteht doch: Wir sind Vaganten und werden weder geduldet noch gern gesehen.«
»Warum ist das so?«
Michael zuckte mit den Schultern. »Vielleicht, weil wir keine feste Heimat haben und herumreisen.«
»Menschen, die in Häusern leben, werden nicht für Diebe gehalten?«
»Natürlich können auch diese Menschen böse sein. Und auch sie werden angeklagt, wenn sie Schlimmes getan haben. Trotzdem wird man eher einem Dorfbewohner glauben als uns, wenn die Schuldfrage offen ist«, erklärte Michael leise. »Jetzt lasst uns gehen, damit wir endlich wieder in die Wärme unseres Lagerfeuers kommen. Meine Füße sind schon Eisklumpen. Außerdem hängt mir mein Magen in den Kniekehlen, da ich wegen euch heute nicht gefrühstückt habe.«
Kapitel 7
Apollonia hatte den Ochsen und den Esel aus dem dunklen Gewölbekeller des Pfarrhauses mit großen Mühen nach oben geschleppt. Die beiden Tierfiguren waren so schwer, dass sie nur eine tragen konnte und sie mehrmals absetzen musste, bis sie endlich neben dem Weihnachtsbaum in der Kirche stand. Der Pfarrer hatte ihr erzählt, dass ein alter Mann aus der Gemeinde die Figuren aus Lindenholz geschnitzt und den ganzen Sommer dazu gebraucht habe.
»Den Stall habe ich selbst gezimmert, denn dieses Jahr möchte ich ein besonderes Weihnachtfest feiern. Deshalb muss alles so sein, wie ich es in einer Kirche in einer großen Stadt einmal erlebt habe«, verriet er stolz, nachdem er ihr die Krippe im Keller gezeigt hatte.
Apollonia war gespannt, wie der Gemeinde der hohe Baum und die besondere Darstellung von der Geburt Jesu gefallen würde. Würden die Alten womöglich dem Pfarrer Gotteslästerung vorwerfen? Das aber war nicht ihr Problem. Sie hatte ihren Auftrag erfüllt.
Erschöpft lehnte sie sich gegen die Kirchenbank und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sie betrachtete den gekehrten Steinboden und die Figuren der Krippe, die sie einzeln über die enge Treppe aus dem Keller des Pfarrhauses geschleppt und über die Gasse zur Kirche getragen hatte. Sie war mit ihrer Arbeit zufrieden. Da wurde eine Seite des Portals aufgerissen, und der Pfarrer rauschte in die Kirche, sodass sein Talar sich aufbauschte.
Schon am Eingang rief er: »Bist du fertig?« Beim Näherkommen verfinsterte sich seine Miene. »Wieso steht die Krippe nicht auf der anderen Seite des Baums? Sie muss näher zum Altar stehen, damit ich die Heiligenbilder von Maria, Josef und dem Jesuskind aufstellen kann. Und warum ist der Boden nicht sauber gefegt? Soll ich so das Weihnachtsfest zelebrieren? Ich hatte dir gesagt, wie wichtig es ist, dass die Gemeinde zufrieden ist und ihr dieses Weihnachtsfest besonders gefällt. Warum befolgst du nicht, was ich dir aufgetragen habe?«
Sein Gezeter hallte in dem Gotteshaus wider. Er blieb vor Apollonia stehen und sah sie mit funkelnden Augen an.
»Der Schmutz war feucht und hat sich im Stein festgesetzt. Ich habe alles versucht, aber manche Stellen bekomme ich nicht gründlich sauber. Sicherlich wird man die dunklen Flecken im schwachen Schein der Kerzenlichter nicht sehen können. Die Krippe kann ich rasch umstellen«, versprach Apollonia und wollte schon umräumen, doch der Geistliche packte sie am Arm und zischte:
»Du solltest längst fertig sein mit deiner Arbeit.«
Apollonia sah ihn entschuldigend an. »Meine Schwester ist nicht gekommen, um mir zu helfen.«
»Das ist eine Ausrede für deine eigene Unfähigkeit. Verschwinde!«
»Und mein Lohn?«, fragte sie.
»Du unverschämtes Weib! Du glaubst doch wohl nicht, dass deine Arbeit auch nur ein Stück Brot wert ist.«
Apollonia sah ihn entsetzt an. »Stundenlang habe ich in Eurer Kirche geschuftet und den Dreck weggewischt, den die Männer reingeschleppt haben. Wie Ihr mir aufgetragen habt, habe ich die schweren Holzfiguren hierhergebracht. Ich habe meinen Lohn verdient«, entrüstete sie sich und sah den Pfarrer aufgebracht an.
»Mach die Augen zu. Das, was du dann siehst, hast du verdient. Mehr nicht«, antwortete der Geistliche höhnisch.
»Es ist Weihnachten. So hartherzig könnt Ihr nicht sein. Wir haben nichts zu essen, wenn Ihr mir Brot und Käse verweigert!«, rief sie und sah ihn flehend an.
Doch der Pfarrer drehte sich von ihr fort, kniete in einer Bank nieder und schloss die Augen. Nachdem er die Hände vor dem Gesicht gefaltet hatte, versank er murmelnd ins Gebet.
Apollonia starrte ungläubig auf seinen Rücken. Wie kann ein Gottesdiener so grausam sein?, dachte sie. Tränen der Wut liefen ihr über die Wangen. Als sie spürte, dass sie keine Barmherzigkeit erwarten konnte, verließ sie verzweifelt die Kirche.
Erst in der kalten Luft konnte sie wieder durchatmen. Sie blickte in den anbrechenden Abendhimmel. Wie konnte Gott zulassen, dass sein Diener ein Lügner und so ungerecht war? Fast den ganzen Tag hatte sie in der kalten Kirche gearbeitet und war trotzdem ohne Lohn geblieben. Was sollten Agnes und sie am Heiligen Abend essen? Sie besaßen nicht eine Münze, um sich beim Bäcker oder Metzger etwas kaufen zu können. Im Armenhaus würde die Suppe, auf der kaum Fettaugen schwammen, ihren Hunger nicht stillen. Wie hatte sie sich auf Käse und Brot gefreut! Darauf, beides genüsslich zu kauen und zu schmecken.
Der Gedanke an das vorenthaltene Essen ließ ihren Zorn auf ihre Schwester wieder aufflammen. Wäre die Kleine wie vereinbart erschienen, dann hätten sie die Aufgaben schneller und sorgsamer erledigen können. So hatte Apollonia die Verantwortung allein getragen. Ihre Plackerei hatte nichts eingebracht, außer dass ihr Bein wegen der Anstrengung und der Kälte stärker schmerzte als sonst. Zornig schaute sie zurück zur Kirche. Gerne hätte sie einen Fluch hinausgeschrien. Stattdessen stieß sie nur ihren Atem in die kalte Luft.
Das Tageslicht war nun gänzlich verschwunden. Ein Schauer überlief Apollonias Körper. Sie zog ihren Umhang vor der Brust zusammen und beschloss, durch die Gasse der Kaufleute zum Armenhaus zu gehen. Zwar waren dort Menschen wie sie nicht gern gesehen, weshalb Apollonia sich nur selten in diese Gegend verirrte. Doch in der Kaufmannsgasse vor den Geschäften waren Feuerkörbe aufgestellt, um Kunden anzulocken, und an denen konnte sie sich wärmen. Zudem war dieser Weg sicherer als der unbeleuchtete Pfad an der Stadtmauer entlang.
Um auf dem vereisten Pflaster nicht auszurutschen, senkte Apollonia den Blick. Der verharschte Schnee knirschte unter ihren dünnen Schuhsohlen. Wenn doch nur diese unsägliche Kälte vorbei und es endlich Frühling würde. Sie mochte den Winter nur, wenn die Sonne schien und sie in der Ferne die schneebedeckten Gipfel der Vogesen glitzern sah. Manchmal ging Apollonia auf die Stadtmauer hinauf, um zu den Bergen hochzuschauen, weil dort der Schnee wie unzählige Edelsteine funkelte. Sie träumte davon, einmal auf solch einem Gipfel zu stehen, um den reinweißen Schnee in Händen zu spüren und zu schmecken. In der Stadt verwandelten sich die Flocken nur zu schnell in unansehnlichen grauen Matsch, kaum dass sie den Boden berührten.
Apollonia hatte die Kaufmannsgasse erreicht und schaute sich scheu um. Menschen eilten von Geschäft zu Geschäft. Jedes Mal, wenn sich eine Ladentür öffnete, hörte man das leise Bimmeln des Türglöckchens. Aus den Bäckereien strömte der Duft von frischgebackenem Kuchen, Brot und Hefeteilchen heraus. Sehnsüchtig schaute sie den Frauen hinterher, die Back- oder Wurstwaren in ihren Beuteln trugen. Sie selbst hatte noch nie in einem solchen edlen Geschäft eingekauft. Wahrscheinlich würde ihr Geld niemals ausreichen, um Esswaren aus der Gasse der Kaufleute zu schmecken.
Schüchtern eilte sie an den Kaufläden vorbei bis zu einem abseits stehenden Feuerkorb, vor dem sich niemand wärmte. Fröstelnd hielt sie ihre Hände über das brennende Holz. Als ihr der Geruch von würzigem Braten in die Nase stieg, knurrte ihr Magen. Wie gern würde sie nur einen einzigen Bissen davon kosten, dachte sie.
Schon wurde sie angeblafft.
»Verschwinde vor meinem Geschäft. Du vertreibst mir die Kunden.« Die Krämerin hatte sich von hinten an sie herangeschlichen.
Vor Schreck zuckte Apollonia zusammen und stammelte: »Ich wollte mich nur etwas wärmen.«
»Verzieh dich in dein Viertel, wo du hingehörst, sonst rufe ich den Büttel«, keifte die Frau so laut, dass die Leute zu ihnen blickten.
»Was ist hier los?«, fragte eine elegant gekleidete Frau, die mit einer Bediensteten aus einem Stoffgeschäft heraustrat.
»Sie wollte mich bestehlen«, erklärte die Ladenbesitzerin ungeniert und sah die Dame mitleidheischend an.
»Das stimmt nicht …«, versuchte sich Apollonia zu wehren.
»Halt dein schändliches Maul. Wir kennen deinesgleichen und wissen, dass ihr Diebespack seid.«
»Ich habe noch nie im Leben etwas gestohlen«, verteidigte sich Apollonia leise und zog den Kopf zwischen die Schultern.
Mittlerweile war sie von Menschen umringt, die sie giftig anstarrten und der Alten zustimmend zunickten.
»Immer dasselbe mit diesem Pack … sie stehlen alle … ein Wachmann müsste dafür sorgen, dass sich niemand von ihrer Sorte in unsere Gasse verirrt. Vertreibt sie.«
Apollonia war entsetzt über diese Anfeindungen. Sie wagte nicht zu widersprechen, da die Leute sie angriffslustig ansahen. Ich muss von hier fort, dachte sie verängstigt, doch ihr Bein schmerzte plötzlich, als ob ein glühender Nagel im Fleisch stecken würde. Sie konnte sich nur mühsam bewegen. Langsam humpelte sie davon, während sich die Menschenmenge auflöste.
Erleichtert wollte Apollonia in den Schutz einer dunklen Häuserecke hinken, um sich gegen die Wand zu lehnen und ihr Bein zu entlasten.
»Warte!«, hörte sie jemanden rufen.
Das Schlimmste vermutend, presste Apollonia sich gegen das Mauerwerk.
»Ich soll dir etwas geben«, sagte ein fremdes Mädchen ungeduldig, das der Kleidung nach eine Magd aus gutem Haus sein musste.
Apollonia glaubte, das Gesicht zwischen den pöbelnden Menschen gesehen zu haben. »Was willst du von mir?«, fragte sie misstrauisch.
»Meine Herrin schickt mich. Ich soll dir das geben«, sagte sie und reichte ihr ein Hefeteilchen, das dick mit Zuckerguss überzogen war. Apollonia war darüber so überrascht, dass sie nicht wagte, danach zu greifen.
»Nimm endlich, sonst schmilzt der Guss und verklebt meine Handschuhe«, schimpfte die Magd.
»Wer ist deine Herrin?«
»Das darf ich nicht sagen.«
»Warum macht sie das?«
»Weil sie gütig ist … Jetzt nimm endlich, sonst lass ich es in den Dreck fallen.«
Hastig griff Apollonia nach dem Hefeteilchen, während das fremde Mädchen sogleich davoneilte.
»Sag deiner Herrin Danke«, rief Apollonia ihr nach und sah sich neugierig um, ob sie ihre Gönnerin in der Gasse entdecken könnte.
Tatsächlich glaubte sie, hinter einem Pfeiler beim Schneiderladen eine Frau stehen zu sehen, die kurz in ihre Richtung blickte und dann im Laden verschwand. Apollonia wollte abwarten, ob die Magd ebenfalls in das Geschäft ging. Doch als der Zuckerguss zwischen ihre Finger lief, lehnte sie sich gegen das Mauerwerk und biss mit geschlossenen Augen in das süße Hefeteilchen.
Kapitel 8
Es dämmerte, als Michael und die Zwillinge zurück ins Lager kamen. Die beiden jüngeren Mädchen, die ebenfalls zur Vagantenfamilie gehörten, liefen ihnen freudig entgegen.
Brid wartete am Lagerfeuer. »Herr im Himmel, wo seid ihr so lange gewesen? Ich habe mir Sorgen gemacht«, schimpfte sie.
»Ich kann nichts dafür«, konterte Michael. »Der Weg nach Montbéliard war beschwerlich. Ich musste durch hohe Schneeverwehungen stapfen. Als ich endlich auf der Brücke war, ging es nur langsam vorwärts, weil zahlreiche Menschen ebenfalls durchs Stadttor wollten. Als ich endlich drin war, wusste ich nicht, wo ich die beiden suchen sollte. Montbéliard ist eine große Stadt mit vielen verwinkelten Gassen. Es war bereits Nachmittag, bis ich die Zwillinge gefunden habe. Und dann der Rückweg bergauf und wieder durch knietiefen Schnee«, stöhnte er.
»Ihr zwei macht nichts als Scherereien«, rügte Brid die Brüder, die beide den Blick senkten.
Doch Michael erkannte ihr Grinsen. Bevor auch Brid es bemerkte, rief er, da er den Topf über dem Feuer sah: »Ich bin am Verhungern.«
»Ich dachte mir, dass du nichts gegessen hast. Deshalb habe ich aus den letzten Bohnen und Gelbrüben einen Eintopf gezaubert«, sagte sie und schaute ihn lächelnd an.
»Wir haben auch Hunger«, riefen die Zwillinge im Chor.
»Euch müsste man hungern lassen. Wegen euch konnte Michael sich von der anstrengenden Reise gestern nicht erholen«, erklärte Brid mit Nachdruck.
»Sie haben verstanden, dass sie einen Fehler begangen haben, und werden jetzt sicherlich keinen Ärger mehr machen«, versuchte Michael die Jungen in Schutz zu nehmen. An Brids Miene konnte er jedoch erkennen, dass sie daran zweifelte – was er verstehen konnte.
»Zieht euch trockene Kleidung an«, murmelte sie und rührte im Eintopf. Auch Michael ging zu seinem Unterstand, um seine nasse Hose und die Strümpfe zu wechseln.
»Das tut gut«, bekundete Michael, nachdem er ein paar Löffel Eintopf gegessen hatte.
Gierig aß er weiter. Kaum war seine Schüssel leer, füllte Brid sie nach. Anschließend scheuchte sie die Kinder zum Schlafen in ihre zeltähnlichen Nachtlager. »Wagt es nicht, zu schwatzen.«
Als Michael sich ebenfalls zur Nachtruhe zurückziehen wollte, hielt Brid ihn an der Hand fest. »Erzähl mir von der Stadt. Werden wir hier Weihnachten verbringen?«
»Lass uns morgen darüber reden. Ich bin zum Umfallen müde.«
»Ach, bitte. Ich war den ganzen Tag allein«, bettelte sie leise.
»Die beiden Mädchen waren bei dir«, erklärte Michael und runzelte die Stirn.
»Das ist nicht dasselbe«, sagte sie mit jammernder Stimme und sah ihn mit diesem besonderen Augenaufschlag an, den er bereits seit einiger Zeit kannte.
Zwar hatte er nicht viel Erfahrung im Umgang mit Frauen, doch diesen Blick wusste auch er zu deuten und versuchte deshalb, so selten wie möglich mit ihr allein zu sein.
»Komm, setz dich zu mir, Michael. Ich teile meine Decke mit dir«, versprach sie und zog ihn neben sich.
Schon legte sie die Hälfte ihrer Decke über seine Schulter und rutschte näher. Michael sah sich außerstande, Abstand zu halten. Stocksteif saß er da und traute sich kaum, sich zu bewegen, aus Angst, sie könnte dies als Aufforderung sehen, noch näher zu rücken.
»Was kannst du mir über Montbéliard berichten?«, raunte sie heiser an sein Ohr.
Michael räusperte sich, zog die Knie an und umschlang sie mit den Armen. »Es ist eine Stadt wie viele andere auch. Es gibt eine Gasse, in der die Reichen einkaufen und in der es fast alles zu kaufen gibt, was dein Herz begehrt. Hier duftet es in allen Ecken nach Köstlichkeiten, die mich an früher erinnern …«
»Wie meinst du das?«
Michael erstarrte. Es widerstrebte ihm, über sein früheres Leben zu reden. Weder Brid noch die Kinder wussten von der Tragik seiner Familiengeschichte. Zum einen wollte er kein Mitleid, zum anderen befürchtete er, deshalb angreifbar zu werden. Dass er seinerseits nichts über Brids Lebensgeschichte oder die der Kinder wissen wollte, war Selbstschutz. Michael versuchte so wenig Gefühl wie möglich in ihre Freundschaft einzubringen, denn er wusste, eines Tages würden sich ihre Wege wieder trennen. Je weniger er über sie wusste, hoffte er, desto leichter könnte er gefühlsmäßigen Abstand zu seiner Vagabundenfamilie halten. Er sorgte für sie, damit alle satt wurden und sie nicht frieren mussten. Auch tröstete er sie, wenn sie traurig waren. Aber er ließ sie nicht nahe an sich herankommen.
Er starrte in die Flammen, die am Holz züngelten. Abermals sah er in seiner Erinnerung den Glanz des Feuers in den Augen der Gaffer. Schon hörte er in Gedanken die Schreie.
»Erzählst du mir von deinem früheren Leben?«, bat Brid sanft und fasste ihn am Arm.
Das war, als ob er einen Schlag bekommen hätte. Michael sprang auf und rief: »Lass mich in Ruhe!«
Dann verschwand er in seinem Unterstand.
Kapitel 9
Apollonia leckte den letzten Tropfen Zuckerguss von ihren Fingern. So etwas Köstliches hatte sie noch nie gegessen. Zu ihrer Freude war eine feine Überraschung im Innern des Gebäcks versteckt gewesen: Der Bäcker hatte eine braune Paste eingebacken, die süß schmeckte.
Berauscht von dem Geschmackserlebnis, betrat Apollonia das Armenhaus. Kaum hörte sie auf dem Gang ihre Schwester schwatzen, verflog ihre gute Laune. Wütend folgte sie der Stimme bis in den Speiseraum, wo zahlreiche Erwachsene zusammenstanden und Agnes anfeuerten.
Das Mädchen saß inmitten einer Horde von Jungen am Boden und ließ Holzwürfel über die festgestampfte Erde rollen. Da die Elfjährige die Gabe hatte, die Würfel im Wurf so zu drehen, dass sie meist die höchste Augenzahl zeigten, gewann Agnes fast jedes Spiel. Wenn das geschah, legte sie den Kopf in den Nacken und lachte aus vollem Hals. So auch jetzt. Erneut wurde sie aufgefordert zu würfeln. Unbekümmert warf Agnes die hölzernen Spielsteine hoch in die Luft.
Noch bevor die Würfel auf dem Boden landeten, packte Apollonia Agnes am Arm und zog sie hoch.
»Spinnst du? Ich war am Gewinnen«, rief Agnes entrüstet und sah sie vorwurfsvoll an. Dabei versuchte sie sich wie eine Schlange aus dem Griff zu winden.
Unbeirrt von ihrem Gezeter hielt Apollonia ihre Schwester weiter fest und zerrte sie in den hintersten Raum am Ende des Gangs. Dort drückte sie das Mädchen mit den Oberarmen gegen die Wand, damit sie nicht weglaufen konnte.
»Wo warst du heute Mittag?«, fragte sie scharf.
»Das geht dich nichts an«, antwortete Agnes schnippisch.
»Das geht mich sehr wohl etwas an, denn wegen dir haben wir an Weihnachten nichts zu essen, außer dem Fraß, den sie hier verabreichen.«
Agnes blickte trotzig, sagte aber nichts.
»Anscheinend hast du vergessen, dass wir beide zusammen die Kirche für den Heiligen Abend herrichten wollten. Weil du nicht gekommen bist, musste ich allein den Boden schrubben und die schweren Holzfiguren schleppen und aufstellen. Hast du eine Ahnung, wie oft ich in dieser Eiseskälte zum Pfarrhaus und zurück zur Kirche gelaufen bin? Jetzt schmerzt mein Bein, als ob es von einem glühenden Schwert durchbohrt wird. Das ist schon schlimm genug. Aber noch schlimmer ist, dass ich nicht rechtzeitig fertig wurde und mir der Pfarrer deshalb den Lohn verweigert hat. Nicht eine Scheibe Brot hat mir dieses Scheusal gegeben«, zischte Apollonia und lehnte sich schniefend neben ihre Schwester an die Wand.
»Du hättest mir die Haare nicht abschneiden dürfen«, versuchte die Elfjährige abzulenken und schaute ihre Schwester anklagend an.
»Dein Haar war voller Ungeziefer und nicht mehr zu retten. Ich hatte keine Wahl, als alles abzurasieren. Außerdem wächst es nach. Bis zum Sommer ist es wieder kinnlang«, entgegnete Apollonia.
»Dank dir sehe ich aus wie ein Junge und werde deshalb ausgelacht«, entrüstete sich Agnes.